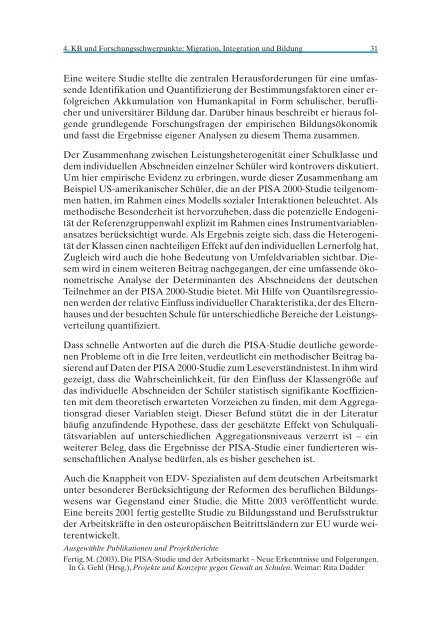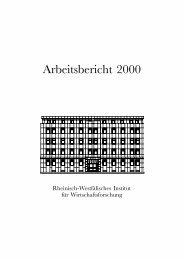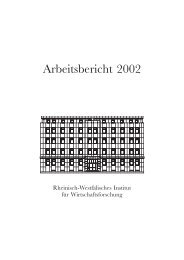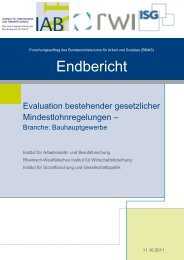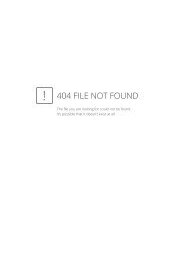Arbeitsbericht des RWI 2003 - Rheinisch-Westfälisches Institut für ...
Arbeitsbericht des RWI 2003 - Rheinisch-Westfälisches Institut für ...
Arbeitsbericht des RWI 2003 - Rheinisch-Westfälisches Institut für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4. KB und Forschungsschwerpunkte: Migration, Integration und Bildung<br />
31<br />
Eine weitere Studie stellte die zentralen Herausforderungen für eine umfassende<br />
Identifikation und Quantifizierung der Bestimmungsfaktoren einer erfolgreichen<br />
Akkumulation von Humankapital in Form schulischer, beruflicher<br />
und universitärer Bildung dar. Darüber hinaus beschreibt er hieraus folgende<br />
grundlegende Forschungsfragen der empirischen Bildungsökonomik<br />
und fasst die Ergebnisse eigener Analysen zu diesem Thema zusammen.<br />
Der Zusammenhang zwischen Leistungsheterogenität einer Schulklasse und<br />
dem individuellen Abschneiden einzelner Schüler wird kontrovers diskutiert.<br />
Um hier empirische Evidenz zu erbringen, wurde dieser Zusammenhang am<br />
Beispiel US-amerikanischer Schüler, die an der PISA 2000-Studie teilgenommen<br />
hatten, im Rahmen eines Modells sozialer Interaktionen beleuchtet. Als<br />
methodische Besonderheit ist hervorzuheben, dass die potenzielle Endogenität<br />
der Referenzgruppenwahl explizit im Rahmen eines Instrumentvariablenansatzes<br />
berücksichtigt wurde. Als Ergebnis zeigte sich, dass die Heterogenität<br />
der Klassen einen nachteiligen Effekt auf den individuellen Lernerfolg hat.<br />
Zugleich wird auch die hohe Bedeutung von Umfeldvariablen sichtbar. Diesem<br />
wird in einem weiteren Beitrag nachgegangen, der eine umfassende ökonometrische<br />
Analyse der Determinanten <strong>des</strong> Abschneidens der deutschen<br />
Teilnehmer an der PISA 2000-Studie bietet. Mit Hilfe von Quantilsregressionen<br />
werden der relative Einfluss individueller Charakteristika, der <strong>des</strong> Elternhauses<br />
und der besuchten Schule für unterschiedliche Bereiche der Leistungsverteilung<br />
quantifiziert.<br />
Dass schnelle Antworten auf die durch die PISA-Studie deutliche gewordenen<br />
Probleme oft in die Irre leiten, verdeutlicht ein methodischer Beitrag basierend<br />
auf Daten der PISA 2000-Studie zum Leseverständnistest.In ihm wird<br />
gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, für den Einfluss der Klassengröße auf<br />
das individuelle Abschneiden der Schüler statistisch signifikante Koeffizienten<br />
mit dem theoretisch erwarteten Vorzeichen zu finden, mit dem Aggregationsgrad<br />
dieser Variablen steigt. Dieser Befund stützt die in der Literatur<br />
häufig anzufindende Hypothese, dass der geschätzte Effekt von Schulqualitätsvariablen<br />
auf unterschiedlichen Aggregationsniveaus verzerrt ist – ein<br />
weiterer Beleg, dass die Ergebnisse der PISA-Studie einer fundierteren wissenschaftlichen<br />
Analyse bedürfen, als es bisher geschehen ist.<br />
Auch die Knappheit von EDV- Spezialisten auf dem deutschen Arbeitsmarkt<br />
unter besonderer Berücksichtigung der Reformen <strong>des</strong> beruflichen Bildungswesens<br />
war Gegenstand einer Studie, die Mitte <strong>2003</strong> veröffentlicht wurde.<br />
Eine bereits 2001 fertig gestellte Studie zu Bildungsstand und Berufsstruktur<br />
der Arbeitskräfte in den osteuropäischen Beitrittsländern zur EU wurde weiterentwickelt.<br />
Ausgewählte Publikationen und Projektberichte<br />
Fertig, M. (<strong>2003</strong>), Die PISA-Studie und der Arbeitsmarkt – Neue Erkenntnisse und Folgerungen.<br />
In G. Gehl (Hrsg.), Projekte und Konzepte gegen Gewalt an Schulen. Weimar: Rita Dadder