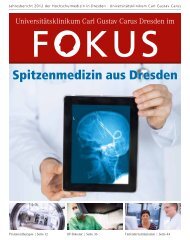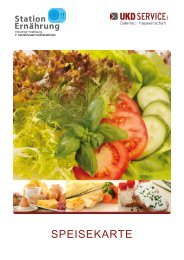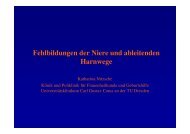Sarah Lehmann 2013 - Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Sarah Lehmann 2013 - Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Sarah Lehmann 2013 - Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das normale Geruchsvermögen wird als Normosmie bezeichnet, die sich unter anderem<br />
durch die gerade noch wahrnehmbare Duftstoffkonzentration, den Schwellenwert, definiert.<br />
(Kobal et al. 2000) Allerdings bildet der Bereich der Riechschwelle, in dem von einer<br />
Normosmie auszugehen ist, ein relativ breites Feld. (Davidson et al. 1987)<br />
Das Riechvermögen ist nämlich von vielen physiologischen Faktoren abhängig. So<br />
verschlechtert es sich bei niedrigen Temperaturen oder trockener Luft und auch unter<br />
hormonellen Einflüssen, wie sie z.B. bei der Menstruation vorliegen. Hunger senkt den<br />
Schwellenwert und steigert so die Geruchsempfindlichkeit, während Sattheit die<br />
Riechschwelle steigert. (Plattig 1999; Hatt 2010)<br />
3 Untersuchung des Riechvermögens<br />
3.1 Psychophysische Riechtests<br />
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Riechvermögen zu untersuchen. Im Allgemeinen<br />
unterscheidet man psychophysische von objektivierenden Riechtests. (Hummel et al. 2007a)<br />
Psychophysische Riechtests prüfen die subjektive Wahrnehmung und Erkennung von<br />
Düften. Es lassen sich verschiedene Aspekte des Riechens untersuchen. Da sie die<br />
Mitarbeit des Patienten erfordern, erreichen sie keine so große Objektivität wie die<br />
objektivierenden Testverfahren, sind aber unkompliziert und kostengünstig und werden<br />
daher gern zur Bestimmung des Riechvermögens verwendet. (Delank 1998)<br />
Es gibt eine Reihe von psychophysischen Tests wie den Cross-Cultural Smell Identification<br />
Test (CCSIT), den Aachener Rhinotest und den Zürcher Riechtest, die vor allem für ein<br />
kurzes Screening empfohlen werden. (AWMF 2007)<br />
Um eine detaillierte Beurteilung des Riechvermögens zu ermöglichen, gibt es quantitative,<br />
validierte Testverfahren.<br />
Neben dem Test des Connecticut Chemosensory Clinical Research Centers (CCCRC) und<br />
dem in Japan gebräuchlichen T&T-Kit sind die bekanntesten Verfahren der UPSIT und die<br />
Sniffin‘ Sticks. (Delank 1998, AWMF 2007)<br />
Der „University of Pennsylvania Smell Identification Test“ (UPSIT) ist ein reiner<br />
Identifikationstest, der misst, wie gut Düfte erkannt und benannt werden können. Er bietet 40<br />
verschiedene Düfte, die mikroverkapselt auf Papier gebracht sind und durch Aufkratzen<br />
freigesetzt werden. Mithilfe von Antwortvorlagen müssen diese identifiziert werden. (Doty et<br />
al. 1984) Der Test ist allerdings aufgrund kultureller Unterschiede nur mit Einschränkungen<br />
verwendbar. Es werden zum Teil Gerüche verwendet, die z.B. in Deutschland größtenteils<br />
unbekannt sind, wie der Duft des Softdrinks „root beer“. (Hummel et al. 2007a)<br />
Eine ausführlichere Testung bieten die in Deutschland gebräuchlichen Sniffin‘ Sticks. Dieser<br />
Test besteht aus drei Untertests, mit denen sich verschiedene Qualitäten des Riechens<br />
8