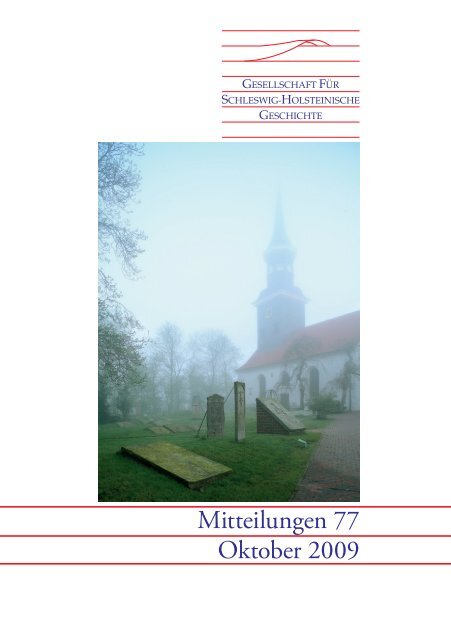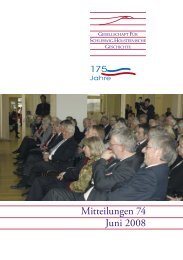Mitteilungen 77 - Geschichte in Schleswig-Holstein
Mitteilungen 77 - Geschichte in Schleswig-Holstein
Mitteilungen 77 - Geschichte in Schleswig-Holstein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Mitteilungen</strong> <strong>77</strong><br />
Oktober 2009
Redaktionsschluss für die <strong>Mitteilungen</strong> 78:<br />
Freitag, 5. März 2010<br />
Titelbild:<br />
Die Lundener Kirche im Nebel.<br />
Abbildung zum Beitrag von Dirk Jonkanski<br />
„Der Geschlechterfriedhof von Lunden als Zeugnis Dithmarscher<br />
<strong>Geschichte</strong>“, <strong>in</strong> diesem Heft<br />
S. 3-15.
Inhalt<br />
Aus <strong>Geschichte</strong> und Kulturgeschichte<br />
Aus <strong>Geschichte</strong> und Kulturgeschichte<br />
Der Geschlechterfriedhof von Lunden als Zeugnis<br />
Dithmarscher <strong>Geschichte</strong><br />
Von Dirk Jonkanski 3<br />
Berichte und <strong>Mitteilungen</strong><br />
Laudatio des Vorsitzenden der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische<br />
<strong>Geschichte</strong> anlässlich der Vergabe des Preises der Gesellschaft für<br />
<strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong> 2009 an<br />
Herrn Prof. Dr. Steen Bo Frandsen am 11. Juli 2009 16<br />
Geschichtspreis im Landesarchiv überreicht 20<br />
Der neue Inhaber der neu-alten regionalgeschichtlichen Professur<br />
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel:<br />
Prof. Dr. Oliver Auge 21<br />
Der neue Inhaber der Professur für Nordeuropäische <strong>Geschichte</strong><br />
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel:<br />
Prof. Dr. Mart<strong>in</strong> Krieger 26<br />
Danewerk und Haithabu als Welterbestätten der Wik<strong>in</strong>gerzeit –<br />
Zum Stand des Projektes<br />
Von Matthias Maluck 28<br />
Reth<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g the Maritime Museum<br />
Entwicklungen – Perspektiven – Herausforderungen<br />
Bericht über e<strong>in</strong>e Tagung maritimer Museen<br />
Von Thomas Overdick 33<br />
Die „Flensburger Rum & Zucker Meile“<br />
Von Jutta Glüs<strong>in</strong>g 37<br />
Projekt Flussgeschichte: Die Stadt, die Trave und das Wasser<br />
Von Sylv<strong>in</strong>a Zander 40
H<strong>in</strong>weise<br />
E<strong>in</strong>ladung zu Vorträgen <strong>in</strong> Kiel 45<br />
Handel, Geld und Politik vom frühen Mittelalter bis heute<br />
Vorträge <strong>in</strong> Lübeck 46<br />
<strong>Schleswig</strong>sche Gespräche 47<br />
Antrittsvorlesungen 47<br />
Ehrenkolloquium für Prof. Dr. Manfred Jessen-Kl<strong>in</strong>genberg 48<br />
„Ripen 1460: 550 Jahre politische Partizipation <strong>in</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>?“<br />
Tagung im Landeskulturzentrum Salzau 48<br />
Suche - Biete<br />
52<br />
<strong>Mitteilungen</strong> des Vorstands<br />
Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung der<br />
Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong><br />
auf Schloss Plön am 11. Juli 2009 53<br />
Preis der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong> 2010 59<br />
Mitarbeiter dieses Heftes 60<br />
Bildquellen 60
Aus <strong>Geschichte</strong> und Kulturgeschichte<br />
Der Geschlechterfriedhof von Lunden<br />
als Zeugnis Dithmarscher <strong>Geschichte</strong><br />
„Lunden. Patron St. Laurentius. Iß e<strong>in</strong> Flecke an der Eider gelegen, van<br />
Hamborch 15 Mile Weges, van Husum 2 Mile, van Flenßborch 8 Mile,<br />
von Rendeßborch 5 Mile, van Schleßwick 5 Milen. Iß ock wegen der vermogen<br />
Lüde, so darsulvest wahnhafft, herrlich unde stattlich mit groten<br />
schonen Hüsern geziret, hefft ock alle Jahr up Michaelis e<strong>in</strong>en herlichen<br />
Vehe= und Pferde=Market, wo dan ock dasuvest vele Flaßes unde allerhande<br />
Kramerie unde Koopmanschop veel gebracht wert“, leitet Neocorus<br />
gegen Ende des 16. Jahrhunderts se<strong>in</strong>e Beschreibung Lundens e<strong>in</strong>.<br />
Der zwischen Marsch und Geest gelegene Ort wird erstmalig 1140 erwähnt.<br />
Das 1529 verliehene Stadtrecht ist mit dem Ende der freien Bauernrepublik<br />
1559, als Lunden an die Gottorfer fiel, wieder aufgehoben worden.<br />
Der von der backste<strong>in</strong>ernen Umfassungsmauer bis zur romanischen St.-Laurentius-Kirche<br />
ansteigende alte Friedhof von Lunden gilt als Denkmal der<br />
Ausschnitt Lunden aus der<br />
Landkarte des Jordanus/<br />
Ortelius (1559-1579), aus:<br />
Danckwerth 1652,<br />
Taf. XXXIIX.
4<br />
freien Dithmarscher Bauerngeschlechter. Der Friedhof wird geprägt von 13<br />
erhaltenen, grasbewachsenen Gruftgewölben dieser Familienverbände. 66<br />
sandste<strong>in</strong>erne Abdeckplatten und die großenteils frei aufgestellten Stelen<br />
erzählen <strong>in</strong> Inschriften, Wappen, Hausmarken und figürlichen Reliefs die<br />
besondere <strong>Geschichte</strong> Dithmarschens. Mit der E<strong>in</strong>führung der Reformation<br />
1532 begann das Ende des Geschlechterwesens, das 1559 <strong>in</strong> der „Letzten<br />
Fehde“ se<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss gänzlich verlor.<br />
Dass e<strong>in</strong>flussreiche Familienverbände ihre Toten <strong>in</strong> gemauerten, tonnenförmigen<br />
Grabkellern beisetzten, die über e<strong>in</strong>en mit e<strong>in</strong>em Deckste<strong>in</strong><br />
verschlossenen Treppenschacht zugänglich s<strong>in</strong>d, blieb <strong>in</strong> Lunden bis zur<br />
Anlage des neuen Friedhofs am Ortsrand 1875 Tradition. Die bis zu zwei<br />
Tonnen schweren Platten und Stelen aus Wesersandste<strong>in</strong> waren von Ste<strong>in</strong>metzen<br />
unter Aussparung e<strong>in</strong>es Todesdatums und der Altersziffer schon<br />
vorgearbeitet, als sie von Bremen aus auf dem Schiffsweg über die Eider bis<br />
nach Wollersum, dem Hafen Lundens, gebracht wurden. Wahrsche<strong>in</strong>lich<br />
wurden sie schon zu Lebzeiten bestellt und dann posthum mit den Jahreszahlen<br />
versehen, was auch durch Bequemlichkeit oder das Fehlen e<strong>in</strong>es<br />
Ste<strong>in</strong>metzes vergessen werden konnte. Gleiches gilt für den Narmurer Blauste<strong>in</strong>,<br />
der aus Belgien über die Handelsverb<strong>in</strong>dung nach Emden bezogen<br />
wurde. Auch auf anderen Kirchhöfen Dithmarschens und Eiderstedts f<strong>in</strong>-<br />
Abendlicher Blick über den Lundener Kirchhof.
den sich Grabplatten und Grüfte, die zu den großen Höfen gehörten und<br />
mit ihnen vererbt oder verkauft wurden, doch <strong>in</strong> ihrer Vielzahl, Vielfalt und<br />
Bedeutung s<strong>in</strong>d sie auf dem Geschlechterfriedhof unübertroffen.<br />
Innerhalb der Kirchhofsmauer, die als Rest e<strong>in</strong>er mittelalterlichen Befestigung<br />
von 1476 gegen dänische Ansprüche angesehen wird, führte e<strong>in</strong><br />
breiter Steg um den Friedhof herum und diente nach e<strong>in</strong>er Trauerfeier <strong>in</strong><br />
der Kirche als Prozessionsweg. Anlässlich e<strong>in</strong>er Bestattung wurde die Grabplatte<br />
der Familiengruft mit Hilfe von Pferden an den vier e<strong>in</strong>gelassenen<br />
R<strong>in</strong>gen beiseite gezogen. Den Sarg brachte man dann durch den schmalen<br />
Treppenschacht <strong>in</strong> die zur Beerdigung frisch geweißte Gruft. Hier wurden<br />
die Holzsärge auf parallel gemauerten Läuferreihen oder <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er zweiten<br />
Reihe auf eisernen Stellagen darüber aufgebahrt, ohne sie direkt übere<strong>in</strong>ander<br />
zu stapeln. Danach wurde die Treppe wieder mit der schweren Grabplatte<br />
verschlossen.<br />
Nach Bugenhagens Kirchenordnung von 1542 sollte der Prediger oder<br />
Diener der Kirche bei der „Ausrichtung kräftig mithelfen“. Und wird dabei<br />
geläutet, dann s<strong>in</strong>d die „[…] die dieses Läuten wünschen,[…] verpflichtet<br />
zum Zwecke der Unterhaltung des Kirchengebäudes Geld dafür zu bezahlen<br />
[…].“ Und: „Auch lassen wir zu, dass dort, wo es Schulen gibt,<br />
5<br />
Grabanlage Hans Rode, 1600, mit Stele,<br />
Abdeck- und Grabplatte mit Halter<strong>in</strong>gen.
6<br />
die Schüler vor der Leiche hergehen und dabei Benedictus s<strong>in</strong>gen oder den<br />
Psalm Dom<strong>in</strong>e Refugium oder De Profundis oder auch Misere mit der Antiphon<br />
Media Vita oder auch andere deutsche Gesänge. Wo es aber ke<strong>in</strong>e<br />
Schulen gibt, sollen die Verwandten und Nachbarn des Toten schweigend<br />
der Leiche folgen.“ In Lunden war der Elementarlehrer gleichzeitig Küster<br />
und Aufseher über den Kirchhof.<br />
Über Jahrhunderte war der Kirchhof der e<strong>in</strong>zige Begräbnisplatz für<br />
das Kirchspiel e<strong>in</strong>schließlich St. Annen. Besonders viel beerdigt wurde <strong>in</strong><br />
Notzeiten, so nach den für Lunden verheerenden Sturmfluten 1211, 1218,<br />
1300, 1313, 1328. 1354, 1362, 1436, 1532, 1634, 1717 und 1825. Die Pest<br />
wütete 1450, 1464 und 1465 im Kirchspiel, abgelöst von den Kriegsnöten<br />
1403/04, 1627, 1659 und 1814, ohne hier jüngere Geschehen <strong>in</strong> und um<br />
Lunden anzuführen. 1909 ist auf dem Gottesacker die letzte Erd-, 1945<br />
die letzte Urnenbestattung <strong>in</strong> der Gruft Pfahler aus dem 16. Jahrhundert<br />
vorgenommen worden. Nicht zuletzt deswegen blieben so viele ältere Grabanlagen<br />
erhalten.<br />
Das wohl bedeutendste Grabmal auf dem Lundener Geschlechterfriedhof<br />
ist die hohe Stele des Peter Swyn aus dem Wurtemannengeschlecht. Das<br />
Sühneste<strong>in</strong> des<br />
Peter Swyn,<br />
gest. 1537.
Kreuzigungsrelief auf dem Sühneste<strong>in</strong> zeigt se<strong>in</strong>e Ermordung im Jahr 1537:<br />
Swyn, der das 48er Kollegium der Dithmarscher Bauernrepublik nach außen<br />
h<strong>in</strong> vertrat, hatte die Abschaffung von Blutrache und Me<strong>in</strong>eid auf den<br />
Kirchhöfen verkündet. Durch diesen Beschluss war die Schwächung der<br />
Geschlechterverbände befürchtet worden. Aus diesem Grund erschlugen<br />
ihn Angehörige des rivalisierenden Russebol<strong>in</strong>gmannen-Geschlechts, als<br />
er von e<strong>in</strong>er Kirchspielsversammlung nach Hause ritt. Unter dem Kreuzigungsrelief<br />
der Stele wird diese Tat gezeigt: Der fe<strong>in</strong>e Herr Swyn liegt<br />
vor se<strong>in</strong>em Pferd auf dem Boden, während der Mörder mit dem Dolch<br />
<strong>in</strong> der Hand über ihm kniet. „Anno 1537 an avent Mari Hemelvart is<br />
hier erbarmlich to dode gebrocht […] Peter Sw<strong>in</strong>“, lautet die Inschrift auf<br />
dem Sühneste<strong>in</strong>, der lange Jahre am Kreuzweg im Lundener Moor stand,<br />
und neben der Mordtat auch vom hohen Ansehen des Peter Swyn zeugt,<br />
denn dieser wurde hier pater patriae, also „Vater des Vaterlandes“ genannt.<br />
Der eigentliche Grabste<strong>in</strong> mit se<strong>in</strong>em Wappen - halber Adler, halbe Lilie<br />
-, den se<strong>in</strong>e Erben <strong>in</strong> Auftrag gaben, trägt die Umschrift: „Anno Christ/<br />
MDXXXVII am Dage Marie Hemelvart / den XV Augusti is / hir Peter<br />
Svi<strong>in</strong> begraven worden. Pater Patriae / H. S. E.“ Swyn hatte u. a. bewirkt,<br />
7<br />
Kle<strong>in</strong>e und Große<br />
Nannenstele nach<br />
ihrer Säuberung.
Karte vom Lundener Friedhof 1864,<br />
Archiv Landesamt für Denkmalpflege.<br />
dass 1517 e<strong>in</strong> Franziskanerkloster nach Lunden verlegt worden war. Handgestrichene<br />
Klosterformatste<strong>in</strong>e (28 x 13 x 8 cm), die zum Bau der Kirchhofsmauer<br />
und Grüfte verwandt wurden, er<strong>in</strong>nern uns an die „klösterliche“<br />
Baukunst.<br />
Neben Swyns Stele ist der Grabste<strong>in</strong> der Nannen, die große Nannenstele,<br />
aus dem Jahr 1588 hervorzuheben, den ionische Pilaster und Dreiecksgiebel<br />
mit Cherubim verzieren. Das Relief der Vorderseite zeigt über dem Familienwappen<br />
das Jüngste Gericht. Christus thront über den Wolken, umgeben<br />
von erlösten Stiftern und Auserwählten neben Posaune blasenden Engeln.
Darunter treiben Teufel die Verdammten durch das Fegefeuer <strong>in</strong> den Höllenschlund.<br />
Auf der Rückseite die Namen der Beigesetzten mit Olde Peters<br />
Hans Nan beg<strong>in</strong>nend, teils als regente hervorgehoben, wie die Mitglieder<br />
der 1447 e<strong>in</strong>gesetzten freien Regierung Dithmarschens, des Rates der 48er,<br />
genannt wurden. Se<strong>in</strong> Sohn Ole Claus Nan wird als Jerusalemsritter geehrt.<br />
Zwei weitere Ste<strong>in</strong>e der Großfamilie Nannen existieren <strong>in</strong> Lunden.<br />
Die Stele von Hans Nanne aus dem Jahr 1648, die kle<strong>in</strong>e Nannenstele,<br />
schmückt e<strong>in</strong> Kruzifix im Bogenfeld.<br />
Auf den Personenkult und Familien bezogene Inschriften zeigen auch<br />
alle anderen, <strong>in</strong> prächtigen Renaissanceformen verzierten Grabste<strong>in</strong>e und<br />
Stelen. Alle großen Geschlechter Lundens s<strong>in</strong>d mit ihren Grabstätten<br />
vertreten: die Nannen, die Swynen, die Ebb<strong>in</strong>gmannen, die Russebell<strong>in</strong>gmannen,<br />
die Sulemannen, die Jeremannen, die Vorgisselmannen, die<br />
Brorsmannen, die Starckmannen, die Huddiemannen, die Vogdemannen,<br />
die Woldersmannen und die Spetmannen. E<strong>in</strong>e Besonderheit stellt das aus<br />
dem Ste<strong>in</strong> gemeißelte „memento-mori-Gedicht“ auf der Rode-Stele dar, das<br />
als Trost für die H<strong>in</strong>terbliebenen gedacht war. Die Anfangsbuchstaben der<br />
Zeilen verweisen auf Hans Rode und se<strong>in</strong>e Frau Wibe.<br />
Immer wieder sieht man die Wappenzeichen der e<strong>in</strong>flussreichen Geschlechter,<br />
denen die meisten der hier Beigesetzten angehörten, gehalten<br />
von Wappenengeln <strong>in</strong> der Ste<strong>in</strong>mitte. Die Ecken s<strong>in</strong>d mit Evangelistensymbolen<br />
verziert. Late<strong>in</strong>ische Antiqua-Capitalen wurden ab 1600 anstelle<br />
gotischer M<strong>in</strong>uskeln für die meist aufliegenden Inschriften verwandt. Die<br />
hochdeutsche Schriftsprache verdrängte allmählich das Niederdeutsche.<br />
Die Ste<strong>in</strong>e stammen auch überwiegend aus dem 16. und 17. Jahrhundert,<br />
der Übergangszeit. Dabei liegt der Höhepunkt zwischen 1588 und 1620,<br />
also nach der „letzten Fehde“ 1559, dem Ende der Bauernrepublik. Es ist<br />
anzunehmen, dass alle Gruftkeller aus der Zeit vor 1700 stammen, was<br />
aus den verwendeten Baumaterialien zu schliessen ist, außerdem liegen<br />
ke<strong>in</strong>erlei Nachrichten über Neubauten von Grüften aus dem 18. und 19.<br />
Jahrhundert vor.<br />
E<strong>in</strong>e erste Beschreibung des Lundener Kirchhofs mit se<strong>in</strong>en Grabstätten<br />
verfasste Claus Harms, der von 1806-1816 als Pastor <strong>in</strong> Lunden wirkte, <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>em „Gnomon“ unter der Überschrift „Der Cicerone auf dem Lundener<br />
Kirchhofe“. Im Grabbuch von 1823 s<strong>in</strong>d noch 19 Familiengrüfte dokumentiert.<br />
Es folgten Chroniken zu Ort und Kirchspiel, zum Pantheon des<br />
Dithmarscher Ruhmes und, mit dem ungedruckten Kunstdenkmäler<strong>in</strong>ventar<br />
beg<strong>in</strong>nend, die Bestandsaufnahmen der Ste<strong>in</strong>e und ihrer Inschriften,<br />
so 1968 durch Herm<strong>in</strong>e Lehmann und1985 durch Pastor Johann-Albrecht<br />
Janzen. Als e<strong>in</strong> Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung s<strong>in</strong>d die Lundener<br />
Kirche und der sie umgebende Friedhof 1968 <strong>in</strong> das Denkmalbuch des<br />
Landes <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong> e<strong>in</strong>getragen worden.<br />
9
10<br />
Die Landkarte von Jordanus/Ortelius von 1559 zeigt die Stadt Lunden<br />
(Stadtrecht seit 1529) auf der Nordseite e<strong>in</strong>er zur Eider auslaufenden B<strong>in</strong>nendüne.<br />
Der „Grundriß von Lunden ao 1648“ gibt den ummauerten, e<strong>in</strong><br />
Viertelkreissegment umfassenden Kirchhof <strong>in</strong> beherrschender Lage auf<br />
dem nördlichen Zipfel des besiedelten Geesthangs wieder, der mit der 1140<br />
erstmals erwähnten Kirche als Zufluchtsort bei Sturmfluten und wall- und<br />
mauerbewehrtes Bollwerk <strong>in</strong> unruhigen Zeiten gedient haben wird. Selbst<br />
bei der großen Sturmflut 1436 kam das Wasser nur bis an den Fuß der<br />
Düne. Vier Friedhofsportale s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>gezeichnet. Entsprechend gliederten<br />
ursprünglich die vier zur Kirche führenden Wege, an die sich die e<strong>in</strong>zelnen<br />
Grabstätten reihten, die Kirchwarft. Auf der Karte vom Lundener Kirchhof<br />
1864 s<strong>in</strong>d die Leher-, Prester-, Lundener- und Fleder-Stegel e<strong>in</strong>gezeichnet.<br />
Betrachten wir Jensens Südansicht der Lundener Laurentiuskirche von<br />
1820, auf der auch das Gräberfeld südlich des Kirchbaus dargestellt ist,<br />
gew<strong>in</strong>nen wir den E<strong>in</strong>druck e<strong>in</strong>es naturbelassenen Friedhofs. E<strong>in</strong>e flächendeckende,<br />
durch Anhäufungen modellierte Hügeloberfläche stellt die überwölbten<br />
Grabkeller <strong>in</strong> West-Ost-Ausrichtung dar. Das Bild e<strong>in</strong>es aufgelassenen<br />
Friedhofs, auf dem nur wenige Grabstellen von Gittern e<strong>in</strong>gefasst<br />
s<strong>in</strong>d, vermitteln auch die frühen Fotos im Archiv des Landesamtes, aus der<br />
Zeit vor der Umgestaltung des Geschlechterfriedhofs <strong>in</strong> den 1930er Jahren.<br />
E<strong>in</strong>e ununterbrochene Ane<strong>in</strong>anderreihung von nach Osten orientierten Familiengräbern,<br />
wie sie auf Friedhofs-Belegungsplänen seit der Barockzeit<br />
überliefert s<strong>in</strong>d, lässt sich noch am Gräberfeld westlich des Hauptzugangs<br />
zur Kirche ablesen.<br />
Man kann auch das soziale Gefüge erahnen, nach dem Reich und Arm<br />
auf dem Friedhof getrennt waren. Die Begräbnisstätten der reichen Geschlechter<br />
lagen an den Hauptwegen, bevorzugt südlich der Kirche. Am<br />
Glockenberg südöstlich der Kirche lag das Armenbegräbnis. Dort stand der<br />
alte hölzerne Glockenturm, bis hier 1783 der Blitz e<strong>in</strong>schlug.<br />
Der erste schleswig-holste<strong>in</strong>ische Prov<strong>in</strong>zialkonservator Richard Haupt<br />
beklagte sich Ende des 19. Jahrhunderts über die lieblose Behandlung des<br />
Friedhofs: „Die Platten, deren manche stehen, die meisten liegen, manche<br />
auch mehrfach benutzt s<strong>in</strong>d, s<strong>in</strong>d im Ganzen viel mehr für die ditmarsche<br />
<strong>Geschichte</strong>, als für die Kunst von Bedeutung und werden von Verständigen<br />
überaus hoch geschätzt; doch irrt, wer etwa glaubt, dass für ihre Erhaltung<br />
je irgend etwas geschehen sei, da doch das M<strong>in</strong>deste wäre, sie an e<strong>in</strong>er<br />
Mauer gedeckt aufzustellen, wenigstens soweit sie jetzt, auf Gräbern oder<br />
<strong>in</strong> Steigen liegend, verderben.“ Manche Ste<strong>in</strong>e sollen auch eigenmächtig<br />
Ergebnis der geomagnetischen Kartierung<br />
des Lundener Friedhofs.
12<br />
entfernt und teils als Treppenste<strong>in</strong>e neu genutzt worden se<strong>in</strong>. Nach dem<br />
Kirchenbrand 1834 s<strong>in</strong>d wohl gezielt Ste<strong>in</strong>e als Baumaterial verkauft worden.<br />
Aus e<strong>in</strong>er musealen Präsentation der Ste<strong>in</strong>e, wie sie Haupt vorschlug,<br />
wurde nichts, denn die „Pat<strong>in</strong>a e<strong>in</strong>es alten Kirchhofes mit Wiesenblumen,<br />
mit Glockenblumen und Königskerzen, die sich ohne Menschenhand weiter<br />
aussäen und das ihre tun“, schwebte dem mit Wiederherstellungsarbeiten<br />
beauftragten Gartenarchitekten Harry Maaß aus Pönitz bei se<strong>in</strong>er<br />
Umgestaltung 1938/39 vor. Se<strong>in</strong> gewundener Rundweg – „als schlichte,<br />
getretene Pfade“ – zu allen Ste<strong>in</strong>en und Gewölben sollte zum Verweilen<br />
e<strong>in</strong>laden: „E<strong>in</strong>e Rankrose hier und da um e<strong>in</strong>en Ste<strong>in</strong>- wie sie übrig blieb<br />
durch die Zeiten-. Das schwebte me<strong>in</strong>em Gefühl vor. Aus demselben Gefühl<br />
entstand die verschiedene Schräglage der Ste<strong>in</strong>e“. Von diesem, noch <strong>in</strong><br />
der Romantik verwurzeltem Konzept, von dem wir anfangs nicht wussten,<br />
ob es überhaupt ausgeführt worden ist, wird noch weiter unten berichtet.<br />
Die „Dekoration“ von Stelen und Platten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em „Ste<strong>in</strong>garten“ ist se<strong>in</strong>erzeit<br />
auch kritisiert worden. Der letzte Schliff wird sicherlich noch gefehlt<br />
haben, auch wenn die wesentlichen Arbeiten <strong>in</strong> den 1930er Jahren fertig gestellt<br />
wurden: die Auflichtung des Bewuchses, die Bodenmodellierung und<br />
Verlegung der Wege, die Neugruppierung der Denkmäler und Beseitigung<br />
der Grabanlagen des 19. Jahrhunderts. Prov<strong>in</strong>zialkonservator Sauermann<br />
vermerkte zum Ortsterm<strong>in</strong> im Juli 1939: „Der Geschlechterfriedhof macht<br />
Baubesprechung am Armentisch, der Deckplatte<br />
der oberirdisch angelegten Gruft der Ebb<strong>in</strong>gmannen.
Der Nannenkeller des Kirchhofs zu Lunden,<br />
Zeichnung Roos 1928,<br />
Archiv Landesamt für Denkmalpflege.<br />
<strong>in</strong> der Art und Weise, wie die Grabste<strong>in</strong>e jetzt gebettet s<strong>in</strong>d, ke<strong>in</strong>esfalls<br />
e<strong>in</strong>en befriedigenden E<strong>in</strong>druck. Die Grabplatten s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Schräg(lage)<br />
zwar gut leserlich, aber die nebene<strong>in</strong>ander aufgeworfenen Hügel und die<br />
Ane<strong>in</strong>anderreihung machen doch e<strong>in</strong>en recht gekünstelten E<strong>in</strong>druck. […]<br />
So kann die Lösung nicht bleiben.“ Etwas zuversichtlicher kl<strong>in</strong>gt se<strong>in</strong> Tätigkeitsbericht<br />
1938: „Der noch etwas künstliche Ausdruck des Friedhofs<br />
wird sich erst mit der Zeit verlieren, wenn die neugesetzten Pflanzen und<br />
Sträucher das Gelände bewuchern.“<br />
Im Mittelpunkt e<strong>in</strong>es mit EU-Mitteln geförderten Projekts, dessen Initia-
14<br />
toren im Jahr 2000 die Pastoren Friedemann Magaard und Peer Munske<br />
waren, standen neben der Wiederherstellung des von Maaß weiterentwikkelten<br />
Wegenetzes die Sanierung der backste<strong>in</strong>ernen Umfassungsmauer sowie<br />
die Konservierung der wertvollen Ste<strong>in</strong>e an.<br />
Geomagnetische Messungen ermöglichten die zerstörungsfreie Erkundung<br />
verborgener Gruftanlagen. Die vorgenommene Kartierung deckte<br />
sich im Wesentlichen mit den bekannten Anlagen. Neben größeren Eisenteilen<br />
bee<strong>in</strong>trächtigten Laternen und Sche<strong>in</strong>werfer das Messergebnis. Um<br />
den baulichen Zustand e<strong>in</strong>er durchschnittlich großen Gruft zu erkunden<br />
und Sanierungsmöglichkeiten auszuloten, wurde durch das Archäologische<br />
Landesamt das aus Klosterformatste<strong>in</strong>en gemauerte Tonnengewölbe der<br />
jüngsten Gruft (Harm Witt von 1837) freigelegt und durch e<strong>in</strong>e schmale<br />
Öffnung auch e<strong>in</strong> Blick <strong>in</strong> das gekälkte, durch zwei Luftschächte be- und<br />
entlüftete Gruft<strong>in</strong>nere mit den Ausmaßen L ca. 3 x Br 2,5 x T 1,50 m<br />
geworfen. Die e<strong>in</strong>st auf parallel gemauerte Läuferreihen aufgestellten Kieferholzsärge<br />
lagen bei der Überprüfung der Wittschen Gruft nicht mehr im<br />
Verband. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen s<strong>in</strong>d Knochen und Sargreste<br />
(Kiefernholz und Stoffreste der Auskleidung) über den Ziegelste<strong>in</strong>boden<br />
zerstreut worden. Auf e<strong>in</strong>em Zettel aus e<strong>in</strong>er aufgefundenen, verkorkten<br />
Der Friedhof mit Info-Pavillon<br />
zur Öffentlichkeitsarbeit.
Glasflasche stand, dass der Grabkeller schon 1938 <strong>in</strong>spiziert und wieder<br />
vermauert worden war.<br />
Zwei Gruftkeller s<strong>in</strong>d seit den 1970er Jahren der Öffentlichkeit zugänglich,<br />
auch wenn ihre E<strong>in</strong>gangsgestaltung zu wünschen lässt: der im Gewölbebereich<br />
sanierte Sulemannenkeller und die Nannengruft. Vor der<br />
Swyn-Stele liegt der mit 22 m² außergewöhnlich große Doppelgrabkeller<br />
der Sulemannen, der als Ausstellungsraum und Lapidarium für die Abgüsse<br />
gedacht ist (Replik der Stele Peter Swyns und Hans Rodes, der Großen<br />
und Kle<strong>in</strong>en Nannen-Stele, der Stele der Familie Henn<strong>in</strong>ges). Bereits 1928<br />
wurde der Nannenkeller mit den Ausmaßen L 5,60 x Br. 3,20 x H 2,20 m<br />
freigelegt, dessen 1,10 m breite Treppe von e<strong>in</strong>er Platte bedeckt ist.<br />
Nach wissenschaftlicher Grabung, Aufmaß und Baualterskartierung<br />
nach verwendetem Ste<strong>in</strong>material 2006 ist für die Friedhofsmauer aus Klosterformatste<strong>in</strong>en<br />
e<strong>in</strong> Sanierungskonzept erstellt worden. Zur Abdeckung<br />
der jetzt neu verfugten Backste<strong>in</strong>mauer s<strong>in</strong>d halbrunde Formste<strong>in</strong>e nachgebrannt<br />
worden. E<strong>in</strong>en Blick auf das freigelegte Sichtmauerwerk aus Klosterformatziegeln<br />
bis h<strong>in</strong> zur Gründung mit Feldste<strong>in</strong>en gibt e<strong>in</strong> mit Glas<br />
abgedeckter Sichtschacht an der östlichen Mauergrenze frei. Er dient dem<br />
Friedhofsbesucher ebenso zur Orientierung wie die Informationsschilder<br />
und -tafeln auf dem Gelände, e<strong>in</strong>e Ausstellung <strong>in</strong> der Kirche wie auch e<strong>in</strong><br />
sechseckiger Pavillon als „Info-Punkt“ am Rande des Friedhofs. E<strong>in</strong>e <strong>in</strong>formative<br />
Broschüre „Bauerngeschlechter zwischen Zeit und Ewigkeit“ liegt<br />
gedruckt vor.<br />
Der Geschlechterfriedhof lädt wieder zum Verweilen e<strong>in</strong>. Sowohl dem<br />
Friedhofs- und Gartendenkmal <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Prägung der 1930er Jahre als auch<br />
den älteren E<strong>in</strong>zeldenkmalen der Ste<strong>in</strong>metzkunst und Epigraphik wurden<br />
die Wiederherstellungsarbeiten gerecht.<br />
Dirk Jonkanski<br />
15<br />
Die Redaktion der <strong>Mitteilungen</strong> der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong><br />
dankt Herrn Dirk Jonkanski für die Zurverfügungstellung se<strong>in</strong>es Aufsatzes<br />
über den Lundener Geschlechterfriedhof aus der Zeitschrift DenkMal! 16/2009, S.<br />
17-24, den wir hier <strong>in</strong> leicht gekürzter Form veröffentlichen. Für die Anmerkungen<br />
und Literaturh<strong>in</strong>weise verweisen wir auf den Aufsatz <strong>in</strong> der Zeitschrift DenkMal!<br />
16/2009.
Berichte und <strong>Mitteilungen</strong><br />
Laudatio des Vorsitzenden der Gesellschaft<br />
für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong> anlässlich der<br />
Vergabe des Preises der Gesellschaft<br />
für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong> 2009<br />
an Herrn Prof. Dr. Steen Bo Frandsen am 11. Juli 2009<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
der Preis der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong> wurde<br />
2007 gestiftet und wird durch die großzügige Zuwendung der Brunswiker<br />
Stiftung f<strong>in</strong>anziert. 2008 konnte der Preis erstmals verliehen werden. Auch<br />
für dieses Jahr wurde der Preis wieder ausgeschrieben. Es hat 12 sehr <strong>in</strong>teressante<br />
Bewerbungen gegeben, über die wir uns sehr gefreut haben und<br />
die unserer Jury die Preisvergabe nicht leicht machten. Die Entscheidung<br />
ist nun heute gefallen, und ich freue mich, Ihnen im Namen des Vorstands<br />
der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong> mitzuteilen: Der<br />
Preis unserer Gesellschaft geht dieses Jahr an Professor Dr. Steen Bo Frandsen,<br />
Syddansk Universitet, Sønderborg, für se<strong>in</strong> Werk „Holsten i helstaten.<br />
Hertugdømmet <strong>in</strong>den for og uden for det danske monarki i første halvdel<br />
af 1800-tallet” auf deutsch: Holste<strong>in</strong> im Gesamtstaat. Das Herzogtum <strong>in</strong>nerhalb<br />
und außerhalb der dänischen Monarchie <strong>in</strong> der ersten Hälfte des<br />
19. Jahrhunderts.<br />
Bedauerlicherweise bef<strong>in</strong>det sich Herr Professor Frandsen zur Zeit im Urlaub<br />
<strong>in</strong> Italien, daher kann ihm der Preis heute zwar verliehen, aber leider<br />
nicht überreicht werden. Das muss später nachgeholt werden.<br />
Doch nun zum preisgekrönten Werk und se<strong>in</strong>em Autor.<br />
Vielleicht mag es verwundern, dass der Geschichtspreis der Gesellschaft<br />
für schleswig-holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong> nun zum zweiten Mal für e<strong>in</strong> dänischsprachiges<br />
Werk vergeben wird. Aber letztendlich ist dies nur e<strong>in</strong> Zeichen<br />
der heutigen grenzüberschreitenden Normalität und wie unbefangen<br />
wir heute mite<strong>in</strong>ander umgehen können. Auch wäre es zu kurzsichtig, ja<br />
engstirnig, den diesjährigen Preisträger, Professor Steen Bo Frandsen, nur<br />
als e<strong>in</strong>en ‚dänischen‘ Historiker zu bezeichnen. Wer nur e<strong>in</strong>en kurzen Blick<br />
auf Steen Bo Frandsens Werdegang und se<strong>in</strong>e reichhaltige Publikationsliste<br />
wirft, merkt sofort, dass wir es mit e<strong>in</strong>em wahrhaft europäischen Historiker<br />
zu tun haben. Freuen wir uns also darüber, dass die schleswig-holste<strong>in</strong>ische
<strong>Geschichte</strong> immer noch <strong>in</strong>teressante Fragestellungen aufwirft, nicht nur für<br />
die deutsche oder dänische, sondern für die europäische <strong>Geschichte</strong>.<br />
Steen Bo Frandsen wurde 1958 geboren und absolvierte se<strong>in</strong> Geschichtsstudium<br />
an der Universität Århus. Dort promovierte er 1986 über Regionen<br />
und Regionalismus im italienischen E<strong>in</strong>igungsprozess, und der Regionalgeschichte<br />
ist Steen Bo Frandsen seitdem treu geblieben. Es folgten Forschungsaufenthalte<br />
<strong>in</strong> Italien und <strong>in</strong> Deutschland an der Gesamthochschule<br />
Kassel als Stipendiat der Alexander von Humboldt Stiftung. In dieser<br />
Zeit entstand das 1994 bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft veröffentliche<br />
Werk „Dänemark – der kle<strong>in</strong>e Nachbar im Norden“, e<strong>in</strong>e auch<br />
heute noch sowohl für Wissenschaftler und <strong>in</strong>teressierte Laien lesenswerte<br />
Darstellung der vielfältigen deutsch-dänischen Beziehungen im 19. und 20.<br />
Jahrhundert. Wer dieses Buch liest, wird viele der dänischen Ängste und<br />
17<br />
Jörg-Dietrich Kamischke mit dem preisgekrönten Werk
18<br />
Vorbehalte gegenüber Deutschland verstehen und damit bei ihrer Überw<strong>in</strong>dung<br />
helfen können.<br />
Von 1990-93 folgte e<strong>in</strong>e dreijährige Assistenzprofessur an der Universität<br />
Århus. In dieser Zeit entstand das Werk, das Steen Bo Frandsen <strong>in</strong> Dänemark<br />
bekannt machte: “Opdagelsen af Jylland. Den regionale dimension i<br />
Danmarkshistorien 1814-1864” – die Entdeckung Jütlands. Die regionale<br />
Dimension der dänischen <strong>Geschichte</strong> 1814-1864. Diese Habilitationsschrift<br />
setzte <strong>in</strong> Dänemark neue Maßstäbe. Hier stellte Frandsen die Zwangsläufigkeit<br />
der historischen Entwicklung zum dänischen Zentralstaat <strong>in</strong> Frage und<br />
untersucht regionale und regionalistische Initiativen und Bewegungen, die<br />
auch föderative Entwicklungen ermöglicht hätten. Das umfassende Werk<br />
ist <strong>in</strong> Dänemark mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden, stellt es<br />
doch zahlreiche bisherige Grundannahmen im dänischen Geschichtsverständnis<br />
<strong>in</strong> Frage.<br />
Steen Bo Frandsen zog es wieder nach Italien. E<strong>in</strong> Jahr arbeitete er als<br />
Jean Monnet Fellow am Europäischen Hochschul<strong>in</strong>stitut <strong>in</strong> Florenz, dann<br />
sechs Jahre als Wissenschaftler am Dänischen Institut <strong>in</strong> Rom und veröffentliche<br />
e<strong>in</strong>ige Werke zur italienischen Regionalgeschichte sowie das Buch<br />
Das Dritte Rom – Stadtentwicklung und Macht<strong>in</strong>szenierung, über den<br />
Ausbau Roms zur Hauptstadt des gee<strong>in</strong>ten Italien nach 1870.<br />
Seit Januar 2008 ist er Gastprofessor am Institut für Grenzregionsforschung<br />
der Süddänischen Universität <strong>in</strong> Sønderborg, und arbeitet an e<strong>in</strong>em<br />
von der Velux-Stiftung f<strong>in</strong>anziertem Forschungsprojekt über die deutschdänischen<br />
Beziehungen im 20. Jahrhundert.<br />
Das heute zu ehrende Werk entstand durch e<strong>in</strong> Forschungsstipendium<br />
der Carlsberg Stiftung. Ausgangspunkt für das Werk war die Tatsache, dass<br />
das Herzogtum Holste<strong>in</strong> bisher <strong>in</strong> der dänischen Historiographie e<strong>in</strong> Schattendase<strong>in</strong><br />
geführt hat, trotzdem es mehrere Jahrhunderte mit der dänischen<br />
Krone verbunden war. Hier ist natürlich der dänische Fokus auf <strong>Schleswig</strong><br />
verantwortlich, als dem Teil der Herzogtümer, wo der nationale Konflikt<br />
zwischen Deutsch und Dänisch kulm<strong>in</strong>ierte, und um dessen Territorium<br />
letztendlich die beiden schleswigschen Kriege geführt wurden. Während<br />
die dänische Geschichtsauffassung <strong>Schleswig</strong> als eigentlich dänisches Territorium<br />
auffasste, galt Holste<strong>in</strong> als deutsch – e<strong>in</strong>e Trennung, die aber erst<br />
durch die Nationalisierung der Regionen und ihrer vormals dom<strong>in</strong>anten<br />
regionalen Identitäten im 19. Jahrhundert wirksam wurde.<br />
Steen Bo Frandsen zeigt <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Studie auf, dass diese Entwicklung<br />
nicht vorherbestimmt war, und dass die Charakterisierung der Herzogtümer<br />
nach re<strong>in</strong> nationalen Kriterien zahlreiche andere Kriterien verdrängt<br />
und übersieht. Er zeigt auf, dass bis <strong>in</strong> die 1840er Jahre für viele Holste<strong>in</strong>er<br />
die Verb<strong>in</strong>dung mit Dänemark e<strong>in</strong>e Selbstverständlichkeit war, obgleich sie<br />
sich e<strong>in</strong>deutig dem deutschen Kulturkreis zugehörig fühlten. Und auch,
Preisträger Prof. Dr.<br />
Steen Bo Frandsen<br />
wie wenig der sich entwickelnde dänische Zentralstaat bereit war, regionale<br />
Strömungen, Sonderrechte und Privilegien zu respektieren. Das Schlusskapitel,<br />
„E<strong>in</strong> dänisches Elsass“, zeigt, wie sich die bisherige Historiographie<br />
auf die nationale Schiene festgelegt hat, und was dabei übersehen worden<br />
ist. Das Elsass entwickelte seit der Französischen Revolution e<strong>in</strong>e französische<br />
Identität, ohne se<strong>in</strong>e deutsche Sprache und Kultur aufzugeben. Auch<br />
<strong>in</strong> Holste<strong>in</strong> war die Gesamtstaatsidentität mit Loyalität zur dänischen Krone<br />
und gleichzeitiger Beibehaltung der deutschen Sprache und Kultur bis<br />
weit <strong>in</strong>s 19. Jahrhundert h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> unumstritten. Während im Elsass vorher<br />
unbekannte politische Freiheit herrschte, unterblieben demokratische Reformen<br />
<strong>in</strong> Holste<strong>in</strong> (und <strong>Schleswig</strong>) nach dem Wiener Kongress. Ganz<br />
im Gegenteil wurden die Beziehungen durch den beg<strong>in</strong>nenden Nationalisierungsprozess<br />
schärfer. In Kopenhagen gewannen die zentralstaatlichen<br />
Kräfte, welche den verme<strong>in</strong>tlichen holste<strong>in</strong>ischen E<strong>in</strong>fluss zurückdrängen<br />
wollten, und <strong>in</strong> Holste<strong>in</strong> erstarkte e<strong>in</strong> Regionalismus, der zwar nicht die<br />
Verb<strong>in</strong>dung zur dänischen Krone auflösen wollte, sich aber gegen verme<strong>in</strong>tliche<br />
Danisierungsbestrebungen wehrte. Steen Bo Frandsens Werk regt
Der Vorstand der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong><br />
mit Preisträger Steen Bo Frandsen (3. v. r.).<br />
hier zum Nachdenken an, und zeigt e<strong>in</strong>mal mehr, dass <strong>Geschichte</strong> ke<strong>in</strong><br />
zwangsläufiger Prozess ist, sondern abhängig von Entscheidungen, die e<strong>in</strong>e<br />
Entwicklung ermöglichen und andere ausschließen.<br />
Hier wird somit e<strong>in</strong> Autor geehrt, der Neuland <strong>in</strong> der schleswig-holste<strong>in</strong>ischen<br />
Geschichtsforschung betreten hat, die Landesgeschichte um e<strong>in</strong>e<br />
europäische Perspektive bereichert hat und e<strong>in</strong> weiteres Beispiel der <strong>in</strong>zwischen<br />
fruchtbaren und reibungslosen Zusammenarbeit deutscher und dänischer<br />
Historiker abgibt.<br />
Auch im nächsten Jahr wird wieder der Preis der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische<br />
<strong>Geschichte</strong> vergeben werden, die öffentliche Ausschreibung<br />
erfolgt demnächst.<br />
Geschichtspreis im Landesarchiv überreicht<br />
Der diesjährige Preis der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong><br />
wurde am 5. Oktober dem dänischen Historiker Prof. Dr. Steen<br />
Bo Frandsen für se<strong>in</strong> Buch „Holsten <strong>in</strong> helstaten“ (Holste<strong>in</strong> im Gesamtstaat)<br />
im Landesarchiv überreicht. Die Gesellschaft würdige damit den für<br />
die dänische und deutsche Geschichtsschreibung neuen Ansatz von Frandsen,<br />
sagte der Vorsitzende Jörg-Dietrich Kamischke.<br />
Galt <strong>Schleswig</strong> im 19. Jahrhundert als Teil Dänemarks, so wird das<br />
deutsche Lehen Holste<strong>in</strong> <strong>in</strong> der aktuellen dänischen Geschichtsschreibung
als Sonderfall gesehen. Zu unrecht, wie Steen Bo Frandsen argumentiert.<br />
Anfang des 19. Jahrhunderts war nicht vorgezeichnet, dass sich <strong>Schleswig</strong><br />
und Holste<strong>in</strong> aus dem Verband des dänischen Gesamtstaates lösen würden.<br />
Holste<strong>in</strong> hätte, so Frandsen, zu e<strong>in</strong>em dänischen Elsass werden können. Es<br />
gab trotz dem Bekenntnis zur deutschen Kultur Loyalität zum dänischen<br />
Staat. Dies, so Frandsen, wurde <strong>in</strong> der Phase des aufkommenden Nationalbewusstse<strong>in</strong>s<br />
auch <strong>in</strong> Dänemark nicht erkannt und nicht genutzt.<br />
Der mit 3000 € dotierte Preis wurde vergangenes Jahr aus Anlass des<br />
175-jährigen Jubiläums gestiftet. Ermöglicht wird er durch die Brunswiker<br />
Stiftung. Zum zweiten Mal <strong>in</strong> Folge geht er an e<strong>in</strong>e Arbeit <strong>in</strong> dänischer<br />
Sprache. Insgesamt wurden e<strong>in</strong> Dutzend Beiträge für den diesjährigen Preis<br />
e<strong>in</strong>gereicht. Nach den Worten des Vorsitzenden der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische<br />
<strong>Geschichte</strong> Jörg-Dietrich Kamischke ist es e<strong>in</strong> Zeichen<br />
der „grenzüberschreitenden Normalität“, dass wiederum e<strong>in</strong> dänischer Historiker<br />
den Preis zuerkannt bekommen hat.<br />
21<br />
Der neue Inhaber der neu-alten regionalgeschichtlichen<br />
Professur an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel:<br />
Prof. Dr. Oliver Auge<br />
Zum 1. März 2009 wurde ich auf die Kieler W2-Professur für Regionalgeschichte<br />
mit Schwerpunkt zur <strong>Geschichte</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>s <strong>in</strong> Mittelalter<br />
und früher Neuzeit berufen. Das ist für mich hohe Ehre und große<br />
Herausforderung zugleich, denn diese Stelle g<strong>in</strong>g aus dem traditionsreichen<br />
Lehrstuhl für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische Landesgeschichte hervor, ich selbst<br />
aber b<strong>in</strong> ke<strong>in</strong> Landesk<strong>in</strong>d, sondern e<strong>in</strong> gebürtiger Schwabe, den die akademische<br />
Wanderschaft nun nach Kiel führte.<br />
Geboren wurde ich 1971 <strong>in</strong> Göpp<strong>in</strong>gen, das <strong>in</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>h<strong>in</strong><br />
über den Handballsport (Frisch Auf Göpp<strong>in</strong>gen) oder die heimische<br />
Spielzeugeisenbahn (Märkl<strong>in</strong>), dem historisch versierten Publikum<br />
im Besonderen durch den unweit von der Stadt bef<strong>in</strong>dlichen Stammsitz<br />
des staufischen Kaiserhauses (Hohenstaufen) bekannt ist. Nach dem Abitur<br />
1990 und dem anschließenden Wehrdienst nahm ich im WS 1991 <strong>in</strong><br />
Tüb<strong>in</strong>gen das Studium der Fächer <strong>Geschichte</strong> und Late<strong>in</strong> (Zielrichtung<br />
Lehramt) auf. Schnell verlegte ich während des Studiums me<strong>in</strong>en Interessenschwerpunkt<br />
auf die vergleichende Landesgeschichte. Dabei wirkte als<br />
me<strong>in</strong> akademischer Lehrer Prof. Dr. Sönke Lorenz, e<strong>in</strong> gebürtiger Schles-
22<br />
wig-Holste<strong>in</strong>er, den es <strong>in</strong> die umgekehrte Himmelsrichtung nach Baden-<br />
Württemberg verschlagen hat. Nach dem Ersten Staatsexamen wurde ich<br />
Anfang 1998 <strong>in</strong> das Tüb<strong>in</strong>ger Graduiertenkolleg „Ars und Scientia <strong>in</strong> Mittelalter<br />
und Früher Neuzeit“ aufgenommen, <strong>in</strong> dessen Rahmen ich dann bis<br />
2001 me<strong>in</strong>e Dissertation „Stiftsbiographien – Die Kleriker des Stuttgarter<br />
Heilig-Kreuz-Stifts (1250-1552)“ erarbeitete. Die Arbeit erhielt 2001 den<br />
Baden-Württembergischen Geschichtspreis. 2000/01 wechselte ich dann als<br />
wissenschaftlicher Assistent zu Prof. Dr. Karl-He<strong>in</strong>z Spieß nach Greifswald<br />
an den Lehrstuhl für Allgeme<strong>in</strong>e <strong>Geschichte</strong> des Mittelalters und Historische<br />
Hilfswissenschaften. Am Ende der Greifswalder Zeit stand Anfang<br />
2008 me<strong>in</strong>e Habilitation mit e<strong>in</strong>er Schrift zu „Handlungsspielräume(n)<br />
fürstlicher Politik im Mittelalter. Der südliche Ostseeraum von der Mitte<br />
des 12. Jh. bis <strong>in</strong> die frühe Reformationszeit“. Dar<strong>in</strong> geht es um die Verb<strong>in</strong>dung<br />
von Forschungsansätzen, die sich dem sog. cultural turn verdanken,<br />
mit klassischen Feldern wie der Politik-, Verfassungs- und Sozialgeschichte,<br />
um so zu e<strong>in</strong>em besseren Verständnis vom „Fürstentum“ der Zeit zu gelangen.<br />
Thematisch und räumlich gelangte ich damit also schon <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
beträchtliche Nähe zur skand<strong>in</strong>avischen und schleswig-holste<strong>in</strong>ischen <strong>Geschichte</strong>.<br />
Die Arbeit ersche<strong>in</strong>t noch 2009. Nach e<strong>in</strong>er Lehrstuhlvertretung<br />
<strong>in</strong> Greifswald im WS 2007/08 wechselte ich im SS 2008 als Gastdozent für<br />
e<strong>in</strong> Semester an den Sonderforschungsbereich 537 nach Dresden, danach<br />
vertrat ich im WS 2008/09 <strong>in</strong> Gött<strong>in</strong>gen den Spätmittelalter-Lehrstuhl.<br />
Me<strong>in</strong> Werdegang und die dabei erworbenen historischen Kenntnisse erlauben<br />
mir e<strong>in</strong>en vergleichenden Blickw<strong>in</strong>kel an die Landesgeschichte(n)<br />
anzusetzen, wie es mit der Denom<strong>in</strong>ation der Kieler Regionalgeschichte<br />
auch <strong>in</strong>tendiert ist. Dies hilft sehr gut dabei, Phänomene richtig, d.h. <strong>in</strong><br />
ihrer E<strong>in</strong>zigartigkeit wie <strong>in</strong> ihrer Parallelität im Vergleich zu anderen Regionen,<br />
e<strong>in</strong>zuordnen. „Regionalgeschichte“ besagt ja – neben der ihr <strong>in</strong>newohnenden,<br />
stark strukturgeschichtlichen Ausrichtung – nicht zuletzt, dass bei<br />
der Erforschung der Vergangenheit e<strong>in</strong>es Raumes an die Stelle der „harten“,<br />
oft ahistorischen Landesgrenze e<strong>in</strong>e „weiche“, je nach Thema festzuschreibende<br />
Grenzziehung e<strong>in</strong>er Region tritt. Und Regionalgeschichte fordert<br />
von vornhere<strong>in</strong> zum Vergleich auf und heraus.<br />
Die künftigen Arbeitsfelder des Lehrstuhls werden zunächst <strong>in</strong> der Erarbeitung<br />
e<strong>in</strong>es <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>isch-Hamburgischen Klosterbuches, <strong>in</strong> der<br />
Untersuchung des Verhältnisses von fürstlichen Stadtherren zu den kle<strong>in</strong>en<br />
Stadtkommunen <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>s und der Beziehungen der Hanse zu<br />
den schleswig-holste<strong>in</strong>ischen Landesfürsten, aber auch <strong>in</strong> der Neuübersetzung<br />
der mittelalterlichen Chronik Arnolds von Lübeck für die renommierte<br />
Reihe der Freiherr vom Ste<strong>in</strong>-Gedächtnisausgabe (FSGA) liegen. Me<strong>in</strong><br />
Assistent Burkhard Büs<strong>in</strong>g beschäftigt sich im Rahmen se<strong>in</strong>es Dissertationsvorhabens<br />
zudem <strong>in</strong>tensiv mit der „verspäteten“ Konfessionalisierung
Prof. Dr. Oliver Auge (2. v. l.) im Kreise se<strong>in</strong>er Mitarbeiter und Studenten.<br />
<strong>in</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>. Daneben gilt es, verschiedene landesgeschichtliche<br />
Themen e<strong>in</strong>em größeren, auch außeruniversitären Publikum zu erschließen.<br />
So wird der Lehrstuhl für Regionalgeschichte gleich im März 2010<br />
e<strong>in</strong>e öffentliche Tagung zum Vertrag von Ripen 1460 veranstalten, dessen<br />
Schlagwort „up ewig ungedelt“ uns allen bekannt ist und dessen Ausstellung<br />
sich eben im März zum 550. Male jährt.<br />
Desweiteren werden wir im November 2010 <strong>in</strong> Kiel e<strong>in</strong>e Tagung zum<br />
Klosterwesen <strong>in</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong> und zu den Aufgaben und Perspektiven<br />
der Klosterforschung unserer Tage veranstalten. Doch wird sich unsere<br />
Öffentlichkeitsarbeit nicht nur <strong>in</strong> der Organisation und Durchführung von<br />
Tagungen ergehen, sondern auch <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelvorträgen zum Ausdruck kommen,<br />
die sich aus verschiedenen Anlässen ergeben. Zu erwähnen s<strong>in</strong>d hier<br />
für das Jahr 2009 beispielsweise e<strong>in</strong> Vortrag zu Kirchbarkau <strong>in</strong> der Welt<br />
des 13. Jahrhunderts, der im Juli aus Anlass der 750jährigen Ersterwähnung<br />
(Kirch-)Barkaus stattfand, oder zum 550. Todestag Adolfs VIII. von<br />
Holste<strong>in</strong> und dem damit verbundenen Aussterben der schauenburgischen<br />
Dynastie <strong>in</strong> Lübeck am 4. Dezember.<br />
Durch solche Veranstaltungen und die darauf folgenden Veröffentlichungen,<br />
aber auch durch künftig <strong>in</strong>s Auge zu fassende Ausstellungsprojekte
24<br />
wollen wir versuchen, <strong>in</strong> breiteren Bevölkerungsschichten e<strong>in</strong> tiefer gehendes<br />
Bewusstse<strong>in</strong> für die vielseitigen Facetten der schleswig-holste<strong>in</strong>ischen<br />
Landesgeschichte zu verankern bzw. weiter abzusichern. E<strong>in</strong> solches Bemühen<br />
muss natürlich auch das Schulwesen mit e<strong>in</strong>beziehen. Gerade an<br />
den Schulen, bei Lehrern wie Schülern, können durch e<strong>in</strong>e anschauliche<br />
Vermittlung landesgeschichtlicher Themen wertvolle Grundlagen für e<strong>in</strong><br />
nachhaltiges Interesse an der langen <strong>Geschichte</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>s gelegt<br />
und erweitert werden, das – bezogen auf die Schüler – auch nach der Schulzeit<br />
fortwirkt.<br />
E<strong>in</strong> solches landesgeschichtliches Interesse und Bewusstse<strong>in</strong> kann <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
immer globaler werdenden Welt nicht nur zur eigenen, <strong>in</strong> der Region<br />
verankerten Identitätsf<strong>in</strong>dung beitragen, sondern stellt <strong>in</strong> gewisser Weise<br />
andererseits auch sicher, dass die besondere Relevanz landesgeschichtlicher<br />
Forschung, ja historischen Arbeitens überhaupt <strong>in</strong> Zukunft <strong>in</strong> breiteren Bevölkerungskreisen<br />
verstanden und anerkannt wird. Aus den Schülern der<br />
Gegenwart werden e<strong>in</strong>mal die aktiven Träger landeshistorischer Arbeit der<br />
Zukunft. E<strong>in</strong>e vertiefte Zusammenarbeit mit den Schulen des Landes ist<br />
auf dem Wege e<strong>in</strong>er kompetenten Beratung bei der Konzeption von Schulbüchern,<br />
durch die Erschließung von Quellen und Informationsmaterial<br />
für den Schulunterricht und überhaupt vermittelst e<strong>in</strong>er stärkeren Kommunikation<br />
zwischen Lehrerschaft und Universität denkbar.<br />
Me<strong>in</strong>e eigenen thematischen Schwerpunkte liegen – der Denom<strong>in</strong>ation<br />
des Lehrstuhls entsprechend – im Mittelalter und <strong>in</strong> der frühen Neuzeit.<br />
Das heißt nun nicht, dass sich der Kieler Lehrstuhl für Regionalgeschichte<br />
der Erforschung der neueren und Zeitgeschichte des Landes verschließt.<br />
Das ist mitnichten der Fall. So betreue ich mehrere Qualifikationsarbeiten<br />
zu verschiedenen Themen der Landesgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.<br />
Das Thema „Kiel als Militär(gedenk)stadt“ schält sich momentan<br />
bereits als weiterer Arbeitsschwerpunkt des Lehrstuhls heraus. Über me<strong>in</strong>e<br />
wissenschaftliche Mitarbeiter<strong>in</strong> Sabr<strong>in</strong>a Keit, die eigens für die regionale<br />
Zeitgeschichte angestellt wurde, ist auch die Lehre für diese äußerst spannende<br />
Geschichtsepoche abgedeckt. In Frau Keits Dissertationsvorhaben<br />
geht es im Übrigen um „Politische Kultur und Geschichtsgebrauch im<br />
<strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong> der 1980er Jahre“.<br />
Der H<strong>in</strong>weis auf die Schule und die Lehre im Bereich der Zeitgeschichte<br />
hat bereits die Brücke zu e<strong>in</strong>em weiteren wichtigen Betätigungsfeld geschlagen,<br />
auf dem wir uns künftig verstärkt tummeln müssen und wollen: Es geht<br />
an der Universität nicht nur um Forschung, die <strong>in</strong> Tagungen und Publikationen<br />
ihren sichtbaren Niederschlag f<strong>in</strong>det, sondern auch um das Angebot<br />
e<strong>in</strong>er attraktiven und zugleich nachhaltigen Lehre. Attraktivität bedeutet,<br />
momentan <strong>in</strong>teressante und relevante, weiterführende Themen anzubieten,<br />
diese anschaulich <strong>in</strong> Sem<strong>in</strong>aren und auf Exkursionen zu vermitteln und
den Studierenden als Angehörigen der berüchtigten „Generation Praktikum“<br />
dabei die Gelegenheit zur aktiven und selbstständigen Mitwirkung<br />
an der Forschungsarbeit zu bieten: z. B. im Rahmen von Ausstellungen<br />
und Publikationen. So werden die Studierenden am Lehrstuhl dazu angehalten,<br />
Fachliteratur <strong>in</strong> Eigenregie zu rezensieren und die selbst verfassten<br />
und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em zweiten Schritt <strong>in</strong> me<strong>in</strong>em wissenschaftlichen Kolloquium ttr<br />
(Themen und Tendenzen der Regionalgeschichte) betreuten Rezensionen<br />
zu veröffentlichen. Die <strong>in</strong> der landeshistorischen Wissenschaftslandschaft<br />
bekannten und anerkannten „Baltischen Studien“ haben die Nachhaltigkeit<br />
e<strong>in</strong>er solchen Rekrutierung junger Leute für die Landesgeschichte erkannt<br />
und das <strong>in</strong> diesem Zusammenhang vom Kieler Lehrstuhl gemachte<br />
Rezensionsangebot bereits dankbar aufgegriffen.<br />
Zu diesem gesamten Bereich gehört natürlich auch e<strong>in</strong>e enge Vernetzung<br />
der Lehre mit den Archiven im Land. So werden wir künftig turnusmäßig<br />
im Rahmen der e<strong>in</strong>zelnen Veranstaltungen Besuchsterm<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Archiven<br />
durchführen, um den Studierenden auf diesem Wege e<strong>in</strong>en ersten Zugang<br />
zu den Schatzkammern unseres historischen Wissens zu vermitteln. Desweiteren<br />
sollen die Studierenden bei Gelegenheit zur selbstständigen Arbeit<br />
im Archiv ermuntert werden. Bei e<strong>in</strong>er entsprechenden Eignung und Qualität<br />
der so erzielten Forschung ist selbstverständlich an e<strong>in</strong>e Publikation<br />
der studentischen Arbeitsergebnisse gedacht. Die Studierenden erhalten auf<br />
diese Weise wertvolle Zusatzqualifikationen, die sich später im rauen Wettbewerb<br />
um e<strong>in</strong>en Arbeitsplatz auszahlen werden. Für die Regionalgeschichte<br />
wiederum ist e<strong>in</strong>e so praktizierte Lehre um so entscheidender, als die neu<br />
e<strong>in</strong>gerichteten Studiengänge des Bachelor und Master unter Umständen zu<br />
e<strong>in</strong>er Verm<strong>in</strong>derung der Absolventenzahlen im Bereich Regional-/Landesgeschichte<br />
führen werden. Nur auf dem Wege e<strong>in</strong>er attraktiven und nachhaltigen<br />
Lehre ist e<strong>in</strong> weiterer Studierendenzulauf sicher gestellt. Die Studierenden<br />
von heute s<strong>in</strong>d selbstredend zu e<strong>in</strong>em großen Teil die Lehrer von<br />
morgen, womit sich wiederum der Kreis zu Schulen und Schülern schließt.<br />
Und wenn nicht gleich Lehrer, so können aus ihnen doch immerh<strong>in</strong> aktive<br />
Mitglieder der zahlreichen historischen Verbände und Vere<strong>in</strong>e werden,<br />
ohne die landesgeschichtliche Arbeit nicht denkbar und möglich ist.<br />
E<strong>in</strong>es ist klar: Die so umrissene vielseitige Forschungs-, Lehr- und Öffentlichkeitsarbeit,<br />
die sich der neu-alte Kieler Lehrstuhl für Regionalgeschichte<br />
vorgenommen hat, kann nur <strong>in</strong> enger Zusammenarbeit mit den an<br />
der CAU angesiedelten Nachbardiszipl<strong>in</strong>en - etwa im Rahmen geme<strong>in</strong>samer<br />
DFG-Projekte und Forschergruppen - sowie mit den außeruniversitären<br />
Institutionen und Personen landesgeschichtlicher Forschung erfolgen.<br />
Es besteht daher me<strong>in</strong>erseits e<strong>in</strong> großes Interesse daran, dass e<strong>in</strong>e solche<br />
Kooperation künftig <strong>in</strong> gedeihlicher Weise geschieht. Dass dieses Anliegen<br />
ernst geme<strong>in</strong>t ist und so auch verstanden werden soll, macht me<strong>in</strong>e Bereit-<br />
25
26<br />
schaft zur aktiven Mitarbeit im Rahmen der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-<br />
Holste<strong>in</strong>ische Landesgeschichte deutlich. Umso erfreuter war ich deswegen<br />
über die auf der letzten Mitgliederversammlung erfolgte Wahl <strong>in</strong> deren<br />
Vorstand. Ich danke auf diesem Wege allen Wählern ganz herzlich für das<br />
mir als Vorschuss gewährte Vertrauen!<br />
Weitere und stets aktualisierte Informationen zur Arbeit des Kieler Lehrstuhls<br />
für Regionalgeschichte siehe unter http://www.histosem.uni-kiel.<br />
de/Lehrstuehle/land/land.html.<br />
Der neue Inhaber der Professur für Nordeuropäische<br />
<strong>Geschichte</strong> an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel:<br />
Prof. Dr. Mart<strong>in</strong> Krieger<br />
Die Nordeuropäische <strong>Geschichte</strong> gehört zu den traditionsreichsten Diszipl<strong>in</strong>en<br />
an der Christiana Albert<strong>in</strong>a. Auch wenn nicht von Beg<strong>in</strong>n an durch<br />
e<strong>in</strong>en eigenständigen Lehrstuhl vertreten, bedeutete doch die enge Verb<strong>in</strong>dung<br />
<strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>s mit dem Norden akademische Chance wie auch<br />
Herausforderung. E<strong>in</strong>e besondere Verpflichtung stellte <strong>in</strong> der Vergangenheit<br />
die Beteiligung am Bau e<strong>in</strong>er kulturellen Brücke zum Norden über alle<br />
nationalen Konfliktl<strong>in</strong>ien h<strong>in</strong>weg dar. Während heute alte Gegensätze allmählich<br />
überwunden sche<strong>in</strong>en, stehen wir vor neuen Herausforderungen,<br />
die auch den Historiker <strong>in</strong> die Pflicht nehmen: das immer enger werdende<br />
Zusammenwachsen e<strong>in</strong>es Europa der Regionen, zukunftsträchtige Infrastrukturprojekte,<br />
die knapper werdenden natürlichen Ressourcen und die<br />
immer noch nicht ganz überwundene Trennung des Ostseeraumes <strong>in</strong>folge<br />
des Kalten Krieges. Bei all diesen Fragen s<strong>in</strong>d Antworten mit historischer<br />
Tiefenschärfe gefragt.<br />
Für mich bedeutet der Ruf nach Kiel an den Lehrstuhl für Nordeuropäische<br />
<strong>Geschichte</strong> e<strong>in</strong>e Rückkehr zu me<strong>in</strong>en schleswig-holste<strong>in</strong>ischen Wurzeln,<br />
<strong>in</strong>sbesondere zu me<strong>in</strong>er Alma mater, an der ich zwischen 1987 und<br />
1993 me<strong>in</strong>e Studienzeit verbrachte – übrigens von Beg<strong>in</strong>n an als Mitglied<br />
der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong>. Geboren 1967<br />
<strong>in</strong> Hamburg und aufgewachsen im Kreis Segeberg, studierte ich an der<br />
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Mittlere und Neuere <strong>Geschichte</strong>,<br />
Ur- und Frühgeschichte sowie Nordische Philologie. Aus dem breiten Studienangebot<br />
und dem für mich immer vorbildlichen Engagement der damaligen<br />
Hochschullehrer g<strong>in</strong>g letztlich auch me<strong>in</strong>e Dissertation hervor, <strong>in</strong>
der ich mich mit dem dänischen Handel auf dem Indischen Ozean im 17.<br />
und 18. Jahrhundert beschäftigte.<br />
Nach Abschluß des Promotionsstudiums <strong>in</strong> Kiel und Greifswald war ich<br />
seit 1996 als Wissenschaftlicher Assistent und später als Privatdozent am<br />
Lehrstuhl von Prof. Dr. Michael North an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität<br />
Greifswald tätig. Auch hier erlebte ich die Nähe zur Ostsee mit ihren<br />
mannigfachen Verb<strong>in</strong>dungen <strong>in</strong> den Norden immer wieder als anregend<br />
und impulsgebend. Gleichsam als norddeutscher Gegenpol zur Dissertation<br />
entstand <strong>in</strong> Greifswald aber auch me<strong>in</strong>e Habilitationsschrift zum Patriotismus-Diskurs<br />
<strong>in</strong> Hamburg im Zeitalter der Frühaufklärung. Daneben<br />
führten mich e<strong>in</strong>zelne Projekte <strong>in</strong> die Umweltgeschichte, <strong>in</strong> die Kulturgeschichte<br />
des Ostseeraumes sowie <strong>in</strong> die politische <strong>Geschichte</strong> des Nordens.<br />
Nach langer Zeit erneut auf den Spuren der Dänen <strong>in</strong> Asien, verbrachte ich<br />
mit me<strong>in</strong>er Familie 2006/2007 e<strong>in</strong> Jahr <strong>in</strong> Indien.<br />
Im Mai 2009 folge schließlich der Ruf nach Kiel. Dieses Amt bedeutet für<br />
mich persönliche Chance wie auch wissenschaftliche Herausforderung und<br />
Verpflichtung; <strong>in</strong>sbesondere sehe ich den Lehrstuhl <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er strategischen<br />
Schlüsselposition für die Universität und das Land <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong> mit<br />
se<strong>in</strong>en zahlreichen Kontakten <strong>in</strong> den Norden. In diesem S<strong>in</strong>ne wird es mir<br />
e<strong>in</strong> Anliegen se<strong>in</strong>, die Inhalte des von mir vertretenen Faches auch über die<br />
Hochschule h<strong>in</strong>aus zu vermitteln.<br />
E<strong>in</strong>zelne Forschungsprojekte laufen bereits oder werden angeschoben. So<br />
arbeite ich gegenwärtig mit Kollegen aus Kopenhagen an e<strong>in</strong>em von der<br />
Gerda-Henkel-Stiftung geförderten Vorhaben über den dänischen Skla-<br />
27
28<br />
Der wik<strong>in</strong>gerzeitliche Handelsplatz Haithabu und das fast 26 km lange<br />
Grenzbauwerk Danewerk bei <strong>Schleswig</strong> zählen zu den bedeutendsten historischen<br />
Denkmalen <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>s. Sie gehören zugleich zu den<br />
wichtigsten und am besten erhaltenen Monumenten der Wik<strong>in</strong>gerzeit. Diese<br />
Epoche vom 8. bis zum 11. Jahrhundert n. Chr. ist herausragend <strong>in</strong> der<br />
<strong>Geschichte</strong> Nordeuropas. Während dieser Zeit wurden die Grundlagen der<br />
modernen skand<strong>in</strong>avischen Gesellschaften gelegt. Zugleich bee<strong>in</strong>flussten<br />
die Wik<strong>in</strong>ger andere europäische Räume erheblich, von Westeuropa über<br />
die britischen Inseln bis <strong>in</strong> den Nordatlantik und das Baltikum. Handel<br />
und Kolonisation g<strong>in</strong>gen Hand <strong>in</strong> Hand mit Eroberung und Plünderung.<br />
Aufgrund ihrer außergewöhnlich seetüchtigen Schiffe und ihrer seemännischen<br />
Fähigkeiten wurden weit entfernte Inseln wie Island und Grönland<br />
besiedelt und es entstanden erste, vorübergehende Siedlungen <strong>in</strong> Nordamerika.<br />
Die Welterbeliste der UNESCO enthält seit dem Ende der 70er Jahre<br />
e<strong>in</strong>e immer größere Anzahl außergewöhnlich bedeutender Monumente,<br />
Stätten und Landschaften der Menschheit. Das Danewerk und Haithabu<br />
sollen nun ebenfalls E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong> diese Liste f<strong>in</strong>den. Dazu wird zusammen<br />
mit anderen Stätten, Monumenten und Landschaften der Wik<strong>in</strong>gerzeit e<strong>in</strong><br />
geme<strong>in</strong>samer Antrag bei der UNESCO gestellt. An dieser sog. transnationalen<br />
seriellen Nom<strong>in</strong>ierung beteiligen sich nunmehr vier Stätten der Wivenhandel<br />
auf dem Indischen Ozean und hoffe natürlich, damit alte, an<br />
der Universität Kiel begonnene Traditionen wieder aufnehmen zu können.<br />
E<strong>in</strong> weiteres Projekt zu Dänisch-Ost<strong>in</strong>dien wird sich mit dem dänischen<br />
Mediz<strong>in</strong>er und Botaniker Nathaniel Wallich beschäftigen – e<strong>in</strong> heute weitgehend<br />
unbekannter nordeuropäischer Gelehrter des 19. Jahrhunderts, dem<br />
wir immerh<strong>in</strong> die Entdeckung des Assam-Tees verdanken. Zum Norden<br />
selbst beteilige ich mich an e<strong>in</strong>em EU-Projekt über das barocke Kulturerbe<br />
Europas; und ich möchte ebenso me<strong>in</strong>e bisherigen Forschungen zum<br />
kulturellen Austausch sowie zu <strong>in</strong>tellektuellen Netzwerken im Ostseeraum<br />
der Neuzeit ausbauen. Für die Zukunft stehen die Umweltgeschichte sowie<br />
die politische und ökonomische <strong>Geschichte</strong> des hohen Nordens zwischen<br />
Grönland und Svalbard auf dem Programm. – Besonders freue ich mich<br />
darauf, möglichst viele Forschungsprobleme geme<strong>in</strong>sam mit me<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en,<br />
e<strong>in</strong>gespielten Team hier <strong>in</strong> Kiel zu lösen.<br />
Danewerk und Haithabu als Welterbestätten<br />
der Wik<strong>in</strong>gerzeit – Zum Stand des Projektes
Das offene Teilstück der Waldemarsmauer beim Danewerk<br />
k<strong>in</strong>gerzeit, die bereits auf der Welterbeliste stehen: Th<strong>in</strong>gvellir <strong>in</strong> Island,<br />
Jell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Dänemark, Birka und Hovgården <strong>in</strong> Schweden und die Urnes<br />
Stabkirche <strong>in</strong> Norwegen. E<strong>in</strong> fünftes wik<strong>in</strong>gerzeitliches Weltkulturerbe,<br />
die Siedlung L’Anse aux Meadows im kanadischen Neufundland, beteiligt<br />
sich als Beobachter und könnte zu e<strong>in</strong>em späteren Zeitpunkt noch dazu<br />
kommen. Neben diesen bestehenden Welterbestätten werden die dänischen<br />
Burgen des Trelleborg-Typs ebenfalls Teil dieser seriellen Nom<strong>in</strong>ierung.<br />
Weitere Länder wurden e<strong>in</strong>geladen, eigene bedeutende Plätze zu benennen<br />
und sie der Nom<strong>in</strong>ierung h<strong>in</strong>zuzufügen. Irland, Lettland, Estland und die<br />
Ukra<strong>in</strong>e haben dabei bereits ihr Interesse an e<strong>in</strong>er unmittelbaren Teilnahme<br />
bekräftigt. Die Zahl der an dem Nom<strong>in</strong>ierungsprojekt teilnehmenden<br />
Stätten kann damit noch bedeutend anwachsen. Aufgrund der unterschiedlichen<br />
Stände bei der Vorbereitung für die Nom<strong>in</strong>ierung wird diese aller<br />
Voraussicht nach <strong>in</strong> mehreren Stufen erfolgen. Bei der ersten Phase werden<br />
dann neben dem Danewerk und Haithabu auch die Burgen des Trelleborg-<br />
Typs und die bereits bestehenden Welterbestätten der Wik<strong>in</strong>gerzeit teilnehmen.<br />
Die Welterbenom<strong>in</strong>ierung der Monumente der Wik<strong>in</strong>gerzeit wird damit<br />
m<strong>in</strong>destens sechs sehr unterschiedliche Kulturstätten umfassen, von e<strong>in</strong>zelnen<br />
Bauwerken wie der Urnes-Stabkirche über Siedlungen wie Haithabu<br />
und Birka bis h<strong>in</strong> zu Landschaften wie Th<strong>in</strong>gvellir. Diese Plätze ha-
Die rekonstruierten Wik<strong>in</strong>gerhäuser im Halbkreiswall<br />
von Haithabu<br />
ben geme<strong>in</strong>sam, dass sie bedeutende Informationen zum Verständnis der<br />
Wik<strong>in</strong>gerzeit lieferten und z. T. auch heute noch von großer symbolischer<br />
Bedeutung s<strong>in</strong>d oder als außergewöhnliche Bauwerke und Orte der Zeit<br />
überliefert s<strong>in</strong>d. Mit der seriellen Nom<strong>in</strong>ierung kann es damit erstmals <strong>in</strong><br />
der <strong>Geschichte</strong> des Welterbes gel<strong>in</strong>gen, e<strong>in</strong>en gesamten historischen Kulturkreis<br />
anhand se<strong>in</strong>er bedeutendsten Stätten zu beschreiben. E<strong>in</strong> Welterbe<br />
der Wik<strong>in</strong>gerzeit wächst so über den außergewöhnlichen Wert jeder e<strong>in</strong>zelnen<br />
Teilstätte h<strong>in</strong>aus und beschreibt e<strong>in</strong> Kulturerbe, das größer ist als die<br />
Summe se<strong>in</strong>er Teile. Es bleibt zudem verbunden mit H<strong>in</strong>terlassenschaften<br />
der Wik<strong>in</strong>gerzeit, die nicht <strong>in</strong> das Korsett von Welterbestätten zu zwängen<br />
s<strong>in</strong>d, welche e<strong>in</strong> hohes Maß an Authentizität verlangen oder etwa bewegliche<br />
Güter gar nicht berücksichtigen. Dazu gehören die reiche literarische<br />
H<strong>in</strong>terlassenschaft der nachfolgenden Zeit, wie etwa die isländischen Sagas<br />
oder die Eddas, genauso wie die ausgegrabenen Schiffe von Oseberg und<br />
Gokstad oder die Runenste<strong>in</strong>e um Haithabu.<br />
Die Vorbereitungen zur Nom<strong>in</strong>ierung erfordern e<strong>in</strong>en erheblichen organisatorischen<br />
Aufwand auf nationaler wie <strong>in</strong>ternationaler Ebene. Haithabu<br />
und das Danewerk müssen, genauso wie die Trelleborg-Burgen, alle
Angaben für e<strong>in</strong>en kompletten neuen Antrag erbr<strong>in</strong>gen. Dazu s<strong>in</strong>d genaue<br />
Angaben zu der Ausdehnung der Stätten, zu ihrem Bestand und ihrer historischen<br />
Entwicklung sowie zu ihrer Bedeutung zu machen. Auf <strong>in</strong>ternationaler<br />
Ebene kommt e<strong>in</strong>e übergreifende Dokumentation h<strong>in</strong>zu, die sowohl<br />
den universellen Wert der gesamten seriellen Nom<strong>in</strong>ierung erläutert,<br />
als auch die <strong>in</strong>ternationalen Organisationsstrukturen aufzeigt, die für den<br />
langfristigen Erhalt der Komponenten sorgen sollen. Im Rahmen e<strong>in</strong>er wissenschaftlichen<br />
Analyse muss auch aufgezeigt werden, welche erhaltenen<br />
Stätten weltweit geeignet s<strong>in</strong>d, das Welterbe der Wik<strong>in</strong>gerzeit am besten zu<br />
vertreten. Damit wird auch e<strong>in</strong>e Aussage darüber getroffen, welchen Umfang<br />
die Serie auch zukünftig haben kann. Dazu, aber auch um e<strong>in</strong>en Stätten<br />
übergreifenden Managementplan zu erstellen, s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>ternationale Arbeitstreffen<br />
mit Experten notwendig, die ab Anfang 2010 beg<strong>in</strong>nen sollen.<br />
Für Danewerk und Haithabu wurde bereits ihre Wertigkeit <strong>in</strong>nerhalb des<br />
wik<strong>in</strong>gerzeitlichen Kontextes def<strong>in</strong>iert und daraus e<strong>in</strong> eigener außergewöhnlicher<br />
universeller Wert des Ensembles formuliert. Dieser ist <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er<br />
seriellen Nom<strong>in</strong>ierung bislang nicht unbed<strong>in</strong>gt gefordert, erleichtert aber<br />
die E<strong>in</strong>ordnung der Stätten <strong>in</strong>nerhalb der Wik<strong>in</strong>gerzeit und die Auswahl<br />
der weltweit bedeutendsten Plätze für e<strong>in</strong> entsprechendes Welterbe. Darauf<br />
bezogen wurden akribisch die Grenzen der Denkmale gezogen sowie<br />
e<strong>in</strong>e Pufferzone def<strong>in</strong>iert. Beides ist notwendig, um die Entwicklung bzw.<br />
den Erhalt der Denkmale kontrollieren und sicherstellen zu können. Dafür<br />
werden nur Landes- und Bundesgesetze angewendet. Die UNESCO-Welterbekonvention<br />
selbst kann nur als weicher Faktor mit dem Verweis auf<br />
die anerkannte Bedeutung der Denkmale für die Menschheit e<strong>in</strong>gebracht<br />
werden. Bei der Def<strong>in</strong>ition der Grenzen der möglichen Welterbestätten<br />
kam es durch neue Feldforschungen <strong>in</strong> Form von Begehungen, Grabungen,<br />
Sonarfahrten und Fernerkundungen auch zu neuen Erkenntnissen, welche<br />
die Ausdehnung des Danewerks deutlich zu erweitern halfen. So gelang es,<br />
den westlichsten Teilabschnitt, den sog. Krummwall, um fast 3 Kilometer<br />
<strong>in</strong> den Ort Holl<strong>in</strong>gstedt h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> zu erweitern. Die Denkmale mussten weiterh<strong>in</strong><br />
beschrieben und ihre historische Entwicklung und ihr geografischer<br />
und kultureller Kontext verdeutlicht werden. Diese Erläuterungen stehen<br />
immer <strong>in</strong> Bezug zu ihrem formulierten Wert, ihrer noch vorhandenen Substanz<br />
und der Gesamtheit ihrer Teilstücke, die für das Verständnis erforderlich<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Den größten Teil der lokalen Arbeit für die Nom<strong>in</strong>ierungsunterlagen<br />
nehmen aber die Bemühungen um e<strong>in</strong> nachhaltiges Management und die<br />
Unterstützung durch die Bevölkerung der umliegenden Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>.<br />
E<strong>in</strong> ausgewogener Managementplan, der unterschiedliche Interessen berücksichtigt,<br />
ist e<strong>in</strong> wesentlicher Teil des Antrags. Dazu wurde vom Archäologischen<br />
Landesamt <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong> und der Aktivregion Schlei-<br />
31
32<br />
Ostsee e<strong>in</strong> Projekt unter der Trägerschaft des Kreises <strong>Schleswig</strong>-Flensburg<br />
<strong>in</strong>itiiert, das als Leuchtturmprojekt der Aktivregionen im März verabschiedet<br />
wurde. Neben der Aktivregion Schlei-Ostsee s<strong>in</strong>d auch die Aktivregionen<br />
Hügelland am Ostseestrand und Eider-Treene-Sorge beteiligt. Dieses<br />
Projekt „Welterbe Danewerk und Haithabu: Denkmal mit Wirkung!“ will<br />
über e<strong>in</strong>en <strong>in</strong>ternationalen Ideenwettbewerb zur Nutzung der Pufferzone<br />
und mit Hilfe von Baulandkatastern zusammen mit den Geme<strong>in</strong>den Ortsentwicklungskonzepte<br />
erstellen, die den Werterhalt der Denkmale aktiv <strong>in</strong><br />
die Geme<strong>in</strong>deentwicklung mit e<strong>in</strong>beziehen. Dadurch sollen Wege gefunden<br />
werden, um auch die Wohn- und Lebensqualität <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den um<br />
das Danewerk langfristig zu verbessern. Anliegen des Projektes ist darüber<br />
h<strong>in</strong>aus, das Verständnis für die Denkmale und ihre <strong>Geschichte</strong> zu erhöhen<br />
und den gegenseitigen Austausch der anliegenden Geme<strong>in</strong>den darüber zu<br />
fördern. Dazu dienen regelmäßige Veranstaltungen mit Teilnehmern aus<br />
allen 15 umliegenden Geme<strong>in</strong>den. Durch die Zusammenarbeit mit Schulen<br />
und dem Jugendzeltlager Selker Noor sollen auch K<strong>in</strong>der und Jugendliche<br />
verstärkt angesprochen werden. Diese Maßnahmen haben zum Ziel,<br />
die Menschen aktiv <strong>in</strong> den Welterbeprozess e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den, die Belange aller<br />
Seiten zu berücksichtigen und e<strong>in</strong>en gegenseitigen Nutzen für Geme<strong>in</strong>den<br />
wie Denkmale zu entwickeln. Insgesamt können so e<strong>in</strong>e nachhaltige Ortsentwicklung<br />
und breit gestreute Vermittlungsarbeit zum Instrument e<strong>in</strong>er<br />
aktiven Denkmalpflege und e<strong>in</strong>er erfolgreichen Ortsentwicklungspolitik<br />
werden. Der Managementplan für Danewerk und Haithabu wird zurzeit<br />
entwickelt und bezieht die Ergebnisse des Leuchtturmprojektes und der<br />
nachfolgenden Abstimmungen mit den Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>.<br />
Anfang Juni wurde auf e<strong>in</strong>em ersten <strong>in</strong>ternationalen Treffen <strong>in</strong> Reykjavik<br />
unter der Federführung Islands das weitere geme<strong>in</strong>same Vorgehen <strong>in</strong> dem<br />
Projekt vere<strong>in</strong>bart. Dazu sollen bis Ende 2009 alle Länder, die an der ersten<br />
Phase der Nom<strong>in</strong>ierung teilnehmen, ihre Beiträge benennen. Zudem wird<br />
Island das Projekt auf se<strong>in</strong>e Welterbe-Vorschlagsliste setzen und damit e<strong>in</strong>e<br />
wesentliche Voraussetzung für die Nom<strong>in</strong>ierung erfüllen. Wenn es gel<strong>in</strong>gt,<br />
2010 alle Angaben für die neu nom<strong>in</strong>ierten Stätten zu sammeln und den<br />
<strong>in</strong>ternationalen Teil des Antrags zu erstellen, ist e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>reichung der Unterlagen<br />
bei der UNESCO im darauf folgenden Jahr möglich. Die Anerkennung<br />
kann dann frühestens im Sommer 2012 erfolgen.<br />
Matthias Maluck
Reth<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g the Maritime Museum<br />
Entwicklungen – Perspektiven – Herausforderungen<br />
33<br />
Bericht über e<strong>in</strong>e Tagung maritimer Museen, 20.– 23.05.2009,<br />
Flensburg und Aabenraa<br />
50 Museumsfachleute aus Deutschland, Dänemark, Grönland, England,<br />
F<strong>in</strong>nland, Belgien und den Niederlanden waren auf E<strong>in</strong>ladung des Flensburger<br />
Schiffahrtsmuseums und des Museums Sønderjylland - Kulturhistorie<br />
Aabenraa vom 20. bis 23. Mai nach Flensburg und Aabenraa gekommen,<br />
um <strong>in</strong>novative Entwicklungen, neue Perspektiven und aktuelle<br />
Herausforderungen maritimer Museen zu diskutieren. Die Tagung war <strong>in</strong><br />
vier themenzentrierte Sektionen untergliedert: Maritime Sachkultur, maritime<br />
Erzählungen, maritimer Tourismus und maritimes Erbe.<br />
Tony Tibbles (Merseyside Maritime Museum, Liverpool) eröffnete die<br />
Tagung mit der provokant gestellten Frage, ob maritime Museen überhaupt<br />
Besuch im Museum Aabenraa am Ende e<strong>in</strong>es e<strong>in</strong>drucksreichen<br />
Tages.
34<br />
e<strong>in</strong>e Zukunft hätten, und setzte damit den Kurs für die folgenden zwei<br />
Tage. Tibbles zeigte auf, wie sich mit dem Wandel der Seefahrt, Hafenstädte<br />
und Küstenregionen auch das Umfeld maritimer Museen und damit<br />
die Zielgruppen und Nutzer dieses spezifischen Museumstyps grundlegend<br />
gewandelt haben. Hatte bislang e<strong>in</strong> Großteil der Besucher maritimer Museen<br />
selber e<strong>in</strong>en engen persönlichen Bezug zur Seefahrt, so ist heute e<strong>in</strong>e<br />
gewachsene Distanz festzustellen. Die Herausforderung, denen sich Schifffahrtsmuseen<br />
heute daher stellen müssen, ist, die Distanz zwischen der<br />
maritimen Wirklichkeit und der Erfahrungswelt an Land zu überbrücken<br />
und verstärkt die Bedeutung aufzuzeigen, die e<strong>in</strong>e global agierende Seefahrt<br />
für den Alltag der allermeisten Menschen heute hat. Tibbles unterstrich,<br />
dass dies nur möglich ist, wenn die Museen ihre traditionell eher objektzentrierte<br />
Ausrichtung ablegen und stattdessen themenzentrierte Strategien<br />
entwickeln, die sich an den Interessen und Erfahrungen der aktuellen und<br />
potentiellen Museumsbesucher orientieren.<br />
Der zweite Tagungstag griff diesen Faden mit Blick auf die beiden musealen<br />
Kernthemen vom Sammeln und Ausstellen auf. Norbert Fischer<br />
(Universität Hamburg) betrachtete <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Beitrag das Umfeld, <strong>in</strong> dem<br />
sich maritime Museen bewegen. Se<strong>in</strong>e Fallstudien verdeutlichten, wie vor<br />
dem H<strong>in</strong>tergrund e<strong>in</strong>es wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandels die<br />
Regionen der Nordseeküste symbolisch als „maritim“ gekennzeichnet und<br />
rekonstruiert werden, wobei das „Maritime“ im Spannungsfeld zwischen<br />
kollektiver Er<strong>in</strong>nerung und populären Vorstellungsbildern def<strong>in</strong>iert wird.<br />
Die Begleitung, Reflexion und Moderation dieses Diskurses wäre für maritime<br />
Museen e<strong>in</strong> wichtiges Aufgabenfeld. Torkil Adsersen (Handels- og<br />
Søfartsmuseet, Kronborg) nahm sich der Frage nach dem „Maritimen“ aus<br />
dem Blickw<strong>in</strong>kel der Sammlungspolitik an. Se<strong>in</strong>e Hauptthese war, dass<br />
nicht das Objekt selbst, sondern se<strong>in</strong> Bezug zur maritimen Wirklichkeit<br />
se<strong>in</strong>e „Maritimität“ def<strong>in</strong>iert, weshalb Adsersen vorschlug, nicht von maritimen<br />
Objekten, sondern von maritimen Beziehungen zu sprechen. So gesehen<br />
werden Objekte zu Mittlern, deren jeweilige <strong>Geschichte</strong>n dabei helfen<br />
können, die Distanz zwischen maritimer Wirklichkeit und Vorstellung zu<br />
überbrücken. Sonja K<strong>in</strong>zler (Universität Bremen) und Anne Dombrowski<br />
(Flensburger Schiffahrtsmuseum) zeigten daran anschließend mögliche<br />
Forschungsperspektiven e<strong>in</strong>er maritimen Sachkulturforschung auf.<br />
Wie sich <strong>Geschichte</strong>n von der Seefahrt im Museum jenseits der bekannten<br />
„Vitr<strong>in</strong>en-Meere“ erzählen lassen, stand im Mittelpunkt des zweiten<br />
Themenblocks. Die Überlegungen und Praxisbeispiele von Benjam<strong>in</strong> Asmussen<br />
(Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg), Vesa Lepisto (Heureka<br />
- The F<strong>in</strong>nish Science Centre, Hels<strong>in</strong>ki) und Heike Ritter-Eden (Deutsches<br />
Sielhafenmuseum Carol<strong>in</strong>ensiel) führten e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>drucksvolles Spektrum lebendiger<br />
Ausstellungskonzepte vor Augen.
Zum Tagungsabschluss e<strong>in</strong>e Fahrt auf dem 100 Jahre alten Salondampfer<br />
ALEXANDRA. - Begleitfahrt zur Flensburger Rum-Regatta.<br />
Ob Museen überhaupt Objekte brauchen, fragte Asser Amdisen (Museum<br />
Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa) zum Abschluss des Tages.<br />
Auch wenn er sich e<strong>in</strong>er gewissen Aff<strong>in</strong>ität für die d<strong>in</strong>glichen Überlieferungen<br />
nicht gänzlich entziehen konnte, so sprach er sich doch klar dafür aus,<br />
das maritime Museum von se<strong>in</strong>en <strong>Geschichte</strong>n her zu denken, und nicht<br />
von se<strong>in</strong>en Objekten.<br />
Der dritte Tagungstag war den übergeordneten Themen des maritimen<br />
Tourismus und maritimen Erbes gewidmet. Eric van Hooydonk (Watererfgoed<br />
Vlaanderen, Antwerpen) stellte <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er mitreißenden Präsentation<br />
se<strong>in</strong> Konzept der „Soft Values of Sea Ports“ vor. Nachdrücklich legte er dar,<br />
dass Hafenentwicklung nicht bloß unter ökonomischen Gesichtspunkten<br />
betrachtet werden sollte, sondern ganzheitlich von e<strong>in</strong>em stadtplanerischen<br />
Standpunkt aus, der die seewirtschaftlichen Interessen mit soziokulturellen<br />
Aspekten e<strong>in</strong>es modernen Hafen(er)lebens verb<strong>in</strong>det. Berit Johannsen
36<br />
Eric van Hooydonk<br />
stellt die<br />
„Soft Values of<br />
Sea Ports“ vor.<br />
(Staatskanzlei Kiel, Abteilung Kultur und Medien), Peter Danker-Carstensen<br />
(Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Rostock) und Ra<strong>in</strong>er Prüß (Wirtschafts-<br />
und Kulturkonzepte, Flensburg) berichteten von den Chancen und<br />
Schwierigkeiten, die e<strong>in</strong> solcher Entwicklungsprozess mit sich br<strong>in</strong>gt. Wie<br />
e<strong>in</strong> maritimes Museum zum Knotenpunkt e<strong>in</strong>es Netzwerkes verschiedener<br />
maritim-historischer Institutionen werden kann, skizzierte James Steward<br />
(Great Yarmouth Museums) anhand der Entwicklung des Museums Time<br />
& Tide <strong>in</strong> Great Yarmouth und se<strong>in</strong>er leitenden Rolle im Kulturnetzwerk<br />
Maritime Heritage East. Ziel dieser europaweit wohl e<strong>in</strong>maligen Initiative<br />
ist die vernetzte Erschließung des maritimen Erbes e<strong>in</strong>er ganzen Region.<br />
Der letzte Themenblock der Tagung wandte sich den Herausforderungen<br />
bei der Erhaltung und Infahrthaltung historischer Wasserfahrzeuge zu.<br />
Die Statements und Kurzreferate von Eckhard Sch<strong>in</strong>kel (Schiffs-Hebewerk<br />
Henrichenburg, Dortmund), Jes Kroman (Skibsbevar<strong>in</strong>gsfonden), Dörte<br />
Münstermann (Lauenburger Elbschiffahrtsmuseum), Christopher Paperitz<br />
(GSHW) und Ra<strong>in</strong>er Prüß (AGDM) machten deutlich, dass Museen und<br />
private Eigner die Aufgabe der Erhaltung historischer Schiffe langfristig<br />
nur geme<strong>in</strong>sam tragen können, <strong>in</strong>dem e<strong>in</strong> gegenseitiger Wissenstransfer<br />
zwischen historischer Forschung und praktischer Erfahrung stattf<strong>in</strong>det.<br />
Insgesamt war die Tagung von e<strong>in</strong>em lebhaften Austausch gekennzeich-
net. Die Auswahl der beteiligten großen und kle<strong>in</strong>eren Museen sowie privaten<br />
Initiativen hat gezeigt, wie viel zurzeit im maritimen Museumssektor<br />
<strong>in</strong> Bewegung ist. Die Veröffentlichung der Tagungsbeiträge ist <strong>in</strong> Vorbereitung.<br />
Um den angestoßenen Austausch auch <strong>in</strong> Zukunft fortzusetzen,<br />
wollen die Museen <strong>in</strong> Flensburg und Aabenraa nun die Gründung e<strong>in</strong>es<br />
Netzwerkes maritimer Museen anstoßen, das den beteiligten Museen und<br />
anderen Institutionen die Möglichkeit des regelmäßigen Erfahrungsaustauschs<br />
bieten und Kooperationen <strong>in</strong> den Bereichen Sammlung, Forschung<br />
und Ausstellung stärken soll.<br />
Thomas Overdick<br />
37<br />
Die „Flensburger Rum & Zucker Meile“<br />
Die Stadt Flensburg feiert 2009 <strong>in</strong> Er<strong>in</strong>nerung an die Bestätigung des<br />
Stadtrechts von 1284 dieses Ereignis mit e<strong>in</strong>er Reihe von Veranstaltungen.<br />
Hierzu gehört die E<strong>in</strong>weihung des Kulturpfads, „Die Rum & Zucker Meile<br />
– E<strong>in</strong> Rundgang durch die Flensburger Altstadt“ am 1. Mai.<br />
Die Mitte des 18. Jahrhunderts e<strong>in</strong>setzende West<strong>in</strong>dienfahrt erlaubte es<br />
den Flensburger Kaufleuten und Reedern, sich am lukrativen Zuckerhandel<br />
mit den dänisch-west<strong>in</strong>dischen Inseln zu beteiligen. Es gelang ihnen trotz<br />
anfänglicher Rückschläge, e<strong>in</strong>en bedeutenden Anteil an der Entwicklung<br />
und dem Aufbau der Zucker<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong> den Herzogtümern <strong>Schleswig</strong> und<br />
Holste<strong>in</strong> sowie im Dänischen Gesamtstaat zu erzielen.<br />
Dieser Überseehandel sowie die Verarbeitung des aus dem Zuckerrohr<br />
gewonnenen wertvollen Rohstoffs, dem Rohrzucker, lagen <strong>in</strong> Flensburg <strong>in</strong><br />
den Händen e<strong>in</strong>iger Familien, die, oft durch Heirat mite<strong>in</strong>ander verwandt,<br />
geme<strong>in</strong>sam ihren Wohlstand mehrten und die Gew<strong>in</strong>ne <strong>in</strong> die Zuckerraff<strong>in</strong>erien,<br />
ihre Manufakturen und Schiffsflotten <strong>in</strong>vestierten. An der Spitze<br />
dieser Handelshäuser standen die Familiendynastien der Christiansen, der<br />
Petersen Schmidt und der Jensen; manchmal bis <strong>in</strong> die 3. Generation.<br />
Ihre Häuser und Hofanlagen sowie die gewaltigen Speicher gehörten zu<br />
den ansehnlichsten Bauten dieser Hafenstadt. Ihre Architektur und gepflegte<br />
Wohnkultur spiegelten den Stolz dieser „Zuckerbarone“ wider. Bis<br />
heute prägen sie die Altstadt Flensburgs. Man kann sie dort <strong>in</strong> den Straßenzügen<br />
entlang der Fußgängerzone zwischen Nordertor und Südermarkt<br />
entdecken und etwas von ihrer e<strong>in</strong>stigen Nutzung und historischen Bedeutung<br />
erfahren.
38<br />
West<strong>in</strong>dienspeicher<br />
Große Straße 24.<br />
Hier <strong>in</strong> der Altstadt befanden sich ebenfalls die Rumhäuser. In den besten<br />
Zeiten der Produktion um 1930 zählte man etwa 30 Firmen. Die Anfänge<br />
der Veredelung dieser hochprozentigen Spirituose ist ebenso e<strong>in</strong>e Erfolgsgeschichte<br />
für Flensburg. Auch sie hat ihre Ursprünge wie der Zuckerhandel<br />
<strong>in</strong> der West<strong>in</strong>dienfahrt. Insbesondere im 19. Jahrhundert setzten viele<br />
Branntwe<strong>in</strong>brenner auf diesen Rohstoff aus der Karibik und entwickelten<br />
daraus Markenfabrikate wie die der berühmten Rumhäuser Sonnberg, Pott<br />
und Hansen sowie Dethleffsen. Während der heimische Rübenzucker bereits<br />
ab der Mitte des 19. Jahrhunderts den Rohrzucker aus den Tropen verdrängte,<br />
wuchs die Flensburger Rum<strong>in</strong>dustrie zunehmend und belieferte<br />
noch gegen Ende des letzten Jahrhunderts mit ihren Spitzenprodukten den<br />
europäischen Spirituosenmarkt.
39<br />
Rumhaus Johannsen<br />
<strong>in</strong> der Marienstraße.<br />
Auch wenn die Anlage neuer Straßen ganze Schneisen <strong>in</strong> das charakteristische<br />
Geflecht der alten Kaufmannshöfe schlug, ist diese e<strong>in</strong>stige Blütezeit<br />
des West<strong>in</strong>dienhandels im heutigen Stadtbild noch klar zu erkennen – e<strong>in</strong><br />
stadthistorisches Kulturerbe ohnegleichen!<br />
Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Plantagenbewirtschaftung<br />
fernab von Flensburg – <strong>in</strong> den europäischen Kolonien Mittelamerikas, so<br />
auch <strong>in</strong> Dänisch-West<strong>in</strong>dien – bis weit <strong>in</strong>s 19. Jahrhundert Millionen von<br />
verschleppten schwarzen Sklaven aus Westafrika geschuldet war.<br />
Über die 20 Stationen der „Rum & Zucker Meile“ <strong>in</strong>formieren e<strong>in</strong> Faltblatt<br />
und e<strong>in</strong>e Broschüre <strong>in</strong> deutscher und dänischer Sprache. Die jeweiligen<br />
Gebäude s<strong>in</strong>d mit e<strong>in</strong>em H<strong>in</strong>weisschild versehen.<br />
Jutta Glüs<strong>in</strong>g
40<br />
Projekt Flussgeschichte:<br />
Die Stadt, die Trave und das Wasser<br />
Für alle, die <strong>in</strong> Lübeck geboren oder aufgewachsen und wohnhaft s<strong>in</strong>d,<br />
ist die Trave e<strong>in</strong> allgegenwärtiger Anblick. Und wer häufiger die Strecke<br />
zwischen Lübeck und Bad Oldesloe fährt, für den ist das Travetal <strong>in</strong> allen<br />
Jahreszeiten e<strong>in</strong> alltäglicher Begleiter. In bestimmten Wetterlagen schwebt<br />
weißer Nebel über dem Wasser und zeichnet die Flussw<strong>in</strong>dungen nach, bei<br />
Hochwasser gleicht das ganze Tal mit se<strong>in</strong>en Niederungen e<strong>in</strong>em See und<br />
bei Sonnensche<strong>in</strong> glitzert das Wasser, <strong>in</strong> dem sich Wasserpflanzen wiegen<br />
- die Schönheit des Flusses war e<strong>in</strong> ganz persönlicher Anlass sich mit se<strong>in</strong>er<br />
<strong>Geschichte</strong> zu befassen, ihm mehr zu entlocken, als se<strong>in</strong> Augensche<strong>in</strong><br />
verrät.<br />
Wo immer e<strong>in</strong> Besucher die Oldesloer Altstadt, die allseitig von der Trave<br />
umflossen wird und damit e<strong>in</strong>er Insel gleicht, betritt, muss er e<strong>in</strong>e Brücke<br />
überqueren. So s<strong>in</strong>d die Trave und die <strong>in</strong> sie mündende Beste im Stadtbild<br />
bis heute unübersehbar präsent. E<strong>in</strong>e sanierte Wassermühle mit e<strong>in</strong>em hölzernen<br />
Mühlrad gehört zu den markantesten Gebäuden der Altstadt und<br />
e<strong>in</strong>e Sohlgleite, die als Ersatz für e<strong>in</strong> den Fischzug hemmendes Stauwehr<br />
2002 angelegt wurde, war und ist wegen ihrer Kosten und e<strong>in</strong>er befürchteten<br />
erhöhten Hochwassergefahr e<strong>in</strong> umstrittenes Bauvorhaben. Die Stadt<br />
selbst wählte zu ihrem „Logo“ e<strong>in</strong>e dreifache Welle und den Schriftzug „Die<br />
Beste Trave Stadt“ und unterstreicht damit ihren Wunsch, sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
zukünftigen Market<strong>in</strong>gkonzept mit dem Wasser identifizieren zu lassen.<br />
„Wasser“ ist also e<strong>in</strong> Thema <strong>in</strong> der Stadt Oldesloe.<br />
Doch nicht nur im Stadtbild, sondern auch <strong>in</strong> den Akten des Stadtarchivs<br />
ist das Wasser, s<strong>in</strong>d die Flüsse, nicht zu übersehen. Travefahrt und Mühlen,<br />
Gewerbezulassungen, Wasserlösungssachen, Wasserverschmutzung, Cholera,<br />
Wasserturm und Wasserwerk, Ertrunkene und Rettungsanstalten,<br />
Badevergnügen im Freibad, Hochwasser, Flussregulierungen und –renaturierungen<br />
s<strong>in</strong>d nur e<strong>in</strong>ige Stichworte. Und wenn im großen Bestand der<br />
Justizakten Menschen im 18. und frühen 19. Jahrhundert beschreiben, was<br />
sie gerade taten, als das zu untersuchende Ereignis stattfand, so s<strong>in</strong>d sie oft<br />
am Wasser beschäftigt: sie tränken Pferde, schöpfen Wasser, durchqueren<br />
e<strong>in</strong>e Furt, angeln, baden oder befahren die Flüsse mit ihren Booten. Nicht<br />
selten verunglücken Menschen und kont<strong>in</strong>uierlich streiten sie sich um die<br />
Ressource Wasser. So s<strong>in</strong>d die Flüsse, ist das Wasser, <strong>in</strong> fast allen Beständen<br />
greifbar.<br />
Dies zusammen – Wahrnehmung und Quellenstudien – richteten das<br />
Forschungs<strong>in</strong>teresse wie zwei Kompassnadeln auf den Magneten „Wasser“<br />
aus, und die Idee war geboren, aus der Fülle des historischen Materials e<strong>in</strong>e
Julius Gottheil, Stahlstich, 1864 gedruckt bei Uflacker <strong>in</strong> Altona, zeigt<br />
die Lage der Stadt an e<strong>in</strong>er Traveschleife, zu erkennen ist e<strong>in</strong> Traveboot<br />
mit Last und die Lohmühle.<br />
neue Sicht auf die Stadt Oldesloe und ihre <strong>Geschichte</strong> herauszuarbeiten.<br />
Nicht e<strong>in</strong>e chronologisch angelegte „Universalgeschichte“ war das Ziel,<br />
sondern e<strong>in</strong>e, die das „Wasser“ zum entscheidenden Entwicklungsfaktor<br />
macht und dabei e<strong>in</strong>e Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte der Stadt<br />
schreibt, <strong>in</strong> der die Menschen zu Wort kommen und bisher Unbekanntes<br />
entdeckt bzw. <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en umfassenden Zusammenhang e<strong>in</strong>gebettet wird. Das<br />
Wasser wird damit – <strong>in</strong> Anlehnung an die lange Wassermühlentradition<br />
Oldesloes – zur „Antriebsenergie“ der Stadtgeschichte.<br />
Flussgeschichten haben seit geraumer Zeit Konjunktur. Über die Isar,<br />
den Rhe<strong>in</strong>, Ma<strong>in</strong>, die Donau, die Weser, die Saar und die Elbe – um nur e<strong>in</strong>ige<br />
zu nennen – s<strong>in</strong>d „Flussbiographien“ und „Flussgeschichten“ geschrieben<br />
worden, die die vielfältigen Nutzungen des Wassers und die daraus<br />
resultierenden anthropogenen E<strong>in</strong>griffe behandeln. Oftmals werden diese<br />
E<strong>in</strong>griffe als „Kampf“ gegen und „Zähmung“ des Wassers aufgefasst. David<br />
Blackbourn hat <strong>in</strong> „Conquest of nature“ (2006) die Bändigung des Wassers<br />
zu e<strong>in</strong>er der Grundbed<strong>in</strong>gungen des politischen und wirtschaftlichen Aufstiegs<br />
Deutschlands seit dem 18. Jahrhundert erklärt. Norbert Fischer hat<br />
den Deichbau und damit den Kampf gegen die Nordseefluten als konstitu-
42<br />
Die Sohlgleite <strong>in</strong> der Trave im Stadtgebiet Bad Oldesloe.<br />
tiv für die Gesellschaften der Elbmarschen (2003 und 2007) beschrieben.<br />
Unübersehbar ist die Literatur, die sich mit der Flussverschmutzung durch<br />
Gewerbe und Industrie beschäftigt oder den Kampf um sauberes Wasser<br />
im Zuge der kommunalen Assanierung im 19. und frühen 20. Jh. aufarbeitet.<br />
Seit dem Ausgang des 20. Jh. hat sich der Umgang mit vielen Flüssen<br />
grundlegend gewandelt. Sie werden nicht mehr als Wasserstraßen genutzt,<br />
nicht mehr zum Hochwasserschutz begradigt – neue Konzepte, neue Nutzungen<br />
vor allem im Freizeitbereich und <strong>in</strong> der Ökologie, ermöglichen e<strong>in</strong><br />
neues Flussideal: an die Stelle des geraden, regulierten Laufs tritt das Ideal<br />
des „natürlichen“ Flusses, dem man se<strong>in</strong>e Krümmungen und W<strong>in</strong>dungen<br />
wiedergibt.<br />
All diese Facetten und damit die herausragende Bedeutung des Wassers<br />
wurden schließlich zur konzeptionellen Basis für e<strong>in</strong>e Untersuchung über<br />
Oldesloe – die Stadt, die Trave und das Wasser . Über die Quellen aus dem<br />
Stadtarchiv h<strong>in</strong>aus, geht es nun um e<strong>in</strong>e Erweiterung des Blickes: Bestände<br />
aus dem Stadtarchiv Lübeck, dem Landesarchiv <strong>in</strong> <strong>Schleswig</strong>, dem Gehei-
men Staatsarchiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>, dem Kreisarchiv<br />
Stormarn und des Kirchenkreisarchiv Segeberg sowie Akten aus dem<br />
Staatlichen Umweltamt Itzehoe und der Landesbibliothek Eut<strong>in</strong> wurden<br />
durchgesehen.<br />
Um das umfangreiche Material zu strukturieren, ist es <strong>in</strong> zwölf Kapitel<br />
gegliedert. Jedes Kapitel lässt sich als eigenständige E<strong>in</strong>heit lesen. Gleichzeitig<br />
ist durchaus e<strong>in</strong> chronologischer Ablauf gewährleistet, denn die unterschiedlichen<br />
Nutzungen variieren im Laufe der Jahrhunderte, d. h. die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Kapitel setzen kont<strong>in</strong>uierlich immer später e<strong>in</strong>: ist die Stadtgründung<br />
e<strong>in</strong> Phänomen des Mittelalters, so s<strong>in</strong>d die Travefahrt, die Schifffahrt,<br />
das vor<strong>in</strong>dustrielle Gewerbe und die Müllerei e<strong>in</strong>es der Frühen Neuzeit.<br />
Alle diese Nutzungen enden um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Danach<br />
beg<strong>in</strong>nt die Industrialisierung, <strong>in</strong> ihrem Gefolge die Stadtsanierung. Die<br />
Regulierung der Flüsse, die Hochwasser und schließlich die Renaturierung<br />
s<strong>in</strong>d im 20. und 21. Jahrhundert zu verorten.<br />
Der Fluss wird als historisch betrachtet, als Ort kont<strong>in</strong>uierlichen Wandels,<br />
sei er geologisch-geographischer Natur oder als Folge anthropogener<br />
E<strong>in</strong>griffe. Gleichzeitig wird die Trave als Gegenstand politisch-territorialer<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzungen vor allem zwischen Lübeck und Holste<strong>in</strong> beschrieben.<br />
Erst vor diesem H<strong>in</strong>tergrund werden die andauernden Mühen um e<strong>in</strong>en<br />
nutzbaren Fluss (Begradigungen, Auskrautungen) und die Konflikte<br />
der Oldesloer und Lübecker Traveschiffer und Fischer um die Nutzung des<br />
Flusses als Schifffahrtsweg und als Fischfanggrund erklärlich.<br />
E<strong>in</strong> entscheidender Aspekt für mittelalterliche Stadtgründungen war die<br />
den Flüssen und ihren sumpfigen Niederungen zukommende Schutzfunktion,<br />
die seit dem 19. Jahrhundert wiederum zu e<strong>in</strong>er wasserbestimmten<br />
E<strong>in</strong>grenzung der Stadt. Mit dem Bau der Eisenbahn verschoben sich die<br />
Kommunikationsströme <strong>in</strong> der Stadt, wuchs sie über ihren alten Inselkern<br />
heraus.<br />
Von Bedeutung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diesem Zusammenhang natürlich die an das<br />
Wasser gebundenen Berufe: Schiffer, Fischer, Müller, aber auch Gerber,<br />
Färber, Brauer, Bleicher sowie die kochenden und waschenden Hausfrauen.<br />
Sie alle nutzten den Fluss. Die Müller griffen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>en Lauf mit Stauungen<br />
und dem Bau von Mühlgraben am sichtbarsten e<strong>in</strong>: sie versuchten den Fluss<br />
ihren Bedürfnissen anzupassen, während die Gewerbetreibenden die Trave<br />
vornehmlich als Produktionsmittel und als Schmutzableiter nutzten. Die<br />
unterschiedlichen Ansprüche dabei und die daraus resultierenden Konflikte<br />
s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> wesentlicher Bestandteil der Untersuchung.<br />
Mit dem Wasser verbunden s<strong>in</strong>d die Moore, die Oldesloe umgaben. Sie<br />
waren Schutz, sie waren e<strong>in</strong> Kommunikationshemmnis, sie versorgten die<br />
Sal<strong>in</strong>e und die Stadt mit Brennmaterial und – als diese wirtschaftliche Bedeutung<br />
verschwand – wurden sie die erste Landschaft Oldesloes, die unter<br />
43
44<br />
dem Aspekt des Naturschutzes schon zu Beg<strong>in</strong>n des 20. Jahrhunderts betrachtet<br />
wurde. Hier zeichnet sich der Nutzungs- und Bedeutungswandel<br />
der Trave <strong>in</strong> dem neuen „romantischen“ Blick auf die „Wasserlandschaft“<br />
Moor ab.<br />
Von zentraler Bedeutung ist die Frage der Wasserverschmutzung und<br />
der Stadthygiene. Sie setzten mit der Industrialisierung e<strong>in</strong> und diskutieren<br />
die vielfältigen Nutzungskonflikte um das Wasser und ihre möglichen Lösungsstrategien:<br />
Bedürfnisse der Industrie – hier vor allem der Papierfabrik<br />
und der Zuckerrübenfabrik – nach ungebremster Ableitung ihrer Abwässer<br />
und der E<strong>in</strong>wohnerschaft und deren Anspruch auf sauberes Tr<strong>in</strong>kwasser.<br />
Nicht nur im Küstenbereich ist das Thema Hochwasser im kollektiven<br />
Gedächtnis verankert, bei den Oldesloern wird es mit der Trave und der<br />
Beste verknüpft. Schutzmaßnahmen wurden im Interesse der Landwirtschaft<br />
durchgeführt und veränderten das Bild des Flusses wie ke<strong>in</strong>e Maßnahme<br />
zuvor. Schließlich darf nicht vergessen werden, dass der Fluss e<strong>in</strong><br />
Ort der Freizeit und des Vergnügens ebenso wie des Todes war und ist.<br />
Neben der Entdeckung der „anmutigen Travelandschaft“ zu Beg<strong>in</strong>n des<br />
19. Jahrhunderts war es der Oldesloer Kurbetrieb um die Wende vom 19.<br />
auf das 20. Jahrhundert, der den Fluss als Ort des Vergnügens beförderte:<br />
Baden und Bootfahren stehen hierfür.<br />
Mit dem Ende der Traveschifffahrt, der Stilllegung der Mühlen, veränderten<br />
Nutzungsansprüchen der Landwirtschaft und der stetig verbesserten<br />
Abwasserklärung konnte die Trave Ende des 20. Jahrhunderts neuen Nutzungsansprüchen<br />
geöffnet werden: Naturschutz und Ökologie bestimmen<br />
nun die Diskussion um und die Gestalt des Flusses entscheidend mit. So<br />
beschreibt die Flussgeschichte <strong>in</strong>sgesamt die Wassernutzung, die sich <strong>in</strong><br />
Oldesloe von e<strong>in</strong>er „Lebensader“ der kommunalen Wirtschaft zu e<strong>in</strong>em<br />
Freizeit- und Stadtmarket<strong>in</strong>gfaktor wandelte.<br />
Sylv<strong>in</strong>a Zander
H<strong>in</strong>weise<br />
E<strong>in</strong>ladung zu Vorträgen <strong>in</strong> Kiel<br />
Die Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong> veranstaltet geme<strong>in</strong>sam<br />
mit der <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ischen Landesbibliothek im W<strong>in</strong>terhalbjahr<br />
2009/2010 wieder Vorträge über ausgewählte Themen der <strong>Geschichte</strong><br />
<strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>s. Die Mitglieder der Geschichtsgesellschaft,<br />
aber auch Gäste s<strong>in</strong>d dazu herzlich e<strong>in</strong>geladen.<br />
Dienstag, 20. Oktober 2009<br />
Dr. Ralf Wiechmann<br />
Haithabu und das Geld der Wik<strong>in</strong>ger<br />
Dienstag, 10. November 2009<br />
Prof. Dr. Peter Wulf<br />
Hochzeit <strong>in</strong> besseren Kreisen – die Ehe des Grafen Otto Blome, Salzau,<br />
mit der Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> Clement<strong>in</strong>e Bagration, Paris<br />
Dienstag, 26. Januar 2010<br />
Hans-Günther Andresen<br />
An R<strong>in</strong>gstraße und Königsweg – Großstädtische Anfänge und Umbrüche<br />
<strong>in</strong> der südlichen Kieler Innenstadt<br />
Dienstag, 23. Februar 2010<br />
Nils H<strong>in</strong>richsen<br />
Benennungen nach H<strong>in</strong>denburg <strong>in</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>:<br />
Drei Fallbeispiele aus Kaiserzeit, Weimarer Republik und „Drittem Reich“<br />
Dienstag, 23. März 2010<br />
Prof. Dr. Oliver Auge<br />
Mord, Gefangennahme, Erpressung – andere Spielregeln der Politik<br />
im schleswig-holste<strong>in</strong>ischen Mittelalter<br />
Alle Vorträge beg<strong>in</strong>nen um 19.30 Uhr<br />
<strong>in</strong> der <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ischen Landesbibliothek<br />
<strong>in</strong> Kiel, Wall 47/51 (Sartori & Berger-Speicher).<br />
Der E<strong>in</strong>tritt ist frei.
46<br />
Handel, Geld und Politik vom frühen Mittelalter bis heute<br />
In dieser Vortragsreihe vertiefen herausragende Fachleute unser Verständnis<br />
von dem, was unsere Gesellschaft im Kern entscheidend prägt – das<br />
Geld und se<strong>in</strong>e Wertb<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> der Zeit. Im Anschluss an ihre Vorträge<br />
stehen die Referenten zur Diskussion und Beantwortung von Fragen zur<br />
Verfügung.<br />
27. Oktober 2009<br />
Dr. Stefanie Rüther, Münster<br />
Der Krieg, die Bürger und das Geld. Spätmittelalterliche Kriegführung<br />
zwischen Ru<strong>in</strong> und Profit.<br />
24. November 2009<br />
Prof. Dr. Mart<strong>in</strong> Krieger, Kiel<br />
Unter dem Danebrog nach Ost<strong>in</strong>dien. Handel und kultureller Austausch<br />
zwischen dem Ostseeraum und dem Indischen Ozean.<br />
15. Dezember 2009<br />
Dr. Raoul Zühlke, Münster<br />
Knotenpunkt Lübeck? – Die Wege von Menschen, Waren und Nachrichten<br />
im Ostseeraum um 1300.<br />
26. Januar 2010<br />
Prof. Dr. Stuart Jenks, Erlangen<br />
Banken und F<strong>in</strong>anzkrisen 1154-2009.<br />
23. Februar 2010<br />
Günther Bock, Großhansdorf<br />
Stadt und Umland: Lübeck und Stormarn im 13. und 14. Jahrhundert.<br />
30. März 2010<br />
Prof. Dr. Stephan Selzer, Hamburg<br />
Wer kaufte die Waren des hansischen Handels? Farbige Stoffe im Mittelalter<br />
und ihre Käufer.<br />
Alle Vorträge beg<strong>in</strong>nen um 20.00 Uhr, sie f<strong>in</strong>den im Kapitelsaal oder im<br />
Vortragssaal des Burgklosters zu Lübeck statt, H<strong>in</strong>ter der Burg 2-6, 23552<br />
Lübeck<br />
E<strong>in</strong>tritt für Erwachsene: 2,50 €,<br />
Schüler und andere Jugendliche bis 18 Jahre haben freien E<strong>in</strong>tritt.
<strong>Schleswig</strong>sche Gespräche<br />
Deutsch-dänische Begegnungen<br />
47<br />
Montag, 2. November 2009<br />
Carsten Mish M.A., Kiel<br />
Grenzlandforschung – Nordschleswig im Fokus der Kieler<br />
Landeshistoriker um Otto Scheel, 1920-1945<br />
DK-6200 Aabenraa, „Haus Nordschleswig“, Vestergade 30<br />
Montag, 30. November 2009<br />
Prof. Dr. Oliver Auge, Kiel<br />
Herr über <strong>Schleswig</strong> und Holste<strong>in</strong>: Zum 550. Todestag<br />
des letzten Schauenburgers Adolf VIII.<br />
D-24937 Flensburg, Deutsches Haus, „Merz-Zimmer“, Friedrich-Ebert-Str. 7<br />
Montag, 1. Februar 2010<br />
Mart<strong>in</strong> Bo Nørregård, cand. mag., Flensburg<br />
Dänische Südschleswiger <strong>in</strong> deutschem Kriegsdienst 1939 - 1945<br />
D-24937 Flensburg, Deutsches Haus, „Merz-Zimmer“, Friedrich-Ebert-Str. 7<br />
Montag, 8. März 2010<br />
Prof. Dr. Mart<strong>in</strong> Krieger, Kiel<br />
Dänemarks unbekannte koloniale Vergangenheit: Trankebar<br />
DK-6200 Aabenraa, „Haus Nordschleswig“, Vestergade 30<br />
Die Vorträge f<strong>in</strong>den an wechselnden Orten statt und beg<strong>in</strong>nen jeweils<br />
um 19.30 Uhr<br />
Antrittsvorlesungen am 3. Februar 2010<br />
im Audimax der CAU Kiel, Hörsaal A, 16-18 Uhr<br />
Prof. Dr. Oliver Auge, Lehrstuhl für Regionalgeschichte:<br />
Mord, Gefangennahme, Erpressung – Andere Spielregeln<br />
der Politik im schleswig-holste<strong>in</strong>ischen Mittelalter?<br />
Prof. Dr. Mart<strong>in</strong> Krieger, Lehrstuhl für Nordische <strong>Geschichte</strong>:<br />
Nathaniel Wallich: E<strong>in</strong>e dänische Karriere<br />
zwischen Kopenhagen und Kalkutta um 1800
48<br />
Ehrenkolloquium für Prof. Dr. Manfred Jessen-Kl<strong>in</strong>genberg<br />
Die Universität Flensburg, Institut für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische Zeit- und<br />
Regionalgeschichte, veranstaltet zur Er<strong>in</strong>nerung an Prof. Dr. Manfred<br />
Jessen-Kl<strong>in</strong>genberg e<strong>in</strong> regionalhistorisches Kolloquium.<br />
Freitag, 20. November 2009, 15.00 – 17.00 Uhr<br />
Vortragssaal des Landesarchivs <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>, Pr<strong>in</strong>zenpalais,<br />
24837 <strong>Schleswig</strong><br />
Prof. Dr. Reimer Hansen<br />
Würdigung des wissenschaftlichen Lebenswerkes<br />
von Prof. Dr. Jessen-Kl<strong>in</strong>genberg<br />
Prof. Dr. Uwe Danker<br />
Würdigung des Menschen Manfred Jessen-Kl<strong>in</strong>genberg<br />
Dr. Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt<br />
Paradigmenwechsel <strong>in</strong> der schleswig-holste<strong>in</strong>ischen Landesgeschichtsforschung<br />
und Geschichtsvermittlung seit 1945<br />
Podiumsdiskussion<br />
Prof. Dr. Reimer Hansen, Prof. Dr. Reimer Witt, Prof. Dr. Detlev Kraack,<br />
Dr. Klaus Bästle<strong>in</strong>, Prof. Dr. Karl-He<strong>in</strong>rich Pohl, Dr. Lars Henn<strong>in</strong>gsen<br />
Moderation: Prof. Dr. Robert Bohn<br />
Ripen 1460:<br />
550 Jahre politische Partizipation <strong>in</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>?<br />
Tagung im Landeskulturzentrum Salzau, 24256 Salzau<br />
Freitag 5. bis Sonntag 7. März 2010<br />
„… dat se bliven up ewich tosammende ungedeelt.“ Wohl kaum e<strong>in</strong>e Redewendung<br />
ist <strong>in</strong> der schleswig-holste<strong>in</strong>ischen <strong>Geschichte</strong> so bekannt und<br />
häufig zitiert wie diese aus der Ripener Handfeste von 1460. Das 550-<br />
jährige Bestehen dieses Vertrages, <strong>in</strong> dem der dänische König Christian<br />
I. mit den Ständen <strong>Schleswig</strong>s und Holste<strong>in</strong>s übere<strong>in</strong>kam, die Regierung<br />
zu übernehmen, bietet den Anlass, nach dem Verhältnis zwischen Ständen<br />
und Fürsten im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen <strong>Schleswig</strong> und<br />
Holste<strong>in</strong> zu fragen. Da die Übere<strong>in</strong>kunft zwischen Landesherr und Ständen<br />
freilich ke<strong>in</strong> orig<strong>in</strong>är schleswig-holste<strong>in</strong>ischer Akt ist, vielmehr bereits
im mittelalterlichen Europa sich allerorts der Adel von den Fürsten zur Friedenswahrung<br />
und Rechtspflege, später vor allem bei Steuer- und F<strong>in</strong>anzfragen<br />
Mitspracherechte ausbedang, tritt deshalb neben der landesgeschichtlichen<br />
Dimension auch der Vergleich mit anderen Territorien des Reiches<br />
und auch europäischer Nachbarstaaten <strong>in</strong> den Fokus der Betrachtungen. So<br />
sollen Parallelen, aber auch Unterschiede der politischen Partizipation im<br />
Übergang der Epochen analysiert und verdeutlicht werden.<br />
Der Kieler Lehrstuhl für Regionalgeschichte lädt hierzu alle an der spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen<br />
Verfassungsgeschichte sowie an der Regional-<br />
und Landesgeschichte Interessierten zur Tagungsteilnahme e<strong>in</strong>.<br />
Für Rückfragen steht Herr Burkhard Büs<strong>in</strong>g, Historisches Sem<strong>in</strong>ar der<br />
Christian-Albrechts-Universität, Leibnizstraße 8, 24098 Kiel, Tel. 0431/880-<br />
3647, e-Mail: b.bues<strong>in</strong>g@email.uni-kiel.de zur Verfügung. Anmeldungen<br />
werden erbeten bis Mittwoch, 17.02.2010 an die gleiche Adresse.<br />
49<br />
Vorläufiges Programm<br />
Freitag 5. März<br />
13.00-13.15 Uhr: Prof. Dr. Oliver Auge, Kiel<br />
Begrüßung<br />
13.15-14.00 Uhr: Prof. Dr. Kersten Krüger, Rostock<br />
Die landständische Verfassung im europäischen Vergleich<br />
14.00-14.45 Uhr: Associate Prof Carsten Jahnke, Kopenhagen<br />
Die Anomalie des Normalen. Die Ripener Handfeste und das „dat se<br />
bliven up ewich tosammende ungedeelt“<br />
Kaffeepause<br />
15.15-16.00 Uhr: Prof. Dr. Detlev Kraack, Plön<br />
Von den „kle<strong>in</strong>en Krautern“ und großen Herren. Der nordelbische<br />
Adel vor 1460<br />
16.00-16.45 Uhr: Mikkel Leth Jespersen, Flensburg<br />
Die politische Partizipation der Ritterschaft im frühneuzeitlichen<br />
<strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong><br />
16.45-17.30 Uhr: Prof. Dr. Oliver Auge, Kiel<br />
Zur Rolle von Klerus und Städten auf den schleswigholste<strong>in</strong>ischen<br />
Landtagen bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts
50<br />
Pause / Abendessen<br />
19.00 Uhr: Grußwort M<strong>in</strong>isterpräsident Peter Harry Carstensen<br />
Grußwort Dänischer Botschafter, S. E. Carsten Søndergaard<br />
Grußwort Präsident CAU: Prof. Dr. Gerhard Fouquet<br />
Grußwort der schleswig-holste<strong>in</strong>ischen Ritterschaft:<br />
Hubertus Graf von Luckner<br />
Abendvortrag: Prof. Dr. Werner Paravic<strong>in</strong>i, Kiel<br />
E<strong>in</strong> Objekt beg<strong>in</strong>nt zu sprechen: Die Privilegienlade der schleswigholste<strong>in</strong>ischen<br />
Ritterschaft vom Anfang des 16. Jahrhunderts<br />
Sonnabend 6. März<br />
9.00-9.45 Uhr: Prof. Dr. Thomas Riis, Kiel<br />
Der Reichsrat <strong>in</strong> Dänemark und Norwegen ca. 1380-1460. Partner und<br />
Gegenspieler des Königs<br />
9.45-10.30Uhr: Prof. Dr. Mart<strong>in</strong> Krieger, Kiel<br />
Ständische Partizipation im frühneuzeitlichen Dänemark<br />
Kaffeepause<br />
11.00-11.45 Uhr: Prof. Dr. Jens E. Olesen, Greifswald<br />
Ständische Partizipation im mittelalterlichen/frühneuzeitlichen<br />
Schweden<br />
11.45-12.30 Uhr: Prof. Dr. Olaf Mörke, Kiel<br />
’Declaration of Abroath‘ (1320), ’Blijde Inkomst’ (1356), ’Groot<br />
Privilege’ (14<strong>77</strong>): Spätmittelalterliche Politikvere<strong>in</strong>barungen und ihre<br />
(früh-) neuzeitliche Wirkungsgeschichte<br />
Mittagspause<br />
14.30-15.15 Uhr: Dr. Axel Metz, Wesel<br />
„In ansehung des, daz wir [ytz zumal] alls römischer künig ir her se<strong>in</strong>“<br />
Königtum und Landstände an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit<br />
– E<strong>in</strong>e Annäherung<br />
15.15-16.00 Uhr: Dr. Sebastian Joost, Rostock<br />
Von der Beratung zur Mitsprache – Etappen landständischer<br />
E<strong>in</strong>flussnahme <strong>in</strong> Mecklenburg im 15. und 16. Jahrhundert
Kaffepause<br />
16.30-17.15 Uhr: Dr. Ralf-Gunnar Werlich, Greifswald<br />
Zur Genese ständischer Partizipation an der Herrschaftsausübung<br />
im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Pommern<br />
51<br />
17.15-18.00 Uhr: Prof. Dr. Sönke Lorenz, Tüb<strong>in</strong>gen<br />
Teilung, Wiedervere<strong>in</strong>igung und Erhebung zum Herzogtum<br />
(1442-1495): Württembergs Stände erwachen<br />
Pause/ Abendessen<br />
19.30-20.15 Uhr: Prof. Dr. Ra<strong>in</strong>er Her<strong>in</strong>g, <strong>Schleswig</strong><br />
Von der Urkunde zur Email. Herausforderungen an Archive und<br />
historische Hilfswissenschaften<br />
Sonntag 7. März<br />
8.30-9.15 Uhr: Tim Neu, M.A., Münster<br />
Von ständischer Vielfalt zu verfasster E<strong>in</strong>heit.<br />
Zum Konstruktionscharakter landständischer Herrschaftspartizipation<br />
am Beispiel der Landgrafschaft Hessen<br />
9.15-10.00 Uhr: Dr. Christoph Volkmar, Wernigerode<br />
Territoriale Funktionseliten? Ständebildung und politische Partizipation<br />
im Machtbereich der Wett<strong>in</strong>er<br />
Kaffeepause<br />
10.30-11.15 Uhr: Prof. Dr. Joachim Schneider, Ma<strong>in</strong>z<br />
Die politische Rolle der Ritterschaft <strong>in</strong> Franken und Alt-Bayern um<br />
1500 – Vergleichende Perspektiven!<br />
Pause<br />
11.30-13.00 Uhr: PD Dr. Harm von Seggern, Kiel<br />
Tagungszusammenfassung und Abschlussdiskussion<br />
Mittagessen und Tagungsende
Suche – Biete<br />
Biete<br />
Zeitschrift der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong><br />
(ZSHG)<br />
Bde. 53 - 63 (1923-1935) und Bde. 65 (1937), 68 - 69 (1940-1941).<br />
Die Heimat. Monatschrift des Vere<strong>in</strong>s zur Pflege der Natur- und Landeskunde<br />
<strong>in</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>, Hamburg und Lübeck<br />
Vollständige Jahrgänge: 1891 - 1895, 1904, 1907, 1908, 1910 - 1920,<br />
1922, 1924 - 1926, 1928 - 1932, 1935 - 1942, 1949 - 1953.<br />
Jahrgänge, bei denen jeweils Heft 1 (von 12) fehlt: 1896, 1897, 1898,<br />
1905, 1906, 1909, 1923, 1933, 1934, 1955.<br />
Vom Jahrgang 1921 fehlen 9 Hefte (von 12); vom Jahrgang 1927 fehlen 2<br />
Hefte (von 12).<br />
Nordelb<strong>in</strong>gen. Beiträge zur Heimatforschung <strong>in</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>,<br />
Hamburg und Lübeck<br />
Bd. 8 (1930/31), 565 S. (es fehlen die Seiten 257 - 262).<br />
Bd. 9 (1932 - 1934, 504 S.<br />
Günther Röstermundt, Akazienweg 14, 31832 Spr<strong>in</strong>ge,<br />
Tel.: 0 50 41 - 8 13 81
<strong>Mitteilungen</strong> des Vorstands<br />
Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung der<br />
Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong><br />
auf Schloss Plön am 11. Juli 2009<br />
Das Programm der diesjährigen Mitgliederversammlung hatte außergewöhnlich<br />
viele unserer Mitglieder angelockt, denn es wurde mit e<strong>in</strong>er Führung<br />
durch Schloss Plön, das heute die Fielmann Akademie beherbergt,<br />
eröffnet. Trotz sommerlicher Hitze war die Besichtigung der prachtvollen<br />
historischen Räume und modernen Ausbildungse<strong>in</strong>richtungen für Augenoptiker<br />
sehr bee<strong>in</strong>druckend und <strong>in</strong>teressant. Anschließend konnte man sich<br />
bei kühlen Getränken, Kaffee, Tee und Kuchen erfrischen.<br />
Schloss Plön –<br />
Schauplatz der<br />
Mitgliederversammlung<br />
2009
54<br />
Begrüßung durch den Vorsitzenden<br />
Auf allgeme<strong>in</strong>en Wunsch h<strong>in</strong> begann die Mitgliederversammlung etwas<br />
früher. Um 15.50 Uhr eröffnete der Vorsitzende Jörg-Dietrich Kamischke<br />
die Versammlung und begrüßte die Anwesenden. Er dankte Herrn Professor<br />
Fielmann für se<strong>in</strong>e Bereitschaft, Schloss Plön der Geschichtsgesellschaft<br />
für ihre Veranstaltung zu öffnen. Außerdem begrüßte er namentlich die<br />
Ehrenmitglieder Dr. Rothert und Prof. Dr. Wulf sowie als neues Mitglied<br />
der Gesellschaft den frischgebackenen Professor für Regionalgeschichte mit<br />
Schwerpunkt zur <strong>Geschichte</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>s an der Kieler Universität<br />
Prof. Dr. Oliver Auge. Der Vorsitzende stellte die fristgerechte E<strong>in</strong>ladung<br />
und die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Erschienen waren 55<br />
Mitglieder. Gegen Form und Inhalt der E<strong>in</strong>ladung wurden ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>wände<br />
erhoben. Mit E<strong>in</strong>verständnis der Versammelten änderte Herr Kamischke<br />
E<strong>in</strong>e Mitarbeiter<strong>in</strong> der Fielmann-<br />
Akademie führt durch das Schloss
die Tagesordnung, um die Punkte 10 und 11 nach Tagesordnungspunkt 1<br />
abzuhandeln.<br />
55<br />
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Dr. Ingwer Momsen<br />
Der Vorsitzende würdigte Dr. Ingwer Momsens Verdienste um die Geschichtsgesellschaft<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er ausführlichen Laudatio. Herr Momsen gründete<br />
den Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, mit dem e<strong>in</strong>e<br />
neue Ära der Geschichtsgesellschaft begann. Er <strong>in</strong>itiierte die „<strong>Mitteilungen</strong>“,<br />
die er lange herausgab. Herr Momsen war viele Jahre Vorstandsmitglied,<br />
später auch stellvertretender Vorsitzender. Er rief das Projekt „Historischer<br />
Atlas <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>“ <strong>in</strong>s Leben und gab den Atlas mit heraus. 2008<br />
<strong>in</strong>itiierte Herr Momsen die Jubiläumsfeier und weitere Veranstaltungen der<br />
Geschichtsgesellschaft im Jubiläumsjahr. Für se<strong>in</strong> herausragendes Engagement<br />
wurde Herrn Momsen die Ehrenmitgliedschaft der Gesellschaft für<br />
<strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong> verliehen.<br />
In e<strong>in</strong>er kle<strong>in</strong>en Ansprache dankte Herr Momsen für die Ehrung, betonte<br />
die <strong>in</strong>tensive Mitwirkung des Festausschusses am Jubiläum und verwies<br />
Dr. Ingwer Momsen<br />
wurde zum<br />
Ehrenmitglied<br />
ernannt
56<br />
auch auf die große Bedeutung der Teamarbeit beim „Historischen Atlas“.<br />
Er dankte Herrn Kamischke und Frau Dr. Imberger für die gute Zusammenarbeit<br />
und will die Arbeit der Geschichtsgesellschaft weiter mit großem<br />
Interesse verfolgen.<br />
Verleihung des Preises der Gesellschaft<br />
für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong> 2009<br />
Der Vorsitzende verlieh den Preis der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische<br />
<strong>Geschichte</strong> 2009 an Prof. Dr. Steen Bo Frandsen aus Sønderborg<br />
für se<strong>in</strong> Werk „Holsten i helstaten. Hertugdømmet <strong>in</strong>den for og uden for<br />
det danske monarki i første halvdel af 1800-tallet” (auf deutsch: Holste<strong>in</strong><br />
im Gesamtstaat. Das Herzogtum <strong>in</strong>nerhalb und außerhalb der dänischen<br />
Monarchie <strong>in</strong> der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts). Leider konnte der<br />
Preisträger nicht persönlich anwesend se<strong>in</strong>. (Die Laudatio des Vorsitzenden<br />
auf das Werk und se<strong>in</strong>en Verfasser ist <strong>in</strong> diesem Heft der „<strong>Mitteilungen</strong>“<br />
abgedruckt).<br />
Bericht der Schriftführer<strong>in</strong><br />
Dr. Elke Imberger erläuterte den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2008 (<strong>Mitteilungen</strong>,<br />
Heft 76, S. 76-80).<br />
Bericht des Rechnungsführers und Haushaltsvoranschlag<br />
Dr. Mart<strong>in</strong> Skaruppe erläuterte se<strong>in</strong>en Kassenbericht für das Jahr 2008 und<br />
stellte den Haushaltsvoranschlag für 2009 vor (<strong>Mitteilungen</strong>, Heft 76, S.<br />
80-81). Beide wurden e<strong>in</strong>stimmig angenommen.<br />
Bericht der Rechnungsprüfer und Antrag auf Entlastung des Vorstands<br />
Ulrich Pilch verlas den von ihm und dem abwesenden Rechnungsprüfer<br />
Dr. Ernst-Joachim Fürsen verfassten Bericht, <strong>in</strong> dem e<strong>in</strong>e ordnungsgemäße,<br />
ordentliche Buchführung attestiert wurde. Der Vorsitzende dankte Herrn<br />
Pilch und Herrn Fürsen für das Prüfen der Rechnungsunterlagen.<br />
Aufgrund des Berichts beantragte Dr. Hans-F. Rothert die Entlastung<br />
des Vorstands, die ohne Gegenstimmen bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder<br />
erteilt wurde.
E<strong>in</strong>e gut besuchte Mitgliederversammlung<br />
Wahlen zum Vorstand<br />
Jörg-Dietrich Kamischke und Karl He<strong>in</strong>rich Buhse wurden ohne Gegenstimmen<br />
bei eigener Enthaltung wieder <strong>in</strong> den Vorstand gewählt.<br />
Auf Vorschlag des Vorstands kandidierte Prof. Dr. Ra<strong>in</strong>er Her<strong>in</strong>g für die<br />
Wahl zum Vorstand. Er stellte sich der Versammlung vor. Herr Her<strong>in</strong>g ist<br />
Leiter des Landesarchivs <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>. Er will se<strong>in</strong>e Verb<strong>in</strong>dungen<br />
nach Hamburg, wo er promoviert und habilitiert wurde, sowie <strong>in</strong> die USA<br />
nutzen, um das Interesse an schleswig-holste<strong>in</strong>ischer Landesgeschichte zu<br />
stärken.<br />
Auf Vorschlag von Herrn Kamischke kandidierte Prof. Dr. Oliver Auge<br />
für den Vorstand. Er promovierte <strong>in</strong> Tüb<strong>in</strong>gen, verbrachte se<strong>in</strong>e Assistentenzeit<br />
<strong>in</strong> Greifswald, wo er sich habilitierte, und ist seit dem 1. März dieses
58<br />
Jahres Professor für Regionalgeschichte an der Kieler Universität.<br />
Herr Her<strong>in</strong>g und Herr Auge wurden ohne Gegenstimmen bei eigener<br />
Enthaltung <strong>in</strong> den Vorstand gewählt.<br />
Wahl der Rechnungsprüfer<br />
Dr. Ernst-Joachim Fürsen und Ulrich Pilch wurden e<strong>in</strong>stimmig im Amt<br />
bestätigt.<br />
Anträge<br />
Es lagen ke<strong>in</strong>e Anträge vor.<br />
Verschiedenes<br />
Zum Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ gab es ke<strong>in</strong>e Meldungen.<br />
Der Vorsitzende dankte den Anwesenden für ihr Kommen und ihr Interesse<br />
und schloss die Versammlung um 17.15 Uhr.<br />
Dr. Elke Imberger<br />
Schriftführer<strong>in</strong>
59<br />
Preis der Gesellschaft<br />
für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong><br />
2010<br />
1. Die Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong> lobt für das<br />
Jahr 2010 erneut e<strong>in</strong>en Preis aus.<br />
Die Auszeichnung trägt den Namen „Preis der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-<br />
Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong>“ und ist mit 3000 Euro dotiert.<br />
2. Die Gesellschaft will mit dieser Auszeichnung e<strong>in</strong>e besondere Leistung<br />
auf dem Gebiet der Erforschung der schleswig-holste<strong>in</strong>ischen <strong>Geschichte</strong><br />
oder ihrer Vermittlung würdigen.<br />
3. Der Preis kann an Personen, an Gruppen oder für Projekte vergeben werden.<br />
4. Über die Preisvergabe entscheidet der Vorstand der Gesellschaft für<br />
<strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong>.<br />
Wenn mehrere Bewerbungen preiswürdig s<strong>in</strong>d, kann der Preis geteilt werden.<br />
5. Der Vorsitzende der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong><br />
überreicht den Preis <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er öffentlichen Veranstaltung.<br />
6. Bewerbungen und Vorschläge werden bis zum 31. März 2010 an die<br />
Schriftführer<strong>in</strong> der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong><br />
erbeten:<br />
Dr. Elke Imberger, Adam-Olearius-Weg 8, 24837 <strong>Schleswig</strong>, Tel. (04621)<br />
86-1843 oder (04621) 9<strong>77</strong>833, e-mail: Elke.Imberger@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Kiel, 29. August 2008<br />
Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong><br />
Jörg-Dietrich Kamischke<br />
Vorsitzender
60<br />
Mitarbeiter dieses Heftes:<br />
Prof. Dr. Oliver Auge, Historisches Sem<strong>in</strong>ar der Christian-Albrechts-Universität,<br />
Olshausenstr. 40, 24098 Kiel<br />
Günther Bock, Ahrensfelder Weg 13, 22927 Großhansdorf<br />
Dr. Jutta Glüs<strong>in</strong>g, Holm 51, 24937 Flensburg<br />
Dr. Elke Imberger, Adam-Olearius-Weg 8, 24837 <strong>Schleswig</strong><br />
Dirk Jonkanski, Landesamt für Denkmalpflege <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>, Wall<br />
47/51, 24103 Kiel<br />
Jörg-Dietrich Kamischke, Brekendorfer Landstr. 5, 24884 Selk<br />
Prof. Dr. Mart<strong>in</strong> Krieger, Historisches Sem<strong>in</strong>ar der Christian-Albrechts-<br />
Universität, Olshausenstr. 40, 24098 Kiel<br />
Frank Lubowitz, Claedenstr. 9, 24943 Flensburg<br />
Matthias Maluck, Archäologisches Landesamt <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>,<br />
Schloss Annettenhöh, Brockdorff-Rantzau-Str. 70, 24837 <strong>Schleswig</strong><br />
Thomas Overdick, Flensburger Schiffahrtsmuseum, Schiffbrücke 39,<br />
24939 Flensburg<br />
Silv<strong>in</strong>a Zander, Stadtarchiv Bad Oldesloe, Markt 5, 23843 Bad Oldesloe<br />
Bildquellen:<br />
Oliver Auge, S. 22<br />
GSHG, Karl-He<strong>in</strong>rich Buhse, S. 17, 53, 54, 55, 57<br />
<strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>isches Landesarch<strong>in</strong> <strong>Schleswig</strong> 19, 20<br />
Jutta Glüs<strong>in</strong>g, S. 38, 39<br />
Dirk Jonkanski, Landesamt für Denkmalpflege, S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,<br />
13, 14<br />
Mart<strong>in</strong> Krieger, S. 27<br />
Matthias Maluck, S. 29, 30<br />
Thomas Overdick, S. 33, 35, 36<br />
Stadtarchiv Bad Oldesloe, S. 41<br />
Sylv<strong>in</strong>a Zander, S. 42
Die MITTEILUNGEN DER GESELLSCHAFT FÜR SCHLESWIG-HOLSTEINISCHE GE-<br />
SCHICHTE (MSHG) berichten von Ereignissen, Vorhaben und Arbeiten <strong>in</strong> der Gesellschaft<br />
für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong>. Sie <strong>in</strong>formieren außerdem über E<strong>in</strong>richtungen, Veranstaltungen<br />
und Forschungen mit landesgeschichtlichem Bezug außerhalb der Geschichtsgesellschaft.<br />
Die <strong>Mitteilungen</strong> veröffentlichen auch Diskussionsbeiträge, Vorträge und kurze<br />
Aufsätze, die für e<strong>in</strong>e Veröffentlichung <strong>in</strong> der Zeitschrift der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische<br />
<strong>Geschichte</strong> oder dem Jahrbuch Nordelb<strong>in</strong>gen nicht <strong>in</strong> Frage kommen.<br />
Herausgeber: Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong><br />
Im Internet: www.geschichte-s-h.de<br />
Redaktion:<br />
Frank Lubowitz M.A., Claedenstraße 9, 24943 Flensburg, Tel. (04 61) 18 10 03;<br />
e-mail: lubowitz.archiv@bdn.dk; f-lubowitz@foni.net<br />
Günter Bock, Ahrensfelder Weg 13, 22927 Großhansdorf, Tel. (04102) 54062;<br />
e-mail: guenther_bock@gmx.de<br />
Im Interesse e<strong>in</strong>er möglichst vielseitigen und vollständigen Berichterstattung s<strong>in</strong>d alle, die<br />
sich aktiv mit der <strong>Geschichte</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>s beschäftigen, zur Mitarbeit an den <strong>Mitteilungen</strong><br />
aufgerufen. Manuskripte für die <strong>Mitteilungen</strong> s<strong>in</strong>d jederzeit willkommen.<br />
Vorstand der Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong>:<br />
Jörg-Dietrich Kamischke, Brekendorfer Landstr. 5, 24884 Selk (Vorsitzender)<br />
Prof. Dr. Detlev Kraack, Seestr. 1, 24306 Plön (Stellv. Vorsitzender)<br />
Dr. Elke Imberger, Adam-Olearius-Weg 8, 24837 <strong>Schleswig</strong> (Schriftführer<strong>in</strong>)<br />
Tel. (04621) 97 78 33; Fax (04621) 86 18 01; e-mail Elke.Imberger@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
Dr. Mart<strong>in</strong> Skaruppe, Dorfr<strong>in</strong>g 18 f, 24235 Ste<strong>in</strong> (Rechnungsführer)<br />
Dr. Jens Ahlers, Roggenkamp 8, 24768 Rendsburg<br />
Prof. Dr. Oliver Auge, Historisches Sem<strong>in</strong>ar Christian-Albrechts-Universität Leibnizstr. 8,<br />
24098 Kiel<br />
Karl-He<strong>in</strong>rich Buhse, Esmarchstr. 63, 25746 Heide<br />
Prof. Dr. Ra<strong>in</strong>er Her<strong>in</strong>g, Landesarchiv <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong> Pr<strong>in</strong>zenpalais, 24837 <strong>Schleswig</strong><br />
Werner Junge, Hermann-Löns-Weg 44, 24939 Flensburg<br />
Frank Lubowitz, Claedenstr. 9, 24943 Flensburg<br />
Dr. Ortw<strong>in</strong> Pelc, Halstenbeker Weg 65, 22523 Hamburg<br />
Ehrenmitglieder:<br />
Prof. Dr. Jürgen Miethke, Molfsee<br />
Dr. Hans F. Rothert, Kiel<br />
Prof. Dr. Wolfgang Prange, <strong>Schleswig</strong><br />
Prof. Dr. Peter Wulf, Gettorf<br />
Dr. Ingwer Momsen, Mönkeberg<br />
Beitrittserklärungen, Anschriftenänderungen, Bestellungen usw. s<strong>in</strong>d an die<br />
Geschäftsstelle zu richten:<br />
Gesellschaft für <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ische <strong>Geschichte</strong>, Sekretariat<br />
Frau Sylvia Günther, Puck´sche Koppel 2, 24217 Schönberg/H., Tel. u. Fax (0 43 44) 45 19.<br />
Der Mitgliedsbeitrag beträgt im Jahr € 30 für E<strong>in</strong>zelmitglieder, m<strong>in</strong>destens € 30 für Institutionen,<br />
€ 40 für Ehepaare, € 10 für Auszubildende (Schüler, Lehrl<strong>in</strong>ge, Studenten, Referendare).<br />
Bankkonten: Förde Sparkasse Kiel (BLZ 210 501 70) Nr. 11 003 803;<br />
Sydbank Kruså/Dänemark, Nr. 806 511 1340-1.
E<strong>in</strong>ladung zu Vorträgen<br />
Dienstag, 20. Oktober 2009<br />
Dr. Ralf Wiechmann<br />
Haithabu und das Geld der Wik<strong>in</strong>ger<br />
Dienstag, 10. November 2009<br />
Prof. Dr. Peter Wulf<br />
Hochzeit <strong>in</strong> besseren Kreisen – die Ehe des Grafen Otto Blome,<br />
Salzau, mit der Pr<strong>in</strong>zess<strong>in</strong> Clement<strong>in</strong>e Bagration, Paris<br />
Dienstag, 26. Januar 2010<br />
Hans-Günther Andresen<br />
An R<strong>in</strong>gstraße und Königsweg – Großstädtische Anfänge und<br />
Umbrüche <strong>in</strong> der südlichen Kieler Innenstadt<br />
Dienstag, 23. Februar 2010<br />
Nils H<strong>in</strong>richsen<br />
Benennungen nach H<strong>in</strong>denburg <strong>in</strong> <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>:<br />
Drei Fallbeispiele aus Kaiserzeit, Weimarer Republik und<br />
„Drittem Reich“<br />
Dienstag, 23. März 2010<br />
Prof. Dr. Oliver Auge<br />
Mord, Gefangennahme, Erpressung – andere Spielregeln der<br />
Politik im schleswig-holste<strong>in</strong>ischen Mittelalter<br />
Alle Vorträge beg<strong>in</strong>nen um 19.30 Uhr<br />
<strong>in</strong> der <strong>Schleswig</strong>-Holste<strong>in</strong>ischen Landesbibliothek <strong>in</strong> Kiel,<br />
Wall 47/51 (Sartori & Berger-Speicher)<br />
Der E<strong>in</strong>tritt ist frei.