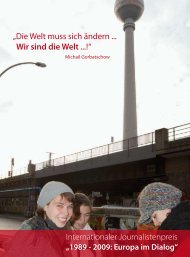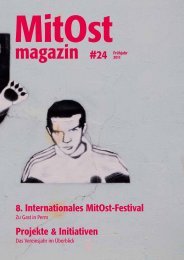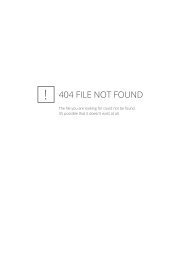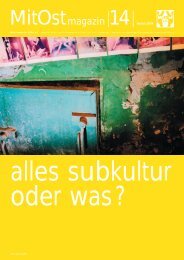MitOstmagazin - MitOst e.V.
MitOstmagazin - MitOst e.V.
MitOstmagazin - MitOst e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MO NR.11|03_PDF VERSION 03.09.2003 12:55 Uhr Seite 32<br />
FEUILLETON<br />
Ästhetik der Leere<br />
Ein Buch über moderne<br />
Architektur in Zentralasien<br />
Cornelia Dörries, Stadtsoziologin und Architekturkritikerin, Zeitungsund<br />
Buchpublikationen, Berlin<br />
Fotos: Anja Heß<br />
Die Glosse ist der Zeitschrift Novokult<br />
entnommen, die vor fast zwei Jahren in<br />
Nowosibirsk gegründet wurde. Die erste<br />
Ausgabe, die aus einer spontanen Idee<br />
entstand, enthielt Neuigkeiten aus<br />
Deutschland, Informationen über Studienund<br />
Stipendienmöglichkeiten, die Adressen<br />
der deutschen Organisationen in<br />
Novosibirsk und einen Kulturkalender.<br />
Nachdem die erste Ausgabe ein Erfolg war,<br />
haben sich der damalige Sprachassistent<br />
des Goethe-Institutes, Jan Helfer, und die<br />
Bosch-Lektorin Anja Heß daran gemacht,<br />
NovoKult regelmäßig herauszugeben. Es<br />
wurden Projektgelder bei verschiedenen<br />
Institutionen beantragt und weitere Leute<br />
zur Mitarbeit angesprochen. Aus den anfänglichen<br />
acht Seiten sind zwanzig geworden.<br />
Mittlerweile arbeiten auch die verschiedenen<br />
deutschen Kulturmittler im<br />
Redaktionsteam der Zeitung, russische<br />
Studenten und Kollegen schreiben Artikel<br />
und helfen beim Layout. Die Zeitung erscheint<br />
in einer Auflage von 1000 Exemplaren.<br />
Die Zeitschrift enthält verschiedene<br />
Rubriken wie „Neues aus Deutschland“,<br />
„Neue deutsche Literatur“, „Interviews“,<br />
„Schwerpunktthema“, „Kulturkalender<br />
Novosibirsk“, „Studieninformationen“ uvm.<br />
32 <strong>MitOst</strong> Nr. 11| Mai 2003<br />
Kioski<br />
Jan Helfer, schreibt für Novokult, Goethe-Institut, Projektberater, Saratow/Russland<br />
Kioske gibt es auch in Deutschland. Man kann da Zigaretten oder Zeitschriften kaufen. Man geht zum<br />
Kiosk, weil man zum Beispiel Zigaretten kaufen will. Der Verkäufer sitzt in seinem Kiosk, lächelt glücklich –<br />
wahrscheinlich denkt er gerade: „Oh, ein Kunde! Wie schön!“ – und sagt: „Guten Tag. Was darf’s sein?“<br />
„Guten Tag. Bitte Zigaretten.“<br />
„Hier, bitte. Das macht drei Euro.“<br />
„Danke. Hier drei Euro. Bitte.“<br />
„Ja, danke und einen schönen Tag.“<br />
„Danke, ebenso.“<br />
Geht also ganz leicht, ist aber auch etwas langweilig. Und wer will schon immer Zeitschriften oder<br />
Zigaretten kaufen? In Russland ist das alles besser. An Kiosken kann man alles kaufen außer Waffen und<br />
Pinguinen. Es gibt Schokolade, Chips, Bier und Zigaretten. Man bekommt Waldmeisterlimonade und<br />
Erdbeersaft. Hunger? Schnell zum Kiosk, Fischkonserven kaufen. Es gibt sogar richtige kleine tote<br />
Fische und Kalmare. Taschentücher oder Kondome? Kein Problem. Sie benötigen Damenbinden? Im<br />
Kiosk liegen sie bereit (jetzt müsste man nur noch wissen, was Damenbinde auf Russisch heißt). Der Kiosk<br />
bei mir um die Ecke hat bis vor kurzem auch Blumentöpfe verkauft. Wohl ohne Erfolg, jetzt gibt es Kerzen.<br />
Spielzeug, Tee oder Kaffee? Gibt’s! Kugelschreiber? Gibt’s! Nagelscheren habe ich gesehen, Klopapier, Schuhcreme<br />
und Kleiderbürsten. Gibt es alles, meist 24 Stunden am Tag. Man muss nur wissen, wie es geht.<br />
Nehmen wir an, Sie sind neu in Nowosibirsk und Sie haben auf dem Heimweg Lust auf ein Bier. Ein<br />
freundlicher Abend, nur fünf Grad unter Null. Das Bier wird nicht sofort in der Flasche gefrieren. Da!<br />
Ein Kiosk! Doch es ist keine Verkäuferin zu sehen, der Kiosk hat keine Öffnung. Nach einigen Minuten<br />
entdecken Sie eine Klappe auf Bauchnabelhöhe. Wieder zwei Minuten später fassen Sie Mut. Sie<br />
klopfen. Die Klappe öffnet sich. Sie sind glücklich und warten auf das vertraute „Guten Tag, kann ich<br />
Ihnen helfen?“ Die Klappe schließt sich wieder. So funktioniert es nicht. Sie klopfen erneut, es wird<br />
geöffnet und jemand fragt genervt: „Was?!“ Lassen Sie sich nicht verunsichern. Nennen Sie schnell<br />
eine Biermarke, die Sie aussprechen können. Beugen Sie sich nicht zur Klappe hinunter, das sieht<br />
dämlich aus. Stecken Sie nicht den Kopf durch die Öffnung. Im Kiosk tut sowieso niemand so, als<br />
dächte er: „Oh, wie schön, ein Kunde!“ Dort denkt jemand: „Wer etwas kaufen will, soll sich kurz und<br />
klar artikulieren. Ich will hier nämlich in Ruhe rauchen. Außerdem kommt sonst kalte Luft in meinen<br />
Kiosk.“ Halten Sie sich daran, dann kriegen Sie auch Ihr Bier.<br />
Als ich neulich zu meinem Lieblingskiosk ging, war es schon dunkel und niemand auf der Straße. Ich<br />
beugte mich doch einmal zur Klappe hinunter. Im Kiosk saßen drei Frauen und rauchten. Ich<br />
brauchte einen Blumentopf, es gab aber nur Kerzen. Die drei Frauen rauchten immer weiter, der<br />
ganze Kiosk war schon voller Rauch. Ich nahm meine Kerzen und ging. Als ich mich umdrehte, hatte<br />
der Rauch die ganze Luft im Kiosk verdrängt. Der Rauch, leichter als Luft, stieg auf und löste den<br />
Kiosk von der Erde. Unsicher taumelte er in der Nacht, stieg schneller auf und flog in eleganter Linie<br />
über das Zentrum der Stadt nach Norden. Ich blieb am Boden zurück, sah dem immer kleiner werdenden<br />
Kiosk nach, der still davonschwebte und schon weit entfernt am Nachthimmel glitzerte:<br />
Wohin werden sie wohl fliegen? Was werden sie tun?<br />
Wenn die Rede auf Kasachstan, Usbekistan<br />
oder Kirgistan kommt, ist man gewöhnlich<br />
geneigt, sich im Atlas zu vergewissern, um<br />
welche Regionen der Erde es sich dabei handelt.<br />
Meistens versinken die ohnehin vagen Vorstellungen<br />
in jenem diffusen Nebel, der die<br />
Entwicklung in den Nachfolgestaaten der ehemaligen<br />
Sowjetunion umgibt: Umweltkatastrophen,<br />
Armut, postsozialistische Despotenregimes<br />
und Verfall. Dieses endzeitliche Leitmotiv<br />
lässt vergessen, dass neben diesen verheerenden<br />
Tatsachen in den zentralasiatischen<br />
Ländern allmählich auch Neues entsteht.<br />
Und was könnte den Anbruch einer neuen Zeit<br />
sinnfälliger verkörpern als neue Städte, neue<br />
Häuser, ergo Architektur?<br />
Den Berliner Architekten und Journalisten Philipp Meuser verschlägt<br />
es seit einigen Jahren immer wieder nach Zentralasien.<br />
Diese riesige Region ist weder pittoresk noch einladend, und<br />
unübersehbar von den üblichen gesellschaftlichen, ökonomischen<br />
und ökologischen Verwerfungen gezeichnet. Städte und Landschaft<br />
sind von den Folgen jahrzehntelangen Raubbaus an Mensch und<br />
Umwelt geprägt und werden noch lange an diesen Altlasten tragen,<br />
die auch das sich allmählich herausbildende Neue mit einer schweren<br />
Hypothek belasten. Insofern stellt sich Philipp Meuser einem fast<br />
uneinlösbaren Anspruch, wenn er nach über zehn Jahren<br />
Unabhängigkeit in Kasachstan, Usbekistan und Kirgistan auf die<br />
Suche nach einer eigenständigen neuen Architektur geht, die das<br />
Erbe des Sowjetzeitalters mit den ethnisch geprägten Bautraditionen<br />
zu vereinen vermag. Dafür bieten die knapp 150 Seiten des<br />
großformatigen Kompendiums schlicht zu wenig Platz. Allerdings<br />
vermitteln die eindrücklichen Fotos mit Texten von insgesamt acht<br />
Autoren einen informativen Eindruck der gegenwärtigen<br />
Entwicklung in Architektur und Städtebau Zentralasiens. Hier löst<br />
das Buch den Anspruch seines Titels ein: Es dokumentiert die<br />
Ästhetik von vier Jahrzehnten städtebaulichen Ehrgeizes in einer<br />
Steppenlandschaft, die so groß ist wie das gesamte Mittel- und<br />
Westeuropa. Dabei beschränkt sich der Herausgeber auf die moderne<br />
Architektur von 1961 bis zur Gegenwart. Die dokumentierten<br />
Neubauten spiegeln einen Aufhol-Prozess wider, mit dem der<br />
Anschluss an die westliche Moderne der Büro- und Hotelquader<br />
gesucht wird und Identität bestenfalls in einer Art vulgarisierter<br />
Folklore daherkommt.<br />
Ein eigenes, erschütterndes Kapitel ist dem ökologisch kollabierten<br />
Aralsee und den sterbenden ehemaligen Fischerdörfern an seinen<br />
Ufern gewidmet. Da geht es weniger um architektonische Aspekte<br />
als vielmehr um einen schockierenden Tatbestand mit beängstigenden<br />
Konsequenzen für Mensch und Natur.<br />
Die Bilder in dem Buch belegen eine gravierende Unausgewogenheit<br />
zwischen Stadt und Land, den Metropolen und ihren unfassbar<br />
weiten Peripherien. Auf der einen Seite gibt es phantasmagorische<br />
Projekte wie die Planung und Errichtung der aseptischen neuen<br />
kasachischen Hauptstadt Astana, die auf Geheiß des Präsidenten<br />
Nasarbajew nach dem Masterplan des japanischen Architekten<br />
Kurokawa in die Steppe geklotzt wird, während andererseits die<br />
kleineren Städte, Dörfer und Siedlungen im Landesinneren verelenden<br />
und verfallen.<br />
Dem vergifteten politischen Humus, auf dem diese fatale Entwicklung<br />
gedeiht, widmet das Buch leider wenig Aufmerksamkeit.<br />
Dennoch gelingt es, die Neugier des Lesers auf Exotisches in tiefer<br />
gehendes Interesse am Schicksal der Länder zwischen Ural und chinesischer<br />
Grenze zu verwandeln.<br />
Philipp Meuser (Hrsg.):<br />
„Ästhetik der Leere. Moderne Architektur in Zentralasien“<br />
Verlagshaus Braun, Berlin 2002. ISBN 3935455135, EUR 29,80<br />
<strong>MitOst</strong> Nr. 11| Mai 2003<br />
33