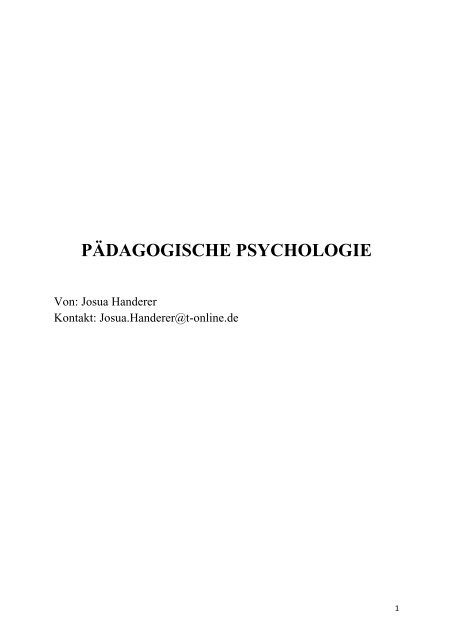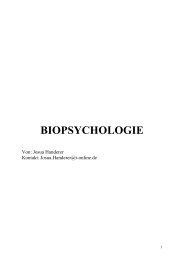A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
A: PSYCHOLOGIE DES UNTERRICHTS UND DER ERZIEHUNG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
PÄDAGOGISCHE <strong>PSYCHOLOGIE</strong><br />
Von: Josua Handerer<br />
Kontakt: Josua.Handerer@t-online.de<br />
1
A: <strong>PSYCHOLOGIE</strong> <strong>DES</strong> <strong>UNTERRICHTS</strong> <strong>UND</strong> <strong>DER</strong> <strong>ERZIEHUNG</strong><br />
A 1: Lehr-Lern-Forschung<br />
1. Begriffsklärung und Gegenstand der Lehr-Lern-Forschung<br />
� Die Lehr-Lern-Forschung (synonyme Begriffe: Instruktionsforschung;<br />
Unterrichtsforschung) untersucht den Zusammenhang zwischen<br />
Unterrichtsmerkmalen und dem Wissens- und Kompetenzerwerb auf Seiten der<br />
Schüler.<br />
� Die Forschungsfrage: Was zeichnet guten Unterricht aus?<br />
� Die L-L-Forschung ist Teil der pädagogischen Psychologie und der<br />
Erziehungswissenschaften; innerhalb der Erziehungswissenschaften ist sie Teil der<br />
Allgemeinen Didaktik!<br />
� ABER: Die internationalen Schulleistungsstudien (PISA und <strong>DES</strong>I) zeigen,<br />
dass eine fachdidaktisch orientierte Lehr-Lern-Forschung effektiver ist (s.u.)!<br />
� Die diversen Schulleistungsstudien haben die hohe Relevanz der Lehr-Lern-<br />
Forschung hinreichend deutlich gemacht!<br />
2. Paradigmen der Lehr-Lernforschung<br />
A) Das Persönlichkeitsparadigma:<br />
� Dominierte in den Anfängen der Lehr-Lernforschung (50er / 60er Jahre); in dieser Zeit<br />
konzentrierte man sich v. a. auf die Frage, welche psychometrisch erfassbaren,<br />
stabilen (situations- und zeitübergreifenden) Persönlichkeitseigenschaften einen<br />
guten Lehrer ausmachen.<br />
� Prinzip: Personenmerkmale (Intelligenz, Belastbarkeit, fachliches Wissen,<br />
Führungsstil, Einstellungen etc.) als Prädiktoren für den Unterrichtserfolg!<br />
� Ein Beispiel für dieses Paradigma sind die Arbeiten KOUNINS. Letzterer<br />
identifizierte auf der Basis empirischer Studien 7 Prinzipien effektiver<br />
Klassenführung („Classroom Management“):<br />
1. Allgegenwärtigkeit der Lehrkraft (Withitness)<br />
� Lehrkraft vermittelt Schülern das Gefühl alles zu registrieren, auch wenn<br />
sie nicht immer reagiert<br />
2. Reibungslosigkeit und Schwung (Momentum)<br />
� Vermeidung von unnötigen Unterbrechungen und Leerlaufphasen<br />
3. Geschmeidigkeit des Ablaufs (Smoothness)<br />
� Vermeidung von Brüchen, systematischer Unterrichtsaufbau<br />
4. Überlappung von inhaltlicher Arbeit, organisatorischen Regelungen und<br />
Störungsprävention (Overlapping)<br />
� Mehrere Dinge gleichzeitig erledigen; z.B. einen unruhigen Schüler<br />
parallel zum Unterrichtsgespräch beruhigen etc.<br />
5. Die ganze Lerngruppe im Blick (Group focus)<br />
6. Geschicktes Management der Übergänge (Managing transitions)<br />
� Übergänge zwischen Unterrichtsschritten und Anfang und Ende der Stunde<br />
sind klar erkennbar (evtl. durch ritualisierte Gesten und/oder akustische<br />
Signale unterstützt);<br />
7. Erkennen und Vermeiden vorgetäuschter Schüleraufmerksamkeit (Avoiding<br />
Mocking Participation)<br />
� Die Ergebnisse der Persönlichkeitsparadigmas sind eher dürftig: Es konnten kaum<br />
signifikante Zusammenhänge zwischen einzelnen Persönlichkeitsvariablen und dem<br />
2
Lehrerfolg gefunden werden. Die ideale Lehrerpersönlichkeit scheint es demnach<br />
nicht zu geben.<br />
� Probleme des Ansatzes:<br />
� Aufgrund der heterogenen Erwartungen, die an einen Lehrer gestellt werden,<br />
lassen sich kaum objektive Kriterien dafür aufstellen, was einen „guten“<br />
Lehrer ausmacht!<br />
� Persönlichkeitseigenschaften sind nicht erlernbar; im Hinblick auf die<br />
Lehrerausbildung ist der Ansatz somit kontraproduktiv!<br />
� Unterricht wird als einseitiger Vermittlungsprozess betrachtet (s.u.: Aptitude-<br />
Treatment-Interaktion). Dem entspricht, dass zu wenige mediierende<br />
Variablen einbezogen werden (wie z.B. das Leistungsniveau der Schüler, die<br />
Klassengröße, die Art des Stoffs etc.)<br />
B) Das Prozess-Produkt-Paradigma<br />
� Im Prozess-Produkt-Paradigma werden keine Persönlichkeitseigenschaften, sondern<br />
spezifische Verhaltensweisen des Lehrers untersucht, z.B. wie dieser das<br />
Unterrichtsgespräch strukturiert, Fragen formuliert oder mit Störungen umgeht.<br />
� Dabei geht man davon aus, dass die Art, wie ein Lehrer sich seinen Schülern<br />
gegenüber verhält, den Unterrichtserfolg vorhersagt.<br />
� Das Prozess-Produkt-Paradigma wird bis heute angewendet, so z.B. in der <strong>DES</strong>I-<br />
Studie (2006). Im Rahmen dieser Studie wurden nämlich nicht nur<br />
Leistungsvariablen (zu Beginn und am Ende der 9. Jahrgangsstufe), sondern auch<br />
diverse Unterrichtsvariablen erhoben (per Schüler- und Lehrerbeschreibungen und<br />
Videoanalysen)<br />
� MEYER (2004) fasst aufgrund der bis dahin vorliegenden Forschungsliteratur 10<br />
Merkmale guten Unterrichts zusammen:<br />
1. Klare Strukturierung des Unterrichts<br />
2. Hoher Anteil echter Lernzeit<br />
3. Lernförderliches Klima<br />
4. Inhaltliche Klarheit<br />
5. Sinnstiftendes Kommunizieren<br />
6. Methodenvielfalt<br />
7. Individuelles Fördern<br />
8. Intelligentes Üben<br />
9. Transparente Leistungserwartungen<br />
10. Vorbereitete Lernumgebung<br />
� Probleme des Ansatzes:<br />
� Die spezifischen Fachinhalte bleiben unberücksichtigt. Dabei führen im<br />
Matheunterricht vermutlich andere Strategien zum Erfolg als im<br />
Deutschunterricht!<br />
� Der Zusammenhang zwischen einzelnen Verhaltensweisen und dem<br />
Unterrichtserfolg ist gering, erst das Zusammenspiel verschiedener<br />
Verhaltensweisen (Wechselwirkung!) hat offenbar einen Einfluss auf den<br />
Unterrichtserfolg.<br />
� Da die Wirksamkeit bestimmter Methoden von den Voraussetzungen auf<br />
Seiten der Schüler abhängt, reicht es nicht aus, das Lehrerverhalten als UV<br />
und das Schülerverhalten als AV zu betrachten (s.u.: Vernachlässigung der<br />
Aptitude-Treatment-Interaktion)!<br />
� Nicht nur der Lehrer beeinflusst die Schüler, sondern auch die Schüler den<br />
Lehrer (Lehrer � Schüler)!<br />
3
� Der Lernzuwachs ist keineswegs das einzige Kriterium guten Unterrichts<br />
(außerdem: soziale Kompetenz, Wohlbefinden, Lernfreude etc.)!<br />
C) Das Experten-Paradigma<br />
� Das Prozess-Produkt-Paradigma wird in jüngster Zeit zunehmend durch das eher<br />
kognitiv ausgerichtete Expertise-Paradigma ergänzt bzw. ersetzt. Dabei wird der<br />
Lehrer als „Experte“ verstanden, dessen Erfolg von seinem Wissen und den<br />
Fertigkeiten abhängt, über die er verfügt (Expertise).<br />
� Der Expertiseansatz verknüpft zwei Forschungstraditionen:<br />
1) Die kognitionspsychologische Expertiseforschung, die untersucht,<br />
inwiefern sich die Informationsverarbeitung von Experten und Novizen<br />
unterscheidet.<br />
� CHI: Schachspieler können sich Schachpositionen besser merken, weil<br />
sie ein großes Repertoire typischer Schachstellungen kennen (s.u.).<br />
2) Das Prozess-Produkt-Paradigma; letzeres wird durch den Expertiseansatz<br />
insofern erweitert, als dieser die kognitionspsychologischen<br />
Rahmenbedingungen effektiver Unterrichtsführung untersucht.<br />
� Gegensatz zum Persönlichkeitsparadigma: Der Lehrberuf ist erlernbar!<br />
� Untersucht wird das Wissen und die Informationsverarbeitung eines Lehrers bzw.<br />
inwiefern beides dessen Wahrnehmung und Unterrichtsstil beeinflusst.<br />
� Das Design ist meist analog zur sonstigen Expertiseforschung: Experten und<br />
Novizen wird Material vorgelegt (z.B. Dias oder Videoaufnahmen von<br />
bestimmten Unterrichtssituationen). Ausgehend davon, wie die Pbn mit<br />
diesem Material umgehen, wird auf ihre kategoriale Wahrnehmung<br />
geschlossen (so z.B. BERLINER).<br />
� Ein methodisches Problem stellt dabei die Identifikation von Experten dar:<br />
Da der Unterrichtserfolg immer auch von den Rahmenbedingungen<br />
(Schulklima, Zusammensetzung der Klasse etc.) abhängt und diese nicht<br />
konstant gehalten werden können, ist dieses Kriterium nur bedingt geeignet;<br />
weitere Auswahlkriterien sind: Berufserfahrung, Beurteilungen von<br />
Vorgesetzten und Kollegen, Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen…<br />
� Untersuchungen zur Expertise von Lehrern zeigen u.a., dass erfahrene Lehrer den<br />
Unterricht in Form typischer Unterrichtsepisoden (sog. „Scripts“) wahrnehmen,<br />
während jüngere Kollegen sich auf einzelne Schüler konzentrieren und das<br />
Wesentliche nur bedingt von irrelevanten Details unterscheiden können. Darüber<br />
hinaus ermöglicht Erfahrung die Ausbildung von Routinen (Automatisierung des<br />
eigenen Verhaltens und Etablierung von Interaktionsregeln), die das Unterrichten<br />
erleichtern.<br />
� Dass es keinen Zusammenhang zwischen Berufserfahrung und<br />
Unterrichtsqualität bzw. Lehrerfolg gibt, erklären Vertreter des<br />
Expertiseansatzes mit dem Burnout-Syndrom.<br />
� Ein aktuelles Forschungsbeispiel zur Expertise von Lehrern ist das interdisziplinäre<br />
und eng mit der PISA-Studie verzahnte Projekt COAKTIV.<br />
� Im Rahmen dieses Projekts untersuchen Psychologen,<br />
Erziehungswissenschaftler und Mathematikdidaktiker den Zusammenhang<br />
zwischen professionellem Wissen von Lehrern, dem unterrichtlichen Handeln,<br />
und der Leistungsentwicklung ihrer Schüler.<br />
� Was von einem erfahrenen Lehrer erwartet wird:<br />
4
� Die Organisation und Aufrechterhaltung einer Struktur von Schüler- und<br />
Lehreraktivitäten<br />
� Antizipation und Gegensteuerung möglicher Störungen; weiche Übergänge<br />
zwischen Themen und Instruktionsmethoden etc.<br />
� Gemeinsame Entwicklung des Unterrichtsstoffs<br />
� Einsetzen eines großen Repertoires an Unterrichtsmethoden;<br />
Ermöglichung von Erfolgserfahrungen; klare Strukturierung der Stunden<br />
etc.<br />
� Organisation der Unterrichtszeit<br />
� Effektive Nutzung der Unterrichtszeit (Stoffbehandlung); Kontrolle und<br />
Abstimmung des Tempos auf die Schüler<br />
� 4 Felder, in denen Lehrer Expertise aufbauen müssen: 1) Fachwissen;<br />
2) Fachdidaktik, 3) Klassenführung, 4) Diagnostik<br />
� Wichtig ist, dass alle Bereiche abgedeckt sein müssen; so wirkt sich ein hohes<br />
Fachwissen z.B. nur dann positiv aus, wenn die betreffende Lehrkraft auch in<br />
den anderen Feldern über Expertise verfügt.<br />
� Experiment (Helmke et al.): Wird der Matheunterricht von einer<br />
fachfremden Facht unterrichtet, hat das nur dann Auswirkungen auf den<br />
Lehrerfolg, wenn auch die anderen Faktoren stimmen.<br />
� Aufteilung des Expertenwissens von Lehrern nach Shulmann:<br />
1. Fachliches Wissen<br />
2. Curricurales Wissen<br />
3. Philosophie des Schulfaches<br />
4. Allgemeines pädagogisches Wissen<br />
5. Fachspezifisches pädagogisch-didaktisches Wissen<br />
6. Diagnostische Kompetenz<br />
D) Das Angebots-Nutzungs-Modell von Helmke<br />
� HELMKE bemüht sich mit seinem Angebots-Nutzungs-Modell die verschiedenen<br />
Forschungstraditionen zu integrieren. Zu diesem Zweck beschreibt er den Unterricht<br />
als ein Angebot, dessen Nutzung von verschiedenen Faktoren abhängt.<br />
� Folgende Faktoren werden dabei berücksichtigt:<br />
� Lehrerpersönlichkeit: Expertise, Werte, Ziele, subjektive Theorien,<br />
Selbstwirksamkeit etc.<br />
� Unterrichtsmerkmale (Angebot): Passung, Adaptivität, Klarheit, Klassenführung<br />
etc.<br />
� Individuelle Eingangsvoraussetzungen auf Schülerseite: Mediationsprozesse<br />
(s.u.), Lernaktivitäten der Schüler (aktive Lernzeit etc.)<br />
� Die beiden mediierenden Prozesse sind a) motivationale und emotionale<br />
Vermittlungsprozesse und b) die Wahrnehmung und Interpretation des<br />
Unterrichts<br />
3. Zur Aptitude-Treatment-Interaktion (ATI) und Adaptivität von Lehrern<br />
� Die Wirkung bestimmter Unterrichtsmerkmale hängt von Schülermerkmalen ab! Man<br />
bezeichnet dieses Phänomen, also die Wechselwirkung zwischen Eigenschaften des<br />
Lernenden und bestimmten Unterrichtsmerkmalen, als Aptitude-Treatment-<br />
Interaktion.<br />
� Der praktische Nutzen der ATI-Forschung ist begrenzt, da die gefundenen<br />
Wechselwirkungen oft zu vielfältig und unübersichtlich sind, um sie für den<br />
Unterricht nutzbar zu machen.<br />
� Nichtsdestotrotz hat die ATI-Forschung 2 wichtige Erkenntnisse geliefert:<br />
5
1) Die Frage nach den besten Methoden lässt sich nicht pauschal<br />
beantworten.<br />
2) Grundsätzlich gilt: Lehrerzentrierte, kleinschrittige Instruktionsformen<br />
sind bei ungünstigen Lernvoraussetzungen (affektiv: Ängstlichkeit;<br />
kognitiv: Intelligenz, Vorwissen) effektiver; offene (selbstgesteuerte),<br />
kooperative Lernformen dagegen bei günstigen Lernvoraussetzungen.<br />
� Die Fähigkeit eines Lehrers, den eigenen Unterrichtstil (konkret: die zur Verfügung<br />
gestellte Lernzeit, das zugrunde gelegte Lernziel und die Methoden) an die<br />
Voraussetzungen der Schüler anzupassen, wird als Adaptivität bezeichnet (s.u.).<br />
� Die Forschung zur Adaptivität zeigt, dass in der Lehr-Lern-Forschung nicht<br />
nur die Auswirkung des Unterrichts (Angebot) auf den Ertrag, sondern auch<br />
die Rückwirkung des Ertrags auf den Unterricht ins Auge gefasst werden<br />
muss.<br />
� Studien zur Adaptivität von Lehrern:<br />
� <strong>DES</strong>I: Im Fach Deutsch wird bei leistungsschwachen Klassen der<br />
Schwerpunkt auf die Vermittlung basaler Kompetenzen (Wortschatz,<br />
Rechtschreibung, Grammatik etc.) gelegt und vermehrt Kleingruppenarbeit<br />
eingesetzt, in leistungsstarken Klassen werden dagegen komplexere<br />
Arbeitsformen eingesetzt und schwierigere Inhalte behandelt.<br />
� Häufig lassen sich auch „Überadaptationen“ beobachten, etwa wenn<br />
Schülern mit geringem Vorwissen unterfordernde Aufgaben dargeboten<br />
werden. Im Hinblick auf das Fach Mathematik konnte z.B. gezeigt werden,<br />
dass auch schwache Schüler (mit geringem Vorwissen) von anspruchsvollen<br />
Textaufgaben stärker profitieren als von einfachen (kein ATI-Effekt).<br />
4. Neuere Perspektiven dank der großen Schulleistungsstests (PISA etc.)<br />
� Aus den Ergebnissen der großen nationalen und internationalen Schulleistungstests<br />
(TIMSS, PISA etc.) haben sich neue Forschungsfragen und -perspektiven ergeben.<br />
1. Verschiebung von einer fächerübergreifenden zu einer fachspezifischen<br />
Forschungsperspektive<br />
2. Analyse schulformspezifischer Unterrichtsskripts<br />
3. Analyse kulturspezifischer Unterrichtsskripts<br />
� Zu 1: Die <strong>DES</strong>I-Studie zeigt im Hinblick auf den Fremdspracherwerb (Englisch)<br />
folgende Effekte:<br />
� Einen Einfluss haben a) die Verwendung der betreffenden Sprache als<br />
Unterrichtssprache, b) der Umfang der Schüler-Lehrer-Interaktion und c) die<br />
Klassengröße; während sich die beiden ersten Faktoren positiv auswirken, hat<br />
die Klassengröße (anders als in anderen Fächern!) einen negativen Einfluss auf<br />
den Kompetenzzuwachs (geringere Verständlichkeit; schlechtere<br />
Klassenführung etc.)<br />
� Zu 2: Der Vergleich der unterschiedlichen Schulformen ergibt für Deutschland (PISA<br />
2003 und <strong>DES</strong>I 2006):<br />
� An Hauptschulen herrscht in Einklang mit der ATI ein lehrerzentrierter<br />
Unterricht vor, an Gymnasien dagegen wird auf anspruchsvollere<br />
Arbeitsmethoden gesetzt (auf die Adaptivität der Lehrer zurückzuführen)<br />
� Das förderlichste Entwicklungsmilieu findet sich an Gymnasien<br />
� Zu 3: Die 3. Internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie TIMSS zeigt<br />
nicht nur Leistungsunterschiede, sondern auch kulturspezifische Unterschiede<br />
bezüglich der Lehr-Lernprozesse (Videoanalysen):<br />
� Japan: kognitiv anspruchsvoller Unterricht, Problemlösungs- und<br />
Modellierungsaufgaben<br />
6
� Deutschland und USA: kleinschrittiges, lehrerzentriertes auf das Einschleifen<br />
von Routinen ausgerichtetes Unterrichtsgeschehen<br />
� Fazit: Nach wie vor geringes Wissen über den Zusammenhang zwischen<br />
Unterrichtsmerkmalen und Lernerfolg; Ursache: mangelnde Zusammenarbeit<br />
zwischen Fachdidaktik, Psychologie und Erziehungswissenschaft! Die Forderung der<br />
Stunde lautet daher: Interdisziplinarität!<br />
A 2: Lehrerverhalten und Lehrereffizienz<br />
7
1. Lerntheorien<br />
� Hauptkennzeichen der Instruktionsforschung ist deren verhaltenswissenschaftliche<br />
(behavioristische) Basis: Ausgehend von Lerntheorien wird nach effektiven<br />
Vermittlungs-Techniken gesucht. Ziel ist die Optimierung von Lehr-Lern-<br />
Prozessen.<br />
� Optimistische Erwartungen einerseits (Skinner etc.): Lernprozesse sind vom<br />
Lehrer genau plan- und steuerbar<br />
� Skepsis und Kritik auf der anderen Seite (Reformpädagogen wie Ellen Key,<br />
kognitivistisch orientierte Psychologen wie Gardner): Lernprozesse sind nur<br />
dann effektiv, wenn sie eben nicht mechanistisch ablaufen und von außen<br />
aufoktroyiert werden, sondern von innen kommen (intuitives, spontanes und<br />
partitives Lernen)<br />
� In „Der unbeschulte Kopf“ (1991) propagiert Gardner die vermeintlich<br />
„natürliche“ Wissensaneignung im Vorschulalter als Modell für<br />
schulisches Lernen. Wie der Vergleich von beschulten und unbeschulten<br />
Kindern zeigt, ist Gardners These, der zufolge das „Pauken“ in der Schule<br />
eher schädlich für die Entwicklung ist, jedoch nicht haltbar.<br />
� Kennzeichnend für moderne Instruktionsmodelle ist die stärkere Berücksichtigung<br />
der Lernenden; letztere werden nicht mehr als passive Rezipienten, sondern als<br />
aktive Teilnehmer betrachtet. Folgende Grundannahmen gelten heute als Konsens:<br />
� Lernen als aktiver und konstruktiver Prozess (Bedeutung des Vorwissens etc.)<br />
� Der Lernstoff muss vom Lernenden als bedeutsam und relevant erfahren<br />
werden (kontextuiertes und situiertes Lernen)<br />
� Intrinsisch motivierte Lernprozesse sind nachhaltiger als extrinsisch motivierte.<br />
� Selbstorganisiertes und selbstkontrolliertes Lernen<br />
A) Mehrspeichermodell von Atkinson und Shiffrin (isolierte Lernakte)<br />
� Betrachtet isolierte Lernakte und unterscheidet ausgehend davon zwischen<br />
verschiedenen Gedächtnistypen bzw. Stadien der Informationsverarbeitung:<br />
1. Das Ultra-Kurzzeitgedächtnis (sensorisches Register): In ihm werden für<br />
kurze Zeit (ca. 0,5-2Sek.) alle eintretenden Reize gespeichert (allerdings ohne<br />
bewusst verarbeitet zu werden)<br />
2. Das Kurzzeitgedächtnis (Arbeitsspeicher): durch Aufmerksamkeitszuwendung<br />
gelangt ein Teil der Informationen (7+/-2 Items) in das KZG, das<br />
seinerseits nicht der Speicherung (ca. 30 Sek.), sondern der Verarbeitung von<br />
Infos dient.<br />
3. Langzeitgedächtnis: Durch Wiederholung und Elaboration (Organisation,<br />
Zusammenfassung, Integration) werden die Infos vom KZG ins LZG<br />
übertragen. Um sie später von dort abrufen zu können, bedarf es<br />
entsprechender Hinweisreize und Suchstrategien.<br />
� Didaktische Schlussfolgerungen aus dem Modell:<br />
� Aufmerksamkeit des Lernenden muss auf die wesentlichen Lerninhalte<br />
gerichtet werden<br />
� Es dürfen nicht zu viele Infos gleichzeitig dargeboten werden; Einzelinfos<br />
sollten zu größeren Einheiten zusammengefasst werden (Chunking)<br />
� Vermittlung metakognitiven Wissens und effektiver Verarbeitungsstrategien<br />
� Wiederholungen etc. etc.<br />
B) Kumulatives Lernen (Gagné)<br />
� Grundannahme: Wie gut etwas gelernt wird, hängt vom verfügbaren Vorwissen ab!<br />
8
� An sich eine banale „Erkenntnis“, damals (Anfang der 60er) jedoch eine<br />
Revolution, da man den Lernerfolg bis dahin ausschließlich auf generelle<br />
individuelle Einflussfaktoren (insbes. die Intelligenz) und die Art des<br />
didaktischen Vorgehens zurückführte.<br />
� Heute gelten Vorkenntnisse dagegen als die wichtigste Leistungsdeterminante<br />
(s.u.)<br />
� Nach Gagnés Modell ist der Lernprozess in Abhängigkeit von dem jeweils<br />
erforderlichen Vorwissen in mehrere Stufen zu unterteilen (Sequenzierung des<br />
Lernprozesses); kurz: der Lernstoff muss von unten nach oben strukturiert werden<br />
(hierarchisches Lernen)<br />
� Didaktische Konsequenzen:<br />
� Genaue Sachanalyse (Grundregel: „basics first“)<br />
� Bei der Analyse der Lernvoraussetzungen ist das erwartete Vorwissen die<br />
wichtigste Komponente<br />
� Kritik:<br />
� Das Modell suggeriert einen mechanistischen (streng sequentiellen)<br />
Lernprozess und ist damit grob vereinfachend; schließlich ist Lernen immer<br />
ein konstruktiver Prozess<br />
� Wird das Modell verabsolutiert, widerspricht es den positiven Erfahrungen mit<br />
„natürlichen“ Lernarrangements (Projektunterricht, situiertes Lernen etc.)<br />
C) Lernen als Aufbau und Veränderung von Wissenssystemen (Kintsch)<br />
� Nach Kintschs Modell der Textverarbeitung ist das Vorwissen die wichtigste<br />
kognitive Ressource des Lesers bzw. Lerners.<br />
� Diese Annahme wird durch das Experten-Novizen-Paradigma bestätigt:<br />
Novizen werden von Experten mit vergleichbarem IQ bei Aufgaben in der<br />
betreffenden Domäne immer übertroffen (s.u.).<br />
� Das Besondere an dem Modell besteht darin, dass das Vorwissen nicht nur unter<br />
quantitativen, sondern v.a. unter qualitativen Gesichtspunkten in den Blick<br />
genommen wird. Die Wirksamkeit des Vorwissens hängt ab…<br />
� vom Organisationsniveau (ungeordnet vs. konzeptuell und hierarchisch<br />
strukturiert)<br />
� dem mentalen Repräsentationsmodus (ikonisch vs. verbal-deklarativ vs.<br />
handlungsbezogen-prozedural vs. symbolisch-operativ)<br />
� der Leichtigkeit des Zugriffs auf die Information<br />
� dem Niveau der Operationen, die mit dem Material durchgeführt werden<br />
können (konventionell, intelligent, kreativ)<br />
� Das Modell sensibilisiert dafür, dass es unterschiedliche Qualitätsstufen von Wissen<br />
und Lernen gibt (z.B. oberflächliches Auswendiglernen; verständnisvoller Erwerb<br />
einer geordneten Menge von Infos, tieferes Verständnis übergreifender<br />
Sinnzusammenhänge).<br />
D) Entwicklung und Erwerb inhaltsübergreifender kognitiver Kompetenzen<br />
� Die Vermittlung sog. Schlüsselqualifikationen (also inhaltsübergreifender<br />
Kompetenzen wie kreatives Denken, Teamfähigkeit oder Lernfähigkeit) ist äußerst<br />
populär. Es gilt jedoch die Faustregel: Je allgemeiner eine Strategie bzw. Methode,<br />
desto geringer ist ihr Wert beim Lösen komplexer Probleme.<br />
� Die Erwartungen an Schlüsselqualifikationen dürfen also nicht überstrapaziert<br />
werden!<br />
� Der gegenwärtige Forschungsstand:<br />
9
� Intelligenz und Kreativität lassen sich durch formale Trainingsprogramme<br />
kaum verbessern<br />
� Die Vermittlung allgemeiner Lernstrategien (das Lernen lernen) ist weniger<br />
wirksam als gemeinhin erwartet wird; erfolgreich ist eine solche Vermittlung<br />
nur, wenn sie im Zusammenhang mit inhaltsspezifischem Wissen erfolgt!<br />
� Hilfreich ist v.a. der Erwerb von metakognitivem Wissen, wobei prozedurales<br />
Fertigkeiten (Planung, Kontrolle, Bewertung des eigenen Lernens) wichtiger<br />
sind als das deklarative Metawissen.<br />
E) Lernen als Folge von sozialem Handeln<br />
� In jüngerer Zeit wird zunehmend der soziale Kontext berücksichtigt, in dem<br />
Lernprozesse stattfinden (Familie, Klasse, Religiöse Gemeinschaften etc.). Lernen<br />
wird also nicht mehr nur als individueller, sondern als sozialer Prozess verstanden.<br />
2. Lernphasen<br />
� Formalstufen des Unterrichts (HERBART, WOLFF): Ende 19. / Anfang 20. Jh.<br />
� Grundidee: Zerlegung des Lernstoffs in Einheiten, deren Behandlung<br />
wiederum in mehreren Stufen erfolgen soll.<br />
� Formalstufen nach Wolff:<br />
1) Zielangabe: der Lernende soll über das Lernziel informiert werden<br />
2) Analyse: des neu zu Lernenden, um die Aufmerksamkeit des Lernenden<br />
darauf zu richten<br />
3) Synthese: Darbietung und Erarbeitung des neuen Lehrstoffs<br />
4) Assoziationsstufe: Verknüpfung des neuen Wissens mit bereits<br />
vorhandenem Wissen<br />
5) Stufe des Systems: Systematische Strukturierung und Einordnung des<br />
neuen Wissens<br />
6) Stufe der Methode: Übung und Anwendung des Gelernten<br />
� Kritik: Äußerst starres System, von der Reformpädagogik massiv kritisiert;<br />
veraltete Terminologie; ABER: Modell liefert trotzdem grundlegende<br />
Einsichten in Lehr-Lern-Prozesse<br />
� AN<strong>DER</strong>SON (1982): 3 Stadien beim Erwerb kognitiver Fähigkeiten<br />
� Die von Anderson postulierten Stadien sind:<br />
1) Das kognitive Stadium: Entwicklung eines Problemverständnisses<br />
(Aufbau einer kognitiven, deklarativen Repräsentation des Wissens),<br />
beginnt mit einer Instruktionsphase (Vermittlung der Lerninhalte)<br />
2) Das assoziative Stadium (Wissenskompilation): Prozedualisierung des<br />
deklarativen Wissens; meint also das Erlernen von Fertigkeiten sowie<br />
deren Feinabstimmung („Tuning“)<br />
3) Autonomes Stadium: Automatisierung der gelernten Fertigkeit<br />
� SHUELL (1990): 3 Phasen des Wissenserwerbs<br />
� Das Modell entstand aus der Kritik an den zu starren Phasenmodellen; versteht<br />
sich nicht als starres System, sondern als heuristisches Schema<br />
1) Initialphase: Einzelinfos sind noch ungeordnet, mehr oder minder<br />
unverbunden und dementsprechend schwer durchschaubar; die Instruktion<br />
muss in dieser Phase einerseits informieren, das vorhandene Vorwissen<br />
aktivieren und ermutigen, andererseits Gelegenheit zu explorativem<br />
Verhalten und produktiven Fehlern geben.<br />
2) Zwischenphase: Erfassen von Zusammenhängen und Gesetzmäßigkeiten,<br />
Bildung abstrakter Schemata etc.; die Instruktion hat diesen Prozess zu<br />
10
unterstützen (z.B. durch Bereitstellung entsprechender Lernarrangements,<br />
sokratische Dialoge; informative Rückmeldungen etc.)<br />
3) Endphase: Bessere Integration des neuen Wissens in das Vorwissen,<br />
Automatisierung der erlernten Fertigkeiten<br />
3. Instruktionsmodelle und -methoden<br />
� Grundsätzlich lassen sich 2 „Instruktionsschulen“ unterscheiden:<br />
� Verhaltensorientierte Ansätze gehen davon aus, dass external gesteuerte<br />
Lernprozesse am effektivsten sind und setzen dementsprechend auf<br />
lehrerzentrierte Instruktionsformen (direkte und adaptive Instruktion)<br />
� Konstruktivistische Ansätze propagieren dagegen schülerzentrierte Methoden,<br />
bei denen die Lerner ihren Lernprozess weitgehend selbst gestalten.<br />
� Ein klassisches Beispiel hierfür ist Bruners Konzept des<br />
entdeckenlassenden Lernens; außerdem alle Formen „offenen Unterrichts“<br />
(kooperatives Lernen, selbstreguliertes Lernen etc. etc.)<br />
� Wichtig: Welche Lernform die beste ist, lässt sich nicht pauschal sagen, sondern<br />
hängt a) von den individuellen Lernvoraussetzungen, b) dem jeweiligen Lerninhalt<br />
und c) dem Lernziel ab.<br />
A) Direkte Instruktion<br />
� Die Methode der direkten Instruktion zielt auf eine externale und damit<br />
lehrerzentrierte Steuerung des Lernprozesses (hohes Maß an Kontrolle). Sie ist<br />
empirisch gut untersucht (Prozess-Produkt-Paradigma) und hat sich als hoch effizient<br />
erwiesen.<br />
� Widerspruch?! - Die Effektivität direkter Instruktion scheint der Annahme zu<br />
widersprechen, Lernen sei dann besonders nachhaltig, wenn es sich um einen<br />
aktiven, vom Lerner selbst gestalteten Prozess handelt. Dieser Widerspruch<br />
löst sich jedoch auf, wenn man bedenkt, dass aktive Teilnahme durch direkte<br />
Instruktion keineswegs ausgeschlossen wird!<br />
� Formen direkter Instruktion: Frontalunterricht, darbietender Unterricht,<br />
Unterrichtsvortrag, gelenktes Unterrichtsgespräch etc.<br />
� Hauptkomponenten direkter Instruktion:<br />
1) Rückblick auf die vorangegangene Stunde und Überprüfung der<br />
Lernvoraussetzungen<br />
� Ziel: Wiederholung, Festigung, Aktualisierung und Aktivierung relevanten<br />
Vorwissens<br />
2) Darstellende Stoffvermittlung<br />
� Explizite Präsentation des Lernstoffs (etwa durch Lehrervortrag) =<br />
inhaltlicher Kern der direkten Instruktion<br />
3) Angeleitetes Üben und Verstehensprüfung<br />
� Ziel: Vorbereitung des selbständigen Übens; Erfolgskontrolle<br />
� Gezielte Fragen zum Stoff (etwa in einem gelenkten Unterrichtsgespräch)<br />
4) Lernüberwachung und korrigierende Rückmeldung<br />
� Adäquates Feedback auf die Schülerantworten<br />
5) Selbständiges Üben<br />
� Ziel: Festigung und Automatisierung des Gelernten (etwa durch Stillarbeit<br />
oder Hausaufgaben)<br />
6) Rückblick und Lernerfolgskontrolle<br />
� Wöchentliche Zusammenfassung des Gelernten, regelmäßige<br />
Leistungstests<br />
11
� AUSUBELS Assimilationstheorie: Ausubel (1968) unterscheidet anhand zweier<br />
Dimensionen vier Formen sprachlichen Lernens:<br />
� Die Dimensionen:<br />
1) Sinnvolles vs. mechanisches Lernen<br />
2) Rezeptives vs. entdeckendes Lernen<br />
� Die Lernformen:<br />
1) Sinnvolles Lernen: beim sinnvollen Lernen wird das Gelernte inhaltlich<br />
verstanden und sinnvoll mit dem Vorwissen verknüpft (Assimilation)<br />
2) Mechanisches Lernen: meint dagegen wortwörtliches und stupides<br />
Auswendiglernen; das neu Gelernte wird dabei weder verstanden, noch<br />
assimiliert.<br />
3) Rezeptives Lernen: dabei wird dem Schüler der Lernstoff in fertiger Form<br />
dargeboten (z.B. als Lehrbuchtext oder Unterrichtsvortrag)<br />
4) Entdeckendes Lernen: dabei werden die Lernergebnisse vom Schüler<br />
selbst erarbeitet (Versuche, Projekt- und Gruppenarbeit etc.)<br />
� Ausubel propagiert „sinnvoll-rezeptives Lernen“ als die beste Variante; er ist<br />
also für direkte Instruktion bzw. „darstellendes Unterrichten“: Ziel ist die<br />
Ausbildung einer hierarchischen Wissensstruktur, erreicht wird dieses Ziel<br />
durch das Prinzip der progressiven Differenzierung; heißt: Allgemeine<br />
Begriffe sollten durch neues Wissen spezifiziert werden (unterordnendes bzw.<br />
deduktives Vorgehen)<br />
� Ausubels Ansatz steht im Gegensatz zum Ansatz Bruners, der das „sinnvollentdeckende<br />
Lernen“ propagiert (s.u.)<br />
B) Adaptive Instruktion<br />
� Die adaptive Instruktion steht nicht in Konkurrenz zur direkten Instruktion, sondern<br />
stellt eine Präzisierung bzw. Ergänzung dieser Methode dar: Bedingt durch die<br />
heterogene Zusammensetzung von Schulklassen müssen die Unterrichtszeit, die<br />
verwendeten Methoden und die Lernziele in Abhängigkeit von den jeweils<br />
vorliegenden Lernvoraussetzungen variiert werden (Adaption bzw.<br />
Individualisierung).<br />
� Entwickelt wurde das Konzept in den 80er Jahren von Corno und Snow<br />
� Adaptive Maßnahmen lassen sich nach folgenden Kriterien systematisieren:<br />
� Adaptionszweck:<br />
� Z.B. Kompensation und Beseitigung von Lern- und Leistungsdefiziten;<br />
gezielte Förderung von Talenten etc.<br />
� Adaptionsmaßnahme:<br />
� Angepasst werden kann die Lernzeit, die Lehrmethode oder das Lernziel<br />
� Adaptionsrate:<br />
� Makroadaptionen: Lang- und mittelfristig angelegte Adaptionsmaßnahmen,<br />
über die bereits vor Beginn einer Lehreinheit entschieden<br />
wird (z.B. das dreigliedrige Schulsystem in Deutschland oder die Wahl<br />
von Grund- und Leistungskursen)<br />
� Mikroadaptionen: Kurzfristige Adaptionsmaßnahmen, die während des<br />
Lernprozesses vorgenommen werden („Feintuning“)<br />
� Formen adaptiver Instruktion:<br />
� Programmierter Unterricht: geht auf SKINNER zurück und basiert auf den<br />
Prinzipien des operanten Konditionierens; in programmierten Lehrbüchern ist<br />
der Lehrstoff in kleine, aufeinander aufbauende Einheiten zerlegt. Die<br />
Darbietung der Einheiten erfolgt in Abhängigkeit von dem bereits<br />
12
vorhandenen Vorwissen. Letzteres wird ermittelt, indem auf jede Einheit eine<br />
Frage folgt. Auf jede Antwort gibt es ein unmittelbares Feedback.<br />
� Der PU ist ein Vorläufer der „computerunterstützten Instruktion“ (CUI)<br />
und computerbasierter „intelligenter Tutorensysteme“ (ITS): s.u.<br />
� Tutoriell unterstütztes Lernen (ITS): basiert genau wie der programmierte<br />
Unterricht im Wesentlichen auf 2 Systemmodulen: Dem „Expertenmodul“, in<br />
dem das (objektiv) zu erlangende Wissen repräsentiert ist, und dem<br />
„Lernermodul“, das den (subjektiven) Wissensstand des Lerners repräsentiert<br />
und gewissermaßen das Diagnosemodul des Systems darstellt.<br />
� Zielerreichendes Lernen („learning for mastery“) nach BLOOM: Äußerst<br />
optimistischer Ansatz, der davon ausgeht, dass alle alles lernen können, wenn<br />
man ihnen nur die nötige Zeit dazu lässt (Credo: „Alle Schüler schaffen es!“);<br />
Grundlage des Modells sind Carolls Überlegungen zur Bedeutsamkeit der<br />
aktiven Lernzeit; CAROLL ersetzt die stabilen Persönlichkeitsparameter<br />
(Intelligenz etc.) durch die beeinflussbaren (und damit pädagogisch<br />
relevanten) Parameter Zeit und Anstrengung (Rekonzeptualisierung des<br />
Begabungsbegriffs).<br />
� Probleme des Ansatzes:<br />
- Zeit ist begrenzt, der Ansatz daher unrealistisch<br />
- Konzept geht trotz vorgeschlagener „enrichement activities“ auf<br />
Kosten der leistungsstarken Schüler<br />
- Mehr Zeit allein reicht nicht, die zur Verfügung gestellte Zeit muss<br />
auch entsprechend genutzt werden; die Bedeutung von Ausdauer und<br />
Motivation wird von Bloom jedoch ausgeblendet (anders bei Caroll)<br />
C) Entdeckenlassendes Lehren / entdeckendes Lernen (Bruner)<br />
� Das Konzept des „entdeckenden Lernens“ geht auf BRUNER zurück (Ende der 50er);<br />
es bildet die Grundlage nahezu aller konstruktivistischen Lehr-Lern-Modelle (z.B.<br />
situiertes Lernen, kooperatives Lernen, problemorientiertes Lernen etc.)<br />
� Das Konzept beruht auf der Annahme, dass selbst erarbeitetes Wissen besser<br />
behalten wird als übernommenes Wissen.<br />
� Darüber hinaus fördert es die intrinsische Motivation<br />
(„Kompetenzmotivation“, Neugierde) und trägt zur Entwicklung einer<br />
allgemeinen Problemlösefähigkeit bei!<br />
� Da schulisches Lernen immer nur exemplarisch sein kann, ist es nach Bruner das<br />
oberste Ziel von Schule, positiven Transfer zu fördern, also die Fähigkeit, bereits<br />
angeeignetes Wissen bzw. erworbene Fertigkeiten in neuen Anforderungssituationen<br />
erfolgreich anzuwenden.<br />
� Während der Schulzeit sollte daher nach Bruner induktives Denken im<br />
Vordergrund stehen (vom Besonderen zum Allgemeinen), später kann neuer<br />
Stoff dann deduktiv erschlossen werden.<br />
� Grundformen entdeckenden Lernens: A) Problemlösendes Lernen, B) Lernen an<br />
Beispielen, C) Lernen durch Explorieren und Experimentieren<br />
� AUSUBEL hat an dem Konzept des entdeckenden Lernens scharfe Kritik geübt:<br />
� Ineffezient, da zeitraubend<br />
� Diskriminierend, da schwächere Schüler systematisch benachteiligend<br />
� Vernachlässigung der Inhalte (zugunsten vermeintlicher<br />
„Schlüsselqualifikationen“)<br />
� Gefahr, Fehlkonzepte zu erlernen<br />
13
D) Kooperatives Lernen<br />
� Kooperatives Lernen bezeichnet ein breites Spektrum von Unterrichtsformen,<br />
denen gemeinsam ist, dass die Schüler in Kleingruppen (2-6 Personen)<br />
zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.<br />
� Kooperatives Lernen wirkt sich nicht nur positiv auf die Lernleistung, sondern auch<br />
auf das Sozialverhalten (Klassenklima etc.) aus.<br />
� Lernleistung: Beteiligung aller; Motivationssteigerung, reziproke Instruktion<br />
(Lernen durch Lehren) etc.<br />
� Sozialverhalten: Teamfähigkeit, prosoziales Verhalten, Integrationsprozesse,<br />
Klassenklima etc.<br />
� Gefahren kooperativen Lernens (negative Gruppenprozesse):<br />
� Soziales Faulenzen (free rider- und sucker-Effekt); Diskriminierung Einzelner<br />
etc.<br />
� Damit kooperatives Lernen positive Effekte zeigt müssen zumindest zwei<br />
Minimalbedingungen erfüllt sein:<br />
1) Positive Interdependenz: Die einzelnen Gruppenmitglieder müssen ein<br />
gemeinsames Ziel haben und bei der Erreichung dieses Ziels aufeinander<br />
angewiesen sein<br />
� Z.B. durch teambezogene Belohnung (Beurteilung der Gruppenleistung)<br />
und/oder aufgabenbezogene Interdependenz (Arbeitsteilung)<br />
2) Individuelle Verantwortlichkeit: Die individuellen Leistungen müssen<br />
identifizierbar sein und sollten einzeln in die Gesamtbewertung einfließen<br />
� Z.B. durch Summierung der individuellen Leistungswerte zu Teamscores<br />
3) Wichtig, wenn auch nicht zwingend notwendig ist außerdem die heterogene<br />
und dabei möglichst ausgewogene Zusammensetzung der Gruppen.<br />
� Nach SLAVIN müssen drei Bedingungen erfüllt sein, um effektives kooperatives<br />
Lernen zu ermöglichen:<br />
1) Teambezogene Belohnung<br />
2) Individuelle Verantwortlichkeit<br />
3) Gleiche Erfolgschancen für alle (die Bewertung sollte also so erfolgen, dass<br />
hoch und wenig leistungsfähige Schüler gleiche Anteile zum Gruppenergebnis<br />
beitragen können.<br />
� Beispiele für kooperative Lernarrangements:<br />
� Die Jigsaw- bzw. Gruppenpuzzle-Methode nach ARONSON:<br />
� Aufteilung einer Aufgabe in verschiedene Unteraufgaben, für die jeweils<br />
„Experten“ bestimmt werden (aufgabenbezogene Interdependenz); die<br />
„Experten“ für ein bestimmtes Thema arbeiten in sog. „Focus-Groups“<br />
zusammen und bringen die dort erarbeiteten Ergebnisse später in ihre<br />
jeweilige „Home-group“ ein.<br />
� Abschließend wird das gesamte Wissen individuell überprüft (individuelle<br />
Verantwortlichkeit)<br />
� „Student-Teams-Achievement-Devisions“ (STAD) nach SLAVIN:<br />
� Schülerteams bereiten sich gemeinsam auf regelmäßige Tests vor, bei<br />
denen es darum geht, ein möglichst gutes Gesamtergebnis zu erzielen.<br />
� Belohnt wird also nicht die Einzelleistung, sondern das Gruppenergebnis<br />
(teambezogene Belohnung), das sich jedoch aus den Einzelleistungen<br />
zusammensetzt (individuelle Verantwortlichkeit);<br />
� Darüber hinaus werden die Gruppen in Rangreihen gebracht, so dass<br />
immer nur die Schüler eines Leistungsniveaus miteinander verglichen<br />
werden (Gleiche Erfolgschancen für alle)<br />
14
E) Selbständiges Lernen<br />
� Selbstreguliertes Lernen ist nicht nur Ziel, sondern zugleich Voraussetzung und<br />
Mittel des Unterrichts. Man versteht darunter die Fähigkeit, Lernprozesse selbst zu<br />
steuern.<br />
� Komponenten selbstregulierten Lernens:<br />
� Kognitive Komponente: Selbstreguliertes Lernen erfordert die Fähigkeit zur<br />
Introspektion, da nur so ein Metawissen über das eigene Lernen aufgebaut<br />
werden kann; bei der Verfeinerung dieses Wissens kommt der Schule eine<br />
entscheidende Rolle zu; darüber hinaus gibt es Trainingsprogramme zur<br />
Verbesserung der Lern- und Denkstrategien.<br />
� Motivationale, volitionale und emotionale Komponenten: Selbstmanipulation<br />
von Gefühlen, Einstellungen und Aufmerksamkeitsverteilungen (z.B. zur<br />
Aufrechterhaltung eines realistischen, positiv getönten Selbstbilds)<br />
4. Instruktionsprinzipien<br />
� Interindividuelle Unterschiede müssen bei der Instruktion berücksichtigt werden<br />
(Passung bzw. Adaptivität)<br />
� Instruktionsmaßnahmen müssen zumindest zu einem gewissen Grad motivierend<br />
wirken!<br />
� Mangelndes Vorwissen muss ist durch Instruktion zu kompensieren!<br />
� Neben inhaltlichem Wissen soll immer auch das Lernen selbst gelehrt werden!<br />
� Rückmeldungen sind ein notwendiges Steuerungsmittel von Lehr-Lernprozessen!<br />
5. Handlungsleitende Kognitionen von Lehrern<br />
� Handlungsziele von Lehrern:<br />
� V.a. im internationalen Vergleich gibt es häufig massive Unterschiede im<br />
Hinblick auf die Erziehungsziele von Lehrern.<br />
� W.C. Wong: Während z.B. deutsche Lehrer Achtung und Toleranz<br />
gegenüber Andersdenkenden überwiegend als das wichtigste Lernziel<br />
einstufen, rangiert dieses Ziel bei chinesischen Lehrern eher weiter unten.<br />
� Auffällig ist, dass zwischen den von Lehren geäußerten Zielen und ihrem<br />
Verhalten oft eine erhebliche Diskrepanz besteht.<br />
� Mögliche Erklärung: Aufgrund der heterogenen Erwartungen, mit denen<br />
sich Lehrer konfrontiert sehen, müssen sie widersprüchliche<br />
Handlungsziele (z.B. Förderung von Selbständigkeit und Disziplin)<br />
miteinander in Einklang bringen.<br />
� Die von den Lehrern am wichtigsten erachteten Erziehungsziele<br />
(Gerechtigkeit, Verantwortungsbewusstsein etc.) sind meist so allgemein, dass<br />
ihnen keine konkreten Handlungsziele entsprechen (es fehlt an<br />
Umsetzungsvorschlägen).<br />
� Pädagogische Oberziele werden nur dann verfolgt, wenn ein störungsfreier<br />
Unterrichtsablauf gesichert ist<br />
� Erwartungen von Lehrern: Erwartungen haben die Tendenz, sich selbst zu erfüllen;<br />
dieses Phänomen wird als Pygmalioneffekt bzw. „self-fulfilling prophecy“ bezeichnet.<br />
� Das klassische Experiment zum Pygmalioneffekt stammt von ROSENTHAL<br />
& JACOBSON (1968/69): Darin wurde Grundschullehrern am Anfang des<br />
Schuljahres weisgemacht, einige (in Wahrheit willkürlich ausgewählte)<br />
Schüler hätten ein besonderes Entwicklungspotenzial; am Ende des<br />
15
Schuljahres wiesen diese Schüler dann tatsächlich einen höheren<br />
Intelligenzzuwachs als die übrigen Schüler auf.<br />
� Vermittelt wird der Effekt u.a. durch: mehr Lob, mehr Aufmerksamkeit,<br />
mehr Zeit für Antworten, mehr Lerngelegenheiten etc.<br />
� Kausalattributionen von Lehrern: haben Einfluss auf deren Erwartungsbildung<br />
� WEINER unterscheidet anhand zweier Dimensionen (Stabilität und<br />
Lokalisation) zwischen 4 Arten, Erfolg bzw. Misserfolg zu attribuieren:<br />
Internal External<br />
Zeitstabil Fähigkeit Aufgabenschwierigkeit<br />
Zeitvariabel Anstrengung Zufall<br />
� Stabilitäts- bzw. Zeitdimension hat Einfluss auf die Erwartung künftiger<br />
Leistungen; die Lokalisation beeinflusst die Art der Rückmeldung.<br />
� Die Kausalattribution von Schülerleistungen ist somit ein wichtiges<br />
Vermittlungsglied zwischen der Wahrnehmung einer Schülerleistung und<br />
der Reaktion darauf.<br />
� Der Attributionsstil des Lehrers wiederum überträgt sich (vermittelt durch die<br />
Art der Rückmeldungen) auf die betroffenen Schüler und kann somit sowohl<br />
motivierend (Anstrengung) als auch demotivierend (Fähigkeit) wirken.<br />
� Bezugsnormorientierung von Lehrern hat Einfluss auf den Attributionsstil:<br />
� Soziale Bezugsnorm (interindividueller Vergleich) => fördert zeitstabile<br />
Ursachenerklärungen (da sich die Rangfolge in einer Klasse meist nur<br />
geringfügig verändert)<br />
� Individuelle Bezugsnorm: (intraindividueller Vergleich) => lenkt<br />
Aufmerksamkeit eher auf Veränderungen<br />
� [Bezugsnormorientierung �] Lehrerattribution [� Erwartungshaltung,<br />
Feedback] � Schülerattribution � Motivation<br />
6. Motivationale und emotionale Bedingungen des Lehrerhandelns<br />
� LENZ & DE JESUS haben ein Modell zur Beschreibung der<br />
Motivationsentwicklung bei Lehrern entwickelt. Als Erklärung für den häufig zu<br />
beobachtenden Motivationsabfall von Lehrkräften ziehen die beiden Seligmanns<br />
Theorie von der „gelernten Hilflosigkeit“ heran.<br />
� Lehrer, die häufig die Erfahrung machen, zu scheitern, tendieren dazu, dieses<br />
Scheitern auf internale und zeitstabile – kurz: unkontrollierbare Faktoren<br />
(mangelnde Fähigkeit) zurückzuführen.<br />
� Mögliche Reaktionen: Resignation, Burnout, Motivationsverlust,<br />
Anpassung der Ziele an das Machbare<br />
� Emotionen und Kognitionen beeinflussen sich wechselseitig; es handelt sich dabei<br />
um 2 interagierende Steuerungssysteme:<br />
� Kognitionen: haben Einfluss darauf, welche Emotion aufkommt (Appraisal)<br />
� Emotionen: beeinflussen u.a. die Aufmerksamkeit, die<br />
Informationsverarbeitung, das Gedächtnis und den Attributionsstil; darüber<br />
hinaus haben sie (auch in Unterrichtssituationen) eine kommunikative<br />
Funktion!<br />
� Für den Lehrerberuf besonders relevante Emos sind Angst und Ärger<br />
16
7. Lehrertraining(s)<br />
� Es gibt Trainingsprogramme zur Bewältigung von Belastungssituationen; zur<br />
Förderung der sozialen Handlungskompetenz und zur Förderung der<br />
Unterrichtskompetenz.<br />
� Grundsätzlich gilt: Trainingsprogramme für Lehrer sind dann besonders effizient,<br />
wenn sie sowohl auf der kognitiven Ebene (Wahrnehmung und Interpretation von<br />
Situationen, Handlungswissen etc.), als auch auf der Verhaltensebene (Einübung<br />
adäquater Reaktionsmuster) ansetzen und dabei die bereits vorhandene Expertise der<br />
teilnehmenden Lehrer mit einbeziehen.<br />
� Das Münchener Lehrertraining von HAVERS (1998) ist als 5-tägiges<br />
Blockseminar konzipiert und richtet sich an Lehramtsstudenten in höheren Semestern.<br />
� Die beiden Schwerpunkte des Trainings sind:<br />
a) Einübung sozialer Kompetenzen für den Umgang mit<br />
Disziplinschwierigkeiten (praktische Komponente): Rollenspiele und<br />
Videofeedback<br />
b) Reflexion der persönlichen Vorstellungen vom Lehrerberuf (kognitive<br />
Komponente): Pädagogische Autobiographien; Collagen zum Thema „ich<br />
und mein Beruf“<br />
� Das Programm wird von Teilnehmern als sehr hilfreich beurteilt und scheint<br />
eine positive Langzeitwirkung zu haben.<br />
� Das Konstanzer Trainingsmodell verfolgt eine ähnliche Zielsetzung, ist aber<br />
wesentlich breiter angelegt: Einübung konkreter Handlungsmuster zur Bewältigung<br />
verschiedener Standardsituationen<br />
8. Besonderheiten der Hochschullehre<br />
� Obwohl die Forderung nach Qualitätsstandards auch im Hochschulbereich zunehmend<br />
virulenter wird (gesetzlich vorgeschriebene Lehrevaluation etc.), gibt es bisher keine<br />
systematische Didaktikausbildung für Hochschullehrer (Professionalisierungsdefizit).<br />
� Folgende Prinzipien guter Hochschullehre lassen sich aus den allgemeinen<br />
Erkenntnissen der Lehr-Lern-Forschung ableiten: Gute Hochschullehre…<br />
1. …fördert den Kontakt zw. Student und Dozent<br />
2. …fördert die Kooperation zwischen Studenten<br />
3. …fördert aktives Lernen<br />
4. …gibt prompte Rückmeldung<br />
5. …legt großen Wert auf studienbezogene Tätigkeiten<br />
6. …stellt hohe Ansprüche<br />
7. …beachtet unterschiedliche Fähigkeiten und Lernwege<br />
� Die subjektiven Theorien über gute Hochschullehre bewegen sich auf einem<br />
Kontinuum zwischen folgenden Polen:<br />
1. Dozentenzentrierte Informationsvermittlung (Student als mehr oder minder<br />
passiver Informationsempfänger; wichtigsten Kriterium ist die Aktualität der<br />
Lehrinhalte)<br />
2. Studentenorientierte Unterstützung des Lerners (Ziel ist es, den Studenten<br />
zu eigenständigem, autonomen Lernen zu befähigen)<br />
� Wichtig: Die Art des Lehrens beeinflusst die Art des Lernens; d.h.: Studenten lernen<br />
so wie sie erwarten, geprüft zu werden. Eine dozentenorientierte Stoffvermittlung<br />
führt dabei eher zu oberflächlichem Auswendiglernen, eine studentenorientierte<br />
Lehrweise zu eigener Auseinandersetzung und tieferem Verständnis. Letztere ist<br />
demnach effektiver!<br />
17
� Programme zur didaktischen Professionalisierung der Hochschullehre werden erst<br />
nach und nach entwickelt und bisher v.a. in Form von Workshops und Seminaren<br />
angeboten.<br />
� Die Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik (AHD) bemüht sich<br />
gegenwärtig um curriculare Rahmenkonzepte für das hochschuldidaktische<br />
Ausbildungsangebot.<br />
� In Baden-Württemberg gibt es ein Hochschuldidaktikzentrum (HDZ), an<br />
dem nach 200 Unterrichtseinheiten (aufgeteilt in 3 Module) ein<br />
hochschuldidaktisches Zertifikat erworben werden kann.<br />
� Als besonders effizient hat sich die Methode des Microteachings erwiesen:<br />
Kurze Präsentation (+ Videoaufzeichnung) => Evaluation => Erneute<br />
(verbesserte) Präsentation => Erneutes Feedback!<br />
18
A 3: Kognitive Determinanten von Schulleistung<br />
1. Zur multiplen Determiniertheit von Schulleistung<br />
� Ziele von Bildung und Unterricht: Schule verfolgt multiple, z.T. gegenläufige Ziele<br />
(z.B. Disziplin und Selbständigkeit; Qualifizierung und Egalisierung etc.)<br />
� BLOOM: Schule verfolgt affektive und kognitive Lernziele; letztere lassen<br />
sich hierarchische strukturieren (Kennen => Verstehen => Anwenden =><br />
Analyse => Synthese => Bewertung)<br />
� WEINERT: Die wichtigsten Ziele von Schule sind a) die Vermittlung<br />
speziellen Wissens und Könnens sowie b) die Förderung der kognitiven<br />
Entwicklung im Allgemeinen.<br />
� Die Prädiktoren von Schulleistung lassen sich folgendermaßen systematisieren:<br />
� Inhaltliche Unterteilung in individuelle, schulische und außerschulische<br />
Faktoren:<br />
� Individuelle Faktoren<br />
- Kognitive Personenmerkmale des Lerners (Intelligenz, Vorwissen)<br />
- Motivationale und affektive Merkmale des Lerners (Fleiß, Angst etc.)<br />
� Schulische Faktoren<br />
- Merkmale des Unterrichts (Qualität und Quantität)<br />
- Klassensituation, Schulklima etc.<br />
� Außerschulische Faktoren<br />
- Politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen<br />
- Familiärer Hintergrund etc.<br />
� Formale Unterteilung in proximale und distale Faktoren:<br />
� Proximale Faktoren: individuelle Lernvoraussetzungen,<br />
Prozessmerkmale des Unterrichts<br />
� Distale Faktoren: Strukturmerkmale von Familien, Schul- und<br />
Unterrichtsklima, Persönlichkeitsmerkmale des Lehrers etc.<br />
� Faktoren auf der Individualebene (einzelner Schüler), der Mikroebene<br />
(Klasse: Größe, Klima etc.), Mesoebene (Schule: Klima, Einzugsbereich etc.),<br />
Makroebene (Land: Schulsystem, Bildungspolitik etc.)<br />
� Entscheidend ist, dass zwischen den verschiedenen Determinanten Überlappungen<br />
und wechselseitige Abhängigkeiten bestehen. Insofern macht es kaum Sinn, einzelne<br />
Determinanten isoliert zu betrachten.<br />
� Je höher z.B. die Unterrichtsqualität, desto weniger ist der Lernzuwachs von<br />
den kognitiven Voraussetzungen der Schüler abhängig.<br />
� Schließlich zeichnet sich guter Unterricht u.a. dadurch aus, dass die<br />
Schüler möglichst individuell gefördert werden und Unterschiede im<br />
Vorwissen zu Beginn einer Unterrichtseinheit egalisiert werden<br />
(Wiederholung der Lerneinheiten, evtl. Vermittlung von Nachhilfe,<br />
Elternkontakt, zusätzliche Lernangebote etc.).<br />
� Auch die kognitiven und affektiv-motivationalen Merkmale des Lerners<br />
interagieren miteinander. Sie stehen entweder im Verhältnis der Kopplung<br />
oder der Kompensation zueinander.<br />
� Von Kopplung spricht man, wenn für einen bestimmten Effekt<br />
Mindestausprägungen verschiedener Variablen notwendig sind.<br />
Schwierige Aufgaben erfordern beispielsweise ein Mindestmaß an<br />
Intelligenz und Anstrengung.<br />
� Leichtere Aufgaben können dagegen entweder mit Intelligenz oder<br />
Anstrengung gelöst werden. Mangelnde Anstrengung kann durch eine<br />
19
entsprechende Intelligenz-, geringe Intelligenz durch entsprechende<br />
Anstrengung kompensiert werden.<br />
� Insbesondere die individuellen Determinanten der Schulleistung sind mit<br />
einer Vielzahl anderer Variablen konfundiert (s.u.); man spricht in diesem Fall<br />
von Kommunalität (= konfundierte Varianz)<br />
� Die Intelligenz beispielsweise mit der familiären Herkunft, aber auch mit<br />
der Unterrichtsqualität (s.o.)<br />
� Fazit: Die Determinanten von Schulleistung ausfindig zu machen, ist aus mehreren<br />
Gründen schwierig.<br />
1. Komplexität des Kriteriums: Schulleistung ist ein komplexes Konstrukt,<br />
dessen Erfassung umstritten ist, sofern diese davon abhängt, welche<br />
Erwartungen an schulisches Lernen gestellt werden (multiple<br />
Zielvorstellungen: kognitive und affektive Lernziele etc.)<br />
2. Komplexität des Bedingungsgefüges: Die Prädiktoren bzw. Determinanten<br />
von Schulleistung sind vielfältig (multiple Determiniertheit) und stehen<br />
zueinander in Wechselwirkung; sie können gleichläufige, gegenläufige oder<br />
substitutive Beziehungen zum Kriterium aufweisen.<br />
� Einzelne Prädiktoren herauszugreifen ist vor diesem Hintergrund nur<br />
bedingt möglich; so sind z.B. individuelle Determinanten (wie Intelligenz<br />
und Vorwissen) nur bedingt von den Kontextbedingungen (Klassenklima<br />
etc.) und den Merkmalen des Unterrichts zu trennen. Kurz: die<br />
verschiedenen Untersuchungsebenen (Individualebene, Mikroebene,<br />
Mesoebene, Makroebene) hängen zusammen. Streng genommen können<br />
Schüler einer Klasse, die Klassen einer Schule, die Schulen eines Landes<br />
daher nicht als unabhängige Beobachtungseinheiten gelten.<br />
� Statistische Verfahren: Mehrebenenanalyse, Kommunalitätenanalyse<br />
(dient zur statistischen Trennung konfundierter Variablen)<br />
2. Modelle schulischen Lernens<br />
A) Carrolls Modell (1963)<br />
� Nach CAROLL ergibt sich der Lernerfolg aus dem Verhältnis der aufgewandten zur<br />
benötigten Lernzeit. Wird so viel Lernzeit aufgewendet, wie benötigt wird, ist das<br />
Ergebnis positiv, so die Annahme (s.o.)!<br />
� Die benötigte Lernzeit hängt ab von…<br />
a) der aufgabenspezifischen Begabung<br />
b) der Fähigkeit, die Aufgabenstellung zu verstehen (Instruktionsverständnis)<br />
c) der Unterrichtsqualität<br />
� Die aufgewendete Lernzeit hängt ab von…<br />
a) der Ausdauer bzw. Lernmotivation und<br />
b) der vom Lehrer zugestandenen Lernzeit<br />
c) wobei auch diese beiden Variablen nicht zuletzt von der Unterrichtsqualität<br />
beeinflusst werden<br />
� Kritik:<br />
� Das Modell eröffnet verschiedene Ansatzpunkte pädagogischer Intervention<br />
� Es lässt aber offen, wie die genannten Einflussfaktoren (Begabung,<br />
Unterrichtsqualität) zu einander in Beziehung stehen: Sind sie z.B. additiv<br />
miteinander verknüpft, so dass die mangelnde Ausprägung einzelner Variablen<br />
kompensiert werden kann (z.B. mangelnde Begabung durch hohe<br />
Unterrichtsqualität) oder sind sie multiplikativ miteinander verknüpft?!<br />
20
� Slavins QUAIT-Modell, das die modifizierbaren Stellgrößen des Carroll-Modells<br />
zusammenfasst (s.u.), geht davon aus, dass diese Größen multiplikativ verknüpft- und<br />
daher nicht ohne Verlust kompensierbar sind:<br />
� Quality (Unterrichtsqualität im engeren Sinn, z.B. Strukturiertheit)<br />
� Appropriateness (Angemessenheit des Vorgehens)<br />
� Incentives (Motivierungsqualität)<br />
� Time (Zeitnutzung)<br />
Blooms Modell (1976)<br />
� Bloom differenziert den Lernerfolg im Hinblick auf den Lernbereich (kognitive vs.<br />
affektive Lernergebnisse) und die Leistungseffizienz (sprich: die gelernte Menge in<br />
Relation zu der dafür benötigten Zeit)<br />
� Abhängig ist der Lernerfolg nach Bloom von 3 Bedingungsgruppen:<br />
1. Affektive Lernvoraussetzungen<br />
� Lernmotivation, Interesse, Einstellung zu Schule etc.)<br />
2. Kognitive Lernvoraussetzungen<br />
� Intelligenz, Vorwissen<br />
3. Qualität des Unterrichts<br />
� Schrittweise Darbietung der Unterrichtsinhalte<br />
� Positive Verstärkung<br />
� Hoher Anteil an aktiver Lernzeit<br />
� Unmittelbares Feedback<br />
� Die entscheidende pädagogische Stellgröße ist die Unterrichtsqualität, wobei Bloom<br />
davon ausgeht, dass es v.a. darauf ankommt, den Schülern in Abhängigkeit von ihren<br />
Voraussetzungen genügend Zeit zu lassen (Vgl. hierzu sein optimistisches Konzept<br />
des zielerreichenden Lernens: s.o.)<br />
B) Walbergs Produktivitätsmodell (80er Jahre)<br />
� Walbergs Modell basiert auf der Metaanalyse mehrerer tausend Studien! Den Daten<br />
zufolge hängt die Produktivität eines Lernenden von insgesamt 9 Faktoren ab; diese<br />
Faktoren korrelieren jeweils unterschiedlich stark mit der Schulleistung und lassen<br />
sich 3 Bereichen zuordnen:<br />
1. Personenmerkmale:<br />
� Kognitive Fähigkeiten / Vorwissen (0.44)<br />
� Entwicklungsstand (0.10)<br />
� Motivation (0.29)<br />
2. Unterrichtsvariablen<br />
� Qualität des Unterrichts (0.48)<br />
� Quantität des Unterrichts (0.38)<br />
3. Kontextvariablen<br />
� Häusliches Umfeld (0.31)<br />
� Klassen- und Schulklima (0.20)<br />
� Außerschulische Peerbeziehungen (0.19)<br />
� Massenmediennutzung (-0.06)<br />
� Nach Walberg sind diese Faktoren multiplikativ miteinander verknüpft; Defizite bei<br />
einzelnen Determinanten sind demnach, wenn überhaupt, nur schwer auszugleichen.<br />
� Ob dem im Einzelnen tatsächlich immer so ist, ist jedoch umstritten.<br />
Insbesondere im Hinblick auf die 4 Kontextvariablen wird häufig eine<br />
Substituier- bzw. Kompensierbarkeit für möglich gehalten.<br />
21
C) Helmkes Angebots-Nutzungs-Modell (2002)<br />
� Helmke beschreibt Unterricht als Angebot, das vom Schüler genutzt werden muss . Ob<br />
der Schüler den Unterricht nutzt, hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab:<br />
� Merkmale der Lehrerpersönlichkeit: Expertise, subjektive Theorien,<br />
Selbstwirksamkeit etc.<br />
� Merkmale des Unterrichts (Angebot): Unterrichtsqualität (Klarheit,<br />
Adaptivität, Methodenvielfalt, Motivierung, Zeitnutzung etc.)<br />
� Individuelle Eingangsvoraussetzungen: a) Motivationale und emotionale<br />
Vermittlungsprozesse, b) Wahrnehmung und Interpretation des Unterrichts<br />
� Klassenkontext und fachlicher Kontext<br />
� Grundidee des Modells ist, dass der Lernerfolg nicht nur vom Angebot, sondern<br />
auch von der „Reaktion“ des Lernenden abhängt!<br />
3. Kognitive Determinanten von Schulleistung<br />
A) Intelligenz und Schulleistung (siehe auch B 4)<br />
� Vorgehen: Als Prädiktor wird üblicherweise ein Intelligenztest verwendet; als<br />
Indikator für Schulleistung dienen Zensuren, Lehrerurteile oder entsprechende<br />
Schulleistungstests!<br />
� Ergebnisse: Die Korrelationen, die man auf diese Weise erhält, liegen im<br />
Durchschnitt bei ca. 0,5 (mittelhoch), was einer Varianzaufklärung von 25%<br />
entspricht. Obwohl dieser Zusammenhang nicht überwältigend ist, ist Intelligenz<br />
damit einer der besten Prädiktoren für schulischen Erfolg.<br />
� Die Zensuren in Hauptfächern korrelieren meist höher mit der allgemeinen<br />
Intelligenz als Leistungen in Nebenfächern (vermutlich wegen der höheren<br />
kognitiven Anforderungen); am Besten lässt sich Mathematiknote vorhersagen.<br />
� Wenn die Schulleistung mit Tests (z.B. AST 4) erfasst wird, treten meist<br />
höhere Korrelationen aus als wenn Zensuren als Kriterium dienen (vermutlich,<br />
weil erstere objektiver sind.<br />
� Der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Schulleistung nimmt mit<br />
zunehmendem Alter der Schüler ab.<br />
� Erklärung: Intelligentere Schüler/innen können sich schneller auf neue Aufgaben<br />
einstellen, verfügen über effektivere Problemlösestrategien, erkennen leichter<br />
lösungsrelevante Regeln, verfügen über elaboriertere Gedächtnisstrategien und<br />
haben eine größere Verarbeitungskapazität. All das erleichtert schulisches Lernen.<br />
� Achtung: Der Zusammenhang zwischen Schulleistung und Intelligenz ist nicht<br />
einseitig, sondern reziprok! Intelligenz ist also nicht nur eine Voraussetzung, sondern<br />
zugleich eine Folge schulischen Lernens.<br />
� Empirische Ergebnisse dazu liefern u.a. eine Metanalyse von CECI und die<br />
SCHOLASTIK-Studie.<br />
� Beispielsweise haben Kinder, die ein Jahr später eingeschult wurden,<br />
durchschnittlich geringere IQs als ihre Altersgenossen, die schon ein Jahr<br />
länger zur Schule gehen.<br />
� Andere Befunde zeigen, dass die im Verlauf eines Schuljahres zu<br />
beobachtende Verbesserung des IQs während der Sommerferien stagniert<br />
oder sogar leicht abfällt.<br />
� Bedenke: Intelligenz beschreibt lediglich ein Leistungspotenzial und ist keineswegs<br />
der einzige Prädiktor für Schulleistung => Es gibt daher erwartungswidrige<br />
Schulleistungen (Over- und Underachievement)<br />
22
B) Vorwissen und Schulleistung<br />
� Intelligenz ist nicht die einzige kognitive Voraussetzung für schulischen Erfolg. In der<br />
neueren Forschung rückt neben der allgemeinen Intelligenz zunehmend das<br />
bereichsspezifische Vorwissen der Schüler in den Blick.<br />
� Als Indikator für das Vorwissen dient dabei meist die jeweilige Note aus dem<br />
vorhergehenden Schuljahr.<br />
� Nähere Auskunft über den Zusammenhang von Vorwissen, Intelligenz und<br />
Schulleistung gibt u.a. die Längsschnittstudie SCHOLASTIK (Helmke & Weinert).<br />
� Helmke & Weinert zeigen anhand einer auf den Ergebnissen dieser Studie<br />
aufbauenden Pfadanalyse, dass der Einfluss der Intelligenz auf die<br />
Schulleistung bis zur 4. Klasse abnimmt, während bereichsspezifisches<br />
Vorwissen zunehmend wichtiger wird.<br />
� Die Korrelation zw. Intelligenz und mathematischer Kompetenz sinkt von<br />
0.3 in der 1. Klasse auf 0.14 in der 4. Klasse.<br />
� Im selben Zeitraum steigt die Korrelation zwischen Vorwissen und<br />
mathematischer Kompetenz von .45 auf .63.<br />
� Erklärung: Diese gegenläufige Entwicklung ist damit zu erklären, dass die<br />
prädiktive Bedeutung der Intelligenz umso größer ist, je unbekannter die<br />
Lerninhalte sind, d.h. je weniger Vorwissen vorhanden ist.<br />
� Die Ergebnisse der SCHOLASTIK-Studie sind kongruent zu einer Vielzahl anderer<br />
Studien, die ebenfalls zeigen, dass fachspezifisches Vorwissen die Schulleistung<br />
besser vorhersagt als allgemeine Intelligenz.<br />
� Als Beleg dafür gelten meist die durchgehend hohen Zusammenhänge<br />
zwischen Noten aus benachbarten Schulstufen, die durch die<br />
Auspartialisierung der Intelligenz nur unwesentlich verringert werden.<br />
� Es gibt auch experimentelle Befunde, die zeigen, dass Intelligenzunterschiede durch<br />
bereichsspezifisches Vorwissen kompensiert werden können.<br />
� Schneider: Fußballexperten<br />
SCHNEI<strong>DER</strong> prüfte in einem 2 × 2- Design den Einfluss von Vorwissen und<br />
Intelligenz auf das Textverständnis und die Behaltensleistung von Schülern. Zu<br />
diesem Zweck legte er Dritt-, Fünft- und Siebtklässlern eine<br />
Fußballgeschichte vor, die sie anschließend reproduzieren sollten. Die Schüler<br />
wurden je nach Intelligenz und fußballerischem Vorwissen einer von 4<br />
Versuchsgruppen zugeteilt.<br />
� Ergebnis: Dabei zeigte sich für alle 3 Altersgruppen, dass die<br />
Fußballexperten unabhängig von ihrer allgemeinen Leistungsfähigkeit den<br />
Text immer besser erinnerten als ihre Mitschüler.<br />
23
A 4: Motivationale und affektive Bedingungen schulischer Leistungen<br />
1. Begriffsklärung<br />
� Motivation: ist die Bereitschaft, zielgerichtetes Verhalten zu initiieren und aufrecht zu<br />
erhalten bzw. die aktivierende Ausrichtung auf einen positiv bewerteten Zielzustand.<br />
� Die Motivation bestimmt demnach Richtung, Dauer und Intensität unseres<br />
Verhaltens.<br />
� Motive: sind dagegen überdauernde Präferenzen für bestimmte Klassen von<br />
Zuständen<br />
� Motivation bzw. Motiviertheit = situationsabhängiger Zustand (state);<br />
Motive = stabile Dispositionen (trait).<br />
� Wichtige Motive sind: das Leistungsmotiv, das Machtmotiv, das<br />
Anschlussmotiv<br />
� Motivation vs. Volition: Da unser Verhalten nicht immer mit unseren Absichten bzw.<br />
Zielen übereinstimmt, ist es sinnvoll, zwischen dem Setzen von Zielen und deren<br />
Umsetzung zu unterscheiden.<br />
� Während dem Setzen von Zielen (Zielauswahl) motivationale Prozesse<br />
zugrunde liegen, liegen der Umsetzung eines Ziels volitionale (=willentliche)<br />
Prozesse zugrunde (s.u.: Rubikonmodell von Heckhausen und Gollwitzer)<br />
� Intrinsische vs. extrinsische Motivation: Wird eine Handlung aufgrund ihrer Folgen<br />
ausgeführt, spricht man von extrinsischer Motivation; wird sie dagegen um ihrer selbst<br />
willen oder aus Interesse am Gegenstand ausgeführt, spricht man von intrinsischer<br />
Motivation.<br />
� Die intrinsische Motivation kann gegenstands- oder tätigkeitszentriert sein. In<br />
ersterem Fall basiert sie auf Interesse am Gegenstand, im letzteren Fall bereitet<br />
die Handlung selbst Freude.<br />
� Intrinisische Motivation korreliert konsistent positiv mit Schul- und<br />
Studienleistungen (im Durchschnitt: r = .23)<br />
� Viele Handlungen sind gleichzeitig intrinisisch und extrinsisch motiviert!<br />
� Interesse: wird meist als ein längerfristiger und überdauernder Person-<br />
Gegenstands-Bezug definiert (Person-Gegenstands-Theorie). Kennzeichnend für<br />
Interesse ist dabei a) dass dem Gegenstand eine hohe subjektive Bedeutung<br />
beigemessen (wertbezogene Valenz) wird und b) dass die Auseinandersetzung mit<br />
dem Gegenstand als positiv und angenehm erlebt wird (emotionale Valenz). Daraus<br />
ergibt sich c) die intrinsische Qualität bzw. „Selbstintentionalität“ von Interessen<br />
und d) die epistemische Orientierung von Interessen: Wer sich für eine Sache<br />
interessiert möchte mehr darüber erfahren.<br />
� Interesse kann sowohl als Zustand (situationales Interesse) als auch als<br />
Disposition (dispositionales Interesse) beschrieben werden.<br />
� Der Zusammenhang zwischen Interesse und Schulleistung beträgt<br />
durchschnittlich r = .30 (nach einer Metaanalyse von SCHIEFELE); der<br />
Zusammenhang ist dabei reziprok!<br />
� Leistungsmotivation: ist eine themenunspezifische Disposition. Leistungsmotiviert<br />
ist ein Verhalten dann, wenn es auf die Selbstbewertung der eigenen Tüchtigkeit<br />
abzielt – und zwar in Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab, den es zu<br />
erreichen oder zu übertreffen gilt.<br />
� Dabei können 2 Komponenten bzw. Teilmotive unterschieden werden:<br />
1. Das Erfolgsmotiv (Streben nach Erfolg)<br />
2. Das Misserfolgsmotiv (Vermeidung von Misserfolg)<br />
� Eine Zielorientierung: ist der Bewertungsmaßstab, anhand dessen man den Erfolg<br />
bzw. Misserfolg des eigenen Handelns misst. Sofern Zielorientierungen im Gedächtnis<br />
24
gespeichert und eng mit dem Selbstkonzept verknüpft sind, haben sie dispositionalen<br />
Charakter.<br />
� In Bezug auf den Lernerfolg lassen sich dabei 2 Zielorientierungen<br />
unterscheiden:<br />
1. Die „Aufgaben-“ oder „Lernzielorientierung“: zielt darauf, die eigene<br />
Kompetenz zu prüfen bzw. zu steigern.<br />
- …basiert auf intraindividueller Fähigkeitskonzeption: Gut bin ich, wenn<br />
ich mich bessere (individuelle Bezugsnorm)<br />
2. Die „Ego-“ oder „Leistungszielorientierung“: zielt auf die unmittelbar<br />
„verwertbare“ Ergebnisse (gute Noten, Lob etc.)<br />
- …basiert auf interindividueller Fähigkeitskonzeption: Gut bin ich, wenn<br />
ich besser bin als andere (soziale Bezugsnorm)<br />
� Empirische Ergebnisse:<br />
� Lernziel- und Leistungszielorientierung sind nicht antagonistisch, sondern<br />
relativ unabhängig voneinander (dafür sprechen die meist niedrigen<br />
Korrelationen zw. den beiden Dimensionen)<br />
� Schüler mit ausgeprägter und stabiler „Lernzielorientierung“ weisen<br />
bessere Leistungen und wesentlich höhere Wissenszuwächse auf als<br />
Schüler mit Ego-Orientierung.<br />
� Lernmotivation: Es lassen sich verschiedene Arten habitueller Lernmotivation<br />
unterscheiden:<br />
� Extrinsisch:<br />
� Wettbewerbsbezogene Lernmotivation (besser als andere sein)<br />
� Leistungsbezogene LM (Streben nach positiver Leistungsrückmeldung)<br />
� Kompetenzbezogene LM (Streben nach Kompetenzerweiterung)<br />
� Soziale LM (Streben nach sozialer Anerkennung)<br />
� Materielle LM (Verfolgen materieller Ziele)<br />
� Berufsbezogene LM (Streben nach einem bestimmtem Beruf)<br />
� Intrinsisch:<br />
� Gegenstandszentrierte LM (aus Interesse und Neugier)<br />
� Tätigkeitszentrierte LM (aus Freude am Lernen)<br />
2. Theorien zur Leistungsmotivation<br />
A) Das Risiko-Wahl-Modell nach Atkinson<br />
� Das Risiko-Wahl-Modell von Atkinson ist ein kognitives Modell zur genaueren<br />
Beschreibung der Leistungsmotivation, sofern es die Faktoren aufzeigt, von denen die<br />
individuelle Anspruchsniveausetzung abhängt.<br />
� Das Modell gilt als Prototyp der Erwartungs-mal-Wert-Theorien.<br />
� Atkinson betrachtet Leistungssituationen als Annäherungs-Vermeidungs-Konflikte.<br />
Auf der einen Seite steht die Tendenz, sich einer Leistungssituation in der Hoffnung<br />
auf Erfolg zu stellen (Te), auf der anderen Seite besteht die Tendenz,<br />
Leistungssituationen aus Furcht vor Misserfolg zu meiden (Tm).<br />
� Das Leistungsmotiv umfasst dementsprechend 2 Komponenten:<br />
A) Das Erfolgsmotiv (Erfolgszuversicht)<br />
B) Das Misserfolgsmotiv (Angst vor Misserfolg)<br />
� Wie stark die Annäherungs- und Vermeidungstendenzen jeweils sind, hängt nach<br />
Atkinson von 3 Faktoren ab:<br />
1. Dem subjektiven Wert des Handlungsziels (Wert)<br />
2. Der Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel auch zu erreichen (Erwartung)<br />
3. Dem Erfolgs- bzw. Misserfolgsmotiv der jew. Person<br />
(Persönlichkeitsvariable)<br />
25
� Der Anreiz einer Aufgabe hängt von deren Schwierigkeitsgrad ab.<br />
� Der Erfolgsanreiz (Ae) bzw. der Wert einer Aufgabe ist umso größer, je<br />
schwieriger sie ist bzw. je geringer die Erfolgserwartung.<br />
� Der Misserfolgsanreiz (Am) dagegen steigt mit der Erfolgserwartung. Je<br />
leichter eine Aufgabe, desto mehr schämt man sich schließlich für einen<br />
Misserfolg.<br />
� Die Tendenz, einen Erfolg anzustreben (Te), ergibt sich aus der multiplikativen<br />
Verknüpfung des Erfolgsmotivs (Me), der Erfolgserwartung (We) und dem Anreiz<br />
von Erfolg (Ae). Die Tendenz, einen Misserfolg zu vermeiden (Tm), ist<br />
dementsprechend das Produkt aus Misserfolgsmotiv (Mm), Misserfolgserwartung<br />
(Wm) und Misserfolgsanreiz (Am).<br />
� Te = Me x We x Ae Tm = Mm x Wm x Am<br />
� Daraus ergibt sich als resultierende Tendenz: Tr = Te – Tm<br />
� Schlussfolgerungen und Hypothesen:<br />
� Wenn das Misserfolgsmotiv einer Person größer ist als deren Leistungs- bzw.<br />
Erfolgsmotiv sollten Leistungssituationen, sofern keine extrinsischen Motive<br />
vorliegen, grundsätzlich gemieden werden; im umgekehrten Fall sollten sie<br />
aufgesucht werden.<br />
� In der Schule ist die völlige Vermeidung von Leistungssituationen<br />
allerdings nicht möglich; Unterschiede im Leistungsmotiv äußern sich<br />
daher v.a. in der Anspruchsniveausetzung.<br />
� Wenn das Misserfolgsmotiv überwiegt, sind Aufgaben mittlerer Schwierigkeit<br />
mit der größten Vermeidungstendenz verbunden; es sollten eher leichte<br />
(geringe Misserfolgserwartung) oder schwere (geringer Misserfolgsanreiz)<br />
Aufgaben gewählt werden.<br />
� Umgekehrtes gilt für ein stärker ausgeprägtes Erfolgsmotiv; hier sollten<br />
überwiegend Aufgaben mittlerer Schwierigkeit gewählt werden, da in diesem<br />
Fall das Produkt aus Erwartung und Wert am größten ist (0,5 × 0,5 = 0,25).<br />
� Empirische Überprüfung:<br />
� Bei einer Ringwurfaufgabe, bei der der Abstand zum Ziel frei gewählt<br />
werden konnte, wählten Vpn mit hohem Erfolgsmotiv (TAT) tatsächlich<br />
überwiegend Aufgaben mittlerer Schwierigkeit (=> realistische Zielsetzung).<br />
� Für Vpn mit hohem Misserfolgsmotiv konnte die Ausgangshypothese<br />
allerdings nicht bestätigt werden. Sie wählten alle Aufgabenschwierigkeiten in<br />
etwa gleich oft und zeigten keine eindeutigen Wahlpräferenzen.<br />
� Generell gilt: Erfolgsmotivierte zeigen langfristig gesehen bessere Leistungen<br />
(sind ausdauernder, setzen sich realistischere Ziele etc.)<br />
B) Attributionsstile und lernrelevante Selbstkonzepte<br />
� Das Risiko-Wahl-Modell lässt offen, wie die beiden Größen „Erwartung“ und „Wert“<br />
zustande kommen und wodurch das überdauernde Leistungsmotiv im Einzelnen<br />
gekennzeichnet ist.<br />
� Nach Weiner hängen Erwartung, Wert und Leistungsmotiv v.a. davon ab, wie die<br />
betreffende Person Erfolg und Misserfolg attribuiert.<br />
� Dabei unterscheidet er anhand zweier Dimensionen 4 Arten von Attributionen:<br />
1. Lokation (internal vs. external)<br />
2. Zeitliche Stabilität (stabil vs. variabel)<br />
� Daraus ergibt sich als übergeordnete Dimension die der subjektiv<br />
empfundenen Kontrollierbarkeit (hoch vs. niedrig)<br />
26
� Auf welche Weise wir Erfolg/Misserfolg attribuieren, bestimmt unser Verhalten in<br />
ähnlichen Situationen. Genauer:<br />
� Die Lokation der Ursache bestimmt den Wert bzw. Anreiz eines Erfolgs bzw.<br />
Misserfolgs und damit die affektive Reaktion.<br />
� Die zeitliche Dimension beeinflusst unsere Erfolgserwartung.<br />
� Die Dimension der Kontrollierbarkeit beeinflusst die Intensität der Affekte<br />
und Erwartungen.<br />
� Auf Basis der Attributionstheorie lassen sich erfolgs- und misserfolgsorientierte<br />
Personen hinsichtlich ihres bevorzugten Attributionsstils unterscheiden.<br />
� Misserfolgsorientierte Personen zeichnen sich durch einen ungünstigen<br />
Attributionsstil aus: Sie tendieren dazu, Erfolg auf zeitvariable- und externe<br />
Faktoren-, Misserfolg dagegen auf zeitstabile und interne Faktoren<br />
zurückzuführen.<br />
� Bei erfolgsorientierten Personen ist es umgekehrt.<br />
� Es liegt auf der Hand, dass der bevorzugte Attributionsstil Einfluss auf das<br />
Fähigkeitsselbstkonzept hat. Dem entspricht, dass auch zwischen dem<br />
Leistungsmotiv und dem Fähigkeitsselbstkonzept ein signifikanter Zusammenhang<br />
besteht (r = 0.25), wobei die Kausalitätsrichtung allerdings unklar ist.<br />
� Führt ein hohes Fähigkeitsselbstkonzept zu einer ausgeprägteren<br />
Erfolgsmotivation, oder eine starke Erfolgsmotivation zu einem höheren<br />
Fähigkeitsselbstkonzept?<br />
� Das Fähigkeitsselbstkonzept ist zwar in der Regel recht stabil, kann sich aber in<br />
Abhängigkeit vom (schulischen) Kontext (z.B. beim Wechsel von der Grundschule<br />
zur Sekundarschule) ändern.<br />
� Der Grund dafür ist der “Big-Fish-Little-Pond-Effect”: also die Veränderung<br />
der Selbsteinschätzung in Abhängigkeit vom Leistungsniveau der<br />
Bezugsgruppe.<br />
� Ein hohes Leistungsniveau der anderen muss sich dabei nicht immer<br />
negativ auf das eigene Selbstbild auswirken (small Fish in a big pond),<br />
sondern kann auch zu einer Aufwertung des Selbstbilds führen („basking<br />
in reflected glory“)<br />
C) Das Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation von Heckhausen<br />
� Heckhausens Modell (genauer: C 4) stellt gewissermaßen eine Synthese aus Atkinsons<br />
Risiko-Wahl-Modell und Weiners Attributionstheorie dar. Anders als Atkinson<br />
betrachtet Heckhausen das Leistungsmotiv dabei nicht als stabiles und einheitliches<br />
Persönlichkeitsmerkmal, sondern als komplexes Selbstbewertungssystem.<br />
� Dem Modell zufolge hängt die Ausprägung des Leistungsmotivs nämlich von<br />
3 sich gegenseitig stabilisierenden Teilprozessen ab:<br />
1. dem Anspruchsniveau bzw. der Zielsetzung<br />
2. dem präferierten Attributionsstil (von Erfolg und Misserfolg)<br />
3. der daraus resultierenden Selbstbewertung<br />
� Ausgehend davon kommt Heckhausen zu einer differenzierten Unterscheidung<br />
zwischen erfolgs- und misserfolgsmotivierten Personen (genauer: C 4):<br />
� Erfolgszuversichtliche Personen: realistische Zielsetzung (mittelschwere<br />
Aufgaben) � Positives Attributionsmuster � positive Selbstbewertungsbilanz<br />
(Freude und Stolz nach Erfolg sind größer als die negativen Affekte nach<br />
Misserfolg) � realistische Zielsetzung � … (ein „Engelskreis“)<br />
� Misserfolgsängstliche Personen: extrem leichte oder schwere Aufgaben �<br />
Ungünstiges Attributionsmuster � Negative Selbstbewertungsbildanz � …<br />
(ein Teufelskreis)<br />
27
� Heckhausens Modell bildet die theoretische Grundlage zahlreicher<br />
Trainingsprogramme (siehe: C 4).<br />
D) Rheinbergs handlungstheoretisches Motivationsmodell<br />
� RHEINBERG unterscheidet in seinem handlungstheoretischen Motivationsmodell<br />
zwischen Situation => Handlung => Ergebnis => und den Folgen des Ergebnisses.<br />
� Auf diese Weise kommt er zu einer differenzierteren Beschreibung der Begriffe<br />
„Erwartung“ und „Anreiz“.<br />
� Zu unterscheiden ist zwischen „Situations-Ergebnis-Erwartungen“ (Was<br />
passiert, wenn ich nicht handle?), „Situations-Handlungs-Erwartungen“,<br />
„Handlungs-Ergebnis-Erwartungen“ und „Ergebnis-Folge-Erwartungen“.<br />
� Bezüglich der Anreize für eine Handlung unterscheidet RHEINBERG zwischen<br />
tätigkeitsspezifischen- und instrumentellen Vollzugsanreizen.<br />
� Bei tätigkeitsspezifischen Vollzugsanreizen liegt der Wert einer Handlung<br />
in der Handlung selbst; bei instrumentellen Anreizen liegt der Wert der<br />
Handlung in deren Folgen begründet.<br />
� RHEINBERG zufolge unterscheiden sich Menschen u.a. danach, ob sie habituell eher<br />
tätigkeits- oder eher zweckorientiert sind (dispositioneller Anreizfokus).<br />
5. Theorien zur intrinsischen Motivation<br />
A) Theorien optimaler Stimuluierung (Berlyne)<br />
� Allgemeine Vorbemerkung:<br />
� Theorien zur intrinsischen Motivation versuchen intrinsisch motiviertes<br />
Verhalten zu erklären. Damit sind sie nicht zuletzt gegen rein behavioristische<br />
Verhaltenstheorien gerichtet.<br />
� Zu den Theorien extrinsischer Motivation gehören v.a. die Erwartungs-mal-<br />
Wert-Theorien (s.o.), sofern bei diesen der Schwerpunkt auf den<br />
Handlungskonsequenzen liegt.<br />
� Das Internalisierungsmodell von Ceci und Ryan macht sowohl Aussagen über<br />
die intrinsische als auch über die extrinsische Motivation.<br />
� Berlyne unterscheidet zwischen dem Aktivationspotential einlaufender Stimuli und<br />
dem tatsächlichen Aktivationsniveau; ist das Aktivationspotential sehr hoch (neue,<br />
komplexe Reize) oder sehr niedrig (Reizarmut), erhöht sich das Aktivationsniveau,<br />
was als unangenehm empfunden wird und zu intrinsisch motiviertem Verhalten führt.<br />
B) Die Selbstbestimmungstheorie von Ceci und Ryan<br />
� Ceci und Ryan gehen von 2 Grundbedürfnissen (basic needs) aus, die allen Menschen<br />
eigen sind und die die Grundlage aller intrinsisch motivierten Handlungen bilden:<br />
1. Das Bedürfnis nach Kompetenz<br />
2. Das Bedürfnis nach Autonomie bzw. Selbstbestimmung<br />
[3. Das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit]<br />
� Einen Hinweis auf diese Bedürfnisse sehen Ceci und Ryan im Explorations- und<br />
Spielverhalten von Kindern gegeben.<br />
� Ihre These: Nur wo zumindest die ersten beiden Bedürfnisse befriedigt werden, wo<br />
sich der Einzelne also als kompetent und selbstbestimmt erlebt, kann sich so etwas wie<br />
Interesse entwickeln.<br />
� Mögliche Erklärung für den Korrumpierungseffekt von Belohnung (s.u.):<br />
Wo Handlungen von außen verstärkt werden, werden sie nicht mehr als<br />
selbstbestimmt erfahren.<br />
28
� Wichtig: Die besagten Grundbedürfnisse sind notwendige, aber keineswegs<br />
hinreichende Bedingungen intrinsischer Motivation; sie können also auch<br />
extrinsisch motivierten Handlungen zugrunde liegen.<br />
� Der Korrumpierungseffekt von Belohnung: besagt, dass intrinsische Motivation<br />
durch äußere Verstärker (Belohnung) untergraben werden kann.<br />
� Experiment: Versuchskinder spielen ein Mathespiel, nachdem es<br />
vorübergehend belohnt wurde, weniger häufig als vor der Belohnungsphase.<br />
Die intrinsische Motivation scheint also durch die Belohnung vermindert zu<br />
werden.<br />
� Der Korrumpierungseffekt ist sehr umstritten: Tatsächlich ist er nicht<br />
verallgemeinerbar, sondern tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf.<br />
Nämlich, 1) wenn die Belohnung zu offensichtlich als eine Form der<br />
Kontrolle eingesetzt wird und 2) wenn sie nicht leistungskontingent, sondern<br />
aufgabenkontingent erfolgt.<br />
� Die Internalisierung ursprünglich extrinsisch motivierter Handlungsziele erfolgt nach<br />
Ceci und Ryan in 3 Schritten; der Prozess wird dabei von denselben Bedürfnissen<br />
angetrieben wie die intrinsische Motivation (Kompetenz und Selbstbestimmung). Als<br />
3. Bedürfnis tritt hier jedoch das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit hinzu!<br />
0. Externale Regulation (Vorstufe)<br />
� Handlungen werden nur ausgeführt, um eine Belohnung zu erhalten oder<br />
eine Bestrafung zu vermeiden; Ort der Verursachung: rein external<br />
1. Introjektion<br />
� Handlungen werden auf „inneren Druck“ hin ausgeführt, „weil es sich so<br />
gehört“. Externale Handlungsziele werden internalisiert, ohne sich jedoch<br />
mit ihnen zu identifizieren; Ort der Verursachung: immer noch external<br />
2. Identifikation<br />
� Handlungen werden ausgeführt, weil man sie selbst für wichtig hält, aber<br />
ohne Freude an ihnen zu haben. Externale Handlungsziele werden als die<br />
eigenen akzeptiert; Ort der Verursachung: internal<br />
3. Integration<br />
� Handlungsziele werden dauerhaft und konsistent in das Selbstkonzeot<br />
integriert.<br />
� Der entscheidende Unterschied zwischen den verschiedenen Stufen extrinsischer<br />
Handlungsregulation liegt somit im Grad der erlebten Selbstbestimmung!<br />
C) Flow-Theorie (Csikszentmihalyi & Schiefele)<br />
� Intrinsisch motivierte Tätigkeiten gehen oft mit einer ganz bestimmten Erlebensweise<br />
einher, dem sog. „Flow“-Erleben. Man versteht darunter das Gefühl, völlig in einer<br />
Tätigkeit (Schreiben, musizieren etc.) aufzugehen.<br />
� Die wichtigsten Kennzeichen eines Flow-Zustandes:<br />
� Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein<br />
� Zentrierung der Aufmerksamkeit auf die momentane Tätigkeit<br />
� Selbstvergessenheit<br />
� Gefühl der Kontrolle über Handlung und Umwelt<br />
� Die wichtigsten Bedingungen eines Flow-Zustandes:<br />
� Passung von Fähigkeit und Handlungsanforderung<br />
� Eindeutigkeit der Handlungsstruktur (klare Ziele)<br />
� Im Flow-Zustand ist der Mensch in höchstem Maße leistungsfähig.<br />
� Flow-Theorie und Selbstbestimmungstheorie schließen sich keineswegs aus, sofern<br />
der Reiz des Flow-Zustandes zu einem hohen Maß darin besteht, sich als kompetent<br />
zu erleben (Kompetenzbedürfnis).<br />
29
� Schneider: Die Selbstbestimmungstheorie befasst sich mit den letztgültigen<br />
Ursachen intrinisisch motivierten Verhaltens (basic needs), die Flow-Theorie<br />
mit den unmittelbaren Ursachen solchen Verhaltens (Erlebnisqualität).<br />
D) Die Stage-Environment-Fit-Theorie (Eccles et al.)<br />
� Empirischer Befund: Verschiedene Längsschnittstudien (so z.B. LOGIK und<br />
SCHOLASTIK) zeigen, dass die Motivation und Lernfreude im Lauf der Schulzeit<br />
sukzessive abnimmt.<br />
� Dieser Prozess beginnt bereits in der Grundschule, ein regelrechter Einbruch<br />
findet dann beim Übergang von der 6. zur 7. Klasse statt. Besonders betroffen<br />
sind die naturwissenschaftlichen Fächer (außer Biologie) und Mathematik.<br />
� Einschränkung: Die Analyse intraindividueller Entwicklungsverläufe zeigt,<br />
dass dieser negative Entwicklungstrend lediglich für 20-30% der Schüler<br />
zutrifft; die Mehrheit der Schüler zeigt keine signifikanten Veränderungen,<br />
was Motivation und Lernfreude betrifft (Fend: Konstanzer Längsschnittstudie)<br />
� Ein möglicher Erklärungsansatz: Pubertät führt zu einer Differenzierung<br />
persönlicher Interessen<br />
� Die „Stage-Environment-Fit-Theorie“ (ECCLES et al.) führt das Absinken der<br />
(intrinsischen) Lernmotivation v.a. auf eine sich im Lauf der Schulzeit<br />
verschlechternde Passung zwischen den Bedürfnissen der Schüler und den<br />
Kontextbedingungen der Schüler zurück.<br />
� Die Lehrer-Schüler-Beziehung wird im Laufe der Schulzeit zunehmend<br />
formeller; dementsprechend erfahren ältere Schüler durchschnittlich weniger<br />
emotionale Unterstützung und Zuwendung als jüngere Schüler. Hinzu kommt<br />
eine Verschärfung der Wettbewerbssituation durch eine zunehmend sozial<br />
ausgerichtete Bezugsnormorientierung<br />
� Dem Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit wird zunehmend weniger<br />
entsprochen!<br />
� Die Ansprüche steigen; die Notenpraxis wird strenger und die Noten<br />
dementsprechend schlechter.<br />
� Widerspruch zum Bedürfnis nach Kompetenz<br />
� Zunehmende Lehrerzentrierung<br />
� Widerspruch zum Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung.<br />
� FAZIT: Mangelnde Passung zwischen den Bedürfnisse der Schüler und den<br />
schulischen Bedingungen führt zum Absinken der Lernmotivation!<br />
30
6. Das Rubikon-Modell: Motivation vs. Volition<br />
� Das Rubikon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer ist eine Theorie zur<br />
Handlungskontrolle; es befasst sich mit den psychologischen Prozessen, die nach der<br />
Zielsetzung (s.o.) zur Zielerreichung beitragen und ein bestimmtes Ziel gegen<br />
konkurrierende Ziele abschirmen.<br />
� Handlungsphasen: Heckhausen & Gollwitzer gehen von 4 Handlungsphasen aus. Am<br />
Anfang einer jeden Handlung steht ein Bedürfnis oder Wunsch (z.B. etw. für die<br />
körperliche Fitness zu tun).<br />
1. Vorentscheidungsphase (prädezisional):<br />
a) Die sog. Vorentscheidungsphase dient der Intentionsbildung. Dabei<br />
werden die verschiedenen Handlungsalternativen bezüglich ihres Wertes<br />
und ihrer Erfolgserwartung* gegeneinander abgewogen (z.B. joggen,<br />
Fußball, Tanzkurs,…).<br />
* Erwartung x Wert (s.o.): Ist die Handlungsalternative realisierbar<br />
(Erwartung) und ist sie attraktiv (Wert)?!<br />
b) Am Ende dieser Phase steht ein Entschluss (Fazittendenz): Aus dem<br />
allgemeinen Wunsch (etw. für die körperliche Fitness zu tun) ist eine<br />
konkrete Handlungsabsicht (Zielintention) geworden (Fußball spielen)<br />
� Überschreitung des Rubikons!<br />
2. Vorhandlungsphase (präaktional):<br />
a) Die Vorhandlungsphase dient der Erstellung eines Handlungsplans; es<br />
geht also um die Erwägung konkreter Umsetzungsmöglichkeiten (Wo, wie<br />
und wann wird Fußball gespielt?).<br />
b) Fiattendenz: Am Ende dieser Phase steht ein Plan bzw. ein konkreter<br />
Vorsatz (Implementierungsintention), der festlegt, wie und wann die<br />
Handlung realisiert werden soll.<br />
3. Handlungsphase (aktional):<br />
a) Die Handlungsphase dient der Ausführung des Handlungsplans, der<br />
dabei fortwährend mit den aktuellen Gegebenheiten verglichen wird.<br />
b) Am Ende dieser Phase steht der Abschluss der Handlung, im idealen Fall<br />
bedeutet das zugleich die Erreichung des Ziels (fit zu sein).<br />
4. Nachhandlungsphase (postaktional):<br />
a) Die Nachhandlungsphase dient der Bewertung des Erreichten. Es geht<br />
also darum, für sich zu entscheiden, ob die Handlung erfolgreich war oder<br />
nicht.<br />
b) Am Ende dieser Phase steht evtl. eine Neubewertung der ursprünglichen<br />
Handlungsalternativen oder gar der eigenen Standards. (Rudern statt<br />
Fußball? Oder ist Erfolg im Studium doch wichtiger als körperliche<br />
Fitness?!)<br />
� Bewusstseinslagen: Die verschiedenen Phasen zeichnen sich durch unterschiedliche<br />
Bewusstseinslagen aus.<br />
� Die motivationale Bewusstseinslage: Zur motivationalen Bewusstseinslage<br />
gehören die Vorentscheidungs- und Nachhandlungsphase: Zielsetzung!<br />
� Um eine möglichst breite Vielfalt von Handlungsalternativen erfassen zu<br />
können, ist diese Bewusstseinlage durch Offenheit und Objektivität<br />
gekennzeichnet.<br />
� Es gilt, möglichst viele Informationen aufzunehmen und sie möglichst<br />
objektiv bezüglich ihres Wertes und der Erfolgserwartung zu bewerten<br />
(realitätsorientierte Informationsverarbeitung).<br />
31
� Die volitionale Bewusstseinslage: Zur volitionalen Bewusstseinslage gehören<br />
die Vorhandlungs- und die Handlungsphase: Initiierung und<br />
Aufrechterhaltung des Handelns!<br />
� In dieser Bewusstseinslage wird die Aufmerksamkeit auf die konkrete<br />
Absicht, deren Umsetzung und Ausführung fokussiert.<br />
� Es gilt, sich nicht durch andere Handlungsabsichten ablenken zu lassen<br />
und die Konzentration ganz auf zielrelevante Infos und Reize zu richten.<br />
� Realisierungsorientierte, statt realitätsorientierte Informationsverarbeitung,<br />
d.h. man ist weitaus optimistischer und blendet negative<br />
Rückmeldungen z.T. aus, um sich bei der Umsetzung nicht entmutigen zu<br />
lassen.<br />
7. Volitionale und emotionale Prozesse<br />
� Volitionale Prozesse kontrollieren kognitive, motivationale und emotionale Prozesse<br />
und sorgen so für die Initiierung und Aufrechterhaltung (Persistenz) einer<br />
Handlung.<br />
� Sofern auch kognitive Prozesse volitional kontrolliert werden, steht das<br />
Konzept in engem Zusammenhang zur Metakognition.<br />
� JULIUS KUHL unterscheidet verschiedene Arten von Strategien, die ein Lernender<br />
mit günstigen volitionalen Voraussetzungen einsetzen kann.<br />
1. Aufmerksamkeitskontrolle (das Ausblenden von Infos, die absichtswidrige<br />
Motivationstendenzen stärken)<br />
2. Enkodierungskontrolle (Fokussierung auf zielrelevante Informationen)<br />
3. Motivationskontrolle (Steigerung der eigenen Motivation, die beabsichtigte<br />
Handlung auszuführen durch Betonung zielkongruenter Anreize)<br />
4. Emotionskontrolle (Beeinflussung der eigenen Gefühlslage zur Steigerung<br />
der Handlungseffizienz)<br />
5. Misserfolgs- bzw. Aktivierungskontrolle (Verdrängung von Misserfolgen<br />
und Abstandnehmen von unerreichbaren Zielen)<br />
6. Initiierungskontrolle (Vermeidung übermäßig langen Abwägens von<br />
Handlungsalternativen)<br />
7. Umweltkontrolle (Vermeidung äußerer Ablenkung)<br />
� Kuhl unterscheidet zwischen Lageorientierung und Handlungsorientierung: Dabei<br />
handelt es sich einerseits um situationsbedingte Einstellungen (ähnlich den<br />
Bewusstseinslagen im Rubikon-Modell), andererseits um überdauernde<br />
Persönlichkeitseigenschaften (messbar mit dem Fragebogen HAKEMP).<br />
� Lageorientierung: ist gekennzeichnet durch die langsame Verarbeitung<br />
negativer Emotionen und leichte Ablenkbarkeit (anstatt sich auf die Aufgabe<br />
zu konzentrieren, denkt man an vergangene Misserfolge und mögliche<br />
Probleme); weist Parallelen zum Phänomen der „gerlernten Hilflosigkeit“ auf.<br />
� Das volitionale Pendant zur Misserfolgsängstlichkeit auf motivationaler<br />
Ebene<br />
� Handlungsorientierung: ist gekennzeichnet durch eine schnelle<br />
Handlungsinitiierung und rasche Affektregulation (Misserfolgserlebnisse<br />
werden zur Seite geschoben, um sich ganz der Aufgabe widmen zu können)<br />
� Das volitionale Pendent zur Erfolgszuversicht auf motivationaler Ebene<br />
� Emotionen haben Einfluss auf kognitive Prozesse:<br />
� Gordon Bower: Wissen ist in Form von assoziativen Netzwerken im<br />
Gedächtnis gespeichert; Emotionen sind Bestandteil dieses Netzwerks und mit<br />
kongruenten Inhalten verknüpft. Daraus folgt, dass in einem bestimmten<br />
32
emotionalen Zustand bestimmte, zu der jeweiligen Emotion passende Inhalte<br />
leichter ins Bewusstsein gerufen werden als andere.<br />
� State-dependent Recall (Zustand beim Lernen = Zustand beim Erinnern)<br />
� Mood-congruent Recall (Valenz des Inhalts = Stimmung beim Erinnern)<br />
� Mood-congruent Encoding (Stimmung beim Lernen = Valenz des<br />
Lernstoffs)<br />
� Stimmungskongruente Urteile<br />
� Im Hinblick auf Lernprozesse sind 3 Sorten von Emos zu unterscheiden:<br />
� Positive Emotionen (wie Lernfreude, leistungsbezogene Hoffnungen<br />
oder Stolz) � wirken sich günstig auf intrinsische Motivation aus<br />
� Aktivierend negative Emotionen (wie Ärger oder Angst) � können die<br />
physische und psychische Handlungsbereitschaft (und damit die Nutzung<br />
von Lernstrategien) stimulieren; reduzieren aber zugleich die intrinsische<br />
Motivation und ziehen Teile der Aufmerksamkeit ab<br />
� Desaktivierend negative Emotionen (wie Hoffnungslosigkeit oder<br />
Langeweile) � ziehen Aufmerksamkeit ab und reduzieren intrinsische<br />
Motivation<br />
33
A 5: Lernumwelten und Schulerfolg<br />
1. Allgemeines zur ökologischen Perspektive in der Päd. Psychologie:<br />
� Die ökologische Psychologie untersucht den Einfluss der distalen (also nicht<br />
unmittelbar, sondern vermittelt wirksamen) Rahmenbedingungen auf d. Lernprozess.<br />
� Sie geht zu diesem Zweck nicht analytisch (Fokussierung auf einzelne<br />
Variablen), sondern systemisch vor (ganzheitliche Perspektive).<br />
� Die Erfassung systemischer Zusammenhänge ist kompliziert, da die Einflüsse,<br />
die dabei ins Auge gefasst werden, meist indirekt und nicht zielgerichtet sind.<br />
Darüber sind die betreffenden Faktoren oft subsistuierbar (z.B. reicht es, wenn<br />
ein Elternteil Akademiker ist; der Bildungsstand des 2. Elternteils hat auf das<br />
Lernmilieu nur noch einen geringfügigen Einfluss)<br />
� Zwei Konzepte sind für die ökologische Psychologie besonders bedeutsam:<br />
� Das Konzept des „Behavior settings“ von Barker<br />
� Bronfenbrenners Schema unterschiedlicher Systeme (Mikro-, Meso- und<br />
Makrosystem)<br />
� Im Unterschied zu Bronfenbrenner betrachtet BARKER lediglich die „objektiven“<br />
(physikalischen) Charakteristika der Umwelt, durch die ein bestimmtes Verhalten<br />
nahegelegt wird: Z.B. beeinträchtigt der Lärmpegel in einem Großraumbüro die<br />
Konzentrationsfähigkeit; die Einrichtung einer Eckkneipe lädt zum gemütlichen<br />
Entspannen ein etc. etc. Die objektiven Merkmale einer bestimmten Umwelt und die<br />
durch sie nahe gelegten Verhaltensmuster bilden dabei ein „behavior setting“.<br />
� Kritik: Der Ansatz vernachlässigt psychologische Faktoren!<br />
� Für die Schulforschung bringt er daher nur geringen Nutzen; entgegen der<br />
Annahme vieler Laien, hat sich nämlich gezeigt, dass „objektive“ Merkmale<br />
von Schulen (z.B. Klassengröße, Sitzordnung, Einrichtung der Klassenräume)<br />
nur einen sehr geringen Einfluss auf die Leistung der Schüler haben (s.u.)<br />
� BRONFENBRENNER versteht „Umwelt“ als Geflecht in sich verschachtelter<br />
Subsysteme, die sich gegenseitig beeinflussen. Anders als Barker betont er dabei die<br />
relative Autonomie des Individuums im Umgang mit diesen Systemen (es kommt eben<br />
nicht nur auf die „objektiven“ Umweltmerkmale an, sondern v.a. auf deren<br />
„subjektive“ Interpretation).<br />
� Die verschiedenen Subsysteme, in denen sich der Einzelne bewegt (z.B.<br />
Familie, Schule, Nation), lassen sich nach Bronfenbrenner 3 Ebenen zuordnen:<br />
1. Mikroebene: unmittelbare Lebensumwelt (Familie, Klasse, Vereine)<br />
2. Mesoebene: alle Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen, auf<br />
der Mikroebene relevanten Subsystemen, wobei auch sog. „Exosysteme“<br />
einzubeziehen sind.<br />
� Exosysteme sind Mikrosysteme, die Einfluss auf ein Individuum<br />
haben, ohne dass es ihnen angehört (z.B. das berufliche Umfeld der<br />
Eltern)<br />
3. Makroebene: ist die Ebene, die die beiden anderen Ebenen umgreift;<br />
man könnte auch von „kultureller Ebene“ sprechen (z.B. das deutsche<br />
Schulsystem)<br />
� Die Makroebene rückt im Rahmen internationaler Vergleichsstudien<br />
in den Blick! Erst seit PISA wird sie genauer untersucht<br />
34
� Methodisches:<br />
� Es sind 2 Arten von Kontextvariablen zu unterscheiden:<br />
1. Analytische Variablen: werden aus den Individualvariablen der Elemente<br />
eines Clusters gewonnen; z.B. der mittere IQ einer Klasse oder die<br />
Streuung der IQ-Werte innerhalb einer Klasse<br />
2. Strukturelle Variablen: genuine Variablen eines Clusters; z.B. das<br />
Geschlecht der Lehrkraft<br />
� Hierarchische „Nestung“ der Variablen: Die Schüler einer Klasse / einer<br />
Schule / eines Landes dürfen streng genommen nicht als unabhängige<br />
Beobachtungseinheiten betrachtet werden (s.o.), da sie dem Einfluss derselben<br />
Kontextvariablen ausgesetzt sind.<br />
� Die statistische Methode: Mehrebenenanalyse!<br />
� „Genestete Datenstrukturen“ sind ferner dadurch gekennzeichnet, dass<br />
gefundene Zusammenhänge oft indirekt-, also durch weitere Variablen<br />
vermittelt sind (=Mediation; Konfundierung) oder durch den Einfluss<br />
anderer Variablen verändert werden (=Moderation).<br />
� Die statistische Methode: Pfadanalysen<br />
� Wo keine experimentelle Variation stattfindet, sind keine Kausalitätsaussagen<br />
möglich!<br />
� „Ökologischer Fehlschluss“: Von Zusammenhängen auf einer höheren<br />
Aggregatsebene darf nicht auf Wirkmechanismen einer darunter liegenden<br />
Ebene geschlossen werden.<br />
� Z.B. zeigt die 3. Internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie<br />
(TIMMS), dass der Mathematikunterricht in Japan effektiver ist als der in<br />
Deutschland und dass Unterschiede im Unterrichtsstil bestehen; daraus zu<br />
schließen, die Leistungsunterschiede seien eine Folge des Unterrichtsstils<br />
wäre jedoch verfehlt, da zw. Japan und Deutschland eine Vielzahl weiterer<br />
Unterschiede bestehen, die ebenfalls für die Leistungsunterschiede<br />
verantwortlich sein könnten.<br />
2. Einfluss der Familie<br />
� Die Familie gilt als die wichtigste außerschulische Einflussgröße; der familiäre<br />
Einfluss auf die Schulleistung ist dabei durch folgende Faktoren vermittelt:<br />
1. Genetische Einflüsse:<br />
� Zum einen sind Intelligenz und Persönlichkeit des Lerners zu großen<br />
Teilen direkt genetisch bedingt.<br />
� Zum anderen schaffen Eltern eine der eigenen Disposition entsprechende<br />
Umwelt.<br />
2. Status- und Strukturvariablen:<br />
� Soziale Schichtzugehörigkeit; Familienkonstellation (Anzahl der<br />
Geschwister, Verhältnis der Eltern etc.); Beruf der Eltern<br />
� PISA 2000 hat gezeigt, dass der Zusammenhang zw. sozialer Herkunft und<br />
Schulleistung in Deutschland besonders hoch ist: die Schichtzugehörigkeit<br />
klärt bei der Leseleistung 13%, bei der mathematischen Kompetenz 14%<br />
der Varianz auf; die Leseleistung von Kindern der untersten Schicht ist<br />
durchschnittlich um eine Standardabweichung schlechter als die<br />
Leseleistung von Kindern der obersten Schicht!!<br />
� Diese Befunde werden durch andere Studien (PISA 2003 etc.) bestätigt;<br />
die IGLU-Studie zeigt, dass der Effekt bereits in der Grundschule gegeben<br />
ist; hier aber noch nicht so stark ausfällt wie in der Sekundarstufe.<br />
35
3. Prozessmerkmale der Elternverhaltens:<br />
� Stimulation (durch eine anregende und aktivierende Umwelt)<br />
� Instruktion (Hilfe bei den Hausaufgaben, „Nachhilfe“ etc.)<br />
- kann in kompensatorischem, konkurrierendem oder kooperativen<br />
Verhältnis zum schulischen Unterricht stehen; ist also nicht<br />
zwangsläufig positiv<br />
� Motivation (durch Leistungserwartungen, das Vorgeben von<br />
Anspruchsniveaus, Sanktionen (Lob und Tadel), Einschätzung der<br />
Kompetenz ihrer Kinder)<br />
� Modellfunktion (z.B. was die Attribution von Erfolg/Misserfolg betrifft<br />
oder den Umgang mit Leistungssituationen betrifft)<br />
� Fazit: Der Einfluss des Elternhauses auf die Schulleistung wirkt vermittelt über<br />
kognitive, motivationale und emotionale Schülermerkmale.<br />
3. Allgemeines zum Einfluss der Schule<br />
� Hat schulischer Unterricht überhaupt einen Einfluss auf die Lern- und<br />
Leistungsentwicklung der Schüler – oder hängt diese Entwicklung ausschließlich an<br />
außerschulischen Faktoren?!<br />
� Der vielbeachtete Coleman-Report (1972) zeigte, dass die Schulleistung nur<br />
zu einem sehr geringen Anteil auf Variablen der Schulorganisation und<br />
Unterrichtsführung zurückzuführen ist, sondern primär von der sozialen<br />
Herkunft der Schüler anhängt. Auch Lehrer sind oft erschreckend skeptisch,<br />
was die Wirkung ihres Unterrichts betrifft.<br />
� Nach Weinert muss jedoch differenziert werden:<br />
a) Was die Vermittlung von Wissen und Können betrifft, ist schulischer<br />
Unterricht hoch wirksam und unbedingt notwendig.<br />
b) Was den Ausgleich von Kompetenzunterschieden betrifft, ist Schule<br />
dagegen wenig wirksam.<br />
� Was den Einfluss schulischer Faktoren auf die Leistungsfähigkeit der Schüler betrifft,<br />
muss zwischen 3 Ebenen differenziert werden:<br />
1. Makroebene: Einfluss des Schulsystems u. d. politischen Rahmenbedingungen<br />
2. Mesoebene: Einfluss des Schulklimas<br />
3. Mikroebene: Einfluss des Unterrichts (Schulklasseneffekte)<br />
4. Makroebene: Einfluss der Schulstruktur<br />
� Der School-Effectiveness-Ansatz stellt alle Variablen zusammen, die mit<br />
Schulleistung korrelieren und fragt, anders als der ökologische Ansatz, erst in zweiter<br />
Linie nach den dahinterliegenden psychologischen und institutionellen Mechanismen.<br />
� Trotzdem ist dieser Ansatz gerade für die anwendungsbezogene pädagogische<br />
Psychologie äußerst wichtig. Ein Beispiel für den school-effectiveness ist das<br />
auf gigantischem Datenmaterial beruhende Produktivitätsmodell von Walberg<br />
(s.o.)<br />
� Wichtiger Befund: Die School-Effectiveness-Forschung zeigt, dass die Veränderung<br />
distaler Variablen (durch politisch-schulorganisatorische Reformen) nur geringe<br />
Effekte zeigt; wesentlich wirksamer ist die Veränderung proximaler Variablen<br />
(also solcher Variablen, die unmittelbar den Unterricht oder das familiäre Umfeld der<br />
Schüler betreffen)<br />
� Gründe: 1) Liegt strukturellen Reformen häufig ein ökologischer Fehlschluss<br />
(s.o.) zugrunde 2) Sind makrostrukturelle Maßnahmen nur dann wirksam,<br />
wenn sie auch zu entsprechenden Veränderungen auf den unteren Ebenen<br />
36
führen (Lehrplanänderungen haben nur dann einen positiven Effekt, wenn sie<br />
von den Lehrern auch umgesetzt werden)<br />
� Ein Beispiel für die geringe Wirksamkeit makrostruktureller Maßnahmen ist<br />
die Einführung von Gesamtschulen zur Kompensation sozialer Unterschiede.<br />
Haben doch mehrere Studien gezeigt, dass Gesamtschulen den Einfluss der<br />
sozialen Herkunft keineswegs verringern. Im Gegenteil: Auch hier sind die<br />
Schüler aus gutem Elternhaus durchschnittlich die besseren; die Gründe dafür<br />
sind auf der Meso- und Mikroebene zu suchen:<br />
� Wirksame Erziehungspraktiken<br />
� Regelmäßige Kommunikation über Lerninhalte<br />
� Kontrolle der Hausaufgaben<br />
� Kontakt zu Lehrern<br />
� Fazit: Ist wie in den westlichen Industrieländern ein gewisser Mindeststandard erfüllt,<br />
birgt die Makroebene wenig Veränderungspotential; Veränderungen sollten daher<br />
eher auf der Meso- und Mikroebene ansetzen!<br />
5. Mesoebene: Einfluss des Schulklimas<br />
� Das Schulkima entspricht der Wahrnehmung und Bewertung der Schulumwelt<br />
durch alle Beteiligten.<br />
� Obwohl diese Begriffe vielfach synonym verwendet werden, muss zwischen<br />
dem Schul- und dem Unterrichts- bzw. Klassenklima unterschieden werden.<br />
� Maehr und Midgley (1996): Maßnahmen zur Verbesserung der Schulkultur<br />
(Teamverantwortung, Qualitätszirkel etc.) wirken sich auch positiv auf die<br />
Unterrichtsführung der einzelnen Lehrer aus!<br />
� Zwischen dem Klassenklima und der durchschnittlichen Schülerleistung werden oft<br />
enorm hohe Zusammenhänge berichtet (bis zu 50% Varianzaufklärung!).<br />
� Solche Studien sind jedoch problematisch: Sie beruhen auf dem Vergleich von<br />
Mittelwerten, weshalb weder Aussagen über individuelle Schülerleistungen,<br />
noch Kausalitätszusammenhänge gemacht werden können.<br />
� Selektionseffekte (Brennpunktschulen => schlechtes Klima und schlechte<br />
Leistungen)<br />
� Wechselseitige Beeinflussung von Klima und Leistungsniveau<br />
� Unterrichtsklima korreliert mit r = .14 mit der Leistung<br />
6. Mikroebene: Einfluss des Unterrichts<br />
A) Objektive Merkmale von Schulklassen<br />
� Räumliche Gestaltung, Klassengröße, Sitzordnung<br />
� Räumliche Gestaltung (traditionelle vs. „offene“ Klassenräume): offene<br />
Klassenräume haben zwar günstige Effekte auf das emotionale Erleben der<br />
Schüler, aber keine Auswirkung auf das Leistungsniveau.<br />
� Klassengröße: Anders als oft angenommen, hat die Klassengröße kaum einen<br />
Einfluss auf Persönlichkeits- und Leistungsmerkmale der Schüler; signifikante<br />
Effekte zeigen sich erst bei extrem kleinen Klassen (< 10); was jedoch stimmt,<br />
ist, dass Lehrer mit zunehmender Klassengröße zu direkteren und<br />
restriktiveren Unterrichtsmethoden und einer milderen Leistungsbewertung<br />
neigen; darüber hinaus steigt in kleinen Klassen naturgemäß der Anteil aktiver<br />
Beteiligung.<br />
� Sitzordnung: widersprüchliche Befunde; Jungs und Mädchen sollten nicht in<br />
homogenen Blöcken, sondern möglichst ausgewogen verteilt sitzen (=><br />
Steigerung des aufgabenbezogenen Verhaltens).<br />
37
� Leistungshomogenität<br />
� Studien zur Fachleistungsdifferenzierung: In leistungshomogenen Klassen<br />
werden schwächere Schüler in ihrer Leistungsentwicklung eher benachteiligt!<br />
� Studien zum Ausgleich von Qualifizierung und Egalisierung (s.u.: Helmke)<br />
� Die Schulklasse als komparative Bezugsgruppe:<br />
� Die Klasse ist eine wichtige Bezugsgröße zur Selbsteinschätzung und hat als<br />
solche Einfluss auf die Motivation und Emotionen der einzelnen Schüler.<br />
� Einen massiven Einschnitt stellt der Wechsel von der Grundschule zur<br />
Sekundarstufe dar (leistungsheterogene Gruppe � leistungshomogene<br />
Gruppe)<br />
� Bezugsgruppeneffekte: Relative Unterschätzung bei schwachen<br />
Gymnasiasten; relative Überschätzung bei starken Hauptschülern<br />
� Wohin mit schwachen Schülern? - Leistungshomogene Klassen sind besser<br />
für ihren Selbstwert und die Psychohygiene; Leistungsfortschritte machen sie<br />
aber eher in heterogenen Klassen (s.o.).<br />
� Bei besonders begabten Schülern ist es anders: Sie machen eher in<br />
leistungshomogenen Klassen Fortschritte und ihr psychisches<br />
Wohlbefinden ist von der Klassenzusammensetzung unabhängig.<br />
� Die Schulklasse als normative Bezugsgruppe:<br />
� Schulklassen schaffen Normen, die denen des Lehrers entgegenstehen können<br />
(z.B.: Wer gut ist, ist ein Streber) und sanktionieren deren Nichtbeachtung.<br />
Dadurch wird der Handlungsspielraum des Lehrers eingeschränkt.<br />
B) Merkmale der Unterrichtsgestaltung<br />
� Empirische Untersuchungen zum Einfluss des Unterrichts auf die Schulleistung:<br />
� Klassisches Vorgehen (Prozess-Produkt-Paradigma): Bestimmte<br />
Unterrichtsmerkmale – wie z.B. der Führungsstil, die Instruktionsform<br />
(kooperatives Lernen, „learning for mastery“, reziproke Instruktion etc.) oder<br />
subjektive Theorien des Lehrers – als Prädiktoren für Schulleistung.<br />
� Ergebnis: Quantität und Qualität des Unterrichts haben zwar einen<br />
Einfluss, dieser ist jedoch wesentlich geringer als der der kognitiven<br />
Eingangsvoraussetzungen (Intelligenz und Vorwissen)<br />
� Neuere Ansätze (ATI): fassen nicht nur einzelne Unterrichtsmerkmale,<br />
sondern auch deren Wechselwirkung ins Auge.<br />
� Multikriteriale Wirksamkeit: Unterricht verfolgt unterschiedliche, z.T.<br />
gegenläufige Ziele (kognitiv, emotional, sozial etc.); zu definieren, was<br />
„guter“ Unterricht ist, ist vor diesem Hintergrund kaum möglich. Z.B.<br />
fördert aufgabenorientierter Unterricht mit intensiver Zeitnutzung zwar die<br />
Leistungen (Ziel A), führt aber längerfristig zu einem Abfall der<br />
Lernfreude (Ziel B).<br />
� Wechselseitige Kompensierbarkeit: Der Vergleich sog. „Optimalklassen“<br />
(s.u.) zeigt, dass diese, was die Lehrmethoden betrifft, oft große<br />
Unterschiede aufweisen => Wechselseitige Kompensierbarkeit und<br />
Subsistuierbarkeit einzelner Qualitätsmerkmale und Lehrerkompetenzen.<br />
� Systemischer Charakter des Unterrichts und seiner Effekte: Die Qualität<br />
des Unterrichts und das Leistungsniveau einer Klasse beeinflussen sich<br />
wechselseitig; sprich: vor guten Schülern fällt es leichter, guten Unterricht<br />
zu halten, als vor schlechten.<br />
� Kontextspezifität: Die Wirkung einzelner Faktoren ist klassen- und<br />
altersspezifisch. So ist z.B. Leistungsangst in der Hauptschule nur dann<br />
leistungsbeeinträchtigend, wenn die Zeitnutzung intensiv und der<br />
38
Unterricht unstrukturiert ist; in Grundschulen nur dann, wenn das<br />
Klassenklima und die affektive Beziehung zum Lehrer schlecht sind (Vgl.<br />
Münchener Studien)<br />
� „Optimalklassen“ sind nach HELMKE Klassen, in denen die durchschnittliche<br />
Leistung relativ hoch-, die Leistungsstreuung dagegen verhältnismäßig gering ist, in<br />
denen es also gelingt, das Leistungsniveau aller zu steigern (Qualifizierung) und<br />
gleichzeitig die Leistungsunterschiede zu verringern (Egalisierung).<br />
� Helmke untersuchte auf Basis der Münchener Hauptschulstudie 39<br />
5.Klassen. In Abhängigkeit vom durchschnittlichen Leistungsniveau und der<br />
Leistungsstreuung (erhoben zu Beginn und am Ende des Schuljahres), ordnete<br />
er sie einer von 4 Gruppen zu (hohe Qualifizierung + hohe Egalisierung; hohe<br />
Qualifizierung + geringe Egalisierung; …) und verglich die so erhaltenen<br />
Typen hinsichtlich ihres Unterrichtsstils.<br />
� Ergebnisse:<br />
� Leistungsegalisierender Unterricht geht meist auf Kosten der höher<br />
Begabten, und zwar ohne dass die weniger Begabten davon profitieren<br />
würden; die Egalisierung erfolgt also über eine Senkung des allgemeinen<br />
Leistungsniveaus („Downgrading“)<br />
� Wie die „Optimalklassen“ zeigen, scheint eine Kombination von<br />
Qualifizierung und Egalisierung jedoch trotzdem möglich zu sein.<br />
Optimalklassen zeichnen sich zwar oft durch bestimmte Merkmale (wie<br />
hohe Adaptivität, klare Instruktionen, Lehrstoffzentrierung, hohe<br />
Ansprüche, kein Zeitdruck etc.) aus; es gibt jedoch nicht die eine Methode.<br />
Stattdessen kann das Ziel, Qualifizierung und Egalisierung miteinander zu<br />
verknüpfen, offenbar auf verschiedene Weise erreicht werden.<br />
� Motivationsförderung: Eine soziale Bezugsnormorientierung wirkt auf die Dauer<br />
eher demotivierend, da sie zu einem ungünstigen Attributionsmuster führt (da sich an<br />
der Klassenverteilung nichts ändert, werden die eigenen Leistungen nicht auf<br />
Anstrengung, sondern auf zeitstabile Faktoren zurückgeführt)<br />
� Ability-Formation-Theorie: Der Unterrichtsstil des Lehrers (Art der<br />
Rückmeldung und Bezugsnormorientierung etc.) hat erheblichen Einfluss auf<br />
die Häufigkeit und Bedeutsamkeit sozialer Vergleichsprozesse im Unterricht.<br />
� Motivierend wirken: eine nicht-kompetitive Klassenatmosphäre, kooperative<br />
Arbeitsformen, eine individuelle Bezugsnorm mit entsprechendem Feedback;<br />
günstige Attributionen, Angebot möglichst vielfältiger Erfolgsfelder etc.<br />
� Die langfristige Leistungsentwicklung und die Förderung schulischen Selbstvertrauens<br />
hängen von jeweils unterschiedlichen Faktoren ab:<br />
� Leistungsentwicklung:<br />
� Hohes Anforderungsniveau<br />
� Individuelle Hilfestellung<br />
� Klarheit der Instruktion<br />
� Hohe Lehrstofforientierung<br />
� Effiziente Klassenführung<br />
� Förderung schulischen Selbstvertrauens:<br />
� Verständlichkeit des Unterrichts<br />
� Individuelle Leistungsrückmeldung<br />
� Positives Klassenklima etc.<br />
39
A 6: Schule im internationalen Vergleich (siehe auch: B 8)<br />
1. Forschungsgeschichte<br />
� Ziel von „Schulsystemvergleichen“ ist es, empirisch fundierte Erkenntnisse über die<br />
Effektivität schulischer Bildung in einem Land oder einer Schulform zu gewinnen, um<br />
auf diese Weise Ansatzpunkte für bildungspolitische Maßnahmen zu gewinnen<br />
(Qualitätsentwicklung).<br />
� Die wichtigsten Träger internationaler Vergleichsstudien sind:<br />
� International Association for the Evaluation of Educational<br />
Achievement (IEA):<br />
- FIMS (1964); SIMS (1980-82), TIMSS (1994/95)<br />
- Anfang der 70er: 6-Fächer-Studie (FISS); SISS<br />
- IGLU (2001)<br />
� Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD):<br />
- PISA (2000, 2003, 2006)<br />
� Produktivitätsparadigma (ca. 1960-1985): Verglichen werden die Leistungswerte,<br />
genauer: die Prozentsätze gelöster Aufgaben, und bestimmte Inputmerkmale (System-<br />
oder Organisationsmerkmale wie z.B. Schulform); die Aufgabenschwierigkeiten (zur<br />
Ermittlung von Kompetenzniveaus) und Besonderheiten des Lernprozesses bleiben<br />
dagegen unberücksichtigt.<br />
� Daraus ergeben sich folgende Probleme:<br />
1. Es sind keine inhaltlichen Aussagen über die erzielten Lernstände<br />
möglich; es können also auch keine Kompetenzniveaus ermittelt werden.<br />
Streng genommen setzt der einfache Vergleich von Prozentsätzen nämlich<br />
voraus, dass die verwendeten Aufgaben alle gleich schwierig sind.<br />
2. Da keine Prozessdaten zum Unterrichtsgeschehen erhoben werden, bleibt<br />
der Erklärungsabstand zwischen Prädiktoren (Systemmerkmale) und<br />
Kriterium (Schulleistung) beträchtlich.<br />
� Kriterumsorientierte Interpretation der Befunde (ca. 1985-2000): basiert auf der<br />
„Item response Theory“; dabei werden einander die beiden Parameter<br />
„Personenfähigkeit“ und „Aufgabenschwierigkeit“ gegenübergestellt und ausgehend<br />
von diesen beiden Größen für alle Aufgaben Lösungswahrscheinlichkeiten ermittelt.<br />
� Daraus ergeben sich mehrere Vorteile:<br />
1. Die erzielten Lernstände sind inhaltlich interpretierbar; die ermittelten<br />
Aufgabenschwierigkeiten lassen sich nämlich zu hierarchischen<br />
Kompetenzstufen zusammenfassen. Letztere wiederum können als Basis<br />
für die Formulierung von Bildungsstandards dienen.<br />
2. Die verwendeten Parameter (Personenfähigkeit, Aufgabenschwierigkeit)<br />
sind intervallskaliert und können daher in standardisierte Werte<br />
transformiert werden (bei TIMMS und PISA: internationaler Durchschnitt<br />
der Personenfähigkeit: 500; Standardabweichung: 100)<br />
� Die Ergebnisse von Tests, die auf eine bestimmte Altersgruppe<br />
zugeschnitten sind, können vergleichbar gemacht werden<br />
� Die Personen × Item-Matrix muss nicht vollständig sein; es können<br />
also auch die Ergebnisse von Tests miteinander verglichen werden,<br />
deren Items sich nur teilweise überschneiden.<br />
� Das wiederum ermöglicht „rotierte Testformen“ (bessere<br />
Abdeckung der untersuchten Anforderungsbereiche bei vertretbarer<br />
Testbelastung für den einzelnen Probanden)<br />
40
� Gegenwärtige Tendenzen (seit 2000):<br />
� Tendenz, möglichst viele Hintergrundinformationen in das Messmodell<br />
aufzunehmen (u.a. zur besseren Bestimmung von Stichprobenfehlern auf<br />
Populationsebene)<br />
� Zunehmende Berücksichtigung von Eingangsvoraussetzungen und<br />
Prozessverläufen (also eine längsschnittliche Perspektive);<br />
� Multikriteriale Systemvergleiche und Erschließung neuer<br />
Kompetenzbereiche (z.B. Geschichte, politische Bildung etc.)<br />
� Mehrkomponentenansatz: Erweiterung der breiten Überblicksstudien um<br />
zusätzliche Untersuchungskomponenten (insbes. Erhebung von<br />
Prozessmerkmalen des Unterrichts)<br />
� Ein Beispiel hierfür ist der intensivierte Ländervergleich zw.<br />
Deutschland, Japan und den USA im Rahmen der TIMS-Studie, sofern<br />
hier Videoanalysen und Fallstudien in den Vergleich mit aufgenommen<br />
wurden.<br />
� Grundsätzlich gilt, dass nicht nur die Mittelwerte eines Merkmals verglichen werden<br />
sollten, sondern auch dessen Verteilungen! Mögliche Darstellungsformen:<br />
� Häufigkeitsverteilungen (geben Auskunft über den Mittelwert und die<br />
Streuung)<br />
� Sog. „Ertragskurven“ („yield curves“): Angefangen bei der<br />
niedrigstmöglichen und endend bei der höchstmöglichen Merkmalsausprägung<br />
werden die Anteile derjenigen aufgetragen, die jeweils mindestens einen<br />
konkreten Wert x erreicht haben.<br />
� Die ausgefüllte Fläche entspricht damit dem empirisch erreichten Ertrag,<br />
anteilig bezogen auf das theoretische Maximum (das erreicht wäre, wenn<br />
die gesamte Fläche des Diagramms ausgefüllt wäre)<br />
� Perzentilbänder: zeigen die Messwerte an, die ein bestimmter Prozentsatz der<br />
Stichprobe (5%, 25%,…) höchstens erreicht hat.<br />
� Unterschiede werden durch Verschiebungen nach links oder rechts auf<br />
der Merkmalsachse und durch die Länge der Bänder bzw. ihrer<br />
Teilabschnitte deutlich.<br />
2. Methodische Probleme<br />
� Transkulturelle (curriculare) Validität: Internationale Schulleistungsvergleiche<br />
setzen vergleichbare Bildungsstandards voraus. Es dürfen daher nur solche<br />
Testaufgaben verwendet werden, die Bestandteil der verschiedenen Curricula sind.<br />
� Um die Fairness zu wahren, hat dem eigentlichen Leistungsvergleich immer<br />
ein Vergleich der Lehrpläne vorauszugehen!<br />
� Prinzipiell gilt, dass gerade für die Naturwissenschaften und das Fach<br />
Mathematik große Übereinstimmungen zwischen den verschiedenen Ländern<br />
bestehen.<br />
� Transkulturelle Äquivalenz: Die Aufgabenschwierigkeiten müssen äquivalent sein;<br />
die Aufgaben müssen also länderübergreifend eine vergleichbare<br />
Lösungswahrscheinlichkeit haben. Dieses Problem wird besonders virulent bei der<br />
Übersetzung von Aufgaben zum Leseverständnis.<br />
� Anhand der PISA-2000-Daten konnte gezeigt werden, dass Schüler bei<br />
textbasierten Aufgaben bessere Leistungen erzielten, wenn diese aus ihrem<br />
Herkunftsland stammten.<br />
� Geprüft wird die transkulturelle Äquivalenz mit Analysen zum „Differential<br />
Item Functioning“; gewährleistet wird sie durch sensible Übersetzungen und<br />
eine möglichst multikulturelle Zusammenstellung der Aufgaben.<br />
41
� Populationsdefinition und Stichprobenziehung: Aufgrund der unterschiedlichen<br />
Schulsysteme ist es schwierig, eine Untersuchungspopulation zu definieren, die für<br />
alle Teilnehmerstaaten eindeutig und inhaltlich sinnvoll ist.<br />
� Grundsätzlich lassen sich diesbezüglich 2 Vorgehensweisen unterscheiden:<br />
1. Festlegung der Population nach dem Lebensalter<br />
2. Festlegung der Population nach dem Schulalter, also nach der<br />
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Jahrgangsstufe<br />
� Welche Vorgehensweise sinnvoller ist, hängt von der Wissensdomäne ab,<br />
genauer: davon, wie sehr der Wissenserwerb in dieser Domäne von<br />
schulischen Lerngelegenheiten abhängig ist.<br />
� Wird die Lesekompetenz überprüft, bietet sich - zumindest in höheren<br />
Jahrgangsstufen (nicht in der Grundschule!) - das Lebensalter an, sofern in<br />
diesem Bereich auch außerschulische Lerngelegenheiten eine wichtige<br />
Rolle spielen. Bei der Erhebung mathematisch-naturwissenschaftlichen<br />
Wissens ist es umgekehrt.<br />
� PISA liegt eine lebensalterbasierte Populationsdefinition zugrunde (s.u.:<br />
getestet wurden 15-jährige); TIMSS eine klassenbasierte Definition.<br />
� Testmotivation: Gibt es kulturelle Unterschiede in der Testmotivation?!<br />
� Ist nicht prinzipiell auszuschließen. Baumert und Demmrich (2001) konnten<br />
jedoch experimentell nachweisen, dass die Teilnahme an internationalen<br />
Studien zumindest in Deutschland nicht weniger motivierend wirkt als Noten<br />
oder finanzielle Belohnungen. An mangelnder Motivation können die<br />
unterdurchschnittlichen Leistungen dt. Schüler in der PISA-Studie also nicht<br />
gelegen haben.<br />
� Vertrautheit mit Tests: Gibt es kulturelle Unterschiede in der Vertrautheit mit<br />
standardisierten Leistungstests?<br />
� Es konnte gezeigt werden, dass die Leistungen in Leistungstests durch die<br />
gezielte Vorbereitung auf solche Tests verbessert werden können (gilt insb. für<br />
mathematische Aufgaben).<br />
� Inwiefern länderspezifische Unterschiede in der Vertrautheit mit Tests<br />
bestehen, ist jedoch offen.<br />
� Wichtig ist die standardisierte Durchführung von Schultests!<br />
� Die Aufgabenkonstruktion in den neueren internationalen Schulleistungstests beruht<br />
auf dem Grundbildungs- bzw. Literacy-Konzept. Abgefragt wird weniger<br />
„Schulwissen“ (wie es in den Lehrplänen festgehalten ist) als vielmehr<br />
„Anwendungswissen“! Literalität bzw. Grundwissen ermöglicht der Theorie nach die<br />
Anpassung an den gesellschaftlichen Wandel.<br />
� Dimensionen mathematischer Literalität („Benchmarks“ = Vergleichsstandards):<br />
� Wertschätzung der Mathematik<br />
� Positives Fähigkeitsselbstkonzept<br />
� Theoretische und praktische Anwendung mathematischen Wissens<br />
� Kommunikation mit Hilfe der Mathematik<br />
� Mathematisches Denken<br />
42
3. Die wichtigsten Studien<br />
� Die 3 wichtigsten internationalen Schulleistungsstudien sind TIMSS, PISA und IGLU.<br />
� TIMSS: Die dritte internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie<br />
� Initiator: IEA (International Association for the Evaluation of Educational<br />
Achievement)<br />
� Durchführungszeit: 1994 und 1995<br />
� Vorläuferstudien: FIMS (1964); SIMS (1980-82)<br />
� 3 Untersuchungskohorten: 3.und 4. Jahrgangsstufe / 7. und 8. Jahrgangsstufe /<br />
Schüler im letzten Ausbildungs- oder Gymnasialjahr<br />
� Durch die TIMMS wurde in Deutschland die systematische Evaluation von<br />
Bildungsprozessen eingeleitet („empirische Wende“)<br />
� PISA: Programme for International Student Assessment<br />
� Initiator: OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und<br />
Entwicklung)<br />
� Durchführungszeit: seit 2000 alle 3 Jahre<br />
� PISA 2000: Schwerpunkt Leseverständnis [+ selbstreguliertes Lernen]<br />
� PISA 2003: Schwerpunkt Mathematik [+ allg. Problemlösefähigkeiten]<br />
� PISA 2006: Schwerpunkt Naturwissenschaften<br />
� Untersuchungskohorte: 15-jährige Schüler (überwiegend 9. Jahrgangsstufe)<br />
� IGLU: Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung<br />
� Initiator: IEA (International Association for the Evaluation of Educational<br />
Achievement)<br />
� Durchführungszeit: 2001<br />
� Untersuchungskohorte: Schüler/innen der 4. Jahrgangsstufe<br />
� Geprüft wurde Leseverständnis, Orthographie, Mathematik, Naturwissenschaften<br />
4. Die wichtigsten Ergebnisse:<br />
� TIMSS: Deutschland liegt unterhalb des internationalen Durchschnitts; Defizite<br />
insbesondere was die praktische Anwendung mathematischen Wissens betrifft; Keine<br />
Folge geringerer Unterrichtszeit; Kumulative Defizite<br />
� PISA: Deutschland liegt in allen 3 Kompetenzbereichen unterhalb des internationalen<br />
Durchschnitts (PISA-Schock!); über 20% der 15-jährigen verfügt lediglich über<br />
mangelhafte Lesekompetenz (Risikogruppe); hohe Streubreite der Leistungen; in<br />
kaum einem anderen Land ist die Leistung so stark von der sozialen Herkunft<br />
abhängig wie in Deutschland (Chancenungleichheit!); deutschlandintern schneiden<br />
Bayern und Baden-Württemberg noch am besten ab; Lehrer erkennen lediglich 10%<br />
der extrem leseschwachen Schüler (schlechte diagnostische Fähigkeiten)<br />
� IGLU: Wesentlich bessere Ergebnisse => Ergo: Deutsche Grundschulen sind<br />
effizienter als die weiterführenden Schulen (Sekundarstufe I und II)<br />
� Deutung: Die gefundenen Leistungsunterschiede zwischen den Ländern hängen nur<br />
unwesentlich mit den unterschiedlichen Fachcurricula oder Verwaltungs- und<br />
Organisationsformen zusammen. Als erklärende Faktoren kommen vielmehr in Frage:<br />
� Kulturelle Differenzen in der Wertschätzung von Bildung und die damit<br />
verbundenen Unterschiede in der Investitions- und Anstrengungsbereitschaft<br />
� Kulturelle Unterschiede in der gesellschaftlichen Akzeptanz und<br />
Wertschätzung einzelner Wissensgebiete und Schulfächer<br />
� Qualitative Unterschiede in der Gestaltung der Lehr-Lern-Prozesse<br />
43
A 7: Basiskompetenzen: Lesen, Schreiben, Mathematik<br />
1. Mathematische Kompetenz<br />
� Mathematische Kompetenz (nach dem Literacy-Ansatz): ist die Fähigkeit, die Rolle<br />
von Mathematik in Alltagssituationen zu erkennen, fundierte mathematische Urteile<br />
abzugeben (d.h. Alltagssituationen mathematisch zu modellieren) und Mathematik<br />
so zu verwenden, dass eine konstruktive gesellschaftliche Teilhabe unterstützt wird.<br />
� Die Fähigkeit Alltagssituationen mathematisch zu modellieren wird meist anhand von<br />
Textaufgaben untersucht:<br />
� Ältere Modelle, wie das STUDENT-Modell von Bobrow, beschreiben das<br />
Lösen von Textaufgaben als direkte Übersetzung gegebener Informationen in<br />
Zahlenwerte und Rechenoperationen.<br />
� Neuere Modelle betrachten das Lösen von Textaufgaben dagegen als zyklischen<br />
Ablauf, im Zuge dessen schrittweise zwischen realer (=Situation in der Aufgabe)<br />
und mathematischer Welt vermittelt wird.<br />
…strukturieren …mathematisiseren …verarbeiten …interpretieren<br />
� Das Realmodell ist eine mentale Repräsentation der vorliegenden Situation;<br />
es in ein mathematisches Modell zu überführen (Mathematisierung bzw.<br />
mathematische Modellierung) ist der entscheidende Prozess der<br />
mathematischen Begriffsbildung.<br />
� Die Verarbeitung des mathematischen Modells, d.h. die Anwendung<br />
entsprechender Rechenoperationen, wird auch als innermathematisches<br />
Modellieren bezeichnet.<br />
� Abschließend wird das gefundene Ergebnis auf die Ausgangssituation<br />
bezogen (Validierung); sollte es nicht plausibel sein, wird der Prozess<br />
erneut durchlaufen.<br />
� Modelle zum mathematischen Modellieren sind freilich Idealisierungen, in der<br />
Realität wird der Prozess vielfach durch einfache Heuristiken abgekürzt:<br />
� Insbesondere die Plausibilitätsprüfung in Bezug auf die situationale<br />
Einkleidung der Aufgabe (=Validierung) wird oft weggelassen.<br />
� Beispiel: „Um 10 Personen zu transportieren, werden 2 ½ (?!) PKWs<br />
benötigt.“<br />
� Erklärung: Der Realitätsbezug der Aufgaben wird von den Schülern und<br />
Lehrern (!) leider meist als sekundär betrachtet.<br />
� Auch der Prozess des Mathematisierens wird oft abgekürzt, indem anhand von<br />
Oberflächenmerkmalen (Schlüsselwörter etc.) das verlangte Schema erschlossen<br />
wird, in das dann nur noch die relevanten Zahlen eingesetzt werden müssen.<br />
� Fishbeins Theorie der primitiven Modelle besagt, dass jede mathematische<br />
Operation auf einer primitiven, impliziten Modellvorstellung beruht, die den<br />
Lösungsprozess von Textaufgaben beeinflusst.<br />
� Multiplikationen liegt z.B. zunächst das einfache Modell der wiederholten<br />
Addition zugrunde. Diese Vorstellung begünstigt zwar die Lösung mancher<br />
Aufgaben (z.B. „3 Mädels bekommen jeweils 4 Bonbons“ => Wie viele<br />
Bonbons?), erschwert aber die Lösung anderer (z.B. Ein Mädel hat 4 Pullis und<br />
5 Hosen“ => Wie viele Kombinationen?); die Modelle müssen daher immer<br />
wieder umstrukturiert werden.<br />
44
� Der Modelling-Ansatz: betrachtet mathematische Kompetenz als die Fähigkeit,<br />
Situationswissen in mathematische Konzepte zu überführen; im Zentrum des<br />
Mathematikunterrichts sollte dementsprechend der Prozess des Mathematisierens<br />
stehen. Das erfordert v. a. Textaufgaben, die nicht nach Rezept gelöst werden können,<br />
sondern komplexe Situationsbeschreibungen enthalten (Modellierungsaufgaben).<br />
� Dass der Prozess der Mathematisierung keineswegs automatisch abläuft, ist<br />
vielfach belegt:<br />
� Textaufgaben werden im Vergleich zu strukturidentischen mathematischen<br />
Aufgaben um bis zu 30% schlechter gelöst.<br />
� Dabei führen bereits geringe Unterschiede in der Aufgabenformulierung zu<br />
Unterschieden in der Aufgabenschwierigkeit.<br />
� 2 Arten von Mathematisierung lassen sich unterscheiden:<br />
a) Horizontales Mathematisieren: Reduktion einer Alltagssituation auf ihre<br />
mathematische Struktur<br />
b) Vertikale Mathematisierung: Weiterverarbeitung der mathematischen<br />
Struktur im Prozess des innermathematischen Modellierens<br />
� Der didaktische Ansatz der „Realistic Mathematics Education“ (Freudenthal):<br />
Damit mathematisches Wissen kein oberflächliches Anwendungswissen bleibt, muss<br />
von der Realität ausgegangen werden; mathematische Modelle und Operationen<br />
erschließen sich nämlich erst, wenn sie an erfahrbare Phänomene zurückgebunden<br />
werden.<br />
� Daraus folgt, dass mathematische Modelle nicht auswendig gelernt-, sondern in<br />
der Auseinandersetzung mit realen Problemen entwickelt werden sollten<br />
(„guided reinvention“).<br />
� Zur Rolle externer Repräsentationen für das mathematische Verständnis:<br />
� Externe Repräsentationen sollen durch ihre strukturelle Ähnlichkeit zur<br />
Problemsituation ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden<br />
mathematischen Strukturen ermöglichen.<br />
� Es wäre jedoch ein Trugschluss zu glauben, die Nutzung externer<br />
Repräsentationen erfolge im Gegensatz zur mathematischen Modellbildung<br />
völlig problemlos. Im Gegenteil: Externe Repräsentationen können nur dann<br />
genutzt werden, wenn die ihnen zugrunde liegenden mathematischen<br />
Strukturen, deren Verständnis durch sie ja erst gefördert werden soll, bereits<br />
verstanden werden (Lernparadox). Kurz: Das Verständnis externer<br />
Repräsentationen und die Entwicklung mathematischer Begriffe<br />
beeinflussen sich wechselseitig.<br />
2. Lesekompetenz<br />
� Kein anderer Lernbereich ist in den ersten Schuljahren so bedeutsam wie die<br />
Schriftsprache; schließlich bildet sie die Voraussetzung für eine aktive und<br />
selbständige Wissensaneignung.<br />
� Basics zur deutschen Schriftsprache:<br />
� Die deutsche Schrift gehört zu den phonographischen bzw. alphabetischen<br />
Schriften, da das wichtigste Orthographieprinzip der deutschen Schriftsprache<br />
das phonographische Prinzip, also die Korrespondenz zwischen Phonemen<br />
(nicht: Lauten!) und Graphemen ist.<br />
� Phoneme sind die kleinsten bedeutungsunterscheidenden lautlichen<br />
Einheiten einer Sprache: im Dt. z.B. das lange und das kurze /e/ (wegen<br />
[be:t] und [bεt])<br />
� Grapheme sind Buchstaben () bzw. Buchstabengruppen (), die<br />
mit den Phonemen korrespondieren.<br />
45
� Die Beziehung zwischen Phonemen und Graphemen ist jedoch nicht<br />
eindeutig; ein gegebenes Graphem kann also mit mehreren Phonemen<br />
korrespondieren (z.B. mit /e/ und /e:/), so wie umgekehrt ein Phonem<br />
durch mehrere Grapheme verschriftlicht werden kann (z.B. /f/ durch , <br />
und ).<br />
� Da es mehr Grapheme als Phoneme gibt, ist dabei die Anzahl der<br />
Phonem-Alternativen für ein gegebenes Graphem insgesamt geringer als<br />
die Anzahl der Graphem-Alternativen für ein Phonem.<br />
� Ein weiteres wichtiges Orthographieprinzip ist das morphematische, also die<br />
Gleichschreibung stammverwandter Wörter (z.B. trotz [hant], wegen<br />
dem in )<br />
� Die Psychologie trägt zum Lernbereich Lesen folgendes bei:<br />
1. Lernpsychologische und/oder entwicklungspsychologische Befunde zur<br />
Begründung bestimmter Methoden des Erstleseunterrichts<br />
2. Evaluation unterschiedlicher Methoden des Erstlese- und Schreibunterrichts<br />
3. Entwicklung von Lesetests zur objektiven Erfassung der Lesekompetenz<br />
4. Problem der Leseschwäche unter diagnostischer, therapeutischer und<br />
präventiver Aufgabenstellung<br />
� Kognitionspsychologische Modelle: befassen sich v.a. mit der Wortidentifikation,<br />
da die dafür notwendigen Prozesse sich am meisten vom Hören unterscheiden und<br />
damit in besonderem Maße lesespezifisch sind.<br />
� 3 Arten von Modellen können unterschieden werden:<br />
a) Top-Down-Modelle: gehen davon aus, dass bei der Worterkennung nicht<br />
nur graphemische Informationen, sondern v.a. der syntaktische und<br />
semantische Kontext des betreffenden Worts genutzt werden (Lesen als<br />
Überprüfung kontextgeleiteter Hypothesen)<br />
b) Bottom-Up-Modelle: beschreiben die Wortidentifikation dagegen als<br />
systematischen Aufbau von der Buchstaben- zur Wortebene und stellen<br />
damit die Verarbeitung der graphemischen Informationen in den<br />
Vordergrund.<br />
c) Interaktive Modelle: verstehen Lesen als Wechselspiel von Top-Down-<br />
und Bottom-Up-Prozessen.<br />
� Die Befunde stützen am ehesten die interaktiven Modelle: Geübte Leser<br />
werden durch einen unpassenden Kontext kaum behindert, Anfänger dagegen<br />
schon; die kontextgeleitete Hypothesenbildung scheint demnach v. a. eine<br />
kompensatorische Funktion zu haben.<br />
� Das Zwei-Wege-Modell von Coltheart (Bottom-Up-Modell) unterscheidet<br />
zwischen einem direkten und einem indirekten Weg der Worterkennung.<br />
� Beim direkten Weg werden die Wörter, sofern sie im inneren<br />
orthographischen Lexikon gespeichert sind, anhand ihrer graphischen<br />
Merkmale unmittelbar wiedererkannt.<br />
� Beim indirekten Weg erfolgt die Wortidentifikation dagegen über die<br />
Synthese der den Graphemen entsprechenden Phoneme (phonologische<br />
Umkodierung und „phonological assembly“).<br />
� Im Verlauf der Grundschulzeit gewinnt der direkte Weg (aufgrund des<br />
anwachsenden „semantischen Lexikons“) zunehmend an Bedeutung,<br />
während der indirekte Weg an Bedeutung verliert.<br />
� Die Annahme, dass die beiden Wege unabhängig voneinander sind<br />
(„horse-race model“), gilt heute jedoch als überholt: die beiden Prozesse<br />
beeinflussen sich vielmehr wechselseitig; sprich: die lexikalische<br />
46
Wiedererkennung ist von der Synthese der Phoneme und diese wiederum<br />
von lexikalischen Faktoren abhängig.<br />
� Interactive-Activation-Model (McClelland et al.): Buchstaben- und<br />
Wortebene aktivieren und inhibieren sich wechselseitig; schon vor Beendigung<br />
der Buchstabenanalyse wird also eine Vielzahl potenzieller Wörter aktiviert,<br />
die die weitere Buchstabenidentifikation beeinflussen.<br />
� Höhere Lesestrategien (beim Lesen von Sätzen und Texten): Die<br />
Verarbeitung von Sätzen bzw. Texten ist nicht lesespezifisch, sondern<br />
entspricht der Verarbeitung gesprochener Sprache (die Leistungen beim<br />
Verstehen gesprochener und geschriebener Sprache sind daher bei<br />
Erwachsenen recht ähnlich).<br />
� Wörter müssen bis zum Ende des Satzes im KZG gespeichert werden, da<br />
erst dann die endgültige Entschlüsselung ihrer Bedeutung erfolgen kann.<br />
� Was von einem Text behalten wird, hängt von der Selbst- bzw.<br />
Fremdinstruktion ab; i.d.R. werden dabei nicht konkrete Wörter, sondern<br />
Bedeutungen gespeichert.<br />
� Entwicklungspsychologische Modelle:<br />
� Die klassischen Stufenmodelle zur Entwicklung der Lesekompetenz (Marsh,<br />
Frith, Seymour) gehen von 3 Entwicklungsphasen aus, die sich, sofern ihnen<br />
je eigene Lesestrategien entsprechen, qualitativ voneinander unterscheiden.<br />
1) Logographisches Lesen: Die Worterkennung bzw. -wiedererkennung<br />
erfolgt direkt – und zwar anhand visueller Oberflächenmerkmale und<br />
einzelner Buchstaben sowie unter Berücksichtigung des Darbietungskontexts.<br />
„Gelesen“ werden können demnach nur zuvor gelernte Wörter!<br />
2) Alphabetisches, synthetisierendes Lesen: Sequentielles Erlesen von<br />
Wörtern auf Basis von Graphemen oder sogar Buchstaben; lexikalische<br />
Identifikation des Wortes oft erst nach dessen vollständiger Artikulation.<br />
3) 3. Stufe wird unterschiedlich beschrieben.<br />
- „Orthographische Strategie“ (Frith): Direkter Zugriff auf ein immer<br />
größer werdendes orthographisches Lexikon und simultane Erfassung<br />
und Verarbeitung immer größerer Worteinheiten (Silben etc.)<br />
- „Hierarchisches Decodieren“ (Marsh): Berücksichtigung<br />
orthographischer Regeln und Anwendung lexikalischer Analogien.<br />
� Neuere Ergebnisse zur Entwicklung von Lesestrategien:<br />
1) Das Erkennen von Symbolen: Die Fähigkeit, Symbole zu erkennen (z.B.<br />
Firmenlogos) ist eine Vorstufe des logographischen Lesens, die sich bereits<br />
im Vorschulalter entwickelt.<br />
2) Logographisches, „ganzheitliches“ Lesen: s.o.; die Strategie ist am<br />
Anfang durchaus sinnvoll; stößt aber mit zunehmender Größe des<br />
Lesewortschatzes schnell an ihre Grenzen<br />
3) „Phonological cue Reading“ und „assoziatives Lesen“: sind<br />
Übergangsstrategien; das Vorgehen ist dabei zwar nach wie vor<br />
überwiegend lexikalisch-logographisch; zumindest vereinzelt werden aber<br />
bereits phonologische Infos (Phoneme zu einigen wenigen Graphemen) in<br />
die Worterkennung einbezogen.<br />
4) Alphabetisches, synthetisierendes Lesen: s.o.;<br />
5) Silbengliederung und die Nutzung suprasegmentaler orthographischer<br />
Strukturen: Erkannt werden Silbengrenzen (notwendig, da die Phoneme<br />
einer Silbe eine lautliche Einheit bilden und daher zusammengesprochen<br />
werden müssen) und Strukturen zur Bezeichnung der Vokallänge bzw. –<br />
kürze.<br />
47
6) Automatisierung: Erst die Automatisierung der Teilprozesse ermöglicht es,<br />
die Aufmerksamkeit vornehmlich auf den Inhalt des Textes zu richten.<br />
7) Bedeutung der metakognitiven Entwicklung für das Lesenlernen:<br />
� Phonologische Bewusstheit (Erkennen von sprachlichen Einheiten)<br />
� Der Erwerb und gezielte Einsatz höherer Lesestrategien (z.B.<br />
„comprehension monitoring“ während des Lesens)<br />
8) Entwicklung des Leseverständnisses: Kann flüssig gelesen werden (2./3.<br />
Schuljahr), wird das Leseverständnis zunehmend von leseunspezifischen<br />
kognitiven Leistungen wie Wortschatz und Weltwissen bestimmt.<br />
� Unterscheidung zw. Lesefertigkeit und Leseverständnis: Die beiden<br />
Komponenten sind zwar nicht unabhängig voneinander, sind aber auch<br />
nicht besonders eng miteinander korreliert!<br />
� Implikationen für den Erstleseunterricht:<br />
� Lesenlernen ist ein Entwicklungsprozess mit wechselnden Strategien, die<br />
ihrerseits nicht an das chronologische Alter gebunden sind. � Forderung nach<br />
offenem Erstleseunterricht, der dem Einzelnen, wenn nötig, mehr Zeit gibt.<br />
� Analytisch-synthetische Verfahren sind notwendig, um ein Gespür für die<br />
Schriftsprache zu entwickeln: Indirekte, lautorientierte Lesestrategien dürfen<br />
daher nicht als Manko betrachtet werden, sondern sind zu fördern!<br />
� Geplante Lesestrategien (z.B. die SQR3-Methode) fördern das Verstehen und<br />
Behalten von Texten<br />
3. Rechtschreiben<br />
� Rechtschreibforschung führt im Gegensatz zur Leseforschung noch immer ein<br />
Schattendasein; und das, obwohl Rechtschreibfähigkeit einer der wichtigsten<br />
Prädiktoren für späteren Schulerfolg ist.<br />
� Rechtschreibprobleme ergeben sich aus der uneindeutigen Zuordnung von<br />
Graphemen und Lauten bzw. Phonemen.<br />
� Lesen vs. Schreiben: Grundsätzliche Prozessunterschiede<br />
� Früher: Lesen und Schreiben wurden lange Zeit als komplementäre Prozesse<br />
betrachtet („Generierungs-Wiedererkennungs-Schleife“), deren Beherrschung<br />
letztlich dieselben Kompetenzen erfordert: nämlich die richtige Zuordnung von<br />
Buchstaben zu Lauten (Lesen) bzw. von Lauten zu Buchstaben (Schreiben).<br />
� Heute: wird davon ausgegangen, dass sich Schreibprozesse in mehrerer<br />
Hinsicht vom Lesen unterscheiden.<br />
� Schon rein logisch ist Schreiben schwieriger als Lesen:<br />
1. Ist die Anzahl von Phonem-Alternativen für ein gegebenes Graphem<br />
(Lesen) geringer als die Anzahl der Graphem-Alternativen für ein<br />
bestimmtes Phonem (Schreiben).<br />
2. Finden beim Lesen lediglich Wiedererkennungsprozesse statt<br />
(Recognition), während beim Schreiben die serielle Reproduktion der<br />
Buchstabensequenzen erforderlich ist (Recall).<br />
� Empirischer Beleg: Bei LR-schwachen Schülern besteht zwischen Lese-<br />
und Rechtschreibleistung lediglich eine Korrelation von r =.33<br />
� Produktorientierte Forschung: Determinanten der Rechtschreibleistung<br />
� Der Versuch, ausgehend von verschiedenen Fehlerarten (Regelverstöße,<br />
unterbliebene Analogiebildung, Schwächen bei der Speicherungsfähigkeit von<br />
Wortbildern etc.) auf spezifische psychische Funktionen zu schließen,<br />
scheitert:<br />
� Hohe Interkorrelationen zwischen den verschiedenen Fehlerarten<br />
48
� Gute und schlechte Schreiber unterscheiden sich v.a. durch das Ausmaß,<br />
nicht aber durch die Eigenart ihrer Fehler.<br />
� Immerhin kann gesagt werden, dass sprachliche Fähigkeiten und bestimmte<br />
Komponenten des Gedächtnisses (verbales KZG etc.) und der Intelligenz für<br />
die Rechtschreibleistung von großer Bedeutung sind; wobei sich die<br />
Gewichtung der einzelnen Determinanten im Laufe der<br />
Rechtschreibentwicklung zu ändern scheint.<br />
� Ein Funktionsmodell des Rechtschreibens (von SIMON & SIMON):<br />
� Simon und Simon gehen davon aus, dass der Rechtschreibprozess im<br />
wesentlichen auf 2 Speichersystemen aufbaut:<br />
1. Der Speicherung von Phonem-Graphem-Entsprechungen<br />
2. Der Speicherung von optischen Wortbildern bzw. Buchstabenfolgen<br />
� Ausgehend davon beschreiben sie den Rechtschreibvorgang als einen<br />
Produktions- und Vergleichsprozess („generate-and-test-procedure“):<br />
Zunächst wird für jedes Phonem ein Graphem aus der Reihe der verfügbaren<br />
Phonem-Graphem-Korrespondenzen eingesetzt. Anschließend wird das so<br />
entstandene orthographische Bild an den Wortbildspeicher weitergegeben und<br />
mit den dort verfügbaren Infos verglichen.<br />
� Praktischer Nutzen: Das Modell verdeutlicht den Stellenwert, den der<br />
Bekanntheitsgrad eines Wortes einnimmt.<br />
� Kritik: Zumindest was das Aufschreiben orthographisch nicht direkt<br />
verfügbarer Wörter betrifft, ist das Modell überzeugend. Dass die aufwendigen<br />
Produktions-Vergleichs-Schleifen aber auch bei orthographisch verfügbaren<br />
Wörtern ablaufen, ist eher unwahrscheinlich.<br />
� Zur Relevanz visueller und phonologischer Strategien beim Zugriff auf das<br />
semantische Lexikon:<br />
� Lediglich schlechte Rechtschreiber arbeiten fast ausschließlich mit<br />
phonologischen Strategien (die bei Unregelmäßigkeiten natürlich versagen);<br />
gute Rechtschreiber verwenden dagegen eine Kombination aus phonologischen<br />
und visuell-orthographischen Prozeduren (Gute Regelkenntnis reicht also nicht<br />
aus!).<br />
� Durch schriftliche Vorlagen wird die Anwendung visueller Strategien<br />
perfektioniert.<br />
� Entwicklungspsychologische Modelle zum Schriftspracherwerb:<br />
� Früher ging man von einer Hierarchie von Teilleistungen aus, die beim Lesen<br />
und Schreiben zusammenwirken und separat diagnostiziert werden können<br />
(additive Komponentenmodelle)<br />
� Heute geht man dagegen von qualitativ unterscheidbaren Entwicklungsstufen<br />
aus, wobei davon ausgegangen wird, dass bereits in der Vorschule wichtige<br />
Grundlagen für den Schriftspracherwerb gelegt werden (Prozessmodelle).<br />
� Grundannahme: Durch den probierenden Umgang mit Schrift wächst die<br />
Einsicht in ihre Funktion und Logik; bereits vorschulischen<br />
Auseinandersetzungen mit der Schriftsprache kommt daher eine große<br />
Bedeutung zu!<br />
� Das dominierende Modell ist heute das „Developemental spelling“-Modell;<br />
es geht davon aus, dass die Orthographie nicht passiv „gespeichert“, sondern<br />
anhand verschiedener Strategien, die sich im Lauf der Zeit ändern,<br />
rekonstruiert wird. Die Entwicklung verläuft dabei in folgenden 5 Stufen:<br />
1. Präkommunikatives Stadium: Kindergartenkinder experimentieren mit<br />
sprachlichen Symbolen; zwar sind bereits einige Buchstaben bekannt, die<br />
49
Kinder sind jedoch noch nicht in der Lage, die Phonem-Graphem-<br />
Korrespondenzregeln zu nutzen.<br />
2. Semiphonetische Stufe (1. und 2. Klasse): Kinder erwerben grundlegende<br />
Kenntnisse und Fertigkeiten; sie lernen, dass Schreibungen von links nach<br />
rechts erfolgen und bestimmte Buchstaben bestimmten Lauten zuzuordnen<br />
sind; Schreibversuche sind noch unvollständig und gehen selten über 3 bis<br />
4 Buchstaben hinaus.<br />
3. Phonetische Stufe (3. und 4. Klasse): erweitertes Verständnis für<br />
Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln; aber noch keine völlige<br />
Beherrschung der orthographischen Konventionen<br />
4. Übergangsstufe (5. und 6. Klasse): bessere Kenntnis der<br />
Rechtschreibregeln; Gespür für standardmäßige Schreibung; neben den<br />
phonologischen Prozeduren werden zunehmend visuelle<br />
Rechtschreibstrategien verwendet (Korrekturlesen)<br />
5. Kompetenzstufe: Umfangreiches Wissen über die Struktur von Wörtern<br />
und Phonem-Graphem-Korrespondenzen; Falschschreibungen werden<br />
daran erkannt, dass Wort „nicht richtig aussieht“<br />
� Kritik am „Developmental spelling“-Modell (Goswami): Bereits<br />
Rechtschreibnovizen benutzen verschiedene Strategien und greifen auf<br />
unterschiedliche Wissensquellen zurück; außerdem: mangelnde empirische<br />
Überprüfung<br />
� Praktische Anwendung des Modells: Das didaktische Konzept des „Invented<br />
spelling“ (Gentry) geht davon aus, dass es in der Anfangszeit fast nur darauf<br />
ankommt, Schreibaktivitäten zu fördern; die Beachtung der orthographischen<br />
Regeln wird dagegen, zumindest während der ersten Entwicklungsstufen, als<br />
sekundär betrachtet, da sich die fehlerfreie Schreibung, so die Annahme, im 5.<br />
Stadium von selbst einstellt!<br />
� Problem: Die Wirksamkeit des Ansatzes ist empirisch kaum belegt.<br />
� Längsschnittstudien zur frühen Vorhersage von Lese-Rechtschreibleistungen:<br />
� Werden bereits im Vorschulalter erhobene Variablen (wie Intelligenz,<br />
phonologische Bewusstheit etc.) zur späteren Leseleistung in Bezug gesetzt,<br />
erweisen sich v.a. die versch. Komponenten der „phonologischen<br />
Informationsverarbeitung“ als vorhersagekräftig; dazu zählen…<br />
a) Die phonologische Bewusstheit (im weiteren und engeren Sinn): Die<br />
Fähigkeit, sich von der Bedeutung der Sprache lösen zu können und sich<br />
ihrer Struktur zuzuwenden.<br />
b) Das phonologische bzw. phonetische Rekodieren im KZG: Die<br />
Fähigkeit, Lautfolgen im Arbeitsspeicher bereitzuhalten (=Kapazität des<br />
verbalen KZG)<br />
c) Das phonologische Rekodieren beim Zugriff auf das semantische<br />
Lexikon: Die Fähigkeit, im LZG gespeicherte sprachliche Infos möglichst<br />
schnell abrufen zu können.<br />
� Komplex angelegte Längsschnittstudien wie die Münchener<br />
Längsschnittstudie LOGIK zeigen:<br />
a) Dass die verschiedenen Bereiche phonologischer Informationsverarbeitung<br />
eine wichtige Rolle beim späteren Schriftspracherwerb haben.<br />
b) Dass zwischen diesen Bereichen z.T. beträchtliche Korrelationen bestehen<br />
(etwa zwischen Indikatoren des KZG und der phonologischen Bewusstheit)<br />
50
c) Dass die Prognosequalität der verschiedenen Komponenten vom jeweiligen<br />
Kriterium abhängt:<br />
- Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn korreliert z.B. stärker mit<br />
Rechtschrift, phonologische Bewusstheit im engeren Sinn dagegen<br />
stärker mit der Lesefertigkeit.<br />
- Insgesamt scheint phonologische Bewusstheit für die spätere<br />
Lesekompetenz wichtiger zu sein als für die Rechtschreibung, während<br />
für die Prognose des Rechtschreibens Indikatoren des<br />
Arbeitsgedächtnisses und der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit<br />
eine größere Rolle spielen.<br />
� Wie der Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und Lese-<br />
Rechtschreibkompetenz zu interpretieren ist, d.h. ob die phonologische Bewusstheit<br />
eine Voraussetzung oder eine Folge des Lesens und Schreibens ist, ist umstritten.<br />
� Mögliche Lösung: Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn ist<br />
Voraussetzung, phonologische Bewusstheit im engeren Sinn eine Folge des<br />
Schriftspracherwerbs.<br />
� Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn meint das generelle<br />
Vermögen, unabhängig von der Bedeutung eines Wortes auf seine<br />
phonologischen Merkmale zu achten (Grundlage für Reimerkennung);<br />
dabei werden zunächst lediglich größere Einheiten wie Silben erkannt.<br />
� Phonologische Bewusstheit im engeren Sinn (auch: phonemische<br />
Bewusstheit) umfasst die Phonemanalyse und -synthese, sie zielt also nicht<br />
mehr nur auf die größeren, sondern auch auf die kleineren Segmente der<br />
gesprochenen Sprache und setzt meist erste Erfahrungen mit dem Alphabet<br />
voraus.<br />
� Trainingsstudien zeigen, dass sich phonologische Bewusstheit trainieren lässt,<br />
und dass solche Trainings auch dann effektiv sind, wenn keine Kenntnisse des<br />
alphabetischen Prinzips vorliegen.<br />
� Training erfolgt z.B. durch Reimaufgaben, Silbenklatschen, Silben-<br />
Zusammenziehen, Phonemdifferenzierung.<br />
4. Lese-Rechtschreibschwierigkeiten<br />
A) Eingrenzung des Phänomens und mögliche diagnostische Gruppierungen<br />
� Veraltete Einteilung nach RANSCHBURG (1916):<br />
� Infantile Wortblindheit: liegt bei extremer Leseschwäche vor, genauer: bei<br />
Kindern, die trotz ausreichender Intelligenz allenfalls einfache, einsilbige<br />
Wörter lesen können und selbst mit spezieller Förderung kaum Fortschritte<br />
erzielen.<br />
� Extrem selten<br />
� Legasthenie: Erhebliche, aber weitaus weniger extreme Rückständigkeit im<br />
Lesen und Schreiben, unabhängig (!) von der Intelligenz (keine<br />
Diskrepanzdefinition!)<br />
� Einteilung nach LINDNER (1951):<br />
� Allgemeine Lese-Rechtschreibschwäche (L-R-Schwäche) : Überbegriff<br />
� Legasthenie (auch: L-R-Störung): Spezialform der Lese-<br />
Rechtschreibschwäche („specific reading disability“), die dann vorliegt, wenn<br />
die schlechten Lese- und Rechtschreibleistungen in Diskrepanz zur Intelligenz<br />
stehen, die Intelligenz also intakt oder sogar hoch ist (Diskrepanzdefinition).<br />
51
� Definition: „Eine spezielle aus dem Rahmen der der übrigen Leistungen<br />
fallende Schwäche im Erlernen des Lesens bei sonst intakter oder relativ<br />
guter Intelligenz.“ (Lindner)<br />
� Diagnose: Vergleich der Lese-Rechtschreibleistungen (Prozentrang <<br />
15) mit dem Wert in einem sprachfreien Intelligenztests und Ausschluss<br />
folgender Punkte:<br />
- Störungen der peripheren Sinnesorgane<br />
- Sonstige körperliche Behinderungen<br />
- Mangelnde Übung (infolge von Krankheit und Fehlstunden)<br />
- Sprach- und Schulwechsel<br />
- Ungewöhnliche Schulumstände<br />
- Schlechte Schulmethoden<br />
- Offensichtlich gestörte Lehrer-Schüler-Beziehung<br />
� Kritik an der Diskrepanzdefinition: Die unterschiedliche Behandlung von<br />
Legasthenikern und allgemein lese-rechtschreibschwachen Schülern ist a) ethisch<br />
bedenklich (schließlich haben alle das gleiche Recht auf Förderung) und<br />
b) theoretisch kaum gerechtfertigt.<br />
� Zwischen Intelligenz und Lese-Rechtsschreibleistung besteht ohnehin nur eine<br />
mittelhohe Korrelation (r =.4 bis .5), eine Diskrepanz zwischen beidem ist<br />
daher durchaus im Rahmen des „Normalen“ und keineswegs erwartungswidrig.<br />
� Dem entspricht, dass intelligente und weniger intelligente Lese-<br />
Rechtschreibschwache große Übereinstimmungen in den Symptomen<br />
aufweisen und ähnlich auf Behandlung reagieren.<br />
� Die Diagnose von Legasthenie, sofern sie lediglich auf dem Vergleich zweier<br />
Testwerte beruht, hängt stark von den verwendeten Tests ab und ist sie zeitlich<br />
sehr instabil.<br />
� Neurologische Auffälligkeiten werden eher bei „retarded readers“ als bei<br />
Legasthenikern gefunden, was gegen den Krankheitswert der „specific reading<br />
disability“ spricht.<br />
� Trotz der berechtigten Kritik an der Diskrepanzdefinition wird sie sie in der<br />
pädagogisch-psychologischen Praxis nach wie vor angewandt (siehe: B1).<br />
� Immerhin: Zumindest in der Forschung wird Legasthenie heute meist in einem<br />
weiteren Sinn verstanden und dementsprechend nicht mehr von der<br />
allgemeinen Lese-Rechtschreib-Schwäche unterschieden (� „Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten“)<br />
� Eine interessante Alternative zur gängigen Definition stammt von Stanovich,<br />
der das Leseverständnis nicht zur Intelligenz, sondern zum Verstehen<br />
gesprochener Sprache in Beziehung setzt.<br />
� Zum Ausmaß des Problems:<br />
� Die ICD-10-Kriterien für eine L-R-Störung (=Legasthenie) erfüllen ca. 2-4%<br />
der Kinder.<br />
� Von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten kann man sprechen, wenn die<br />
Leistung um mehr als eine Standardabweichung unter dem Durchschnitt liegt,<br />
was bei ca. 15% der Fall ist<br />
� Geschlechterverhältnis: Jungen sind dabei weitaus stärker betroffen als<br />
Mädchen: 2,5 : 1 [Interessanter Weise ist dieser Geschlechtsunterschied<br />
bei Legasthenikern noch deutlicher: 7 : 1]<br />
� Meist treten Lese- und Rechtschreibschwäche gekoppelt auf; es gibt aber auch<br />
Rechtschreibprobleme ohne Leseprobleme und, wenn auch noch seltener,<br />
Leseprobleme ohne Rechtschreibprobleme.<br />
52
B) Ursachen der Lese-Rechtschreibschwäche<br />
� Methodische Probleme bei der Ursachenforschung:<br />
� Das häufigste Forschungsparadigma ist der Vergleich von Extremgruppen,<br />
also der Vergleich von guten und schlechten Lesern. Parallelisiert werden diese<br />
Gruppen entweder nach dem Alter oder einer bestimmten<br />
Merkmalsausprägung (z.B. verbale Intelligenz).<br />
� Problem: Parallelisiert man nach dem Alter, treten in fast allen erhobenen<br />
Merkmalen (Wortschatz etc.) Unterschiede auf, ohne dass gesagt werden<br />
kann, ob diese eine Ursache oder eine Folge der Lese-<br />
Rechtschreibschwäche sind. Parallelisiert man nach einem Merkmal<br />
werden nicht repräsentative Gruppen verglichen.<br />
� Besser ist daher das Lesealtervergleich-Paradigma, bei dem die<br />
Vergleichsgruppen nach ihrem Lesealter parallelisiert werden. Finden sich<br />
beim Vergleich zwischen guten bzw. durchschnittlichen jüngeren und<br />
unterdurchschnittlichen älteren Lesern Unterschiede in kognitiven<br />
Teilleistungen, sind diese als spezifische Probleme der Leseschwachen zu<br />
interpretieren, da sie nicht auf die bisherige Leseerfahrung zurückgeführt<br />
werden können.<br />
� Einige sichere Ergebnisse zu den Symptomen:<br />
� LRS-Kinder machen lediglich quantitativ mehr Fehler als gute Rechtschreiber<br />
(qualitative Unterschiede gibt es nicht)<br />
� LRS-Kinder weisen Defizite in der Artikulations- und Lautunterscheidungsfähigkeit<br />
auf, haben einen geringeren Wortschatz und schwächere verbale<br />
Gedächtnisleistungen.<br />
� LRS-Kinder müssen sich schon bei vergleichsweise einfachen<br />
Problemstellungen maximal konzentrieren, da die Verarbeitung von<br />
Buchstabensequenzen noch nicht ausreichend automatisiert ist (EEG-<br />
Untersuchungen)<br />
� Schereneffekt: Die Diskrepanz zu normalen Lesern und Rechtschreibern<br />
vergrößert sich im Lauf der Zeit enorm; was nicht zuletzt auf die Motivationsprobleme<br />
(Sekundärsymptomatik) von LRS-Kindern zurückzuführen ist.<br />
� Dem entspricht, dass Trainingsprogramme umso effektiver sind, je früher<br />
sie ansetzten; die Identifikation von Risikokindern schon in der Vorschule<br />
ist daher enorm wichtig!<br />
� Einige unsichere Ergebnisse zu den Ursachen:<br />
� Neurologische Auffälligkeiten (z.B. die fehlende Asymmetrie zwischen<br />
rechtem und linkem Planum temporale) scheinen zwar eine Rolle zu spielen,<br />
sind aber letztlich weder notwendig, noch hinreichend, um die Symptome zu<br />
erklären.<br />
� Erblichkeit: Es gibt zwar Hinweise, dass phonologische Fähigkeiten vererbt<br />
werden, aber keinen Anlass von der Erblichkeit der LRS auszugehen.<br />
� Störungen der Sinnesorgane: Schlechte Leser machen beim Lesen mehr<br />
Regressionen (Rechts-links-Sprünge); kann zwar ein Hinweis auf eine primäre<br />
Augenstörung sein, kann aber genauso eine Folge der LRS sein.<br />
� Soziokulturelle Faktoren (wie das Bildungsniveau der Eltern, die Häufigkeit,<br />
mit der einem Kind vorgelesen wird etc.): haben zwar einen Einfluss auf die<br />
Lesekompetenz, sind aber keineswegs alleine verantwortlich.<br />
� Die pädagogisch-psychologische Forschung bewegte sich anfangs ganz im Rahmen<br />
der differentiellen Psychologie; Ziel war die Ermittlung der für die LRS<br />
verantwortlichen kognitiven Funktionen und Teilleistungen, um ausgehend davon sog.<br />
„Funktionstrainings“ zu entwickeln.<br />
53
� Problem: Die gefundenen Korrelationen zwischen LRS und anderen Defiziten<br />
erlauben keine Kausalitätsaussagen; da letztere sowohl die Ursache als auch<br />
eine Folge der LRS sein können.<br />
� Neuere Untersuchungen (experimentelle Leseforschung) befassen sich daher<br />
eher mit den Teilprozessen des Lesens selbst - als mit deren Verknüpfung zu<br />
anderen kognitiven Prozessen.<br />
� Ergebnisse der differentiellen Psychologie:<br />
� Phonologische Bewusstheit: ist eine metalinguistische Kompetenz und gilt<br />
heute als der entscheidende Faktor beim Erwerb der Schriftsprache.<br />
� Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn meint die Fähigkeit, auf die<br />
phonologischen Merkmale von Wörtern unabhängig von deren Bedeutung<br />
zu achten.<br />
� Phonemanalyse: Die Fähigkeit, ein gesprochenes Wort in seine<br />
Phonembestandteile zu untergliedern („Was bleibt übrig, wenn man bei<br />
‚mich„ das ‚m„ weglässt?“); hat hohen prognostischen Wert bei der<br />
Vorhersage der späteren Lese-Rechtschreibleistung.<br />
� Phonemsynthese: Fähigkeit, ein Wort aus vorgegebenen Phonemen zu<br />
rekonstruieren.<br />
� Phonologische Verarbeitung: Codieren, Speichern und Abrufen<br />
� Beeinträchtigung des verbalen KZG: LR-schwache Kinder haben<br />
Probleme beim Nachsprechen langer Wörter oder kurzer Pseudowörter<br />
� Beeinträchtigung des LZG: LR-schwache Kinder haben Probleme beim<br />
Abruf von Wörtern aus dem inneren Lexikon (z.B. beim Benennen von<br />
Gegenständen oder Bildern, deren Bezeichnungen prinzipiell bekannt sind)<br />
� Ergebnisse der experimentellen Leseforschung:<br />
� Die Hauptprobleme von leseschwachen Kindern betreffen die schnelle und<br />
richtige Wortidentifikation.<br />
� Besonders große Probleme treten beim Lesen von unbekannten<br />
Pseudowörtern auf, woraus folgt, dass die LRS v.a. den indirekten Weg<br />
betrifft (passt zu den Befunden zum phonologischen Bewusstsein und<br />
verbalen Kurzzeitgedächtnis).<br />
� Auch Leseschwache nutzen den Satzkontext, z.T. sogar stärker als gute<br />
Leser (kompensatorische Funktion)<br />
� Die Kenntnis und schnelle Anwendung von Graphem-Phonem-<br />
Korrespondenzen ist bei einem Teil der Legastheniker (literale<br />
Legastheniker) beeinträchtigt, bei einem Teil nicht (verbale<br />
Legastheniker)<br />
� Sofern die Worterkennung die Basis des Lesens bildet, sind auch alle höheren<br />
Prozesse (Textverständnis etc.) bei Legasthenikern beeinträchtigt.<br />
� Fazit: Viele Symptome Lese-Rechtschreib-Schwacher lassen sich als Besonderheiten<br />
einer frühen Entwicklungsstufe beim Erwerb der Schriftlichkeit interpretieren. LRS<br />
kann daher auch als Entwicklungsverzögerung interpretiert werden, darf aber nicht<br />
auf eine solche reduziert werden (da oft auch kontraproduktive Strategien verwendet<br />
werden)<br />
C) Intervention und Prävention (siehe: C 1)<br />
� Erfolgreiches Lesetraining muss am Entwicklungsstand der Kinder anknüpfen und die<br />
bisher erworbenen Lesestrategien berücksichtigen.<br />
� In der Regel ist dabei am alphabetischen, synthetisierenden Lesestrategie<br />
anzusetzen, da von ihr am ehesten ein positiver Transfer zu erwarten ist.<br />
54
� Darüber hinaus gilt: Je früher eine Intervention stattfindet, desto mehr Chancen auf<br />
Erfolg hat sie!<br />
� Aus diesem Grund sollte die Förderung der phonologischen Bewusstheit etc.<br />
bereits in der Vorschule beginnen!<br />
� Beispiele für Lesetrainings:<br />
� Training von Scheerer-Neumann: richtet sich an Kinder, die das Prinzip der<br />
Synthese bereits verstanden haben und v.a. beim Lesen längerer Wörter<br />
Probleme haben.<br />
� Training zur Silbensegmentierung in der gesprochenen und geschriebenen<br />
Sprache<br />
� Kieler Leselehrgang: zielt ebenfalls auf eine bessere Erkennung der Silben;<br />
Unterstützung des Lesens durch Handzeichen etc.<br />
� Prädiktion:<br />
� Die klassischen Schulreifetests hatten nur eine geringe prädiktive Validität<br />
und werden daher kaum noch eingesetzt, getestet wurden v. a. visuelle<br />
Fähigkeiten und logisches Denken; die phonologische Bewusstheit blieb<br />
dagegen unberücksichtigt.<br />
� Die „Differenzierungsprobe“ für Vorschulkinder von Breuer und Weuffen<br />
testet neben der optischen- auch phonematische-, melodische und rhythmische<br />
Differenzierungsleistungen.<br />
� Am besten eignet sich das Bielefelder Screeningverfahren (BISC) zur<br />
Vorhersage von LRS (siehe C1): es überprüft neben dem<br />
Aufmerksamkeitsverhalten für visuelle Symbolfiguren 3 phonologische<br />
Verarbeitungsprozesse: a) die phonologische Bewusstheit (Phonemanalyse<br />
vorgesprochener Wörter), b) phonetisches Rekodieren im KZG und<br />
c) schnelles Rekodieren aus dem inneren Lexikon (z.B. durch Farbnennungen<br />
zu nichtfarbigen Objekten).<br />
� 3 Erhebungszeitpunkte: 10 Monate und 3 Monate vor- sowie 14 Wochen<br />
nach der Einschulung.<br />
� Sehr gute Vorhersage der späteren Lese- und Rechtschreibleistung;<br />
Identifikation von Risikokindern (Probleme am Ende des 2. Schuljahres)<br />
� Wurde z.B. in der Bielefelder Längsschnittstudie und der Münchener<br />
Längsschnittstudie LOGIK eingesetzt.<br />
� Wichtige Begriffe:<br />
� Selektionsrate: Prozentsatz der Kinder, die aufgrund eines Screenings als<br />
Risikokinder identifiziert wurden.<br />
� Grundrate: Prozentsatz der Kinder, die in der Schule Probleme mit dem<br />
Rechtschreiben bzw. Lesen bekommen.<br />
� Maximaltrefferquote: Obergrenze der theoretisch möglichen Trefferrate:<br />
100% - Differenz aus Selektions- und Grundrate<br />
� Gesamttrefferquote: liegt im Wertebereich zwischen Maximal- und<br />
Zufallstrefferquote; gibt die Zahl der valid positiv und negativ<br />
klassifizierten Fälle an.<br />
- Sensitivität: Anteil der Problemkinder, die durch das Screening korrekt<br />
vorhergesagt wurden.<br />
- Spezifität: Anteil der unproblematischen Kinder, die durch das<br />
Screening korrekt vorhergesagt wurden.<br />
� RATZ-Index: gibt den relativen Anstieg der Gesamttrefferquote<br />
gegenüber der Zufallstrefferquote an; bei Werten zwischen 66% und<br />
100%: sehr gute und spezifische Klassifikation; bei Werten zwischen 34%<br />
und 66%: gute, aber eher unspezifische Klassifikation.<br />
55
� Fazit: Die besten Prädiktoren für die spätere LRS sind a) Indikatoren der<br />
phonologischen Bewusstheit, b) Indikatoren der Gedächtniskapazität,<br />
c) Indikatoren der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit und d) Merkmale<br />
der frühen Schriftsymbolkenntnis.<br />
� Prävention:<br />
� Phonologische Analysefähigkeit ist schon im Vorschulalter trainierbar und<br />
sollte v.a. bei Kindern mit schlechten Testleistungen auch schon in dieser Zeit<br />
trainiert werden. Besonders effektiv ist ein Training der phonologischen<br />
Bewusstheit bei gleichzeitiger Einführung der Buchstaben.<br />
� Grundsätzlich gilt, dass der Erwerb der Schriftsprache zeitlich flexibler<br />
gestaltet werden müsste (z.B. durch eine altersgemischte Eingangsstufe)<br />
56
A 8: Lern- und Unterrichtsformen / Lernen mit neuen Medien<br />
1. Lernen mit Medien<br />
A) Allgemeines zu Medien und Medienforschung<br />
� Allgemein lassen sich Medien als nicht-personale Informationsträger definieren.<br />
� Nach Weidenmann lassen sich Medien hinsichtlich 3er Dimensionen<br />
unterscheiden:<br />
1. Technische Basis: Hardware vs. Software<br />
2. Verwendetes Kodierungs- bzw. Zeichensystem: sprachlich vs. bildlich<br />
3. Verwendete Modalität: visuell, auditiv, audiovisuell etc.<br />
� Neue Medien: digital (Computer); „alte“ Medien: analog (Fernsehen, Radio...)<br />
� Multimedia: Sind Medien, die mit mehreren Codes bzw. Modalitäten arbeiten.<br />
� Präziser als der Begriff „Multimedia“ ist daher die Unterteilung in<br />
multikodale- und multimodale Angebote.<br />
� Die traditionelle Medienforschung (70er Jahre) verglich unterschiedliche Medien<br />
(z.B. Text vs. Film) hinsichtlich ihrer Lerneffizienz und kam dabei zu äußerst<br />
widersprüchlichen Ergebnissen.<br />
� Kritik (nach Clark): Aufgrund der Spezifität der unterschiedlichen Medien<br />
sind Treatment (Lehrmethode) und Medium immer konfundiert;<br />
Vergleichsuntersuchungen erlauben daher keine Aussage darüber, ob<br />
gefundene Unterschiede auf die eingesetzten Medien oder auf die mit ihnen<br />
verknüpften Lehrmethoden und Instruktionsformen zurückgehen.<br />
� Die aktuelle Medienforschung verzichtet auf globale Medienvergleiche und<br />
konzentriert sich stattdessen auf Folgendes:<br />
� Medienspezifische Anforderungen an den Lerner (Kognitionspsychologie)<br />
� Anstatt den Lerner als passiven Rezipienten zu betrachten, wird<br />
untersucht, auf welche Weise medienspezifische Symbolsysteme vom<br />
Lerner verarbeitet werden, und wie sich die Darbietungsform auf diese<br />
Verarbeitung auswirkt.<br />
� Emotionale und motivationale Aspekte<br />
� Vergleich unterschiedlicher Präsentationsformen innerhalb eines Mediums<br />
(z.B. visuelle vs. auditive Textpräsentation am PC)<br />
� Vergleich zwischen computervermittelter Kommunikation und Face-to-face-<br />
Interaktionen (Sozialpsychologie)<br />
� Mayers „Cognitive Theory of Multimedia Learning” ist aktuell die dominierende<br />
Theorie zum Lernen mit (neuen) Medien.<br />
� Dem Modell zufolge erfolgt der Lernprozess in mehreren Schritten:<br />
1. Ausgewählte Informationen werden aus dem sensorischen Gedächtnis ins<br />
Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis überführt und dort, je nach Kodalität,<br />
unterschiedlich verarbeitet: Während nonverbale Infos (Bilder etc.) zu<br />
analogen Repräsentationen führen, werden verbale Informationen<br />
(Wörter Zahlen) zu symbolischen Repräsentationen verarbeitet.<br />
� Das Modell übernimmt demnach Paivios Annahme einer dualen<br />
Kodierung (s.u.).<br />
2. Die Speicherung im LZG gelingt umso besser, je besser es gelingt, die<br />
neuen Infos mit dem vorhandenen Vorwissen zu verknüpfen.<br />
� Das Modell erklärt…<br />
a) den Multimedia-Effekt: Dual dargebotene Infos (z.B. Text und Bild)<br />
werden besser gemerkt<br />
57
) den Modalitätseffekt: Bei einer Präsentation von Text und Bild ist eine<br />
audiovisuelle Darbietung effizienter als eine nur visuelle.<br />
� Die „Cognitive Load Theory“ (CLT):<br />
� Ausgehend von der begrenzten Verarbeitungskapazität des Arbeitsgedächtnisses<br />
nennt die Theorie 3 Quellen kognitiver Belastung:<br />
1) Intrinsic load: meint die Belastung, die durch die zu lernenden Inhalte<br />
selbst zustande kommt; wie groß diese Belastung ist, hängt a) von der<br />
Komplexität des Stoffes und b) von dem zur Verfügung stehenden<br />
Vorwissen ab.<br />
2) Extraneous load: ist die Belastung, die durch die Art und Weise der<br />
Informationspräsentation zustande kommt; sie ist überflüssig und sollte<br />
daher so gering wie möglich gehalten werden.<br />
3) Germane load: ist die Belastung, die der Verarbeitungsprozess mit sich<br />
bringt.<br />
� Effektives Lernen, so die CLT, findet nur dann statt, wenn a) die<br />
Gesamtanforderungen die gerade verfügbare kognitive Kapazität nicht<br />
übersteigen und b) der Stoff genügend Kapazität für lernförderliche (germane<br />
load induzierende) Verarbeitungsprozesse lässt.<br />
� Kurz: Ziel muss es sein, den extraneous load zu reduzieren und den<br />
germane load zu fördern.<br />
� Gemessen werden kann der Cognitive load z.B. mit der „Dual-task-Methode“.<br />
� ATI-Effekte bei der Mediennutzung:<br />
� Die Einstellung zu einem Medium hat Einfluss auf dessen Nutzung (s.u.).<br />
� Das Vorwissen wirkt sich ebenfalls auf die Wirksamkeit bestimmter<br />
Darbietungsformen aus.<br />
� So konnte z.B. gezeigt werden, dass sich mediale Unterstützungsangebote,<br />
die für Novizen lernförderlich sind, für Experten sogar<br />
hinderlich sein können („Expertise Reversal“). Erklärt werden kann<br />
dieser Befund mit der „Cognitive load-Theory“: Während die medialen<br />
Unterstützungsangebote für Novizen Quellen von germane load<br />
darstellen, da sie zu einer tieferen Verarbeitung anregen, sind sie für<br />
Experten, die einer solchen Hilfe nicht bedürfen, überflüssig und damit<br />
als „extraneous load“ zu werten.<br />
B) Psychologische Voraussetzungen auf Seiten des Lerners<br />
� Wie effektiv ein Lerner mit Hilfe eines Mediums lernt, hängt v.a. ab von:<br />
1. Der psychologischen Einstellung des Lerners zum Medium<br />
2. Der Fähigkeit, die medienspezifischen Symbolsysteme zu verstehen<br />
(„Literacy“)<br />
3. Der Verarbeitungstiefe<br />
� Zur psychologischen Einstellung des Lerners zum Medium:<br />
� Die motivierende Wirkung von Medien wird in der Didaktik immer wieder<br />
hervorgehoben. Sie geht jedoch häufig auf Neuheitseffekte zurück und klingt<br />
daher mit der Zeit ab.<br />
� Die Einstellung zu einem Medium ist nicht nur unter<br />
motivationspsychologischen Gesichtspunkten relevant, sondern hat auch<br />
Einfluss auf die Art der Mediennutzung.<br />
� Salomon (1984): Einer Schülergruppe wurde ein Video ohne Ton, der<br />
anderen ein Text dargeboten, der den Filmablauf wiedergab. Anschließend<br />
wurde die Lernleistung getestet. Darüber hinaus wurden folgende<br />
Variablen erhoben:<br />
58
a) Perceived demand characteristics (PDC): Erfragt wurde die<br />
Einschätzung der Realitiätsnähe von Film- und Druckmedien und die<br />
Attribution von Erfolg und Misserfolg beim Lernen mit diesen Medien<br />
- Ergebnis: Erfolg beim Lernen mit Filmen wurde external dem<br />
Medium zugeschrieben, Misserfolg dem Lerner, bei Lernen mit<br />
Texten war die Attribution umgekehrt.<br />
b) Perceived self efficacy (PCE): Die Schüler sollten zu 10 Lehrstoffen<br />
einstufen, wie leicht sie diese mithilfe eines Fernsehprogramms oder<br />
eines Textes lernen würden.<br />
- Ergebnis: Die Kinder glaubten, mit Fernsehen erfolgreicher zu<br />
lernen als mit einem Text; tatsächlich wurde jedoch mit dem Text<br />
effektiver gelernt als mit dem Film!<br />
c) Amount of invested mental effort (AIME): Nach Bearbeitung des<br />
Materials sollten die Schüler einschätzen, wie sehr sie sich angestrengt<br />
hatten bzw. wie viel Konzentration sie aufbringen mussten.<br />
- Ergebnis: Das Lernen mit dem Text wurde von den Schülern als<br />
anstrengender eingeschätzt; der Anstrengungsgrad korrelierte dabei<br />
in beiden Gruppen hoch mit positiven Testergebnissen (s.u.:<br />
Verarbeitungstiefe).<br />
� Salomons Experiment zeigt: Film und Fernsehen werden als einfacher<br />
eingestuft, die Schüler investieren dementsprechend weniger Anstrengung in die<br />
Verarbeitung; beim Text ist es genau umgekehrt (Eine „Self-fulfilling<br />
prophecy“?)<br />
� Zur Fähigkeit, medienspezifische Symbolsysteme zu verstehen<br />
(„Literacy“):<br />
� Nicht nur Texte müssen „gelesen“ werden, sondern auch Bilder; die Fähigkeit zu<br />
letzterem wird im Unterschied zur „verbal literacy“ als „visual literacy“<br />
bezeichnet.<br />
� Unterschiedliche Arten von Bildern stellen dabei unterschiedliche<br />
Anforderungen an den Betrachter.<br />
� Filme z.B. erfordern aufgrund ihrer häufigen Perspektivwechsel und der<br />
oft abrupten Kamerabewegungen die Fähigkeit, den Wechsel des<br />
Beobachtungsstandpunktes mental mitzuvollziehen.<br />
� Bei Cartoons müssen die Linien für Geschwindigkeit, Sprechblasen etc.<br />
als solche erkannt werden.<br />
� Die Darstellung von Perspektivität ist eine Kulturtechnik; Naturvölker in<br />
Afrika, denen sie nicht bekannt ist, sind daher nicht dazu in der Lage,<br />
perspektivische Bilder zu lesen, weshalb sie z.B. auch weniger anfällig für<br />
die Ponzo-Täuschung sind.<br />
� Die These, dass es persönlichkeitsabhängige Präferenzen für bestimmte<br />
Kodierungsformen gibt (Visualisierer vs. Verbalisierer), konnte bisher nicht<br />
bestätigt werden.<br />
� Die Dual-Code-Theorie von PAIVIO<br />
� …geht von 2 kognitiven Verarbeitungssystemen aus:<br />
a) Das visuell-nonverbale System verarbeitet nicht-sprachliche Infos<br />
und speichert sie in Form anschaulicher Vorstellungen bzw. analogen<br />
(ähnlichen) Repräsentationen.<br />
b) Das verbale System verarbeitet dagegen sprachliche Infos und<br />
speichert sie in Form symbolischer Repräsentationen.<br />
� Erst auf einer späteren Verarbeitungsstufe kann durch die Aktivierung des<br />
jeweils anderen Systems eine duale Kodierung stattfinden: ein Wort löst<br />
59
ein Vorstellungsbild aus oder ein Bild wird sprachlich bezeichnet. Doppelt<br />
kodierte Infos werden dabei am besten behalten.<br />
- Am häufigsten treten Doppelkodierungen bei Bildern und konkreten<br />
Wörtern (z.B. „Hund“) auf.<br />
� Paivios Modell erklärt zum einen den „Bildüberlegenheitseffekt“ (Bilder<br />
werden besser gemerkt als Wörter); zum anderen deckt es sich mit den<br />
neurologischen Befunden zur Hemisphärenlateralisation (links: Sprache;<br />
recht: Bilder)<br />
� Zur Verarbeitungstiefe:<br />
� Nach CRAIK & LOCKHARDT ist der entscheidende Prädiktor für gute<br />
Gedächtnisleistungen die Verarbeitungstiefe; die tiefste und damit beste<br />
Verarbeitungsstufe ist die der „semantischen“ Verarbeitung.<br />
� Wie erreicht man eine tiefere Verarbeitung:<br />
� Durch Instruktion, wobei gilt: Je spezifischer die Instruktion, desto besser<br />
(Nicht: „Gib Acht!“; sondern: „Achte besonders auf…“)<br />
� Durch ein gewissen Grad an Komplexität: da zu einfache Texte bzw.<br />
Bilder leicht zu oberflächlicher Verarbeitung verführen.<br />
� Durch Interesse: indem z.B. Raum für Interaktivität (Kompetenz) und<br />
Selbständigkeit (Autonomie) gegeben wird.<br />
� Durch die Vermeidung kognitiver Überlastung („Overload“), deren Folge<br />
eine geringere Verarbeitungstiefe ist (Ablenkung vom Wesentlichen).<br />
C) Text als Lernmedium<br />
� Ein Text erschließt sich nur, wenn wir ihn zu unserem Vorwissen in Bezug setzen und<br />
bestimmte Fragen an ihn stellen. Lesen ist daher kein passiver Rezeptionsakt, sondern<br />
ein konstruktiver Prozess, bei dem idiosynkratische (für den jew. Leser spezifische)<br />
Wissensstrukturen aufgebaut werden. (Vgl. Prozessmodell des Lesens von Kintsch<br />
oder auch einfach nur: Hermeneutik!).<br />
� Es wird davon ausgegangen, dass unser Wissen in Form von Netzwerken gespeichert<br />
ist, die aus Mikropropositionen (z.B. einzelnen Begriffen) und Makropropositionen<br />
(z.B. den Hauptideen eines Textes) bestehen.<br />
� Ein tieferes Textverständnis zeichnet sich durch den Aufbau solcher<br />
Makropropositionen aus; sie sind dem Text meist nicht direkt entnehmbar,<br />
sondern müssen erschlossen werden.<br />
� Mindmaps: regen zu reduktiven und elaborativen Prozessen an (und fördern<br />
dadurch die Verarbeitungstiefe)<br />
� Methoden, um das Lernen mit Texten effizienter zu gestalten, sind zwar hilfreich zum<br />
trainieren. Die Wirksamkeit steht jedoch meist nicht im Verhältnis zu ihrem Aufwand!<br />
� SQ3R-Methode (Robinson): Survey� Question� Read� Recite� Review<br />
� Das Trainingsprogramm nach DANSERAU:<br />
1) Verstehensstrategien (beim Lesen): MUR<strong>DER</strong> 1<br />
M (Mood): geeignete Lernatmosphäre schaffen<br />
U (Understanding): Überblick verschaffen und zentrale Textstellen genauer<br />
lesen<br />
R (Recalling): Das Gelesene in eigenen Worten wiedergeben<br />
(Exzerpt)<br />
D (Digesting): Verknüpfung mit anderem Wissen, Beurteilung des<br />
Gelesenen<br />
E (Expanding): Wissen durch Selbstbefragung erweitern: Was bedeutet<br />
das Gelesene für mich?<br />
R (Reviewing): Nach einiger Zeit wiederholen<br />
60
2) Abruf- u. Anwendungsstrategien (z.B. in Prüfungssituationen):MUR<strong>DER</strong> 2<br />
M (Mood): Sich mental einstellen<br />
U (Understanding): Aufgabenstellung verstehen<br />
R (Recalling): Die Aufgabenrelevanten Hauptideen vergegenwärtigen<br />
und in Skizze, Mindmap etc. festhalten<br />
D (Detailing): Hauptideen mit Details anreichern<br />
E (Expanding): Infos im Hinblick auf Aufgabe strukturieren und<br />
vervollständigen<br />
R (Reviewing): Adäquatheit des Lernergebnisses überprüfen<br />
� Texte leserfreundlich gestalten:<br />
� Verständlichkeit<br />
� Das Hamburger Verständlichkeitskonzept: Wichtig sind…<br />
- Einfachheit (Wortwahl, Satzbau usw.)<br />
- Gliederung, Ordnung (Überschriften, Abschnitte etc.)<br />
- Kürze, Prägnanz<br />
- Anregung (direkte Rede, Beispiele, Humor etc.)<br />
� Kohärenz<br />
� Den aktuellen Lesefokus nach vorn (etwa durch Aktivierung von Vorwissen<br />
oder Fragen) und hinten (Arbeitsspeicher) erweitern; Verbesserung durch<br />
explizite Formulierungen (Kohäsion): „deshalb“, „wie ich gezeigt habe /<br />
zeigen werde…“<br />
� Organisationshilfen (z.B. „advance organizers”, Zusammenfassungen…)<br />
� Verbessern die Eingliederung des Textes in die kognitive Struktur des<br />
Lesers (Assimilation)<br />
� Sequenzierung (sinnvolle Reihenfolge, Hervorhebungen etc.)<br />
� Wie lässt sich effektives Lesen fördern?<br />
� Training (etwa mit der „Murder“-Methode)<br />
� Instruktion (konkrete Leseaufträge geben)<br />
� Gut strukturierte Texte auswählen (s.o.)<br />
D) Illustrationen als Lernmedien<br />
� Bilder sind in Lernkontexten meist mit Text verknüpft und dienen dementsprechend<br />
der Illustration.<br />
� Befund: Illustrierte Texte werden besser behalten als nicht-illustrierte!<br />
� Die ökologische Validität dieses Befunds wird jedoch gelegentlich<br />
angezweifelt (Brody).<br />
� Die Zuordnung von Text und Bild kann redundant oder komplementär (sich<br />
wechselseitig ergänzend) sein; letzteres ist effektiver!<br />
� In jedem Fall zu vermeiden, sind rein dekorative Illustrationen, da sie<br />
lediglich vom Wesentlichen ablenken!<br />
� Bilder werden meist als erstes angeschaut; sie sollten daher so gewählt sein,<br />
dass sie die Aufmerksamkeit nicht vom Text abziehen, sondern zu ihm<br />
hinführen.<br />
� Text und Bild haben je eigene Vor- und Nachteile:<br />
� Bilder: sind besser geeignet, räumliche Anordnungen, Bewegungsabläufe,<br />
Strukturen oder Mengenverhältnisse darzustellen.<br />
� Texte: können dagegen auch nicht Sichtbares beschreiben, auf sich selbst<br />
Bezug nehmen, Negation oder Konjunktiv benutzen und den<br />
Verarbeitungsprozess des Lesers besser steuern.<br />
61
� Bilder können auf zwei unterschiedliche Arten verarbeitet werden:<br />
1) Natürliches (ökologisches) Bildverstehen: Dabei wird das Bild auf einen Blick<br />
erfasst, d.h.: es wird das Wesentliche erkannt, ohne die Darstellungs- und<br />
Steuerungskodes des betreffenden Bildes genauer zu analysieren; der dazu<br />
nötige Verarbeitungsprozess ist präattentiv und erfolgt analog zur<br />
Wahrnehmung der realen Umwelt<br />
� Ein Darstellungskode ist z.B. die Zentralperspektive; Steuerungskodes sind<br />
Pfeile, Vergrößerungen, Einrahmungen oder farbliche Hervorhebungen.<br />
2) Indikatorisches Bildverstehen: ist ein attentiver Prozess, im Zuge dessen<br />
einzelne Bildelemente erfasst, identifiziert und zueinander in Bezug gesetzt<br />
werden.<br />
� Lerner begnügen sich leider oft mit dem natürlichen Bildverstehen; indikatorisches<br />
Bildverstehen kann jedoch trainiert werden (ist ein Aspekt der „visual Literacy“).<br />
E) Film, Fernsehen und Video als Lernmedien<br />
� Das Symbolsystem des Films ist der alltäglichen Wahrnehmung am nächsten und stellt<br />
daher nur geringe Anforderungen an die „visual literacy“; aufgrund der häufigen<br />
Schnitte etc. ist jedoch ein hohes Maß an „media-“ bzw. „viewing literacy“<br />
erforderlich (s.u.)<br />
� Sturm beschreibt die Entwicklung der „viewing literacy“ anhand von Piagets<br />
Stufenmodell der kognitiven Entwicklung:<br />
1) Im Stadium des anschaulichen Denkens (Vorschulalter) sind Kinder von<br />
der Montagetechnik des Films überfordert (Rückblenden, Szenenwechsel,<br />
Inkongruenz von Text und Bild etc. werden nicht verstanden)<br />
2) Im Stadium der konkreten Operationen ist das Denken zwar immer noch<br />
an Anschauliches gebunden, die Kinder sind jedoch dazu in der Lage,<br />
umzugruppieren und Synthesen zu bilden. Schnitte, Perspektivwechsel etc.<br />
können daher kognitiv verarbeitet werden.<br />
3) Im Stadium der formalen Operationen (ca. ab 11 Jahren) löst sich das<br />
Denken von der Bindung an Konkretes; das Symbolsystem des Films kann<br />
hier nicht mehr viel zur kognitiven Entwicklung beitragen.<br />
� Jüngere Kinder achten beim Fernsehen weniger auf die Inhalte als auf formale<br />
Merkmale (wie Bewegung, lustige Szenen, Kinderstimmen, Rasanz der<br />
Handlung etc.)<br />
� Für das Verständnis von Film- und Fernsehformaten sind folgende<br />
Bedeutungschemata von Bedeutung:<br />
1) Formatschemata (Identifikation von Genres und Unterscheidung von<br />
Fiktion und Realität)<br />
2) Personschemata (Wiedererkennung von Fernsehakteuren; Unterscheidung<br />
zw. „Spiel“ und „Ernst“)<br />
3) Szenenschemata (entwickelt sich schon relativ früh)<br />
4) Narrationsschemata (umfassen eine Reihe von Szenen)<br />
� Das medienpsychologische Konzept der „perceived reality“ unterscheidet 3<br />
Aspekte, anhand derer zwischen Fiktion und Realität unterschieden werden<br />
können bzw. müssen.<br />
a) Werkkategorie (Spielfilm oder Reportage?)<br />
b) Erfahrungsinhalt (Wahrscheinlich oder unwahrscheinlich?)<br />
c) Erfahrungsmodus (Interaktiv oder passiv?)<br />
62
� Sind Film und Fernsehen geeignete Lernmedien?<br />
� Auf den ersten Blick scheinen Film und Fernsehen die idealen Lernmedien zu<br />
sein (Multimediaeffekt, Modalitätseffekt, Realitätsnähe etc.)<br />
� ABER: Das Arbeitsgedächtnis wird durch die multimodale und –kodale<br />
Darstellungsweise des Films stark beansprucht, was v.a. bei Konsumenten mit<br />
geringem Vorwissen (Kindern und Jugendlichen) leicht zu kognitiver<br />
Überlastung führt; die Folge ist eine geringere Verarbeitungstiefe der Inhalte,<br />
von denen in der Tat oft nur wenig behalten wird (Vgl. „Cognitive load<br />
Theory“)<br />
� Die Kurzzeitigkeit in Filmen stellt auch für Erwachsene oft eine<br />
Überforderung dar; das belegt ein Experiment von Wember, in dem Vpn<br />
verschieden aufgebaute Infosendungen zu sehen bekamen und hinterher<br />
danach gefragt wurden, was sie behalten hätten. Obwohl die Mehrheit die<br />
jeweils gesehenen Sendungen als informativ einstufte, wurden im Schnitt<br />
nur 20% der Infos behalten („Illusion of knowing“)<br />
� ATI: Intelligente Konsumenten mit hoher visual literacy und gutem<br />
Vorwissen behalten deutlich mehr als andere!<br />
� Negativbefunde: Der Fernsehkonsum korreliert negativ mit Intelligenz /<br />
Schulleistung / Einfallsreichtum / Phantasie / schriftsprachlichen Kompetenzen<br />
etc. und positiv mit motorischer Unruhe / Aggression etc.<br />
� ABER: Diese Korrelationen erlauben keine Kausalitätsaussagen! Bei der<br />
negativen Korrelation zwischen Fernsehkonsum und schriftsprachlichen<br />
Kompetenzen könnte es sich z.B. auch um ein Zeitproblem handeln etc. etc.<br />
� Die nach wie vor wichtigste Theorie zum Lernen mit Film/Video ist die Theorie<br />
des Modelllernens nach Bandura.<br />
� Banduras bekanntes Puppenexperiment zeigt, dass in einem Video<br />
beobachtete Modelle genauso nachgeahmt werden wie real beobachtete<br />
Modelle.<br />
� Die wichtigsten Komponenten des Modelllernens:<br />
- Aufmerksamkeitsprozesse (das beobachtete Verhalten muss bewusst<br />
wahrgenommen werden)<br />
- Gedächtnisprozesse (das beobachtete Verhalten muss kognitiv<br />
verarbeitet und im Gedächtnis gespeichert werden)<br />
- Motorische Reproduktionsprozesse (die konkrete Ausführung des<br />
beobachteten Verhaltens muss mental oder physisch geübt werden)<br />
- Motivations- bzw. Verstärkungsprozesse (ob das beobachtete<br />
Verhalten dann in einer bestimmten Situation tatsächlich ausgeführt<br />
wird, hängt von motivationalen Faktoren und damit nicht zuletzt von<br />
den erwarteten Folgen des Verhaltens ab)<br />
� Pädagogische eingesetzt wird die Theorie des Modelllernens u. a. in<br />
Rollenspielen oder videogestützten Lehrertrainings (www.lessonlab.com).<br />
� Einige Thesen zur Wirkung des Fernsehens:<br />
� Kultivierungsthese: Fernsehsendungen schaffen eine eigene soz. Realität, die<br />
auf die Sozialisation des Betrachters Einfluss nimmt (deshalb haben Vielseher<br />
z.B. oft ein pessimistischeres Weltbild, sind misstrauischer, überschätzen die<br />
Kriminalitätsrate etc.)<br />
� Eskapismusthese: Fernsehkonsum als Ersatzbefriedigung im Alltag unerfüllter<br />
Wünsche<br />
� Prägungsthese: V.a. auf Kinder und Jugendliche hat Fernsehen einen prägenden<br />
Einfluss (Entwicklung von Einstellungen, Vorstellungen etc.)<br />
63
� Simulationsthese: Der Konsum gewalthaltiger Programme führt zu höherer<br />
Gewaltbereitschaft<br />
� Unidirektionale Wirkung ist jedoch eher unwahrscheinlich; besser sind<br />
zirkuläre Modelle (Höhere Gewaltbereitschaft führt zum Konsum<br />
entsprechender Sendungen, die ihrerseits die Gewaltbereitschaft steigern)<br />
F) Computer und Netz als Lernmedium<br />
� Die Möglichkeiten, die sich durch die neuen (computergestützten) Medien für das<br />
Lernen ergeben, sind enorm:<br />
� Lernort und Lernzeit werden beliebig<br />
� Lerngruppe ist offen und variabel<br />
� Face-to-Face-Kommunikation kann durch computervermittelte Kommunikation<br />
ersetzt bzw. ergänzt werden.<br />
� Der Lernende kann seinen Lernprozess selbst gestalten; statt mit einem<br />
vorgegebenen Lernstoff wird er im Internet mit einer Vielzahl möglicher<br />
Lernquellen konfrontiert (Lernen als Holen und Explorieren)<br />
� Insbesondere die Forderungen konstruktivistischer Lerntheorien können durch die<br />
neuen Medien verwirklicht werden:<br />
� Reichhaltige Lernumgebungen<br />
� Kommunikation und Interaktion zwischen den Lernenden<br />
� Selbststeuerung des Lernens<br />
� Adaptivität und Offenheit für unterschiedliche Lernniveaus (=><br />
Individualisierung)<br />
� …<br />
� Einige Begriffe:<br />
� „E-Learning“: Lernen mit dem PC, das entweder online (WBT = web-based<br />
training) oder offline (CBT = computer-based training) erfolgen kann.<br />
� Vorteile: geldsparend und flexibel; weniger abhängig von der Person des<br />
Lehrers; v.a. für schwache Lerner bedeutsam: der Computer lässt dem<br />
Einzelnen so viel Zeit wie man braucht und übt keinen sozialen Druck aus.<br />
� „Blended Learning“ („Misch-Lernen“): Da reines E-Learning meist mit hohen<br />
Abbrecherquoten einhergeht, wird es i.d.R. mit klassischen Lernformen<br />
(Präsenzlernen) verbunden.<br />
� „Edutainment“: spielerische und unterhaltsame Lernprogramme (Game based<br />
learning)<br />
� Vorteil: motivierend, intrinisch etc.<br />
� Nachteile: nährt die Illusion, Lernen müsse immer Spaß machen,<br />
Unterhaltungselemente schlucken kognitive Kapazität und führen daher oft<br />
zu einer geringeren Verarbeitungstiefe der eigentlichen Inhalte (Vgl. CLT)<br />
� Typen von Lernsoftware:<br />
1. Drill-and-Practice-Programme: Pool von Übungselementen, deren Darbietung<br />
nach dem Zufallsprinzip erfolgt, und auf deren Bearbeitung ein unmittelbares<br />
Feedback folgt.<br />
2. Tutorielle Programme:<br />
a) Tutorials nach dem Muster des programmierten Unterrichts (Skinner);<br />
kleinschrittiges Vorgehen, unmittelbare Überprüfung und Rückmeldung<br />
b) Adaptive Programme: passen die Auswahl der Lernaufgaben entweder<br />
makroadaptiv an die allgemeinen Vorlieben- oder mikroadaptiv an den<br />
jeweiligen Leistungsstand des Lerners an.<br />
c) Intelligente tutorielle Systeme (ITS): entwickeln ein genaues, sich ständig<br />
aktualisierendes Bild vom Lerner (Student-Modelling)<br />
64
3. Hypertext und Hypermedia: sind Texte bzw. Medien (also auch Videos etc.),<br />
die netzartig, d.h. über bestimmte Knotenpunkte (bzw. Links) miteinander<br />
verknüpft sind (z.B. das Internet)<br />
� Dass der Umgang mit Hypertexten vernetztes und multiperspektivisches<br />
Denken trainiert, konnte empirisch bisher nicht bestätigt werden;<br />
� Fest steht jedoch, dass für einen effizienten Umgang mit Hypertexten<br />
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein sollten (Interesse, Zielorientierung,<br />
Vorwissen, metakognitive Fähigkeiten)<br />
4. Simulationen und Mikrowelten: Mikrowelten sind Anwendungen, die im<br />
Unterschied zu Simulationen (z.B. Planspielen) nur einen sehr begrenzten<br />
Bereich simulieren (z.B. die Brechung eines Lichtstrahls durch Linsen<br />
unterschiedlicher Krümmung)<br />
� Vorteil: Interaktiv und lebensnah (fördern den Transfer von der Lern- auf<br />
die Anwendungssituation)<br />
5. Interaktive Lernumgebungen: Vereinigt verschiedene Arten von Lernsoftware<br />
(Tutorial, Hypermedia, Simulationen etc.); werden häufig in Unternehmen<br />
eingesetzt<br />
6. Lernplattformen und Lernmanagement-Systeme (LMS): werden etwa von der<br />
Fernuni Hagen genutzt, ansonsten überwiegend in Unternehmen, da noch sehr<br />
teuer<br />
� Kooperatives Lernen am Computer:<br />
� E-Learning im Online-Modus eignet sich in besonderem Maße für kooperative<br />
Lernsettings (Austausch von Material; Chatforen etc.)<br />
� Die soziale Präsenz der Beteiligten nimmt in computervermittelter<br />
Kommunikation andere Formen an als in Face-to-Face-Interaktionen:<br />
� Soziale Signale wie Körpersprache, Mimik, Sitzabstand oder Kleidung<br />
spielen eine geringere Rolle oder fallen ganz weg � Daraus ergeben sich<br />
Probleme für den Sprecherwechsel („Turntaking“) und die Übernahme<br />
sozialer Verantwortung<br />
� Durch Emoticons, Bilder etc. wird z.T. versucht, diese medienspezifischen<br />
Mängel zu kompensieren.<br />
� Modelle der computervermittelten Kommunikation (CvK):<br />
� Kanalreduktions-Modelle: Da in der CvK bestimmte Sinneskanäle und<br />
Handlungsmöglichkeiten entfallen, kommt es zu einer Verarmung des<br />
Austauschs (mehr sach- als beziehungsorientiert, oberflächlicher etc.)<br />
� Filter-Modelle: differenziertere Analyse der Bedingungen der CvK; der<br />
Wegfall sozialer Hinweisreize und Statussymbole führt zu mehr Gleichheit<br />
in der Gruppe (Vorteil), führt aber auch zu einer verminderten Einhaltung<br />
sozialer Normen (Nachteil)<br />
� SIDE-Modell (Social identity und deindividuation): Die höhere<br />
Anonymität in CvK führt zu einer stärkeren Orientierung an den sozialen<br />
Normen der Gruppe (erkenntlich z.B. an den bisherigen Beiträgen in einem<br />
Forum)<br />
� Modell der Medienwahl: betont, dass ja jeder Nutzer selbst auswählt, wann<br />
er welche Kommunikationsform einsetzt; für einen kompetenten Nutzer<br />
dürfte die CvK daher keinen Nachteil bringen<br />
� Probleme beim kooperativen Lernen mit dem Computer:<br />
� Erschwerte Koordination (v.a. bei asynchronen Kommunikationsformen)<br />
� Überangebot an Information (gegenseitige Überschwemmung mit Material)<br />
� Fehlendes Gruppenwissen (insbes. was die Kompetenzen der einzelnen Mitglieder<br />
betrifft)<br />
65
B: PÄDAGOGISCH-PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSE, PROGNOSE<br />
<strong>UND</strong> EVALUATION<br />
B 1: Diagnose von Lernstörungen<br />
1. Definition:<br />
� Der Begriff „Leistungsstörung“ kann prinzipiell auf zwei verschiedene Arten<br />
konzeptualisiert werden:<br />
� Kategoriale Konzeptualisierung: Personen werden einer bestimmten Störung<br />
typologisch zugeordnet.<br />
� Z.B.: „Person A ist ein Legastheniker!“<br />
� Dimensionale Konzeptualisierung: Hier wird der Begriff Störung nicht auf<br />
Personen, sondern auf quantifizierbare Personen- und Verhaltensmerkmale<br />
bezogen.<br />
� Z.B.: „Person A hat starke Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben!“<br />
� Störungen lassen sich nach 2 Dimensionen untergliedern:<br />
1. Umfang/Breite der Störung: partiell vs. generell<br />
2. Zeitliche Erstreckung der Störung: temporär vs. chronisch<br />
� Nach Weinert und Zielenski sind „Lernstörungen“ v.a. durch 2 Merkmale<br />
gekennzeichnet:<br />
1) liegt eine signifikante Normabweichung vor.<br />
� Wobei die Norm entweder durch die Anforderungen einer Institution<br />
(Kriteriumsmessung), die Durchschnittsleistung der Vergleichsgruppe<br />
(normorientierte Messung) oder die früheren Leistungen einer Person<br />
(ipsative Messung) bestimmt wird.<br />
2) Ist diese Normabweichung für die betroffene Person so bedeutsam, dass sie<br />
längerfristig zu „unerwünschten Nebenwirkungen im Verhalten, Erleben<br />
oder der Persönlichkeitsentwicklung“ führt.<br />
� Dieser 2. Aspekt impliziert, dass als Lernstörungen nur relativ<br />
überdauernde Minderleistungen anzusehen sind.<br />
� Dass es sinnvoll ist, zwischen „umschriebenen“ Lernschwächen und einer<br />
generellen Retardierung zu unterscheiden, ist unumstritten. Das auf dieser Einsicht<br />
aufbauende Konzept der „Teilleistungsstörungen“ ist jedoch problematisch:<br />
� „Teilleistungsstörungen“ werden meist auf sog. „minimale cerebrale<br />
Dysfunktionen“ (MCD) zurückgeführt. Die Diagnose solcher Dysfunktionen<br />
ist jedoch ebenso unsicher, wie ihr Zusammenhang zum konkreten Verhalten.<br />
� Umschriebene Leistungsminderungen als „Störungen“ zu bezeichnen, ist<br />
problematisch, da es eben keineswegs normal ist, dass sich Personen in allen<br />
Leistungsbereichen auf einem relativ homogenen Niveau bewegen.<br />
2. Zur Diagnose von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (Legasthenie)<br />
� Lindners (1951) Definition von „Legasthenie“ ist sowohl theoretisch, als auch<br />
praktisch kaum zu rechtfertigen (s.o.); trotzdem spielt sie in der pädagogischpsychologischen<br />
Praxis nach wie vor eine große Rolle.<br />
� Zielenski (1995) definiert Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten als „partielle (!)<br />
Lernprobleme, die sich in unterdurchschnittlichen Leistungen im Lesen<br />
und/oder Rechtschreiben äußern.“<br />
66
� Auch wenn das Diskrepanzkriterium in dieser Definition nicht mehr<br />
explizit genannt wird, impliziert der Begriff „partiell“ Diskrepanzen zu<br />
anderen Leistungen.<br />
� Im Kriterienkatalog des DSM-IV („Diagnostic and Statistical Manual of<br />
Mental Disorders“) wird LRS nach wie vor zur Intelligenz in Bezug gesetzt,<br />
ein Kriterium ist nämlich, dass die Lese- und/oder Rechtschreibleistungen<br />
unter dem liegen, was „aufgrund des Alters, der gemessenen Intelligenz und<br />
der altersgemäßen Bildung zu erwarten wäre“.<br />
� Auch wenn Lese- und Rechtschreibprobleme häufig zusammen auftreten und beide in<br />
engem Zusammenhang zur phonologischen Informationsverarbeitung stehen (s.o.),<br />
sollten sie getrennt voneinander betrachtet werden.<br />
� Zu den Unterschieden zwischen Schreiben (schwieriger!) und Lesen: siehe A7<br />
� Diagnostische Verfahren zur Ermittlung von Leseschwäche:<br />
� Testverfahren zur Diagnose von Leseschwierigkeiten sind verhältnismäßig<br />
selten, da nämlich die meisten Lesetests (etwa in Schulleistungstests etc.) eher<br />
das Textverständnis, als basale Lesefertigkeiten messen. Mit Blick auf letztere<br />
können sie daher lediglich als grobe Screeningverfahren eingesetzt werden.<br />
� Der „Salzburger Lese- und Rechtschreibtest“ (1997): besteht aus einem<br />
Lese- und einem Rechtschreibteil:<br />
� Leseteil: Häufige Wörter (z.B. „Buch“, „Tier“ etc.) zur Überprüfung der<br />
direkten Worterkennung in der 1. und 2. Klasse; zusammengesetzte<br />
Wörter zur Überprüfung der direkten Worterkennung in der 3. und 4.<br />
Klasse; wortunähnliche (z.B. „holom“) und –ähnliche Pseudowörter (z.B.<br />
„Vaus“) zur Überprüfung der phonologischen Informationsverarbeitung;<br />
Text zur Prüfung der Lesefähigkeit in „natürlichen Lesesituationen“<br />
� Rechtschreibteil: Diktierte Wörter sind in Lückensätze einzutragen;<br />
Kategorisierung der Fehler in Groß-/Kleinschreibung; orthographische<br />
Fehler und nicht lauttreue Fehler<br />
� „Knuspels Leseaufgaben“ (Marx): Lesetest für die Grundschule, der nicht<br />
nur die Lesefähigkeit als solche, sondern auch relevante Vorläuferfähigkeiten<br />
(phonologische Bewusstheit etc.) misst.<br />
� Zielenski: Liste mit Mono-, Di-, Tri- und Tetragrammen zur Testung der<br />
Rekodierungsgeschwindigkeit von Phonem-Graphem-Korrespondenzen; Pbn,<br />
die beim Abruf der Phonem-Graphem-Korrespondenzen Schwierigkeiten<br />
haben, brauchen beim Lesen der Tri- und Tetragramme deutlich länger!<br />
� Diagnostische Verfahren zur Ermittlung von Rechtschreibschwäche:<br />
� Konventionelle Rechtschreibtests (z.B. der WRT3+) arbeiten mit<br />
Lückentexten, in die diktierte Wörter eingetragen werden sollen. Sind als<br />
Screenings geeignet, nicht aber zur genaueren Diagnose.<br />
� „Salzburger Lese- und Rechtschreibtest“ (s.o.)<br />
� „Inventar impliziter Rechtschreibregeln“ (IiR): testet sowohl Komponenten<br />
der phonologischen Informationsverarbeitung als auch Kenntnis und<br />
Anwendung der orthographischen Konventionen.<br />
� Einige Aufgabentypen:<br />
- Identifikation richtiger Schreibweisen (z.B.: „Father“ –„Fater“ –<br />
„Vather“ – „Vater“)<br />
- Visuelles Erkennen von Hauptmorphemen (z.B. den Verbstamm<br />
„fahr“)<br />
- Diktat von Vornamen und Nachnamen (ersteres zur Überprüfung der<br />
phonologischen Infoverarbeitung: z.B. „Susi“; letzteres zur Testung<br />
orthographischer Konventionen: z.B. „Rahn“, „Ruppel“<br />
67
- Außerdem: Aufgaben zur Silbentrennung; zur Unterscheidung von<br />
Kurz- und Langvokalen, zur Groß- und Kleinschreibung usw. usw.<br />
� Die verschiedenen Aufgabentypen unterscheiden sich in ihrem<br />
Schwierigkeitsgrad so, dass sie 3 hierarchisch angeordneten<br />
Kompetenzstufen zugeordnet werden können, wobei die auf den höheren<br />
Stufen angesiedelten Kompetenzen die grundlegenderen jeweils<br />
voraussetzen!<br />
� Der Test ermöglicht somit sowohl die Messung der vorhandenen-, als auch<br />
die Messung der noch zu erlernenden Voraussetzungen eines Pbn.<br />
� Grundsätzliche Probleme bei der Diagnose von LRS:<br />
� Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten können im Unterricht meist erst relativ<br />
spät entdeckt werden (3. / 4. Schuljahr); das ist v.a. deshalb problematisch,<br />
weil die LRS dann meist schon durch andere Effekte (etwa des Unterrichts<br />
oder der Lehrer-Schüler-Interaktion) und von den Bewältigungsstrategien des<br />
Kindes selbst überlagert ist. Darüber hinaus kommen oft Sekundärsymptome<br />
wie Schulangst hinzu.<br />
� Bei der Intervention ist es wichtig, solche Sekundärsymptome a) zu erkennen<br />
und b) getrennt von der LRS zu behandeln (etwa durch Entspannungsübungen<br />
etc.)<br />
3) Zur Diagnose von Rechenschwierigkeiten (Diskalkulie)<br />
� Im Vergleich zur Legasthenie ist Diskalkulie zumindest in der Öffentlichkeit recht<br />
unbekannt.<br />
� Von Zielinski werden Rechenschwierigkeiten analog zur Lese-Rechtschreibschwäche<br />
als „partielle Lernprobleme“ definiert, „die sich in unterdurchschnittlichen Leistungen<br />
im arithmetischen Bereich äußern“.<br />
� Dasselbe gilt für das DSM IV: analoge Definition wie bei LRS (s.o.)<br />
� Auch die Definition von Diskalkulie beruht somit auf der Diskrepanz<br />
zwischen erwarteter und tatsächlich beobachteter Rechenleistung.<br />
� Die wichtigsten (empirisch belegten) Determinanten von Rechenkompetenz sind:<br />
� Allgemeine Intelligenz und spezifische Vorkenntnisse<br />
� Geschlecht<br />
� Kulturelle Einflüsse (Art der Aufgabenstellung, Vertrautheit mit<br />
Zahlsymbolsystemen etc.)<br />
� Die spezifischen Vorkenntnisse eines Schülers lassen sich durch Fehleranalysen<br />
ermitteln; dabei sind die den Fehlern zugrundeliegenden Fehlkonzepte teilweise<br />
unmittelbar aus der Lösung ersichtlich (z.B. 1 + 3 = 13), teils werden sie erst deutlich,<br />
wenn der Schüler den Lösungsweg laut vorspricht (Methode des lauten Denkens)<br />
� Vier häufig auftretende Fehlertypen bei den Grundrechenarten (nach Wong):<br />
1) Teillösungen (wenn Aufgaben nicht zu Ende gerechnet werden)<br />
2) Falsche Anordnungen (z.B. wenn beim schriftlichen<br />
Addieren/Subtrahieren die Zahlen „im Sinn“ nicht über den Strich,<br />
sondern unter den Strich geschrieben werden)<br />
3) Falsche Strategien<br />
- Bei Additionsaufgaben tritt z.B. häufig der der Minus 1-Fehler auf<br />
(z.B.: 9 + 4 = 12), der dadurch zustande kommt, dass beim Aufzählen<br />
der „Setter“ (in unserem Beispiel die 9) mitgezählt wird.<br />
4) Fehlkonzept der 0 (die häufig als 1 gezählt wird)<br />
� Diagnostische Verfahren:<br />
� Es gibt eine Vielzahl standardisierter Mathe- und Rechentests; sie sollten<br />
jedoch nur als Screenings eingesetzt werden.<br />
68
� Genauer sind die „strukturbezogenen Aufgaben zur Prüfung<br />
mathematischer Einsichten“ (von Kutzer und Probst), die, genau wie der IiR<br />
(s.o.) hierarchisch aufgebaut sind, so dass Pbn bestimmten Kompetenzstufen<br />
zugeordnet werden können.<br />
� Grundsätzlich empfiehlt sich (genau wie bei der Diagnostik von LRS auch)<br />
eine weitergehende Diagnostik (etwa zur optischen Differenzierung, zum<br />
Kurz- und Langzeitgedächtnis, zur Intelligenz, zur Schulangst etc. etc.)<br />
69
B 2: Diagnose von Lernbehinderungen und sonderpädagogischem<br />
Förderbedarf<br />
1. Definition und Prävalenz<br />
� Definition: Lernbehinderungen sind wissenschaftlich eher schlecht definiert. Es<br />
handelt sich bei ihnen um drastische, d.h. chronische und generelle (s.o.)<br />
Lernstörungen.<br />
� Der Begriff „Lernbehinderung“ ist eher ein rechtlich-verwaltungsbezogener<br />
Begriff. Nach der Verordnung des Landes NRW sind folgende Kriterien<br />
ausschlaggebend: deutliche Minderleistungen in verschiedenen<br />
Unterrichtsbereichen bei reduzierter Allgemeinintelligenz (IQ unter 80),<br />
sozialen Verhaltensstörungen oder umschriebenen Entwicklungsstörungen.<br />
� In den internationalen Klassifikationssystemen (DSM IV; ICD-10) taucht<br />
der Begriff „Lernbehinderung“ nicht auf; im ICD-10 („International<br />
Classification of mental Deseases“) finden sich folgende Bezeichnungen:<br />
a) „Kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten“: liegt vor, wenn die<br />
Lese-, Rechen- und Schreibleistungen deutlich unter dem liegen, was<br />
aufgrund von Alter, Intelligenz und Beschulung zu erwarten wäre.<br />
- Kriterien: Minderleistungen in standardisierten Schulleistungstests um<br />
mind. 2 Standardabweichungen, IQ von mind. 70; Ausschluss von<br />
(extremen) Unzulänglichkeiten in der Erziehung und Beschulung;<br />
Ausschluss von sensorischen und/oder neurologischen Erkrankungen;<br />
Behinderung der Schulausbildung und des Alltags durch die Störung<br />
b) „Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung schulischer<br />
Fertigkeiten“: Allgemeine Lernschwäche, die nicht auf<br />
Intelligenzminderung, Sehstörungen oder unangemessene Beschulung zu<br />
erklären ist.<br />
- Kriterien: schlechter als 97% der Schüler; IQ von mind. 70; etc. (s.o.)<br />
� Prävalenz (Auftretenshäufigkeit):<br />
� Lernbehinderung: 2,4 %<br />
� Kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten: 2, 3%<br />
� Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten: bis 3%<br />
� Auffälligkeiten und Risikogruppen:<br />
� Jungen sind häufiger betroffen als Mädchen (Verhältnis 2:1)<br />
� Kinder aus ungünstigen sozialen Verhältnissen und Kinder mit ausländischer<br />
Herkunft sind ebenfalls häufiger betroffen.<br />
� Lernschwache Kinder sind vermehrt von frühen und späteren psychosozialen<br />
Belastungen betroffen (Krankenhausaufenthalte des Kindes in den beiden<br />
ersten Lebensjahren, Delinquenz des Vaters, hohe Wohndichte, unerwünschte<br />
Schwangerschaft etc.)<br />
� Lernbehinderungen und –störungen treten in familiärer Häufung auf, was auf<br />
eine genetisch-erbliche Komponente hinweist.<br />
� Etwa 1/3 der lernbehinderten Kinder ist auch aufmerksamkeitsgestört bzw.<br />
hyperaktiv.<br />
� Lernbehinderte Schüler weisen in einzelnen Funktionsbereichen (etwa<br />
Gedächtnis oder sprachliche Kodierung) Ausführungsdefizite auf, die im Sinne<br />
des Teilleistungskonzepts interpretiert werden können.<br />
� Teilleistungskonzept: Bei Teilleistungsstörungen scheitert eine<br />
Gesamthandlung an einem einzelnen, für die übrigen Handlungsschritte<br />
jedoch notwendigen Ausführungsschritt.<br />
70
2. Ursachen und Symptome von Lernbehinderungen<br />
� Die Gruppe der Lernbehinderten ist äußerst heterogen; darüber hinaus sind<br />
Lernbehinderungen (wie alle komplexen Störungen) multifaktoriell bedingt.<br />
Lernbehinderungen auf eindeutige Ursachen zurückzuführen (ätiologisch-kausaler<br />
Ansatz) macht daher wenig Sinn; stattdessen sollte deskriptiv-bedingungsanalytisch<br />
vorgegangen werden.<br />
� Sprich: Statt nach den tieferen Ursachen zu forschen, sollten die konkreten<br />
Probleme untersucht werden, die Lernbehinderte beim Lernen haben, um<br />
ausgehend davon Ansätze zur effektiven Förderung zu entwickeln.<br />
� Lernen ist ein komplexer Vorgang, der eine Vielzahl von Aktivitäten und Fertigkeiten<br />
erfordert.<br />
� Das „Good-strategy-user“-Modell von PRESSLEY beschreibt Lernen als einen<br />
Prozess der „Selbstoptimierung“. Dem Modell nach entwickeln gute Lerner die<br />
zum Lernen notwendigen Fertigkeiten bzw. Strategien nämlich von selbst (d.h.<br />
ohne direkte Instruktion); die besagten Strategien lassen sich dabei auf 3 Ebenen<br />
anordnen:<br />
1) Planung (Strategien zur Handlungsorganisation):<br />
- metakognitive Fertigkeiten zur Strukturierung der Lernprozesses:<br />
Aufgabe verstehen (Einordnung neuer Infos) => das Lernproblem<br />
bestimmen => ein Lernziel formulieren (!) => den Lernvorgang grob<br />
planen (z.B. den Termin für die Klassenarbeit notieren; mögliche<br />
Schwierigkeiten antizipieren etc.)<br />
2) Handlungssteuerung (Strategien zur Handlungskontrolle):<br />
- Selbstbeobachtende und selbstkontrollierende Prozesse (metakognitiv):<br />
Unterdrückung konkurrierender Handlungsimpulse => Lernfortschritt<br />
überwachen und Lernweg bei mangelndem Erfolg ändern => das<br />
erreichte Ergebnis mit dem Lernziel vergleichen =><br />
Schlussfolgerungen für das weitere Lernen ziehen<br />
3) Ausführung (Strategien zur Informationsentnahme und –verarbeitung)<br />
- Prozedurale Fertigkeiten zur Ausführung der Operationen: Anwendung<br />
von Strategien (z.B. sich Notizen machen, wiederholen, neues Wissen<br />
mit Vorwissen verknüpfen etc.)<br />
� Bei lernbehinderten Kindern sind diese Fertigkeiten bzw. Strategien nur sehr<br />
bedingt vorhanden (Strategiedefizit). Sie sind daher weder dazu in der Lage<br />
effektiv zu lernen, noch können sie aus ihrem Scheitern lernen und verharren<br />
dementsprechend auf dem Niveau eines inkompetenten Lerners („inaktive“<br />
Lerner).<br />
� Zu dem Mangel an zielgerichteten Aktivitäten tritt meist ein Überschuss an<br />
ungeeigneten Aktivitäten: motorische Unruhe; Grübeln über vergangene<br />
und mögliche Misserfolge (self preoccupation); Meidung von<br />
Lernsituationen…<br />
� Übergeordnete Bedingungsmomente: Gründe, warum schlechte Lerner keine<br />
Strategien nutzen<br />
� Motivationale Defizite: Die Anstrengungsbereitschaft zur Entfaltung<br />
zielführender Lernaktivitäten (effort control) ist, wohl hauptsächlich aufgrund<br />
der bisherigen Misserfolgserfahrungen, sehr gering; stattdessen: Mutlosigkeit,<br />
Hilflosigkeit, Angst etc.<br />
� Mangelndes und schlecht strukturiertes Vorwissen: erschweren die Einordnung<br />
und Verarbeitung neuer Inhalte<br />
� Sozioökonomischer Kontext: Metakognitive Fertigkeiten werden stark durch die<br />
von den Eltern vorgelebten Analyse- und Bedeutungsraster beeinflusst; darüber<br />
71
hinaus erleichtert die Ähnlichkeit der beiden Lebenswelten Schule und<br />
Elternhaus schulisches Lernen<br />
� Defizite auf der Ausführungsebene: z.B. mangelnde Sprachkompetenz, geringe<br />
Gedächtniskapazität etc. (siehe: Teilleistungskonzept)<br />
3. Implikationen für Diagnostik und Förderung<br />
� Diagnostik:<br />
� Ziel: sollte weniger die Ermittlung der Ursachen, als vielmehr die Entwicklung<br />
konkreter Förderungsmöglichkeiten sein.<br />
� Methode: Beobachtung und hypothesengeleitete Analyse des Lernverhaltens;<br />
um die konkreten Gründe für das Scheitern eines Kindes herauszufinden<br />
� Leitfragen für die Analyse:<br />
a) Anforderungsstruktur der betreffenden Aufgabe<br />
b) Tatsächlich realisiertes Verhalten des Lernenden<br />
� Förderung:<br />
� Ziel: Förderungsmaßnahmen sollten einen direkten Bezug zum Lernverhalten<br />
haben (Vermittlung zielführender Lernaktivitäten).<br />
� Methoden:<br />
� Bei tiefgreifenden Lernbeeinträchtigungen: Vermittlung der defizitären<br />
Teilfertigkeiten<br />
� Bei falschen Lernstrategien: Einübung der richtigen Lernstrategien und<br />
Vermittlung metakognitiver Kompetenzen bei gleichzeitiger Förderung der<br />
Selbstwirksamkeitserwartungen (self efficacy) durch positives Feedback<br />
� Bei fehlenden inhaltlichen Lernvoraussetzungen: Vermittlung des fehlenden<br />
Wissens<br />
� Optimale Lernbedingungen: Mittelschwere Aufgaben; Verhinderung von<br />
falschen Antworten, sofortiges Feedback bei richtigen Aufgaben, zunehmende<br />
Steigerung der Aufgabenschwierigkeit<br />
4. Ergänzung: Neuere Lese- und Rechtschreibtests (von Schneider)<br />
� ELFE 1 – 6 (Schneider, 2000): Leseverständnistest für 1.-6.-Klässler<br />
� Als PC- und Paper/Pencil-Version erhältlich<br />
� Einsatzbereich: jew. Schuljahresmitte und -ende<br />
� Bearbeitungszeit: ca. 20-30 Minuten<br />
� Testet folgende Bereiche:<br />
a) Wortverständnis (Zuordnung Wort – Bild)<br />
b) Lesegeschwindigkeit<br />
c) Satzverständnis (Worte ergänzen)<br />
d) Textverständnis (Textaufgaben)<br />
� ELFE – Training: 14 Lernspiele auf Wort-, Satz- und Textebene, wobei jedes<br />
Spiel 3 Schwierigkeitsstufen umfasst<br />
� <strong>DER</strong>ET 3-4 (Schneider, 2007): Deutscher Rechtschreibtest für 3. und 4.-Klässler<br />
� Einsatzbereich: Ende des 3. und 4.-, Beginn des 4. und 5. Schuljahres<br />
� Bearbeitungszeit: 30-45 Minuten<br />
� DEMAT 1+ (Schneider, 2003): Deutscher Mathematiktest für erste Klassen<br />
� Gruppen- und Einzeltest<br />
� Einsatzbereich: Ende 1., Anfang 2. Klasse<br />
72
B 3: Schuleingangsdiagnostik<br />
1. Das Konstrukt „Schulreife“ im Spiegel der Forschungsgeschichte<br />
� Rechtliche Regelung:<br />
� Kinder werden schulpflichtig, wenn sie in der ersten Hälfte des laufenden<br />
Schuljahres 6 Jahre alt sind; Kinder die erst in der zweiten Hälfte des<br />
Schuljahres 6 Jahre alt werden, können auf Antrag der Eltern vorzeitig<br />
eingeschult werden.<br />
� Nicht schulreife schulpflichtige Kinder können vom Schulunterricht<br />
zurückgestellt werden.<br />
� Erwartungen von Grundschullehrern an Schulanfänger: soziale Kompetenz,<br />
Lernkompetenz (Konzentrationsfähigkeit etc.), motorische Kompetenz, kognitive<br />
Kompetenz (Differenzierungsfähigkeit etc.), Auftragssensibilität, Selbständigkeit<br />
� Es gab und gibt unterschiedliche Konzepte von „Schulreife“:<br />
� Kern (1951): „Schulreife“ ist das Ergebnis hauptsächlich biologischer<br />
Reifungsprozesse. Da diese Prozesse synchron ablaufen, reicht zur Testung der<br />
Reifelage die Erhebung eines einzelnen Kriteriums aus (Kern wählte hierzu die<br />
optische Gliederungsfähigkeit; vgl. den „Grund-Leistungs-Test“)! Zudem<br />
braucht Schulreife, da sie sich bei jedem, wenn auch zu unterschiedlichen<br />
Zeitpunkten, mehr oder minder von selbst einstellt, nicht eigens gefördert<br />
werden.<br />
� Hildegard Hetzer (1953) übte schon früh Kritik an diesem Konzept: Anstatt<br />
von einer harmonischen Entwicklung auszugehen, unterscheidet sie zwischen<br />
verschiedenen Reifemerkmalen: nämlich zw. „körperlichen“,<br />
„willensmäßigen“, „sozialen“ und „geistigen“. Dabei geht sie davon aus, dass<br />
sich diese Merkmale durchaus asynchron entwickeln können.<br />
� Das „Fähigkeitskonzept“ beruht auf der Annahme, dass die kindliche<br />
Entwicklung eben nicht biologisch determiniert-, sondern in hohem Maß von<br />
Umwelteinflüssen abhängig ist und dementsprechend aktiv gefördert werden<br />
muss; statt von „Schulreife“ wird deshalb häufig von „Schulfähigkeit“<br />
gesprochen.<br />
� Eine 3. Richtung betont die Vielseitigkeit des Konstrukts „Schulreife“, zu<br />
dem eben nicht nur kognitive Fähigkeiten, sondern auch soziale, motivationale<br />
und emotionale Faktoren zählen und plädiert daher für den Begriff<br />
„Schulbereitschaft“.<br />
� Der differenzierteste Ansatz ist das „ökopsychologische Schulreifemodell“ von<br />
Nickel. Es richtet sich gegen die Tendenz, Schulreife ausschließlich an<br />
Merkmalen der Kinder festmachen zu wollen, stattdessen müsse das Konstrukt<br />
„Schulreife“ aus system-ökologischer Perspektive betrachtet werden (s.u.)<br />
� Nickels „ökosystemisches Prozessmodell der Einschulung“: betrachtet die<br />
Einschulung im Sinne Bronfenbrenners als einen „ökologischen Übergang“, im Zuge<br />
dessen das Mesosystem eines Kindes um ein neues Mikrosystem (das der Schule)<br />
erweitert wird.<br />
� Ob dieser Übergang gelingt, hängt vom Zusammenspiel mehrerer Faktoren ab:<br />
1) Schüler<br />
- Somatische Voraussetzungen (Gesundheit, körperliche<br />
Entwicklung…)<br />
- Kognitive Voraussetzungen (Gedächtnis und Lernen, Denken…)<br />
- Motivationale und soziale Voraussetzungen (Arbeitsbereitschaft,<br />
emotionale Stabilität…)<br />
73
2) Mikro- bzw. Ökosystem Schule:<br />
- Schulsystem: Aufbau der Primarstufe, Lehrpläne, Versetzungsregelungen,...<br />
- Spezielle Unterrichtsbedingungen: Erzieherverhalten, Klassenklima,<br />
Klassengröße, räumliche Ausstattung,…<br />
3) Mikro- bzw. Ökosystem Kindergarten:<br />
- Art und Qualität der vorschulischen Erziehung: Erzieherverhalten,...<br />
(kurz: wie sehr unterscheidet sich das vorschulische- vom schulischen<br />
Umfeld?)<br />
4) Mikro- bzw. Ökosystem Familie:<br />
- Wohnverhältnisse, Geschwisterzahl, Zuwendung durch Eltern etc.<br />
� Eingerahmt werden diese für das Konstrukt „Schulreife“ allesamt gleichermaßen<br />
relevanten Systeme durch das sozio-kulturelle Makrosystem: die Gesellschaft<br />
(allgemeine Ziel- und Wertvorstellungen etc.)<br />
� Aus dem Modell ergibt sich, dass Schuleingangsdiagnostik keine punktuelle<br />
Maßnahme sein sollte, sondern ein begleitender Prozess; Interventionen können<br />
dabei nicht nur auf Individual-, sondern auch auf institutioneller- und familiärer<br />
Ebene notwendig sein.<br />
� Die vielleicht wichtigste Forderung: Enge Verzahnung und Abstimmung<br />
von Kindergarten und Grundschule!<br />
2. Schulreifetests:<br />
� Die meisten Schulreifetests wurden in den 60er / 70er Jahren entwickelt; sie messen<br />
hauptsächlich kognitive Fähigkeiten und korrelieren dementsprechend hoch mit IQ-<br />
Tests (ca.: r = .60)<br />
� Heute werden Schulreifetests nur noch sehr selten eingesetzt (s.u.)<br />
� Etwas neuere Verfahren (s.u.) sind…:<br />
a) Das Mannheimer Schuleingangsdiagnostikum, kurz: MSD (1976)<br />
b) Das Kieler Einschulungsverfahren, kurz: KEV (1986)<br />
c) Der Visuomotorische Schulreifetest, kurz: VSRT (1990)<br />
� Der Aufbau der verschiedenen Schulreifetests ist meist recht ähnlich; ihre<br />
Interkorrelationen sind dementsprechend hoch (ca. r = .60).<br />
� Typische Aufgabentypen von Schulreifetests sind…:<br />
- Das Nachmalen von Formen (Figuren, Ziffern, Buchstaben etc.); „Mann-<br />
Zeichnungen“ (z. T. mit Baum, Haus etc.); das wiederholte Zeichnen<br />
abstrakter Figuren (Muster, Randverzierung etc.); Größen- und<br />
Mengenvergleiche; Visuelles Behalten (Bilder von Gegenständen);<br />
Markieren von Bildern nach zusammenhängender Geschichte etc. etc.<br />
� Zu den 3 neueren Schulreifetests:<br />
1. Das Mannheimer Schuleignungsdiagnostikum (1967): ist entgegen der<br />
Behauptung der Autoren recht konventionell!<br />
2. Das Kieler Einschulungsverfahren (1986):<br />
� Versucht möglichst alle (also nicht nur kognitive) Aspekte des Konstrukts<br />
„Schulreife“ zu erfassen: Arbeits- und Sozialverhalten,<br />
Leistungsmotivation, sprachliche, motorische und kognitive Kompetenzen<br />
etc.<br />
� Besteht aus 3 Testteilen:<br />
1. Elterngespräch (anhand eines Leitfadens)<br />
2. Unterrichtsspiel (in einer Kleingruppe von max. 6 Kindern)<br />
3. Einzeluntersuchung (wird nur in besonderen Einzelfällen durchgeführt)<br />
74
� Vorteil: engere Übereinstimmung mit dem Konstrukt „Schulleistung“;<br />
Nachteil: nicht standardisiert<br />
3. Der Visuomotorische Schulreifetest (1990): zur Kurzdiagnose von Schulärzten<br />
verwendet; enthält den „Mann-Zeichen-Test“ und das „Reihenfortsetzen“ in<br />
standardisierter Form<br />
� Beurteilung der Schulreifetests:<br />
� Die gängigen Gütekriterien, sprich: Reliabilität, Objektivität und Validität, sind<br />
bei den meisten Schulreifetests gegeben.<br />
� Problematisch ist jedoch die meist über 30 Jahre zurückliegende (und damit<br />
veraltete) Normierung der Tests<br />
� Hinzu kommt, dass der kritische Wert (der meist als Prozentrang angegeben<br />
wird) von den Autoren mehr oder minder willkürlich festgelegt ist; die<br />
Diagnose ist dementsprechend stark testabhängig!<br />
� Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem Gesamttrefferanteil, der für die<br />
Effizienz diagnostischer Verfahren ja mindestens genauso wichtig ist wie die<br />
Validität. Die Effizienzschätzung der Tests zeigt nämlich, dass mit Tests nicht<br />
weniger Fehldiagnosen zu erwarten sind als ohne Tests; verringert wird durch<br />
sie lediglich die Quote ungerechtfertigter Aufnahmen.<br />
3. Diagnostische Praxis<br />
� Die Frage der Einschulung wird heute i.d.R. mit Hilfe informeller Verfahren<br />
entschieden; Schulreifetests werden praktisch nur noch im Falle eines Antrags auf<br />
vorzeitige Einschulung oder bei einer geplanten Zurückstellung eingesetzt.<br />
� Worauf bei der Diagnose zu achten ist:<br />
� Wichtig ist, dass nicht nur die kognitiven-, sondern auch die sozialen,<br />
emotionalen- und motivationalen Komponenten von Schulreife geprüft<br />
werden. Häufig stehen diese nämlich in Diskrepanz zu den kognitiven<br />
Leistungen!<br />
� Die gängigen Schulreifetests können insofern nur ein Baustein der Diagnose<br />
sein (als Screeningverfahren); sie sind durch weitere Maßnahmen<br />
(Elterngespräch, Gespräch mit den Kindergärtnern, evtl. Unterrichtsspiel<br />
etc. zu ergänzen.)<br />
� Darüber hinaus sollte die Diagnose mit Interventionsmaßnahmen verknüpft<br />
werden (z.B. zur Förderung der sozialen Kompetenz); damit solche<br />
Interventionen noch greifen können, sollte mit der Diagnostik bereits früh<br />
begonnen werden (also nicht erst kurz vor Schulbeginn)<br />
� Da die Frage, ob ein Kind bereit für die Schule ist, nicht nur von ihm selbst<br />
abhängt, sondern auch von der Schule, dem Kindergarten und der Familie,<br />
sollten diese in die Diagnostik mit einbezogen werden (etwa, indem mit der<br />
zukünftigen Lehrerin gesprochen wird)<br />
� „Schulunreife“ Kinder dürfen nicht einfach zurückgestellt werden, sondern<br />
bedürfen besonderer Förderung (z.B. in Vorschuleinrichtungen)<br />
75
B 4: Prognose des Schulerfolgs:<br />
1. Allgemeines:<br />
� Leistungs- bzw. Schuleignungsprognosen sind für eine Reihe schulischer<br />
Entscheidungen relevant (z.B. Zuweisung zu bestimmten Leistungskursen, Übergang<br />
auf weiterführende Schulen, Schullaufbahnentscheidungen, Klassenwiederholungen<br />
etc.)<br />
� Folgende Arten von Entscheidungen lassen sich unterscheiden: Selektions-<br />
Klassifikations- und Beratungsentscheidungen; relevant für die Erstellung<br />
von Leistungsprognosen sind v. a. die beiden zuletzt Genannten.<br />
1) „Klassifikation“: Zuordnung von Personen zu bestimmten<br />
Leistungsbedingungen (z.B. einer Schulart) aufgrund mehrerer Prädiktoren<br />
- Erfolgt die Zuteilung univariat (wird also nur ein Prädiktor wie z.B. die<br />
Intelligenz herangezogen) spricht man von „Platzierungsentscheidungen“<br />
2) Beratung: Der Beratung geht es ebenfalls um die richtige Zuordnung zu<br />
bestimmten Leistungsbedingungen; allerdings wird die endgültige<br />
Entscheidung hier dem zu Beratenden (z.B. Schüler) selbst überlassen.<br />
- Bildungsberatung sollte sich dabei nicht nur auf die individuelle<br />
Beratung Einzelner (Individualberatung) beschränken, sondern auch<br />
versuchen, auf die schulischen Rahmenbedingungen Einfluss zu<br />
nehmen (Systemberatung: Schule, Lehrer)<br />
� Ferner kann zwischen terminalen (an der Stelle eines Übergangs<br />
stattfindenden) und investigatorischen (ein Treatment bzw. eine Intervention<br />
vorbereitenden) Entscheidungen unterschieden werden.<br />
� Terminale Entscheidungen = Laufbahnentscheidungen<br />
� Investigatorische Entscheidungen = didaktische- bzw. therapeutische<br />
Interventionsentscheidungen<br />
� Bei diagnostischen Entscheidungen im Bildungsbereich bietet sich eine<br />
sequentielle Entscheidungsstrategie an: Dabei werden bei Uneindeutigkeit<br />
nach und nach weitere Kriterien und Tests hinzugezogen, bis ein vertretbares<br />
Urteil gefällt werden kann.<br />
� Lehrerurteil => Evtl. Hinzuziehen von Experten (Schulpsychologen) etc.<br />
� Zur multikausalen Bedingungsstruktur von Schulleistung: Schulleistung hängt<br />
von einer Vielzahl von Determinanten ab (s.o.), diese haben sowohl eine Erklärungs-<br />
als auch eine Prognosefunktion, wobei jedoch immer bedacht werden muss, dass ihr<br />
Zusammenhang mit Schulleistung lediglich korrelativ und nicht kausal ist!<br />
� Prädiktoren: kognitive Schülermerkmale<br />
a) Kognitive Fähigkeiten (Intelligenz, Metakognition, Kreativität…)<br />
b) Vorwissen (als Indikator wird meist die bisherige Schulleistung verwendet)<br />
� Moderatoren: Nichtkognitive Schülermerkmale, die den Zusammenhang<br />
zwischen kognitiven Faktoren und Schulleistung moderieren.<br />
� Leistungsmotivation, Attributionsstil, Fähigkeitsselbstkonzept, Werthaltungen<br />
etc.<br />
� Umweltfaktoren: wirken sich lediglich vermittelt über die kognitiven und<br />
nichtkognitiven Schülermerkmale auf die Leistung aus (= distale Variablen).<br />
a) Schulische Sozialisationsfaktoren (Struktur- und Prozessmerkmale)<br />
b) Familiäre Sozialisationsfaktoren (Struktur und Prozessmerkmale)<br />
c) Sonstige Sozialisationsfaktoren (Peers etc.)<br />
76
� Die verschiedenen Bedingungsfaktoren von Schulleistung sind recht klar, wie stark ihr<br />
jeweiliger Einfluss ist, kann jedoch nach wie vor nicht mit Sicherheit gesagt werden.<br />
Schließlich hängt die Wirkung der einzelnen Determinanten immer vom gesamten<br />
Interaktionsgefüge ab.<br />
� Intelligenz: Der Zusammenhang zw. Intelligenz und Schulleistung liegt im<br />
Schnitt etwa bei r =.5 (eher höher), was einer Varianzaufklärung von 25%<br />
entspricht. Damit ist Intelligenz, zumindest im Vergleich zu den anderen<br />
Einflussgrößen, der beste bekannte Prädiktor für Schulleistung.<br />
� Bei jüngeren Schülern (GS) fällt der Zusammenhang stärker aus als bei<br />
älteren Schülern (HS, RS, GYM), da das Vorwissen und nicht-kognitive<br />
Faktoren in höheren Klassen stärker ins Gewicht fallen.<br />
� Bei Mädchen ist der Zusammenhang durchgängig (d.h. auf allen Alters-<br />
und Bildungsstufen) höher als bei Jungen.<br />
� Mit Schulleistungstests korrelieren Intelligenztests höher als mit anderen<br />
Indikatoren (z.B. Noten oder Lehrerratings)<br />
� Der Zusammenhang zw. Intelligenz und Schulleistung wird durch andere<br />
Faktoren moderiert (s.o.).<br />
- Bei geringer Leistungsmotivation fällt er z.B. geringer aus.<br />
- Auch durch bestimmte Unterrichtsstile (z.B. einen stark<br />
individualisierenden Unterricht) wird der Zusammenhang verringert.<br />
� Vorwissen: Die Grundschulnoten klären zumindest in den ersten vier Jahren<br />
der Sekundarstufe den größten Anteil der Schulleistungsvarianz auf!<br />
� Leistungsmotivation: leistet einen signifikanten, aber relativ geringen Beitrag<br />
zur Aufklärung der Schulleistungsvarianz, was aber nicht zuletzt an der<br />
Schwierigkeit liegen mag, die Leistungsmotivation zu messen (meist wird sie<br />
nur als überdauernde Persönlichkeitseigenschaft und nicht im Hinblick auf ihre<br />
situationsspezifische Aktualisierung gemessen)<br />
� Familiäre Faktoren: Früher wurde v. a. der Einfluss globaler<br />
Schichtmerkmalen untersucht; da die Effekte umso größer sind, je spezifischer<br />
die erfassten Variablen sind, wird davon jedoch zunehmend abgerückt.<br />
� Trudewinds „Taxonomie des nicht-schulischen Lebensraumes“ geht davon<br />
aus, dass die (Grund-)Schulleistung v.a. von folgenden 5 Dimensionen des<br />
familiären Umfelds beeinflusst wird.<br />
- Anregung<br />
- Leistungsdruck<br />
- Bildungsaspiration<br />
- Sanktionsverhalten<br />
- Selbständigkeitserziehung<br />
2. Methodisches<br />
� Definition und Operationalisierung des Kriteriums: a) muss genau definiert<br />
werden, was unter „Schulleistung“ verstanden wird (siehe B 5), und b) muss überlegt<br />
werden, wie das Konstrukt am besten zu operationalisieren ist (Schulleistungstest,<br />
Noten, etc.?).<br />
� Auswahl der Prädiktoren: hängt von der Kriteriumsdefinition ab (z.B. Leistung im<br />
Fach „Deutsch“) und sollte auf einem expliziten theoretischen Konzept beruhen (also<br />
nicht einfach aufgrund leichter Verfügbarkeit oder Augescheinvalidität erfolgen).<br />
� Erfassung der Prädiktoren: sollte möglichst objektiv, reliabel und valide sein; da<br />
aber nicht für alle möglichen Prädiktoren standardisierte Tests zur Verfügung stehen,<br />
kann die Güte der erhobenen Daten durchaus variieren (das muss dann halt bei der<br />
Interpretation berücksichtigt werden).<br />
77
� Erstellung der Prognose: Im Hinblick auf den Umgang mit den Daten lassen sich 2<br />
Strategien unterscheiden, die im Idealfall miteinander verknüpft werden.<br />
� Statistische Vorhersage: Prognose erfolgt auf Basis eines expliziten<br />
Prognosemodells und mittels statistischer Verfahren (s.u.); führt zwar zu<br />
besseren Ergebnissen, ist in der Praxis aber eher selten<br />
� Klinische Vorhersage: Prognose erfolgt auf Basis des individuellen<br />
Urteilsvermögens des Beraters und ohne Anwendung statistischer Verfahren<br />
� Grundsätzlich gilt, dass keine Prognose 100%ige Sicherheit gibt. Schließlich sind<br />
weder alle relevanten Bedingungen bekannt, noch können diese, geschweige denn ihre<br />
Wechselwirkungen, auf empirischer Ebene hinlänglich erfasst werden.<br />
3. Statistische Prognosemodelle<br />
� Grenzwertmethode: Zuordnung einer Person zu einer Gruppe anhand bestimmter<br />
Grenzwerte (z.B. IQ-Mittelwert von Gymnasiasten).<br />
� Aus mehreren Gründen problematisch:<br />
a) Zwischen verschiedenen Schülergruppen bestehen starke Überlappungen<br />
(etwa hinsichtlich des IQs), weshalb die Grenzwertmethode zwangsläufig<br />
zu unbefriedigenden Gruppentrennungen führt.<br />
- Eine genauere Gruppentrennung erreicht man nur mit Hilfe einer<br />
„multiplen Diskrimanzanalyse“: Dabei werden relevante Merkmale so<br />
gewichtet, dass die Varianz innerhalb der Gruppe minimiert, die<br />
Varianz zwischen den Gruppen dagegen maximiert wird.<br />
b) Darüber hinaus ist es kaum plausibel, warum z.B. ein Grundschulabgänger<br />
beim Übertritt aufs Gymnasium kognitive Voraussetzungen mitbringen<br />
soll, über die (so zumindest bei der Mittelwertsentscheidung) eigentlich nur<br />
50% der Gymnasiasten verfügen.<br />
� Modell der Regressionsanalyse: ist das im wissenschaftlichen Kontext am häufigsten<br />
eingesetzte Modell; zur Berechnung einer multiplen Regression werden mehrere<br />
Prädiktoren zur Vorhersage herangezogen und jeweils spezifisch gewichtet;<br />
Spezialfälle der multiplen Regressionsanalyse sind z.B. die Kovarianz- und die<br />
Pfadanalyse (Ermittlung von Strukturmodellen).<br />
� Nachteil: Das Modell geht davon aus, dass die jeweiligen Prädiktoren bei<br />
jedem Individuum (bzw. jeder Merkmalskombination) dieselbe Wirkung<br />
haben. Eventuelle Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen<br />
Prädiktoren bleiben demnach unberücksichtigt.<br />
� Der Moderator-Ansatz: geht davon aus, dass die Wirkung einzelner Prädiktoren vom<br />
Interaktionsgefüge aller Prädiktoren abhängt. Die verschiedenen Prädiktoren haben<br />
demnach für verschiedene Personengruppen einen unterschiedlichen Vorhersagewert.<br />
� Problem: Der Ansatz ist praktisch kaum umsetzbar, da das Interaktionsgefüge<br />
zu komplex ist und kaum gesichertes Wissen über die spezifische Wirkung der<br />
einzelnen Moderatoren zur Verfügung steht.<br />
� Methode der „Automatischen Klassifikation“ (Heller): dabei wird das<br />
Merkmalsprofil eines Schülers mit den für die verschiedenen Schultypen<br />
charakteristischen Anforderungsprofilen verglichen und dem Profil, dem es am<br />
ähnlichsten ist („HS-Typ“, „RS-Typ“, „Gym-Typ“), zugeordnet.<br />
� Genauer: Anhand repräsentativer Eichstichproben werden für verschiedene<br />
Fähigkeitstests schulartspezifische Klassennormen ermittelt, mit denen dann<br />
die Testwerte der zur Debatte stehenden Schüler verglichen werden können<br />
(für den kognitiven Fähigkeitstest KFT 4-13+ z.B. gibt es solche Normen<br />
ohnehin, für andere Tests wurden sie von Heller extra ermittelt)<br />
78
� Nachteile:<br />
� Die Annahme, dass den institutionellen Schultypen jeweils spezifische<br />
Schülertypen entsprechen, ist problematisch; schließlich sammeln sich in<br />
bestimmten Schultypen ganz unterschiedliche Schülertypen, was v.a. daran<br />
liegt, dass Schulerfolg auf unterschiedlichen Merkmalskonfigurationen<br />
beruhen kann.<br />
� Auch charakteristische Schulprofile lassen sich heute kaum noch erstellen<br />
(Differenzierung, Autonomie der einzelnen Schulen etc.)<br />
� Rosemanns Methode der typologischen Prädiktion: unterscheidet anhand<br />
typischer Merkmalskonfigurationen, wobei nicht nur kognitive, sondern auch<br />
nichtkognitive- und Umweltmerkmale einbezogen werden, zwischen verschiedenen<br />
Schülergruppen, denen empirisch jeweils bestimmte Leistungsniveaus entsprechen.<br />
� Das dem Modell zugrundeliegende Prinzip entspricht dem der Automatischen<br />
Klassifikation; genau wie dort, geht es um die typologische Zuordnung zu<br />
einem bestimmten Merkmalsprofil. Die Zuordnung erfolgt jedoch wesentlich<br />
differenzierter. 1) werden nicht nur kognitive, sondern auch nicht-kognitive-<br />
und Umweltfaktoren einbezogen, 2) wird von wesentlich mehr Untergruppen<br />
ausgegangen.<br />
79
B 5: Leistungsbeurteilung / Schulleistungstests<br />
1. Allgemeines zur schulischen Leistungsbeurteilung<br />
� Leistungsbeurteilungen haben folgende Funktionen:<br />
� Gesellschaftliche Funktion (Rückmeldung an die Gesellschaft)<br />
� Didaktische Funktion (Rückmeldung an den Lehrer)<br />
� Persönliche Funktion (Rückmeldung an den Schüler)<br />
� Jede Leistungsbeurteilung erfolgt im Hinblick auf eine Norm; 4 Arten von<br />
Bezugsnormen lassen sich dabei unterscheiden:<br />
1) Soziale Bezugsnorm: Die Einzelleistung wird an der durchschnittlichen<br />
Leistung der Gruppe gemessen; die Beurteilung informiert also darüber,<br />
welche relative Position die beurteilte Person in dieser Gruppe einnimmt.<br />
2) Individuelle Bezugsnorm: Die Einzelleistung wird an dem sonstigen<br />
Leistungsniveau der betreffenden Person gemessen, so dass die Beurteilung<br />
darüber informiert, inwiefern der Lerner seine Möglichkeiten ausgeschöpft-<br />
bzw. sich vielleicht sogar gesteigert hat.<br />
3) Sachliche (bzw. kriteriale) Bezugsnorm: Die Einzelleistung wird an<br />
sachlichen Vorgaben gemessen, also danach beurteilt, inwieweit bestimmte<br />
Lernziele (bzw. Punkte) erreicht wurden.<br />
4) Fähigkeitsorientierte Bezugsnorm: Die Einzelleistung wird danach<br />
bemessen, inwiefern bestimmte, an Eichstichproben gewonnene,<br />
Kompetenzstufen erreicht wurden. Demnach informiert die Beurteilung über<br />
die Fähigkeit einer Person in Relation zu eben diesen Kompetenzstufen.<br />
� Relevant im Hinblick auf die Einführung sog. „Bildungsstandards“<br />
� Klassifikation von Bewertungsmethoden:<br />
� Intuitive Methoden: Beurteiler entscheidet nach individuellen Regeln, wie<br />
eine Leistung zu beurteilen ist; die Objektivität, Reliabilität und Validität<br />
solcher Verfahren ist mehr als fraglich; noch problematischer ist die fehlende<br />
Transparenz und Kontrolle; intuitive Methoden sind dementsprechend<br />
abzulehnen.<br />
� Rationale Methoden: Auf der Basis von sachlogischen und fachlichen<br />
Überlegungen werden kriteriale Bewertungsmaßstäbe entwickelt und<br />
hinreichend operationalisiert.<br />
� Rational-empirische Methoden: basieren auf empirisch gewonnenen<br />
Bezugsnormen; lassen dem Lehrer aber keinen pädagogischen<br />
Gestaltungsspielraum!<br />
� Verschiedene Methoden zur Erfassung von Leistung:<br />
� Beobachtung (Selbst- und Fremdbeobachtung): siehe B 6<br />
- Vorteile: flexibel, adaptiv, ökonomisch<br />
- Nachteile: Wahrnehmungs- und Registrierfehler; Nichteindeutigkeit<br />
in der Identifikation der Merkmale;<br />
Objektivität, Reliabilität und Validität sind nicht<br />
garantiert<br />
� Mündliche Prüfungen<br />
- zu Vor- und Nachteilen: s.o.<br />
� Schriftliche Prüfungen<br />
� Arbeitsprobe<br />
� Lerntagebuch<br />
� Aufsatz<br />
� Informeller Test<br />
� Formeller Test (s. u.)<br />
80
� Portfoliomethode (s. u.)<br />
� Zum Portfolioverfahren: Ein Portfolio ist eine Sammlung von (Schüler-)Arbeiten,<br />
welche die Anstrengung des Lernenden, den Lernfortschritt und die Leistungsresultate<br />
auf einem oder mehreren Gebieten zeigt; bei der Zusammenstellung des Portfolios<br />
wird der Schüler beteiligt.<br />
� Zu verbalen Zeugnissen: zeigen vergleichbare Fehlertendenzen wie Ziffernnoten,<br />
stellen vielfach eine Überforderung für Lehrer, Schüler und Eltern dar!<br />
2. Allgemeines zu Schulleistungstests<br />
� Schulleistungstests lassen sich anhand zweier Dimensionen klassifizieren: Nach der<br />
Art der Bezugsnorm (sozial vs. sachlich) und nach dem Grad der<br />
Standardisierung (formell vs. informell)<br />
� w<br />
Soziale f Norm<br />
(vergleichsbezogen)<br />
Sachnorm<br />
(lehrzielbezogen)<br />
Formell Informell<br />
Normorientierte<br />
Informelle, normorientierte<br />
Schulleistungstests Tests ( auch Klassenarbeiten)<br />
Lehrzielorientierte Informelle, lehrzielorientierte<br />
Schulleistungstests Tests<br />
� Für alle Tests gilt: Die Validität muss immer aufgrund einer Lehrzielanalyse<br />
bestimmt werden.<br />
� Lehrzielorientierte Tests könnten bei anderer Standardisierung auch als<br />
normorientierte Tests verwendet werden.<br />
� Normorientierte Tests enthalten zumeist Aufgaben auf mittlerem<br />
Lehrzielniveau (da solche Aufgaben die höchste Trennschärfe haben)<br />
� Informelle Tests unterscheiden sich von formellen nur durch den Grad der<br />
Normierung (Bezug auf eine Klasse anstatt auf eine repräsentative<br />
Eichstichprobe)<br />
3. (Sozial-)Normorientierte Schulleistungstests<br />
� Definition: Wissenschaftliches Routineverfahren zur Feststellung des<br />
Kenntnisstandes in einem (oder mehreren) inhaltlich spezifizierten kognitiven<br />
Lehrzielbereich(en); dabei werden Aussagen über die Leistungshöhe aufgrund des<br />
Vergleiches mit den Leistungen einer für die jeweilige Alterstufe, Schulstufe oder<br />
Schulart repräsentativen Stichprobe getroffen.<br />
� Analyseschritte bei der Konstruktion normorientierter Schulleistungstests:<br />
1) Analyse der Lehrpläne (zwecks inhaltlicher bzw. curricularer Validität)<br />
� Die für die Zielgruppe relevanten Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien<br />
sind auf die in ihnen enthaltenen Lehrziele hin zu analysieren (geschieht<br />
meist unter Mitarbeit von Fachdidaktikern)<br />
� Die Lehrziele sind dabei in eine „Lehrzielmatrix“ einzutragen, bei der<br />
zwischen „Inhaltsaspekt“ (Zeilen) und „Verhaltensaspekt“ (Spalten)<br />
unterschieden wird.<br />
- Der Verhaltensaspekt lässt sich mit Blooms Lernzieltaxonomie in 6<br />
Bereiche untergliedern: 1) Wissen � 2) Verstehen � 3) Anwenden<br />
� 4) Analyse � 5) Synthese � 6) Bewertung/Evaluation (s.o.)<br />
- Für die Inhalte müssen je nach Lehrzielbereich eigene (möglichst<br />
konkrete) Kategorien entwickelt werden.<br />
� In die Zellen der Matrix wird die Zahl der geplanten Items eingetragen<br />
(Spaltensumme = Gewicht des jew. Verhaltensbereiches; Zeilensumme =<br />
Gewicht des betreffenden Inhaltsbereiches)<br />
81
� Die Lehrzielmatrix hat v. a. heuristische Funktion; sie soll dabei helfen,<br />
geeignete Aufgabenklassen zu finden und für eine ausgewogene<br />
Zusammenstellung sorgen (schließlich wird oft nur „Wissen“ abgefragt)<br />
2) Entwurf von Testitems bzw. Aufgaben<br />
� Inhaltlich sollten die Items für die einzelnen Zellen der Lehrzielmatrix<br />
repräsentativ sein.<br />
� Was die formale Gestaltung der Items betrifft, gibt es folgende<br />
Möglichkeiten:<br />
a) Gebundene Aufgabenbeantwortung<br />
- Auswahlantworten (Richtig/Falsch- und Mehrfachwahlaufgaben)<br />
- Ordnungsantwortaufgaben (Zuordnung- und Umordnungsaufgaben)<br />
b) Freie Aufgabenbeantwortung<br />
- Ergänzungsaufgaben (Lücken)<br />
- Kurzantwortaufgaben<br />
- Kurzaufsatzaufgaben<br />
3) Vorerprobung an wenigen Fällen (um die Verständlichkeit der<br />
Aufgabenformulierungen zu überprüfen, evtl. Revision der Items)<br />
4) Testdurchführung an einer kleinen Stichprobe (200-400 Schüler)<br />
5) Aufgaben- und Testanalyse anhand der so gewonnen Daten<br />
� Berechnung der Aufgabenschwierigkeit: der Schwierigkeitsindex einer<br />
Aufgabe (Pi) entspricht dabei dem prozentualen Anteil der richtigen<br />
Lösungen zu dieser Aufgabe; heißt: je höher die statistische Schwierigkeit,<br />
desto einfacher die Aufgabe!<br />
- Die Schwierigkeitsindices sollten zwischen .20 und .80 streuen (damit<br />
der Test maximal diskriminiert)<br />
- Zum Einstieg sollten leichtere Items gewählt werden<br />
(Eisbrecherfunktion); danach ansteigender Schwierigkeitsgrad (zwecks<br />
Erhaltung der Testmotivation)<br />
- Je nachdem, ob der Test eher im oberen oder unteren Leistungsbereich<br />
differenzieren soll, werden mehr schwierige oder mehr leichte<br />
Aufgaben beibehalten.<br />
� Distraktorenanalyse: Wie oft werden welche Distraktoren gewählt?<br />
- 10% = geeigneter Distraktor; 15% = guter Distraktor<br />
- Wird eine falsche Antwort zu häufig gewählt, kann das ein Hinweis auf<br />
fehlleitende Instruktion sein (oder eben auf typische Denkfehler)<br />
- Ein Distraktor, der nie gewählt wird, ist ungeeignet.<br />
� Trennschärfeberechnung: Die Trennschärfe einer Aufgabe gibt an, wie<br />
gut sie zwischen guten und schlechten Pbn differenziert; der<br />
Trennschärfekoeffizient entspricht der Korrelation zwischen dem<br />
Aufgabenwert und dem Gesamttestwert (rit liegt zw. -1,0 und +1,0).<br />
- Ein hoher Trennschärfekoeffizient besagt, dass die Pbn, die die<br />
betreffende Aufgabe richtig gelöst haben, auch im Gesamttest gut<br />
waren; hohe Trennschärfen sind v. a. bei Aufgaben mittlerer<br />
Schwierigkeit zu erwarten.<br />
- Ein Trennschärfekoeffizient von 0 besagt, dass gute und schlechte Pbn<br />
die Aufgabe in etwa gleich häufig gelöst bzw. nicht gelöst haben (=><br />
Item ist unbrauchbar)<br />
- Ein negativer Trennschärfekoeffizient besagt, dass das Item eher von<br />
schlechten Pbn gelöst wurde (Item muss entfernt oder umformuliert<br />
werden)<br />
� Reliabilitäts-(Homogenitäts-)Schätzung<br />
82
� Berechnung der Verteilungskennwerte des Tests: Mittelwert, Streuung,<br />
Schiefe und Exzess der Rohwertverteilung<br />
6) Testeichung an einer für den Anwendungsbereich repräsentativen<br />
Stichprobe: Berechnung von Normwerten (evtl. auch von Schulartnormen)<br />
� Standardnormen:<br />
- nur bei Normalverteilung möglich; Transformation der Rohwerte in z-<br />
Werte (damit sich ein Mittelwert von 0 und eine Streuung von 1<br />
ergibt): Die Differenz aus Rohwert und arithmetischem Mittelwert -<br />
geteilt durch die Streuung der Rohwertverteilung<br />
� Standardnorm-Äquivalente:<br />
- Entstehen durch die Transformation der z-Werte (z.B. indem man zu<br />
jedem z-Wert 100 addiert, um negative Werte zu vermeiden)<br />
� Prozentrangnormen:<br />
- Für wissenschaftliche Zwecke zu ungenau<br />
7) Testvalidierung<br />
� Empirische Validität wird meist an kleinen Stichproben geprüft!<br />
� Inhaltliche Validität sozialnormierter Schulleistungstest: Da Schulleistungstests<br />
anders als Intelligenztests Leistungen erfassen wollen, die aufgrund eines schulischen<br />
Lehrangebots initiiert wurden, muss dieses Angebot sowohl bei der Konstruktion, als<br />
auch bei der Auswertung hinreichend berücksichtigt werden. Neben der Abgleichung<br />
mit den Lehrplänen (curriculare Validität) muss dabei auch überprüft werden,<br />
inwiefern die Lehrplanvorgaben im Unterricht tatsächlich umgesetzt wurden<br />
(Lerngelegenheit).<br />
� Letzteres kann auf 3 Arten geschehen:<br />
1. Überprüfung von Unterrichtsmaterialien (Klassenbucheintragungen,<br />
Lehrbücher, Klassenarbeiten etc.)<br />
2. Erhebung von Lehrerurteilen über die curriculare Validität eines Tests<br />
(z.B. Wie viel Zeit wurde auf die in den Testitems repräsentierten Inhalte<br />
verwendet etc.)<br />
3. Erhebung von Schülerurteilen über die curriculare Validität eines Tests<br />
� Einsatzmöglichkeiten sozialnormierter Schulleistungstests:<br />
� Anwendung in der Schulklasse:<br />
� Vergleich des Leistungsstandes einer bestimmten Klasse mit der<br />
Eichstichprobe<br />
- Durchschnittliche Leistungsfähigkeit der Klasse<br />
- Überprüfung der Effektivität des eigenen Unterrichts<br />
- Lehrplangemäßheit des Unterrichts<br />
� Überprüfung des eigenen Benotungssystems durch den Vergleich mit den<br />
Testwerten<br />
- systematische Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Schüler?<br />
- Bestimmung der Position spezifischer Gruppen (z.B.<br />
Gastarbeiterkinder)<br />
� Objektivierungsmöglichkeit bei Schulart- oder Kurswechsel<br />
� Einsatz zur Lehr- und Lernsteuerung<br />
- Diagnose der Eingangsvoraussetzungen bei neuen Lehrsequenzen<br />
- Übernahme einer neuen Klasse: Wissenstandsüberprüfung<br />
� Einsatz zur Unterrichtsdifferenzierung<br />
- Binnendifferenzierung: Wo haben einzelne Schüler besondere<br />
Schwächen (besonders wichtig beim Prinzip des „Mastery Learning“)<br />
83
� Äußere Differenzierung<br />
- Einteilung nach Leistungsgruppen (A-, B-, C-Kurse); v. a. in<br />
Gesamtschulen relevant<br />
� Summative Evaluation<br />
- Schulleistungstests (bei gegebener inhaltlicher Validität) als Ersatz für<br />
Klassenarbeiten<br />
� Forschungsfragen<br />
� Überprüfung der Effektivität verschiedener Unterrichtsmethoden<br />
� Überprüfung der Wirksamkeit verschiedener Schulsysteme<br />
� Überprüfung der Wirksamkeit verschiedener Schülergruppierungen<br />
(heterogen vs. homogen)<br />
� Formative Evaluation und Entwicklung von Lehrplänen oder Curricula<br />
� Erarbeitung und Überprüfung von Bedingungsmodellen für Schulleistung<br />
� Kritik: Standardisierte Schulleistungstests werden im Unterricht nach wie vor äußerst<br />
selten eingesetzt. Gründe dafür könnten sein:<br />
� Negative motivationale Folgen: sozialnormierte Tests, die noch dazu<br />
„wissenschaftlich“ abgesichert sind, können v. a. auf schlechtere Schüler<br />
demotivierend wirken<br />
� Sozialnormierte Tests machen die Leistungsunterschiede zw. den Schülern für<br />
den Lehrer überdeutlich und legen damit einen ungünstigen Attributionsstil<br />
nahe!<br />
� Erstarrung des Unterrichts und Verarmung der Lehrpläne, da Lehrer nur<br />
noch testrelevantes und testbares Wissen vermitteln!<br />
4. Kriteriumsorientierte Leistungsmessung (v.a. von Klauer propagiert)<br />
� Vertreter der kriteriumsorientierten Leistungsmessung (z.B. Klauer) wenden sich<br />
dezidiert gegen sozialnormierte Verfahren: Der klassischen Testtheorie geht es darum,<br />
Unterschiede zwischen Personen zu erfassen; pädagogischen Tests müsse es dagegen<br />
um die Frage gehen, ob bestimmte Lernziele erreicht wurden oder nicht.<br />
� Zur Kritik im Einzelnen: s. o.<br />
� Definition: Kriteriumsorientierte Tests orientieren sich dementsprechend nicht an<br />
Gruppennormen, sondern an inhaltlichen Lehr- und Lernzielen. Zu diesem Zweck<br />
wird ein Mindesttestwert (eine Idealnorm) festgeschrieben, mit dessen Hilfe<br />
entschieden wird, ob der zu testende Inhalt bzw. die geforderte Verhaltensweise<br />
hinreichend beherrscht wird oder nicht.<br />
� Voraussetzungen kriteriumsorientierter Tests:<br />
� Genaue Definition und Quantifizierung der Lernzielbereichs<br />
� Quantitative Erfassung der Schülerleistungen<br />
� Messmodell für die zufallskritische Entscheidung darüber, ob Lehrziel<br />
erreicht wurde oder nicht<br />
� Während die Einzelleistung in sozialnormierten Tests nur im Hinblick auf die<br />
Leistung anderer interpretiert werden kann (relativ), ist bei<br />
kriteriumsorientierten Tests auch die Einzelleistung interpretierbar (absolut).<br />
� Für die Entscheidung, ob ein Lehrziel erreicht wurde oder nicht, schlägt Klauer die<br />
Verwendung des Binomialmodells vor. Danach kann die Lehrzielerreichung als eine<br />
bestimmte Lösungswahrscheinlichkeit für eine bestimmte Menge von Items<br />
angesehen werden.<br />
� Die erforderliche Lösungswahrscheinlichkeit p wird auf 1 (bzw. P = 100%)<br />
festgelegt, wobei jedoch eine gewisse Fehlertoleranz (τ = 0.1 oder 0.05)<br />
eingeräumt wird.<br />
84
� Voraussetzungen des Binomialmodells:<br />
� Die Annahme, dass alle Items zur gleichen Lehrstoffklasse gehören<br />
� Die Annahme dass alle Aufgaben voneinander unabhängig zu lösen sind<br />
� Die Annahme, dass die Aufgaben gleiche Schwierigkeiten aufweisen<br />
� Reliabilität und Objektivität kriteriumsorientierter Tests können aufgrund ihrer<br />
geringen Varianz nicht mit den gängigen Methoden geprüft werden; eine Möglichkeit<br />
ist jedoch die Berechnung des Ü-Koeffizienten.<br />
85
B 6: Verhaltensbeobachtung im Unterricht<br />
1. Typische Probleme bei der Beobachtung<br />
� Aufmerksamkeits- und Ermüdungsprobleme (insbes. bei Überlastung)<br />
� Fehlerhafte Aufzeichnung<br />
� Reaktanzeffekte<br />
� Kognitive Verzerrungen (Übergeneraliserung, zu frühe Wertung, Akzentuierung,<br />
Selektion etc.)<br />
� Identifizierung mit den beobachteten Personen (insbes. bei der teilnehmenden<br />
Beobachtung)<br />
� Nicht repräsentative Auswahl der Beobachtungsperioden<br />
� Etc. etc.<br />
2. Arten von Beobachtung<br />
� Naive Beobachtung vs. systematische („wissenschaftliche“) Beobachtung:<br />
� Wissenschaftliche Beobachtungen sind a) zielorientiert (heißt: es wird vorher<br />
genau festgelegt, was beobachtet wird und warum es beobachtet wird) und b)<br />
methodisch kontrolliert (Ausschaltung von Störvariablen; Verwendung eines<br />
standardisierten Registrierschemas; Speicherung der Ergebnisse; etc. etc.)<br />
� „Breitband-Fidelitäts-Dilemma“: Je genauer ein Verfahren in der Lage ist,<br />
ein Personenmerkmal zu erfassen, desto schmaler ist sein Aussage- bzw.<br />
Validitätsbereich!<br />
� Naive Beobachtungen sind all das nicht und dementsprechend anfällig für eine<br />
Vielzahl von Störeinflüssen (subjektive Wertungen, Übergeneralisierungen,<br />
Ungenauigkeit, willkürliche Auswahl etc.)<br />
� Fremd- vs. Selbstbeobachtung:<br />
� Selbstbeobachtung (Introspektion):<br />
� Nachteile:<br />
- Reaktivität (Veränderung des Beobachtungsgegenstandes durch die<br />
Beobachtung)<br />
- Kognitive Überforderung (sofern Verhalten und Beobachtung simultan<br />
ablaufen);<br />
- Ergebnisse sind nicht nachprüfbar;<br />
- Es gibt psychische Phänomene, die der Introspektion unzugänglich<br />
bleiben müssen, weil sie nicht bewusst sind<br />
� Vorteil: Bei therapeutischen oder verhaltensmodifikatorischen<br />
Interventionen kann die Methode der Selbstbeobachtung sehr sinnvoll sein;<br />
sie sollte dabei jedoch mit Fremdbeobachtung kombiniert werden (Vgl.<br />
kooperative Verhaltensmodifikation).<br />
� Fremdbeobachtung: von den Behavioristen stark gemacht; im<br />
wissenschaftlichen Kontext die grundlegende Methode der Datengewinnung (zu<br />
den verschiedenen Formen der Fremdbeobachtung: s.u.)<br />
� Teilnehmende- vs. nicht-teilnehmende Beobachtung:<br />
� Teilnehmende Beobachtung: Beobachter ist selbst Teil der zu beobachtenden<br />
Gruppe (klassisch: die diversen Wallraff-Reportagen); Intention ist es<br />
Reaktanzeffekte zu vermeiden; Probleme: Gefährdung der Objektivität,<br />
kognitive Überforderung aus Seiten des Beobachters; Gedächtnisverzerrungen,<br />
sofern Ergebnisse erst im Nachhinein protokolliert werden können<br />
� Nicht-teilnehmende Beobachtung: es findet keine Interaktion zw. Beobachter<br />
und den beobachteten Pbn statt.<br />
86
� Wissentliche / offene Beobachtung vs. unwissentliche / verdeckte Beobachtung:<br />
� Unwissentliche Beobachtung: Beobachtete wissen nicht, dass sie beobachtet<br />
werden (zum Beispiel durch Einwegscheibe oder mit versteckter Kamera);<br />
Vorteil: Ausschluss von Reaktanzeffekten; Nachteil: ethisch problematisch;<br />
nachträgliche Einverständniserklärung unbedingt erforderlich<br />
� Einseitig verdeckte Beobachtung: Pbn weiß nicht, was beobachtet wird<br />
(z.B. durch eine Coverstory)<br />
� Beidseitig verdeckte Beobachtung: Weder Beobachteter, noch Beobachter<br />
wissen, worum es eigentlich geht (Coverstory + „blinder VL“)<br />
� Technisch vermittelte- vs. technisch unvermittelte Beobachtung:<br />
� Vermittelte Beobachtung: Zu beobachtendes Verhalten wird gespeichert (z.B.<br />
mittels Audio- oder Videoaufnahme) und ist dadurch beliebig abrufbar und<br />
wieder verwendbar.<br />
� Vorteile: Verminderung von Wahrnehmungs- und Registrierfehlern,<br />
Möglichkeit, simultan ablaufendes Verhalten zu beobachten und zu kodieren,<br />
Einsatz verschiedener Beobachter<br />
� Nachteile: Subjektive Bildauswahl durch Kameramann, oft schlechte<br />
Qualität etc.<br />
� Kontinuierliche- vs. diskontinuierliche Beobachtung:<br />
� Kontinuierliche Beobachtungen: Dauerbeobachtungen; aus ökonomischen<br />
Gründen meist nicht möglich<br />
� Diskontinuierliche Beobachtungen: Zeitstichprobenpläne, bei denen z.B. jeder<br />
Schüler 3 Minuten beobachtet wird; Probleme: Zeitliche Struktur eines<br />
Verhaltens (etwa die Entwicklung über eine Schulstunde hinweg) kann nicht<br />
erfasst werden; seltene Verhaltensweisen bleiben oft unbeobachtet<br />
� Life- (bzw. Feld-) vs. Laborbeobachtung:<br />
� Laborbeobachtungen:<br />
� Vorteile: leichte Manipulierbarkeit der UV, Kontrolle von Störbvariablen,<br />
Schaffung optimaler Beobachtungsbedingungen<br />
� Nachteile: Reaktanzeffekte; Problem der externen (bzw. ökologischen)<br />
Validität!<br />
� Fazit: Die systematische, nicht-teilnehmende und verdeckte Beobachtung ist,<br />
zumindest was die diagnostischen Gütekriterien betrifft, wohl die beste Methode!<br />
3. Mögliche Beobachtungssysteme<br />
� Beobachtungssysteme dienen dazu, den Beobachtungsvorgang zu strukturieren; sie<br />
legen fest, was beobachtet werden soll und wie die Ergebnisse zu protokollieren sind.<br />
� Grundsätzlich lassen sich 2 Arten von Beobachtungssystemen unterscheiden:<br />
1) Isomorphe Deskription: Möglichst vollständige und unveränderte Wiedergabe<br />
des beobachteten Geschehens<br />
� Faktisch nicht durchführbar, da keine Beobachtung ohne Kategorisierung<br />
auskommt und Verhalten immer unterschiedlich kategorisiert werden kann.<br />
2) Reduktive Deskription: nur ausgewählte Verhaltensweisen werden registriert.<br />
� Dabei lassen sich, je nachdem wie die beobachteten Verhaltensweisen<br />
kodiert werden, 3 Typen von Beobachtungssystemen unterscheiden:<br />
a) Zeichensysteme: Eine oder mehrere ausgewählte Verhaltensweisen<br />
werden nach der Häufigkeit ihres Auftretens festgehalten (je nachdem, ob<br />
dabei eine Zeit- oder Ereignisstichprobe zugrunde gelegt wird, spricht<br />
man von Time- oder Event-Sampling)<br />
b) Kategoriensysteme: Jede auftretende Verhaltensweise wird einer<br />
Kategorie zuzuordnen versucht; die zur Auswahl stehenden Kategorien<br />
87
werden dabei vorher genau festgelegt (so ist z.B. die Interaktions-<br />
Prozess-Analyse von Bales angelegt: s.u.)<br />
c) Schätzskalen: Die zu beobachtenden Verhaltensweisen sind nicht nur als<br />
solche zu registrieren, sondern sind darüber hinaus hinsichtlich ihrer<br />
Intensität zu beurteilen. Stellt hohe Anforderungen an den Beobachter<br />
und sollte daher mit technischer Unterstützung erfolgen.<br />
� Entwicklungsschritte bei der Ausarbeitung eines Beobachtungssystems:<br />
1) Abgrenzung des Beobachtungsziels und des interessierenden<br />
Verhaltensbereiches<br />
2) Entwurf eines vorläufigen Kategoriensystems, das durch Experten, Kollegen<br />
etc. auf seine inhaltliche Validität überprüft wird<br />
3) Formulierung der Beobachtungsitems: positiv und im Präsens; die zu<br />
beobachtenden Verhaltensweisen sollten leicht identifizierbar sein; die Anzahl<br />
der Kategorien darf die kognitive Kapazität der Beobachter nicht übersteigen etc.<br />
� Kategorien für die Unterrichtsbeobachtung könnten z.B. sein:<br />
- Sprechzeiten von Lehrer und Schülern (Dauer)<br />
- Wartezeiten auf Schüler-Antworten (Dauer)<br />
- Interaktionsrichtungen: Lehrer => Schüler, Schüler => Lehrer; Schüler<br />
=> Schüler (Häufigkeit)<br />
- Arbeitsformen: Lehrervortrag, Stillarbeit etc. (Dauer)<br />
- Einsatz von Verstärkern: positive-, negative Verstärkung, Bestrafung<br />
Typ I und II, Ignorierung (Häufigkeit), …<br />
4) Planung des Ablaufs der Beobachtung: Zeit- oder Ereignisstichproben, wie<br />
viele Beobachter, Verwendung technischer Hilfsmittel etc.<br />
5) Beobachtertraining: mit Hilfe von Videoaufzeichnungen, anhand derer die<br />
Kategorien verdeutlicht werden (=> enorme Erhöhung der Objektivität)<br />
6) Pretest zur Prüfung der intersubjektiven Übereinstimmung: evtl. Änderung<br />
der Beobachtungskategorien<br />
7) Durchführung der Beobachtung<br />
� Einige Ergebnisse zu Art und Häufigkeit von Lehrer- und von Schüleräußerungen im<br />
Unterricht (v. a. von Tausch):<br />
� Zur Häufigkeit von Lehreräußerungen:<br />
� Hohe Lehrerdominanz im Unterricht (Lehrer reden 40- bis 50 mal mehr als<br />
ein einzelner Schüler)<br />
� Sprachverhalten einzelner Lehrer ist konsistent und unabhängig vom<br />
Unterrichtsgegenstand (scheint also persönlichkeitsabhängig zu sein)<br />
� Logisch: Je höher der Redeanteil des Lehrers, desto geringer der Redeanteil<br />
der Schüler (r = -.75); auch die Qualität der Schülerbeiträge wird<br />
beeinträchtigt, sofern Schüler häufiger einsilbig oder in unvollständigen<br />
Sätzen antworten.<br />
� Bezeichnend: Die von ihnen in Anspruch genommene Redezeit wird von<br />
Lehrern massiv unterschätzt.<br />
� Zur Art von Lehreräußerungen:<br />
� Die Häufigkeit von Befehlen und Aufforderungen ist stark vom Lehrer<br />
abhängig; sie schwankt zwischen 5 und 108 Befehlen pro Stunde und hat<br />
weder etwas mit dem Alter oder Geschlecht des Lehrers, noch mit dem<br />
Unterrichtsfach zu tun, ist also vermutlich persönlichkeitsspezifisch!<br />
� Die Häufigkeit von Fragen ist ebenfalls vom Lehrer abhängig und nicht auf<br />
das Unterrichtsfach, das Alter oder die Anzahl der Schüler zurückzuführen.<br />
88
4. Die Interaktions-Prozess-Analyse (IPA) nach Bales<br />
� Die IPA ist ein vielseitig einsetzbares System zur Beobachtung und Kodierung von<br />
Interaktionsprozessen in Kleingruppen (Familien, Paare, Kurse etc.); Ziel ist es<br />
dabei, sowohl das emotionale und soziale Verhalten der Gruppe, als auch das der<br />
Einzelnen zu erfassen. Zu diesem Zweck werden nicht nur sprachliche Äußerungen,<br />
sondern auch non-verbale Verhaltensweisen bestimmten Kategorien zugeordnet.<br />
� Die konkreten Inhalte der Interaktionen werden dabei ausgeblendet.<br />
� Theoretischer Hintergrund des Modells:<br />
� Grundannahme: Das Modell geht davon aus, dass jedes soziale System zwei<br />
antagonistische Anpassungsleistungen vollbringen muss:<br />
1) Anpassung an die äußere Situation: und zwar im Sinne einer<br />
Aufgabenbewältigung; diese Funktionalisierung hat z. B. Aufgabenteilung,<br />
Autorität und Statusunterschiede zur Folge.<br />
2) Integration bzw. Reintegration nach innen: Da die zur Aufgabenbewältigung<br />
erforderlichen Prozesse (s.o.) den inneren Zusammenhalt des<br />
Systems gefährden, müssen immer wieder Integrationsleistungen<br />
vollbracht werden, die auf Solidarität und Gleichheit der<br />
Gruppenmitglieder ausgerichtet sind.<br />
� Da ein vollkommen ausgeglichenes Verhältnis zwischen diesen beiden<br />
Prozessen nicht möglich ist, bleibt ein soziales System permanent in Bewegung;<br />
jede „Gleichgewichtsstörung“ gibt dabei Anlass zu Interaktion.<br />
� Aufbau und Vorgehen der IPA:<br />
� Aufbau: Das Modell unterscheidet zwischen 2 Bereichen: dem<br />
sozialemotionalen- und dem Aufgabenbereich. Mit Blick auf den<br />
sozialemotionalen Bereich wird zwischen positiven- und negativen Reaktionen,<br />
mit Blick auf den Aufgabenbereich zw. Antwortversuchen und Fragen<br />
differenziert. Daraus ergeben sich für die Beobachtung 4 übergeordnete<br />
Kategorien; ihnen entsprechen jeweils 3 konkrete Verhaltenskategorien (s.u.),<br />
so dass für die Kodierung insgesamt 12 Kategorien zur Verfügung stehen.<br />
Immer zwei dieser Kategorien lassen sich einem bestimmten Problem zuordnen,<br />
das in Gruppen zu bewältigen ist. Die 6 Probleme, um die es sich dabei handelt,<br />
sind: a) Orientierung, b) Bewertung, c) Kontrolle, d) Entscheidung,<br />
e) Spannungsbewältigung, f) Integration.<br />
� Vorgehen: Der Beobachter muss fortwährend jeden sprachlichen und nichtsprachlichen<br />
Akt in eine der 12 Kategorien einordnen (Kategoriensystem mit<br />
Event-Sampling) und darüber hinaus die Interaktionsrichtung (d.h. Sender und<br />
Empfänger) vermerken.<br />
� Beinahe unnötig zu sagen, dass das Verfahren eine intensive<br />
Beobachterschulung voraussetzt!<br />
89
Bereiche Kategorien Probleme<br />
Sozialemotionaler Bereich<br />
Positive Reaktionen<br />
Aufgabenbereich<br />
Versuche der Beantwortung<br />
Aufgabenbereich<br />
Fragen<br />
Sozialemotionaler Bereich<br />
Negative Reaktionen<br />
1. Zeigt Solidarität,<br />
bestärkt die anderen,<br />
hilft, belohnt<br />
2. Entspannt Atmosphäre,<br />
scherzt, lacht, zeigt<br />
Befriedigung<br />
3. Stimmt zu, nimmt passiv<br />
hin, versteht, stimmt<br />
überein, gibt nach<br />
4. Macht Vorschläge, gibt<br />
Anleitung bei Wahrung<br />
der Autonomie des<br />
anderen<br />
5. Äußert Meinung,<br />
bewertet, analysiert,<br />
drückt Gefühle oder<br />
Wünsche aus<br />
6. Orientiert, informiert,<br />
wiederholt, klärt,<br />
bestätigt<br />
7. Erfragt Orientierung,<br />
Infos, Wiederholung,<br />
Bestätigung<br />
8. Fragt nach Meinungen,<br />
Stellungnahmen,<br />
Bewertung etc.<br />
9. Erbittet Vorschläge,<br />
Anleitung etc.<br />
10. Stimmt nicht zu, zeigt<br />
passive Ablehnung etc.<br />
11. Zeigt Spannung, bittet<br />
um Hilfe, zieht sich<br />
zurück<br />
12. Zeigt Antagonismus,<br />
setzt andere zurück,<br />
verteidigt oder<br />
behauptet sich<br />
Integration<br />
Spannungsbewältigung<br />
Entscheidung<br />
Kontrolle<br />
Bewertung<br />
Orientierung<br />
Orientierung<br />
Bewertung<br />
Kontrolle<br />
Entscheidung<br />
Spannungsbewältigung<br />
Integration<br />
� Auswertung:<br />
1) Profilanalyse für jeden Teilnehmer (Interaktionsprofile pro Person): Verteilung<br />
der Äußerungen einer Person über die 12 Kategorien hinweg<br />
2) Sequenzanalyse: Untersuchung, welche Kategorie auf welche folgt<br />
3) Wer-mit-Wem-Matrix (bzw. Interaktionsmatrix): Wer interagiert wie<br />
(Kategorie) mit wem und wie oft (Häufigkeit)<br />
4) Phasenuntersuchung: Festlegung von Zeitabschnitten, um Änderungen im<br />
Gruppengeschehen festzuhalten.<br />
� Ergebnisse (typische Interaktionsprozesse in Gruppen):<br />
� Prozessphasen: Orientierungsprobleme sind kennzeichnend für die<br />
Anfangsphase, Bewertungsprobleme sind in der mittleren Phase dominant,<br />
Kontrollversuche nehmen, genau wie die relative Häufigkeit sozialemotionaler<br />
Reaktionen, kontinuierlich zu.<br />
� Verteilung auf Gruppenmitglieder (Rollendifferenzierungen):<br />
� Personen werden umso häufiger angesprochen, je mehr Äußerungen sie<br />
selbst initiieren.<br />
90
� Rangniedrigere Gruppenmitglieder richten mehr Äußerungen an<br />
ranghöhere als sie von diesen erhalten.<br />
� Sozial hoch stehende Gruppenmitglieder richten ihre Äußerungen eher an<br />
die ganze Gruppe als an einzelne Personen, bei rangniedrigen ist es<br />
umgekehrt.<br />
� Die Tendenz zur Zentralisierung der Kommunikation nimmt mit der<br />
Gruppengröße zu.<br />
� Auffällig: Das aktivste Mitglied ist meistens nicht das Beliebteste =><br />
spricht für 2 unabhängige Führungspersönlichkeiten: einen<br />
„Aufgabenspezialisten“ und einen „sozio-emotionalen Führer“<br />
� Handlungsmuster: Im sozio-emotionalen Bereich überwiegen meist posititive<br />
Reaktionen, im Aufgabenbereich fallen die meisten Handlungen unter die<br />
Oberkategorie „versuchte Antworten“<br />
� Wo es umgekehrt ist, droht Gruppenzerfall!<br />
� Untersuchungsergebnisse zu Unterrichtsprozessen:<br />
� Das Lehrerverhalten gegenüber einzelnen Schülern hängt stark von deren<br />
soziometrischem Status ab; welcher Art der Zusammenhang ist, ist<br />
persönlichkeitsspezifisch: Manche wenden sich vermehrt schönen und<br />
beliebten Schülern zu, andere v. a. leistungsstarken Schülern.<br />
5. Varianten der Interaktions-Prozess-Analyse<br />
A) Unterrichtsbeobachtung mit der IPA nach Trolldenier (1985)<br />
� Da die IPA primär für kleinere Diskussionsgruppen konzipiert ist, wurde sie von<br />
Trolldenier zwecks besserer Handhabbarkeit und um sie genauer an die Erfordernisse<br />
von Schulklassen anzupassen, leicht modifiziert.<br />
� Die Interaktionsrichtung wird dabei auf folgende 9 Möglichkeiten reduziert:<br />
� L-S: Lehrer mit einzelnem Schüler<br />
� L-O: Lehrer mit mehreren Schülern<br />
� S-L: Einzelner Schüler mit Lehrer<br />
� O-L: Mehrere Schüler mit Lehrer<br />
� S-O: Schüler mit mehreren anderen Schülern<br />
� S-S: Ein Schüler mit einem anderen Schüler<br />
� O-O: Alle Schüler miteinander<br />
� O-S: Mehrere Schüler mit einem<br />
� X: Interaktion mit einem Dazugekommenen<br />
� Die einzelnen Bereiche und Kategorien der IPA bleiben inhaltlich weitgehend<br />
unverändert; letztere werden jedoch teilweise im Hinblick auf die<br />
Unterrichtssituation spezifiziert.<br />
� Wenn der Lehrer einen Schülerbeitrag wiederholt, wird er nur dann zur 3.<br />
Kategorie („stimmt zu“) gezählt, wenn im Tonfall Bekräftigung und<br />
Zustimmung anklingt, ansonsten wird die Wiederholung zu Kat. 6 (gibt<br />
Infos) gezählt<br />
� Zur Kategorie 12 („zeigt Antagonismus“) wird anders als bei Bales nicht<br />
jede Form von Lenkung gezählt, die dem anderen keine Entscheidung lässt<br />
(da eine solche Lenkung bei Lehrern dazugehört), sondern nur solches<br />
Verhalten, das von den Betroffenen als unfreundlich und aggressiv<br />
aufgefasst werden muss (Unterbrechungen etc.)<br />
91
� Sollte das vorgeschlagene Verfahren immer noch zu aufwendig sein, kann die IPA<br />
nach Trolldenier noch weiter vergröbert werden:<br />
� Die Interaktionsrichtung kann nur nach dem Initiator kodiert (bzw. signiert)<br />
werden<br />
� Lr: Lehrerinitiierte Interaktionen<br />
� Sr: Schülerinitiierte Interaktionen<br />
� Die 12 Kategorien können auf die 4 Basiskategorien reduziert werden:<br />
1. Sozialemotionaler Bereich: positive Aktionen<br />
2. Aufgabenbereiche: Versuche der Beantwortung<br />
3. Aufgabenbereich: Fragen<br />
4. Sozialemotinaler Bereich: Negative Aktionen<br />
� Kritik: Verfahren ist zwar weniger zeit- und trainingsaufwendig als das Original,<br />
aber immer noch äußerst aufwendig und wesentlich unspezifischer. Trotzdem ein<br />
guter Vorschlag! Wurde sowohl in Life-Situationen als auch mit Videoaufzeichnungen<br />
erprobt.<br />
B) Interaction-Process-Scores (IPS) nach Borgotta (1962)<br />
� Borgotta kritisiert an der IPA, dass darin nicht zwischen passiv-beiläufigen- und<br />
aktiv-gestaltenden Handlungen unterschieden wird, sondern diese oft in einer<br />
Kategorie zusammengefasst werden; die IPS-Kategorien differenzieren hier genauer.<br />
� So werden z.B. aus der 2. Kategorie bei Bales („Stimmt zu, nimmt passiv hin,<br />
gibt nach“) bei Borgotta zwei Kategorien: einmal „Versteht, zeigt passive<br />
Billigung“ (passiv) und einmal „Willigt ein, unterstützt, stimmt zu“ (aktiv)!<br />
� Ähnliches gilt für andere Kategorien, so das Borgotta, auch wenn er die 7. und<br />
9. Kategorie der IPA ganz weglässt, insgesamt auf mehr, nämlich auf 18<br />
Kategorien kommt.<br />
C) Kommunikationsmusteranalyse nach Lewis et al. (1961)<br />
� Fortlaufende Registrierung des Verhaltens anhand von 14 Kategorien (wobei alle 10<br />
Sekunden eine Signierung vorzunehmen ist).<br />
� Bedingt durch das Time-Sampling kann auch die Kategorie „keine<br />
Kommunikation“ belegt werden; sie liegt vor, wenn innerhalb eines 10-<br />
Sekunden-Intervalls keine erkennbare Reaktion gezeigt wird.<br />
92
6. Flanders Interaction Categories (FIAC)<br />
� FIAC wurde ursprünglich von der IPA abgeleitet, ist mittlerweile aber das<br />
bekannteste Kategoriensystem zur Beobachtung von Gruppenprozessen; konzipiert<br />
wurde es eigens für den schulischen Raum.<br />
� Aufbau und Vorgehen:<br />
� Mit dem Modell wird vorwiegend das Verbalverhalten kodiert; dabei wird<br />
zwischen initiierenden und responsiven Äußerungen unterschieden.<br />
� Von den insgesamt 10 Kategorien beziehen sich 7 auf das Verhalten des<br />
Lehrers und 2 auf das Verhalten der Schüler. Die 10. Kategorie ist eine<br />
Restkategorie.<br />
� Lehreräußerungen: 1. Akzeptiert Gefühle (responsiv)<br />
2. Lobt und ermutigt (responsiv)<br />
3. Akzeptiert oder verwendet Gedanken von<br />
Schülern (responsiv)<br />
4. Stellt Fragen<br />
5. Lehrervortrag (initiativ)<br />
6. Gibt Anweisungen (initiativ)<br />
7. Kritisiert Schülerverhalten oder rechtfertigt die<br />
eigene Autoritiät (initiativ)<br />
� Schüleräußerungen: 8. Antworten<br />
9. Initiativen<br />
� Unklar: 10. Schweigen oder Durcheinander<br />
� Vorgehen: Alle 3 Sekunden soll eine Verhaltensweise kodiert werden (Time-<br />
Sampling); zusätzlich sollen sog. „Episoden“ festgehalten werden (z.B. der<br />
Wechsel von einer Unterrichtsform zu einer anderen).<br />
� Auswertung: Kodierungen werden in eine Matrix (10×10) eingetragen, wobei die<br />
Zeile jeweils das erste Glied- und die Spalte das zweite Glied eines zeitlich<br />
aufeinanderfolgenden Paares wiedergibt. Auf diese Weise kann abgelesen werden,<br />
welche Kategorie auf welche folgte.<br />
� Mögliche Fragen: Ist der Lehrer zu dominant? Wie reagiert er auf Einfälle<br />
seiner Schüler? Etc. etc.<br />
� Kritik:<br />
� Ungleichgewicht zwischen Lehrer- und Schülerkategorien<br />
� Ober (1968) modifiziert die 10 Kategorien so, dass sie sowohl auf Schüler-,<br />
als auch auf Lehrerverhalten bezogen werden können (reziprokes<br />
Kategoriensystem), so dass es insgesamt 20 Kodierungsmöglichkeiten gibt.<br />
� Individuenspezifische Auswertung nicht möglich<br />
� Der Kategoriendefinition und -auswahl liegen keine expliziten theoretischen<br />
Annahmen zugrunde<br />
7. Ergänzung: Das Münchener Aufmerksamkeitsinventar (MAI)<br />
� Ziel: Systematische Beobachtung der Aufmerksamkeit der Schüler; Methode: Time-<br />
Sampling, multiples Kategoriensystem<br />
93
B 7: Diagnostik bei Verhaltensstörungen<br />
1. Verhaltensstörungen allgemein<br />
� Der Begriff „Verhaltensstörung“ (auch „Verhaltensauffälligkeit“, „Schwererziehbarkeit“<br />
etc.) bezieht sich auf den sozial-emotionalen Bereich und umfasst eine<br />
Vielzahl möglicher Symptome (Zurückgezogenheit, Aggressivität, Hyperaktivität<br />
etc.).<br />
� Der Begriff ist jedoch nicht einheitlich definiert; die gefundenen Prävalenzen<br />
schwanken dementsprechend, je nach zugrunde gelegtem Konzept, zw. 15 und<br />
35%!<br />
� „Verhaltensstörungen“ lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien<br />
klassifizieren (Ätiologie, Indikation etc.); rein phänomenologisch lässt sich<br />
zwischen Störungen unterscheiden, die sich nach außen richten (Aggressivität,<br />
Unaufmerksamkeit etc.) und solchen, die sich nach innen richten<br />
(Ängstlichkeit, Zurückgezogenheit etc.)<br />
� Versuch einer Definition: Eine Verhaltensstörung liegt dann vor, wenn soziale<br />
und/oder emotionale Verhaltensweisen eines Schülers so stark von idealen, sozialen<br />
und funktionalen Bezugsnormen abweichen, dass sie zur Beeinträchtigung des<br />
Schülers selbst und/oder seiner sozialen Umwelt führen.<br />
� Ideale Bezugsnormen: sind implizit oder explizit formulierte Regeln, die in<br />
einer Gesellschaft bzw. Gruppe Gültigkeit beanspruchen.<br />
� Die soziale Bezugsnorm: entspricht dem durchschnittlichen Verhalten in einer<br />
Kultur („statistische Norm“)<br />
� Funktionale Bezugsnormen: bewerten ein Verhalten dahingehend, ob bzw.<br />
inwieweit es zur Erreichung eines Verhaltenszieles funktional (förderlich) oder<br />
dysfunktional (hinderlich) ist.<br />
� Unkonzentriertes Verhalten z.B. ist dysfunktional in Bezug auf<br />
befriedigende Lernleistungen.<br />
� Die Definition impliziert, dass die Frage, was noch als „normal“ gelten kann und was<br />
als „verhaltensgestört“ eingestuft wird, nicht zuletzt von (sub-)kulturellen Einflüssen<br />
abhängt.<br />
� In asiatischen Kulturen wird aggressives Schülerverhalten z.B. eher toleriert<br />
als hierzulande.<br />
� Darüber hinaus hängt die Frage, ob ein bestimmtes Verhalten als „gestört“<br />
eingestuft wird oder nicht, sowohl vom Geschlecht desjenigen ab, der das<br />
Verhalten zeigt, als auch vom Geschlecht des Beurteilers.<br />
� Bei Jungen wird aggressives Verhalten eher toleriert als bei Mädchen…<br />
� Konsequenz: Da die Einstufung als „verhaltensgestört“ somit stark von der Person des<br />
Beurteilers abhängt, ist bei der Diagnostik eine hohe Transparenz erforderlich, heißt:<br />
die zugrunde gelegten Wertmaßstäbe müssen offen gelegt werden!<br />
2. Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen (siehe auch: C 3)<br />
� Schulischer Misserfolg wird im Schulalltag oft auf mangelnde Aufmerksamkeit und<br />
Konzentrationsschwierigkeiten zurückgeführt.<br />
� Experten gehen jedoch davon aus, dass die Prävalenzrate deutlich niedriger<br />
ist, als Lehrer und Eltern (10-45 %) vermuten.<br />
� DSM-IV: Prävalenzrate von 3-7% (Faustregel: etwa ein Kind pro Klasse)<br />
� Jungen sind deutlich häufiger betroffen als Mädchen (zw. 2:1 und 9:1)<br />
94
� Dass Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen häufig vorschnell<br />
diagnostiziert werden, hat verschiedene Gründe:<br />
a) Entlastungsfunktion: Die Diagnose entlastet sowohl Lehrer (da diese auf<br />
die Konzentrationsfähigkeit keinen Einfluss haben) als auch Eltern (besser<br />
zerstreut als dumm).<br />
b) Laiendiagnosen vermischen unterschiedliche Konzepte, so dass auch<br />
solche Verhaltensweisen auf Aufmerksamkeitsstörungen zurückgeführt<br />
werden, die z.B. mit mangelnder Leistungsmotivation, fehlendem Interesse<br />
oder ungünstigem Attributionsstil besser zu erklären wären.<br />
� Schulische Aufmerksamkeit bzw. Konzentration lässt sich definieren als „eine direkte<br />
Zuwendung auf unterrichtsbezogene Tätigkeiten sowie als Kontrolle kognitiver<br />
Prozesse“ (Borchert)<br />
� Konzentration ist in hohem Maße situations- und aufgabenspezifisch, heißt:<br />
sie kann bei ein und derselben Person in unterschiedlichen Kontexten (z.B.<br />
Schule vs. Freizeit) recht unterschiedlich ausgeprägt sein.<br />
„Konzentrationsfähigkeit“ als Persönlichkeitskonstrukt anzusehen, wäre vor<br />
diesem Hintergrund verfehlt. Sinnvoller ist es, sich die konkreten<br />
Konzentrationsleistungen einer Person anzusehen.<br />
� V. a. in Amerika werden Aufmerksamkeitsdefizite und Hyperaktivität häufig als<br />
Syndrom (Einheit, eigentlich: „Zusammenlauf“) gesehen. So auch im DSM-IV, das<br />
Aufmerksamkeitsdefizite und Hyperaktivität zu einem Krankheitsbild<br />
zusammenfasst, wobei für beide Bereiche jeweils 9 Symptome genannt werden<br />
(genauer: C 3).<br />
� Eine Störung liegt nach dem DSM-IV vor, wenn entweder 6 Symptome von<br />
Unaufmerksamkeit oder von Hyperaktivität/Impulsivität vorliegen, die<br />
betreffende Person durch diese Symptome in zwei oder mehr Bereichen (z.B.<br />
in der Schule und zu Hause) beeinträchtigt wird und andere Störungen<br />
ausgeschlossen werden können.<br />
� Lauth und Schlottke sehen Aufmerksamkeitsstörungen als Ergebnis einer komplexen<br />
Entwicklung, die sich in 5 hierarchische aufeinander aufbauende Ebenen unterteilen<br />
lässt:<br />
1) Psycho-physische Störungsgrundlagen<br />
2) Eingeschränkte Verhaltensregulation<br />
3) Beeinträchtigung des Planungsverhaltens sowie des Inhalts- und Regelwissens<br />
4) Negative Umweltreaktionen durch Eltern, Lehrer und Gleichaltrige<br />
5) Negative Erlebnisverarbeitung<br />
� Westhoff verwendet zur Beschreibung der Konzentration die Metapher eines Akkus;<br />
sie kann von Natur aus stark oder schwach sein und arbeitet unter unterschiedlichen<br />
Bedingungen unterschiedlich gut. Konzentration wird damit sowohl als<br />
Persönlichkeitsmerkmal, als auch als Zustand verstanden.<br />
� Ergo: Störungen können auftreten, wenn die Konzentrationsfähigkeit von<br />
Natur aus schwach ausgeprägt ist und/oder durch bestimmte Bedingungen<br />
gestört wird.<br />
� Störbedingungen können sein:<br />
� Körperliche Voraussetzungen<br />
� Motivationale Bedingungen<br />
� Äußere Bedingungen (z.B. Lärm)<br />
� Intellektuelle Lernfähigkeit<br />
� Soziale Bedingungen<br />
� Emotionale Bedingungen<br />
95
� Diagnostische Methoden: Ausgehend von den „Ebenen“ bei Lauth und Schlottke oder<br />
Westhoffs Störbedingungen sind bei der Diagnose spezifische Hypothesen zu<br />
formulieren und mittels altersadäquater Verfahren zu prüfen.<br />
� Konzentrationstests: der bekannteste ist der „d2“-Test, bei dem in<br />
vorgegebener Zeit alle „ds mit 2 Strichen“ zu markieren sind. Die<br />
Konzentrationsleistung wird dabei entweder anhand der Gesamtzahl aller<br />
bearbeiteten Items oder anhand der Anzahl aller richtig bearbeiteten Items<br />
pro Zeiteinheit bestimmt.<br />
� Bei kleineren Kindern empfehlen sich Durchstreichtests, die mit konkreten<br />
Objekten (z.B. Fischen) statt abstrakter Zeichen arbeiten.<br />
� Für die Fremd- und Eigenanamnese stehen entsprechende Gesprächsleitfäden<br />
zur Verfügung (abzufragen sind u. a. Gesundheitszustand,<br />
Schlafgewohnheiten, Interessen, persönliche Probleme etc.)<br />
� Persönlichkeitsvariablen können durch einschlägige Persönlichkeitstest<br />
erfasst werden: wie z.B. dem Persönlichkeitsfragebogen für Kinder zwischen 9<br />
und 14 (PFK 9-14) oder dem Problemfragebogen für 11- bis 14-jährige (PF<br />
11-14)<br />
� Intelligenzmessungen sollten, sofern die Schulleistungen durch die<br />
Konzentrationsfähigkeit schon nachhaltig eingeschränkt sein können, durch<br />
möglichst „schulferne“ Tests wie dem CFT erhoben werden.<br />
� Im Idealfall: Verhaltensbeobachtung in konkreten Situationen (Münchener<br />
Aufmerksamkeitsinventar); notfalls Befragung unterschiedlicher Personen<br />
(Lehrer, Eltern etc.)<br />
� Prävention und Intervention:<br />
� Am besten wirkt gut strukturierter und anregender Unterricht! Bevor<br />
Individualmaßnahmen eingeleitet werden, sollte also erst mal der Unterricht<br />
ins Auge gefasst werden.<br />
� Ein neueres Trainingsprogramm ist das „Training mit<br />
aufmerksamkeitsgestörten Kindern“ von Lauth und Schlottke<br />
3. Aggressivität und dissoziales Verhalten<br />
� Angesichts der diversen Aggressionstheorien (Triebtheorien, Frustrations-<br />
Aggressions-Theorie, lerntheoretische Ansätze) gibt es keine allseits anerkannte<br />
Definition von „Aggression“; für den alltäglichen Gebrauch kann sie jedoch als<br />
„intentionales Verhalten“ beschrieben werden, „das darauf ausgerichtet ist, Schmerz<br />
bzw. Schaden zuzufügen“.<br />
� Mögliche Differenzierungen: offene (körperliche / verbale) vs. verdeckte<br />
(phantasierte) Aggression; positive (gesellschaftlich anerkannte) vs. negativer<br />
Aggression etc.<br />
� Im DSM-IV fallen nicht tolerierbare Aggressionen, sofern sie von Personen unter 18<br />
gezeigt werden, unter die Kategorie „Störung des Sozialverhaltens“; eine solche<br />
Störung liegt dann vor, wenn Kinder und Jugendliche wiederholt eine oder mehrere<br />
der folgenden Verhaltensweisen zeigen:<br />
� Aggressives Verhalten gegenüber Menschen und Tieren<br />
� Zerstörung von Eigentum<br />
� Betrug oder Diebstahl<br />
� Schwere Regelverstöße<br />
� Epidemologie: Die vielbemühte These, dass die Aggression unter Kindern und<br />
Jugendlichen in den letzten Jahren drastisch zugenommen habe, lässt sich empirisch<br />
kaum nachprüfen (uneinheitliche Definition von Aggression, keine hinreichenden<br />
Methoden zur Datenerhebung etc.); es liegt jedoch nahe, dass die Häufigkeit<br />
96
aggressiver Ausschreitungen an Schulen aufgrund ihrer medialen Präsenz allgemein<br />
überschätzt wird.<br />
� Fest steht: Jungen zeigen häufiger physisch-aggressives Verhalten, Mädchen<br />
dagegen häufiger psychisch-aggressives Verhalten<br />
� Mögliche Ursachen: Biologische Faktoren (Geschlechtsunterschiede etc.), psychische<br />
Faktoren (verzerrte sozial-kognitive Informationsverarbeitung etc.), soziale Faktoren<br />
(Modelllernen etc.)<br />
� Modell zur Genese aggressiven Verhaltens (Petermann): prä- und perinatale<br />
Probleme � schwieriges Kind � Hyperaktivität [� schulische Probleme �<br />
Delinquenz] � Trotzverhalten � Aggression � mangelnde soziale Fertigkeiten und<br />
Informationsverarbeitungsdefizite � Probleme mit Gleichaltrigen [� Delinquenz]<br />
� Aggressives Verhalten stellt eine relativ stabile Störung dar; die Prognose ist<br />
dabei umso ungünstiger, je früher das Kind im Sinne des Modells auffällig<br />
wird.<br />
� Die Diagnose: hat in 2 Schritten vorzugehen: 1) Möglichst genaue Beschreibung des<br />
aggressiven Verhaltens und seiner situationalen Bedingungen 2) Hypothesenbildung<br />
bezüglich des individuellen Ausmaßes der Aggressivität<br />
� Eine gezielte Verhaltensbeobachtung aggressiven Verhaltens ist kaum<br />
möglich; die Verhaltensanalyse hat dementsprechend durch Exploration und<br />
Anamnese zu erfolgen.<br />
� Exploration: Welches Verhalten tritt zu welchen Zeiten und<br />
Gelegenheiten und gegenüber wem (oder was) auf? Als Leitfaden können<br />
hierbei z.B. die Kategorien des Beobachtungsbogens für aggressives<br />
Verhalten sein (von Petermann & Petermann)<br />
� Anamnese: bezieht sich auf die bisherige Entwicklung, die bisherigen<br />
Belastungen und Konflikte sowie das bisherige Erzieherverhalten (der<br />
Eltern und Lehrer)<br />
� Einsatz von Testverfahren (s.u.)<br />
� Die wichtigsten Testverfahren zur Messung der Aggressivität:<br />
� Der „Picture-Frustration-Test“ von Rosenzweig („Rosenzweig P-F-Test”):<br />
� 24 Bilder, auf denen jeweils 2 Personen abgebildet sind, wobei immer eine<br />
von der anderen frustriert wird. Die Pbn haben die Reaktion der<br />
frustrierten Peron in eine Sprechblase einzutragen (projektives Verfahren)<br />
� Jedes Item wird hinsichtlich der Aggressionsrichtung und des<br />
Reaktionstyps ausgewertet, wobei insgesamt 9 Signierungsmöglichkeiten<br />
bestehen:<br />
- Aggressionsrichtung: a) Extrapunitivität (gegen die Umgebung)<br />
b) Intropunitivität (gegen das eigene Ich)<br />
c) Impunitivität (Aggression wird umgangen)<br />
- Reaktionstyp: a) Obstacle-dominance (Hindernis dominiert die<br />
Reaktion)<br />
b) Ego-Defense (Bezug auf Ich dominiert die R.)<br />
c) Need-persistence (Lösung der problematischen<br />
Situation steht im Vordergrund)<br />
� Probleme: Aggressionsintensität bleibt unberücksichtigt; es bedürfte<br />
dringend einer Aktualisierung (Test stammt aus dem Jahr 1948)<br />
� Der „Erfassungsbogen für aggressives Verhalten in konkreten<br />
Situationen“ von Petermann & Petermann (EAS):<br />
� 22 bildhafte Items alltäglicher Situationen mit jeweils 3<br />
Antwortalternativen, die den Kategorien „sozial erwünscht“, „leicht<br />
aggressiv“ und „schwer aggressiv“ zugeordnet werden. Darüber hinaus<br />
97
epräsentieren die Items unterschiedliche Formen von Aggression (offen.<br />
Verdeckt, nach außen, nach innen, verbal, physisch etc. etc.)<br />
� Test gibts für Jungen und Mädchen und ist für Kinder von 9 bis 14 Jahre<br />
normiert (allerdings nur bezüglich der Intensität und nicht der Art der<br />
Aggressionen)<br />
� Prävention und Intervention:<br />
� Maßnahmen gegen Gewalt an der Schule haben sich nach Olweus auf 3<br />
Ebenen zu beziehen:<br />
1) Schulebene (Schulklima etc.)<br />
2) Klassenebene (Klassenklima etc.)<br />
- z.B. mit dem „Konstanzer Trainings-Modell“ von Tennstädt et al.<br />
3) Persönliche Ebene<br />
- Training in Einzel- und Gruppensitzungen, Entspannungsübungen,<br />
Förderung einer differenzierten Wahrnehmung, der Selbstkontrolle und<br />
des Einfühlungsvermögens etc.<br />
� Wichtig: Bei aller Sorge um die Täter dürfen auch die Opfer nicht vergessen<br />
werden!<br />
98
B 8: Pädagogisch-psychologische Evaluation in Schule und Hochschule<br />
1. Allgemeines zu Evaluation<br />
� Definition: Allgemein gesprochen ist Evaluation die systematische (im Idealfall auf<br />
sozialwissenschaftlichen Methoden beruhende und von externen Experten<br />
durchgeführte) Bewertung einzelner Handlungsformen oder mehrerer<br />
Handlungsalternativen.<br />
� Konkret: Evaluiert werden können…<br />
� Zielvorgaben (z.B. die Konsequenzen unterschiedlicher Lehrpläne für ein<br />
Fach etc. etc.)<br />
� Handlungsweisen einzelner Personen (z.B. die Lehrqualität eines<br />
Lehrers)<br />
� Techniken und Verfahrensweisen (z.B. unterschiedliche<br />
Unterrichtsformen)<br />
� Programme (z.B. die Ergebnisse einer Aufklärungskampagne zur<br />
Verkehrssicherheit)<br />
� Systeme (z.B. unterschiedliche Schulsysteme)<br />
Problem: Da die genannten Aspekte oft vermischt sind (z.B. Merkmale der<br />
Lehrerpersönlichkeit und Unterrichtsform), ist eine Trennung der Effekte<br />
vielfach nur bedingt möglich!<br />
� Verschiedene Evaluationsmodelle: Je nach Zielsetzung und Art der Durchführung<br />
lassen sich verschiedene Formen von Evaluation unterscheiden:<br />
� Wulf unterscheidet zwischen…<br />
1) Praxisorientierter Evaluation (sie dient der konkreten Verbesserung der<br />
Ist-Situation)<br />
2) Entwicklungsorientierter Evaluation (ihr Ziel ist die Auswahl und<br />
Optimierung von Hilfsmitteln, etwa der Entwicklung von Lehrtexten)<br />
3) Theorieorientierter Evaluation (ist weniger auf handlungsleitende als auf<br />
wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung ausgerichtet)<br />
� Vor dem Hintergrund der Curriculumsentwicklung wird unterschieden<br />
zwischen…<br />
1) Mikro- und Makroevaluation (erstere zielt auf einzelne Aspekte des<br />
evaluierten Programms, letztere zielt auf ein Gesamturteil)<br />
2) Innerer- und äußerer Evaluation (erstere wird von den Entwicklern bzw.<br />
Trägern eines Programms selbst durchgeführt, letztere von externen<br />
Experten => Trennung zw. Entwicklung und Evaluation)<br />
3) Summativer- und formativer Evaluation (erstere erfolgt nach Abschluss<br />
der zu evaluierenden Maßnahme, letztere während der Durchführung =><br />
fortlaufende Kontrolle und Optimierung)<br />
� Stake unterscheidet zwischen….<br />
� 3 Evaluationsfeldern: „Voraussetzungen“, „Prozesse“ und „Ergebnisse“<br />
� Für jedes dieser Felder können u.a. Intentionen (Ziele), Beobachtungen<br />
(empirische Fakten), Normen (Bewertungsmaßstäbe, z.B. die der<br />
Auftraggeber) und Urteile (wertende Aussagen der Evaluatoren) erhoben<br />
werden.<br />
99
� Das sog. KIPP-Modell der Evaluation (von Stufflebeam) unterscheidet<br />
zwischen…<br />
1) Kontext (Erheben der Rahmenbedingungen, Problemanalyse)<br />
2) Input (Verfügbare Ressourcen, Realisierungsmöglichkeiten, Kosten-<br />
Nutzen-Analysen)<br />
3) Prozess (fortlaufende Kontrolle neu eingeführter Maßnahmen)<br />
4) Produkt (Bewertung der Alternativen nach der Erprobungsphase)<br />
� Im Idealfall werden im Rahmen von Evaluationsstudien die Folgen zweier oder<br />
mehrerer Alternativen miteinander verglichen; wird nur eine Handlungsweise<br />
evaluiert, müssen vor der Durchführung andere Maßstäbe festgelegt werden, an denen<br />
sich die Bewertung orientieren kann.<br />
� Mögliche Maßstäbe sind dabei:<br />
� Teilnehmererwartung („Die Schüler waren mit der neuen Methode<br />
zufrieden“)<br />
� Vorhergehende Situation („das Klassenklima hat sich erheblich<br />
verbessert.“)<br />
� Persönliche oder externe Zielsetzung („wir wollten / wir sollten die<br />
Unfallrate mit unserer Kampagne um 20% reduzieren“)<br />
� Probleme: Wird nur eine Handlungsweise evaluiert, ist auch bei positiver<br />
Evaluation keine Aussage über die Gütegrad möglich. Auch Kausalaussagen<br />
sind, wenn überhaupt, nur bei Vergleichsstudien möglich.<br />
� Kosten: Wissenschaftliche Evaluationen sind aufwendig und bringen nicht nur<br />
finanzielle Kosten mit sich<br />
� Allein die Tatsache einer Evaluation wird von den Betroffenen u. U. als<br />
Abwertung ihres bisherigen Vorgehens erlebt.<br />
� Unruhe bei allen Beteiligten => Störung des alltäglichen Betriebs<br />
� Negative Ergebnisse können zu einer Beeinträchtigung der Lebenssituation<br />
der Beteiligten führen (weniger Aufträge, Studienbewerber etc. etc.)<br />
� Zusätzliche Arbeitsbelastung bei allen Beteiligten<br />
� Zeitverzögerung (wenn eine Maßnahme auch ohne vorherige Evaluation<br />
eingeführt werden könnte)<br />
� Evtl. Schädigung der Betroffenen durch probeweise eingesetzte Maßnahmen<br />
(z.B. neuere Konzepte in Modellschulen, die sich plötzlich doch als<br />
kontraproduktiv erweisen)<br />
� Vorteile einer professionell durchgeführten Evaluation: Wissenschaftlich ausgebildete<br />
Evaluatoren bringen a) Fachkompetenz, b) Methodenwissen und c) die nötige<br />
Objektivität mit.<br />
2. Wichtige Aspekte einer Evaluationsstudie<br />
� Ablauf einer idealen Evaluationsstudie (in der Realität so kaum durchführbar):<br />
1) Konsensfähige und exakte Beschreibung der zu evaluierenden Alternativen<br />
(z.B. Gesamtschule vs. 3-gliedriges Schulsystem)<br />
2) Festlegung der Bewertungskriterien einschließlich der zu verwendenden<br />
Messinstrumente<br />
3) Aufstellung konsensfähiger Entscheidungsregeln, die für alle möglichen<br />
Ergebnisse eine eindeutige Handlung vorsehen<br />
4) Durchführung<br />
5) Auswertung<br />
6) Berichtlegung<br />
7) Zusätzliche Aufnahme aller zunächst übersehenen Aspekte in die<br />
Entscheidungsregeln<br />
100
8) Beibehaltung der Entscheidungsregeln und Durchführung der<br />
evaluationsgestützten Entscheidung<br />
9) Bei veränderten Rahmenbedingungen oder dem Auftreten neuer Alternativen<br />
erneute Evaluation<br />
� Besonders wichtig ist die Festlegung und Operationalisierung der Ziel- und<br />
Bewertungskriterien: Worum soll es in der Evaluation gehen und nach welchen<br />
Kriterien soll entschieden werden, ob die Ergebnisse positiv oder negativ zu bewerten<br />
sind.<br />
� Der Evaluator selbst kann hier lediglich eine beratende Funktion einnehmen!<br />
� 2 Methoden:<br />
� MAUT (Multiattributive Nutzenmessung): Vor der Durchführung werden<br />
die verschiedenen Vorteile, die die zu evaluierenden Maßnahme mit sich<br />
bringen könnte (bessere Noten, besserer Selbstwert etc.), explizit gemacht<br />
und von den Betroffenen und/oder Experten gewichtet. Auf diese Weise<br />
kann nach der Evaluation der Gesamtnutzen der Maßnahme errechnet<br />
werden.<br />
� Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Ergebnisse einer Evaluation<br />
nicht nach den gleichen Kriterien, sondern für jede Person individuell und<br />
entsprechend ihrer jeweiligen Zielvorstellungen zu bewerten (v. a. bei der<br />
Einzelberatung sinnvoll).<br />
� Methodische Probleme bei der Durchführung:<br />
� Selbst wenn Alternativen verglichen werden, liegt Evaluationsstudien<br />
allenfalls ein „quasi-experimentelles“ Design zugrunde (bei gravierenden<br />
Mängeln wird ein Programm schon während der Evaluationsphase modifiziert<br />
etc. etc.)<br />
� Es wird nahezu immer mit Klumpenstichproben gearbeitet!<br />
� Auswertungsfragen: Der Auswertung können 3 Strategien bzw. Modelle zugrunde<br />
liegen:<br />
1) Das allgemeinpsychologische Modell: geht davon aus, dass die Auswirkungen<br />
der jeweils evaluierten Maßnahme prinzipiell bei allen Personen gleich sind.<br />
2) Das differentialpsychologische Modell: geht davon aus, dass<br />
Personenunterschiede zumindest im Hinblick auf bestimmte Modellparameter<br />
(z.B. die Ausgangswerte einer Person) für die Wirkung einer Maßnahme<br />
relevant sind und diese daher berücksichtigt werden müssen.<br />
3) Das individualpsychologische Modell: geht davon aus, dass die Wirkung einer<br />
Maßnahme letztlich nur auf Individualebene entschieden werden kann (was<br />
faktisch jedoch kaum bzw. nur sehr selten durchführbar ist)<br />
� Berichtlegung:<br />
� Schriftliche Berichte: neigen, wenn sie sich an die Politik bzw. Öffentlichkeit<br />
wenden, zu radikalisierten Ursachenzuschreibungen und Vereinfachungen<br />
� Mündliche Berichte: Gefahr der falschen Rollenzuschreibung: Evaluator wird<br />
nicht mehr als neutraler Experte, sondern als Meinungsvertreter<br />
wahrgenommen<br />
� Wissenschaftliche Publikationen: Materialien sollten für Sekundäranalysen<br />
zur Verfügung gestellt werden<br />
� Über die Verwertung der Evaluationsergebnisse entscheidet nicht der Evaluator,<br />
sondern die Auftraggeber (z.B. Uni), die Betroffenen (z.B. die Hochschullehrer aber<br />
auch die Studenten, die eine schlecht evaluierte Veranstaltung nicht mehr besuchen),<br />
politische Gremien oder die allgemeine Öffentlichkeit.<br />
101
3. Internationale Schulleistungsvergleiche (siehe auch: A 6)<br />
� Die Funktion von internationalen Schulleistungsvergleichen (auch „Large-Skale<br />
Assessments“ genannt) besteht darin, a) Informationen über den Leistungsstand des<br />
jeweiligen Schulsystems zu sammeln („Bildungsmonitoring“) und<br />
b) Steuerungswissen für eine mögliche Qualitätsentwicklung zur Verfügung zu stellen<br />
(Qualitätssicherung und -entwicklung).<br />
� Was Schulleistungstests leisten: Sie informieren…<br />
� …über welche Kompetenzen die Schüler innerhalb eines Landes in der<br />
untersuchten Domäne verfügen<br />
� …inwiefern diese Leistungen vom internationalen Leistungsniveau<br />
abweichen<br />
� …über die Kopplung zwischen Leistung und Hintergrundmerkmalen<br />
(Sozialstatus, Geschlecht, Migrationshintergrund)<br />
� …über spezifische Stärken und Schwächen von Schülern und damit auch<br />
des Schulsystems sowie speziellen Unterrichtskulturen<br />
� Was Schulleistungstests (noch) nicht leisten:<br />
� Sie liefern letztlich keine Erklärung, wie die gefundenen<br />
Länderunterschiede im Einzelnen zustande kommen.<br />
� Was wird untersucht? – In Internationalen Schulleistungsleistungstests sollten nur<br />
solche Leistungsbereiche untersucht werden, die sich a) objektiv, reliabel und valide<br />
messen lassen, b) zentral für schulisches Lehren und Lernen sind und c) in den<br />
beteiligten Ländern eine vergleichbare Rolle spielen.<br />
� Diese Kriterien treffen am ehesten auf kognitive Leistungen zu (Mathe,<br />
Naturwissenschaften, Lesen, Schreiben). Sie werden dementsprechend am<br />
häufigsten untersucht.<br />
� Soziale Kompetenzen werden dagegen weitgehend ausgeklammert. Zum einen<br />
lassen sie sich schwieriger messen, zum anderen bestehen im Bezug auf<br />
psychosoziale Lernziele z. T. erhebliche kulturelle Unterschiede.<br />
� Trotzdem werden in jüngerer Zeit neben kognitiven Leistungen auch<br />
zunehmend andere Bereiche berücksichtigt (z.B. die Fähigkeit zu<br />
selbstreguliertem Lernen, motivationale Voraussetzungen oder Einstellungen)<br />
� Die IEA-Studie CIVIC-Education untersucht z.B. die politische<br />
Einstellung von Jugendlichen in unterschiedlichen Ländern.<br />
� Neben den Leistungswerten werden in Large-Scale-Assessments zahlreiche<br />
Hintergrundvariablen erfasst (sozialer Hintergrund der Pbn, Ausstattung der<br />
Schulen, Prozessmerkmale des Unterrichts etc.)<br />
� Konzeption von internationalen Schulleistungsvergleichen:<br />
1. Definition des Untersuchungsgegenstandes<br />
� Nachdem geklärt ist, welcher Bereich untersucht werden soll, ist zu prüfen,<br />
ob dieser Bereich in den unterschiedlichen Ländern bzw. Schulsystemen<br />
eine vergleichbare Rolle spielt (curriculare Passung); dabei gibt es<br />
grundsätzlich 2 Vorgehensweisen:<br />
a) Herausarbeitung des kleinsten gemeinsamen Nenners aus den<br />
Lehrplänen.<br />
- Problem: Unterschiedliche Abfolge und Gewichtung der<br />
Lehrplaninhalte<br />
b) Entwicklung eines normativen Modells (Literacy-Konzept): Dabei wird<br />
gefragt, welche allgemeinen Kompetenzen in allen Teilnehmerstaaten<br />
von Schülern einer bestimmten Jahrgangsstufe / eines bestimmten<br />
Alters erwartet werden.<br />
102
� Die curriculare Passung, sprich: die Sicherstellung, dass für einen<br />
Kompetenzbereich in den verschiedenen Teilnehmerstaaten vergleichbare<br />
Lerngelegenheiten bestehen, ist besonders in den Fächern wichtig, für die<br />
Schule gewissermaßen ein Vermittlungsmonopol hat (z.B. Mathematik).<br />
2. Systematische Sammlung und Dokumentation von Aufgaben und<br />
Stimulusmaterial (Texte, Tabellen, Problemstellungen etc.)<br />
3. Auswahl durch Fach- und Ländervertreter<br />
� Wichtig: Beachtung der unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen<br />
Kontexte.<br />
4. Übersetzung der Aufgaben in die verschiedenen Landessprachen<br />
5. Feldtests an kleinen Stichproben zwecks Überprüfung der Gütekriterien<br />
(z.B. transkulturelle Validität)<br />
6. Hauptuntersuchung mit einer für die Zielpopulation repräsentativen<br />
Stichprobe<br />
� Entscheidung: Alters- oder Klassenstichprobe? (Siehe: A 6)<br />
� Methodische Fragen:<br />
� Abgrenzung und Differenzierung der untersuchten Kompetenzbereiche:<br />
� I.d.R. ist es möglich, Leistungen innerhalb einer Domäne auf einer<br />
Dimension abzubilden (liegt wohl nicht zuletzt an dem Einfluss<br />
allgemeiner Intelligenz) – gleichzeitig können mittels der verschiedenen<br />
Subtests jedoch auch Teildimensionen identifiziert werden, was eine<br />
gezieltere Analyse von Stärken und Schwächen innerhalb einer Domäne<br />
erlaubt (=> Kompetenzstufen):<br />
- In der PISA-Studie ließen sich z.B. im Bereich Naturwissenschaften 7<br />
Teilkompetenzen voneinander abgrenzen: darunter u. a. divergentes<br />
Denken, mentale Modelle, Umgang mit Graphiken etc.<br />
- Im Bereich Lesen fanden sich u. a. Unterschiede zwischen narrativen<br />
und expositorischen Texten.<br />
� Interkulturelle Validität und Äquivalenz (siehe: A 6):<br />
� Methoden: Geprüft wird die Äquivalenz mit Analysen zum „Differential<br />
Item Functioning“; erforderlich sind sensible Übersetzungen und eine<br />
interkulturelle Zusammenstellung der Aufgaben<br />
� Die Grundannahme internationaler Schulleistungstests, nämlich dass die<br />
gestesteten Kompetenzen die Grundlage für eine erfolgreiche<br />
Lebensbewältigung bilden, wurde empirisch bisher nicht geprüft (könnte<br />
allerdings anhand von Längsschnittstudien geschehen)<br />
� Ausblick: Angestoßen durch die internationalen Schulleistungsvergleiche vollzieht<br />
sich in der deutschen Bildungspolitik derzeit ein Paradigmenwechsel: Man<br />
verabschiedet sich von einer reinen Input-Steuerung (etwa durch Lehrpläne) und lässt<br />
sich stattdessen zunehmend von den Resultaten schulischer Bildung leiten (Output-<br />
Steuerung).<br />
103
4. Lehrevaluation<br />
� Definition: Lehrevaluation ist die Bewertung von universitärer Lehre durch<br />
Studierende oder Fachkolleginnen und –kollegen (Peers).<br />
� Die Evaluation der Hochschullehre ist mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben<br />
(Hochschulrahmengesetz und Landeshochschulgesetze); durch die Einführung<br />
der Studiengebühren gewinnt sie zusätzlich an Relevanz!<br />
� Die wichtigsten Ziele der Lehrevaluation sind:<br />
� Übergeordnetes Ziel: Sicherung und Verbesserung der Qualität von Lehre<br />
und Studium<br />
� Spezifische Ziele:<br />
� Verkürzung der Studienzeiten und Erhöhung der Studienerfolgsquoten<br />
� Wettbewerb und Profilierung zwischen den Universitäten<br />
� Motivierung und Kontrolle der Lehrenden<br />
� Leistungsvergleich und leistungsbezogene Mittelvergabe (an Lehrstühle<br />
etc.)<br />
� Hilfe bei Laufbahnentscheidungen (etwa bei anstehenden Berufungen,<br />
Vertragsverlängerungen etc.)<br />
� Verbesserung der Berufsqualifizierung der Absolventen<br />
� Transparenz für Universitäts- und Veranstaltungswahl (für Studenten)<br />
� Informationsgrundlage für Verbesserungen<br />
� Gegenstände der Lehrevaluation:<br />
� Makroebene:<br />
� Evaluation eines Studiengangs: als Erfolgsindikatoren werden z.B. die<br />
Studiendauer, die Studienerfolgsquote und die Anzahl der Studienabschlüsse<br />
in Regelstudienzeit erhoben; außerdem werden Rahmenbedingungen<br />
erfasst wie z.B. die Raum- und Materialausstattung etc.<br />
� Evaluation eines Curriculums (sprich: der Inhalte eines Studienganges):<br />
Lehre der einzelnen Veranstaltungen, inhaltliche und zeitliche<br />
Abstimmung des Lehrangebots, Lehr- und Prüfungsorganisation etc.<br />
� Mikroebene:<br />
� Evaluation einzelner Lehrveranstaltungen<br />
- Lehrqualität<br />
Problem: Qualitätsbegriff ist schwer zu definieren, da er von den<br />
Zielvorstellungen abhängig ist<br />
- Lehreffektivität<br />
Problem: Die Effektivität müsste an den Leistungen der Studenten<br />
gemessen werden, dazu wären jedoch aufwendige Designs notwendig<br />
(Vortest, Nachtest, Follow up-Untersuchung + Kontrollgruppe), die bei<br />
der Lehrevaluation so gut wie nie zur Anwendung kommen.<br />
- Lehrveranstaltungszufriedenheit<br />
Erhebt man die Einstellung der Studenten zu einer Lehrveranstaltung,<br />
stellt sich das Validitätsproblem nicht!<br />
� Träger der Lehrevaluation: Meist wird eine Kombination aus interner- und externer<br />
Evaluation gewählt:<br />
1) Dabei verfassen die Angehörigen eines Lehrstuhls bzw. Instituts zunächst<br />
einen Selbstbericht, in den die wichtigen statistischen Daten (Studiendauer,<br />
Prüfungsnoten etc.) und eine Darstellung der Stärken und Schwächen eingehen<br />
2) Danach kommt ein externer Evaluator (z.B. ein Kollege von einer anderen<br />
Uni), der auf Basis des Selbstberichts und seiner eigenen Beobachtungen ein<br />
Gutachten erstellt.<br />
104
� Methoden der Lehrevaluation:<br />
� Makroebene: Hochschulstatistische Daten; Selbstberichte der verschiedenen<br />
Studiengänge, mündliche/schriftliche Befragung der Beteiligten<br />
� Mikroebene: Befragungen der Teilnehmer mittels Fragebögen (mittlerweile<br />
liegen mehrere validierte Fragebögen vor (z.B. das „Heidelberger Inventar<br />
zur Lehrveranstaltungsevaluation“)<br />
� Die Fragebögen umfassen sowohl globale Urteile als auch die Bewertung<br />
spezieller Merkmale:<br />
- Lehrendenvariablen (z.B. Strukturierung, Engagement, Anregung)<br />
- Themenvariablen (z.B. Interessantheit, Praxisrelevanz)<br />
- Studierendenvariablen (z.B. Häufigkeit der Teilnahme, Arbeitseinsatz)<br />
- Rahmenbedingungen (z.B. Raumverhältnisse)<br />
� Verwendet werden sowohl Items in Aussageform (Likert-Skala) als auch<br />
offene Fragen (für Anregungen, Kritik etc.)<br />
� Probleme der Lehrevaluation:<br />
� Validitätsproblematik: Ob Studentenurteile ein valides Maß für die<br />
Lehrqualität sind, ist fraglich; sie korrelieren nur gering mit den<br />
Selbsteinschätzungen der Lehrenden und lediglich mittelhoch mit den Urteilen<br />
externer Evaluatoren, beeinflusst bzw. verzerrt werden studentische Urteile vor<br />
allem durch das jeweilige Vorinteresse.<br />
� Fehlende Wirkung: Meist bleiben Lehrevaluationen ohne sichtbare<br />
Konsequenzen; die öffentliche Bekanntmachung der Ergebnisse wird<br />
freigestellt und es folgen keine Beratungs- und Qualifizierungsangebote für die<br />
Lehrenden!<br />
105
C: PÄDAGOGISCH-PSYCHOLOGISCHE PRÄVENTION; INTER-<br />
VENTION <strong>UND</strong> BERATUNG<br />
C1: Prävention b. Rechenschwierigkeiten und Lese-Rechtschreib-Schwäche<br />
1. Allgemeines zu mathematischer Kompetenz und ihren Determinanten<br />
� Langzeitstudien zeigen, dass der Erwerb mathematischer Kompetenzen bereits im<br />
Kindergartenalter beginnt.<br />
� Dabei lassen sich zwei Arten von Prädiktoren (bzw. Vorläuferkompetenzen)<br />
unterscheiden:<br />
1) Spezifische Prädiktoren (beeinflussen ausschließlich die späteren<br />
Mathematikleistungen): Mengen-Zahlen-Kompetenz<br />
2) Unspezifische Prädiktoren (wirken sich nicht nur auf die späteren<br />
Mathematikleistungen, sondern auch auf andere Kompetenzen, wie z.B. die<br />
Lese-Rechtschreibfähigkeit aus): Intelligenz, Kapazität des Arbeitsgedächtnisses,<br />
Zugriffsgeschwindigkeit auf das LZG<br />
� Die Vorhersagekraft der Mengen-Zahlen-Kompetenz ist wesentlich größer als<br />
die der unspezifischen Prädiktoren.<br />
� Trotzdem sollten letztere nicht unterschätzt werden; neben dem direkten<br />
Einfluss auf die späteren Mathematikleistungen, haben sie nämlich, sofern<br />
sie den Erwerb einer Mengen-Zahlen-Kompetenz begünstigen, auch einen<br />
indirekten Einfluss.<br />
� Förderprogramme, die die spezifischen Vorläuferkompetenzen trainieren und sich<br />
direkt auf mathematische Inhalte beziehen (inhaltsspezifische Trainings), sind<br />
wesentlich effektiver als unspezifische Trainings (in denen z.B. allgemeine<br />
Denkoperationen, visuelle Wahrnehmung uns so geübt werden)!<br />
� Die begrenzten Gedächtnisressourcen jüngerer Kinder sollten durch<br />
Darstellungsmittel zur visuellen Veranschaulichung des Zahlenraums (z.B.<br />
Zahlenstrahl) entlastet werden.<br />
� Sofern sie klar strukturiert sind und wiederholt eingesetzt werden, entlasten<br />
externe Repräsentationen nicht nur das Arbeitsgedächtnis, sondern<br />
erleichtern darüber hinaus den Aufbau mentaler Repräsentationen!<br />
� Der Erwerb mathematischer Basiskompetenzen vollzieht sich auf 3 Ebenen bzw. in 3<br />
Schritten, wobei die Ebenen nicht unbedingt für alle Anzahlen gleichzeitig<br />
durchlaufen werden.<br />
� Ebene I: Erwerb numerischer Basisfertigkeiten (unpräziser Mengenbegriff;<br />
Zählprozedur, exakte Zahlenfolge)<br />
� Entwicklung eines, wenn auch unpräzisen, Mengenbegriffs: Mengen<br />
können zwar hinsichtlich ihrer Größe („viel“/„wenig“) verglichen, aber noch<br />
nicht numerisch bestimmt werden.<br />
� Es werden Zahlwörter und die Prozedur des Zählens gelernt: Gegenstände<br />
können abgezählt werden und die Reihenfolge der Zahlen wird als<br />
unveränderlich begriffen (exakte Zahlenfolge); die Zahlwörter werden<br />
jedoch noch nicht mit den korrespondierenden Mengen in Verbindung<br />
gebracht, sondern lediglich in ihrer Ordnungsfunktion wahrgenommen.<br />
106
� Ebene II: Anzahlkonzept (Mengenbewusstsein von Zahlen = Zahlen als<br />
Anzahlen; Mengenrelationen)<br />
� Entwicklung eines Mengenbewusstseins von Zahlen: Die Verknüpfung des<br />
Mengenkonzepts mit den Zahlen erfolgt in 2 Schritten.<br />
a) Unpräzises Anzahlkonzept: Kinder lernen, den Zahlen eine quantitative<br />
Bedeutung beizumessen; allerdings ordnen sie den Zahlen dabei noch<br />
keine exakten-, sondern lediglich unbestimmte Mengen zu (1 = „wenig“;<br />
20 = „viel“; 100 = „sehr viel“) – und verstehen den Mengenbegriffe im<br />
Sinne von „viel“ bzw. „wenig zählen müssen“.<br />
b) Präzises Anzahlkonzept: Kinder erkennen, dass die Länge des Zählens<br />
exakt mit der ausgezählten Menge korrespondiert und die Menge durch<br />
die zuletzt genannte Zahl numerisch bezeichnet wird.<br />
� Unabhängig vom Anzahlkonzept entwickelt sich ein erstes Verständnis von<br />
Mengenrelationen: es wird a) erkannt, dass sich Mengen in Teile zerlegen<br />
lassen (Teil-Ganzes) und b) dass sie durch Zufügung bzw. Abzug einzelner<br />
Elemente größer bzw. kleiner werden (Zunahme-Abnahme-Schema).<br />
� Ebene III: Anzahlrelationen (Mengenbewusstsein von Zahlrelationen)<br />
� Die Verknüpfung des Anzahlkonzepts mit dem Verständnis für<br />
Mengenrelationen führt zu einem tieferen Verständnis der Zahlstruktur:<br />
Zum einen wird erkannt, dass Anzahlen sich wiederum aus Anzahlen<br />
zusammensetzen und dementsprechend wie Mengen zerlegt werden können<br />
(5 = 3 und 2), zum anderen wird erkannt, dass und wie sich die Differenzen<br />
zwischen Anzahlen als Zahlen ausrücken lassen („5 ist um 2 mehr als 3“)<br />
- Auf dieser Ebene ist der Einsatz anschaulicher Darstellungsmittel<br />
besonders wichtig!<br />
� Fazit: Mathematische Frühförderung sollte darauf zielen, basale Fertigkeiten für<br />
den Umgang mit Mengen und Zahlen zu schulen, diese anschließend zum<br />
Anzahlkonzept zu verknüpfen und Anzahlrelationen bewusst zu machen.<br />
2. Drei deutsche Trainingsprogramme zur Prävention von Rechenschwäche<br />
A) „Komm mit ins Zahlenland“<br />
� Das Programm stellt die Zahlen von 1 bis 10 in personalisierter, Phantasie<br />
anregender Weise dar und regt zu diversen Zähl- und Zahlspielen ein.<br />
� z.B. gehört zu jeder Zahl ein fester Wohnort mit Haus und Garten, eine<br />
Zahlenpuppe (die „Eins“ trägt eine Zipfelmütze, die „Zwei“ zwei Brillengläser<br />
etc.), eine bestimmte Geschichte (die Eins hat ein Einhorn etc.) …<br />
� Nach 10-wöchigem Training mit 3-6-jährigen zeigen sich folgende Effekte:<br />
� Das Programm ermöglicht den Erwerb basaler Grundfertigkeiten, wie z.B. die<br />
Fähigkeit Mengen zu erfassen und herzustellen (Ebene I)<br />
� Darüber hinaus unterstützt es durch Zählspiele und Zahl-Mengen-Zuordnungen<br />
den Erwerb des unpräzisen Zahlkonzepts (Ebene IIa)<br />
� Die Möglichkeit zur Ausbildung höherer Kompetenzstufen (insbes. Ebene IIIb)<br />
sind jedoch begrenzt, da das Zunahme-um-eins-Prinzip nicht hinreichend geübt<br />
wird und die „Beseelung“ des Zahlenraums dem Verständnis abstraktnumerischer<br />
Operationen entgegensteht.<br />
� Kritik: Kinder lernen eher, Zahlen als beseelte Wesen statt als vom Kontext<br />
losgelöste Symbole zu verstehen!<br />
� Eine Überprüfung langfristiger Effekte des Programms steht noch aus; die Frage, was<br />
es zur Prävention schulischer Rechenschwierigkeiten beiträgt, muss insofern offen<br />
bleiben.<br />
107
B) Zahlenbegriffsförderung in der ehemaligen DDR<br />
� In der ehemaligen DDR wurde die mathematische Kompetenz der Kinder bereits 2<br />
Jahre vor Schulbeginn systematisch zu fördern versucht. Das Training umfasste dabei<br />
alle 3 Kompetenzebenen; den Kindern wurde also nicht nur das Anzahlkonzept<br />
(Ebene II) vermittelt, sondern sie wurden auch in der Bildung und numerischen<br />
Benennung von Differenzen geschult (Ebene IIIb).<br />
� Ergo: Eine frühe Förderung auf allen Kompetenzebenen ist möglich und<br />
sinnvoll!<br />
� Zusätzlich gab es ein besonderes Trainingsprogramm für Risikokinder, mit denen v. a.<br />
Übungen auf der 1. Ebene vertieft wurden. Die Ergebnisse dieses Zusatzprogramms<br />
waren jedoch eher enttäuschend (fehlender Transfer)!<br />
� Ergo: Auch bei schwachen Kindern sollte eine Förderung bis zur 3. Ebene<br />
angestrebt werden!<br />
C) „Mengen, Zählen, Zahlen“ (MZZ; Krajewski, Nieding, Schneider: 2005)<br />
� Dem Würzburger Trainingsprogramm „Mengen, Zählen, Zahlen“ (MZZ) liegt das<br />
oben genannte Entwicklungsmodell zugrunde; es versucht dementsprechend,<br />
sukzessive und systematisch das für alle 3 Ebenen notwendige Wissen aufzubauen:<br />
1) Zunächst lernen die Kinder zu zählen und die Ziffern (Ebene I)<br />
2) Darauf folgt die Förderung eines präzisen Anzahlkonzepts (Ebene IIb); sie<br />
bildet einen Schwerpunkt des Programms und erfolgt anhand von Übungen, bei<br />
denen Mengen auszuzählen- und den in einer Reihe angeordneten Zahlen<br />
zuzuordnen sind.<br />
3) Den zweiten Schwerpunkt bildet das Verständnis der Anzahlrelationen (Ebene<br />
III). Den Kindern wird vermittelt, dass von einer zur nächsten (An-)Zahl immer<br />
genau eins hinzukommt (Zunahme-um-Eins-Prinzip) und dass sich Anzahlen aus<br />
kleinern Anzahlen zusammensetzen lassen.<br />
� Methoden:<br />
� Die Übungen werden mittels fester und abstrakter Darstellungsformen<br />
veranschaulicht; das wichtigste Darstellungsmittel ist dabei die<br />
„Zahlentreppe“: Mit ihr können nicht nur die Ordnung der Zahlenfolge<br />
(präzises Anzahlkonzept; IIb), sondern auch die Zahlbeziehungen (Ebene III)<br />
veranschaulicht werden.<br />
� Wichtig sind außerdem metakognitive und selbstinstruierende Elemente<br />
sowie das Modellverhalten der Erzieherin.<br />
� Durchführung: Das Programm wird täglich über einen Zeitraum von 10 Wochen<br />
durchgeführt. Wo? – Im Kindergarten natürlich!<br />
� Befunde: Trainierte Kinder weisen im Vergleich zu nicht trainierten Kindern einen<br />
erheblichen (und bis zum Ende des Kindergartens anhaltenden) Zuwachs in der<br />
Mengen-Zahlen-Kompetenz auf. Inwiefern sich das Programm präventiv auf spätere<br />
Rechenschwierigkeiten auswirkt, ist noch zu untersuchen.<br />
108
3. Methoden zur Früherkennung von L-R-Schwierigkeiten<br />
A) Vorbemerkung<br />
� LRS wird i.d.R. erst spät diagnostiziert (3./4.Klasse); zu diesem Zeitpunkt ist die<br />
Störung meist schon durch eine Vielzahl weiterer Symptome überlagert<br />
(Sekundärsymptomatik), wodurch eine Behandlung enorm erschwert wird.<br />
� Es bedarf daher sowohl einer frühen Risiko-Diagnose, als auch früher<br />
Präventionsmaßnahmen!<br />
� „Phonologische Informationsverarbeitung“: Es besteht heute weitgehende<br />
Einigkeit darüber, dass L-R-Schwierigkeiten v. a. durch Defizite in der<br />
„phonologischen Informationsverarbeitung“ bedingt sind. Der Terminus fungiert dabei<br />
als Sammelbegriff für die verschiedenen Prozesse der Lautverarbeitung, wobei sich 3<br />
Arten von Prozessen unterscheiden lassen:<br />
1) Phonologische Bewusstheit: meint das Bewusstsein über die lautliche Struktur<br />
der Sprache<br />
� Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn bezieht sich dabei auf die<br />
gröberen Strukturen (Erkennen von Reimen, Wörtern und Silben);<br />
phonologische Bewusstheit im engeren Sinn (auch phonemische<br />
Bewusstheit) auf die Feinstruktur der Sprache (Erkennung von Lauten)<br />
2) Phonologisches/Phonetisches Rekodieren im KZG: meint die Verarbeitung<br />
sprachlicher Infos im KZG; genauer: die Fähigkeit, Lautfolgen im<br />
Arbeitsspeicher bereitzuhalten (beim Lesen und Schreiben werden schriftliche<br />
Symbole im Arbeitsgedächtnis lautsprachlich repräsentiert, um sie möglichst<br />
lange aktiviert zu halten)<br />
3) Phonologisches Rekodieren beim Zugriff auf das semantische Lexikon: Die<br />
Fähigkeit, sprachliche Infos möglichst schnell aus dem LZG abzurufen!<br />
B) Risiko-Screenings im Vorschulalter<br />
� Das Bielefelder Screening (BISC, 1999): überprüft die visuelle Aufmerksamkeit und<br />
die 3 Komponenten der phonologischen Informationsverarbeitung, sprich: die<br />
phonologische Bewusstheit, die Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses<br />
und Zugriffsgeschwindigkeit auf das semantische Lexikon.<br />
� Aufgabentypen:<br />
� Der Schwerpunkt liegt auf der Erfassung der phonologischen<br />
Bewusstheit; ihr sind 4 Subtests gewidmet:<br />
1) Reimerkennungsaufgaben<br />
2) Silbentrennung<br />
3) Aufgrund vorgesprochener Laute und Lautfolgen Wörter erraten<br />
4) Erkennen, ob ein Laut in einem vorgesprochenen Wort als<br />
Anfangssilbe vorkommt<br />
� Kapazität des phonologischen KZG: Nachsprechen von Pseudowörtern<br />
� Zugriffsgeschwindigkeit auf das semantische Lexikon: Schnelles<br />
Benennen der Farben unfarbiger oder falschfarbiger Objekte<br />
� Durchführung: 10 Monate und 3 Monate vor- sowie 14 Wochen nach der<br />
Einschulung.<br />
� Bewertung: Das BISC führt zu ausgesprochen guten Ergebnissen<br />
� Hoher RATZ-Index (Trefferquote im Verhältnis zur Zufallstrefferquote):<br />
� Hohe Sensitivität (Anteil entdeckter Problemkinder)<br />
� Hohe Prädiktortrefferquote: Anteil der als Risikokinder eingestuften Pbn,<br />
die später (Ende 2. Schuljahr) tatsächlich Probleme bekommen<br />
� BISC wird meist nur mit einer Förderung der phonologischen Bewusstheit<br />
verknüpft; ein Training der beiden anderen Komponenten phonologischer<br />
109
Infoverarbeitung scheint nämlich nach bisherigen Befunden nicht sonderlich<br />
effektiv zu sein (Grund: nur schwer trainierbar!).<br />
� Die Differenzierungsprobe von Breuer und Weuffen (2005): testet die<br />
Differenzierungsfähigkeit in 5 sprachbezogenen Wahrnehmungsleistungen:<br />
nämlich die optische-, kinästhetisch-artikulatorische-, phonematisch-akustische-,<br />
melodische- und rhythmische Differenzierungsfähigkeit.<br />
� Ist bereits 1 Jahr vor Schuleintritt durchführbar, wird aber auch im Rahmen<br />
von Schuleingangsuntersuchungen eingesetzt.<br />
� Ziel ist weniger eine globale Risikoprognose, als vielmehr die Ermittlung<br />
einzelner förderungsbedürftiger Wahrnehmungsleistungen, die als<br />
Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb betrachtet werden.<br />
� Kritik: geringe Itemzahl pro Subtest (fragliche Reliabilität);<br />
Längsschnittstudien zur prognostischen Validität liegen nicht vor<br />
C) Risiko-Screenings zu Schulbeginn<br />
� Vorteile einer Prognose bei Schulbeginn:<br />
� Ökonomischere Gruppentestung möglich<br />
� Testung der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinn möglich (verändert<br />
sich rapide und hängt stark vom Erstleseunterricht ab)<br />
� Der „Gruppentest zur Früherkennung von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten“<br />
(2004) und der Einzeltest „Rundgang durch Hörhausen“ (2001) beschränken sich<br />
auf eine Testung der phonologischen Bewusstheit im weiteren und engeren Sinn.<br />
� Grund: Diese Vorläuferfähigkeit kann am besten gefördert werden.<br />
� Die prognostische Validität der beiden Tests ist zufriedenstellend.<br />
� Das Münsteraner Screening ist eng an das BISC angelehnt und testet<br />
dementsprechend auch die beiden anderen Komponenten der phonologischen<br />
Infoverarbeitung und die visuelle Aufmerksamkeit, verzichtet dafür aber auf eine<br />
Testung der phonologischen Bewusstheit im engeren Sinn.<br />
� Befunde zur prognostischen Validität des Screenings liegen bisher nicht vor.<br />
� Es gibt auch Verfahren für die Mitte des 1. Schuljahres; allerdings sind deren<br />
Ergebnisse stark von Unterrichtseinflüssen abhängig.<br />
D) Ausblick<br />
� Die prognostische Validität der verschiedenen Früherkennungsverfahren ist meist<br />
zufriedenstellend.<br />
� Trotzdem ist VORSICHT angeraten:<br />
1) Rund die Hälfte aller späteren Problemkinder werden nicht als<br />
Risikokinder identifiziert!<br />
2) Falscher Alarm (in über 30% der Fälle) führt zu einer massiven<br />
Verunsicherung der Eltern.<br />
� Kompetenzen in den Bereichen Grammatik und Wortschatz bleiben in den<br />
prognostischen Verfahren unberücksichtigt, weil es sich bei ihnen nicht um<br />
unmittelbare Vorläuferkompetenzen der Lese-Rechtschreibleistung handelt.<br />
� Da sie aber massiven Einfluss auf das spätere Leseverständnis haben, sollten<br />
auch sie schon früh erhoben und wo nötig, gezielt gefördert werden (s.u.).<br />
110
4. Vorschulische Förderung der phonologischen Bewusstheit<br />
� 3 Arten von Prävention lassen sich unterscheiden:<br />
� „Universelle Präventionsmaßnahmen“ richten sich an unausgelesene<br />
Gruppen<br />
� „Selektive Präventionsmaßnahmen“ richten sich ausschließlich an<br />
„Risikokinder“<br />
� „Indizierte Präventionsmaßnahmen“ richten sich an Kinder, bei denen bereits<br />
Schwierigkeiten aufgetreten sind<br />
� Präventive Maßnahmen zur Verbesserung der späteren Lese-Rechtschreib-Leistungen<br />
konzentrieren sich v.a. auf die frühe Förderung der phonologischen Bewusstheit.<br />
� Zwar haben auch die anderen Komponenten der phonologischen<br />
Infoverarbeitung Einfluss auf den Schriftspracherwerb, sie lassen sich aber<br />
kaum trainieren.<br />
� Die Effektivität von Trainingsprogrammen zur phonologischen Bewusstheit<br />
konnte dagegen in diversen Längsschnittstudien nachgewiesen werden.<br />
� Klassisch ist in diesem Zusammenhang v.a. eine Studie von Lundberg,<br />
Frost und Petersen (1988): Darin wurden in einer Experimentalgruppe<br />
über 9 Monate jeden Tag 15-20 Minuten Trainingseinheiten zur<br />
phonologischen Bewusstheit durchgeführt (Lauschspiele; Reime erkennen<br />
und reproduzieren; Segmentierung der Sprache in Wörter und Sätze,<br />
Anlautidentifikation, Übungen zur Phonemsynthese und –analyse) �<br />
Ergebnis: die Lese-und-Rechtschreib-Leistungen der Experimentalgruppe<br />
lagen noch im 2. Schuljahr signifikant über denen der Kontrollgruppe<br />
(Wow!)!<br />
� Das Würzburger Trainingsprogramm „Hören-Lauschen-Lernen“ (HLL;<br />
Schneider): orientiert sich in seinem Aufbau an den Aufgabentypen der besagten<br />
Studie.<br />
� Lauschspiele � Reimaufgaben � Sätze und Wörter � Silbentrennung �<br />
Anlautidentifikation � Phonemsynthese und –analyse<br />
� Ergänzung (seit 2004): Buchstaben-Laut-Zuordnungstraining!<br />
� Diverse Längsschnittstudien zur Bewertung des Programms konnten zeigen:<br />
a) …dass die spätere Lese-Rechtschreib-Kompetenz durch das Vorschul-<br />
Training signifikant verbessert wird.<br />
b) …dass Kinder aller Leistungsgruppen von dem Training gleichermaßen<br />
profitieren.<br />
c) …dass auch Kinder, die nach dem BISC zur Risikogruppe gehören, mit<br />
dem Programm erfolgreich trainiert werden können (ihre Lese-<br />
Rechtschreib-Leistungen unterschieden sich nach dem Training nur<br />
unwesentlich von denen einer untrainierten, aber „normalen“<br />
Kontrollgruppe)<br />
d) …dass die Frühförderung dann am effektivsten ist, wenn neben der<br />
phonologischen Bewusstheit auch die Kenntnis von Buchstaben vermittelt-<br />
und deren Zuordnung zu Lauten (Buchstaben-Laut-Zuordnung) trainiert<br />
wird (= Bestätigung der sog. „Phonologischen Verknüpfungshypothese“)<br />
e) …dass auch Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache von dem Training<br />
profitieren.<br />
� Prävention zu Beginn der Schulzeit:<br />
� Trainingsprogramme zur phonologischen Bewusstheit, die zu Beginn der<br />
Schulzeit durchgeführt werden, zeigen wesentlich geringere Transfereffekte als<br />
vorschulisches Training.<br />
111
� Evaluationsstudien zur Wirksamkeit unterschiedlicher Lese-Instruktionsmethoden<br />
(z.B. synthetischer vs. ganzheitlicher Ansatz) haben keine Effekte<br />
ergeben.<br />
5. Förderung anderer Bereiche (Grammatik und Lesemotivation)<br />
� Die Lesefertigkeit (im Sinne einer schnellen und automatisierten Worterkennung)<br />
muss vom Leseverständnis (im Sinne eines adäquaten Umgangs mit Texten)<br />
unterschieden werden.<br />
� Diese beiden Komponenten sind zwar nicht völlig unabhängig voneinander, sie<br />
sind aber auch nicht besonders eng miteinander korreliert.<br />
� Ein umfassendes Modell zur Lesekompetenz, in dem nicht nur die Lesefertigkeit,<br />
sondern auch das Leseverständnis berücksichtigt werden, stammt von Lundberg:<br />
Dem Modell zufolge setzt sich die Lesekompetenz einerseits aus der Worterkennung,<br />
andererseits aus dem Leseverständnis zusammen.<br />
� Die wichtigsten Voraussetzungen der Worterkennung sind: phonologische<br />
und phonemische Bewusstheit und das davon abhängige phonologische<br />
Rekodieren.<br />
� Weitere Faktoren sind: die Automatisierung (der Worterkennung) und die<br />
orthographische Verarbeitung, die ihrerseits von der Buchstabenkenntnis<br />
und der Beherrschung der Phonem-Graphem-Korrespondenzen abhängen.<br />
� Die wichtigsten Voraussetzungen des Leseverständnisses sind: a) der<br />
Wortschatz und b) syntaktische Kompetenzen<br />
� Weitere Faktoren sind: das Hintergrundwissen und die von der<br />
syntaktischen Entwicklung abhängige Fähigkeit zum Schlussfolgern.<br />
� Aus dem Modell folgt: Eine Förderung des Leseverständnisses müsste in den<br />
Bereichen Grammatik und Wortschatz ansetzen; noch gibt es diesbezüglich jedoch<br />
kaum Untersuchungen.<br />
a) weil bei einer allgemeinen Sprachförderung geringere Effekte als bei<br />
phonologischem Training zu erwarten sind<br />
b) weil Tranfereffekte schwerer nachweisbar sein dürften, da sich die Wirkung<br />
eines solchen Trainings erst in der späteren Grundschulzeit zeigen sollte.<br />
� Förderung von Lesemotivation und Leseinteresse: Die Schaffung einer anregenden<br />
Leseumwelt (v. a. in der Familie) hat einen indirekten Einfluss auf die spätere<br />
Lesekompetenz!<br />
� Wichtige Komponenten einer förderlichen Lesesozialisation („early literacy“)<br />
sind: Vorlesen (wobei die Qualität wichtiger als die Quantität zu sein scheint);<br />
Bilderbücher; Hörspiele; Aneignung von Kinderliedern und Sprachspielen etc.<br />
� Wie groß die Effekte solcher indirekten Präventionsmaßnahmen allerdings<br />
wirklich sind, lässt sich kaum sagen => Hier besteht enormer<br />
Forschungsbedarf!<br />
112
6. Zusammenfassung:<br />
� Bei der Früherkennung von L-R-Schwierigkeiten sind enorme Fortschritte gemacht<br />
worden, trotzdem sollten die Screeningprozeduren nicht überschätzt werden.<br />
� Merkmale eines erfolgreichen Trainings sind:<br />
� Das Training sollte schon in der Vorschule beginnen;<br />
� Außerdem muss es regelmäßig (am besten täglich) und über einen langen<br />
Zeitraum (mind. ½ Jahr) stattfinden.<br />
� Es sollten mehrere Übungen zur phonologischen Bewusstheit im engeren Sinn<br />
enthalten sein (Anlautidentifikation, Phonemanalyse und –synthese)<br />
� Im Sinne der Verknüpfungsthese sollte neben der phonologischen Bewusstheit<br />
auch das Prinzip der Buchstaben-Laut-Verknüpfung trainiert werden.<br />
� Phonologische Infoverarbeitung ist nicht alles! Auch andere Komponenten der<br />
Lesekompetenz (Wortschatz, Grammatik…) sollten berücksichtigt werden!<br />
113
C 2: Kognitive Förderung von Kindern und Jugendlichen<br />
1. Kognitive Bedingungen von Lern- und Gedächtnisleistungen<br />
� Nach Barclay hängt die Gedächtnisleistung von 3 Komponenten ab:<br />
1) Kapazität<br />
� Die Gedächtniskapazität wird einerseits durch architektonische Merkmale<br />
(Strukturaspekt), andererseits durch basale Eigenschaften der<br />
Informationsverarbeitung (Prozessaspekt) determiniert.<br />
2) Strategische Aktivitäten<br />
� Zu den strategischen Aktivitäten gehören einerseits die konkreten Lern-<br />
und Erinnerungsaktivitäten (z.B. Wiederholung etc.), andererseits<br />
übergeordnete (metakognitive) Kontroll- und Regulationsprozesse<br />
(prozedurales Metagedächtnis).<br />
3) Wissensaspekte<br />
� Für die Gedächtnisleistung relevant sind einerseits das Ausmaß und die<br />
Strukturierung des Vorwissens, andererseits das Wissen um die<br />
Möglichkeiten und Grenzen des eigenen Gedächtnisses (deklaratives<br />
Metagedächtnis)<br />
� Zur Gedächtniskapazität: Während man früher davon ausging, dass die<br />
strukturelle Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses bis ins Erwachsenenalter zunimmt,<br />
geht man heute eher davon aus, dass die Kapazität lediglich durch einen effizienteren<br />
Ablauf der Prozesse gesteigert wird, die Strukturen jedoch unverändert bleiben (s.u.).<br />
Trainieren lässt sich jedoch weder die strukturelle, noch die prozessuale Komponente<br />
der Gedächtniskapazität!<br />
� Robbie Case unterscheidet zwischen einem Arbeits- und einem<br />
Kurzzeitspeicher:<br />
a) Der Arbeitsspeicher („operating space“): ist zuständig für die kognitiven<br />
Prozesse der Informationsverarbeitung!<br />
b) Der Kurzzeitspeicher („storage space“): ist zuständig für die<br />
Informationsspeicherung!<br />
� Annahme: Die Kapazität als solche bleibt ab dem 2. Lebensjahr gleich; was<br />
sich mit dem Alter verändert, ist lediglich das Verhältnis zwischen operating-<br />
und storagespace. Aufgrund der zunehmenden Automatisierung der<br />
Verarbeitungsprozesse brauchen diese nämlich immer weniger Kapazität, so<br />
dass sich das Verhältnis zugunsten des storagespace verschiebt.<br />
� Kurz: Was zunimmt ist die „operationale Effizienz“ und nicht die<br />
Kapazität als solche!<br />
� Nach Baddeley setzt sich das KZG aus 3 Komponenten zusammen: Einem<br />
zentralen Steuerungssystem und 2 modalitätsspezifischen Hilfssystem.<br />
a) Das zentral-exekutive Überwachungs- und Steuerungssystem ist<br />
modalitätsunspezifisch und dient v.a. der Aufmerksamkeitslenkung und<br />
-kontrolle)<br />
b) Die phonologische Schleife („phonological loop“) ist für die Verarbeitung<br />
und Bereithaltung verbaler Infos zuständig<br />
c) Der visuell-räumliche Notizblock („visuo-spatial scratch pad“) ist<br />
dagegen für die Verarbeitung und Speicherung bildhafter Infos zuständig.<br />
� Wie Case geht auch Baddeley davon aus, dass die verfügbare Kapazität in den<br />
beiden Hilfssystemen dabei wesentlich durch die prozessuale Komponente<br />
bestimmt wird.<br />
114
� Strategische Aktivitäten: sind im Gegensatz zu den kapazitätsbedingenden<br />
Faktoren trainierbar.<br />
� Zwei Arten von Strategien lassen sich dabei unterscheiden:<br />
1) Kognitive Gedächtnisstrategien: Wiederholung, Organisation, Elaboration<br />
2) Metakognitive Gedächtnisstrategien: betreffen die Planung (z.B. das<br />
Setzen von Lernzielen), die Selbstüberwachung (Kontrollfragen etc.) und<br />
die Regulation (Anpassung an die jew. Anforderungen durch<br />
Lernzeitallokation etc.) des eigenen Lernverhaltens.<br />
� Wissensaspekte:<br />
� Zwei Formen von Wissen sind für das Lernen relevant:<br />
1) Das Weltwissen: dazu zählt sowohl bereichsspezifisches als auch<br />
übergreifendes Wissen über die Welt<br />
2) Metamemoriales Wissen: dazu zählt sowohl Wissen über das eigene<br />
Gedächtnissystem (systemisches Wissen) als auch Wissen über aktuelle<br />
Gedächtnisinhalte (epistemisches Wissen)<br />
� Ausmaß und Strukturierung des verfügbaren Weltwissens haben zwar großen<br />
Einfluss auf das strategische Verhalten in Lernsituationen (Vgl. Experten-<br />
Novizen-Paradigma) – die Wirkung der Wissensvermittlung bleibt jedoch<br />
meist bereichsspezifisch, weshalb sich diesbezügliche Maßnahmen nur bedingt<br />
für ein allgemeines Gedächtnistraining eignen.<br />
� Anders ist es bei der Vermittlung metamemorialen Wissens: letzteres wirkt<br />
sich direkt auf die Lern- und Gedächtnisleistung aus – und zwar in allen<br />
Bereichen.<br />
� Spezifisches Strategiewissen: in welchem Kontext ist welche Strategie am<br />
effektivsten?<br />
� Generelles Strategiewissen: meint die generelle Überzeugung, dass sich<br />
strategisches Vorgehen förderlich auf die Lern- und Gedächtnisleistung<br />
auswirkt (nimmt mit dem Alter zu)<br />
2. Elemente eines effektiven Lern- und Gedächtnistrainings<br />
� Anders als früher (bis in die 70er Jahre) wird die Effektivität von Lern- und<br />
Gedächtnistrainings heute nicht mehr anhand einfacher Leistungsvergleiche gemessen;<br />
stattdessen wird zwischen mehreren Effektivitätskriterien unterschieden:<br />
� Kurzfristige Veränderung vorhandener Kompetenzen<br />
� Mittelfristige Stabilisierung dieser Veränderung<br />
� Langfristige Aufrechterhaltung veränderter bzw. neu erworbener<br />
Kompetenzen<br />
� Generalisierung auf andere Aufgabenbereiche (distaler Tranfer)<br />
� Auf Grundlage dieser Kriterien hat Hasselhorn 6 wirksame Trainingselemente<br />
identifiziert:<br />
1) Modellgeleitetes Einüben selbständiger Strategieanwendung<br />
� Eine kurzfristige Verbesserung ist bereits bei häufiger Anwendung einer<br />
Strategie zu erreichen, zu einer langfristigen Verbesserung kommt es<br />
jedoch erst bei interaktivem Modelllernen, wobei die Aktivität der Trainers<br />
schrittweise zurückgenommen werden sollte.<br />
� Förderlich ist darüber hinaus die Methode der verbalen Selbstinstruktion!<br />
2) Explizite Vermittlung metamemorialen Strategiewissens<br />
� Längerfristige Aufrechterhaltung und Generalisierung von Strategien<br />
werden durch explizite Infos über deren Nutzen und<br />
Anwendungsmöglichkeiten begünstigt („informed training“ statt „blind<br />
training“)<br />
115
3) Variation des Aufgabenkontexts bzw. der Aufgabenstellung<br />
� Um einen distalen Transfer zu fördern, sollte das trainierte Lernverhalten<br />
in unterschiedlichen Situationen und auf unterschiedliche Lernaufgaben<br />
angewendet werden.<br />
4) Einüben genereller Techniken der Selbstkontrolle und Lernregulation<br />
� „Stop-check-and-study“-Routine: Kinder werden aufgefordert, während<br />
des Lernprozesses immer wieder innezuhalten, um die bis dahin erzielten<br />
Fortschritte zu überprüfen.<br />
5) Inhaltliche Nähe zum schulischen Lernen<br />
� Anwendung der Trainingselemente auch in komplexen schulalltagsnahen<br />
Aufgabenbereichen wie z.B. dem Textlernen<br />
6) Verknüpfung der trainierten Strategien mit persönlicher Zielmotivation<br />
� Der funktionale und persönliche Wert der gelernten Strategien muss den<br />
Kindern eigens verdeutlicht werden!<br />
3. Beispiele komplexer Trainingsprogramme zur Lern- und Gedächtnisleistung<br />
A) „Teufelsgeschichten und Teufelsspiele“ (TUT)<br />
� Ziel: Förderung des verbalen Kurzzeitgedächtnisses von Kindern zw. 5 und 8<br />
Jahren und Prävention von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten.<br />
� Annahme: Effektivere Nutzung des verbalen Kurzzeitgedächtnisses führt zu<br />
einer Verbesserung der phonemischen Bewusstheit => Erleichterung des<br />
Schriftspracherwerbs.<br />
� Inhalt/Methode: Anhand von Merkspielen zu vorher gelesenen Geschichten wird den<br />
Kindern eine einfache Wiederholungsstrategie („rehearsal“) vermittelt.<br />
� Durchführung: Gruppentraining im Kindergarten, 13 Spielstunden a 45 Minuten<br />
� Ablauf:<br />
� Zu Beginn jeder Spielstunde: Vorlesen einer Teufelsgeschichte<br />
� Dabei legt der Spielleiter Bildkarten ab, um die Aufmerksamkeit der<br />
Kinder auf bestimmte Schlüsselwörter zu lenken, die später erinnert<br />
werden sollen.<br />
� Es folgt ein „Basisspiel“, in dem es um die Vermittlung der „Rehearsal-<br />
Strategie“ geht.<br />
� Trainer macht‟s vor und betont die Nützlichkeit – Kinder machen‟s nach<br />
� Mindestens ein „Übungspiel“ zur Festigung der Strategie<br />
� Aufgabentypen: In den Basis- und Übungsspielen kommen insgesamt 3<br />
Aufgabentypen zur Anwendung:<br />
1) „Reihenfolge-Aufgaben“ (serielle Reproduktion)<br />
2) „Ketten-Aufgaben“ (serielle Reproduktion bei zunehmender Itemzahl)<br />
3) „Paar-Such-Aufgaben“ (Zuordnung vorher gelernter Items zu einer Reihe von<br />
Items)<br />
� Evaluation:<br />
� Der Anspruch, durch die Optimierung des KZG L-R-Schwierigkeiten<br />
vorzubeugen, kann nicht eingelöst werden.<br />
� Zwar lernen die Kinder die Anwendung der Rehearsal-Strategie, die Effizienz<br />
des KZG wird dadurch jedoch nicht gesteigert.<br />
� Fazit: Nur für jüngere Vorschulkinder geeignet, die die Rehearsal-Strategie noch<br />
nicht spontan verwenden.<br />
116
B) Training zum Textlernen (von Hasselhorn und Körkel)<br />
� Ziel: Kurzzeittraining für 6.-Klässler zur Verbesserung der Verstehens- und<br />
Behaltensleistungen beim Textlernen.<br />
� Inhalt/ Methode: Förderung von 4 Wissens- und Fertigkeitsbereichen, die als<br />
Voraussetzungen für effektives Textlernen betrachtet werden können.<br />
1) Verfügbarkeit und flexible Nutzung basaler Verstehens- und<br />
Behaltensstrategien<br />
� z.B. das Markieren wichtiger Texteinheiten, Exzerptieren, Generieren<br />
visueller Hilfsvorstellungen etc. etc.<br />
2) Aktive und spontane Verständniskontrolle des Gelesenen (anstelle einer<br />
Wort-für-Wort-Verarbeitung)<br />
3) Reflexives Klären auftretender Verständnisschwierigkeiten<br />
4) Planen und zieladaptives Regulieren des Textlernens<br />
� Durchführung: 5 Sitzungen a 90 Minuten<br />
� Ablauf: Training unterteilt sich in 3 Phasen<br />
� Phase I: Anhand einfacher Texte werden grundlegende Fertigkeiten<br />
vermittelt und eingeübt: z.B. das Unterstreichen wichtiger Sätze, die<br />
Antizipation möglicher Textinhalte anhand der Überschrift, das Anfertigen<br />
zusammenfassender Notizen, die regelmäßige Überprüfung des eigenen<br />
Textverständnisses etc.<br />
� Methode: Die Vermittlung dieser Strategien erfolgt direkt und explizit; ihre<br />
Einübung erfolgt mittels schrittweiser verbaler Selbstinstruktion und im<br />
Rahmen variierender Aufgabenstellungen.<br />
� Phase II: Anhand von Texten, in denen spezifische Schwierigkeiten auftreten<br />
(z.B. logische Widersprüche, unbekannte Wörter, inhaltliche Sprünge) wird ein<br />
reflexiver und lösungsorientierter Umgang mit Verständnisproblemen<br />
eingeübt.<br />
� Die zu lernende Strategie besteht dabei aus 4 Schritten:<br />
a) Identifikation und Lokalisierung des Problems, b) Sammlung möglicher<br />
Lösungswege, c) Entscheidung für den erfolgversprechendsten<br />
Lösungsweg und dessen Umsetzung d) Klärung, inwiefern das<br />
Verständnisproblem dadurch behoben werden konnte.<br />
� Übungsmethode: verbale Selbstinstruktion<br />
� Phase III: Zusammenfassung aller zuvor trainierten Fertigkeiten zu einer<br />
verallgemeinerbaren Heuristik, die die Schüler erneut erproben.<br />
� Evaluation:<br />
� Training verbessert sowohl die metakognitiv-strategischen Fertigkeiten als<br />
auch die Behaltens- und Verstehensleitung beim Textlernen.<br />
� Die Anwendung der darin vermittelten Strategien ist besonders effektiv, wenn<br />
nur wenige Vorkenntnisse zu einem Text bestehen.<br />
C) „Reciprocal Teaching“ (Brown)<br />
� Ziel: Das Programm wurde ursprünglich für die Förderung des Textverständnisses<br />
und der selbständigen Verstehenskontrolle konzipiert, ist mittlerweile aber auch auf<br />
andere Bereiche (mathematisches Denken im Grundschulalter etc.) übertragen<br />
worden.<br />
� Inhalt der Textlern-Version: Vermittlung von 4 Strategien:<br />
1) Das Zusammenfassen wesentlicher Inhalte<br />
2) Das Formulieren verstehensbezogener Fragen an den Text<br />
3) Die Vorhersage weiterer Textinhalte<br />
4) Die Klärung von Mehrdeutigkeiten<br />
117
� Methode: Die Vermittlung dieser Strategien erfolgt nach dem Prinzip des<br />
entdeckenden Lernens in einer Art sokratischem Dialog.<br />
� Ablauf (Instruktionsprinzpien):<br />
� Trainer demonstriert die zu lernende Strategie – und zwar möglichst deutlich<br />
und in angemessenen inhaltlichen Kontexten<br />
� Trainer informiert über die Möglichkeiten und Grenzen der Strategie und<br />
betont ihren Nutzen<br />
� Schrittweise und selbständige Übernahme der Strategien durch die<br />
Trainingsteilnehmer<br />
� Trainer gibt adäquate, dem Kompetenzniveau des jew. Teilnehmers angepasste<br />
Rückmeldung<br />
� Durchführung: ca. 20 Sitzungen à 25 Minuten, in Kleingruppen oder dem<br />
Klassenverband durchführbar<br />
� Trainingsmaterial: Sammlung von über 100 Textabschnitten<br />
� Evaluation: Training führt zu beachtlichen Leistungssteigerungen in standardisierten<br />
Leseverständnistests<br />
D) Textlern-Training von Paris und Jacobs<br />
� Ziel: Steigerung des metakognitiven Wissens über Lesestrategien und Förderung<br />
der Lesekompetenz bei 8- bis 11-Jährigen.<br />
� Methode (Instruktionselemente):<br />
� Explizite und direkte Vermittlung strategischen Wissens zum Textlernen und<br />
-verstehen<br />
� Die Lesestrategien werden durch bildlich dargestellte Metaphern illustriert<br />
(z.B. Detektivbild mit der Aufschrift: „Sei ein Textdetektiv“)<br />
� Die verschiedenen Strategien werden im Klassenverband diskutiert<br />
(Gruppendiskussion)<br />
� Einübung der Strategien und Rückmeldung<br />
� Verwendung möglichst unterschiedlicher Textbeispiele (zwecks<br />
Generalisierung)<br />
� Durchführung: 20 Module, die jew. Aus 3 halbstündigen Einheiten bestehen<br />
� Evaluation: Trainierte Kinder haben a) mehr Wissen über mögliche Lesestrategien,<br />
geben b) an, sie häufiger zu gebrauchen und zeigen c) bessere Leistungen in<br />
verschiedenen Lesetests und Textlernaufgaben.<br />
E) „Wir werden Textdetektive“ (Gold)<br />
� Ziel: Systematische Vermittlung von Lesestrategien im Rahmen des regulären<br />
Deutschunterrichts<br />
� Inhalte: Vermittelt werden kognitive und metakognitive Lesestrategien<br />
(„Detektivmethoden“); darüber hinaus enthält das Programm jew. einen Baustein zur<br />
kognitiven und motivationalen Selbstregulation<br />
� Kognitive Strategien:<br />
� Verknüpfende (elaborative) Strategien: Beachtung der Überschrift (und<br />
darauf aufbauend: Antizipation des Inhalts), Generierung bildlicher<br />
Vorstellungen<br />
� Ordnende (reduktive) Strategien: Wichtiges unterstreichen und Wichtiges<br />
zusammenfassen<br />
� Wiederholende Strategien: Mehrmaliges Lesen<br />
� Metakognitive Strategien:<br />
� Verstehen überprüfen; Behalten überprüfen; Umgang mit<br />
Textschwierigkeiten<br />
118
� Kognitive Selbstregulation:<br />
� Mittel-Ziel-Überlegungen: Wann sind welche Lesestrategien anzuwenden?<br />
� Leseplan: Festlegung des Leseziels � Festlegung und Auswahl der<br />
Lesestrategien � Bewertung des Ergebnisses<br />
� Motivationale Selbstregulation:<br />
� Ringwurfspiel (à la Atkinson) => Schulung einer realistischen Zielsetzung<br />
und Förderung eines günstigen Attributionsstils<br />
� Methode (Instruktionselemente): Explizit-darstellende Vermittlung der Lesestrategien;<br />
Erklärung des Nutzens und der Anwendungsbedingungen von Strategien; modellhafte<br />
Demonstration der kompetenten Strategieanwendung durch die Lehrperson und<br />
Verbalisierung der begleitenden Überlegungen; angeleitetes, später zunehmend<br />
selbstständiges Einüben der Strategieanwendung<br />
� Durchführung: für 5.Klässler gedacht; Einsatz im regulären Deutschunterricht (es liegt<br />
aber auch eine Version für lernschwache Kinder vor)<br />
� Evaluation: zeigt gute Ergebnisse<br />
4. Zusammenfassende Bewertung der Trainingsprogramme<br />
� Kurzfristige Trainingswirkungen lassen sich für nahezu alle Trainingsprogramme<br />
belegen (Pretest-Posttest-Untersuchungen); zu den langfristigen Effekten der<br />
Programme liegen bis dato jedoch kaum Befunde vor.<br />
� Die Generalisierungseffekte der Programme scheinen eher begrenzt zu sein, was sich<br />
daran zeigt, dass sich die Leistung trainierter Kinder zwar in trainingsnahen Aufgaben<br />
verbessert (proximaler Transfer), eine Verbesserung bei trainingsferneren Aufgaben<br />
wie standardisierten Leseverständnistests (distaler Transfer) aber eher selten ist.<br />
� Interindividuelle Differenzen in der Trainingseffektivität: Nicht alle Kinder<br />
profitieren von einem Training gleichermaßen und in gleicher Weise; dabei gilt, dass<br />
die Unterschiede umso größer ausfallen, je größer die Distanz zw. den<br />
Trainingsinhalten und der zur Effektivitätsanalyse verwendeten Prüfungsaufgabe ist<br />
(distaler Transfer)<br />
� Bei vielen Trainingsprogrammen gilt das „Matthäus-Prinzip“: Je besser die<br />
Eingangsvoraussetzungen der Kinder, desto wirksamer das Training! Was die<br />
metakognitiven Ausgangskompetenzen betrifft, konnte dieser Effekt zwar für<br />
die Trainings zum Textlernen ausgeschlossen werden, im Hinblick auf andere<br />
Ausgangskomptenzen kann er jedoch durchaus auftreten.<br />
� Metakognitives Training kann auch zu unerwünschten Nebeneffekten führen. So<br />
kann es z.B. sein, dass vorhandene Lernroutinen durch das Training deautomatisiert<br />
werden, während die neuen Strategien ungewohnt bleiben und dementsprechend ein<br />
hohes Maß an kognitiver Kapazität erfordern (mögliche Erklärung für ausbleibende<br />
Transfereffekte).<br />
� 3 Arten von Strategiedefiziten bei Kindern können unterschieden werden (siehe D 2):<br />
1) Mediationsdefizit: Strategien können auch nach Vermittlung und Training<br />
nicht angewandt werden, da die nötigen Voraussetzungen fehlen<br />
� bei jüngeren Kindergartenkindern<br />
2) Produktionsdefizit: Strategien werden auch nicht spontan angewandt, können<br />
aber nach Vermittlung und Training gewinnbringend genutzt werden.<br />
� Vorschulalter / Schulanfänger<br />
3) Nutzungsdefizit: Strategien werden spontan angewandt, führen aber nicht zu<br />
einer Leistungsverbesserung<br />
� betrifft v. a. Kinder unter 7, oft aber auch ältere Kinder<br />
� Erklärung: Sind die neuen Strategien noch nicht automatisiert, schlucken<br />
sie zuviel Kapazität, um noch einen Nutzen zu bringen.<br />
119
� Einige Konsequenzen:<br />
� Trainingsprogramme sollten möglichst stark individualisieren<br />
(Gruppentrainings daher zweifelhaft)<br />
� Die Strategien dürfen nicht nur theoretisch vermittelt, sondern müssen zwecks<br />
Automatisierung auch hinreichend geübt werden.<br />
� Verwendung variierender Aufgaben, um Generalisierung zu begünstigen<br />
� Berücksichtigung motivationaler Aspekte<br />
5. Klauers Trainingsprogramme zum induktiven Denken<br />
� Theoretischer Hintergrund des Programms:<br />
� Klauers Trainingsprogramme beruhen auf der Theorie des paradigmatischen<br />
Transfers. D.h.: Es sollen v. a. solche Lösungsprozeduren vermittelt werden,<br />
die auf eine möglichst große Anzahl von Problemen angewandt werden<br />
können und auf diese Weise einen breiten Transfer ermöglichen.<br />
� Erfüllt wird dieses Kriterium von Prozessen induktiven Denkens, die<br />
nicht umsonst zum Kernbestand aller Intelligenzmodelle gehören.<br />
� Induktives Denken ist die Ableitung von Regelmäßigkeiten aus konkreten<br />
Beobachtungen. Klauer unterscheidet 3 Facetten bzw. Dimensionen<br />
induktiven Denkens:<br />
1) Anstellen von Vergleichsprozessen zur Feststellung von Gleichheit,<br />
Verschiedenheit oder – bei gleichzeitiger Betrachtung mehrerer Aspekte<br />
– Gleichheit und Verschiedenheit<br />
2) Verglichen werden können Merkmale oder Relationen<br />
3) Materialer Aspekt: Verglichen werden kann verbales, bildhaftes,<br />
geometrisch-figurales oder sonstiges Material.<br />
� Vor diesem Hintergrund lässt sich induktives Denken definieren als das<br />
Entdecken von Gleichheit, Ungleichheit oder Gleichheit und Ungleichheit<br />
bei Merkmalen und Beziehungen unterschiedlichen Materials.<br />
� Sofern damit genau festgelegt ist, welche Operationen zum induktiven<br />
Denken gehören und welche nicht, handelt es dabei um eine präskriptive<br />
Definition.<br />
� Anhand der ersten beiden Dimensionen lassen sich 6 Formen induktiven<br />
Denkens (und damit 6 für das induktive Denken relevante Aufgabentypen)<br />
unterscheiden:<br />
Festzustellen ist… Aufgabenklasse .<br />
1. Gleichheit von Merkmalen Generalisierung<br />
2. Verschiedenheit von Merkmalen Diskrimination<br />
3. Gleichheit und<br />
Verschiedenheit<br />
von Merkmalen Kreuzklassifikation<br />
4. Gleichheit von Relationen Beziehungserfassung<br />
5. Verschiedenheit von Relationen Beziehungsunterscheidung<br />
6. Gleichheit und<br />
Verschiedenheit<br />
von Relationen Systembildung<br />
� Klauers Training zum induktiven Denken liegt in 3 Versionen vor:<br />
� Denktraining für Kinder I (für Kinder zw. 5 und 8 Jahren)<br />
� Denktraining für Kinder II (für Kinder zw. 10 und 13 Jahren)<br />
� Denktraining für Jugendliche (leistungsschwache Jugendliche zw. 14 und 17)<br />
� Allen 3 Versionen liegt dasselbe Grundkonzept zugrunde: In 10 Trainingssitzungen<br />
zu je 45 Minuten werden insgesamt 120 Aufgaben behandelt, die sich zu gleichen<br />
120
Teilen auf die 6 oben genannten Aufgabentypen verteilen (20 pro Aufgabenklasse);<br />
auch die vermittelten Lösungsschemata sind dieselben.<br />
� Unterschiede bestehen lediglich bezüglich der Inhalte und Schwierigkeitsgrade<br />
der Aufgaben. Im Denktraining für Kinder I wird primär mit Bauklötzen und<br />
Bildern gearbeitet, in den beiden anderen neben figuralem auch mit verbalem<br />
und numerischem Material. Die schwierigsten Aufgaben enthält das<br />
Denktraining für Kinder II.<br />
� Durchführung: als Einzel-, Paar- oder Gruppentraining<br />
� Beim jüngeren Kindern ist Einzel- oder Paartraining besser (intensivere<br />
Betreuung), bei älteren Kindern und Jugendlichen dagegen Gruppentraining<br />
(Diskussion)<br />
� Methoden:<br />
� Die Instruktion soll nach dem Prinzip des „gelenkten Entdecken Lassens“<br />
erfolgen; der Trainer sollte sich also einerseits zurückhalten, andererseits den<br />
Lösungsprozess durch gezielte Fragen unterstützen.<br />
� V. a. leistungsstarke Schüler sollen zum „Verbalisieren“ (lautes Denken) und<br />
zur „Selbstreflexion“ (nachträgliches Kommentieren des eigenen Vorgehens)<br />
angehalten werden, für Schüler mit Lernschwierigkeiten empfiehlt Klauer die<br />
Methode der „verbalen Selbstinstruktion“<br />
� Aufgabentypen:<br />
1) Generalisierung:<br />
� Klassenbildung (Suche nach einem Merkmal, das mehrere Objekte<br />
gemeinsam haben)<br />
� Ergänzung von Klassen (Benennung eines Objekts, das zu einer bereits<br />
gebildeten Klasse gehört)<br />
� Gemeinsamkeiten finden (Identifikation gemeinsamer Merkmale<br />
vorgegebener Objekte)<br />
2) Diskrimination:<br />
� Unpassendes Herausstreichen (was passt nicht in die Reihe?)<br />
3) Kreuzklassifikation:<br />
� Systematisierung vorgegebener Objekte anhand relevanter Merkmale<br />
(geschieht durch Eintragung in vorgegebene Tabellen)<br />
4) Beziehungserfassung:<br />
� Folgen ordnen (Objekte sind anhand ihrer Beziehungen zueinander in eine<br />
sinnvolle Abfolge zu bringen, z.B. der Größe nach oder chronologisch)<br />
� Folgen ergänzen (Fortsetzung einer Folge bzw. Einordnung eines neuen<br />
Objekts)<br />
� Einfache Analogie<br />
5) Beziehungsunterscheidung:<br />
� Vorgabe falscher Folgen, die entweder durch Umstellung oder durch das<br />
Herausstreichen eines Objekts richtig gestellt werden sollen<br />
6) Systembildung:<br />
� Vollständige Analogie (Vier Objekte sind durch 2 Relationen miteinander<br />
verbunden)<br />
� Matrize (Erweiterung der vollständigen Analogie auf 6 oder 9 Objekte)<br />
� Ablauf: Pro Sitzung werden 12 Aufgaben bearbeitet.<br />
� 1. Sitzung: Bearbeitung der Aufgaben, ohne auf den Lösungsweg oder die<br />
Aufgabenart einzugehen<br />
� Hinführender Teil zur Motivierung und um mit Material vertraut zu<br />
werden<br />
121
� 2./3./4. Sitzung: Kinder lernen die verschiedenen Aufgabenklassen kennen<br />
und unterscheiden<br />
� 5./6./7. Sitzung: Erarbeitung von Lösungsschemata für die verschiedenen<br />
Aufgabenklassen, wobei jede Aufgabe vor der Bearbeitung einer der sechs<br />
Klassen zuzuordnen ist<br />
� 8./9./10. Sitzung: Einübung und Festigung des vorher Erarbeiteten in<br />
verschiedenen Zusammenhängen<br />
� Evaluation: kann sich auf sehr breite Datenbasis stützen<br />
� Bereichsspezifische Wirksamkeit des Trainings: Hohe Transfereffekte des<br />
Denktrainings auf IQ-Tests mit induktiven Aufgaben; allerdings<br />
verhältnismäßig große Streuung<br />
� Letzteres kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass die<br />
Wirksamkeit von den Durchführungsbedingungen des Trainings abhängt.<br />
� Der (distale) Transfer auf schulisches Lernen und Problemlösefähigkeit:<br />
war überraschender Weise noch größer als der proximale Transfer auf IQ-<br />
Tests.<br />
� Mögliche Erklärung: IQ-Tests arbeiten mit sinnarmen Material,<br />
schulische Aufgaben dagegen genau wie die Trainingsaufgaben mit<br />
sinnvollem Material.<br />
� Am größten war der Effekt auf schulisches Lernen in der Sonderschule!<br />
� Nachhaltigkeit der Trainingseffekte: Tests nach 6 Monaten zeigen, dass die<br />
Kompetenzsteigerungen durch das Training relativ stabil sind; eine weitere<br />
Optimierung der Nachhaltigkeit ist durch Auffrischungssitzungen zu<br />
erreichen.<br />
� Fazit: Hervorragendes Training (sowohl was die theoretische Fundierung, als auch<br />
was die praktische Wirksamkeit betrifft):<br />
� Verbessert induktives Denken<br />
� Verbessert schulisches Lernen und Problemlöseleistungen<br />
� Und: beide Effekte sind längerfristig und stabil!<br />
122
C 3: Interventionsprogramme bei Kindern und Jugendlichen<br />
1. Klinisch bedeutsame Aufmerksamkeitsstörungen<br />
� Klinisch bedeutsame Aufmerksamkeitsstörungen:<br />
� Das DSM-IV-TR differenziert zwischen 3 Arten von Aufmerksamkeits-/<br />
Hyperaktivitätsstörungen:<br />
1) Einem Störungstyp mit vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Störungsanteilen<br />
2) Einer vorwiegend durch Unaufmerksamkeit gekennzeichneten Störungsform<br />
3) Einem Mischtypus der Störung<br />
� Anders die ICD-10: Hier wird das Vorliegen von zusätzlicher motorischer<br />
Unruhe und Impulsivität als notwendiges Kriterium für die Diagnose „einfache<br />
Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung“ angesehen.<br />
� Epidemiologie:<br />
� ADHS ist keine kulturbedingte Störung: sie tritt nämlich nicht nur in den USA,<br />
Kanada und Europa, sondern auch in anderen Kulturkreisen auf!<br />
� DSM-IV-TR (2000) schätzt den Anteil der betroffenen Kinder auf 3-7%<br />
(Prävalenzrate), wobei Jungen wesentlich häufiger betroffen sind als Mädchen<br />
(das Verhältnis liegt zw. 2:1 und 9:1)<br />
� Ätiologie: nach Lauth & Schlottke, die ein integratives Bedingungsmodell der<br />
Störung vorschlagen<br />
� Neurobiologische Grundlage des Syndroms: ist eine Störung der<br />
zentralnervösen Aktivitätsregulation.<br />
� Aufgrund dieses Defizits können die Kinder ihre zentralnervöse Aktiviertheit<br />
(„geistige Wachheit“) nicht oder nur unzureichend auf die Anforderungen<br />
der jeweiligen Situation ausrichten, so dass es immer wieder zu Phasen der<br />
Über- und Unteraktivierung kommt.<br />
� Bedingt durch die Störung der Aktivitätsregulation kommt es zu<br />
Beeinträchtigungen der Verhaltensregulation:<br />
� Einschränkung der Daueraufmerksamkeit, mangelnde Impulskontrolle und<br />
Tendenz zu vermehrter Suche nach neuen Reizen => Impulsivität und<br />
Hyperaktivität<br />
� Ebenfalls beeinträchtigt ist die Fähigkeit zur Handlungsorganisation:<br />
� Kinder führen nur unvollständige Problem- und Zielanalysen durch, prüfen<br />
selten alternative Lösungsmöglichkeiten und sind kaum dazu in der Lage, ihr<br />
Verhalten strategisch zu planen.<br />
� Es fehlt an metakognitivem Wissen:<br />
� Vorerfahrungen werden nicht berücksichtigt etc. etc.<br />
� Es bestehen Schwierigkeiten bei der Begriffsbildung und abstrakten<br />
Denkoperationen<br />
� Zur Verfestigung dieser Auffälligkeiten trägt v. a. das soziale Umfeld bei:<br />
Schlechte Modelle, Misserfolgserlebnisse und Sanktionen, soziale Isolation in<br />
der Gruppe der Peers etc. führen zu Vermeidungsverhalten, negativen<br />
Emotionen etc. (ein Teufelskreis!)<br />
2. Interventionsmöglichkeiten bei Aufmerksamkeitsstörungen<br />
� Das oben genannte Modell verdeutlicht, dass Interventionen bei Aufmerksamkeits-<br />
Hyperaktivitätsstörungen auf verschiedenen Ebenen ansetzen können:<br />
� Verbesserung der Selbstregulationskompetenzen des Kindes<br />
� Schulung der direkten Bezugspersonen des Kindes<br />
� Medikamentöse Behandlung der neurobiologischen Störungsgrundlagen<br />
� Sollte auf Fälle mit besonders krisenhafter Entwicklung beschränkt bleiben.<br />
123
� Grundsätzlich gilt, dass die Heterogenität des Störungsbilds ein stark<br />
individualisiertes Vorgehen notwendig macht.<br />
� Einzelne Elemente einer aufmersamkeitsfördernden Intervention sind dabei:<br />
1. Geeignete Situationsgestaltung (meint die Sicherstellung klar strukturierter<br />
Rahmenbedingungen)<br />
� Räumliche Gestaltung der Lernumgebung (Spielsachen weg vom<br />
Schreibtisch etc.)<br />
� Inhaltliche und optische Gestaltung der Lern- und Unterrichtsmaterialien<br />
(Einteilung längerer Aufgaben in kürzere Abschnitte etc.)<br />
� Aufstellung verbindlicher Regeln (lieber wenige und dafür klar und sachlich<br />
formuliert sowie konsequent sanktioniert)<br />
� Einführung von Routinen und Ritualen<br />
2. Förderung grundlegender Operatoren<br />
� Da aufmerksamkeitsgestörte Kinder häufig Defizite in der<br />
Informationsverarbeitung aufweisen, sollte die Intervention damit beginnen,<br />
diesbezüglich grundlegende Kompetenzen zu vermitteln.<br />
� Anhand aufmerksamkeitsrelevanter Aufgaben (z.B. Zuordnungs- oder<br />
Vergleichsaufgaben) gilt es, „genaues Hinschauen und Hinhören“ zu<br />
trainieren. Wichtig ist dabei, das geforderte Vorgehen vorher genau zu<br />
demonstrieren (der Trainer als Modell)<br />
3. Förderung der Selbstregulationskompetenzen<br />
� Zu diesem Zweck werden Kinder zu verbalen Selbstanweisungen angehalten;<br />
mittels derer sie sich z.B. vor der Bekanntgabe einer Lösung laut zum<br />
Innehalten auffordern sollen („Halt-Stopp-Überprüfen!“); unterstützt<br />
werden kann dieser Prozess durch passende Signalkarten (z.B. „Kind mit<br />
Stoppschild“).<br />
4. Förderung der Handlungsorganisation und des metakognitiven Wissens<br />
� Fertigkeiten zur Handlungsplanung und –steuerung werden ebenfalls mit<br />
Hilfe der verbalen Selbstinstruktion trainiert („Ich mache mir einen Plan!“;<br />
„Was ist mein Ziel?“; „Ich fange jetzt an!“ etc.)<br />
5. Eltern als Mediatoren<br />
� Eltern sind einerseits über das Störungsbild (mögliche Ursachen, Symptome<br />
etc.) aufzuklären, andererseits mit entsprechendem Handlungswissen<br />
auszustatten; sie sollen also zu einem adäquaten und förderlichen Umgang<br />
mit ihren Kindern angeleitet werden.<br />
6. Schulzentrierte Förderung in der Großgruppe<br />
� Strukturierende Maßnahmen zur Organisation des Lehrstoffs und operante<br />
Verfahren (Token-Programme etc.) zur Lenkung des Schülerverhaltens; bei<br />
leichten Fällen sind solche schulischen Interventionen oft ausreichend, bei<br />
schweren sollten sie parallel zur psychologischen Intervention erfolgen.<br />
7. Aufmerksamkeitsförderung im Kindergarten<br />
� Strukturierende Maßnahmen, operante Verfahren<br />
� Frühe Maßnahmen wirken oft präventiv!<br />
3. Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem<br />
Problemverhalten (THOP)<br />
� Das THOP ist für Kinder zw. 3 und 12 Jahren konzipiert; es behandelt zwei<br />
Störungsformen, nämlich einerseits hyperkinetisches und andererseits oppositionelles<br />
Problemverhalten; diese Störungen können sowohl einzeln als auch gemeinsam<br />
auftreten.<br />
124
� Hyperkinetische Störungen: sind durch 3 Kernsymptome gekennzeichnet<br />
a) Störungen der Aufmerksamkeit<br />
- Schlechte Schulleistungen, vorzeitiger Abbruch oder unordentliche<br />
Erledigung mental anstrengender Aufgaben, Flüchtigkeitsfehler etc.<br />
b) Impulsivität<br />
- unüberlegtes und plötzliches Handeln, mangelnder Bedürfnisaufschub<br />
etc.<br />
c) Hyperaktivität<br />
- exzessive motorische Aktivität (Herumkaspern im Klassenzimmer,<br />
vom Essenstisch aufspringen etc.)<br />
� Oppositionelle Verhaltensstörung:<br />
� gekennzeichnet durch ein trotziges, ungehorsames und feindseliges<br />
Verhaltensmuster gegenüber Autoritätspersonen; außerdem: extreme<br />
Reizbarkeit, Wutausbrüche etc.<br />
� Diagnostik: Die Eingangsdiagnostik nimmt die ersten 3 bis 5 Sitzungen in Anspruch<br />
und bildet die Grundlage für das weitere Vorgehen (Festlegung der Therapieziele)<br />
� Psycho-, Verhaltens- und Interaktionsdiagnostik: dient der Feststellung der<br />
Verhaltensauffälligkeiten und emotionalen Auffälligkeiten des Kindes<br />
� Intelligenz- und Leistungsdiagnostik<br />
� Familiendiagnostik: Beziehungen und Interaktionsmuster innerhalb der Familie<br />
� Durchführung: Zwischen 10 und 40 wöchentliche Therapiesitzungen (à 50-60<br />
Minuten); evtl. Nachbehandlung in größeren Abständen<br />
� Methode: Verhaltenstherapeutisches Programm, das sowohl kind- als auch<br />
familienzentrierten Interventionen enthält.<br />
� Kindzentrierte Interventionen: setzten direkt beim Kind an (z.B.:<br />
Selbstinstruktionstraining; Spieltraining, Ärger-Kontroll-Training)<br />
� Familienzentrierte Interventionen: setzen bei den Interaktionsmustern<br />
innerhalb der Familie an und versuchen so, diejenigen Bedingungen zu ändern,<br />
die das auffällige Verhalten verstärken.<br />
� Ablauf: Der Ablauf der Intervention ist in 7 Stufen unterteilt, auf denen jeweils ein<br />
spezifisches Therapieziel im Mittelpunkt steht; den einzelnen Stufen entsprechen<br />
jeweils mehrere, flexibel einsetzbare Interventionsmaßnahmen bzw.<br />
Therapiebausteine.<br />
1) Problemdefinition, Entwicklung des Störungskonzeptes und<br />
Behandlungsplanung<br />
2) Förderung positiver Eltern-Kind-Interaktionen und einer guten Eltern-Kind-<br />
Beziehung<br />
3) Verminderung impulsiven und oppositionellen Verhaltens<br />
4) Spezielle operante Methoden (Punkte-Pläne, Auszeit etc.)<br />
5) Interventionen bei spezifischen Verhaltensproblemen (z.B. im Rahmen der<br />
Hausaufgabenerledigung)<br />
6) Stabilisierung der Effekte<br />
7) Ergänzende kindzentrierte Interventionen (evtl. medikamentöse Behandlung)<br />
� Aufbau: Das THOP besteht aus 2 parallel ablaufenden Teilprogrammen.<br />
1) Das Eltern-Kind-Programm: soll hyperkinetische und oppositionelle<br />
Verhaltensstörungen in der Familie vermindern<br />
2) Das Erzieher-Lehrer-Kind-Programm: soll hyperkinetische bzw. oppositionelle<br />
Verhaltensstörungen im Kindergarten und in der Schule vermindern<br />
125
� Beispiele für Therapiebausteine:<br />
� Elternleidfaden für wirkungsvolle Aufforderungen (gehört zu Stufe 3)<br />
� Regel 1: Stellen sie nur Aufforderungen, wenn sie bereit sind, sie auch<br />
durchzusetzen!<br />
� Regel 2: Verringern sie jegliche Ablenkung, bevor Sie eine Aufforderung<br />
geben!<br />
� Regel 3: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind aufmerksam ist, wenn sie eine<br />
Aufforderung geben!<br />
� Regel 4: Äußern Sie die Aufforderung eindeutig und nicht als Bitte!<br />
� Regel 5: Geben Sie immer nur eine Aufforderung!<br />
� Regel 6: Bitten Sie Ihr Kind, Ihre Aufforderung zu wiederholen!<br />
� Regel 7: Bleiben Sie in unmittelbarer Nähe des Kindes, um sicher zu gehen,<br />
dass Ihr Kind der Aufforderung nachkommt!<br />
� Regel 8: Konzentrieren Sie sich zunächst nur auf wenige Aufforderungen<br />
und protokollieren Sie Ihre Erfahrungen in einem Tagebuch!<br />
� Die kindzentrierten Interventionsmaßnahmen (z.B. Selbstinstruktionstraining)<br />
werden durch Geschichten aus dem Buch „Wackelpeter und Trotzkopf“<br />
eingeleitet, in denen die beiden Figuren von ihren eigenen Erfahrungen mit der<br />
jeweiligen Interventionsmaßnahme berichten und das Kind ermutigen, es auch<br />
mal zu versuchen.<br />
� Mögliche Probleme im Therapieverlauf: Schuldgefühle der Eltern,<br />
Partnerschaftsprobleme der Eltern, zu hoher Erwartungsdruck an die Therapie etc. etc.<br />
� Evaluation: Programm ist vielfach erprobt und hat sich in der Praxis bewährt!<br />
4. Training mit sozial unsicheren Kindern<br />
� Definition: Soziale Unsicherheit ist keine klar definierte Störung; sie weist jedoch<br />
Parallelen zu verschiedenen anderen Störungen auf: etwa zur Trennungsangst,<br />
Überängstlichkeit, sozialer Phobie oder dem elektiven Mutismus (andauernde<br />
Weigerung, in einer oder mehreren sozialen Situationen zu sprechen).<br />
� Sozial unsicheres Verhalten äußert sich sowohl auf verbaler, als auch<br />
nonverbaler Ebene:<br />
� Verbales Verhalten: Betroffene sind eher still, sprechen oft undeutlich oder<br />
stottern und sind oft außer Stande, Gefühle zu äußern etc.<br />
� Nonverbales Verhalten: Betroffene meiden Blickkontakt und soziale<br />
Anforderungssituationen generell, sind im sozialen Kontakt entweder<br />
apathisch oder zappelig etc.<br />
� Sozial unsicheres Verhalten kann dabei personen-, objekt- oder<br />
situationsspezifisch auftreten.<br />
� Epidemologie: Aufgrund der uneinheitlichen Definition sind valide Angaben zur<br />
Epidemologie nur bedingt möglich.<br />
� Sozialphobie.: 0,9%; Trennungsangst: 3,5% etc.<br />
� Schüchterne, zurückgezogene Schüler (nach Lehrerschätzungen): 24-35%<br />
� Ursachen: sind meist ungünstige Lernprozesse<br />
� Modellverhalten der Eltern<br />
� Operantes und klassisches Konditionieren (=> evtl. erlernte Hilflosigkeit)<br />
� Diagnostik: Systematische Verhaltensbeobachtung („Beobachtungsbogen für sozial<br />
unsicheres Verhalten“) + Elternexploration + Ausschluss biologischer Faktoren<br />
(z.B. Seh- und Hörschäden)<br />
� Therapeutischen Vorgehen (typische Interventionsprinzipien und –maßnahmen):<br />
� Modellernen (mit Videos) und Verhaltensübung<br />
126
� Verhaltensübung (in Rollenspielen oder „In-vivo-Übungen“) und Coaching<br />
(exakte Instruktionen, differenziertes Feedback, Fremd- und Selbstverstärkung)<br />
� Kognitive Ansätze: Selbstinstruktionstrainings, Aufbau eines positiven<br />
Selbstkonzepts etc.<br />
� Selbstsicherheitstrainings: kombinieren verschiedene Techniken<br />
� Kompakte Trainings: kombinieren verschiedene Interventionsmaßnahmen,<br />
verfolgen vielfältige und differenzierte Therapieziele und integrieren wichtige<br />
Bezugspersonen (Eltern, Lehrer etc.)<br />
� Ein Beispiel: Das Trainingsprogramm für sozial unsichere Vor- und<br />
Grundschulkinder von Petermann & Petermann (1992)<br />
� Das Programm richtet sich an sozial unsichere Vor- und Grundschulkinder,<br />
wobei bei der Durchführung zw. diesen beiden Altersgruppen zu differenzieren<br />
ist.<br />
� Ablauf: Das Programm setzt sich aus Einzelsitzungen, Gruppensitzungen und<br />
Elternsitzungen zusammen.<br />
� Aufbau: Einzel- und Gruppensitzungen sind dabei vergleichbar aufgebaut und<br />
enthalten verschiedene wiederkehrende Rituale (Konstanz schafft Vertrauen!):<br />
� Begonnen wird mit der Besprechung des sog. „Detektivbogens“<br />
(Selbstbeobachtungsinstrument); es folgt eine Entspannungsphase. Den<br />
Schwerpunkt bildet die materialgeleitete Arbeit (z.B. mit Videos oder<br />
Puppen)<br />
� Ziele und Methoden des Einzeltrainings:<br />
� Bewusstmachung von sozialer Angst und Unsicherheit<br />
� Sensibilisierung der Wahrnehmung für Interaktionsabläufe<br />
- Etwa indem Videos von sozialen Interaktionen gezeigt und analysiert<br />
werden oder indem anhand sparsam gezeichneter Gesichter<br />
(„Wolkenköpfe“) die Identifikation und Unterscheidung von Mimiken<br />
geübt wird.<br />
� Reflexion der eigenen Erwartungen an das Verhalten anderer<br />
� Reflexion der eigenen sozialen Ängste und Unsicherheiten<br />
- Selbstbeobachtung mit dem „Detektivbogen“<br />
� Entwicklung von Kriterien zur Beurteilung von Sozialverhalten<br />
� Entwicklung und Einübung von Verhaltensalternativen<br />
- Rollenspiele<br />
� Ziele und Methoden der Gruppentrainings:<br />
� Positive Gefühle und Fertigkeiten gegenüber anderen, vertrauten Personen<br />
zeigen; eigene Ansprüche durchsetzen und Ansprüche anderer erkennen;<br />
Kontaktaufnahme üben etc. etc.<br />
� Methode: meist Rollenspiele<br />
� Strukturierte Elternberatung: findet parallel statt und dient u. a. dazu, die<br />
Eltern in der Beobachtung ihres Kindes zu schulen, ihnen geeignete<br />
Handlungsstrategien an die Hand zu geben und sich mit ihnen über Fort- bzw.<br />
Rückschritte des Kindes auszutauschen.<br />
5. Training mit aggressiven Kindern<br />
� Aggression kann nach dem DSM-IV und ICD-10 klassifiziert werden als<br />
„oppositionelles Trotzverhalten“ oder „Störung des Sozialverhaltens“<br />
� Zur Definition; Diagnostik („Erfassungsbogen für aggressives Verhalten in<br />
konkreten Situationen“ / „Beobachtungsbogen für aggressives Verhalten“),<br />
Ursachen etc.: siehe B 7<br />
127
� Trainingsprogramm von Petermann und Petermann:<br />
� Aufbau: Einzelsitzungen, Gruppensitzungen sowie Elterntraining und –beratung<br />
� Ziele:<br />
� Abbau von hinderlichen Wahrnehmungsverzerrungen<br />
� Einübung angemessener Verhaltensalternativen (z.B. kooperatives Verhalten,<br />
konstruktive Formen der Selbstbehauptung und Konfliktlösung etc.)<br />
� Selbstkontrolle<br />
� Empathiefähigkeit etc.<br />
� Methoden:<br />
� Entspannungsverfahren (Kapitän-Nemo-Geschichte)<br />
� Rollenspiele<br />
� Detektivbogen<br />
� Token-Programm (siehe: B 5)<br />
� Modelllernen an Videos etc.<br />
� Weitere Interventionsprogramme:<br />
� Gewaltpräventionsprogramm von Olweus (richtet sich an Schulen)<br />
� Ärger-Kontroll-Training von Feindler<br />
� …<br />
128
C 4: Motivationsförderung<br />
1. Allgemeines (siehe auch: A 4)<br />
� Begriffsklärungen (s.o.):<br />
� Motivation: Aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf<br />
einen positiv bewerteten Zielzustand<br />
� Motiv: Relativ zeitstabile Bevorzugung bestimmter Klassen von Anreizen bzw.<br />
Zuständen.<br />
� Die grundlegenden Motive sind:<br />
- Das Anschlussmotiv (Ziel: Aufbau und Erhalt vertrauensvoller<br />
Sozialbeziehungen)<br />
- Das Machtmotiv (Ziel: Wirkung und Einflussnahme auf andere<br />
Personen)<br />
- Das Leistungsmotiv (Ziel: Leistung in Auseinandersetzung mit einem<br />
Gütemaßstab)<br />
� Motive sind individuell verschieden stark ausgeprägt; darüber hinaus können<br />
sie aufsuchend oder meidend sein (Hoffnung vs. Furcht)<br />
� Vorbemerkung: Leistungsmotivation ist kein normatives, sondern ein empirisches<br />
Konzept!! Dementsprechend geht es in Motivationstrainings nicht darum, etwas zu<br />
implementieren, das von bestimmten Instanzen (Lehrern etc.) als positives Ideal<br />
betrachtet wird, sondern darum, etwas zu fördern, was im Menschen angelegt ist.<br />
� Dass das Leistungsmotiv ein menschliches Essential ist, zeigt sich an den<br />
verschiedenen Phänomenen autonomer Kompetenzmotivation: Kinder, die<br />
versuchen, auf schmalen Mauern zu balancieren etc. etc.<br />
� Die „Funktionslust“ (Bühler) bzw. „effectance motivation“ (White) des<br />
Menschen ist evolutionsbiologisch gesehen hoch adaptiv und hat daher<br />
vermutlich neurophysiologische Grundlagen.<br />
� Zur Ontogenese des Leistungsmotivs:<br />
� 2,5 – 3 Jahre: Aufbau von Gütemaßstäben (individuell, sachlich, sozial),<br />
anhand derer die Resultate des eigenen Handelns als Erfolg bzw. Misserfolg<br />
gewertet werden können; parallel dazu lernen Kinder, sich selbst als Urheber<br />
ihrer Handlungen zu verstehen (Selbstverantwortlichkeit)<br />
� Eine gesunde Entwicklung der Leistungsmotivsmotivation zeichnet sich<br />
durch folgende Merkmale aus:<br />
- Präferenz für mittelschwere Aufgaben (sofern diese den höchsten<br />
Informationswert haben)<br />
- Tendenz, die eigenen Leistungen an individuellen Gütestandards zu<br />
messen<br />
- Selbstwertstützender Attributionsstil<br />
- Erleben von Selbstverantwortlichkeit<br />
129
2. Das Harvard-Motivtrainingsprogramm von McClelland<br />
� Das erste Motivationstraining ist das Harvard-Motivtrainingsprogramm von<br />
McClelland (60er Jahre). Das Programm zielt auf eine Veränderung des<br />
Motivsystems und steht damit eigentlich in Diskrepanz zu McClellands theoretischen<br />
Grundannahmen (Theorie � Praxis).<br />
� McClelland beschreibt Motive nämlich als assoziative Netzwerke, die bereits in<br />
frühkindlicher Zeit erworben werden und überaus stabil sind. Aktiviert werden<br />
die Netzwerke durch Hinweisreize, die je nach Lerngeschichte und individueller<br />
Veranlagung positive oder negative Affekte (Hoffnung vs. Furcht) auslösen.<br />
� Drei funktional voneinander unabhängige Motive lassen sich dabei<br />
unterscheiden:<br />
A) Das Anschlussmotiv<br />
B) Das Machtmotiv<br />
C) Das Leistungsmotiv<br />
� Diese 3 Motive sind evolutionsbiologisch bedingt und daher universell; es<br />
bestehen jedoch interindividuelle Unterschiede bezüglich ihrer Ausprägung<br />
sowie ihrer Stellung im Gesamtgefüge der Motive.<br />
� Diese Unterschiede sind a) bedingt durch unterschiedliche<br />
Lerngeschichten und b) durch generelle neurohormonelle Unterschiede<br />
(Veranlagung).<br />
� Messen lassen sich die interindividuellen Unterschiede im Motivsystem<br />
mit dem Thematischen Apperzeptionstest (TAT).<br />
� Das Leistungsmotiv beschreibt McClelland als hedonistisch verankerten<br />
Selbstoptimierungsmechanismus!<br />
� Fazit: McClellands Theorie zufolge sind Motive eigentlich völlig ungeeignet,<br />
durch kurzfristige Trainings beeinflusst zu werden (frühe, vorsprachliche<br />
Ausbildung, unbewusst, teilweise genetisch bedingt). Trotzdem setzt das von ihm<br />
entwickelte Programm genau dort an.<br />
� Das Harvard-Motivtraining wurde ursprünglich für Manager und Unternehmer<br />
konzipiert, ist aber, entsprechend abgewandelt, auch bei Schülern eingesetzt worden.<br />
In Coachingprogrammen für Manager, Parteien etc. wird es in erweiterter Form noch<br />
heute angeboten.<br />
� Durchführung: In dem sehr aufwendigen Ursprungsprogramm wurden<br />
Führungskräfte über 2 Jahre betreut. Den Kern des Projekts bildete ein<br />
2wöchiger Intensivkurs.<br />
� Ziel war es, das Leistungsmotiv der Teilnehmer durch eine Verstärkung und<br />
Ausdehnung des entsprechenden Netzwerks zu steigern; zu diesem Zweck<br />
wurde z.B. versucht, möglichst viele Situationen an das leistungsmotivationale<br />
Affektsystem zu koppeln.<br />
� Methoden: Selbsterfahrungsübungen, Theorieerarbeitungen, Zielsetzungsübungen<br />
etc. etc.<br />
� Ergebnis: Die Teilnehmer des Trainingsprogramms waren danach wesentlich<br />
unternehmerischer als die Unternehmer einer Kontrollgruppe (sie tätigten z.B.<br />
mehr Investitionen, schufen mehr Arbeitsplätze, erlitten aber auch häufiger<br />
Konkurs)<br />
� Bei Anwendung im schulischen Kontext: unklare Effekte!<br />
� McClelland selbst bezweifelte später, mit seinem Training die basalen Motivsysteme<br />
der Teilnehmer tatsächlich verändert zu haben. Stattdessen führte er die Effekte darauf<br />
zurück, dass die Teilnehmer lediglich Strategien („life management skills“) gelernt<br />
hätten, die für eine hohe Leistungsmotivation typisch sind: anspruchsvolle, aber<br />
realistische Zielsetzung, Einforderung von Feedback etc. etc.<br />
130
3. Das Selbstbewertungsmodell der Leistungsmotivation von Heckhausen (1972)<br />
� Auch wenn McClellands Überlegungen ihre Berechtigung haben und keineswegs<br />
überholt sind, stellt Heckhausens Modell eine wesentlich bessere Grundlage für<br />
Trainingsprogramme dar. Da es weniger grundsätzlich ist, eröffnet es nämlich gleich<br />
mehrere Möglichkeiten, auf die Leistungsmotivation einzuwirken.<br />
� Heckhausens Modell beschreibt das Leistungsmotiv nicht als Persönlichkeitsmerkmal,<br />
sondern als ein komplexes Selbstbewertungssystem.<br />
� Die Ausprägung des Leistungsmotivs hängt dabei von 3 sich gegenseitig<br />
stabilisierenden Teilprozessen ab:<br />
1. dem Anspruchsniveau bzw. der Zielsetzung<br />
2. dem präferierten Attributionsstil (von Erfolg und Misserfolg)<br />
3. der daraus resultierenden Selbstbewertung<br />
� Ausgehend davon kommt Heckhausen zu einer differenzierten Unterscheidung<br />
zwischen erfolgs- und misserfolgsmotivierten Personen:<br />
� Erfolgszuversichtliche Personen:<br />
� …zeichnen sich durch eine realistische Zielsetzung aus: Sie bevorzugen<br />
mittelschwere Aufgaben, also Aufgaben, die am meisten über ihre<br />
Leistungsfähigkeit aussagen<br />
� Die Folge ist ein positives Attributionsmuster; schließlich liegt es bei<br />
mittelschweren Aufgaben nahe, Erfolg auf Fähigkeit oder Anstrengung,<br />
Misserfolg dagegen auf Pech oder mangelnde Anstrengung<br />
zurückzuführen. Darüber hinaus werden Leistungsverbesserungen bei<br />
mittelschweren Aufgaben am ehesten sichtbar.<br />
� Die Folge ist eine ausgewogene bzw. positive Selbstbewertungsbilanz<br />
(Freude und Stolz nach Erfolg sind größer als die negativen Affekte nach<br />
Misserfolg � realistische Zielsetzung � … (ein „Engelskreis“)<br />
� Bei misserfolgsängstlichen Personen ist es umgekehrt:<br />
� Sie bevorzugen extrem leichte oder extrem schwere Aufgaben, da diese<br />
am wenigsten über ihr Leistungsniveau aussagen. Evtl.<br />
Kompetenzzuwächse bleiben ebenso verborgen.<br />
� Die Folge ist ein negatives Attributionsmuster: Erfolg wird auf externale<br />
Faktoren (wie Glück oder die Leichtigkeit der Aufgabe) zurückgeführt;<br />
Misserfolge dagegen auf mangelnde Fähigkeit<br />
� Die Folge ist eine asymmetrische bzw. negative Selbstbewertungsbilanz.<br />
Ein Erfolg bedeutet wenig, während Misserfolge als enorm belastend erlebt<br />
werden � unkluge Zielsetzung �… (ein Teufelskreis)<br />
� Mit Heckhausens kognitivem Modell der Leistungsmotivation (kognitive Wende) hat<br />
sich die Perspektive von Trainingsprogrammen grundlegend geändert: Anstatt zu<br />
versuchen, das Leistungsmotiv generell zu stärken (damit es in der Gesamthierarchie<br />
der Motive aufsteigt), konzentriert man sich heute darauf, die Richtung des<br />
Leistungsmotiv zu verändern: nämlich von misserfolgsängstlich zu<br />
erfolgszuversichtlich!<br />
� Zu diesem Zweck wird an den 3 Teilprozessen der Leistungsmotivation<br />
angesetzt: Es wird also versucht, den Teilnehmern a) zu einer realistischen<br />
Zielsetzung zu verhelfen, ihnen b) einen günstigen Attributionsstil<br />
anzugewöhnen und c) eine positive Selbstbewertungsbilanz zu fördern.<br />
� Pionierarbeit leisteten in diesem Zusammenhang Krug & Hanel (1976): s.u.<br />
131
4. Neuere Trainingsprogramme<br />
A) Außerschulisches Training<br />
� Krug und Hanel (1976) arbeiteten auf der Basis von Heckhausens Modell mit<br />
misserfolgsängstlichen und dementsprechend leistungsschwachen Viertklässlern.<br />
� Die Schüler wurden in 16 Sitzungen, die außerhalb des regulären Unterrichts<br />
stattfanden, darauf trainiert, sich realistische Ziele zu setzen, günstige<br />
Attributionen zu tätigen und zu einer positiven Selbstbewertungsbilanz zu<br />
kommen.<br />
� Um verfestigte Defensivstrategien zu vermeiden, wurde dabei zunächst mit<br />
schulfernem Material (Geschicklichkeitsspielen) gearbeitet; danach ging das<br />
Training jedoch zunehmend zu Material aus dem laufenden Unterricht<br />
über.<br />
� Der Trainer fungierte als Modellperson (äußerte laut die relevanten<br />
Kognitionen); auch die Schüler wurden dazu aufgefordert, ihre Kognitionen<br />
zu verbalisieren und dabei gegebenenfalls vom Trainer (oder Mitschülern)<br />
korrigiert; später: Übergang zum stummen Verbalisieren („internal<br />
speech“).<br />
� Ergebnisse: Es konnten nicht nur die 3 trainierten Prozesse im Sinne des<br />
Trainings verändert werden, sondern auch die Richtung des Leistungsmotivs,<br />
sprich: die Hoffnung auf Erfolg nahm zu, die Furcht vor Misserfolg dagegen ab.<br />
B) Unterrichtsintegriertes Training<br />
� Um einen besseren Transfer auf schulisches Lernen zu ermöglichen, versuchte man,<br />
Motivationstrainings direkt in den Unterricht zu integrieren.<br />
� In einem Projekt von DeCharms (1979) wurden Lehrer zu diesem Zweck<br />
zunächst in die Grundlagen der Motivationspsychologie eingeführt und darin<br />
trainiert, sich selbst als Urheber ihrer Handlungen zu erleben („origin training“);<br />
im Anschluss daran wurden sie aufgefordert, selbst Unterrichtsmaßnahmen zu<br />
entwickeln, mittels derer sie dieses Gefühl an ihre Schüler weitergeben können.<br />
� Ergebnis: Eines der wenigen Trainingsprogramme, bei denen es neben<br />
Motivationseffekten auch Leistungseffekte gab!<br />
� Rheinberg & Krug (1999) führten mit Fünftklässlern ein Motivationstraining<br />
im Klassenverband durch; dabei wurde den Schülern anhand von<br />
Geschicklichkeitsspielen zunächst der Zusammenhang zw. den 3 Teilprozessen<br />
beigebracht (Kurzform des Trainings von Krug & Hanel); anschließend: Rechen-<br />
und Schreibaufgaben, wobei die Schüler auf den Arbeitsblättern a) ihre<br />
individuelle Zielsetzung, b) den Grad der Zielerreichung, c) eine<br />
Ursachenerklärung und d) ihre Zufriedenheit mit dem Ergebnis festhalten<br />
sollten.<br />
� Ergebnis: Realistischere Zielsetzung; weniger Furcht vor Misserfolg, mehr<br />
Hoffnung auf Erfolg<br />
� Damit die 3 Teilprozesse der Leistungsmotivation im Unterricht effektiv trainiert<br />
werden können, müssen folgende Kriterien erfüllt sein:<br />
� Die verwendeten Aufgaben müssen ein eindeutiges Ergebnis haben.<br />
� Die verwendeten Aufgaben müssen eine deutliche Schwierigkeitsstaffelung<br />
aufweisen.<br />
� Die verwendeten Aufgaben müssen zumindest so vertraut sein, dass den<br />
Schülern eine Einschätzung des Schwierigkeitsgrades möglich ist.<br />
� Die Ergebnisse müssen zumindest teilweise von der aufgebrachten Anstrengung<br />
oder anderen kontrollierbaren Faktoren abhängen.<br />
132
� Die Lösung der Aufgaben sollte nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, damit<br />
der Zusammenhang zw. den 3 Teilprozessen für die Schüler erkennbar bleibt.<br />
� Am besten lassen sich diese Elemente im Sportunterricht verwirklichen; bei<br />
Fächern mit überwiegend kognitiven Inhalten sind die Kriterien am ehesten in<br />
Wiederholungs- und Übungsphasen realisierbar.<br />
C) Individuelle Bezugsnorm im Unterricht<br />
� Die Bezugsnormorientierung des Lehrers hat starken Einfluss auf die<br />
Leistungsmotivation der Schüler.<br />
� Eine individuelle Bezugsnormorientierung wirkt sich dabei v.a. aus 2 Gründen<br />
positiv aus:<br />
1) Gerät durch die individuelle Bezugsnormorientierung das Potenzial eines<br />
Schülers stärker in den Blick als seine Grenzen; Misserfolge werden<br />
dementsprechend eher auf variable Ursachen wie Anstrengung<br />
zurückgeführt als auf mangelnde Fähigkeit.<br />
2) Fördert die individuelle Bezugsnormorientierung eine realistische<br />
Zielsetzung; anstatt sich an den Klassenbesten zu messen, wird<br />
leistungsschwachen Schülern nahegelegt, sich an den eigenen Standards zu<br />
orientieren.<br />
� Die Forschung zur Bezugsnormorientierung wirkte sich sowohl auf die<br />
Motivationstrainings, als auch auf den Unterricht aus.<br />
� Neben den genannten Punkten vermitteln neuere Motivationstrainings, dass<br />
Zielsetzung und Selbstbewertung sich v. a. am individuellen Leistungsniveau<br />
orientieren sollten.<br />
� Darüber hinaus wird zunehmend versucht, Lehrer darin zu trainieren, die<br />
individuelle Bezugsnorm im Unterricht stärker zur Geltung zu bringen.<br />
� Stärkere Individualisierung des Unterrichts; wo möglich, Abstimmung<br />
der Aufgabenschwierigkeit auf die Voraussetzungen der Schüler; Lob und<br />
Notenvergabe sollten stärker vom Leistungsniveau abhängig gemacht<br />
werden etc. etc.<br />
D) Integrierte Förderung kognitiver und motivationaler Effekte<br />
� Motivationstrainings mit kognitiver Förderung zu verknüpfen, ist aus 2 Gründen<br />
sinnvoll:<br />
1) Sind die positiven Effekte von Motivationstrainings nur dann wirklich stabil,<br />
wenn sie mit größerem Lern- und Leistungserfolg einhergehen.<br />
2) Wird das Leistungsmotiv in Situationen, in denen es um eine Verbesserung der<br />
eigenen Kompetenzen geht, in besonderem Maße aktiviert.<br />
� 2 Beispiele für kombinierte Trainingsprogramme:<br />
� Rheinberg und Schliep (`85): Eine Gruppe von 11-14-jährigen mit ungünstigen<br />
Leistungsmotivkennwerten und ungewöhnlicher Rechtschreib-Schwäche wurden<br />
im Rahmen eines Rechtschreibtrainings (nach dem morphematischen Prinzip)<br />
zugleich bezüglich ihrer Leistungsmotivation gefördert.<br />
� Ergebnis: Das Programm zeigte sowohl günstige Effekte bezüglich der<br />
Rechtschreibkompetenzen als auch bezüglich des Leistungsmotivs<br />
� Fries, Lund und Rheinberg (1999): Anreicherung des Denktrainings II von<br />
Klauer mit Elementen des Motivationstrainings.<br />
� Ergebnis: Das integrierte Training erwies sich sowohl gegenüber dem<br />
reinen Denktraining, als auch gegenüber einer reinen Motivförderung als<br />
überlegen! Insbesondere die kognitiven Leistungszuwächse wurden durch<br />
die Kombination gesteigert; aber auch die Motivförderung konnte,<br />
zumindest bezüglich der Misserfolgskomponente, optimiert werden.<br />
133
E) Kombinierte Förderung von Selbstregulation (Volition) und Motivation<br />
� Motivationale Komponenten allein reichen nicht aus, um effektives Lernen zu<br />
ermöglichen; darüber hinaus bedarf es Kompetenzen, den eigenen Lernprozess zu<br />
regulieren.<br />
� Beispiele für Trainingsprogramme, in denen die Förderung motivationaler und<br />
volitionaler Komponenten miteinander kombiniert wird.<br />
� Training zur Förderung der Selbstregulationskompetenz v. Zimmermann:<br />
zielt darauf, durch die Vermittlung konkreter Lernstrategien die<br />
Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Zwar werden motivationale Komponenten dabei<br />
nicht direkt gefördert, sofern der Einsatz von Strategien die Selbstwirksamkeit<br />
(self efficacy) erhöht, wird die Leistungsmotivation jedoch zumindest indirekt<br />
gefördert. – So zumindest die Annahme; theoretische Befunde gibt es<br />
diesbezüglich bisher nicht!<br />
� Das Prozessmodell der Selbstregulation von Schmitz: kombiniert<br />
verschiedene Selbstregulations-, Volitions- und Motivationskonzepte. Um es zu<br />
evaluieren, wurden Studenten konkrete Maßnahmen zur Zielsetzung,<br />
Selbstüberwachung (Monitoring) und Bewertung vermittelt; zum Monitoring<br />
gehörte dabei die Führung eines Lerntagebuchs.<br />
� Ergebnis: Verbessertes Zeitmanagement und erhöhte Konzentration, aber<br />
kaum Einflüsse auf Motivationsvariablen.<br />
� „Mental Contrasting and Implementation Intentions“ (MCII, 2005): Das<br />
Modell kombiniert 2 Techniken: a) das mentale Kontrastieren des (als attraktiv<br />
ausgemalten) Zielzustandes mit dem gegenwärtigen, als unbefriedigend<br />
erfahrenen Zustand und b) die Formulierung konkreter Durchführungsvorsätze.<br />
Während die erste Technik zu realistischen und motivierenden<br />
Zielsetzungen anregt, dient die zweite Technik dazu, volitionale Prozesse zu<br />
unterstützen.<br />
� Noch ist dieses Programm im Schulkontext nicht erprobt worden; da es sich<br />
auf die Vermittlung effektiver Techniken beschränkt, anstatt in das<br />
Motivsystem als solches eingreifen zu wollen, ist es jedoch äußerst<br />
vielversprechend.<br />
5. Fazit:<br />
� Weitere Trainingsprogramme: Neben den besprochenen Trainingsprogrammen gibt es<br />
auch reine (Re-)Attributionstrainings; ein Modell, das die Förderung günstiger<br />
Attributionen mit weiteren Komponenten (wie z.B. der Vermittlung von<br />
Lernstrategien) verknüpft, ist das Münchner Motivationstraining; als effektiv haben<br />
sich außerdem Elterntrainings erwiesen!<br />
� Wichtig: Motivationsfördernde Maßnahmen im Unterricht dürfen sich keineswegs auf<br />
das Leistungsmotiv beschränken! Mindestens ebenso wichtig ist die Förderung des<br />
Interesses:<br />
� Emotionale Valenz des Unterrichtsgegenstands (ist nach Ryan und Deci<br />
abhängig davon, inwiefern die Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz<br />
und sozialer Eingebundenheit befriedigt werden): Ermöglichung von Autonomie<br />
und Kompetenzerfahrungen; kooperative Lernumgebung!<br />
� Wertbezogene Valenz (inhaltsspezifisch): Beteiligung der Schüler an der<br />
Themenwahl, Relevanz und Alltagsbezug des Stoffs, Spannende Aufgaben- und<br />
Fragenstellungen, ansprechendes Unterrichtsmaterial etc. etc.<br />
134
C 5: Ein Entspannungsverfahren für Kinder und Jugendliche<br />
1. Allgemeines zu Entspannungstechniken u. zur progressiven Muskelrelaxation<br />
� Entspannungsverfahren lassen sich anhand folgender Dimensionen unterscheiden:<br />
� Entspannungsinstruktion: selbstinstruktiv vs. fremdinstruktiv<br />
aktiv vs. passiv (suggestiv)<br />
� Entspannungsreaktion: physisch vs. psychisch<br />
� Bekannte Entspannungstechniken sind:<br />
� Bei Erwachsenen: Hypnose, Autogenes Training, Meditation, Biofeedback,<br />
progressive Muskelentspannung<br />
� Bei Kindern: Kapitän-Nemo-Geschichten, progressive Muskelentspannung<br />
� Indikation: v. a. bei Angst und Stress, aber auch bei Aggressionen, Schlafstörungen,<br />
Konzentrationsschwierigkeiten, Hyperaktivität etc. etc.<br />
� Die Technik der progressiven Muskelentspannung geht auf Jacobson (1929) zurück:<br />
� Das Verfahren wird fremdinstruktiv eingeübt; Ziel es jedoch, den Übenden dazu<br />
zu befähigen, sich selbstinstruktiv in den gewünschten Entspannungszustand zu<br />
versetzen.<br />
� Einzelne Muskelgruppen werden nacheinander angespannt – und dann wieder<br />
entspannt; das führt einerseits zu Wärme- und Schweresensationen, andererseits<br />
wird durch den Kontrasteffekt der Unterschied zw. An- und Entspannung<br />
verdeutlicht.<br />
� Im Fortgeschrittenenstadium soll man dazu in der Lage sein, die unnötig<br />
angespannten Muskelgruppen selbständig zu erkennen!<br />
� Da die Technik der progressiven Muskelrelaxation mittlerweile in verschiedensten<br />
Versionen vorliegt, ist es kaum möglich, globale Aussagen zur Effektivität des<br />
Verfahrens zu machen.<br />
� Insgesamt sind die Erfahrungen jedoch sehr positiv!<br />
2. Progressive Muskelentspannung mit Jugendlichen<br />
� Der Einsatz von Entspannungsverfahren bei Jugendlichen ist mit verschiedenen<br />
Problemen belastet:<br />
� Jugendliche (insbes. Jungen) haben häufig eine ablehnende Haltung gegenüber<br />
Entspannungsverfahren, da sie ihrem Selbstbild widersprechen.<br />
� Entspannung wird von ihnen mit Schwäche, Hilflosigkeit und Unterlegenheit<br />
assoziiert!<br />
� Aufgrund erhöhter Selbstaufmerksamkeit sind Jugendliche anfälliger für<br />
Schamgefühle als Kinder oder Erwachsene<br />
� Jugendliche nutzen Entspannungsverfahren häufig nicht zur aktiven<br />
Problembewältigung, sondern als Flucht- und Vermeidungsritual.<br />
� Bei Entspannungsverfahren mit Jugendlichen sollte daher folgendes beachtet werden:<br />
� Alter, Geschlecht, persönliche Entwicklung, Bezugsgruppe und Setting<br />
(Einzel- oder Gruppenverfahren) müssen berücksichtigt werden.<br />
� Verfahren sollten im Sitzen und nicht im Liegen durchgeführt werden.<br />
� Zwischen den Jugendlichen und dem Erwachsenen muss ein<br />
Vertrauensverhältnis bestehen.<br />
� Durch eine konkrete Beschreibung des Vorgehens und der Ziele muss<br />
Motivation aufgebaut werden.<br />
135
� Progressive Muskelentspannung ist für Jugendliche besonders geeignet, da<br />
körperbezogen, aktiv (und nicht suggestiv), gut erlernbar und schnell wirksam.<br />
� Effekte: weniger Aufregung, höhere Konzentrationsfähigkeit, Gefühl<br />
körperlicher Fitness<br />
� Einsatz: z.B. im Anschluss an eine sportliche Aktivität<br />
� Für Jugendliche liegt eine Kurzform der progressiven Muskelentspannung vor, die<br />
sich auf die Relaxation von 10 Muskelgruppen beschränkt und ca. 15 bis 20 Minuten<br />
dauert.<br />
� Sitzhaltung einnehmen und Augen schließen<br />
� An- und (plötzliche) Entspannung der einzelnen Muskelgruppen:<br />
1) Anspannen von Hand, Unterarm und Oberarm der dominanten Seite<br />
2) Gleiches Vorgehen bei der nichtdominanten Seite<br />
3) Anspannen der Augenregion<br />
- Stirnrunzeln<br />
- Augenbrauen Zusammenziehen<br />
4) Anspannen der Schultern<br />
- Schultern zurückziehen<br />
- Schultern hochziehen<br />
5) Anspannen des Rumpfes<br />
- Bauch einziehen<br />
- Rücken zu Hohlkreuz durchdrücken<br />
6) Anspannen von Ober-, Unterschenkel und Fuß der dominanten<br />
Körperseite<br />
7) Gleiches Vorgehen bei der nicht-dominanten Seite<br />
� Die Anspannung dauert ca. 5-7 Sekunden; die Entspannungsphase ca. 30-40<br />
Sekunden; die beiden Phasen werden dabei für jede Muskelgruppe unmittelbar<br />
wiederholt; danach darf die betreffende Muskelgruppe nicht mehr bewegt<br />
werden, da der Entspannungseffekt sonst unterbrochen wird.<br />
� Nach der Übung ist es wichtig, die Jugendlichen korrekt „zurückzuholen“:<br />
� Arme und Beine recken, 3 Mal tief durchatmen und Augen öffnen<br />
� Einige Minuten sitzen bleiben, bis Kreislauf ausreichend aktiviert ist<br />
� Beim Ersteinsatz sollten lediglich 2 bis 3 Übungen mit Wiederholung<br />
durchgeführt werden.<br />
136
C 6: Pädagogische Verhaltensmodifikation bei Kindern u. Jugendlichen<br />
1. Theoretischer Hintergrund der pädagogischen Verhaltensmodifikation<br />
� Ziel der „pädagogischen Verhaltensmodifikation“ ist es, durch die systematische<br />
Veränderung der situativen Rahmenbedingungen und/oder die Veränderung der<br />
Konsequenzen eines Verhaltens, dieses zu beeinflussen.<br />
� Kurz: Die „pädagogische Verhaltensmodifikation“ ist das pädagogische<br />
Pendant zur klinischen Verhaltenstherapie!<br />
� Die pädagogische Verhaltensmodifikation beruht auf den Erkenntnissen des<br />
Behaviorismus. Wie dieser geht sie davon aus, dass menschliches Verhalten zu einem<br />
Großteil gelernt ist und dementsprechend von bestimmten Umweltfaktoren abhängig<br />
ist.<br />
� Die entscheidenden Lernformen sind:<br />
1) Klassische Konditionierung (respondentes Lernen): Durch die<br />
wiederholte Verknüpfung eines unbedingten (oder konditionierten) Reizes<br />
mit einem neutralen Reiz, wird die Reaktion auf den ersteren auf letzteren<br />
übertragen.<br />
� Ist v. a. für emotionale Lernprozesse (Prüfungsangst; Schulangst etc.)<br />
und den Erwerb von Vorlieben und Werthaltungen relevant!<br />
2) Operante Konditionierung (operantes bzw. instrumentelles Lernen): Die<br />
Auftretenswahrscheinlichkeit einer Verhaltensweise wird durch deren<br />
Konsequenzen bestimmt.<br />
� 4 Arten von Konsequenzen lassen sich dabei unterscheiden:<br />
- Positive Verstärkung (Darbietung eines angenehmen Reizes)<br />
- Negative Verstärkung (Entzug eines unangenehmen Reizes)<br />
- Bestrafung, Typ I (Darbietung eines unangenehmen Reizes)<br />
- Bestrafung, Typ II (Entzug eines angenehmen Reizes)<br />
� Das Prinzip der operanten Konditionierung ist das für die pädagogische<br />
Verhaltensmodifikation wichtigste Prinzip!<br />
3) Modelllernen (nach Bandura)<br />
� Verhaltensmodifikationen setzten eine genaue Analyse des Verhaltens und seiner<br />
Rahmenbedingungen voraus.<br />
� Nach der sog. SORKC-Gleichung müssen folgende Faktoren beachtet<br />
werden:<br />
� S: Stimulusbedingungen (auslösende Reize, Hinweisreize etc.)<br />
� O: Organismusvariablen (Persönlichkeit des Lerners, Vorlieben etc.)<br />
� R: Reaktion (Problem- bzw. Zielverhalten)<br />
� K: Verhaltenskonsequenzen (wirksame Verstärker)<br />
� C: Kontingenzverhältnisse (v. a. Häufigkeit und zeitliche Abfolge der R-<br />
K-Beziehung)<br />
� Versuchsdesigns zur Überprüfung verhaltensmodifikatorischer Effekte:<br />
� A-B-Plan: Nach Ermittlung der Grundrate (A) folgt eine<br />
Interventionsmaßnahme (B)<br />
� Problem: Veränderungen der Grundrate können nicht eindeutig auf die<br />
Interventionsmaßnahme zurückgeführt werden!<br />
� Umkehrpläne (z.B. A-B-A-B-Design): Treatment wird vorübergehend<br />
abgesetzt, um zu sehen, ob sich das Verhalten daraufhin wieder der Grundrate<br />
annähert.<br />
� Problem: Ausblendung eines effektiven Treatments ist ethisch<br />
problematisch!<br />
137
� Multiple Grundratenpläne: Kombination mehrerer zeitversetzter A-B-<br />
Pläne, wobei entweder eine Verhaltensweise bei unterschiedlichen Personen,<br />
unterschiedliche Verhaltensweisen bei einer Person oder das gleiche Verhalten<br />
einer Person in unterschiedlichen Settings in den Blick genommen wird.<br />
� Problem: Das Design setzt voraus, dass die beobachteten Verhaltensweisen<br />
unabhängig voneinander sind, was nicht immer sicher gestellt werden<br />
kann.<br />
� Kriteriums-Veränderungs-Pläne: Verhaltensänderung soll sukzessive<br />
erreicht werden; also gewissermaßen A-B-Pläne, bei denen die B- bzw.<br />
Treatmentphase in mehrere Teilphasen unterteilt wird.<br />
� Problem: Nicht geeignet, wenn eine qualitative Verhaltensänderung<br />
angestrebt wird.<br />
� Alternierende Behandlungspläne: Variation der Behandlung<br />
2. Verhaltensmodifikatorische Techniken<br />
A) Token-Programme<br />
� Token sind münzartige Marken, die unmittelbar auf positive Verhaltensweisen<br />
vergeben- oder bei unerwünschtem Verhalten wieder entzogen werden. Nach einer<br />
gewissen Zeit können sie gegen verschiedene „Eintauschverstärker“ („back-upreinforcer“)<br />
eingewechselt werden.<br />
� Token haben demnach eine zweifache Funktion: Zum einen dienen sie als<br />
generalisierte Verstärker, zum anderen haben sie eine Feedback-Funktion.<br />
� Die Anwendung eines Token-Systems erfolgt in 6 Phasen:<br />
1) Definition, Präzisierung und pädagogische Begründung des Zielverhaltens<br />
� Ausgangs- und Zielverhalten sind genau zu operationalisieren<br />
2) Auswahl von Eintauschverstärkern<br />
� Je größer die Variabilität der Eintauschverstärker, desto besser!<br />
3) Zuordnung von Verhaltensweisen-Token-Eintauschverstärkern und Festlegung<br />
von Kontrollprozeduren (z.B. „Punktethermometer“)<br />
4) Einführung<br />
5) Evtl. Korrekturen<br />
6) Ausblendung und Generalisierung<br />
� Was unbedingt zu vermeiden ist:<br />
� Bestrafung eines Schülers, indem ohne vorherige Absprache Token abgezogen<br />
werden<br />
� Vorübergehender Ausschluss eines Schülers von der Möglichkeit, sich Token<br />
zu verdienen<br />
� Verteilung von Token bereits vor einer Leistung<br />
B) Kontingenzverträge<br />
� Kontingenzverträge sind Verträge zw. Erzieher und Kind, in denen genau festgelegt<br />
wird, welches Verhalten welche Konsequenzen nach sich zieht. Der Vorteil solcher<br />
Verträge besteht darin, dass sie für beide Parteien Verhaltenssicherheit schaffen und<br />
die Interaktion versachlichen. Ihr letztendliches Ziel ist der Eigenvertrag, also der<br />
Vertragsschluss mit sich selbst zur autonomen Verhaltenskontrolle (s.u.)<br />
� Vertragsmanagement durchläuft 4 Phasen:<br />
1) Ausgangsverhalten (Ist-Zustand) und Zielverhalten (Soll-Zustand) klären und<br />
operationalisieren<br />
2) Vertragsaushandlung<br />
3) Vertragsformulierung und Inkraftsetzung<br />
4) Kontrolle der Vertragstreue und evtl. Korrekturen des Vertrages<br />
138
� Regeln, die im schulischen Bereich zu beachten sind:<br />
� Regeln zum Vertragsabschluss:<br />
� Gerechtigkeit (Verstärkung muss im ausgewogenen Verhältnis zur<br />
Leistung stehen)<br />
� Eindeutigkeit (klare und verständliche Vertragbedingungen)<br />
� Freiwilligkeit (Vertrag darf nicht aufoktroyiert, sondern muss gemeinsam<br />
ausgehandelt werden)<br />
� Belohnung (besser als Bestrafung)<br />
� Gewohnheit (systematischer Einsatz)<br />
� Regeln zum Verstärkereinsatz:<br />
� Kontinuität<br />
� Staffelung (im Sinne eines „shapings“)<br />
� Zu verstärken ist Leistung, nicht Gehorsam!!<br />
C) Selbstkontrollverfahren<br />
� Die Verfahren zur Selbstkontrolle gehören zu den kognitivistischen Ansätzen der<br />
Verhaltensmodifikation.<br />
� Der erste Schritt der Selbstkontrolle besteht in der Selbstüberwachung („selfmonitoring“);<br />
die vermehrte Aufmerksamkeit auf das eigene Verhalten initiiert<br />
dabei häufig schon eine erste Verhaltensänderung.<br />
� Es folgt die Selbstbewertung (hinsichtlich der Erreichung der zuerst fremd-,<br />
dann selbstgesetzten Ziele)<br />
� Selbstbekräftigung (entweder durch positive Gedanken oder externe Verstärker:<br />
Dinge, Aktivitäten etc.)<br />
� Der Eigenvertrag: ist ein Kontingenzvertrag mit sich selbst. Ein solcher Vertrag<br />
muss sukzessive vorbereitet werden:<br />
� 1. Stufe: Der vom Erzieher aufgesetzte und kontrollierte Vertrag<br />
� Übergangsstufen: Schüler wird an der Aushandlung der Vertragsbedingungen<br />
beteiligt und erhält zunehmend die Verantwortung dafür, auch die Einhaltung<br />
des Vertrages zu kontrollieren.<br />
� Der vom Schüler selbst formulierte und kontrollierte Vertrag (Eigenvertrag)!<br />
� Die Technik der Selbstinstruktion: basiert auf der bewussten Versprachlichung<br />
problemrelevanter Elemente und Begriffe; sie wird in unterschiedlichen Kontexten<br />
eingesetzt (Lernverhalten, Sozialverhalten, komplexe Problemlösungen, kreatives<br />
Schaffen etc.).<br />
� Das auf Meichenbaum zurückgehende Selbstinstruktionstraining läuft in 5<br />
Schritten ab:<br />
1) Kognitives Modellieren: Lehrer demonstriert die Aufgabenlösung, wobei er<br />
sein Vorgehen laut kommentiert<br />
2) Offene, externe Anleitung: Schüler wiederholt die Aufgabe, wobei der<br />
Lehrer ihn mittels sprachlicher Instruktionen dirigiert.<br />
3) Offene Selbst-Anleitung: Schüler wiederholt die Aufgabe und instruiert sich<br />
dabei selbst (übernimmt also die Verbalisierung des Modells)<br />
4) Überführung offener in verdeckte Selbstanleitung: Schüler wiederholt<br />
flüsternd die Aufgabe<br />
5) Verdeckte Selbstanleitung: Schüler spricht „innerlich“ und schließlich gar<br />
nicht mehr.<br />
139
C 7: Trainingsprogramme für Eltern und Erzieher/innen<br />
1. Allgemeines zu Elterntrainings<br />
� Verhaltenstherapeutisch orientierte Elterntrainings werden sowohl als Präventions- als<br />
auch als Interventionsmaßnahme eingesetzt; ihr Ziel ist es, durch die Vermittlung<br />
von Erziehungskompetenzen Verhaltensauffälligkeiten b. Kindern entgegenzuwirken.<br />
� Als besonders effektiv haben sich Eltertrainings bei jüngeren Kindern mit<br />
oppositionellen und aggressiven Verhaltensauffälligkeiten erwiesen (sie sind<br />
hier die Therapieform der Wahl!); Elterntrainings werden aber auch in andere<br />
Interventionsprogramme integriert (etwa bei Angststörungen, Essstörungen etc.)<br />
� Elterntrainings haben eine hohe Abbrecherquote (30-40%); dass dem so ist, hat<br />
verschiedene Gründe.<br />
� Familiäre Gründe: niedriger sozioökonomischer Status; niedrige kognitive<br />
Leistungsfähigkeit der Eltern; partnerschaftliche Probleme der Eltern;<br />
mangelnde elterliche Einsicht in die Erkrankung des Kindes; Abwehrhaltung<br />
gegenüber externer Hilfe (Erziehung als Privatsache) etc. etc.<br />
� Trainingsfaktoren: ungünstige Rahmenbedingungen (lange Anfahrtswege etc.);<br />
Training wird als zu zeitraubend, zu „theoretisch“ oder zu schulmeisterhaft<br />
empfunden etc. etc.<br />
2. Das Münchener Trainingsmodell<br />
� Das Münchener Trainingsmodell ist ein verhaltenstherapeutisch orientiertes<br />
Elterntraining, das den Teilnehmern die Grundlagen der Verhaltensanalyse und<br />
praktisches Handlungswissen für den Umgang mit konkreten Erziehungsproblemen zu<br />
vermitteln versucht.<br />
� Das Modell zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:<br />
� Sprachliche Instruktionen werden weitgehend durch Rollenspiele-, theoretische<br />
Erläuterungen durch anschauliche Demonstrationsexperimente ersetzt.<br />
� Im Zentrum des Trainings stehen ein oder zwei konkrete, von den Eltern<br />
eingebrachte Erziehungsprobleme und keine globale Störung wie z.B.<br />
aggressives Verhalten; es handelt sich somit um ein störungsunspezifisches<br />
Training!<br />
� Vermeidung von Überforderung; möglichst genaue Abstimmung auf die<br />
Bedürfnisse der Eltern<br />
� Durchführung als Kompakttraining (3 bis 4 Blocksitzungen von jeweils 2<br />
Stunden)<br />
� Durchführung in einer Gruppe von 3 bis 4 Elternteilen („Leidensgenossen“) und<br />
2 Therapeuten<br />
� Zumindest in der Anfangsphase keine Paare, um paardynamische<br />
Belastungen aus der Gruppe fernzuhalten.<br />
� Das Modell betont, dass es ihm nicht um eine Veränderung des Erziehungsstils<br />
geht, sondern darum, neue Handlungsspielräume zu gewinnen!<br />
� Inhaltlich gliedert sich das Training in 3 Interventionsschritte (Beobachten –<br />
Interpretieren – Handeln):<br />
1) Ziel des ersten Interventionsschritts ist es, die Teilnehmer darin zu schulen, das<br />
Verhalten ihrer Kinder möglichst genau und unter Berücksichtigung der<br />
situativen Rahmenbedingungen zu beobachten (Beobachtung)<br />
� Einführung: Man stellt sich vor, es werden die Ziele und Regeln der<br />
gemeinsamen Arbeit festgelegt und die Teilnehmer werden durch ein<br />
einführendes Rollenspiel mit der Methode des Rollenspiels vertraut gemacht<br />
140
� Beobachtungsübung: Ein Elternteil beschreibt ein Problemverhalten, das<br />
dann in einem Rollenspiel (ca. 2 Minuten) nachgespielt wird; anhand einer<br />
Videoaufzeichnung wird das Verhalten anschließend möglichst detailliert<br />
beschrieben (Mimik, Situation etc.), wobei Wertungen und Interpretationen<br />
bewusst ausgeklammert werden sollen.<br />
2) Ziel des zweiten Interventionsschrittes ist es, das Verhalten des Kindes in<br />
Abhängigkeit von seiner Umwelt interpretieren zu lernen (Interpretation).<br />
� Durchführung eines experimentellen Demonstrationsspiels<br />
- z.B. das sog. „Hilfespiel“: dabei bekommt ein Teilnehmer eine<br />
schwierige Aufgabe (z.B. ein Puzzle), wobei der Therapeut zunächst mit<br />
unzweckmäßigen Hilfestellungen in den Lösungsprozess eingreift<br />
(Zeitdruck, nicht kontingentes Lob, unnötige Unterstützung etc.), dann<br />
aber in einem 2. Durchgang zweckmäßige Hilfe leistet und damit das<br />
positive Verhalten demonstriert.<br />
� Systematische Beobachtung und Auswertung (!) des Demonstrations- bzw.<br />
Rollenspiels anhand einer Videoaufzeichnung<br />
3) Im dritten Interventionsschritt geht es um die gemeinsame Erarbeitung und<br />
Erprobung zweckmäßiger Handlungsalternativen.<br />
� Analyse des Problemereignisses (Verhaltensanalyse): anhand der im ersten<br />
Interventionsschritt erhobenen Beobachtungsdaten.<br />
� Gewinnung von Lösungsansätzen: Brainstorming und Erprobung der<br />
Vorschläge in Rollenspielen<br />
� Kennzeichnung der Lösungsarten: handelt es sich um interaktive, situative<br />
oder präventive Lösungen?!<br />
3. Tripple P („Positive Parenting Program“)<br />
� Tripple P ist ein in Australien (von Matt Sanders) entwickeltes Elterntraining, das<br />
vorwiegend präventiv ausgerichtet ist. Ziel des Programms ist es, Eltern bewährte<br />
(überwiegend verhaltenstherapeutisch ausgerichtete) Erziehungsstrategien zu<br />
vermitteln, um auf diese Weise eine positive Eltern-Kind-Beziehung zu<br />
ermöglichen. Längerfristig soll auf diese Weise Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern,<br />
insbes. aggressiven und oppositionellen Verhaltensstörungen, vorgebeugt werden.<br />
� Inhaltlich bietet Triple-P im Grunde nichts Neues; das Programm stellt vielmehr eine<br />
Sammlung evaluierter Erziehungsmethoden dar, deren theoretische Grundlagen v. a.<br />
aus der Lernpsychologie stammen (Sozial-kognitive Lerntheorie von Bandura,<br />
operante Lernprinzipien etc.).<br />
� Das Programm orientiert sich dabei an 5 Leitprinzipien positiver Erziehung:<br />
1) Sorgen Sie für eine sichere und interessante Umgebung!<br />
2) Regen Sie Ihr Kind zum Lernen an (etwa durch Aufmerksamkeit,<br />
beschreibendes Lob, Zuneigung etc.)!<br />
3) Verhalten Sie sich konsequent!<br />
4) Erwarten Sie nicht zuviel (realistische Ziele)!<br />
5) Beachten Sie Ihre eigenen Bedürfnisse!<br />
� Prinzipiell lässt sich zwischen 3 Präventionsebenen unterschieden:<br />
1) Universelle präventive Intervention: richtet sich an die gesamte Bevölkerung,<br />
im Fall von Triple-P: an alle Eltern<br />
2) Selektive präventive Intervention: richtet sich an Personen bzw. Familien mit<br />
Risikofaktoren (z.B. alleinerziehende, arbeitslose oder psychisch kranke Eltern)<br />
3) Indizierte präventive Intervention: richtet sich an Eltern, deren Kinder bereits<br />
erste Symptome einer Störung aufweisen<br />
141
� Um möglichst viele Familien zu erreichen und das Angebot gleichzeitig an die<br />
Bedürfnisse der Eltern anzupassen, unterscheidet Triple-P zwischen<br />
5 Interventionsebenen (Mehrebenenansatz):<br />
1) Universelle Information über Erziehung:<br />
� richtet sich an alle interessierten Eltern<br />
� Vermittlung grundlegender Infos durch Broschüren („Positive Erziehung“),<br />
sog. „Tipp-Sheets“ („Kleine Helfer“), Videos, Vorträge etc.<br />
� Unterstützung durch Medienkampagne (Werbespots, Radiobeiträge etc.)<br />
2) Kurzberatung für spezifische Erziehungsprobleme<br />
� richtet sich an Eltern mit kurzfristigem Beratungsbedarf<br />
� erfolgt durch Telefonberatung oder 1 bis 4 kurze Einzelsitzungen (ca. 20<br />
Minuten), wobei auch hier v. a. mit dem vorhandenen Infomaterial (s.o.)<br />
gearbeitet wird.<br />
3) Kurzberatung und aktives Training<br />
� richtet sich an Eltern mit etwas intensiverem Beratungsbedarf (selektive<br />
Präventionsstrategie)<br />
� beschränkt sich aber ebenfalls auf einige wenige Sitzungen, wobei das<br />
Verhalten jetzt aber aktiv (in Form von Rollenspielen) eingeübt wird<br />
4) Intensives Elterntraining<br />
� Indizierte Prävention für Eltern, deren Kinder Verhaltensschwierigkeiten<br />
aufweisen, ohne jedoch das Vollbild der Diagnose zu erfüllen<br />
� Erfolgt entweder als Einzeltraining, Gruppentraining mit 5 – 6 Familien oder<br />
als telefonisch unterstütztes Selbsthilfeprogramm<br />
� Vier 2-stündige Sitzungen, in denen anhand eines Arbeitsbuches und eines<br />
Videos verschiedene Erziehungsstrategien vermittelt und eingeübt werden<br />
5) Erweiterte Interventionen auf Familienebene<br />
� richtet sich an Eltern, bei denen das intensive Elterntraining nicht gefruchtet<br />
hat oder bei denen zusätzlich familiäre Schwierigkeiten wie Ehekonflikte<br />
oder Alkoholismus eine Rolle spielen.<br />
� Ergänzung des intensiven Elterntrainings (Stufe 4) um weitere Module: z.B.<br />
Hausbesuche, Video-Home-Trainings (VHT), Einübung von<br />
Entspannungstechniken, Partnerberatung etc.<br />
� Evaluation: Triple-P zeigt auf allen Interventionsebenen nachhaltige Effekte, sowohl<br />
was das Elternverhalten als auch das Problemverhalten der Kinder betrifft!<br />
142
C 8: Pädagogisch-psychologische Beratung<br />
1. Erziehungsberatung:<br />
� Die institutionelle Erziehungsberatung ist ein Angebot der Jugendhilfe und als solches<br />
gesetzlich geregelt (Kinder- und Jugendhilfegesetz, KJHG); sie richtet sich an<br />
Kinder und Jugendliche (bis 27 Jahren), Eltern und andere Erziehungsberechtigte und<br />
dient zur Unterstützung bei Familien- und Erziehungsproblemen verschiedenster<br />
Art.<br />
� Zentrale Rahmenbedingungen: Die Nutzung des Beratungsangebots erfolgt<br />
freiwillig und ist kostenfrei; die Berater stehen in der Schweigepflicht und<br />
kommen aus unterschiedlichen Disziplinen (Psychologen, Pädagogen,<br />
Sozialarbeiter, Ärzte etc.)<br />
� Verbreitung: Heute gibt es in Deutschland rund 1.100 Erziehungsberatungsstellen<br />
in öffentlicher (ca. 40%) oder freier Trägerschaft (ca. 60%); die<br />
Nachfrage nach Beratungsangeboten steigt – die Existenz von Beratungsstellen<br />
ist jedoch nach wie vor nicht ausreichend im Bewusstsein der Bevölkerung<br />
verankert, weshalb es intensiver Öffentlichkeitsarbeit bedarf!<br />
� Beratungsanlässe: Beziehungsprobleme, Entwicklungsauffälligkeiten (Ängste,<br />
aggressives Verhalten etc.), Schul- bzw. Ausbildungsprobleme, Scheidung der<br />
Eltern, Anzeichen für sexuellen Missbrauch/Misshandlungen, Suchtprobleme...<br />
� Besondere Kennzeichen der Erziehungsberatung:<br />
� Personenbezogener, partizipativer und ressourcenorientierter Ansatz (mit<br />
besonderer Hinwendung zu benachteiligten Zielgruppen)<br />
� Ziel ist Ressourcenstärkung und Hilfe zur Selbsthilfe!<br />
� Gesundheitsförderlicher und präventiver Ansatz mit stark pädagogischer<br />
Ausrichtung<br />
� Anders als in der Psychotherapie geht meist nicht um Symptome mit<br />
Krankheitswert, stattdessen orientiert sich die Erziehungsberatung an<br />
alltagspraktischen Problemen (universelle/selektive/ indizierte Prävention)<br />
� Einbezug der Familie und des sozialen Umfelds (finanzielle Lage,<br />
Wohnsituation etc.)<br />
� weniger individuumszentriert als Psychotherapie<br />
� Erziehungsberatung findet nicht notwendigerweise in Face-to-Face-Interaktionen<br />
statt; darüber hinaus gibt es telefonische- und zunehmend auch Online-<br />
Beratungsangebote<br />
� Typischer Ablauf eines problemzentrierten Beratungsprozesses:<br />
1) Diagnose: Erfassung und Definition des Problems<br />
� Diagnostik erfolgt durch ausführliche Anamnese (biographische Daten,<br />
Klärung der Problemlage und familiären Situation etc.), wobei<br />
gegebenenfalls auch standardisierte Testverfahren einzusetzen sind.<br />
� Generierung einer Hypothese!<br />
2) Formulierung des Ziels und Planung geeigneter Interventionsmaßnahmen<br />
3) Durchführung der Interventionsmaßnahmen<br />
4) Evaluation<br />
� Qualitätssicherung in der Erziehungsberatung:<br />
� Zu unterscheiden ist zw. Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Die<br />
Strukturqualität (Standards für die räumliche und personelle Ausstattung von<br />
Beratungsstellen etc.) und Prozessqualität (Umgang mit den Daten etc.) wird<br />
weitgehend durch das KJHG geregelt; die Ergebnisqualität ist nur schwer zu<br />
überprüfen (Mangel an validen Verfahren und Kriterien) => Hier besteht<br />
Forschungsbedarf!<br />
143
� Ein hinreichend evaluiertes und zunehmend verbreitetes Programm der<br />
Erziehungsberatung stellt Triple-P dar (s.o.).<br />
2. Schulberatung allgemein<br />
� Gesellschaftliche Funktionen von Schule:<br />
� Globales Ziel von Schule ist die Sozialisation der Schüler; Sozialisation meint<br />
dabei einerseits die Eingliederung in die Gesellschaft (Reproduktionsfunktion),<br />
andererseits die Personwerdung des Einzelnen (Personalisationsfunktion)<br />
� Spezifische Ziele bzw. Funktionen von Schule sind:<br />
� Qualifikationsfunktion (Wissensvermittlung)<br />
� Persönlichkeitsförderung<br />
� Legitimationsfunktion (Weitergabe gesellschaftstragender Werte und<br />
Normen)<br />
� Selektions- und Allokationsfunktion (Leistungsbewertung und Zuordnung<br />
zu entsprechenden Bildungsgängen)<br />
� Rückmeldungsfunktion<br />
� Typische Zielkonflikte:<br />
� Konflikte zwischen administrativen Regelungen und pädagogischen<br />
Zielsetzungen<br />
� Konflikte zwischen schulischen und elterlichen Zielen (etwa bezüglich des<br />
Bildungsganges)<br />
� Konflikte zwischen verschiedenen Wert- und Zielvorstellungen<br />
� Schulberatung hat eine Informations-, Unterstützungs- und Steuerungsfunktion.<br />
Welche dieser Komponenten im Vordergrund steht, hängt vom Beratungsanlass ab.<br />
Dabei lassen sich 3 Arten von Beratungsanlässen unterscheiden:<br />
1) Orientierungsprobleme � Orientierungsberatung<br />
� Themen: Einschulung, Versetzung, Übergang in die Sek I, Kurswahl,<br />
Berufswahl etc. (kurz: Laufbahnentscheidungen)<br />
� Adressaten: Schüler, (Eltern)<br />
� Beratende: Lehrer, Berufsberater, Beratungslehrer<br />
2) Psychosoziale Probleme � Beratung bei psychosozialen Problemen<br />
� Themen: Prüfungsangst, Lernstörungen, Mobbing, Scheidungsfolgen etc.<br />
� Adressaten: Schüler, (Eltern)<br />
� Beratende: Lehrer, Beratungslehrer, Schulpsychologen, Sozialarbeiter<br />
� Themen: Disziplinprobleme, Burnout etc.<br />
� Adressaten: Lehrer<br />
� Beratende: Schulpsychologen, Beratungslehrer, Supervisor, Coachs<br />
3) Systemprobleme � Systemberatung<br />
� Themen: Akzentuierung des Schulprofils, Umsetzung nationaler<br />
Bildungsstandards, Lehrerfortbildungen, traumatische Ereignisse (Erfurt,<br />
Meisen…) etc.<br />
� Adressaten: Alle an der Schule beteiligten (Schulleitung, Lehrer, Schüler,<br />
Eltern, Sekreteriatspersonal etc.)<br />
� Beratende: Schulpsychologen, Personal- und Organisationsentwickler,<br />
Schulleitungen etc.<br />
� Die Grenzen zwischen den verschiedenen Beratungsfeldern sind meist fließend:<br />
Verhaltensauffälligkeiten eines Schülers z.B. hängen immer auch mit Systemvariablen<br />
zusammen.<br />
144
� Was ein Berater können muss:<br />
� Die 3 Grundhaltungen eines Beraters sind nach Rogers: Empathie, Akzeptanz<br />
(bedingungslose Zuwendung) und Kongruenz (Echtheit); sie zu erlernen, ist<br />
schwierig<br />
� Erlernbare Kompetenzen eines Beraters sind:<br />
� Fachkompetenz (Allgemeines Wissen über Schule und Lehr-Lern-Prozesse,<br />
aber auch spezialisiertes Wissen, etwa zu ADHS oder Legsthenie)<br />
� Methoden- und Prozesskompetenz: Beherrschung diagnostischer Verfahren,<br />
Techniken der Gesprächsführung etc.<br />
� Soziale Kompetenz: Aufbau eines Vertrauensverhältnisses etc.<br />
3. Schulpsychologischer Dienst im Speziellen<br />
� Institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen des schulpsychologischen Diensts:<br />
� Die für Bildung und Erziehung zentralen Artikel im Grundgesetz sind Art.6 u. 7:<br />
� Art. 6 spricht den Eltern das Grundrecht auf Pflege und Erziehung ihrer<br />
Kinder zu. Im Art. 7 beansprucht der Staat einen eigenständigen schulischen<br />
Bildungs- und Erziehungsauftrag, der dem Elternrecht gleichgeordnet ist.<br />
� Schulpsychologische Beratung bewegt sich dementsprechend im<br />
Spannungsfeld dieser beiden Erziehungsinstitutionen.<br />
� Im Bildungsgesamtplan der „Bund-Länder-Kommission“ (1973) wurden<br />
ehrgeizige Richtwerte für den Ausbau der Schul- und Bildungsberatung<br />
festgelegt: Ein Schulpsychologe für jeweils 5000 Schüler, ein Beratungslehrer<br />
für jeweils 500 Schüler!<br />
� Diese Werte wurden jedoch bis heute von kaum einem Bundesland erreicht;<br />
die Situation ist daher nach wie vor unbefriedigend; zwar wurden<br />
flächendeckend Beratungsstellen eingeführt; diese sind jedoch chronisch<br />
unterbesetzt (bestehen meist nur aus einem Psychologen und einer<br />
Verwaltungskraft)<br />
� Aufgrund der Bildungshoheit der Länder ist der schulpsychologische Dienst in<br />
den verschiedenen Bundesländern z.T. unterschiedlich geregelt.<br />
� Institutionelle Verankerung: Nur in manchen Bundesländern (wie z.B.<br />
Bayern) sind die schulpsychologischen Beratungsstellen direkt den<br />
Schulämtern angegliedert.<br />
� Regionale Präsenz: Während in manchen Bundesländern nach dem<br />
Fachprinzip vorgegangen wird (überregionale Zuständigkeit für bestimmte<br />
Aufgabenbereiche), werden Schulpsychologen in anderen Bundesländern<br />
bestimmten Regionen (Regionalprinzip) zugeordnet.<br />
� Berufliche Qualifikation: In manchen Bundesländern (z.B. Berlin und<br />
Hessen) wird von Schulpsychologen entweder eine Doppelqualifikation als<br />
Lehrer und Psychologe oder eine praktische pädagogische Tätigkeit nach<br />
dem Psychologiestudium erwartet; in Bayern gibt es das Fach „Psychologie<br />
mit schulpsychologischem Schwerpunkt“, das im Rahmen des<br />
Lehramtsstudiums als Hauptfach angerechnet wird.<br />
� Selbstverständnis/Beratungskonzepte: Einzelfallbezogene Schülerhilfe vs.<br />
schulorientierte Schulpsychologie (Systemberatung)<br />
� Für die Schulpsychologie relevante Teildisziplinen sind: klinische Psychologie,<br />
Entwicklungspsychologie, Pädagogischen Psychologie, Pädagogik, Soziologie<br />
� Probleme schulpsychologischer Beratung:<br />
� Überlastung aufgrund schlechter Rahmenbedingungen (s.o.)<br />
� Oftmals geringe Bereitschaft auf Seiten der Schüler, den schulpsychologischen<br />
Dienst in Anspruch zu nehmen<br />
145
� Skepsis von Seiten der Lehrer, denen Psychologen oft zu wenig pädagogische<br />
Erfahrung haben.<br />
� Schulpsychologische Beratung erfolgt auf 3 Ebenen, wobei der Übergang zw. den<br />
Ebenen fließend ist:<br />
1. Individuelle Ebene (Beratung von Einzelpersonen)<br />
� Mögliche Adressaten und Themen (s.o.): Schüler (Lern- und Verhaltensprobleme,...),<br />
Lehrer (Burnout,…), Eltern (Schullaufbahnentscheidungen,…)<br />
� Unterscheidung zwischen 3 Beratungsmodi:<br />
- Individuumzentriert-dyadischer Beratungsmodus<br />
- Mediatorischer Beratungsmodus (Einbeziehung des Umfelds;<br />
Teilnahme eines Mediators)<br />
- Systemischer Beratungsmodus (Mehrebenenansatz)<br />
2. Gruppenebene (Beratung von Gruppen)<br />
� Schülergruppen: Programme und Trainings im intellektuellen- und<br />
psychosozialen Bereich<br />
- z.B. Denktraining von Klauer, Antiaggressionstraining von Petermann<br />
& Petermann<br />
� Elterngruppen: Förderung erzieherischer Kompetenzen (z.B. mit Triple-P)<br />
� Lehrergruppen: Supervision, Teamberatung, Fortbildungsseminare etc.<br />
3. Institutionelle bzw. Systemebene (Beratung der Institution Schule)<br />
� Während sich der schulpsychologische Dienst früher v. a. auf<br />
Einzelberatungen beschränkte, wird die Systemebene in jüngerer Zeit<br />
zunehmend wichtiger!<br />
� Zwei grundlegende Strategien zur Veränderung von Schule:<br />
- Veränderungen von oben („top-down“): durch gesetzliche Vorgaben<br />
- Veränderungen von unten („bottom-up“): Veränderungen einzelner<br />
Schulen, die ihrerseits „Schule machen“<br />
� Die Systemberatung sollte auf eine Verzahnung beider<br />
Veränderungsprozesse zielen.<br />
� Was zu beachten ist:<br />
� Die 3 Ebenen sollten nicht unabhängig voneinander betrachtet werden; das Beste<br />
ist eine systemische Sichtweise, die die Wechselwirkungen zwischen den<br />
verschiedenen Ebenen beachtet!<br />
� Interventionen sollten auf allen 3 Ebenen ansetzen!<br />
� Schulpsychologen sollten um Überparteilichkeit bemüht sein und nicht als<br />
Verbündete bestimmter Systemparteien (z.B. Eltern oder Lehrer) auftreten.<br />
� Ziel ist ein kooperatives Beratungssystem, in das alle Beteiligten (Eltern<br />
Lehrer, Schüler etc.) integriert sind!<br />
146
D: <strong>PSYCHOLOGIE</strong> <strong>DES</strong> LERNERS<br />
C 1: Intelligenz / Hochbegabung und schulisch-akademische Leistung<br />
1. Verschiedene Intelligenzmodelle und IQ-Tests<br />
A) Allgemeines<br />
� Intelligenz kann definiert werden als die allgemeine Fähigkeit zum Denken oder<br />
Problemlösen in neuartigen Situationen. Nach Sternberg ist Intelligenz die<br />
allgemeine Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen und sich neuen<br />
Umweltgegebenheiten anzupassen. Wechsler beschreibt intelligentes Verhalten als<br />
„zweckvoll“ und „vernünftig“.<br />
� Da es sich bei Intelligenz um ein hypothetisches Konstrukt handelt, das je nach<br />
zugrunde liegendem Modell unterschiedlich beschrieben wird, gibt es jedoch<br />
keine allgemein anerkannte Definition!<br />
� Grundsätzlich lassen sich 3 Arten von Intelligenzmodellen unterscheiden:<br />
� Eindimensionale Intelligenzmodelle: stehen in der Tradition Spearmans und<br />
gehen von einem alle kognitiven Teilleistungen beeinflussenden Generalfaktor<br />
(„g“) aus.<br />
� Mehrdimensionale Intelligenzmodelle: gehen dagegen von mehreren,<br />
voneinander unabhängigen Intelligenzfaktoren aus. Sie stehen in der Tradition<br />
Thurstones.<br />
� Kognitionspsychologische Intelligenzmodelle: versuchen, die für<br />
Intelligenzleistungen notwendigen Prozesse zu identifizieren und zu beschreiben<br />
B) Eindimensionale Intelligenzmodelle<br />
� Die Zwei-Faktoren-Theorie von Spearman (20er Jahre) geht davon aus, dass die<br />
kognitive Leistungsfähigkeit einer Person von einem bereichsunspezifischen<br />
Generalfaktor („g“) und mehreren spezifischen Faktoren („s1-n“) abhängt, die<br />
ihrerseits voneinander unabhängig sind und in die der Generalfaktor in<br />
unterschiedlichem Maß einfließt.<br />
� Während der Generalfaktor mit der allgemeinen Intelligenz gleichzusetzen ist,<br />
entsprechen den spezifischen Faktoren bestimmte Teilfertigkeiten (z.B.<br />
Wortschatz etc,); sie dienen der Aufklärung der Restvarianz.<br />
� Spearmans Modell ist von seinen Schülern verschiedentlich weiterentwickelt worden.<br />
Auf der Ebene zwischen dem Generalfaktor und den spezifischen Faktoren wird z.B.<br />
häufig zwischen einer verbal-schulischen- und einer praktischen Intelligenz<br />
unterschieden.<br />
� Der Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder bzw. Erwachsene (HAWIK<br />
und HAWIE) teilen sich in einen Verbal- und einen Handlungsteil auf.<br />
� Skalen, die zum Verbalteil zählen, sind z.B. „allgemeines Wissen“,<br />
„Wortschatz-Test“, „Rechnerisches Denken“, „Allgemeines Verständnis“,<br />
„Objekte finden“<br />
� Skalen, die zum Handlungsteil gehören, sind u.a. „Bilder ergänzen“, „Bilder<br />
ordnen“, „Figuren legen“ etc.<br />
� Die Theorie der fluiden und kristallinen Intelligenz von Cattell (1957) ist genau<br />
wie das Intelligenzmodell von Spearman hierarchisch gegliedert; geht aber nicht von<br />
einem, sondern von 2 Generalfaktoren aus.<br />
1) Die fluide Intelligenz (gf): entspricht der Leistungsfähigkeit des<br />
neurophysiologischen Apparates (Hardware) und ist damit verantwortlich für<br />
die Basisprozesse der Informationsverarbeitung; nach Cattell ist die fluide<br />
147
Intelligenz angeboren und weitgehend unabhängig von persönlichen<br />
Lernerfahrungen (~ Spearmans Generalfaktor „g“)<br />
� Testskalen zur fluiden Intelligenz (v.a. im CFT verwendet) beziehen sich u.a.<br />
auf die Gedächtnisspanne, die Fähigkeit zum induktiven Schließen und die<br />
Identifikation und Generierung figuraler Beziehungen.<br />
2) Die kristalline bzw. kristallisierte Intelligenz: ist die umweltbedingte<br />
Komponente der allgemeinen Intelligenz; sofern sie auf persönlichen<br />
Lernerfahrungen beruht, kann sie als das Produkt aus flüssiger Intelligenz und<br />
Sozialisationseinflüssen beschrieben werden. Sie umfasst das deklarative und<br />
prozedurale Wissen einer Person sowie deren sprachlichen Fähigkeiten.<br />
� Testskalen zur kristallinen Intelligenz betreffen z.B. das verbale Verständnis.<br />
� Anders als die fluide Intelligenz, die ab einem gewissen Alter abnimmt,<br />
nimmt die kristalline Intelligenz kontinuierlich zu oder bleibt zumindest<br />
gleich!<br />
C) Mehrdimensionale Intelligenzmodelle<br />
� Das Primärfaktormodell von Thurstone (1938) geht davon aus, dass sich die<br />
menschliche Intelligenz aus 7 voneinander unabhängigen Primärfaktoren<br />
zusammensetzt.<br />
� Statt wie Spearman eine allgemeine Intelligenz zu postulieren, spricht Thurstone<br />
von sieben primären mentalen Fähigkeiten:<br />
1) Verbales Verständnis (verbal comprehension)<br />
2) Wortflüssigkeit (verbal fluency)<br />
3) Schlussfolgerndes Denken (reasoning)<br />
4) Räumliches Vorstellungsvermögen (spatial visualisation)<br />
5) Merkfähigkeit; KZG (memory)<br />
6) Rechenfähigkeit (number)<br />
7) Wahrnehmungs- & Auffassungsgeschwindigkeit (perceptual seed)<br />
� Je nach Aufgabentyp fließen die einzelnen Fähigkeiten in unterschiedlichem<br />
Ausmaß in die Leistung einer Person mit ein.<br />
� Guilford (1959): unterscheidet zwischen 3 Dimensionen, anhand derer er versucht,<br />
die menschliche Intelligenz zu strukturieren.<br />
� Er differenziert zwischen Denkoperationen, Denkinhalten und<br />
Denkprodukten.<br />
� Zu den von ihm genannten Denkoperationen gehören Erkenntnis,<br />
Gedächtnis, Bewertung, divergente Produktion und konvergente<br />
Produktion.<br />
� Zu den Denkprodukten zählt Guilford z.B. Einheiten, Klassen, Systeme<br />
und Transformationen.<br />
� Bezüglich der Inhalte unterscheidet er u.a. zwischen semantischen,<br />
symbolischen und figuralen Inhalten.<br />
� Aus der Kombination dieser 3 Dimensionen ergibt sich ein Würfel mit 120<br />
Zellen, die laut Guilford jeweils als eigenständige Intelligenzfaktoren zu<br />
betrachten sind.<br />
� Aufgrund dieses enormen Umfangs ist das Modell für die Praxis kaum<br />
brauchbar; entscheidend ist jedoch, dass Guilford der erste ist, der Kreativität<br />
(=divergente Produktion) als eigenständige Komponente von Intelligenz<br />
thematisiert (s.u.)<br />
148
� Gardners Modell der multiplen Intelligenzen (1983): Gardner polemisiert gegen die<br />
gängigen IQ-Tests und postuliert 6 voneinander unabhängige Intelligenzen:<br />
� Die 6 von ihm postulierten Intelligenzen sind:<br />
1) Sprachliche Intelligenz<br />
2) Logisch-mathematische Intelligenz<br />
3) Räumliche Intelligenz<br />
4) Musikalische Intelligenz<br />
5) Motorische Intelligenz<br />
6) Personale Intelligenz (= emotionale bzw. soziale Intelligenz)<br />
� Problem: mangelnde empirische Fundierung; beliebig erweiterbar!<br />
D) Das Berliner Intelligenzstrukturmodell (BIS) von Jäger<br />
� Das Berliner Intelligenzstrukturmodell von Jäger ist gegenwärtig zumindest im<br />
deutschsprachigen Raum das empirisch fundierteste Intelligenzmodell. Es geht davon<br />
aus, dass sich jede Intelligenzleistung bimodal aus einer operativen- und einer<br />
inhaltlichen Komponente (bzw. „Modalität“) zusammensetzt.<br />
� Insgesamt werden 4 operative Fähigkeiten und 3 mögliche Inhalte unterschieden, so<br />
dass sich eine zweidimensionale Matrix mit 12 Feldern ergibt.<br />
� Die operativen Fähigkeiten beziehen sich auf die allgemeinen kognitiven<br />
Prozesse, die zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben notwendig sind.<br />
Unterschieden wird zwischen…<br />
1) der Bearbeitungsgeschwindigkeit (B)<br />
2) dem Gedächtnis (G) (= Merkfähigkeit)<br />
3) dem Einfallsreichtum (E)<br />
4) und der Verarbeitungskapazität (K)<br />
� Davon abzugrenzen sind die 3 inhaltsbezogenen Fähigkeitskomponenten.<br />
Unterschieden wird zwischen…<br />
1) Sprachgebundenem Denken (verbaler Inhalt, V)<br />
2) Zahlengebundenem Denken (numerischer Inhalt, N)<br />
3) und anschauungsgebundenem Denken (figural-bildhafter Inhalt, F)<br />
� Aus der Kreuzung der inhaltlichen und operativen Komponenten ergeben sich 12<br />
spezifische Teilfähigkeiten, die zusammen die „allgemeine Intelligenz“ („g“) einer<br />
Person bilden.<br />
� Das Modell ermöglicht es, jede Intelligenzleistung als Kombination aus einer<br />
operativen und einer inhaltsgebundenen Komponente darzustellen.<br />
� Das Merken von Zahlen = GN; das Erkennen figuraler Analogien = KF; das<br />
Aufschreiben möglichst vieler Wörter zu einem Anfangsbuchstaben = EV etc.<br />
� Auf diesem Modell baut der Berliner Intelligenzstruktur-Test (BIS-Test) auf, der in<br />
2 Versionen vorliegt (s.u.):<br />
� BIS-4 (Berliner Intelligenzstrukturtest, Form 4): ab 15<br />
� BIS-HB (Berliner Intelligenzstrukturtest für Jugendliche) für Jugendliche zw. 12<br />
und 16; besonders für die Begabungs- und Hochbegabungsdiagnostik geeignet.<br />
E) Kognitionspsychologische Intelligenzmodelle<br />
� Campione und Brown: unterscheiden zwischen einer „Architektur“-Ebene und einer<br />
übergeordneten exekutiven Ebene der Intelligenz<br />
� Die „Architektur“-Ebene: stellt gewissermaßen die „Hardware“ des<br />
kognitiven Apparats dar; sie wird von Campione und Brown im Sinne des<br />
Dreispeicher-Gedächtnismodells beschrieben.<br />
� Die auf dieser Ebene angesiedelten Komponenten (Speicherkapazität und<br />
Verarbeitungsgeschwindigkeit) lassen sich kaum trainieren.<br />
149
� Die übergeordnete exekutive Ebene besteht nach Campione und Brown v.a.<br />
aus 2 Komponenten: Dem Vorwissen und dem metakognitiven Wissen<br />
(Person-, Regel- und Strategiewissen)<br />
� Diese Komponenten lassen sich durchaus trainieren und sind zusammen<br />
mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit wichtige Faktoren bei der<br />
Erklärung von Intelligenzunterschieden.<br />
� Das triarchische Intelligenzmodell von Sternberg: unterscheidet zwischen<br />
analytischen-, kreativen- und praktischen Fähigkeiten. Leistungen in diesen<br />
Bereichen lassen sich aus Sicht dreier „Subtheorien“ näher beschreiben.<br />
1) Die Komponentensubtheorie besagt, dass es 3 Komponenten gibt, die zur<br />
Informationsverarbeitung notwendig sind. Diese sind universell und umfassen…<br />
� sog. „Metakomponenten“, die der Planung und Überwachung der<br />
kognitiven Prozesse dienen („Monitoring“),<br />
� sog. „Performanzkomponenten“, die der Ausführung dienen (Kodierung,<br />
Kombinieren und Vergleichen etc. etc.),<br />
� und Komponenten des Wissenserwerbs, die der Speicherung und<br />
Assimilation von Wissen dienen (LZG).<br />
2) Die Zwei-Facetten-Subtheorie bezieht sich auf das Verhältnis von Erfahrung<br />
und Intelligenz und beschreibt 2 Fähigkeiten:<br />
� Zum einen die Fähigkeit, mit Neuem umzugehen, zum anderen die Fähigkeit,<br />
Prozesse zu automatisieren.<br />
3) Die Kontextsubtheorie besagt, dass die Intelligenz immer im kulturellen<br />
Kontext betrachtet werden muss. Sie umfasst die Komponenten, die im<br />
Zusammenhang mit der jeweiligen Umwelt stehen (Anpassung, Selektion,<br />
Umformung)<br />
2. Kreativität<br />
� Mit seiner Unterscheidung zwischen divergenter und konvergenter Produktion hat<br />
GUILFORD in den 60er / 70er Jahren das Kreativitätskonstrukt in die Diskussion um<br />
die Intelligenz eingeführt.<br />
� Nach GUILFORD zeichnet sich das Konstrukt „Kreativität“ durch 4 Merkmale aus:<br />
1) Sensitivität gegenüber Problemen<br />
� Insofern erfordert Kreativität nicht zuletzt Vorwissen bzw. Expertise.<br />
2) Flüssigkeit des Denkens<br />
� Die Leichtigkeit, Ideen und Assoziationen zu generieren.<br />
3) Flexibilität<br />
� Fähigkeit zum Perspektivwechsel, Wechsel von Bezugssystemen etc.<br />
4) Originalität<br />
� Kreative Produkte sind neu und selten!<br />
3. Intelligenz- und Leistungsentwicklung<br />
� Zum Zusammenhang zwischen Intelligenz und Schulleistung: siehe A 4 und B 4<br />
� Der Zusammenhang zw. Intelligenz und Schulleistung ist wesentlich größer als<br />
der zwischen Intelligenz und außerschulischen bzw. außerakademischen<br />
Leistungen; hier scheinen Erfahrung und Übung die entscheidenden<br />
Determinanten zu sein!<br />
� Intelligenz nimmt im Laufe der Entwicklung zu; die Unterschiede zwischen den<br />
Individuen bleiben jedoch ab Ende der Grundschulzeit relativ konstant!<br />
� Ob die Intelligenz im frühen Erwachsenenalter ihren Höhepunkt erreicht, ist umstritten<br />
und ließe sich aufgrund des Flynn-Effekts lediglich mit Hilfe von Längsschnittstudien<br />
untersuchen.<br />
150
� Flynn-Effekt: Der durchschnittliche Intelligenzquotient der Gesamtpopulation<br />
nimmt zu (ca. 3 Punkte pro Jahrzehnt)<br />
� Mögliche Erklärungen: wachsende Vertrautheit mit Testmaterial, stärkere<br />
schulische Förderung<br />
� Entgegen früherer Annahmen gibt es heute verschiedene Belege für die<br />
Trainierbarkeit von Intelligenz – insbesondere bei leistungsschwachen Kindern.<br />
� Vgl. Denktraining von Klauer<br />
4. Anlage-Umwelt-Problem: Soziale u. genetische Determinanten der Intelligenz<br />
� Begrifflichkeiten:<br />
� Die Erblichkeit bzw. Heritabilität eines Merkmals ist definiert als der Anteil<br />
genetisch bedingter Varianz an der (phänotypischen) Gesamtvarianz dieses<br />
Merkmals!<br />
� Interpretation: Der Erblichkeitskoeffizient (zw. 0 und 1) sagt demnach<br />
nichts über Individuen aus! Er besagt lediglich, zu welchem Anteil die<br />
Unterschiede zwischen den Personen einer Population unter den<br />
gegebenen Umweltbedingungen auf Erbanlagen zurückzuführen sind (bei<br />
identischen Umweltbedingungen wäre er 1, was aber nicht bedeuten würde,<br />
dass die Umwelt keinen Einfluss auf die Entwicklung des Einzelnen hat)<br />
� Bezüglich der Umwelteinflüsse muss zwischen Einflüssen unterschieden<br />
werden, die zur Ähnlichkeit- (gemeinsame Umwelt), und solchen, die zur<br />
Unähnlichkeit zwischen Individuen beitragen (spezifische Umwelt).<br />
� Verhaltensgenetische Studien versuchen, die genetisch bedingten und die durch<br />
die Umwelt bedingten Unterschiede anteilig zu bestimmen.<br />
� Die Methoden und Ergebnisse verhaltensgenetischer Studien:<br />
� Die Verhaltensgenetik arbeitet üblicherweise mit Zwillings-, Adoptions- und<br />
sonstigen Familienstudien.<br />
� Am häufigsten ist dabei der Vergleich gemeinsam ausgewachsener<br />
eineiiger (EZ) und zweieiiger Zwillinge (ZZ). Ist die Ähnlichkeit zw. EZ in<br />
einem Merkmal größer als die von ZZ, ist dies ein Hinweis auf Erblichkeit;<br />
sind die Koeffizienten für ZZ mehr als halb so hoch wie die für EZ, ist dies<br />
ein Hinweis auf den Einfluss der gemeinsamen Umwelt.<br />
- Eine Voraussetzung dieses Ansatzes ist die sog. „Equal Environments<br />
Assumption“, der zufolge die Umwelt zur Ähnlichkeit EZ nicht stärker<br />
beiträgt als zur Ähnlichkeit ZZ.<br />
� Einfacher (aber seltener) ist der Vergleich getrennt aufgewachsener<br />
eineiiger Zwillinge; hier können sämtliche Ähnlichkeiten auf genetische<br />
Einflüsse zurückgeführt werden; die Korrelation bezüglich eines Merkmals<br />
(etwa die Korrelation zw. den IQ-Werten) kann dementsprechend als direkter<br />
Schätzwert für die Erblichkeit dieses Merkmals interpretiert werden.<br />
� Die Unterschiede zw. gemeinsam aufgewachsenen eineiigen Zwillingen<br />
können als Schätzwert für den Einfluss der spezifischen Umwelt interpretiert<br />
werden.<br />
� Adoptionsstudien: Die Korrelation nicht verwandter, aber in der gleichen<br />
Familie aufgewachsener Kinder kann als Schätzwert für den Einfluss der<br />
gemeinsamen Umwelt interpretiert werden.<br />
� Auch wenn die Schätzmethoden im Einzelnen fehleranfällig sind, ergibt sich aus<br />
den unterschiedlichen Forschungsdesigns insgesamt ein konsistentes<br />
Gesamtbild; Ergebnisse (nach Loehlin):<br />
� Erblichkeit des IQ: ca. 50% (nimmt jedoch im Erwachsenenalter zu)<br />
� Einfluss der gemeinsamen Umwelt auf den IQ: ca. 25%<br />
151
� Einfluss der spezifischen Umwelt auf den IQ: ca. 15%<br />
� Messfehler: ca. 10%<br />
� Umwelt und genetische Faktoren beeinflussen sich wechselseitig:<br />
� Nach PLOMIN kann das auf 3 verschiedene Arten geschehen. Er unterscheidet<br />
zwischen passiver-, evokativer- und aktiver Genom-Umwelt-Passung:<br />
1) Passive Genom-Umwelt-Passung:<br />
� Eltern schaffen durch ihren Lebensstil eine bestimmte Erziehungsumwelt<br />
(z.B. durch das Vorhandensein von Büchern etc.), durch die das Kind<br />
beeinflusst wird. Entspricht diese Umwelt den Anlagen des Kindes, liegt<br />
eine passive Genom-Umwelt-Passung vor. Dass die Erziehungsumwelt<br />
dem Genom des Kindes entspricht, ist bei biologischen Eltern<br />
wahrscheinlicher als z.B. bei Adoptiveltern.<br />
2) Evokative Genom-Umwelt-Passung:<br />
� Kinder beeinflussen ihre Umwelt durch ihr Verhalten bzw. ihre Art.<br />
Freundlich veranlagte Kinder evozieren beispielsweise mehr Zuwendung<br />
als schwierige. Die Umwelt einer Person reagiert gewissermaßen auf<br />
deren Genom.<br />
3) Aktive Genom-Umwelt-Passung:<br />
� Menschen wählen ihre Umweltbedingungen zu großen Teilen aktiv aus<br />
und gestalten sie entsprechend ihrer Anlagen (z.B. bei der Berufswahl<br />
oder der Wahl von Partnern und Freunden).<br />
� Die Tatsache, dass die Erblichkeit mit dem Alter zunimmt, kann durch die mit<br />
dem Alter zunehmende Bedeutung der evokativen und aktiven Genom-<br />
Umwelt-Passung erklärt werden.<br />
� Richtigstellung häufiger Missverständnisse:<br />
� Anders als oft behauptet wird, sind genetische Einflüsse und Umwelteinflüsse<br />
keineswegs so eng verwoben, dass sie sich nicht voneinander trennen ließen! –<br />
Vielmehr verfügt die Verhaltensgenetik mittlerweile über Methoden, die eine<br />
zuverlässige Schätzung beider Einflussgrößen ermöglichen!<br />
� Der so ermittelte Erblichkeitskoeffizient darf jedoch nicht auf einzelne<br />
Individuen angewandt werden. Nicht 50% der Intelligenz gehen auf die Gene<br />
zurück, sondern 50% der Intelligenzunterschiede gehen auf die Gene zurück!<br />
Dem entspricht, dass Erblichkeit keine Konstante ist, sondern ihrerseits von<br />
den Umweltbedingungen der betreffenden Gruppe abhängig ist; je ähnlicher<br />
diese sind, desto höher der Anteil genetisch bedingter Unterschiede!<br />
� Implikationen für die pädagogische Psychologie:<br />
� Es gilt Anlageunterschiede als Entwicklungsgegebenheiten ernst zu nehmen<br />
(„Erziehung kann nicht alles!“), ohne sie vorschnell als deterministisch<br />
anzusehen („Erziehung kann nicht nichts!“); am besten ist eine Förderung, die<br />
den natürlichen Anlagen entspricht!<br />
� Ein Forschungsschwerpunkt sollte künftig auf die spezifische Umwelt<br />
(Peerbeziehungen) etc. gelegt werden!<br />
152
5. Hochbegabung<br />
A) Definition:<br />
� Die gängige Definition von Hochbegabung richtet sich nach der Intelligenz. Danach<br />
sind Personen hochbegabt, wenn sie mindestens 2 Standardbeweichungen über dem<br />
Durchschnitt liegen, also einen IQ von 130 oder mehr haben, was einem<br />
Bevölkerungsanteil von 2% entspricht!<br />
� Vorteil: Gut operationalisierbar!<br />
� Nachteil: Ausklammerung nicht intellektueller Hochbegabungen (etwa im Sport<br />
oder in der Kunst)<br />
� Renzullis „Drei-Ringe-Modell“: ist das wohl bekannteste Hochbegabungsmodell.<br />
� Dem Modell zufolge setzt sich Hochbegabung aus 3 konstitutiven Komponenten<br />
zusammen:<br />
1) Überdurchschnittliche Fähigkeiten (dazu zählt v. a. überdurchschnittliche<br />
Intelligenz, aber auch spezifische Fähigkeiten)<br />
2) Kreativität (Flüssigkeit, Flexibilität, Originalität)<br />
3) Aufgabenengagement (Motivation, Interesse, Beharrlichkeit etc.)<br />
� Nachteile:<br />
� Modell enthält kaum Aussagen über die funktionalen Zusammenhänge<br />
zwischen den 3 Bereichen bzw. „Ringen“.<br />
� Durch die Aufnahme der motivationalen Komponente, wird Leistung als<br />
konstitutiver Bestandteil von Hochbegabung angesehen (Keine<br />
Unterscheidung zw. Kompetenz und Performanz � Ausklammerung der<br />
„Underachiever“)<br />
� Das Münchener Modell der Hochbegabung von Heller: ist wesentlich<br />
differenzierter als das Modell Renzullis.<br />
� Es unterscheidet zwischen Fähigkeitsfaktoren (Intelligenz, Kreativität, soziale<br />
Kompetenz, künstlerische Fähigkeiten etc.) und Leistungsbereichen<br />
(Mathematik, Wissenschaften, soziale Beziehungen, Kunst etc.).<br />
� Ob die vorhandenen Fähigkeiten (Prädiktoren) umgesetzt werden und sich in<br />
entsprechenden Leistungen (Kriterium) niederschlagen, hängt a) von nichtkognitiven<br />
Persönlichkeitsmerkmalen (Leistungsmotivation, Lernstrategien<br />
etc.) und b) von Umweltfaktoren (Klassenklima, kritische Lebensereignisse<br />
etc.) ab, die somit als Moderatoren zu betrachten sind.<br />
� Ein Test, der auf diesem Modell aufbaut, ist die „Münchener Testbatterie für<br />
Hochbegabung“<br />
B)Empirische Befunde zu Hochbegabten:<br />
� Verbreitete Mythen über Hochbegabung, die so nicht haltbar sind:<br />
� Mythos von der universellen Begabung: Hochbegabte Kinder und Jugendliche<br />
schneiden keineswegs in allen intellektuellen Bereichen gleichermaßen<br />
überdurchschnittlich ab!<br />
� Mythos von der außergewöhnlichen intellektuellen Begabung: Eine Reihe<br />
von Kindern mit sportlicher oder musisch-künstlerischer Hochbegabung weisen<br />
keinen überdurchschnittlichen IQ auf!<br />
� Mythos von den überehrgeizigen Eltern: Eltern, die ihre hochbegabten Kinder<br />
zu sehr unter Druck setzen und sich in ihrem Ruhm sonnen wollen, sind eher die<br />
Ausnahme!<br />
� Mythos von der überdurchschnittlich guten körperlichen und seelischen<br />
Verfassung Hochbegabter: LEWIS TERMAN versuchte mit seiner<br />
Langzeitstudie zur biographischen Entwicklung Hochbegabter (1921-1996)<br />
genau das zu belegen und tatsächlich konnte er zeigen, dass Hochbegabte im<br />
153
Durchschnitt keineswegs schlechter, oftmals sogar besser angepasst sind, als<br />
normal begabte Personen. Insbesondere in der Gruppe der Höchstbegabten gab<br />
es jedoch Pbn, die soziale Probleme aufwiesen!<br />
� Der Mythos, dass Hochbegabung zu beruflichem Erfolg oder gar<br />
Berühmtheit führt: Auch hier ist die Terman-Studie zu zitieren. Zwar waren die<br />
Teilnehmer insgesamt überdurchschnittlich erfolgreich; es gab jedoch nur<br />
wenige außergewöhnliche Karrieren zu verzeichnen; besonders markant: Zwei<br />
spätere Nobelpreisträger waren zuvor aufgrund eines zu geringen IQs nicht in<br />
die Studie aufgenommen worden.<br />
� Nicht-kognitive Faktoren (wie Leistungsmotivation, Selbstbewusstsein<br />
etc.) sowie Umweltfaktoren (sozialer Status etc.) scheinen für beruflichen<br />
Erfolg entscheidender zu sein als der IQ!<br />
� Mögliche Probleme hochbegabter Kinder und mögliche Erklärungen für „Underachievement“<br />
� Schere zwischen mentalem und sozial-emotionalem Entwicklungsstand �<br />
soziale Unangepasstheit; Probleme mit Mitschülern, wenig Freunde etc.<br />
� Unterforderung in der Schule � Langeweile, Konflikte mit Lehrern,<br />
Schulabsentismus etc.<br />
� 2 Typen von hochbegabten Jugendlichen lassen sich unterscheiden: Die<br />
Gruppe der „Blaumacher“ bildet den geringeren Teil und ist im Großen<br />
und Ganzen unproblematisch (Schulleistung bleibt meist trotz Schwänzens<br />
überdurchschnittlich), größer ist der Anteil Hochbegabter mit einer<br />
„Schulaversion“ (sie zeigen von Anfang an schulmeidendes Verhalten und<br />
erzielen dadurch zunehmend schlechtere Leistungen).<br />
� Zu hoher Leistungsdruck von Seiten der Eltern � Überforderung, negatives<br />
Selbstbild etc.<br />
C) Fördermöglichkeiten:<br />
� Die meisten im schulischen Kontext angewandten Fördermaßnahmen lassen sich<br />
einem von 2 Grundmodellen zuordnen; diese Grundmodelle werden als<br />
„Enrichment“ (Vertiefung) und „Akzeleration“ (Beschleunigung, Raffung)<br />
bezeichnet.<br />
� Der Begriff „Enrichment“ bezieht sich auf Zusatzmaßnahmen im Unterricht<br />
(z.B. Sonderaufgaben) oder spezielle Kurse außerhalb der regulären<br />
Unterrichtszeit; während derartige Maßnahmen im deutschsprachigen Raum<br />
noch relativ selten sind, finden sie in den USA zunehmende Verbreitung.<br />
� „Purdue Three-Stage Enrichment Model“ (von Feldhusen und Kolloff):<br />
Hochbegabte nehmen außerhalb der regulären Unterrichtszeit an einem<br />
speziellen Kurs teil, der aus 3 Modulen besteht und v. a. darauf zielt,<br />
selbstreguliertes Lernen zu fördern.<br />
- 1. Modul: Verhältnismäßig einfache Aufgaben zum logischen Denken<br />
- 2. Modul: Förderung der kreativen Problemlösefähigkeit<br />
- 3. Modul: Planung und Durchführung eigener Forschungsprojekte<br />
� „Enrichment Triad“ bzw. „Revolving Door Model“ (von Renzulli):<br />
Die Schule wählt einen „Talent Pool“ aus den 15-20% der fähigsten und<br />
leistungsstärksten Schüler aus, denen ein besonderes, ihren jeweiligen<br />
Interessen entsprechendes Förderprogramm zuteil wird. Das Programm<br />
gliedert sich dabei in 3 Teile („Enrichment Triad“):<br />
- 1. Teil: Wissensvertiefung<br />
- 2. Teil: Logisches Denken<br />
- 3. Teil: Eigenständiges Forschungsprojekt<br />
154
� Das Konzept der „Akzeleration“ meint Maßnahmen, die zu einer<br />
Beschleunigung der Schulkarriere führen (vorzeitige Einschulung, Klasse<br />
überspringen, Aufnahme in Klassen mit verkürztem Ausbildungsgang)<br />
� Anders als oft befürchtet wird, führt das Überspringen von Klassen meist<br />
nicht zu sozialen Belastungen oder schulischen Leistungsproblemen.<br />
� Innere Differenzierung in leistungsheterogenen Gruppen meint Differenzierungsmaßnahmen<br />
innerhalb des Unterrichts: etwa durch Sonderaufgaben, Übergabe<br />
besonderer Verantwortung etc.<br />
� Vorteile: Schwächere Schüler können von den stärkeren profitieren (und<br />
umgekehrt); kein Elitedünkel, etc.<br />
� Nachteile: Diverse Studien (wie z.B. IGLU und PISA) zeigen jedoch, dass eine<br />
innere Differenzierung in den seltensten Fällen hinreichend gelingt, so dass der<br />
Unterricht in sehr leistungsheterogenen Gruppen meist doch auf Kosten der<br />
Hochbegabten geht!<br />
� Äußere Differenzierung: kann auf unterschiedliche Weise stattfinden; z.B. indem<br />
man Hochbegabte an Kursen für höhere Jahrgangsstufen teilnehmen lässt, indem man<br />
spezielle Hochbegabtenklassen bildet oder sie auf Eliteschulen schickt.<br />
� Beispiel für ein Hochbegabteninternat: St. Afra in Meißen<br />
� Hochbegabten-Förderklassen: z.B. am Würzburger Deutschhaus-Gymnasium<br />
� Das Würzburger Projekt zeigt, dass sich Kontroll- und Förderklasse in den<br />
Schulleistungen zumindest anfangs kaum unterschieden. Wohl aber gab es<br />
Unterschiede, was die Arbeitshaltung und Leistungsmotivation betrifft;<br />
diese waren nämlich in der Kontrollklasse, wohl aufgrund besserer<br />
Erfahrungen in der Grundschule, signifikant höher. Die Förderklasse<br />
konnte in diesem Punkt allerdings aufholen, was für die Effektivität der<br />
Differenzierungsmaßnahme spricht.<br />
155
D 2: Gedächtnisentwicklung und schulische/akademische Leistung<br />
1. Überblick über die wichtigsten „Determinanten“ des Gedächtnisses<br />
� Die (selektive) Aufmerksamkeit: Nur die Infos, auf die wir unsere Aufmerksamkeit<br />
richten, werden uns bewusst – und evtl. im LZG gespeichert; der Rest wird<br />
ausgeblendet und geht verloren.<br />
� Die (Arbeits-)Gedächtniskapazität: Der Begriff der Kapazität bezieht sich einerseits<br />
auf die Speichergröße und -dauer, andererseits auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit<br />
des Arbeitsgedächtnisses; ein Maß für die Gedächtniskapazität ist die sog.<br />
„Gedächtnisspanne“: sie liegt bei Erwachsenen bei 7+/- 2 Items.<br />
� Vorwissen: Unser Wissen ist in Form assoziativer Netzwerke organisiert; inhaltliches<br />
Vorwissen erleichtert daher sowohl die Enkodierung neuen Wissens (sofern es leichter<br />
ist, ein vorhandenes Netzwerk zu erweitern, als ein neues zu schaffen), als auch den<br />
Abruf (sofern in einem dichten Assoziationsnetz derselbe Knotenpunkt auf<br />
verschiedenen Assoziationswegen erreicht werden kann).<br />
� Das Metagedächtnis: Unter Metagedächtnis versteht man das Wissen über<br />
Gedächtnisvorgänge; einer Metaanalyse von Schneider zufolge besteht zwischen dem<br />
Metagedächtnis und der Gedächtnisleistung ein Zusammenhang von r = .41 (nicht<br />
überragend, aber stabil); vermittelt wird dieser Zusammenhang vermutlich v.a. über<br />
die Anwendung von Strategien, die bei gutem Metagedächtnis stärker ausgeprägt ist.<br />
� Deklaratives Metagedächtnis: das faktisch verfügbare und verbalisierbare<br />
Wissen um Gedächtnisvorgänge<br />
� Wissen über Personmerkmale: Wie gut ist das eigene Gedächtnis und das<br />
Gedächtnis anderer?<br />
� Wissen über Aufgabenmerkmale: Was macht bestimmte<br />
Gedächtnisaufgaben schwerer als andere?<br />
� Wissen über Strategiemerkmale: Welche Enkodier- und Abrufstrategien<br />
gibt es und welche Funktion und Bedeutung haben sie?<br />
� Prozedurales Metagedächtnis: Die Fähigkeit zur Planung, Überwachung bzw.<br />
Kontrolle und Regulation gedächtnisbezogener Aktivitäten („monitoring“ und<br />
„controll“)<br />
� z.B. die Fähigkeit, sich einen Lernstoff sinnvoll einzuteilen bzw. auf<br />
schwer zu Merkendes mehr-, auf Einfaches weniger Zeit zu verwenden<br />
(Allokation der Lernzeit) usw.<br />
� Lern- und Gedächtnisstrategien: sind kognitive Operationen, die der Optimierung<br />
der obligatorischen Verarbeitungsprozesse dienen und insofern über diese<br />
hinausgehen. Sie werden bewusst gesteuert und sind zielgerichtet. 3 Arten von<br />
Lernstrategien lassen sich unterscheiden:<br />
� Kognitive Lernstrategien (= Informationsverarbeitungsstrategien)<br />
� Wiederholung - Mneomonische Strategien (Mnemotechniken)<br />
� Organisation - Strukturierende Strategien<br />
� Elaboration - Generative Strategien<br />
� Metakognitive Lernstrategien (= Kontrollstrategien)<br />
� Planung (z.B. das Setzen von Zielen, die Antizipation von Problemen etc.)<br />
� Selbstüberwachung (Verständniskontrolle etc.)<br />
� Bewertung<br />
� Regulation (Lernzeitallokation etc.)<br />
� „Stützstrategien“ (des externen Ressourcenmanagements)<br />
� Gestaltung der Lernumgebung, Beschaffung von gutem Lernmaterial etc.<br />
� „Skripts“ bzw. „Generalized Event Representations“: sind Schemata, die sich auf<br />
häufig wiederkehrende Ereignisse beziehen (Kontext, Akteure, Handlungen etc.)<br />
156
2. Die Entwicklung des Gedächtnisses in der frühen Kindheit (0-4 Jahre)<br />
A) Gedächtnis bei Säuglingen und Kleinkindern<br />
� Es ist empirisch belegt, dass bereits Neugeborene über Gedächtniskompetenzen<br />
verfügen.<br />
� Wiedererkennung (Recognition) ist eine dieser Kompetenzen: Die Fähigkeit<br />
dazu ist schon von Geburt an vorhanden und verbessert sich in den ersten<br />
Lebensmonaten beträchtlich.<br />
� Bei Säuglingen wird die Wiedererkennungsleistung meist mit Hilfe des<br />
Habituationsverfahrens bzw. der Präferenzmethode geprüft: Fixieren<br />
Babys Stimuli, die ihnen schon einmal präsentiert wurden, weniger lang als<br />
neue Stimuli, erkennen sie diese offenbar wieder (kann z.B. mit Bildpaaren<br />
getestet werden, wobei immer ein bekanntes und ein unbekanntes Bild<br />
zusammen dargeboten werden)<br />
� Assoziatives Lernen und motorisches Gedächtnis: Schon 3 Monate alte<br />
Säuglinge, die gelernt haben, durch Strampeln ein Mobile in Bewegung zu<br />
setzen (assoziatives Lernen), merken sich diese Kontingenz bis zu 8 Tagen<br />
(Verfahren der konjugierten Verstärkung nach Carolyn Rovee-Collier).<br />
� Der situative Kontext, in dem Fall: ein um das Bett herum aufgespanntes<br />
Muster, fungiert dabei als „retrieval cue“ (Abrufreiz): War das Muster in<br />
der Lern- und Abrufphase dasselbe, erinnerten sich die Babys nämlich<br />
leichter!<br />
� Die freie Reproduktion (Recall) ist eine komplexere Form des Erinnerns. Auch sie<br />
wird jedoch schon von sehr jungen Kindern (ca. ab 1 ½ Jahren) in Ansätzen<br />
beherrscht. Im Unterschied zu Rekognitionsleistungen entwickelt sich die<br />
Reproduktionsfähigkeit im Verlauf der Kindheit und Jugend jedoch noch in<br />
beträchtlichem Maß weiter (s.u.).<br />
� Da Imitationslernen die Fähigkeit zur freien Reproduktion (Recall) voraussetzt,<br />
dient bei Säuglingen und Kleinstkindern die verzögerte Imitation als Maß für<br />
Recall.<br />
� Meltzoff: Kindern zw. 9 und 14 Monaten werden an Gegenständen, auf<br />
die sie selbst keinen Zugriff haben, neue Handlungen vorgeführt. Bietet<br />
man den Kindern die betreffenden Gegenstände 24 Stunden später zum<br />
Eigengebrauch an, imitieren sie die am Tag davor gesehenen Handlungen!<br />
Nach einer Woche erinnern sich nur noch die älteren Pbn!<br />
� Autobiographisches Gedächtnis und infantile Amnesie: Ereignisse, die sich vor<br />
dem 3. Lebensjahr abgespielt haben, können später nicht mehr erinnert werden.<br />
� Mögliche Erklärungen:<br />
� Theory of Mind: Ein Selbstkonzept bildet sich erst ab 2-3 Jahren heraus –<br />
vorher können Ereignis nicht als selbst erlebt abgespeichert werden (s.u.)!<br />
� Veränderung der Repräsentation: Erinnerungen der frühen Kindheit<br />
werden in einem anderen (nicht sprachlichen) Format enkodiert, weshalb<br />
sie später nicht mehr abgerufen werden können.<br />
� Reifung: Die Hirnstrukturen, die bewusstes Erinnern ermöglichen, sind in<br />
den ersten Lebensjahren noch nicht voll funktionsfähig!<br />
� Wissensstrukturen: Es fehlt Kindern an adäquaten Wissenstrukturen<br />
(„Skripts“), um erlebte Ereignisse einzuordnen.<br />
157
B) Gedächtnis im Vorschulalter (2-4 Jahre)<br />
� Viele Befunde sprechen dafür, dass das implizite („unwillkürliche“) Gedächtnis<br />
schon in früher Kindheit voll entfaltet ist, während das explizite („willkürliche“)<br />
Gedächtnis sich erst allmählich entwickelt.<br />
� Zur Unterscheidung der beiden Gedächtnisformen:<br />
� Explizites Gedächtnis: Inhalte sind bewusst und können dementsprechend<br />
verbal beschrieben bzw. als mentale Vorstellung visualisiert werden.<br />
� Implizites Gedächtnis: Nachwirkungen einer Lernerfahrung, derer man sich<br />
nicht bewusst ist.<br />
� Zur Messung der beiden Gedächtnisformen:<br />
� Bildergänzungsaufgabe (Russo et al.): 4- und 6-Jährige bekommen für jew.<br />
3 Sekunden 12 Bilder gezeigt (Benennungsphase); nach einer 10minütigen<br />
Spielpause die bereits gesehenen, sowie 12 neue Bilder, jeweils in<br />
Fragmentform dargeboten, wobei die Fragmente so lange ergänzt werden, bis<br />
die betreffenden Bilder entweder erkannt oder ganz sichtbar sind. Dabei<br />
sollen die Pbn a) so schnell wie möglich angeben, um was es sich handelt<br />
(„implizite“ Aufgabe) und b) angeben, welche Bilder sie schon aus der<br />
vorhergehenden Benennungsphase kennen („explizite“ Aufgabe); erstere<br />
wird von 4- und 6-Jährigen gleich gut gelöst, bei letzterer bestehen deutliche<br />
Altersunterschiede!<br />
� Diskrepanz zw. Rekognition und Reproduktion => Grund: In Rekognitionsaufgaben<br />
stehen „retrieval cues“ zur Verfügung; in Reproduktionsaufgaben nicht; da<br />
Kleinkinder i.d.R. kein intentionales Memorierverhalten zeigen, sind sie auf solche<br />
cues jedoch stark angewiesen.<br />
� Die Bedeutung von Skripts: Schon sehr junge Kinder (unter 3 Jahren!) organisieren<br />
wiederkehrende Ereignisse (etwa das tägliche Schlafengehen) in Form von Skripts<br />
(schematisierte „Drehbücher“).<br />
� Die LOGIK-Studie zeigt: Drei- bis Vierjährige können Geschichten mit<br />
Skriptcharakter („Geburtstagsparty“) besser reproduzieren als Geschichten, die<br />
sich nicht in ein allgemeines Schema einordnen lassen. In höherem Alter nimmt<br />
der Einfluss des Skriptwissens ab.<br />
3. Die Entwicklung des Gedächtnisses zwischen 5 und 15 Jahren<br />
� Die entscheidenden Entwicklungen des sprachlichen Gedächtnisses finden zw. 5 und<br />
15 Jahren statt. In dieser Zeit sind dementsprechend die größten Leistungszuwächse<br />
zu beobachten.<br />
A) Die Gedächtniskapazität<br />
� Die Gedächtnisspanne ist die Anzahl von Items (Wörter, Zahlen oder Buchstaben),<br />
die nach kurzer Präsentation in der richtigen Reihenfolge reproduziert werden kann.<br />
� Sie nimmt in der Grundschulzeit rapide zu:<br />
� 4 Zahlen im Alter von 4 Jahren � 6-7 Zahlen im Alter von 12 Jahren<br />
� Mögliche Erklärungen für die alterskorrelierte Verbesserung der Gedächtnisspanne:<br />
� Kapazitätshypothese: Aufgrund neuronaler Reifungsprozesse kommt es zu einer<br />
sukzessiven und strukturellen Steigerung der Gedächtniskapazität!<br />
� Erhöhte Item-Identifikationsgeschwindigkeit<br />
� Mangelnde Speicherfähigkeit für Reihenfolge-Infos bei Kindern<br />
� Vermehrte Anwendung von Strategien<br />
158
� Die Kapazitätshypothese wird heute von den meisten Forschern angezweifelt.<br />
Stattdessen tendiert man zunehmend dazu, Verbesserungen des Gedächtnisses auf<br />
Prozessmerkmale zurückzuführen.<br />
� V. a. 2 Modelle sind dabei populär: Das eine führt die Verbesserung der<br />
Gedächtnisspanne auf eine höhere Item-Identifikations- und<br />
Verarbeitungsgeschwindigkeit zurück (Case), das andere Modell erklärt die<br />
Verbesserung mit einer erhöhten Artikulationsgeschwindigkeit (Baddeley).<br />
� Die Theorie von Robbie Case: geht davon aus, dass sich im Lauf der Entwicklung<br />
nicht die Verarbeitungskapazität, sondern lediglich deren Effizienz ändert (s.o.).<br />
� Case unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen dem „operating space“<br />
(Arbeitsspeicher) und dem „storage space“ (Kurzzeitspeicher).<br />
� Durch biologische Reifung (Myelinisierung der Nervenbahnen), v.a. aber durch<br />
die zunehmende Automatisierung kognitiver Prozesse (Übung und Anwendung<br />
von Strategien), laufen diese zunehmend schneller ab und brauchen weniger<br />
Platz im „operating space“ – mit dem Ergebnis, dass mehr Speicherplatz im<br />
„storage space“ zur Verfügung steht!<br />
� Die Theorie von Baddeley: unterscheidet im Zusammenhang mit dem<br />
Arbeitsgedächtnis zwischen einer zentralen Exekutive und 2 Dienstleistungssystemen:<br />
eines davon („visuo-spatial scratch pad“) ist für die Verarbeitung bildhafter Infos<br />
zuständig, das andere („phonological loop“) für die Verarbeitung verbaler Infos.<br />
� Für die Verarbeitung verbaler Infos gilt dabei: Je mehr Wörter in einer<br />
bestimmten Zeitspanne artikuliert werden können, umso länger die<br />
Sequenzen, die im „phonological loop“ simultan gespeichert bzw. verarbeitet<br />
werden können.<br />
� Daher auch der Wortlängeneffekt (je kürzer die Wörter, desto mehr werden<br />
gemerkt)<br />
� Die Verbesserung der Gedächtnisspanne ist vor diesem Hintergrund auf die<br />
Artikulationsgeschwindigkeit zurückzuführen, die mit zunehmendem Alter<br />
steigt!<br />
B) Gedächtnisstrategien<br />
� Befunde zur Entwicklung der einzelnen Strategien:<br />
� Anwendung von Wiederholungsstrategien: ist a)alterskorreliert u. b)effektiv<br />
Flavell (1966): Kindergartenkindern, Zweit- und Fünftklässlern wurde eine<br />
Serie von Bildern gezeigt mit der Aufforderung, sie sich in der richtigen<br />
Reihenfolge zu merken; nach der Präsentation bekamen die Pbn 5 Min. Zeit, sich<br />
auf die Reproduktion der Sequenz vorzubereiten.<br />
� Nur 10% der Kindergartenkinder bewegten dabei ihre Lippen oder<br />
wiederholten die Wörter laut; von den Fünftklässlern wendeten dagegen<br />
85% diese Strategie an.<br />
� Dabei konnte für jede Altersgruppe gezeigt werden, dass die Anwendung der<br />
Strategie zu besseren Leistungen führt.<br />
� Die Organisation des Lernstoffs: ist ebenfalls alterkorreliert und effektiv<br />
Schneider: zeigte 7- und 10-jährigen Kindern mehrere Bildkarten und forderte<br />
sie explizit dazu auf, „alles zu tun, was ihnen später hilft, sich an die Dinge zu<br />
erinnern.“<br />
� Von den 7-Jährigen ordneten nur 10% die Bilder nach ihrer<br />
Kategorienzugehörigkeit (z.B. Tiere, Fahrzeuge, Möbel etc.); von den 10-<br />
Jährigen wandten dagegen 60% diese Strategie an und erzielten<br />
dementsprechend bessere Ergebnisse!<br />
� Elaborationsstrategien: werden im Gegensatz zu Wiederholungs- und<br />
Organisationsstrategien erst verhältnismäßig spät (frühe Adoleszenz)<br />
159
angewandt; darüber hinaus gibt es bis ins Erwachsenenalter große<br />
interindividuelle Unterschiede, was die Effektivität ihrer Nutzung betrifft (s.u.:<br />
Nutzungsdefizit).<br />
� Zur Interpretation der Daten:<br />
� Querschnittstudien (Gruppendaten) zur Anwendung von Strategien legen nahe,<br />
dass die strategischen Fertigkeiten mit dem Alter kontinuierlich zunehmen.<br />
Längsschnittstudien (Individualdaten) wie die Münchener Längsschnittstudie<br />
LOGIK (s.u.) zeigen dagegen, dass der Übergang zum Gebrauch von Strategien<br />
bei den meisten Kindern eher abrupt als graduell verläuft.<br />
� Grundsätzlich gilt: Je komplexer eine Strategie, desto später wird sie erlernt;<br />
über ein umfassendes und flexibel einsetzbares Strategierepertoire verfügen<br />
Kinder bzw. Jugendliche vermutlich erst im Alter zw. 15 und 16.<br />
� Wichtig: Wie Studien mit Naturvölkern zeigen, handelt es sich bei Strategien um<br />
ein Kulturprodukt; sie treten demnach keineswegs zwangläufig auf, sondern<br />
müssen vermittelt werden!<br />
� Insofern in verschiedenen Altersstufen mehr oder weniger spezifische Probleme<br />
auftreten, lassen sich bezüglich des Strategieerwerbs 3 Stadien unterscheiden:<br />
1) Mediationsdefizit (tritt v. a. bei jüngeren Kindergartenkindern auf): Strategien<br />
können auch nach Vermittlung und Training nicht angewandt werden, da<br />
offenbar die nötigen Voraussetzungen (Mediatoren) fehlen.<br />
2) Produktionsdefizit (lässt sich v. a. bei Vorschulkindern und Schulanfängern<br />
beobachten): Strategien können zwar nach Vermittlung und Training<br />
gewinnbringend genutzt werden, werden aber nicht spontan, sondern nur nach<br />
Aufforderung angewandt.<br />
� Das Produktionsdefizit ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass das<br />
Wissen über die Nützlichkeit einer Strategie (als ein Teil des deklarativen<br />
Metagedächtnisses) noch nicht hinreichend ausgebildet ist!<br />
3) Nutzungsdefizit (z. T. sogar noch bei Erwachsenen beobachtbar): Strategien<br />
werden zwar angewandt, führen aber nicht zu einer Leistungsverbesserung.<br />
� Das Nutzungsdefizit kann 2 Ursachen haben:<br />
a) eine unzureichende Automatisierung der Strategie (Anwendung<br />
schluckt noch zu viel Kapazität)<br />
b) eine mangelnde Sensitivität dafür, wann und wie die Strategie<br />
wirkungsvoll einsetzbar ist<br />
� Das Nutzungsdefizit geht mit motivationalen Problemen einher („Wozu<br />
das Ganze, wenn es ohnehin nichts bringt?“), denen im Unterricht<br />
entgegengewirkt werden muss.<br />
� Das Nutzungsdefizit muss keineswegs notwendigerweise auftreten und ist<br />
daher in der Forschung umstritten; tatsächlich tritt es vermutlich v. a. bei<br />
komplexeren Lernstrategien auf.<br />
C) Inhaltliches Vorwissen<br />
� Unser Wissen ist in Netzwerken organisiert, in dem ähnliche Inhalte miteinander<br />
verknüpft sind. Mit zunehmendem Alter bzw. Wissen wächst sowohl die Menge an<br />
Knoten, als auch die Anzahl an Verbindungen, was sowohl die Enkodierung als auch<br />
den Abruf von Gedächtnisinhalten erleichtert.<br />
� Wie stark dieser Effekt ist, zeigt u.a. ein klassisches Experiment von<br />
CHI (1978): Schachexperten und Schachneulinge bekamen die Aufgabe, in einer<br />
kurzen Lernphase präsentierte Schachpositionen auf einem leeren Schachbrett zu<br />
rekonstruieren. Die Versuchsgruppen wurden dabei so gewählt, dass Alter und<br />
Wissen negativ miteinander korrelierten: Die Experten waren zw. 6 und 10<br />
Jahre alt, die Novizen Erwachsene unterschiedlichen Alters.<br />
160
� Ergebnis: Obwohl die Schachexperten jünger waren als die Neulinge und<br />
über eine geringere Gedächtnisspanne verfügten, schnitten sie wesentlich<br />
besser ab als diese. Vorwissen hat demnach einen so großen Einfluss auf die<br />
Gedächtnisleistung, dass dadurch sogar Altersunterschiede nivelliert werden<br />
können.<br />
� Erklärung: besseres „Chunking“ bei Experten!<br />
D) Metagedächtnis<br />
� Das deklarative Metagedächtnis: ist erst gegen Ende der Grundschulzeit<br />
einigermaßen konsolidiert<br />
� Untersucht wird die Entwicklung des dekl. MG anhand von Interviewstudien:<br />
� Eine klassische Interviewstudie von KREUTZER zeigt, dass sich das<br />
deklarative Metagedächtnis im Lauf der Grundschulzeit beständig verbessert,<br />
so dass Fünftklässler bereits über ein recht spezifisches Wissen über Person-,<br />
Aufgaben- und Strategiemerkmale verfügen.<br />
� In der LOGIK-Studie (s.u.) wurde dieser Befund repliziert.<br />
� Das prozedurale Metagedächtnis: Im Hinblick auf die Entwicklung des<br />
prozeduralen Metagedächtnisses, muss zwischen Überwachungsprozessen<br />
(„monitoring“) und Prozessen der Selbstregulation („Controll“) unterschieden werden.<br />
� A) Die Fähigkeit zur Überwachung („monitoring“) eigener Lernprozesse wird<br />
üblicherweise anhand von Leistungsvorhersagen und Performanzurteilen<br />
getestet. Zwar sind diese bereits bei Grundschülern z. T. recht präzise, sie<br />
entwickeln sich jedoch bis zur Adoleszenz weiter.<br />
1) Paradigma der Leistungsvorhersage: „Feeling of knowing“ (FOK)<br />
- Dabei werden die Kinder gefragt, ob sie sich zutrauen, momentan nicht<br />
erinnerte Items in einer Wiedererkennungsaufgabe zu identifizieren.<br />
2) Paradigma der Leistungsvorhersage: „Ease of learning“ (EOL)<br />
- Dabei werden Kinder gebeten, vor der Bearbeitung einer<br />
Gedächtnisaufgabe einzuschätzen, wie sie darin abschneiden werden,<br />
sprich wie viele Items sie sich merken werden.<br />
3) Paradigma der Leistungsvorhersage: „Recall Readiness”<br />
- Jüngere Kinder haben oft Probleme ihre Reproduktionsbereitschaft<br />
(recall readiness) richtig einzuschätzen, was dazu führt, dass sie<br />
Lernvorgänge oft zu früh abbrechen (Selbstüberschätzung?!).<br />
4) Paradigma der Performanzurteile: „Judgement of learning” (JOL)<br />
- Dabei sollen die Kinder nach der Bearbeitung einer Gedächtnisaufgabe<br />
einschätzen, wie sie beim nächsten Lerndurchgang abschneiden werden.<br />
� B) Selbstregulative Fähigkeiten („control“) => noch deutlichere Alterstrends<br />
als beim „monitoring“:<br />
� Allokation der Lernzeit: Vorschulkinder verwenden auf leicht zu lernendes<br />
Material (z.B. hoch assoziative Wortpaare wie Hund – Katze) genauso viel<br />
Zeit wie auf leicht zu lernendes Material; erst ab ca. 10 Jahren wird auf<br />
leichten Lernstoff signifikant weniger Zeit verwendet!<br />
� Zum Zusammenhang zwischen Metagedächtnis und Gedächtnis (r = .41):<br />
� Ein unzureichend entwickeltes deklaratives Metagedächtnis, genauer: fehlendes<br />
Wissen über die Relevanz von Strategien, wird als Ursache für das<br />
Produktionsdefizit angesehen (s.o.); aus diesem Grund nimmt der<br />
Zusammenhang zw. Metagedächtnis und Gedächtnis mit dem Alter zu!<br />
� Rückkopplungshypothese (Flavell): Die Beziehung zwischen Trainingserfolg<br />
und Metagedächtnis ist bidirektional!<br />
161
E) Die Fuzzy-Trace-Theorie (Brainerd& Reyna)<br />
� Die Fuzzy-Trace-Theorie unterscheidet wird dabei zwischen 2 Repräsentationstypen<br />
(„verbatim“ und „gist“). Bei der Enkodierung von Informationen, werden immer<br />
beide Typen parallel generiert; welcher der beiden Typen dominanter ist, hängt dabei<br />
vom Alter ab.<br />
� Verbatim (im Vorschulalter dominant): exakte Repräsentation;<br />
„wortwörtliches Gedächtnis“; gespeichert werden Oberfächenmerkmale eines<br />
Items bzw. Sachverhalts in Form sog. „verbatim traces“<br />
� Gist (nach dem Vorschulalter dominant): abstrakte Repräsentation;<br />
„Gedächtnis fürs Wesentliche“; gespeichert wird die Bedeutung eines<br />
Sachverhalts in Form sog. „fuzzy traces“<br />
� Gist- und verbatim traces sind funktional dissoziiert. D.h.: sie werden separat<br />
gespeichert und durch entsprechende Hinweisreize unabhängig voneinander<br />
abgerufen.<br />
� Dabei gilt, dass verbatime Informationen wesentlich schneller vergessen werden<br />
als Gist-Informationen (fuzzy traces sind stabiler, langfristiger verfügbar,<br />
leichter abrufbar und manipulierbar)<br />
� „Reduction to essence rule“: Kein Wunder also, dass das<br />
Informationsverarbeitungssystem Repräsentationen favorisiert, die so nah wie<br />
möglich am „fuzzy“-Ende des Kontinuums liegen. Kurz: Wir merken uns das<br />
Wesentliche einer Info lieber als deren Oberflächenmerkmale!<br />
� Die altersbedingten Unterschiede der Gedächtnisleistungsfähigkeit werden von<br />
Baynerd und Reyna v.a. auf 2 Ursachen zurückgeführt:<br />
1) Die Entwicklung des Gedächtnisses ist der Fuzzy-Trace-Theorie zufolge durch<br />
einen „verbatim-gist-shift“ gekennzeichnet: Während im Vorschulalter noch<br />
die verbatime Verarbeitung dominiert, werden im Verlauf der Grundschulzeit die<br />
Gist-Repräsentationen zunehmend dominanter.<br />
� Kurz: Jüngere Kinder sind darauf spezialisiert, wortwörtliche Information<br />
aus dem Kurzzeitgedächtnis abzurufen (adaptiver Vorteil beim<br />
Spracherwerb), ältere hingegen sind besser darin, „das Wesentliche“ aus dem<br />
Langzeitgedächtnis abzurufen.<br />
2) Ein weiterer Bestandteil der Fuzzy-trace-Theorie ist das sog.<br />
Optimierungsmodell, im Zuge dessen Entwicklungsveränderungen nicht auf<br />
strategisches Verhalten oder das Metagedächtnis zurückgeführt werden, sondern<br />
auf die altersabhängige Sensitivität gegenüber Interferenzen: Demnach liegen<br />
die schlechteren Gedächtnisleistungen jüngerer Kinder v.a. darin begründet, dass<br />
diese sich schlechter konzentrieren- und aufgabenirrelevante Informationen nur<br />
bedingt unterdrücken können.<br />
� Als Beleg für die Bedeutsamkeit von Interferenzen wird die Reihenfolge<br />
angesehen, in der sog. starke und schwache (im vorhergehenden Durchgang<br />
nicht erinnerte) Gedächtnisinhalte erinnert werden. Da die Wiedergabe<br />
schwacher Inhalte durch sog. Outputinterferenzen stärker beeinträchtigt wird<br />
als die Wiedergabe gedächtnisstarker Inhalte, ergibt sich bei der Wiedergabe<br />
mehrerer Items nämlich ein typisches Muster (Cognitive-Triage-Effekt): Da<br />
die Output-Interferenzen zu Beginn einer Wiedergabephase noch<br />
verhältnismäßig gering sind, werden zuerst schwache Items wiedergegeben<br />
(=> wodurch die Outputinterferenz steigt) => Es folgt einer Reihe<br />
gedächtnisstarker Inhalte, wodurch die Outputinterferenz wieder sinkt, so<br />
dass am Ende noch einmal schwache Inhalte wiedergegeben werden können.<br />
162
D 3: Metakognitives Wissen und Lern-/Denkstrategien<br />
1. Subkategorien der Metakognition:<br />
� 2-Komponentenmodell (Flavell u.a.): Klassischer Weise wird im Hinblick auf<br />
Metakognition zwischen 2 Komponenten unterschieden: dem Wissen über die eigenen<br />
Kognitionen (deklarative Wissenskomponente) und der Kontrolle über die eigenen<br />
Kognitionen (prozedurale Kontrollkomponente).<br />
� HASSELHORN (dem Arsch) ist diese Unterscheidung nicht genau genug. Er schlägt<br />
daher folgende Klassifikation kognitiver Prozesse vor:<br />
1) Systemisches Wissen<br />
a) Wissen über das eigene kognitive System und seine Funktionsgesetze<br />
(Wissen über eigene Stärken und Schwächen etc.)<br />
b) Wissen über Lernanforderungen (adäquate Einschätzung von<br />
Aufgabenschwierigkeiten)<br />
c) Wissen über Strategien<br />
2) Epistemisches Wissen<br />
a) Wissen über die eigene kognitive Verfassung und Lernbereitschaft<br />
b) Wissen über die Inhalte und Grenzen des eigenen Wissens (Wo sind Lücken<br />
usw.?)<br />
c) Wissen über Verwendungsmöglichkeiten des eigenen Wissens<br />
3) Exekutive Prozesse (entspricht der Kotrollkomponente im klassischen Modell)<br />
a) Planung eigener Lernprozesse<br />
b) Überwachung eigener Lernprozesse<br />
c) Steuerung bzw. Regulation eigener Lernprozesse<br />
4) Sensitivität für die Möglichkeiten kognitiver Aktivitäten (muss nicht bewusst<br />
sein)<br />
a) Erfahrungswissen<br />
b) Intuition<br />
5) Metakognitive Erfahrung bezüglich der eigenen kognitiven Aktivität<br />
(bewusst)<br />
a) Bewusste kognitive Empfindungen (z.B. „verwirrt sein“ über scheinbare<br />
Widersprüche in einem Text etc.)<br />
b) Bewusste affektive Zustände (z.B. „bedrückt“ sein, weil man etwas nicht<br />
versteht etc.)<br />
� Auch wenn die verschiedenen Subkomponenten der Metakognition im Einzelnen<br />
unterschiedliche Funktionen haben, weisen alle mindestens eines von 2 Merkmalen<br />
auf: Sie enthalten entweder eine Reflexion über den eigenen Lernprozess oder<br />
beziehen sich auf strategische Aktivitäten!<br />
� Die metakognitive Reflexion kann dabei entweder vergangenheitsbezogen<br />
(Nachdenken über das Lernen) oder gegenwartsbezogen (Nachdenken während<br />
des Lernens) sein!<br />
� Über das Bindeglied der Reflexion sind die einzelnen Komponenten der<br />
Metakognition so eng miteinander verknüpft, dass sie sich empirisch z.T. kaum<br />
voneinander trennen lassen.<br />
� Inter-individuelle Unterschiede in den metakognitiven Kompetenzen lassen sich nach<br />
Baker durch 3 Klassen von Einflussfaktoren erklären:<br />
1) Biologische Reifungsmechanismen<br />
2) Soziale Einflüsse<br />
3) Ausmaß und Intensität von Eigenaktivität<br />
163
2. Lernstrategien:<br />
A) Kognitive Lernstrategien<br />
� Wiederholungsstrategien (Rehearsal): dienen dazu, Inhalte vom KZG ins LZG zu<br />
übertragen; zum Lernen komplexer Zusammenhänge ist die Wiederholungsstrategie,<br />
sofern man sie nicht mit anderen Strategien kombiniert, jedoch ungeeignet. Ihre<br />
Anwendung bietet sich v.a. für das Lernen isolierter Fakten an.<br />
� Effektiv sind dabei v.a. „kumulative“ Wiederholungsstrategien, also solche, bei<br />
denen nicht jedes Item einzeln, sondern mehrere Items zusammen wiederholt<br />
werden.<br />
� Organisationsstrategien: zielen auf die interne Verknüpfung und Strukturierung des<br />
Lernmaterials (Reduktion); auf diese Weise können komplexe Inhalte zu größeren<br />
Einheiten zusammengefasst werden (Chunking), was sowohl die Enkodierung, als<br />
auch den späteren Abruf der betreffenden Infos erleichtert.<br />
� Die Kategorisierung erfolgt dabei meist nach semantischen Kriterien: Erstellen<br />
von Mindmaps und Begriffshierarchien, Exzerpte erstellen, Wichtiges<br />
unterstreichen, Gliederung eines Texts in Unterabschnitte, Sortieren von Infos<br />
Clusterbildung etc.<br />
� Elaborationsstrategien (=generative Strategien): Hierbei werden die neuen Infos zu<br />
bereits Bekanntem in Bezug gesetzt; anders als bei Organisationsstrategien wird der<br />
Stoff also nicht reduziert, sondern sinnvoll erweitert, z.B. indem…<br />
� Vorwissen aktiviert-, weitere Beispiele gesucht-, Querverbindungen hergestellt,<br />
bildliche Vorstellungen generiert- oder nach Analogien gesucht wird.<br />
� Ebenfalls zu den Elaborationsstrategien zu zählen sind sog. „Mnemotechniken“:<br />
z.B. die Loci-Methode, Eselsbrücken („333- bei Issos Keilerei“) oder die<br />
„Schlüsselwortmethode“ (lat. „cubare“ => „Die Kuh liegt auf der Bahre“)<br />
B) Metakognitive Lernstrategien<br />
� Planung: Welches Ziel soll angestrebt werden (Zielsetzung) und wie soll es erreicht<br />
werden (Auswahl geeigneter Strategien)?<br />
� Die Zielsetzung betrifft nicht nur das primäre Ziel (etwa einen Text lernen),<br />
sondern auch sekundäre Ziele (etwa die angestrebte Dauer)<br />
� Die Auswahl geeigneter Strategien setzt eine Aufgabenanalyse und eine Prüfung<br />
der eigenen Ressourcen voraus; darüber hinaus sind evtl. Probleme, die beim<br />
Lernprozess auftreten könnten, zu antizipieren.<br />
� Überwachung: Bin ich auf dem richtigen Weg?<br />
� Permanenter Vergleich zwischen dem Ist- und Soll-Zustand; Registrierung von<br />
Problemen, Einschätzung des eigenen Fortschritts etc.<br />
� Die Überwachung („monitoring“) löst ihrerseits Regulationsprozesse („control“)<br />
aus: Allokation der Lernzeit, Wiederholung etc.<br />
� Bewertung: Habe ich das gesteckte Ziel erreicht?<br />
� Abschließende Bewertung ermöglicht eine Verbesserung bei zukünftig zu<br />
bearbeiteten Aufgaben (führt zu einer Steigerung des deklarativen<br />
Metagedächtnisses)<br />
D) Das „Modell des Guten Informationsverarbeiters“ (GIV/GIP) von Pressley<br />
� Im Zentrum des Modells steht die effektive Anwendung von Strategien. Diese hängt<br />
dem Modell zufolge von verschiedensten Komponenten ab, die ihrerseits wiederum<br />
miteinander interagieren.<br />
� Der GIV verfügt einerseits über generelles-, andererseits über spezifisches<br />
Strategiewissen.<br />
164
� Die Anwendung komplexerer Strategien (Organisation und Elaboration)<br />
erfordert jedoch nicht nur metakognitives, sondern auch bereichsspezifisches<br />
Vorwissen. Auch über dieses verfügt der GIV!<br />
� Darüber hinaus ist er dazu in der Lage, sein Strategiewissen durch die Evaluation<br />
der eigenen Lernprozesse selbständig zu erweitern („Selbstoptimierung“)…<br />
3. Verschiedene Lerntypen und Lernstile<br />
� Offner (1924): unterschied schon früh zwischen formalen und materialen Lerntypen.<br />
� Während materiale Lerntypen eine Präferenz für bestimmte Inhalte (etwa<br />
Musik oder Naturwissenschaften) haben, sind formale Lerntypen durch einen<br />
bevorzugten Lernstil (mechanisch, logisch mnemotechnisch) gekennzeichnet.<br />
� Diese typologische Unterscheidung gilt heute jedoch als überholt; in der Realität<br />
kommen allenfalls Mischformen vor!<br />
� Witkin (1977): unterscheidet zwischen verschiedenen „kognitiven Stilen“; dabei<br />
handelt es sich aus seiner Sicht um stabile, intelligenzunabhängige<br />
Verarbeitungspräferenzen<br />
� Die bekanntesten kognitiven Stile sind: „Feldabhängigkeit“ vs.<br />
„Feldunabhängigkeit“ und „Impulsivität“ vs. „Reaktivität“<br />
� Feldabhängige Personen tendieren zu ganzheitlicher Wahrnehmung,<br />
haben Schwierigkeiten, wichtige Details zu fokussieren und sind weniger<br />
kompetent in der Anwendung und Überwachung kognitiver Strategien.<br />
Dafür haben sie jedoch ein gutes Gedächtnis für soziale Situationen und<br />
arbeiten gut in Gruppen (Interessen: Literatur und Geschichte)<br />
� Feldunabhängige Personen tendieren dagegen zu einer analytischen<br />
Betrachtungsweise und sind besser in der Anwendung und Überwachung<br />
kognitiver Strategien (Interessen: Mathe und Naturwissenschaften)<br />
� Neuere Befunde haben gezeigt, dass die besagten Stile keineswegs unabhängig<br />
von der Intelligenz sind; darüber hinaus führen sie nicht nur zu qualitativ-,<br />
sondern auch zu quantitativ unterschiedlichen Lernleistungen: Feldunabhängige<br />
Personen sind feldabhängigen nämlich überlegen!<br />
� Aktuell wird nicht mehr zwischen kognitiven Stilen, sondern zwischen verschiedenen<br />
„Lernstilen“ bzw. „Lernorientierungen“ unterschieden; die Art des Lernens wird<br />
dabei zu den jeweils verfolgten Zielen in Bezug gesetzt:<br />
� Lernende mit einer „meaning orientation“: sind intrinsisch motiviert, lernen<br />
also um der Sache willen und sind dementsprechend autonomer von externen<br />
Vorgaben; diese motivationale Ausgangslage schlägt sich wiederum in einer<br />
tiefen Verarbeitung („deep-level approach“) nieder; d.h. es werden<br />
Organisations- und Elaborationsstrategien angewendet und Verknüpfungen<br />
hergestellt!<br />
� Andere Bezeichnung: „Comprehension learners“; verwendeter Lernstil:<br />
„Tiefenverarbeitung“ („deep-level approach“) bzw. „holistische Strategie“<br />
� Lernende mit einer „reproducing orientation“: machen sich große Sorgen um<br />
das Bestehen der Prüfungen und sind dementsprechend vorwiegend extrinsisch<br />
motiviert. Der korrespondierende Lernstil zielt auf das Behalten unverbundener<br />
Fakten und wird daher auch als „Oberflächenverarbeitung“ („surface-level<br />
approach“) bzw. „serielle Strategie“ bezeichnet.<br />
� Andere Bezeichnung: „Operation learners“<br />
� Lernende mit einer „achieving orientation“: sind durch die Hoffnung auf<br />
Erfolg extrinsisch motiviert und werden als selbstbewusst und rücksichtslos<br />
gekennzeichnet; ihnen entspricht keine spezifische Lernstrategie<br />
� Im Ggs. z. d. beiden anderen Typen empirisch nicht sonderlich abgesichert!<br />
165
4. Selbstreguliertes bzw. selbstgesteuertes Lernen<br />
� Die Fähigkeit zur Selbstregulation entspricht der Fähigkeit, sich Ziele zu setzen und<br />
die eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen an diese Ziele anzupassen.<br />
� Selbstreguliertes Lernen kann dementsprechend auch als eigenverantwortliches<br />
Lernen charakterisiert werden.<br />
� In mehr oder minder allen Modellen zum selbstregulierten Lernen wird der Aspekt der<br />
Selbstregulation als Wechselspiel kognitiver, metakognitiver und motivationaler<br />
Prozesse beschrieben.<br />
� Im „Drei-Schichten-Modell“ (Boekaerts) des selbstregulierten Lernens wird<br />
von drei Regulationssystemen ausgegangen:<br />
1. Regulation des Selbst (Ziel- und Ressourcenwahl)<br />
2. Regulation des Lernprozesses (Verwendung metakognitiven Wissens zur<br />
Überwachung und Steuerung des Lernprozesses)<br />
3. Regulation der Informationsverarbeitung (Auswahl und Anwendung<br />
kognitiver Strategien)<br />
� Das Prozessmodell (Schmitz) betrachtet selbstreguliertes Lernen weniger als<br />
statische mentale Fähigkeit, denn als systematische Abfolge dreier Prozesse bzw.<br />
Phasen:<br />
1. Präaktionale Phase: Setzung von Zielen, an denen sich die Selbstregulation<br />
orientiert<br />
2. Aktionale (bzw. volitionale) Phase: Zielumsetzung => Exekutive<br />
Metakognition bzw. „Self-monitoring“<br />
3. Postaktionale Phase: Vergleich zw. dem Ist- und Sollzustand => Evtl.<br />
Änderung der Ziele und/oder Strategien<br />
� Das Phasenmodell (von Zimmerman): geht ebenfalls von einer zyklischen<br />
Abfolge dreier Phasen aus; berücksichtigt aber neben den relevanten Prozessen<br />
auch dispositionelle Personenmerkmale<br />
1) Vorbereitungsphase:<br />
� Aufgabenanalyse (Zielsetzung und strategische Planung)<br />
� Motivationale Überzeugungen (Lernzielorientierung, Ergebniserwartung)<br />
2) Handlungsphase<br />
� Selbstbeobachtung (Registrieren, Experimentieren)<br />
� Selbstkontrolle (Selbstinstruktion, Strategien, Aufmerksamkeitsfokus)<br />
3) Selbstreflexionsphase<br />
� Selbstbeurteilung (Kausalattribution, Selbstbewertung)<br />
� Selbstbeobachtung (Selbstzufriedenheit, Affekt etc.)<br />
� Die Förderung selbstregulierten Lernens: ist nicht nur wichtig, sondern, wie zahlreiche<br />
Studien belegen, auch möglich!<br />
� Trainingsprogramme zum selbstregulierten Lernen arbeiten meist mit<br />
Lerntagebüchern, Selbstinstruktion etc. (siehe irgendwo oben)<br />
� Ein Beispiel für ein solches Trainingsprogramm ist das „Self-Regulation<br />
Empowerment Program“ von Zimmerman.<br />
� Prinzipiell gilt: Trainings sind dann am effektivsten, wenn sie die Förderung<br />
selbstregulierten Lernens mit fachlicher Förderung verknüpfen!<br />
166
D 4: Bereichsspezifisches Wissen und Expertiseerwerb<br />
1. Expertiseforschung<br />
� „Expertise“ geht mit überdurchschnittlichen Leistungen in einem Gebiet einher und<br />
umfasst sowohl ein besonders reichhaltiges, bereichs- und aufgabenspezifisches<br />
Wissen (deklarative Komponente), als auch besondere bereichsspezifische<br />
Problemlösefähigkeiten (prozedurale Komponente).<br />
� Besonders die Gedächtnisleistungen in dem betreffenden Gebiet werden durch<br />
Expertise verbessert: Bessere Enkodierung, besserer Abruf, schnellere<br />
Verarbeitung von Information (insbes. durch „Chunking“, sprich durch die<br />
Verknüpfung von Einzelinfos zu größeren Einheiten).<br />
� Kurz: Die Überlegenheit von Experten ist bedingt durch: a) umfangreicheres<br />
Wissen, b) ein qualitativ hochwertigere Organisation dieses Wissens und<br />
c) schnellere Wahrnehmungs- und Gedächtnisprozesse!<br />
� Methoden der Expertiseforschung:<br />
� Experten-Novizen-Paradigma => kontrastive Untersuchungen (s.o.: Chi)<br />
� Prospektive Längsschnittstudien wären prinzipiell am Besten geeignet, den<br />
Expertiseerwerb zu untersuchen, sie sind jedoch praktisch kaum umsetzbar (da<br />
man vorher nicht weiß, wer sich zum Experten entwickelt, bräuchte man riesige<br />
Stichproben!)<br />
� In der Praxis wird daher meist auf retrospektive Befragungen zurückgegriffen,<br />
bei denen ausgewiesene Experten nachträglich zu ihrer Entwicklung befragt<br />
werden.<br />
� Theorien und Modelle des Expertiseerwerbs:<br />
� Das Modell zum Erwerb von Fertigkeiten (von Fitts und Posner): geht von 3<br />
qualitativ verschiedenen Stufen des Fertigkeitserwerbs aus.<br />
1) „Kognitive Stufe“: Aufgabenanalyse und Differenzierung zw. Wichtigem<br />
und weniger Wichtigem => Aufbau von deklarativem Wissen<br />
2) „Assoziative Stufe“: Überführung des auf der ersten Stufe erworbenen<br />
deklarativen Wissens in prozedurales Wissen => Effektivere Gestaltung<br />
der kognitiven Prozesse<br />
3) „Autonome Stufe“: Aufgabenausführung (z.B. Autofahren) erfolgt im<br />
Wesentlichen automatisch; bewusste Kognitionen und Kontrollprozesse<br />
nur noch selten<br />
� „Chunking-Theorie“ (von Chase und Simon): Das Wissen von Experten<br />
zeichnet sich nicht nur durch einen größeren Umfang aus, sondern v. a. durch die<br />
Verknüpfung von Einzelinfos zu größeren Einheiten (sog. „Chunks“); auf diese<br />
Weise können mehr Infos gleichzeitig verarbeitet werden!<br />
� „Skilled-memory-Theorie“ (Ericsson): Das Wissen von Experten ist nicht nur<br />
durch einen größeren Umfang und die Verfügbarkeit von mehr Chunks<br />
gekennzeichnet, sondern qualitiativ besser organisiert: Dichteres semantisches<br />
Netzwerk => dadurch kann mit neuartigen Problemen flexibler umgegangen<br />
werden (Aktivierung spezifischer Knoten führt zur Aktivierung benachbarter<br />
Bereiche); Infos können besser abgerufen werden (ein Knoten kann auf<br />
verschiedenen Assoziationswegen erreicht werden); bessere Elaboration etc. etc.<br />
167
� Expertise und Fähigkeit: Ist Expertise eine erlernte oder angeborene Kompetenz?<br />
� Empirische Befunde:<br />
� Die Korrelationen zw. allgemeiner Intelligenz und beruflichem Erfolg<br />
fallen eher niedrig aus und nehmen mit zunehmender Berufserfahrung<br />
weiter ab.<br />
� Schneider (s.o.): Fußballexperten und –novizen unterschiedlichen Alters<br />
(3.-, 5.- und 7.-Klässler) wurden hinsichtlich ihrer Behaltensleistung bei<br />
einer einfachen (auch für Nicht-Experten verständlichen)<br />
Fußballgeschichte verglichen.<br />
a) Erwartungsgemäß: Experten erzielten durchweg bessere Leistungen!<br />
b) Überraschend: Experten mit hohem und niedrigem IQ erzielten<br />
vergleichbare Ergebnisse; Defizite in der Intelligenz scheinen demnach,<br />
zumindest bei Aufgaben, die nur wenig strategische Kompetenz<br />
erfordern, durch reichhaltiges Vorwissen kompensiert werden zu<br />
können.<br />
� Schneider: Die Auswertung von Längsschnittdaten zur Entwicklung<br />
hochtalentierter Tennisspieler (darunter Graf und Becker) zeigt, dass für<br />
den späteren Erfolg (Platz in der Weltrangliste) v. a. folgende Prädiktoren<br />
entscheidend waren:<br />
- Erlebte elterliche Unterstützung<br />
- Umfang und Intensität der Übung<br />
- Habituelle Leistungsmotivation<br />
� Ericssons Modell der „deliberate practice“ (anstrengungsbetonte Übung):<br />
� Der Expertiseerwerb erfolgt in 3 Stufen:<br />
- Spielerische Erfahrungen im Zielbereich<br />
- Intensive Übung unter Anleitung eines guten Trainers bzw. Lehrers<br />
- Intensive Übung unter Anleitung eines Trainers bzw. Lehrers, der<br />
selbst Experte auf dem betreffenden Gebiet ist<br />
� These: Die Ausgangsbegabung ist irrelevant für den Erwerb von<br />
Expertise, die entscheidenden Faktoren sind stattdessen: gelenkte<br />
Erfahrung, bereichsspezifische Übung („deliberate practice“), inhaltliches<br />
Interesse, eine ausgeprägte Leistungsbereitschaft und volitionale<br />
Kompetenzen. Ihren Höhepunkt erreicht die Expertise dabei meist erst<br />
nach 10 Jahren intensiver Übung („10-Jahres-Regel“)<br />
� Das „Schwellenmodell“ (Schneider): Ein gewisses (meist<br />
überdurchschnittliches) Begabungsniveau ist eine notwendige Voraussetzung<br />
für den Erwerb einer bereichsspezifischen Expertise. Ist diese Voraussetzung<br />
erfüllt, entscheiden begabungsferne Merkmale, wie Engagement, Ausdauer,<br />
Konzentration und Erfolgsmotivation über das Leistungsvermögen, das erreicht<br />
werden kann.<br />
� Der für die verschiedenen Bereiche kritische Schwellenwert lässt sich<br />
dabei jedoch kaum eindeutig festlegen!<br />
� Fazit: Intelligenz und Begabung sind zwar nicht die entscheidenden, aber auch<br />
nicht zu vernachlässigende Faktoren beim Erwerb von Expertise!<br />
� Zumal eine intensive Auseinandersetzung mit einem Bereich, umso<br />
wahrscheinlicher ist, je besser man darin schon zu Beginn der<br />
Auseinandersetzung ist!<br />
168
2. Erwerb von Lese- und Rechenexpertise<br />
� Leseexpertise erfordert:<br />
� Phonologische Bewusstheit (klangliche Segmentierung von Sprache)<br />
� Dekodieren von Wörtern (Übersetzung der Schriftsymbole in Laute)<br />
� Erkennen von Wortbedeutungen (Rekodieren)<br />
� Integration von Wörtern zu einem Satz<br />
� Höhere Kompetenzen zum Leseverständnis<br />
� Rechenexpertise erfordert:<br />
� Basales arithmetisches Wissen (Ergebniswissen, Einmaleins etc.)<br />
� Allgemeines Weltwissen (zur Übersetzung eines mathematischen Problems in<br />
eine interne Repräsentation)<br />
� Konzeptuelles Wissen (Übersetzung der Aufgabeninfos)<br />
� Lösungsstrategisches Wissen (zur Optimierung und Überwachung des<br />
Rechenprozesses)<br />
� Operationales Wissen (zur Ausführung der Rechnungen)<br />
169
D 5: Leistungsmotivation (siehe A 4) und Leistungsängstlichkeit<br />
1. Allgemeines zu Leistungsängstlichkeit<br />
� Leistungsangst (~Prüfungsangst/Schulangst) lässt sich definieren als Bedrohungserleben<br />
in evaluativen Situationen. Da dabei v. a. die soziale Identität und der<br />
Selbstwert als bedroht erlebt werden, handelt es sich bei Leistungsangst um eine<br />
soziale Angst; sie basiert meist auf antizipierter Scham im Falle des Versagens.<br />
� Die Unterscheidung zwischen „State“ und „Trait“ ist im Fall der<br />
Leistungsängstlichkeit nicht eindeutig zu treffen; am ehesten lässt sich sagen, es<br />
handele sich um ein situationsgebundenes Persönlichkeitsmerkmal (wobei<br />
hoch leistungsängstliche Schüler meist generell ängstlicher sind!)<br />
� Zu unterscheiden ist Leistungsangst von Schulphobie (klinisch) und<br />
Schuleschwänzen.<br />
� Leistungsangst äußert sich wie alle Ängste auf 3 Ebenen:<br />
1. Physiologische Ebene:<br />
� Erregungsanstieg des autonomen Nervensystems � unspezifische<br />
Reaktionen wie Herzklopfen, erhöhter Blutdruck, Schweißausbrüche,<br />
beschleunigte Atmung etc.<br />
2. Kognitive bzw. emotional-subjektive Ebene:<br />
� Angstbezogene Kognitionen in Leistungssituationen lassen sich grob in 2<br />
Gruppen aufteilen, die den beiden Hauptkomponenten der Leistungsangst<br />
entsprechen (nach Liebert & Morris):<br />
a) „Emotionality“-Komponente („Aufgeregtheit“): Wahrnehmung der<br />
körperlichen Erregungssymptome (Schwitzen, Zittern etc.)<br />
- „Emotionality“ tritt typischerweise am Anfang einer Prüfung auf und<br />
nimmt dann rasch ab<br />
b) „Worry“-Komponente („Besorgtheit“): umfasst aufgabenirrelevante<br />
Gedanken und Sorgen wie z.B. die Antizipation möglicher Misserfolge,<br />
selbstwertschädigende Leistungsvergleiche, eine übersteigerte Beschäftigung<br />
mit Noten etc. etc.<br />
- „Worry“-Kognitionen zeigen sich recht kontinuierlich im<br />
Prüfungsverlauf und halten auch nach der Prüfung eine Weile an<br />
3. Verhaltensebene:<br />
� Aufschiebung der Prüfungsvorbereitung, unstrukturierteres Vorgehen bei der<br />
Vorbereitung, mehr Gesamtlernzeit, aber weniger effektive Nutzung etc.<br />
� Merkmale leistungsängstlicher Schüler/innen:<br />
� Haben ein negativ getöntes Selbstbild, sind stark misserfolgsorientiert und<br />
tendieren zu ungünstigen Attributionen<br />
� Sind durch Hilflosigkeit und Unsicherheit gekennzeichnet (Nervosität etc.)<br />
� Nehmen in der sozialen Hierarchie eher einen unteren Rangplatz ein, sind oft<br />
sogar sozial isoliert.<br />
� Wirken überfordert und haben schlechtere Noten<br />
� Häufigeres Fehlen und Kranksein<br />
� Prinzipiell: Mädchen sind häufiger betroffen als Jungen!<br />
2. Theorien zur Entstehung von Leistungsängstlichkeit<br />
� Theorien zur Entwicklung einer entsprechenden Disposition:<br />
� Physiologische Reaktionen sind genetisch bedingt; ihr phylogenetischer<br />
Ursprung lässt sich evolutionsbiologisch erklären: sie dienen dazu, den Körper<br />
auf eine Flucht- oder Angriffsreaktion vorzubereiten.<br />
170
� Transaktionsmodell: Die konkrete Ausbildung genetischer Dispositionen<br />
hängt jedoch nicht zuletzt von Sozialisationseinflüssen ab; im Fall der<br />
Leistungsängstlichkeit kommt dabei v. a. dem Elternverhalten eine<br />
entscheidende Rolle zu (zu hohe Ansprüche, geringe Empathie etc.)<br />
� Psychoanalytische Erklärung: Traumatisierende Erfahrungen mit den Eltern<br />
und Konflikte zwischen Ich und Über-Ich => Moralische Angst<br />
� Lerntheoretische Ansätze: Modelllernen, klassisches Konditionieren, operantes<br />
Konditionieren<br />
� Theorie zur Aktualgenese von Leistungsangst (Wie entsteht Leistungsangst in einer<br />
konkreten Situation?):<br />
� Die (Coping-)Theorie von LAZARUS beschreibt die Entstehung von Angst als<br />
mehrstufigen Bewertungsprozess:<br />
1. Primary Appraisal: In einem ersten Schritt werden Situationen im Hinblick<br />
auf das eigene Wohlergehen bewertet (Relevanz?<br />
Nützlichkeit/Schädlichkeit?)<br />
2. Secondary Appraisal: In einem 2. Schritt werden die eigenen Ressourcen<br />
eingeschätzt, genauer: die zur Verfügung stehenden<br />
Bewältigungsmöglichkeiten (Coping)<br />
� Ergibt die zweite Bewertung, dass keine direkte Handlung möglich ist,<br />
um die Bedrohung zu beseitigen, reagiert man mit Angst!<br />
3. Leistungsangst und Schulleistung<br />
� Nach einer Metaanalyse von Seipp beträgt die durchschnittliche Korrelation zw. Angst<br />
und Leistung r = -.21. Obwohl dieser Zusammenhang lediglich schwach negativ ist,<br />
sollte er nicht unterschätzt werden.<br />
� Zwar ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Schulangst und Leistung sich<br />
wechselseitig beeinflussen: Ängstlichkeit mindert das Leistungsvermögen,<br />
schlechte Leistungen wiederum erhöhen die Angst; es wäre jedoch verfehlt, die<br />
schlechteren Leistungen ängstlicher Schüler pauschal auf ein geringeres<br />
Kompetenzniveau zurückzuführen. Die negative Korrelation zwischen<br />
Leistungsängstlichkeit und Leistung bleibt nämlich auch dann bestehen, wenn<br />
man das Kompetenzniveau kontrolliert.<br />
� Faustregel: Schüler mit hoher Leistungsängstlichkeit (Prozentrang von<br />
mind. 75) schneiden etwa eine halbe Ziffernnote schlechter ab, als aufgrund<br />
ihrer Kompetenzen zu erwarten wäre!<br />
� Längsschnittstudien zeigen, dass der langfristige Lernzuwachs durch<br />
Leistungsangst nicht beeinträchtigt wird! Mögliche Gründe dafür: Kompensation<br />
durch mehr Lernzeit; Unterscheidung zw. Unterrichts- und Prüfungssituation;<br />
Selbstselektion<br />
� Generell gilt: Die leistungsmindernde Wirkung der Leistungsangst geht primär von<br />
der „worry“-Komponente aus!<br />
� Mögliche Erklärungen für den negativen Zusammenhang zw. Leistungsangst und<br />
Leistung:<br />
� „Habit-Interferenz-Modell“ (Mandler, Sarason): In Leistungssituationen<br />
werden 2 antagonistische Triebe aktiviert: der Aufgabentrieb und der Angsttrieb.<br />
Letzterer führt bei zu starker Ausprägung zu aufgabenirrelevanten<br />
Reaktionstendenzen, durch die die Aufgabenlösung beeinträchtigt wird.<br />
� Sprich: Leistungsängstliche Schüler lassen sich durch ihre Sorgen und<br />
Selbstzweifel von der Aufgabenlösung ablenken (Aufmerksamkeitshypothese)<br />
171
� Kuhn: Leistungsängstliche Personen sind durch eine „Lageorientierung“ (s.o.)<br />
gekennzeichnet � oberflächlichere Aufgabenbearbeitung, unzureichende<br />
Strategieanwendung etc.<br />
� „Yerkes-Dodson-Gesetz“: Bei einfachen Aufgaben wirkt Erregung<br />
leistungsoptimierend, bei schwierigen Aufgaben dagegen leistungsmindernd!<br />
Am besten ist ein mittleres Erregungsmaß!<br />
4. Diagnostik und Prävention/Intervention<br />
� Zur Diagnose von Leistungsängstlichkeit stehen verschiedene Fragebögen zur<br />
Verfügung:<br />
� „State Anxiety Questionaire“ (TAG) von Mandler & Sarason (1952): gilt heute<br />
als überholt, da er weder zwischen habitueller Angstneigung (Trait) und<br />
konkreter Angst (State), noch zwischen den Subkomponenten „worry“ und<br />
„emotionality“ unterscheidet (=> unidimensionale Auswertung)!<br />
� Anders im „State-Trait-Anxiety Inventory” (STAI) von Spielberger (1970),<br />
der zumindest zwischen „State“ und „Trait“ unterscheidet (=> bidimenionale<br />
Auswertung)!<br />
� Das „Differentielle Leistungsangst Inventar“ (DAI) von Rost und Schermer<br />
(1997) ist aktuell das differenzierteste Instrument zur Individualdiagnosstik: es<br />
unterscheidet nicht nur zwischen verschiedenen Erscheinungsweisen, sondern<br />
erfasst darüber hinaus die Auslösefaktoren, die stabilisierenden Bedingungen<br />
und die präferierten Bewältigungsstrategien (= die entscheidenden Elemente<br />
einer Verhaltensanalyse!)<br />
� Präventive Maßnahmen im schulischen Kontext:<br />
� Vermeidung unangekündigter Leistungskontrollen<br />
� Frühzeitige und möglichst genaue Absprache der relevanten Inhalte<br />
� Bei schriftlichen Tests: Bereitstellen strukturell ähnlich aufgebauter Übungstests<br />
� Zulassung vorher abgesprochener Hilfsmittel<br />
� Individuelle Bezugsnormorientierung bei der Leistungsrückmeldung<br />
� Möglichkeiten bieten, schlechte Leistungen auszugleichen<br />
� Lieber mehrere kleinere als wenige große Prüfungen!<br />
� Zur Intervention empfehlen sich v. a. kognitiv-verhaltenstherapeutische<br />
Maßnahmen!<br />
172
D 6: Entwicklung sozialer Kognitionen und Kompetenzen<br />
1. Allgemeines zu sozialer Kognition<br />
� Definition: Soziale Kognition umfasst einerseits das allgemein verfügbare Wissen<br />
über psychische Vorgänge und soziale Ereignisse (Inhalt), andererseits das situativ<br />
eingebettete Verständnis von Menschen, zwischenmenschlichen Beziehungen und<br />
sozialen Gruppen (Prozess).<br />
� Die Unterscheidung zwischen dem Inhalt und dem Prozess sozialer Kognition ist<br />
plausibel: zu wissen, was Freundschaft heißt, bedeutet schließlich noch lange<br />
nicht, eine Freundschaft knüpfen und führen zu können.<br />
� Soziale Kognition bezieht sich a) auf innerpsychische Prozesse des jeweiligen<br />
Gegenübers, b) auf die psychologische Qualität zwischenmenschlicher<br />
Beziehungen und c) auf die Fähigkeit, dem jew. Gegenüber Bewusstsein,<br />
Selbstbestimmung und eine mentale Repräsentation der Umwelt zuzuschreiben.<br />
� Zur Bedeutung sozialer Kognition:<br />
� Soziale Interaktionen orientieren sich überwiegend an etablierten<br />
Handlungsskripts (ins Restaurant gehen etc.), zu einer tiefer gehenden<br />
Verarbeitung sozialer Situationen (bei der man z.B. das eigene Handeln aus der<br />
Perspektive des Anderen betrachtet) kommt es dementsprechend nur, wenn die<br />
Routine versagt (etwa bei Beziehungskonflikten).<br />
� Eine entwickeltere soziale Kognition zieht kompetenteres Sozialverhalten nach<br />
sich.<br />
� Das zeigt sich z.B., wenn man Kindern nicht nur die einschlägigen Aufgaben<br />
(z.B. zum False Belief) vorlegt, sondern sie darüber hinaus beim Spielen<br />
beobachtet (und die Ergebnisse hinterher miteinander vergleicht)<br />
� Prosoziales Verhalten setzt Empathie voraus etc. etc.<br />
� Zum Gegenstand sozialer Kognition: Soziale Kognition unterscheidet sich in<br />
mehrerer Hinsicht von der (einfacheren) Kognition über Objekte:<br />
� Variabilität des Erscheinens (Mimik, Bewegung, Tonfall etc.)<br />
� Intentionalität (Selbstverursachter Wandel)<br />
� Reagibilität (Verhalten des Gegenübers ist immer auch eine Reaktion auf das<br />
eigene Verhalten)<br />
� Grundsätzliche Ähnlichkeit zwischen Menschen (von sich selbst auf andere zu<br />
schließen, ist meist gar nicht so verkehrt)<br />
� Emotionales Berührtsein<br />
� Komplexe Interaktionen (unterschiedliche Perspektiven und Intentionen sind zu<br />
berücksichtigen)<br />
� Forschungsansätze zur sozialen Kognition:<br />
� Forschung zur Personwahrnehmung:<br />
� Die wichtigsten Ergebnisse (Details in Abs. 2):<br />
- Schon Säuglinge unterscheiden zwischen Personen und Objekten (s.u.)<br />
- Personenkonzepte von Kindern sind stärker am Verhalten-;<br />
Personenkonzepte von Jugendlichen stärker an psychischen<br />
Dispositionen und (!) deren situativer Differenzierung orientiert.<br />
� Forschung zur Perspektivübernahme (kognitiv-strukturtheoretischer Ansatz)<br />
� Kognitive Perspektivübernahme: meint die Fähigkeit, das Denken anderer<br />
aus deren Situation zu erschließen; überprüft werden kann diese Fähigkeit<br />
mit dem Paradigma des Informationsprivilegs (wie interpretiert ein Dritter<br />
eine Bildergeschichte, aus der ein Bild herausgenommen wurde?!)<br />
� Emotionale Perspektivübernahme (Verstehen) ≠ Empathie (Nachfühlen)<br />
173
� Fazit: Sowohl die Fähigkeit zur kognitiven, als auch die zur emotionalen<br />
Perspektivübernahme setzen die Fähigkeit voraus, die<br />
Situationsgebundenheit von Emotionen, Kognitionen oder Handlungen zu<br />
erkennen. Sieht man von Vorläuferkomptenzen ab, entwickelt sich diese<br />
Fähigkeit ca. ab 4 Jahren!<br />
� Forschung zu Handlungserklärungen (attributionstheoretischer Ansatz)<br />
� Das Kovariationsmodell (von KELLEY): Handlungen können internal-,<br />
external- oder situational attribuiert werden. Auf welche Weise attribuiert<br />
wird, hängt dabei von 3 Faktoren ab:<br />
- Konsens (Reagieren andere in dieser Situation / auf diesen Stimulus in<br />
vergleichbarer Weise?)<br />
- Konsistenz (Reagiert die betreffende Person auf diesen Stimulus auch<br />
ansonsten so?)<br />
- Distinktheit (Reagiert die Person auf andere Stimuli in gleicher Weise?)<br />
� Zu den besagten Faktoren hinzu kommen folgende 2 Zusatzbedingungen:<br />
- Das Abwertungsprinzip (die angenommene Bedeutung einer best.<br />
Ursache sinkt, wenn noch weitere Ursachen angenommen werden<br />
können)<br />
- Das Aufwertungsprinzip (Liegen ein verhaltenshemmender und ein<br />
verhaltensförderlicher Faktor gleichzeitig vor, wird der förderliche<br />
Einfluss höher angesetzt)<br />
� Ergebnisse: Die Anwendung der 3 Prinzipien Konsens, Konsistenz und<br />
Distinktheit erfolgt erst nach dem Kindergartenalter. Das<br />
Abwertungsprinzip wird erst ab 8 Jahren genutzt, das Aufwertungsprinzip<br />
erst im Jugendalter!<br />
� Forschung zur Zuschreibung mentaler Repräsentationen (Theory of Mind-<br />
Ansatz)<br />
4. Der Theory of Mind-Ansatz<br />
A) Allgemeines zur Theory of Mind<br />
� Die „Theory oft mind“ (TOM) ist eine Art intuitive Alltagspsychologie; genauer: es<br />
handelt sich dabei um die Fähigkeit, uns selbst und anderen mentale Zustände<br />
zuzuschreiben (z.B. Absichten, Wünsche, Emotionen oder Überzeugungen), und<br />
diese aus dem Verhalten zu erschließen.<br />
� Mentale Zustände sind durch 3 Merkmale gekennzeichnet:<br />
1. Sie sind unserer inneren Erfahrung zugänglich.<br />
2. Sie fungieren als theoretische Konstrukte in einer intuitiven<br />
Verhaltenstheorie.<br />
- Peter weint, weil er „traurig ist“ / eigentlich ins Kino „will“ etc.<br />
3. Sie sind intentional auf etwas gerichtet.<br />
- An etwas denken, sich etwas wünschen etc.<br />
� Wellman beschreibt die „Theory of Mind“ als „Belief-desire-theory“: Wir<br />
erklären uns menschliches Verhalten, indem wir uns selbst und anderen<br />
Wünsche bzw. Absichten (Desires) und Überzeugungen (Beliefs) zuschreiben!<br />
� Die „Theory of Mind“-Forschung fragt einerseits, ab wann Kinder beginnen, sich<br />
selbst und anderen mentale Zustände zuzuschreiben, anderseits, inwiefern sie diese<br />
Zustände im Sinne der 3 oben genannten Kriterien verstehen.<br />
� Als das entscheidende Indiz gilt dabei die Frage, ob Überzeugungen<br />
unabhängig vom Zustand der Realität repräsentiert werden können oder nicht.<br />
Überprüft wird diese Frage anhand von „False Belief“-Aufgaben (s.u.)<br />
174
� Die „Theory of Mind“ setzt voraus, das mentale Repräsentationen als solche<br />
mental repräsentiert sind (Metarepräsentationen); das Konzept weist somit eine<br />
enge Verwandtschaft zum Konzept der Metakognition auf (s.o.).<br />
� Die für die Ausbildung der „Theory of Mind“ entscheidenden Entwicklungsschritte<br />
finden im Alter zwischen 3 und 4 Jahren statt: Ab ca. 3 ½ bis 4 Jahren sind Kinder<br />
nämlich dazu in der Lage, falsche Überzeugungen zu erkennen.<br />
� Bereits vorher erwerben Kinder jedoch grundlegende Fertigkeiten, ohne die eine<br />
„Theory of mind“ nicht denkbar wäre; die drei Wichtigsten sind:<br />
1) Ab ca. 9 Monaten sind Kinder dazu in der Lage, andere als intentionale<br />
Agenten wahrzunehmen („Joint attention“).<br />
2) Im 2. Lebensjahr entwickeln Kinder ein Selbstkonzept; sie lernen also,<br />
zwischen sich und der Umwelt zu unterscheiden („self recognition“)<br />
3) Darüber hinaus entwickeln Kinder mit 2 Jahren ein Verständnis für<br />
Wünsche<br />
B) Entwicklung der „Theory of Mind“<br />
� Die wichtigsten Entwicklungsschritte im 1. Lebensjahr:<br />
� Säuglinge zeigen von Geburt an eine Präferenz für Gesichter und unterscheiden<br />
schon früh zwischen Menschen und Objekten.<br />
� Letzteres zeigt sich z.B. am sozialresponsiven Verhalten der Babys (Lächeln,<br />
Vokalisieren).<br />
� Ab 7 Monaten unterscheiden Babys zwischen Lebewesen und unbelebten<br />
Objekten nach dem Kriterium der selbstinitiierten Bewegung � Wahrnehmung<br />
anderer als responsive Agenten, die man z.B. durch Schreien herbeibewegen<br />
kann.<br />
� Zwischen 9 und 12 Monaten: Wahrnehmung anderer als intentionale Agenten<br />
(„Joint Attention“)<br />
� Dyadische Interaktionen werden zunehmend durch triadische Interaktionen<br />
abgelöst (geteilte Aufmerksamkeit auf ein gemeinsames Bezugsobjekt).<br />
� Kinder beginnen, der Blickrichtung Erwachsener hin zu bestimmten<br />
Referenzobjekten zu folgen („Attention following“)<br />
� Einsatz von Zeigegesten (referentielle Gesten), um Aufmerksamkeit<br />
Erwachsener zu lenken<br />
� Dishabituierung auf abgebrochene Handlungen (Ergo: Kinder verfügen bereits<br />
über einfache Handlungsskripts)<br />
Trotz dieser Kompetenzen ist nicht von einer Repräsentation mentaler Zustände auszugehen,<br />
die Zeigegesten etc. sind vielmehr behavioral zu verstehen: hinter ihnen<br />
steht keine naive Alltagspsychologie, sondern das Wissen um Kontingenzen: mache<br />
ich das, passiert das…<br />
� Die wichtigsten Entwicklungsschritte im 2. Lebensjahr:<br />
� Zw. 15 und 24 Monaten: Kinder erkennen sich selbst im Spiegel (Rouge-Test)<br />
� Ab dem 2. Lebensjahr: Symbolspiel (setzt jedoch keine Theory of Mind im<br />
engeren Sinn voraus!)<br />
� Ab ca. 18 Monaten: zeigen Kinder emphatisches Verhalten; d.h. sie sind<br />
emotional berührt vom Missgeschick anderer und versuchen, zu helfen. �<br />
Hinweis darauf, dass Emotionen als innere Erfahrungen verstanden werden<br />
� Ab 2 Jahren: Kinder sagen „ich will / er will“, auch wenn eine Handlung noch<br />
nicht ausgeführt wurde oder nicht zielführend war � Mentale Repräsentation<br />
von Wünschen und Absichten!<br />
175
� Ab 3 ½ bis 4 Jahren entwickeln Kinder ein Verständnis von Überzeugungen; d.h.:<br />
sie verstehen zum einen, dass Überzeugungen handlungsleitend sind, zum anderen,<br />
dass es sich dabei um mentale Repräsentationen handelt, die als solche von der<br />
Realität abweichen können.<br />
� False-Belief-Aufgabe von Wimmer & Perner (1983): Maxi und die<br />
Schokolade! Kindern wird folgende Geschichte erzählt: Maxi verstaut eine<br />
Schokolade im grünen Schrank; während er draußen beim Spielen ist, benutzt sie<br />
die Mutter zum Kochen und legt sie danach in den blauen Schrank. Wo sucht<br />
Maxi die Schokolade, wenn er vom Spielplatz zurückkommt?<br />
� Nahezu alle 3-Jährigen geben die falsche Antwort; ca. 50% der 4- bis 5-<br />
Jährigen und 90% der 6- bis 7-Jährigen geben dagegen die richtige<br />
Antwort!<br />
� Die Leistung der 3-Jährigen verbessert sich auch dann nur unwesentlich,<br />
wenn sie ausdrücklich zu genauem Nachdenken aufgefordert- oder eigens<br />
noch mal darauf hingewiesen werden, dass Maxi nicht sehen konnte, dass<br />
seine Mutter die Schokolade in den anderen Schrank geräumt hat.<br />
� Ergo: 3-Jährige können Überzeugungen anderer noch nicht unabhängig<br />
von der Realität repräsentieren!<br />
� False-Belief-Aufgabe von Gopnik et al. (1988): Die Smartiesrolle<br />
Kindern wird eine Smartiesrolle gezeigt und sie werden danach gefragt, was sie<br />
darin vermuten. Nachdem sie „Smarties“ geantwortet haben, zeigt ihnen der VL,<br />
dass in Wirklichkeit Stifte in der Verpackung sind. Auf die Frage, welchen Inhalt<br />
sie vorhin vermutet hätten, antworten unter 4-Jährige: „Buntstifte!“<br />
� 3-Jährige haben demnach sogar Schwierigkeiten, ihre eigenen falschen<br />
Überzeugungen zu erkennen!<br />
� Ergo: Ihre Fehler in False-Belief-Aufgaben sind nicht auf unzureichende<br />
Perspektivübernahme zurückzuführen, sondern auf das mangelnde<br />
Verständnis eigener und fremder mentaler Zustände.<br />
� Von Kritikern wird oft behauptet, die Probleme mit False-Belief-Aufgaben seien<br />
nicht grundsätzlicher Art, sondern lediglich durch die unnötig komplizierte<br />
Versuchsanordnung bedingt. Als Beleg dafür wird darauf verwiesen, dass schon<br />
jüngere Kinder zu Täuschung und Lüge in der Lage sind.<br />
� Dieser Einwand lässt sich jedoch leicht entkräften: Die Täuschungsmanöver<br />
jüngerer Kinder setzen keine „Theory of Mind“ voraus, sondern sind<br />
gelernte Strategien zur Vermeidung negativer Konsequenzen (daher auch<br />
die Ungeschicklichkeit kindlicher Lügen: das ganze Gesicht voller<br />
Schokolade aber Leugnen, genascht zu haben!).<br />
� Das Verständnis falscher Überzeugungen geht mit einer Reihe weiterer Kompetenzen<br />
einher, die ebenfalls erst zwischen 3 und 4 Jahren erworben werden:<br />
� Das Wissen über die Genese von Überzeugungen bzw. ein Verständnis<br />
dafür, wie Wissen zustande kommt.<br />
� Erst ab 4 Jahren können Kinder die Frage beantworten, woher sie etwas<br />
wissen (z.B. woher sie den Inhalt einer zuvor für kurze Zeit geöffneten<br />
Schachtel kennen)<br />
� Dem entspricht, dass die TOM-Entwicklung in engem Zusammenhang zur<br />
Gedächtnisentwicklung steht (Stichwort: Metagedächtnis!)<br />
� Zw. 3 und 5 Jahren: markante Verbesserung der Recall-Leistungen, weil nun<br />
ein Bewusstsein dafür entsteht, wie die eigenen Gedächtnisinhalte zustande<br />
kommen, was eine bessere Kontrolle der betreffenden Prozesse ermöglicht!<br />
� Erklärung für die infantile Amnesie: Weil es Kindern unter 3 Jahren an einer<br />
Theory of Mind fehlt, werden Ereignisse nicht als selbst erlebt enkodiert!<br />
176
� Bezüglich der Perspektivübernahme lassen sich 2 Ebenen unterscheiden:<br />
� Ebene 1: Verstehen, dass ein anderer etwas sieht, das man selbst nicht sehen<br />
kann und vice versa! � Ab 2 ½ Jahren!<br />
� Ebene 2: Verstehen, dass ein anderer das gleiche Objekt anders sieht als man<br />
selbst (z.B. von hinten) � Ca. ab 4 Jahren!<br />
� Unterscheidung zwischen Schein und Sein ist ebenfalls erst ab 4 J. möglich!<br />
� „Der Schwamm sieht aus wie ein Fels (Schein), ist aber ein Schwamm<br />
(Sein)“!<br />
� Fazit: Das Konzept von Überzeugungen ist ein genuines und universelles<br />
(kulturübergreifendes!) Entwicklungsphänomen; es entwickelt sich mit 4 Jahren.<br />
C) Sonstiges<br />
� TOM-Defizite finden sich bei:<br />
� Kindern mit Autismus: Mangelnde Sensibilität für Gesichtswahrnehmung und<br />
Störung im Sozialverhalten beeinträchtigen die TOM-Entwicklung � Oft bis ins<br />
Erwachsenenalter unzureichende Repräsentation falscher Überzeugungen!<br />
� Taubheit: Sprachlicher Input enorm wichtig für die mentale Entwicklung und<br />
somit auch für die Ausbildung einer TOM.<br />
� Familiären Belastungen (Depressive Mutter, sexueller Missbrauch etc.)<br />
� Gründe für individuelle Unterschiede der TOM-Entwicklung:<br />
� Erziehungsstil der Eltern<br />
� Sprachliche Interaktion<br />
� Bildungsniveau der Mutter<br />
� Sozialschicht<br />
� Art zu spielen (je phantasievoller, desto früher TOM)<br />
� Unterschiede in Sozialkompetenz lassen sich z.T. auf TOM zurückführen, sofern ein<br />
frühes Verständnis menschlichen Verhaltens Konfliktlösungs-Fähigkeiten und<br />
Kommunikation fördert.<br />
D) Theoretische Erklärungen der Theory of Mind:<br />
� Die Theorie-Theorie (Wellman, Gopnik etc.): beschreibt die kognitive Entwicklung<br />
des Kindes, analog zum Paradigmenwechsel in der Wissenschaftsgeschichte, als einen<br />
Wandel intuitiver, domänenspezifischer Theorien (konzeptueller Wandel). Das<br />
Konzept von Überzeugungen, das im Alter von 4 Jahren zu der naiven<br />
Wunschpsychologie hinzukommt, lässt sich demnach trainieren, indem Evidenz für<br />
die richtige Theorie geliefert wird!<br />
� Modularitätstheorien (z.B. Leslie, Baron-Cohen): Die TOM ist modular angelegt<br />
und von Geburt an vorhanden (nativistische Sichtweise); die Defizite jüngerer Kinder<br />
werden dementsprechend nicht auf falsche Konzepte zurückgeführt, sondern auf zu<br />
hohe Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsanforderungen; das Konzept der falschen<br />
Überzeugungen kann dementsprechend nicht trainiert werden, sondern ist eine Frage<br />
der Reifung!<br />
� Problem: Schwer vereinbar mit interindividuellen Unterschieden in der TOM-<br />
Entwicklung.<br />
� Die Simulationstheorie (z.B. Harris): Kinder verstehen die geistigen Prozesse<br />
anderer, indem sie sie in ihrem eigenen Innern simulieren, sich also überlegen, was sie<br />
in der besagten Situation tun, denken fühlen würden. Das Problem mit False-Belief-<br />
Aufgaben ist darauf zurückzuführen, dass den Kindern darin gleich 2 Simulationen<br />
zugemutet werden: Sie müssen nicht nur den mentalen Zustand des anderen, sondern<br />
auch die Realität, wie sie sich ihm zeigt, simulieren!<br />
� Problem: Kinder können auch eigene falsche Überzeugungen nicht als solche<br />
erkennen (Vgl. Smartiesrolle)<br />
177
D 7: Entwicklungsveränderungen im Erwachsenenalter und Alter<br />
1. Allgemeines zur Entwicklung im Erwachsenenalter<br />
� Mit Entwicklungen im Erwachsenenalter setzt sich die Psychologie der Lebensspanne<br />
(„Life-Span-Psychologie“) auseinander.<br />
� Die wichtigsten Annahmen der „Life-span-Psychologie“<br />
1. Lebenslange Entwicklung: die Ontogenese ist ein lebenslanger Prozess.<br />
2. Mulitdirektionalität der Ontogenese: Entwicklung bedeutet nicht nur<br />
Wachstum, sondern auch Abbau.<br />
3. Plastizität: Die Entwicklung ist nicht vollständig determiniert (etwa durch<br />
Erbanlagen), sondern zeichnet sich durch eine hohe Plastizität aus.<br />
� Einteilung der Ontogenese:<br />
� Frühe Kindheit, Kindheit, Jugend, junges Erwachsenenalter<br />
� Mittleres Erwachsenenalter: 35-65 Jahre<br />
� Differenzierung und Expansion von Aufgaben, Kompetenzen und<br />
Ressourcen (Partnerschaft, Beruf, Elternschaft)<br />
� Höheres Erwachsenenalter: 65-80 Jahre<br />
� Wichtigste Entwicklungsaufgabe: Übergang von Expansion zu<br />
Konzentration (Abschied von bestimmten Bereichen, etwa dem Beruf, und<br />
Pflege der verbleibenden Bereiche)<br />
� Hohes Alter: > 80 Jahre<br />
� Die generelle Architektur des Lebenslaufs: Die Entwicklung im Alter ist nach<br />
Baltes v. a. durch 3 Funktionen gekennzeichnet:<br />
1) Die positiven Auswirkungen des evolutionären Selektionsdrucks nehmen mit<br />
dem Alter ab, da evolutionäre Selektionsmechanismen nach der reproduktiven<br />
Phase weniger wirksam sind (eine Krankheit wie Alzheimer z.B. würde sich im<br />
Jugendalter nicht halten können)<br />
2) Der Bedarf an Kultur nimmt mit dem Alter zu (Altersheime, Pflege,<br />
intellektuelle Förderung etc.)<br />
3) Gleichzeitig lässt der Wirkungsgrad von Kultur mit dem Alter nach; sprich:<br />
kulturelle Ressourcen wie Weiterbildung etc. sind weniger effektiv als bei<br />
jüngeren.<br />
� Gründe: a) Abnahme des biologischen Potentials; b) je mehr Vorwissen /<br />
Erfahrung besteht, desto schwieriger sind Fortschritte zu erzielen („Law of<br />
Practice“)!<br />
� Veränderungen in der relativen Ressourcenallokation:<br />
� In funktionaler Hinsicht lassen sich Entwicklungsziele 3 allgemeinen<br />
Kategorien zuordnen:<br />
a) Zuwachs<br />
b) Aufrechterhaltung des bestehenden Funktionsniveaus<br />
c) Regulation von Verlusten<br />
� Im Laufe des Lebens wird ein zunehmender Anteil an Ressourcen (Zeit,<br />
Aufmerksamkeit, Anstrengung etc.) in die Ziele der Aufrechterhaltung (a) und<br />
Verlustregulation (b) investiert, während der Anteil der in das Entwicklungsziel<br />
Zuwachs (c) investierten Ressourcen zunehmend abnimmt.<br />
� Das Modell der selektiven Optimierung mit Kompensation (SOK) von Baltes &<br />
Baltes: beschreibt Entwicklung als Wechselspiel dreier übergeordneter<br />
Entwicklungsprozesse: nämlich Selektion, Optimierung und Kompensation! Ziel<br />
dieser Prozesse ist die Maximierung von Gewinnen bei gleichzeitiger Minimierung<br />
von Verlusten (Eine Entwicklung ohne Verluste ist nicht möglich! Man kann nicht<br />
zugleich super Tennisspieler und Konzertpianist sein!)<br />
178
� Zu den einzelnen Prozessen:<br />
a) Selektion: meint die Auswahl bestimmter Funktionsbereiche, auf die die zur<br />
Verfügung stehenden Ressourcen verwendet werden.<br />
- Elektive Selektion: Auswahl von Entwicklungszielen, die den eigenen<br />
Werten und Kompetenzen möglichst gut entsprechen.<br />
- Verlustbasierte Selektion: „Auswahl“ von Entwicklungszielen<br />
entsprechend der eigenen Möglichkeiten und der Erfordernisse.<br />
b) Optimierung: meint die Produktion von Entwicklungsgewinnen (etwa durch<br />
den Erwerb neuer Fertigkeiten, Übung, Zeitinvestition, den Gebarauch<br />
externer Hilfe etc.)<br />
- z.B. regelmäßiges Joggen für die körperliche Fitness und seelische<br />
Ausgewogenheit.<br />
c) Kompensation: meint die Aufrechterhaltung des Funktionsniveaus bei<br />
Verlusten (etwa durch Mobilisierung latenter Reserven, vermehrte<br />
Anstrengung, erhöhte Zeitinvestition, den Gebrauch externer Hilfe etc.)<br />
� Selektion, Optimierung und Kompensation können bewusst oder unbewusst,<br />
aktiv oder passiv, intern oder extern erfolgen:<br />
� Beispiel für passive Selektion: Einschulung in ein neusprachliches<br />
Gymnasium (weil kein altsprachliches zur Verfügung steht)<br />
� Beispiel für unbewusste Optimierung: implizites Lernen (etwa beim<br />
Spracherwerb)<br />
� Beispiel für externe Kompensation: Verwendung eines Rollstuhls<br />
2. Intellektuelle Entwicklung im mittleren und höheren Erwachsenenalter<br />
� Zweikomponentenmodelle der intellektuellen Entwicklung unterscheiden zwischen<br />
biologischen und kulturellen Determinanten kognitiver Leistung; empirisch stützen<br />
sie sich auf die gefundenen Unterschiede zw. alterungsresistenten und<br />
alterungsanfälligen intellektuellen Fähigkeiten.<br />
� Die bekanntesten 2-Komponenten-Modelle:<br />
� Tetens: absolutes- vs. relatives Vermögen<br />
� Cattell: fluide- vs. kristalline Intelligenz<br />
� Bates: Mechanik vs. Pragmatik<br />
� Bates: unterscheidet zwischen „Mechanik“ und „Pragmatik“ der Kognition.<br />
1. Die Mechanik der Kognition: ist biologisch bestimmt. Die mit ihr<br />
verbundenen Fähigkeiten (Verarbeitungsgeschwindigkeit, Kurzzeitgedächtnis<br />
etc.) zeigen i.d.R. einen schnellen Anstieg im Kindes- und<br />
Jugendalter, eine annähernd lineare Abnahme im Erwachsenenalter sowie<br />
eine Beschleunigung dieses Rückgangs im hohen Alter; sie sind also stark<br />
alterungsanfällig!<br />
2. Die Pragmatik der Kognition: ist kulturell bedingt und umfasst das<br />
deklarative und prozedurale Wissen, das sich eine Person im Laufe ihres<br />
Lebens angeeignet hat (Wortschatz, Weltwissen etc.). Im Vergleich zur<br />
Mechanik ist dieses Wissen nur sehr bedingt alterungsanfällig: es nimmt<br />
bis ins Erwachsenenalter zu und fällt erst im hohen Alter wieder ab.<br />
- Normativ-pragmatische Wissensbestände: werden im Kontext<br />
allgemeiner Sozialisationsvorgänge (z.B. in der Schule) erworben und<br />
lassen sich mittels psychometrischer Verfahren messen.<br />
- Personenspezifisches pragmatisches Wissen: ist individuell und hängt<br />
von den jeweiligen Interessen und Erfahrungen einer Person ab (=><br />
bereichsspezifische Expertise)<br />
179
� Mechanik und Pragmatik sind dabei nicht unabhängig voneinander, sondern<br />
interagieren miteinander:<br />
� Die Mechanik bildet die Voraussetzung für den Erwerb pragmatischen<br />
Wissens – umgekehrt können sich jedoch auch mechanische Prozesse nur in<br />
Auseinandersetzung mit bestimmten Inhalten entwickeln.<br />
� Pragmatisches Wissen kann altersbedingte Verluste in der Mechanik<br />
abschwächen oder sogar ganz ausgleichen (Kompensation)! Die positiven<br />
Auswirkungen von Expertise bleiben dabei jedoch bereichsspezifisch!<br />
� Beispiel für die relative Bedeutsamkeit beider Komponenten: Das<br />
Leistungsmaximum im Korrespondenzschach (3 Tage Zeit für einen Zug)<br />
wird im Durchschnitt mit ca. 46 Jahren erreicht, das Leistungsmaximum im<br />
Turnierschach (etwa 3 Minuten pro Zug) dagegen mit 36 Jahren.<br />
� Determinanten der mechanischen Entwicklung:<br />
� Bezüglich der näheren Beschreibung der mechanischen Entwicklung lassen sich<br />
2 Ansätze unterscheiden:<br />
a) Ressourcenorientierte Ansätze suchen nach einigen wenigen übergreifenden<br />
Ursachen für die altersbedingte Verschlechterung der Mechanik.<br />
b) Prozessorientierte Ansätze gehen dagegen von mehreren, übergreifenden<br />
und spezifischen Ursachen aus.<br />
� Innerhalb der Prozessorientierung konzentriert man sich v.a. auf folgende<br />
Determinanten der mechanischen Entwicklung:<br />
1. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit (bildet den stärksten Prädiktor für<br />
Altersunterschiede)<br />
2. Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses<br />
3. Die Fähigkeit zu Inhibition, also zur Unterdrückung irrelevanter Infos<br />
(wird z.B. mit dem Stroop-Test ermittelt)<br />
� In jüngerer Zeit werden darüber hinaus neurologische Determinanten gesucht:<br />
� Neuroanatomische Veränderung des Stirnhirns (das v. a. für exekutive<br />
Funktionen erfüllt, sprich: der Verhaltenskoordination und –planung dient)<br />
� Neurochemisch: Abnahme der Dopaminrezeptoren<br />
� Zur Erfassung mechanischer Leistungsveränderungen: Standardmaße zur Mechanik<br />
der Kognition (wie z.B. Tests zur fluiden Intelligenz) sind durch pragmatische<br />
(Testvertrautheit etc.) und andere Einflüsse (Motivation etc.) kontaminiert: Die<br />
gefundenen Altersunterschiede können daher nicht mit Sicherheit auf Unterschiede in<br />
der Mechanik zurückgeführt werden.<br />
� Eine Lösung des Problems bietet das „Testing the limits“-Paradigma: dabei<br />
werden Vpn durch Übung so nah wie möglich an ihre jew. Leistungsmaxima<br />
herangeführt! Derartige Versuche machen deutlich, dass das mechanische<br />
Leistungsmaximum früher anzusetzen ist, als es die klassischen Verfahren<br />
vermuten lassen.<br />
� Historische Plastizität:<br />
� Der Vergleich unterschiedlicher Generationen ist aus mehreren Gründen<br />
problematisch:<br />
� Kohorteneffekte: Stabile Unterschiede zw. Personen unterschiedlicher<br />
Geburtsjahrgänge (Vgl. etwa den Flynn-Effekt)<br />
� Periodeneffekte: Einfluss spezifischer historischer Ereignisse (z.B. Krieg)<br />
� Gesellschaftlicher Wandel: Generelle und zeitlich ausgedehnte Veränderung<br />
der Umweltbedingungen<br />
� Aber: Längsschnittstudien sind zwar notwendig für den interindividuellen<br />
Vergleich intra-individueller Veränderungen; was die durchschnittliche Größe<br />
von Entwicklungsveränderungen in der Population betrifft, führen sie jedoch<br />
180
nicht unbedingt zu genaueren Ergebnissen als Querschnittstudien (mögliche<br />
Ursachen: Übungseffekte, selektiver Drop-out).<br />
� Ontogenetische Plastizität – Zur Wirkung kognitiver Interventionen im Alter.<br />
� Die wichtigsten Ergebnisse kognitiver Interventionsstudien (Pretest –<br />
Intervention – Posttest):<br />
1. Kognitive Plastizität bleibt bei geistig gesunden Erwachsenen bis ins hohe<br />
Alter erhalten!<br />
2. Der positive Transfer trainierter oder geübter Leistungen auf andere<br />
Aufgaben ist i.d.R. gering!<br />
3. Altersunterschiede zwischen jungen und älteren Erwachsenen nehmen an<br />
den Leistungsobergrenzen („testing the limits“) zu!<br />
4. Die Koordination mehrerer Wahrnehmungs- und Handlungsstränge ist für<br />
ältere Erwachsene besonders schwierig!<br />
� Fazit: Trainiert werden können nur Fertigkeiten (pragmatische<br />
Komponente), nicht aber Fähigkeiten (Mechanik). Dafür sprechen a) die<br />
engen Grenzen des positiven Transfers und b) die Interventionsresistenz der<br />
Altersunterschiede in den Leistungsobergrenzen!<br />
� Praktische Konsequenz: Kognitive Intervention im Alter sollte sich v.a. auf<br />
Fertigkeiten konzentrieren, die möglichst unverändert in den Alltag der<br />
betreffenden Person integriert werden können und dort praktischen Nutzen<br />
haben!<br />
� Die Differenzierungshypothese der Intelligenz (Spearman: „Gesetz der<br />
nachlassenden Gewinne“) beschreibt die intellektuelle Entwicklung über die<br />
Lebensspanne als Abfolge von Differenzierung und Dedifferenzierung.<br />
� Der Generalfaktor der Intelligenz verliert im Laufe der Kindheit in Folge der<br />
Reifung und Ausdifferenzierung des Gehirns und durch den Erwerb spezifischer<br />
Wissensbestände an Gewicht (Differenzierung), bleibt vom Jugendalter bis ins<br />
späte Erwachsenenalter relativ konstant und nimmt im hohen Alter wieder zu<br />
(Dedifferenzierung)!<br />
� Die Annahme, die dahinter steht, ist nicht zuletzt Folgende: Der begrenzende<br />
Faktor niedriger Leistungen ist bereichsübergreifender Art (=> ein intakter<br />
kognitiver Apparat); hohe Leistungen dagegen werden überwiegend durch<br />
bereichsspezifische Bedingungen begrenzt!<br />
� Dedifferenzierungsprozesse im Alter:<br />
� Im hohen Alter gehen nicht mehr nur die mechanischen, sondern auch die<br />
pragmatischen Fähigkeiten irgendwann zurück<br />
(Richtungsdedifferenzierung)<br />
� Die Interkorrelationen verschiedener intellektueller Fähigkeiten sind im<br />
hohen Alter deutlich höher als im Erwachsenenalter (intrasystemische<br />
Kovarianzdedifferenzierung)<br />
� Die intellektuellen Fähigkeiten korrelieren im hohen Alter wesentlich stärker<br />
mit sensorischen und sensomotorischen Fähigkeiten (Sehschärfe,<br />
Gleichgewicht etc.) als im Erwachsenenalter (intersystemische<br />
Kovarianzdedifferenzierung)<br />
� Wichtige Entwicklungstendenzen: a) Heritabilität, b) relative Stabilität (Stabilität<br />
der interindividuellen Unterschiede), c) normativ-pragmatisches Wissen sowie d) die<br />
Differenziertheit der Struktur intellektueller Fähigkeiten nehmen von der Kindheit bis<br />
ins späte Erwachsenenalter zu und ihm hohen Alter wieder ab!<br />
� Erklärung: Zu- und wieder abnehmende Genom-Umweltpassung!<br />
� Grundlegendes Dilemma des Alterns: Weil die Zuverlässigkeit der Sinne und des<br />
Bewegungsapparates nachlässt, nimmt zwar der Bedarf an kognitiver<br />
181
Verhaltenskontrolle mit dem Alter zu, die Fähigkeit zu kognitiver Kontrolle nimmt<br />
jedoch ab (Veränderung des Stirnhirns etc.). Kognitives Altern kann dementsprechend<br />
als Verknappung einer zunehmend nachgefragten Ressource begriffen werden!<br />
� Möglichkeiten, dieses Dilemma abzuschwächen:<br />
� Aerobe Fitness (Bewegung an der frischen Luft: Walking etc.): führt zu<br />
besseren kognitiven Leistungen, insbesondere was die kognitive Kontrolle<br />
betrifft, indem alterungsbedingte strukturelle Veränderungen des Gehirns<br />
hinausgezögert werden. Mögliche Erklärungen: a) stärkere Durchblutung<br />
frontaler Hirnregionen, b) Zunahme neuronaler Plastizität, c) Abnahme des<br />
Kontrollbedarfs von Sensorik und Sensomotorik (� Freisetzung kognitiver<br />
Ressourcen!)<br />
� Intelligent unterstützende Umwelten (=Externe Hilfsmittel): Z.B. ein<br />
Navigationssystem, das Älteren das Autofahren erleichtert, indem nicht mehr<br />
auf den richtigen Weg bzw. eine Karte geachtet werden muss<br />
3. Persönlichkeitsentwicklung im mittleren und höheren Erwachsenenalter<br />
� Verschiedene Forschungsansätze und –perspektiven:<br />
� Bezüglich der Persönlichkeitsentwicklung lassen sich 3 Forschungsansätze<br />
unterscheiden:<br />
a) Persönlichkeitsforschung: untersucht die strukturelle Stabilität,<br />
Niveaustabilität, relative Stabilität und Profilstabilität von<br />
Persönlichkeitseigenschaften bzw. Eigenschaftsmustern über die<br />
Lebenspanne hinweg; inhaltlich orientiert sie sich dabei meist an den „Big<br />
Five“ (Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Neues, Verträglichkeit,<br />
Gewissenhaftigkeit)<br />
b) Forschung zu Selbstkonzept, Selbstdefinition und Identität: fragt weniger<br />
danach, wie eine Person objektiv ist, als vielmehr danach, wie sie sich selbst<br />
sieht; betont wird dabei v. a. die soziale und situationale Bedingtheit des<br />
Selbstkonzepts und der Identität!<br />
c) Forschung zu selbst-regulativen Prozessen: untersucht u. a.<br />
Selbstevaluationen, Zielorientierungen, Bewältigungsverhalten (Coping),<br />
Kontrollüberzeugungen, emotionale Regulation etc. Sie bietet sich damit am<br />
ehesten an, eine Brücke zu den Untersuchungen zur kognitiven Entwicklung<br />
zu schlagen.<br />
� Zwei mögliche Perspektiven:<br />
� Personale Perspektive: Konstrukte wie das „Selbst“, die „Persönlichkeit“<br />
etc. werden als Explans verstanden, d.h. sie werden zur Verhaltenserklärung<br />
herangezogen.<br />
� Subpersonale Perspektive: betrachtet diese Konstrukte dagegen als<br />
Explanandum; untersucht werden etwa die verschiedenen Funktionen des<br />
Selbstkonzepts etc.<br />
� Die wichtigsten Ergebnisse der Persönlichkeitsforschung: Insgesamt sprechen die<br />
Befunde für eine hohe Stabilität von Persönlichkeitseigenschaften über die<br />
Lebensspanne.<br />
� Strukturelle Stabilität (Stabilität der Anzahl sowie der Varianzen und<br />
Kovarianzen der erhobenen Persönlichkeitsdimensionen): ab dem 10. Lebensjahr<br />
gegeben<br />
� Hohes Maß an relativer Stabilität (Stabilität interindividueller Unterschiede):<br />
r =.65.<br />
� Niveaustabilität (einzelner Eigenschaften) an sich recht hoch, nimmt aber<br />
insbes. im hohen Alter ab; dabei zeigen sich folgende Tendenzen: leichte<br />
182
Abnahme der Dimensionen Extraversion, Offenheit und Neurotizismus, dafür<br />
aber Zunahme der Dimensionen Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit<br />
� Problem: Daten zur Niveaustabilität werden meist aus Querschnittsstudien<br />
entnommen (=> mögliche Kohorteneffekte!)<br />
� Profilstabilität: geringer als die übrigen Stabilitäten<br />
� Mögliche Erklärung (s.u.): Unterschiedliche Entwicklungsaufgaben<br />
erfordern unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale!<br />
� Trotz der recht hohen Stabilität von Persönlichkeitseigenschaften und<br />
Eigenschaftsmustern ist auch der Bereich von Selbst und Persönlichkeit durch<br />
Plastizität gekennzeichnet.<br />
� Verschiedene Selbstkonzepte (etwa als Berufstätiger, Vater, Hobbymusiker etc.)<br />
erleichtern die Anpassung an veränderte Entwicklungsbedingungen; im Sinne<br />
des SOK-Modells können sie genau wie intellektuelle Fähigkeiten als personale<br />
Ressourcen beschrieben werden.<br />
� Welche Ziele (Beruf, Familie, Gesundheit, Freunde etc.) und Selbstkonzepte im<br />
Vordergrund stehen, hängt nicht zuletzt vom Alter ab.<br />
� Während z.B. im Alter zw. 25 und 35 meist der „Beruf“ ganz vorne auf der<br />
Prioritätenliste steht, ist es ab 35 eher die Familie und spätestens ab 85 meist<br />
die Gesundheit!<br />
� 2 Formen von Bewältigungs- bzw. „Coping“-Verhalten lassen sich<br />
unterscheiden:<br />
� Assimilatives Bewältigungsverhalten: problemorientiertes Verhalten zur<br />
Erreichung bestimmter Ziele � unterstützt Optimierungsprozesse und ist<br />
dementsprechend v. a. in der ersten Lebenshälfte wichtig!<br />
� Akkomodatives Bewältigungsverhalten: Aufgabe nicht erreichbarer Ziele,<br />
Reduktion des Anspruchsniveaus und positive Neubewertung besser<br />
erreichbarer Ziele � unterstützt verlustbasierte Selektionsprozesse und<br />
gewinnt dementsprechend in höherem Erwachsenenalter zunehmend an<br />
Bedeutung!<br />
183