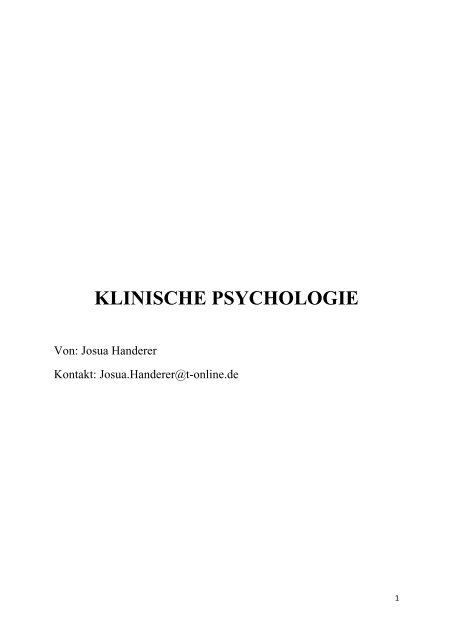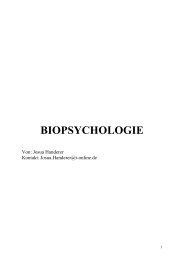KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>KLINISCHE</strong> <strong>PSYCHOLOGIE</strong><br />
Von: Josua Handerer<br />
Kontakt: Josua.Handerer@t-online.de<br />
1
1.1. Allgemeines:<br />
1. Einführung<br />
1.1.1. Häufigkeit und Definition psychischer Störungen<br />
Die klinische Psychologie bzw. Psychopathologie beschäftigt sich mit den<br />
Ursachen und der Entwicklung gestörten (=abnormem) Verhaltens.<br />
Zur Häufigkeit psychischer Erkrankungen:<br />
a) Psychische Erkrankungen sind die vierthäufigste Ursache krankheitsbedingter<br />
Fehltage (AU-Tage = Ausfalltage am Arbeitsplatz); ihr prozentualer Anteil<br />
beträgt 9,8%!<br />
Zum Vergleich: die beiden häufigsten Gründe sind Erkrankungen am<br />
Muskel-Skelett-System (22,6%) oder Atmungssystem (15,5%)<br />
b) Die Häufigkeit psychischer Erkrankungen nimmt massiv zu (zw. 1997 und<br />
2004 stieg ihr Anteil um 70%!)<br />
Die Definition psychischer Störungen und abnormen Verhaltens ist problemtisch;<br />
es bedarf dazu immer mehrerer Kriterien.<br />
1) Statistische Seltenheit<br />
Abnormes Verhalten ist statistisch selten! Geistige Behinderung liegt z.B.<br />
bei einem IQ < 70 vor.<br />
Aber: - Nicht jedes seltene Verhalten gilt als „gestört“ (z.B. extreme<br />
Begabungen)<br />
2) Verletzung sozialer Normen<br />
Abnormes Verhalten weicht von sozialen Normen ab und stellt damit eine<br />
Belästigung oder Bedrohung für das Umfeld dar.<br />
Aber: - Nicht jede Störung verletzt soziale Normen (z.B. Angst)<br />
Nicht jedes Verhalten, das soziale Normen verletzt, gilt als<br />
psychische Störung (z.B. Kriminalität)<br />
Soziale Normen sind stark vom kulturellen Kontext<br />
abhängig und in diesem Sinne relativ (z.B. Homosexualität,<br />
Drogengebrauch, Stimmen hören etc.)<br />
3) Persönliches Leid<br />
Psychische Störungen fördern persönliches Leid!<br />
Aber: - Nicht jede psychische Störung beinhaltet Leid (z.B. Manie)<br />
Nicht alle Leiden (Hunger, Schmerz etc.) sind psychopathologisch!<br />
4) Beeinträchtigung der Lebensführung<br />
Abnormität geht mit Einschränkungen in der Lebensführung einher (z.B.<br />
Flugangst etc.)<br />
Aber: - Gilt nicht für alle Störungen (z.B. Transvestismus)<br />
Nicht alle Einschränkungen (z.B. nicht singen können) sind<br />
psychopathologisch!<br />
5) Unangemessenheit des Verhaltens<br />
Unangemessene Reaktionen auf Situationen (z.B. übertriebene finanzielle<br />
Sorgen trotz großen Reichtums)<br />
2
FAZIT: Die Klassifizierung psychopathologischen Verhaltens hängt stark vom<br />
sozialen und kulturellen Kontext ab und ist dementsprechend wandelbar; dies<br />
spiegelt sich nicht zuletzt in den verschiedenen Überarbeitungen der diagnostischen<br />
Manuale (DSM, ICD) wider!<br />
Homosexualität z.B. galt in den ersten beiden Versionen des DSM (genauer:<br />
bis 1973) noch als Störung – und wird von manchen immer noch als solche<br />
angesehen („Habemus papam!“)<br />
1.1.2. Wissenschaftstheoretisches<br />
In der klinischen Psychologie ist es aufgrund verschiedener Faktoren besonders<br />
schwer, das Ideal der Objektivität ist zu erreichen:<br />
Kulturellen und soziale Abhängigkeit psychischer Störungen (s.o.)<br />
Eigene Betroffenheit<br />
Schon gesundes Verhalten lässt sich nicht vollständig erklären<br />
Thomas Kuhn: Paradigmen beeinflussen, welche Art von „Rätseln“ untersucht<br />
wird, wie sie untersucht werden (Methoden), was dabei beobachtet wird und wie<br />
die Beobachtungsergebnisse interpretiert werden.<br />
Frühere Paradigmen der Psychopathologie (geschichtlicher Rückblick):<br />
Dämonologie (Mittelalter): Psychische Störungen als Besessenheit =><br />
„Therapie“: Exorzismus; Hexenverbrennung<br />
Asyle (ab 15.Jh): als Fluchtorte für psychisch Kranke<br />
Aktuelle Paradigmen in der Psychopathologie und –therapie (s.u.):<br />
1) Das biologische Paradigma<br />
2) Das psychoanalytische Paradigma<br />
3) Das Humanistische bzw. existentielle Paradigma<br />
4) Lerntheoretische bzw. behavioristische Paradigmen<br />
5) Das kognitive Paradigma<br />
6) Das Diathese-Stress-Modell (ein integratives Paradigma)<br />
Experiment zur Wirkung von Paradigmen (Langer und Abelson, 1974):<br />
Verhaltenstherapeuten und Psychoanalytikern wird ein Interview mit einem Mann<br />
präsentiert, der entweder als „Stellenbewerber“ (A) oder als „Patient“ (B) charakterisiert<br />
wird; Aufgabe der Therapeuten ist es, die „Angepasstheit“ dieses Mannes einzustufen.<br />
Ergebnis: In Bedingung A: kein Unterschied, in Bedingung B: Analytiker halten das<br />
Verhalten des „Patienten“ für wesentlich gestörter als die Verhaltenstherapeuten<br />
Erklärung: Analytiker beschränken sich bei ihrer Einschätzung nicht nur auf das<br />
gezeigte Verhalten, sondern gehen darüber hinaus!<br />
3
2. Gegenwärtige Paradigmen der Psychopathologie<br />
2.1. Das biologische Paradigma<br />
2.1.1. Grundannahmen:<br />
Somatogene Hypothese: Alle psychischen Störungen sind organisch bedingt, sprich:<br />
auf somatische bzw. physiologische Ursachen zurückzuführen.<br />
Solche Ursachen können sein:<br />
a) Vererbung<br />
b) Biochemie des Nervensystems<br />
c) Fehlentwicklung oder Verletzung von Gehirnstrukturen<br />
Beispiele:<br />
Schizophrenie (=> genetische Disposition)<br />
Manie (=> Überschuss an Noradrenalin)<br />
Demenzen (=> Schädigung von Gehirnstrukturen)<br />
Interventionsmaßnahmen zielen auf die Beeinflussung biologischer Prozesse<br />
(Medikamente, chirurgische Eingriffe); die Wirksamkeit nichtbiologischer<br />
Interventionen (Psychotherapie) wird dabei jedoch nicht geleugnet; auch sie können<br />
körperliche Prozesse beeinflussen.<br />
2.1.2. Forschungsansätze:<br />
Die Verhaltensgenetik: untersucht, inwiefern individuelle Unterschiede im<br />
Verhalten auf genetische Unterschiede zurückgeführt werden können.<br />
Sie bedient sich dabei folgender Methoden:<br />
1) Familienstudien<br />
Dabei werden Personen, die eine Störung aufweisen (sog.<br />
„Indexfälle“), identifiziert und anschließend untersucht, ob<br />
Verwandte dieser Personen ein im Vergleich zur Normalpopulation<br />
höheres Risiko aufweisen, ebenfalls an dieser Störung zu erkranken<br />
(Prävalenzrate).<br />
Beispiel (Schizophrenie): Verwandte ersten Grades (50% genetische<br />
Übereinstimmung) haben ein 10 Mal höheres Risiko an Schizophrenie<br />
zu erkranken als die Normalpopulation (10% zu 1%)!<br />
2) Zwillingsstudien<br />
Dabei werden ein- und zweieiige Zwillinge (100- und 50%ige<br />
Übereinstimmung) hinsichtlich einer Krankheit verglichen; stimmen<br />
sie darin überein, spricht man von Konkordanz!<br />
Ist die Konkordanz bei eineiigen Zwillingen höher als bei zweieigen,<br />
ist das ein Index für die Erblichkeit der betreffenden Krankheit, da ja<br />
sowohl eineiige-, als auch zweieiige Zwillinge jeweils denselben<br />
Umwelteinflüssen ausgesetzt sind (Annahme der gleichen Umwelt!)<br />
4
3) Adoptionsstudien<br />
Dabei werden Kinder untersucht, die getrennt von ihren psychisch<br />
kranken Eltern aufwachsen.<br />
Vorteil: Anders als bei Familien- und Zwillingsstudien kann hier der<br />
Einfluss von Erziehungseinflüssen von vornherein ausgeschlossen<br />
werden.<br />
4) Linkage-Analysen<br />
Untersuchung von vererbten genetischen Markern: Treten in<br />
Indexfamilien genetische Besonderheiten auf?!<br />
Zwischen Phäno- und Genotyp muss genau unterschieden werden: ersterer ist<br />
nicht statisch, sondern entwickelt sich in Abhängigkeit vom Genotyp und der<br />
Umwelt!<br />
Wichtig: Psychische Störungen sind Störungen des Phänotyps und nicht des<br />
Genotyps! Ob sie auftreten oder nicht, hängt dementsprechend nicht nur von der<br />
genetischen Disposition, sondern auch von Umwelteinflüssen ab!<br />
Biochemie des Nervensystems:<br />
Das Nervensystem besteht auf Neuronen, die sich ihrerseits aus Zellkörper,<br />
Zellkern (Nukleus), mehreren kurzen Dendriten und einem (oder mehreren)<br />
langen Axonen zusammensetzen; an letzteren befinden sich die „Endknöpfe“,<br />
die zusammen mit dem synaptischen Spalt und der postsynaptischen Membran<br />
eine Synapse bilden.<br />
Aktionspotenziale führen dazu, dass die synaptischen Vesikel in den<br />
„Endknöpfen“ eines Axons Neurotransmitter in den synaptischen Spalt<br />
freigeben; diese lagern sich an entsprechenden Rezeptoren der postsynaptischen<br />
Membran an und ermöglichen so die Weiterleitung des Signals an das folgende<br />
Neuron (Öffnung von Ionenkanälen Veränderung des Membranpotenzials).<br />
Ausgeschüttete Neurotransmitter, die sich nicht an Rezeptoren anlagern konnten,<br />
werden entweder abgebaut oder durch einen Wiederaufnahmemechanismus (Re-<br />
Uptake) in die präsynaptische Zelle zurückgeholt.<br />
Die im Zusammenhang mit psychischen Störungen wichtigsten Neurotransmitter<br />
sind: a) Noradrenalin<br />
b) Serotonin<br />
c) Dopamin<br />
d) Gamma-Aminobuttersäure (GABA)<br />
Psychopathologische Symptome werden meistens durch den Mangel oder<br />
Überschuss eines bestimmten Neurotransmitters verursacht. Ursachen für ein<br />
solches Ungleichgewicht können sein:<br />
Fehler in der Synthese des betreffenden Neurotransmitters (= gestörter<br />
Stoffwechselprozess)<br />
Gestörter Re-Uptake-Mechanismus<br />
Defekt, Mangel oder Überschuss postsynaptischer Rezeptoren<br />
5
2.1.3. Bewertung:<br />
Gefahr des Reduktionismus: Psychische Störungen sollten nicht auf ihre<br />
biologischen Grundlagen reduziert werden!<br />
1) Wäre eine solche Reduktion willkürlich (man könnte ebenso gut noch eine<br />
Ebene „tiefer“ gehen und die Biologie auf Atomphysik reduzieren)<br />
2) Ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile (Emergenzprinzip)!<br />
Ein biologisches Modell bedeutet in keinem Fall, dass psychotherapeutische Methoden<br />
unwirksam sind!<br />
2.2. Das lerntheoretische (behavioristische) Paradigma<br />
2.2.1. Theoretischer Hintergrund:<br />
Historischer Hintergrund: Die Behavioristen (Watson etc.) wollten Anfang des<br />
20.Jh. weg von der Introspektion, hin zu naturwissenschaftlichen Methoden; sie<br />
forderten daher, Bewusstseinsvorgänge ganz aus den psychologischen Überlegungen<br />
auszuklammern („Black Box“) und sich stattdessen ganz auf beobachtbares Verhalten<br />
zu konzentrieren (Reiz-Reaktions-Zusammenhänge)!<br />
Grundannahme: Pathologisches Verhalten ist genau wie normales Verhalten erlernt!<br />
Klassische Konditionierung (Pawlow, Watson): Die wiederholte Kopplung<br />
eines bedingten Reizes (CS) an einen unbedingten (UCS) führt zum Erlernen<br />
einer bedingten Reaktion (UCR => CR)!<br />
Beispiele: Der Pawlowsche Hund (Glocke + Futter => Speichelsekretion);<br />
Watson und der kleine Albert (Weiße Ratte + lautes Metallgeräusch =><br />
Angstreaktion); auch allergische Reaktionen sind z. T. kondioniert, deshalb<br />
fängt es oft schon an zu jucken, wenn man eine Katze nur sieht!<br />
Psychopatholgische Anwendung: v.a. bei emotionalen Störungen (z.B.<br />
Phobien)<br />
Operante Konditionierung (Thorndike, Skinner): fasst die Konsequenzen eines<br />
Verhaltens ins Auge (instrumentelles Lernen); positive Verstärkung =<br />
Hinzufügung eines positiven Reizes; negative Verstärkung = Entzug eines<br />
aversiven Reizes; „Shaping“ = sukzessive Annäherung an ein Zielverhalten<br />
durch Verstärkung<br />
Beispiel: „Skinner-Box“ (Ratten lernen, einen Hebel zu betätigen, um sich<br />
Futter zu verschaffen)<br />
Psychopathologische Anwendung: z.B. das Erlernen aggressiven Verhaltens<br />
im Kindes- und Jugendalter (durch Verstärkung); Zwei-Faktoren-Theorie<br />
der Angst (s.u.)<br />
Modelllernen bzw. stellvertretendes Lernen (Bandura): zeigt, dass Lernen<br />
auch ohne offene Reaktion oder direkte Verstärkung stattfinden kann<br />
„Zwei-Faktoren-Theorie der Angst“ (Mowrer & Miller):<br />
Das zugrundeliegende Experiment: Ratten lernen in einem<br />
Konditionierungsexperiment (Klingel + Stromschlag) nicht nur das Fürchten,<br />
sondern auch entsprechende Vermeidungsreaktionen.<br />
6
Zwei Lernschritte bzw. Faktoren sind entscheidend:<br />
1) In einem ersten Schritt wird durch klassische Konditionierung Angst als<br />
Reaktion auf einen Reiz gelernt Innere Schmerz- Furchtreaktion<br />
2) Im zweiten Schritt wird die Angst durch operante Konditionierung zum<br />
Antrieb für das Erlenen von Vermeidungsverhalten, sofern letzteres durch<br />
die Reduktion der Angst negativ verstärkt wird Offene<br />
Vermeidungsreaktion<br />
Angst lässt sich vor diesem Hintergrund aus 2 Perspektiven betrachten:<br />
a) als emotionale Reaktion, die gelernt wird wie jede andere Reaktion<br />
b) als Stimulus bzw. Antrieb für Vermeidungsverhalten<br />
Drei-Ebenen-Modell: Psychische Störungen sind multidimensional; sie äußern sich<br />
auf 3 Ebenen:<br />
1) Verhaltensebene<br />
2) Physiologisch-humorale Ebene<br />
3) Subjektiv-kognitive Ebene<br />
Bewertung des behavioristischen Paradigmas:<br />
Noch ist es nicht gelungen, psychische Störungen auf spezifische Lernprozesse<br />
zurückzuführen.<br />
2.2.2. Interventionsmaßnahmen (Verhaltenstherapie)<br />
Die Verhaltenstherapie entstand in den 50er Jahren; sie verwendet Lernmethoden<br />
(klassisches und operantes Konditionieren sowie Modelllernen), um abnormes<br />
Verhalten, Denken und Fühlen zu verändern.<br />
Bekannte Interventionsmaßnahmen sind:<br />
Gegenkonditionierung: Löschung einer Reaktion A + Konditionierung einer<br />
neuen Reaktion B, indem unangenehme Reize an positive gekoppelt werden.<br />
Systematische Desensibilisierung (nach Wolpe): Aufstellen einer<br />
Angsthierarchie; Kopplung der angstbesetzten Reize an Entspannungsübungen<br />
=> der Patient stellt sich, während er entspannt ist, die Reihe der<br />
angstauslösenden Situationen vor<br />
Aversives Konditionieren: Konditionierung von Angstreaktionen zur<br />
Blockierung unerwünschter Verhaltensweisen (Vgl. Clock-Work-Orange); z.B.<br />
bei Drogensucht; wird heute jedoch aus ethischen Gründen kaum noch<br />
angewendet<br />
Flooding / Implosionstherapie: Intensive Darbietung des angstauslösenden<br />
Reizes => Überstrapazierung des Angstreflexes => Körperliche Erschöpfung<br />
und Hemmung der Reflexbereitschaft<br />
Operante Konditionierung: SORCK-Gleichung von Kanfer und Phillips (s.u.)<br />
7
2.3. Das kognitive Paradigma und sonstige Paradigmen<br />
2.3.1. Das Kognitive Paradigma<br />
Wichtige Vertreter: BECK, ELLIS<br />
Kognitive Psychologen nehmen nicht nur das Verhalten, sondern auch die<br />
Kognitionen in den Blick.<br />
Kognitionen = Wahrnehmungsprozesse, Urteile, Attributionen etc.<br />
Auch Konditionierungsprozesse werden als kognitive Prozesse aufgefasst: das<br />
klassische Konditionieren z.B. als aktiver Lernvorgang, bei dem die Beziehung<br />
zw. zwei Ereignissen gelernt wird!<br />
Dysfunktionalen Kognitionen wird eine wichtige Rolle bei der Entstehung und<br />
Aufrechterhaltung psychischer Störungen zugeschrieben. Sie zu verändern, gilt daher<br />
als Hauptziel psychotherapeutischer Intervention. Neben kognitiven Methoden werden<br />
aber auch immer verhaltenstherapeutische Maßnahmen eingesetzt ( daher:<br />
kognitive Verhaltenstherapie!)<br />
Rational-emotive Verhaltenstherapie (Ellis): zielt v.a. auf die „Austreibung“<br />
irrationaler Überzeugungen<br />
Kognitive Umstrukturierung (Reattributionstrainings; Selbst-Instruktion etc.)<br />
2.3.2. Sonstige Paradigmen<br />
Das psychodynamische Paradigma: Freud & Co.<br />
„Psychodynamisch“ bezieht sich auf die Wechselwirkung der drei Instanzen<br />
(„Ich“, „Es“, „Über-Ich“)<br />
Das humanistische bzw. existentielle Paradigma: Rogers & Co.<br />
2.4. Das Diathese-Stress-Modell<br />
Das Diathese-Stress-Modell ist ein integratives Modell; es berücksichtigt nämlich<br />
sowohl biologische als auch psychologische und umweltbedingte Faktoren.<br />
Grundannahme: Zur Ausbildung einer Störung bedarf es sowohl einer „Diathese“<br />
als auch einer „Stress“-Komponente.<br />
Eine „Diathese“ ist eine Prädisposition für eine Krankheit; sie kann<br />
biologischer (z.B. Genetik, Infektionen, schlechte Ernährung etc.),<br />
psychologischer (z.B. kognitiver Stil) oder soziokultureller Art sein (z.B.<br />
Schlankheitswahn).<br />
„Stress“ meint schädliche oder ungünstige Umweltreize (z.B. der Tod eines<br />
Partners, ein Trauma, der Verlust des Arbeitsplatzes etc.)<br />
Vorhersagen: Wo keine Diathese vorliegt, ist die Stresskomponente meist irrelevant<br />
(sie führt zu keiner Störung), umgekehrt führt eine Diathese i.d.R. nur dann zu einer<br />
Störung, wenn entsprechende Umweltbelastungen hinzukommen.<br />
Vorteil: Das Diathese-Stress-Modell erlaubt es, die verschiedenen Paradigmen<br />
miteinander zu verknüpfen und deren Einseitigkeiten zu überwinden. Die<br />
verschiedenen Komponenten einer Störung (biologische, psychologische etc.) können<br />
je nach Art der Störung unterschiedlich gewichtet und bei der Behandlung<br />
berücksichtigt werden.<br />
8
3. Klassifikation und Diagnostik<br />
3.1. Die wichtigsten Klassifikationssysteme (DSM-IV und ICD-10)<br />
3.1.1. Geschichte diagnostischer Systeme<br />
1882: Der Statistik-Ausschuss der „Royal Medico-Psychological Association“ erstellt<br />
das erste Klassifikationsschema psychischer Krankheiten; es wird jedoch nicht einmal<br />
von den Mitgliedern allgemein anerkannt.<br />
1939: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erweitert die „International List of<br />
Causes of Death“ (ICD) um psychische Störungen.<br />
1952: Die „American Psychiatric Association“ (APA) veröffentlicht ihr eigenes<br />
„Diagnostic and Statistical Manual of mental diseases“ (DSM-I).<br />
Psychoanalytisch ausgerichtet<br />
1980: Die APA veröffentlicht das DSM-III, das nicht nur wesentlich umfangreicher<br />
als seine Vorgänger ist (über 400 Seiten), sondern auch ansonsten zahlreiche<br />
Veränderungen aufweist:<br />
Der Begriff der „Neurose“ wird entfernt<br />
Um die Reliabilität zu steigern, werden statt beschreibender Definitionen<br />
(„Prosa“) klare diagnostische Kriterien genannt<br />
Einführung des multiaxialen Systems: Jede Person soll im Hinblick auf 5<br />
Dimensionen bzw. Achsen beurteilt werden<br />
1992: Die WHO veröffentlicht die ICD-10 („International Classification of<br />
Diseases“, 10. Revision), die dem DSM-IV recht ähnlich ist.<br />
1994: DSM-IV (s.u.)<br />
2000: DSM-IV-TR (für Textrevision) ist die aktuellste Version des<br />
Diagnosehandbuchs, unterscheidet sich inhaltlich aber kaum vom DSM-IV<br />
2010/11: Geplante Veröffentlichung des DSM-V<br />
3.1.2. Das Wichtigste zum DSM-IV<br />
Allgemeines:<br />
Name: „Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen“ (DSM)<br />
Herausgeber: „American Psychiatric Association“ (APA)<br />
Verwendung: international; in Deutschland eher in forschungsorientierten<br />
Einrichtungen<br />
Grundannahme: Störungen können als Symptom-Gruppen (Cluster)<br />
beschrieben werden!<br />
Bei der Diagnose nach dem DSM-IV sind 5 verschiedene Dimensionen bzw. Achsen<br />
zu berücksichtigen (enorme Informationsmenge):<br />
1) Achse I: Alle psychischen Störungen außer Persönlichkeitsstörungen und<br />
geistiger Behinderung<br />
die für die Diagnose wichtigste Achse<br />
enthält 14 verschiedene Störungsgruppen (s.u.): z.B. Affektive Störungen...<br />
2) Achse II: Persönlichkeitsstörungen und geistige Behinderung<br />
enthält Langzeitstörungen und wird deshalb von Achse I unterschieden<br />
zu den versch. Arten von Persönlichkeitsstörungen: s.u.<br />
3) Achse III: Medizinische Krankheitsfaktoren (= körperliche Störungen)<br />
Z.B. Diabetes; Herzerkrankungen etc.<br />
9
Kodiert werden körperliche Störungen nur dann, wenn sie einen Einfluss auf<br />
die diagnostizierte psychische Störung haben (dieser kann z.B. auch darin<br />
bestehen, dass bestimmte Medikamente nicht verschrieben werden können)<br />
4) Achse IV: Psychosoziale und umgebungsbedingte Probleme<br />
z.B. Eheprobleme, finanzielle Probleme, Tod eines Angehörigen etc.<br />
5) Achse V: Globale Beurteilung des beruflichen und sozialen Funktionsniveaus<br />
(= Angepasstheit)<br />
Engl.: „Global Assessment of Functioning“ (GAF)<br />
Funktionsniveau (Leistungsfähigkeit, soz. Integriertheit etc.) wird auf einer<br />
Skala von 1-100 eingestuft, wobei zw. 91 und 100 eine hervorragendes, zw.<br />
1 und 10 ein massiv gestörtes Funktionsniveau vorliegt!<br />
Die wichtigsten Kategorien der Achse I:<br />
1. Störungen, die gewöhnlich zuerst im Kleinkindalter, in der Kindheit oder<br />
Adoleszenz diagnostiziert werden<br />
z.B. Trennungsangst, Aufmerksamkeitsdefizits-/Hyperaktivitätsstörung,<br />
Lernstörungen etc. (s.u.)<br />
2. Delir, Demenz, amnestische und andere kognitive Störungen<br />
Delir = Bewusstseinstrübung; Demenz = Abbau der geistigen Fähigkeiten;<br />
amnestische Störungen = Störungen des Gedächtnisses, die weder auf Delir<br />
noch Demenz zurückgeführt werden können<br />
3. Substanzinduzierte Störungen<br />
liegen vor, wenn die Drogeneinnahme die berufliche und soziale<br />
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt<br />
4. Schizophrenie und andere psychotische Störungen (gestörter Realitätsbezug…)<br />
5. Affektive Störungen (bei massiven Gemütsschwankungen)<br />
3 Unterarten: Major Depression, Manie, bipolare Störung<br />
6. Angststörungen (bei irrationaler und überproportionaler Angst)<br />
6 Unterarten: spezifische Phobien, Panikstörung, generalisierte<br />
Angststörung, Zwangsstörung, posttraumatische Belastungsstörung, akute<br />
Belastungsstörung<br />
7. Somatoforme Störungen (körperliche Symptome ohne physiologische Ursache)<br />
5 Unterarten: Somatisierungsstörung, Konversionsstörung, Schmerzstörung,<br />
Hypochondrie, körperdysmorphe Störung<br />
8. Vorgetäuschte Störungen<br />
9. Dissoziative Störungen (plötzliche Bewusstseinsänderungen, die das Gedächtnis<br />
und Identitätsgefühl beeinträchtigen)<br />
Unterarten: dissoziative Amnesie („Memento“), dissoziative Fugue<br />
(„Stiller“), dissoziative Identitätsstörung („Fight Club“),<br />
Depersonalisationsstörung (Kafka)<br />
10. Psychosexuelle Störungen<br />
Unterarten: Paraphilien (z.B. Exhibitionismus, Sadismus etc.), sexuelle<br />
Funktionsstörungen (Impotenz, EP etc.), Störungen der Geschlechtsidentität<br />
11. Essstörungen<br />
2 Hauptkategorien: a) Anexoria nervosa (Magersucht); b) Bulimia nervosa<br />
12. Schlafstörungen<br />
2 Hauptkategorien: a) Dyssomnien (Störung der Schlafquantität und<br />
-qualität); b) Parasomnien (ungewöhnliche Ereignisse während des Schlafs:<br />
Schlafwandeln, Alpträume etc.)<br />
13. Störungen der Impulskontrolle, nicht andernorts klassifiziert<br />
z.B.: Intermittierende explosive Störung (Wutausbrüche), Kleptomanie,<br />
Pyromanie, pathologisches Spielen, Trichotillomanie (= Haare ausreißen)<br />
10
14. Anpassungsstörungen<br />
Symptome in Folge von Belastungsfaktoren (z.B. Tod eines Verwandten)<br />
Kategorien der Achse II:<br />
Persönlichkeitsstörungen = überdauernde, tiefgreifende, unflexible und<br />
schlecht angepasste Verhaltensmuster und Erlebensweisen<br />
Cluster<br />
A<br />
Cluster<br />
B<br />
Cluster<br />
C<br />
a) Paranoide PS<br />
b) Schizoide PS<br />
c) Schizotypische PS<br />
d) Antisoziale PS<br />
e) Borderline PS<br />
f) Histrionische PS<br />
g) Narzisstische PS<br />
h) Vermeidend-selbstunsichere PS<br />
i) Dependente PS<br />
j) Zwanghafte PS<br />
Restkategorie (auf Achse I oder II?!): „Andere Zustände, die von klinischem<br />
Interesse sein können“<br />
Darunter fallen alle möglichen Gründe, wegen derer man einen Therapeuten<br />
aufsuchen kann: z.B. Schulschwierigkeiten, antisoziales Verhalten,<br />
zwischenmenschliche Probleme (etwa zw. Geschwistern), Berufsprobleme (z.B.<br />
Unzufriedenheit mit der Arbeit) usw. usw.<br />
Allgemeines zur Diagnose:<br />
Zu jedem Krankheitsbild werden unter B. mehrere Symptome genannt, von<br />
denen immer eine bestimmte Mindestanzahl vorliegen muss, um eine Diagnose<br />
zu rechtfertigen.<br />
Darüber hinaus setzt jede Diagnose voraus, dass…<br />
a) …eine deutliche Einschränkung des sozialen und beruflichen Lebens<br />
vorliegt und/oder über subjektives Leiden geklagt wird (C.)<br />
b) …die Symptome nicht auf die direkte Wirkung einer Substanz oder eines<br />
medizinischen Krankheitsfaktors zurückgeführt- und nicht durch eine<br />
andere Störung besser erklärt werden können.<br />
3.1.3. Das Wichtigste zum ICD-10<br />
Allgemeines:<br />
Name: Die 10. Revision der International Classification of Deseases (ICD-10)<br />
Herausgeber: Weltgesundheitsorganisation (WHO)<br />
Aufbau: Die ICD umfasst möglichst alle Krankheiten; psychische Störungen<br />
werden im 5. Kapitel (Abschnitt F) behandelt<br />
Verwendung: eher im europäischen Raum, im dt. Gesundheitswesen weiter<br />
verbreitet als das DSM-IV<br />
Psychische Störungen werden in 10 Hauptgruppen gegliedert:<br />
F0: Organische, einschließlich psychischer Störungen<br />
Hirnverletzungen und –schädigungen unterschiedlichster Art<br />
F1: Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen<br />
F2: Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen<br />
F3: Affektive Störungen<br />
F4: Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen<br />
F5: Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren<br />
Essstörungen, nichtorganische Schlafstörungen, sex. Funktionsstörungen<br />
F6: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen<br />
11
F7: Intelligenzminderung<br />
F8: Entwicklungsstörungen<br />
F9: Verhaltens- und emotionale Störungen in der Kindheit und Jugend<br />
Kodierung:<br />
Allgemein:<br />
F = psychische Störung<br />
1. Zahl nach dem F = Hauptgruppe (s.o.)<br />
2. Zahl nach dem F = Nähere Spezifizierung<br />
Zahlen nach dem Punkt = Zusatzinfos<br />
Beispiel: F 32.2 = Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen<br />
3 = Hauptgruppe 3 (Affektive Störungen)<br />
2 = Depressive Episode<br />
.2 = mit psychotischen Symptomen<br />
Vergleich zum DSM-IV:<br />
Gemeinsamkeiten: Große Ähnlichkeit bezüglich der einzelnen Kategorien<br />
Unterschiede: Im Unterschied zum DSM-IV verlangt die ICD-10 keine<br />
multiaxiale Beurteilung; außerdem: andere Kodierung (s.o.)<br />
3.1.4. Chancen und Probleme der Klassifikation<br />
Chancen: Diagnostische Systeme…<br />
…geben Auskunft über die Ursachen einer Störung<br />
…erlauben Prognosen<br />
…erleichtern die Auswahl einer optimalen Behandlungsmethode<br />
…bilden die Grundlage weiterer Forschung<br />
Klassifikationssysteme reduzieren Information, so dass zwangsläufig ein Teil der<br />
Einmaligkeit der untersuchten Person verloren geht.<br />
Aber: Klassifizieren ist ein unabdingbarer Teil menschlichen Denkens!<br />
Ob die für die Klassifikation berücksichtigten Infos die entscheidenden sind, kann<br />
nicht mit Sicherheit gesagt werden; es könnte also durchaus sein, dass triviale<br />
Ähnlichkeiten überbetont und relevante Ähnlichkeiten (noch) vernachlässigt werden.<br />
Klassifikationen können zu Stigmatisierungen führen.<br />
Die Anzahl der zur Diagnose notwendigen Symptome (s.o.) ist mehr oder minder<br />
willkürlich!<br />
Sowohl das DSM-IV als auch die ICD-10 sind kategoriale Klassifikationssysteme, sie<br />
verlangen dem Kliniker also diskrete Ja-/Nein-Entscheidungen ab: Liegt eine<br />
Störung vor oder nicht? Dass sich „normales“ und „abnormes“ Verhalten auf einem<br />
Kontinuum bewegen und in verschiedenen Ausprägungen auftreten können, bleibt<br />
damit unberücksichtigt.<br />
Aber: Auch dimensionale Klassifikationen (Einstufung auf einer quantitativen<br />
Skala) haben Nachteile:<br />
1. Müssen auch sie einen Grenzpunkt beinhalten, der eine diskrete<br />
Klassifikation erlaubt.<br />
2. Liegt dimensionalen Variablen (wie z.B. Bluthochdruck) häufig eine diskrete<br />
Variable (z.B. das Vorhandensein eines Gens) zugrunde.<br />
Diagnostische Systeme implizieren, dass die von ihnen verwendeten Kategorien<br />
kulturell unabhängig sind (im DSM-IV wird eine solche Unabhängigkeit für manche<br />
Störungen sogar explizit postuliert).<br />
Zwar gibt es in der Tat kulturübergreifende Symptome (so z.B.<br />
Wahnvorstellungen bei Schizophrenie oder Energielosigkeit bei Depression), die<br />
12
Beurteilung dieser Symptome kann jedoch in Abhängigkeit vom kulturellen<br />
Kontext variieren.<br />
Auch die Symptome selbst sind z.T. kulturabhängig: z.B. sind Schuldgefühle bei<br />
Depressionen in westlichen Gesellschaften sehr häufig, in Japan und im Iran<br />
dagegen eher selten.<br />
Sogar bestimmte Krankheiten als ganze können kulturell bedingt sein: Anorexia<br />
z.B. tritt (fast) nur in westlichen Gesellschaften auf.<br />
Trotz standardisierter Interviews bleibt auf Seiten des Therapeuten nach wie vor ein<br />
großer Ermessensspielraum und damit Raum für subjektive Verzerrungen: Was z.B.<br />
ist ein „übersteigertes Selbstwertgefühl“?<br />
Reliabilität = Genauigkeit, mit der ein Test ein bestimmtes Merkmal misst<br />
Drei Arten von Reliabilität lassen sich unterscheiden:<br />
1. Interrater-Reliabilität: Übereinstimmungsgrad zw. 2 Beobachtern<br />
Sensitivität: Übereinstimmung darin, dass eine bestimmte Diagnose<br />
vorliegt!<br />
Spezifität: Übereinstimmung darin, dass eine bestimmte Diagnose nicht<br />
vorliegt!<br />
2. Test-Retest-Reliabilität: Übereinstimmungsgrad zweier Messungen an<br />
derselben Person<br />
3. Interne Konsistenz: Zusammenhang der Items eines Tests<br />
Die Reliabilitäten der DSM-IV und ICD-10-Diagnosen sind größtenteils<br />
zufriedenstellend; die meisten Kappa-Koeffizienten (um die zufällige<br />
Übereinstimmung bereinigte Interrater-Reliabilität) liegen über bzw. knapp<br />
unter .70 (=gut)!<br />
Tatsächliche Reliabilität (unter klinischen Alltagsbedingungen) vermutlich<br />
etwas niedriger!<br />
Validität = Genauigkeit, mit der ein Test das misst, was er messen soll<br />
Drei Arten diagnostischer Validität (=Konstruktvalidität):<br />
1. Ätiologische Validität: ist gegeben, wenn für die Störung von Patienten mit<br />
gleicher Diagnose die gleichen lebensgeschichtlichen Umstände<br />
verantwortlich sind.<br />
Bei Schizophrenie z.B.: Genetische Prädisposition, aufreibende<br />
Vorkommnisse, virale Infektion der Mutter etc.<br />
2. Übereinstimmungsvalidität: ist gegeben, wenn sich weitere Symptome, die<br />
nicht zur eigentlichen Diagnose gehören, als charakteristisch erweisen.<br />
Bei Schizophrenie z.B.: geringe soziale Fertigkeiten, Beeinträchtigung<br />
des Gedächtnisses etc.<br />
3. Vorhersagevalidität: ist gegeben, wenn Patienten mit derselben Diagnose<br />
einen ähnlichen Verlauf aufweisen und ähnlich auf best.<br />
Behandlungsmethoden reagieren.<br />
Bei Schizophrenie z.B.: Episodischer Verlauf, gutes Ansprechen auf<br />
medikamentöse Therapien<br />
13
4. Klinische Erhebungsverfahren<br />
4.0. Allgemeine Vorbemerkungen<br />
Klinische Erhebungsverfahren dienen dazu, herauszufinden…<br />
…was mit einem Menschen nicht stimmt<br />
…wie sich die Störung auf den verschiedenen Ebenen äußert (emotional,<br />
kognitiv, auf der Verhaltensebene und auf der Persönlichkeitsebene)<br />
…wo die Ursachen der betreffenden Störung liegen könnten<br />
…welche Behandlungen präventiv oder kurativ wirksam sein könnten<br />
…wie wirksam therapeutische Interventionen sind<br />
Grundsätzlich kann zwischen psychologischen und biologischen Verfahren<br />
unterschieden werden. Welche Verfahren bevorzugt und wie sie im Einzelnen<br />
angewandt werden, hängt dabei nicht zuletzt vom zugrundegelegten Paradigma ab.<br />
Reliabilität und Validität der Verfahren ist unterschiedlich!<br />
4.1. Psychologische Erhebungsverfahren<br />
4.1.1. Klinische Interviews<br />
Ein „Interview“ ist jeder zwischenmenschliche Austausch, der zum Sammeln von<br />
Informationen genutzt wird. Unterschieden werden kann zwischen strukturierten und<br />
weniger strukturierten Interviews.<br />
In strukturierten Interviews sind sowohl die Formulierung als auch die<br />
Reihenfolge der Fragen vorgegeben (s.u.).<br />
Vorteil: Erhöhte Reliabilität; standardisierte Daten<br />
In der Praxis liegen klinischen Interwies jedoch meistens nur grobe Leitlinien<br />
zugrunde. Jeder Therapeut entwickelt so im Laufe seiner Berufszeit einen<br />
eigenen Interviewstil.<br />
Problem: Geringe Reliabilität einzelner Interwies; es muss jedoch bedacht<br />
werden, dass i.d.R. mehrere Interviews geführt werden.<br />
Strukturierte Interviews: sind z.B. das „Strukturierte Klinische Interview für die<br />
Achse I des DSM-IV“ (SKID-I) oder das „Diagnostische Interview bei psychischen<br />
Störungen“ (DIPS)<br />
Aufbau des SKID-I: Das SKID ist ein verzweigtes Interview, d.h. die Antwort<br />
des Patienten auf eine Frage bestimmt, welche Frage als nächstes gestellt wird<br />
(Entscheidungsbaum).<br />
Screening zur Erfassung der Kernsymptome<br />
Detaillierte Nachfrage zu Störungsbildern, bei denen die Kernsymptome<br />
vorliegen<br />
Beurteilung der Symptome auf einer dreistufigen Skala<br />
Dauer: 1 ½ Stunden, wenn keine gravierende Symptomatik vorliegt,<br />
entsprechend länger, wenn mehrere Problembereiche vorliegen<br />
Problem: kann ermüdend und belastend sein (z.B. Retraumatisierung)<br />
Merkmale eines klinischen Interviews:<br />
a) Beachtung non-verbalen Verhaltens<br />
Es geht in klinischen Interviews nicht nur darum, was der Patient antwortet,<br />
sondern auch darum, wie er antwortet.<br />
b) Einfluss des Paradigmas<br />
Das Paradigma des Interviewers bestimmt, was für Infos gesucht-, wie sie<br />
gewonnen- und wie sie interpretiert werden.<br />
14
c) Bedeutung der Beziehung<br />
Ein klinisches Interview setzt auf Seiten des Patienten Vertrauen und auf<br />
Seiten des Therapeuten ein hohes Maß an Empathie voraus.<br />
d) Unklare Verlässlichkeit der Information<br />
Problematisch ist a) dass sich die Klienten über ihre eigene Lage oft nicht<br />
hinreichend bewusst sind, um sie zu erörtern und b) dass ihre Antworten in<br />
hohem Maß von situativen Faktoren abhängig sind (Erscheinungsbild des<br />
Therapeuten etc.)<br />
4.1.2. Psychologische Tests<br />
Psychologische Tests sind standardisierte Prozeduren, um die Leistung oder<br />
Persönlichkeit einer Person zu messen; sie können ergänzende Infos für eine Diagnose<br />
liefern, wenn das Interview zu keinem eindeutigen Ergebnis führt.<br />
Dass psychologische Tests standardisiert sind, heißt, dass ihre Auswertung<br />
anhand statistischer Normen erfolgt, die aus der Normalpopulation gewonnen<br />
wurden.<br />
Unterscheiden werden kann zwischen:<br />
1. Persönlichkeitsfragebögen (NEO-FFI etc.)<br />
2. Projektiven Persönlichkeitstests (TAT etc.)<br />
3. Intelligenztests (HAWIE, HAWIK, CFT etc.)<br />
4. Spezifischen Tests (etwa zur Erhebung des dispositionellen und<br />
zustandsgebundenen Angstniveaus: State-Trait-Angstinventar)<br />
Beispiele für Persönlichkeitsfragebögen:<br />
Das „Minnesota Multiphasic Personality Inventory“ (MMPI) ist der im<br />
klinischen Kontext am häufigsten eingesetzte Persönlichkeitstest! Eher ein<br />
Inventar klinischer Störungen als ein allgemeiner Persönlichkeitstest.<br />
Die „Symptom-Checkliste-90“ (SC-90): enthält 90 Items und misst insgesamt<br />
9 Skalen, nämlich: Somatisierung, Zwanghaftigkeit, soziale Unsicherheit,<br />
Depressivität, Ängstlichkeit, Aggressivität, phobische Angst, paranoides Denken<br />
und Psychotizismus. Generell geht es darum, die subjektiv empfundene<br />
Beeinträchtigung durch körperliche und psychische Symptome innerhalb eines<br />
Zeitraums von 7 Tagen zu erheben.<br />
Das Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI): erhebt mehrere Skalen;<br />
darunter: Lebenszufriedenheit, Leistungsorientierung, soziale Orientierung,<br />
Gehemmtheit, Aggressivität und Extraversion.<br />
Das NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI): basiert auf dem Fünf-<br />
Faktoren-Modell der Persönlichkeit („big five“), erhoben werden<br />
1. Neurotizismus; 2. Extraversion; 3. Offenheit für Erfahrungen;<br />
4. Verträglichkeit; 5. Gewissenhaftigkeit.<br />
Zu projektiven Tests:<br />
In projektiven Tests geht es um die subjektive Beurteilung mehrdeutigen<br />
Reizmaterials; die hinter den Tests stehende Grundannahme wird als<br />
„Projektionshypothese“ bezeichnet; sie besagt, dass in den Antworten der Pbn<br />
unbewusste Einstellungen und Motive zu Tage treten.<br />
Beispiele für projektive Tests:<br />
Rohrschach-Test: sammelt Assoziationen zu 10 Klecksbildern<br />
Thematischer Apperzeptionstest (TAT): Pbn schreiben zu einer Reihe<br />
bildhafter Szenen kurze Geschichten<br />
Scenotest: Mithilfe von Figuren und Gegenständen sollen Alltagsszenen<br />
aufgestellt werden<br />
Problem projektiver Tests: Schwierige Auswertung; fragliche Reliabilität<br />
15
4.1.3. Beobachtungsverfahren<br />
Die klinische Verhaltensbeobachtung orientiert sich an dem sog. SORKC-Modell<br />
(Kanfer und Phillips):<br />
S (Stimuli): bezieht sich auf die Stimuli und Umgebungsfaktoren, die dem<br />
problematischen Verhalten vorausgehen<br />
Bei Schlafstörungen z.B. das Schlafzimmer<br />
O (Organismus): bezieht sich auf die relevanten psychologischen und<br />
physiologischen Faktoren innerhalb der Person, die den Umwelteinfluss<br />
moderieren.<br />
Bei Schlafstörungen z.B. eine hohe Erregung durch Ehe- oder<br />
Berufsprobleme<br />
R (Reaktion): bezieht sich auf die Verhaltensmuster, die das Problem bedingen<br />
bzw. damit einhergehen<br />
Bei Schlafstörungen z.B. wach im Bett liegen, etwas essen, fernsehen etc.<br />
K (Kontingenz): bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen R und C.<br />
C (Konsequenzen): bezieht sich auf die Ereignisse, die der Reaktion folgen und<br />
diese verstärken bzw. bestrafen.<br />
Kurzfristige Konsequenzen: positive Verstärkung (interessanter Film, gutes<br />
Essen); negative Verstärkung (Ablenkung von Sorgen)<br />
Mittel- und langfristige Konsequenzen: „Bestrafung“ (Konzentrationsprobleme,<br />
Müdigkeit etc.)<br />
Prinzipiell kann zwischen direkten Beobachtungsverfahren und<br />
Selbstbeobachtungsverfahren unterschieden werden:<br />
Direkte Verhaltensbeobachtung: während der Sitzungen, bei Hausbesuchen<br />
oder im Rahmen sog. Verhaltensexperimente, wozu z.B. Rollenspiele, In-vivo-<br />
Expositionen und „Behaviour Avoidance Tests“ (BAT) zählen.<br />
Ein BAT wäre z.B. die sukzessive Annäherung an einen phobischen Reiz<br />
(etwa eine Spinne).<br />
Erleichtert werden kann die direkte Beobachtung z.B. durch die Methode<br />
des „lauten Denkens“<br />
Selbstbeobachtung: in Form von Selbstaussage-Fragebögen,<br />
Tagebucheinträgen oder Protokollen; erfolgt die Selbstbeobachtung in Echtzeit<br />
spricht man auch von einer „Ökologischen Momentaufnahme“ (ÖMA)<br />
Probleme: Gedächtnisverzerrungen, Reaktanz! Letztere ist jedoch nicht nur<br />
ein Nachteil, sondern therapeutisch von großem Nutzen!<br />
4.2. Biologische Erhebungsverfahren<br />
4.2.1. Bildgebende Verfahren<br />
Computertomographie (CT): ist ein Verfahren zur Darstellung von Gehirnstrukturen<br />
Dabei wird aus vielen einzelnen Röntgenaufnahmen (aus unterschiedlichen<br />
Winkeln und Schichten) ein Bild von der Dichteverteilung des Körper- bzw.<br />
Gehirngewebes errechnet!<br />
Es gilt: Je dichter das Gewebe => desto mehr Röntgenstrahlen werden<br />
absorbiert => desto heller das auf die Detektorplatte projizierte Bild<br />
Magnetresonanz- bzw. Kernspintomographie (MRT): ist ebenfalls ein Verfahren<br />
zur Darstellung von Gehirnstrukturen<br />
Durch elektromagnetische Impulse werden die Wasserstoffatome (genauer:<br />
deren Kerne => H+) zunächst in eine Richtung ausgerichtet („Alignment“) und<br />
anschließend ihr Eigendrehimpuls („Spin“) registriert (=elektromagnetisches<br />
16
Signal). Auf diese Weise kann die Wasserstoffkonzentration und damit die<br />
Durchblutungsstärke der verschiedenen Hirnregionen sichtbar gemacht werden.<br />
Vorteile: MRT liefert nicht nur bessere Bilder als die CT, sondern benötigt auch<br />
weniger Strahlung!<br />
Funktionelle Kernspintomographie (fMRT): dient der Abbildung zerebraler<br />
Prozesse!<br />
fMRT basiert auf dem BOLD-Effekt („Blood Oxygenation Level Dependent<br />
Contrast“): In aktivierten Hirnregionen steigt der Anteil sauerstoffhaltigen Bluts<br />
(„Oxyhämaglobin“); oxygeniertes (O2-haltiges) Blut ist dabei magnetischer als<br />
Deoxyhämaglobin und sendet dementsprechend ein stärkeres BOLD-Signal aus.<br />
Positronenemissionstomographie (PET): kann sowohl zur Abbildung von<br />
Hirnstrukturen, als auch zur (räumlichen und zeitlichen) Abbildung zerebraler<br />
Prozesse genutzt werden!<br />
Verschiedene stoffwechselrelevante Moleküle (z.B. Sauerstoff oder Glukose)<br />
werden chemisch mit kurzlebigen Radionukletiden markiert und in den<br />
Blutkreislauf injiziert; die so markierten Moleküle sammeln sich an den Orten<br />
des Stoffwechsels an und die durch ihren Zerfall ausgelöste (γ-) Strahlung wird<br />
aufgezeichnet.<br />
Viele Vorteile (geringe Strahlenbelastung, sehr genau, in-vivo-Untersuchungen<br />
etc.), aber: sau-teuer (wegen der Gewinnung der Radionukletiden)<br />
4.2.2. Psychophysiologische Methoden<br />
Die Psychophysiologie befasst sich mit den physischen Prozessen, die als<br />
Begleiterscheinung psychischer Ereignisse auftreten oder mit den psychischen<br />
Merkmalen einer Person zusammenhängen.<br />
Somatisches Nervensystem: steuert bewusste Vorgänge (z.B. die Kontraktion<br />
von Muskeln) und kann willkürlich gesteuert werden<br />
Autonomes (=vegetatives oder viszerales) Nervensystem: steuert unbewusste<br />
Vorgänge (z.B. die Atmung oder Verdauung) und kann nur bedingt willkürlich<br />
gesteuert werden<br />
Unterteilt sich in Sympathikus (überwiegend exzitatorisch: Erhöhung der<br />
Herzfrequenz etc.) und Parasympathikus (überwiegend dämpfend:<br />
Verlangsamung des Herzschlages etc.)<br />
Elektrokardiogramm (EKG): misst die Aktionspotenziale des Herzmuskels und<br />
damit die Herzfrequenz<br />
Elektroenzephalogramm (EEG): misst die spontane oder evozierte elektrische<br />
Aktivität der Großhirnrinde<br />
Blutdruck:<br />
Systolischer Blutdruck (maximaler Wert während der Austreibungsphase):<br />
normalerweise bei ca. 120 mmHg (Millimeter Quecksilber)<br />
Diastolischer Blutdruck (minimaler Wert während der Füllungsphase):<br />
normalerweise bei ca. 80 mmHg<br />
Skin Conductance Response (SCR); Skin Resistance Response (SRR): gibt<br />
Auskunft über die Hautleitfähigkeit und damit über die Schweißproduktion: je mehr<br />
Schweiß, desto besser die Hautleitfähigkeit bzw. desto geringer der Hautwiderstand<br />
17
4.2.3. Neurochemische Methoden<br />
Neurochemische Verfahren dienen dazu, die Menge der Neurotransmitter bzw. ihrer<br />
Rezeptoren zu messen.<br />
Bei Post-Mortem-Untersuchungen werden verschiedene Hirnregionen<br />
verstorbener Patienten mit Substanzen infundiert, die sich an bestimmte<br />
Rezeptoren binden, und anschließend die Bindungsmenge ermittelt.<br />
Eine andere Möglichkeit besteht darin, Blut, Urin oder Gehirn- und<br />
Rückenmarksflüssigkeit von Patienten auf Metaboliten zu untersuchen, um auf<br />
die Menge des entsprechenden Neurotransmitters zu schließen.<br />
Metaboliten sind Abbauprodukte von Neurotransmittern; der wichtigste<br />
Metabolit von Dopamin ist z.B. Homovanillinsäure (HVA), von Serotonin<br />
ist es 5-Hydroxyindolessigsäure (5-HTAA)<br />
4.2.3. Neuropsychologische Verfahren<br />
Neuropsychologische Tests dienen dazu, anhand von Verhaltensstörungen bzw.<br />
kognitiven Defiziten auf Funktionsstörungen des Gehirns zu schließen.<br />
Haben recht hohe Validität, da die Kompensation neurologischer Störungen in<br />
den Testaufgaben weitaus schwieriger ist als bei Alltagstätigkeiten.<br />
Beispiele für neuropsychologische Tests:<br />
Die Halstead-Reitan-Batterie: umfasst vier Tests<br />
1. Taktiler Leistungstest (Zeit): Einpassung unterschiedlich geformter Klötze<br />
in ein Formenbrett (mit verbundenen Augen natürlich!)<br />
2. Taktiler Leistungstest (Gedächtnis): Das Formenbrett muss anschließend<br />
aus dem Gedächtnis gezeichnet werden => Test 1 und 2 sind Indikatoren für<br />
eine Läsion im rechten Parietallappen<br />
3. Kategorientest: Erschließen von Kategorisierungsregeln anhand nonverbaler<br />
Rückmeldungen (Zuordnung von Bildern zu Zahlen zw. 1 und 4) =><br />
Allgemeiner Indikator für eine Hirnschädigung<br />
4. Lautwahrnehmungstest: Zuordnung sinnloser Silbenreihen zu Worten =><br />
Funktion der linken Hemisphäre<br />
Die Luria-Nebraska-Batterie: besteht aus 11 Teilen und testet u.a. motorische<br />
Fertigkeiten, rhythmische, melodische und räumliche Fertigkeiten,<br />
Sprachverständnis, Ausdrucksvermögen und Gedächtnis.<br />
Der Uhren-Test (wird in der Demenzdiagnostik eingesetzt): Aufgabe ist es, auf<br />
einen Kreis eine bestimmte Uhrzeit samt Zahlen und Zeigern einzuzeichnen<br />
Maximal erreichbare Punktzahl beträgt 7: Ist die 12 oben => 2 Punkte; sind<br />
alle Zahlen eingezeichnet => 1 Punkt; sind Stunden- und Minutenzeiger<br />
vorhanden => 2 Punkte; entspricht ihre Position der vorgegebenen Uhrzeit<br />
=> 2 Punkte<br />
Uni- bzw. kontralateraler Neglect: Aufmerksamkeitsstörung, bei der eine<br />
Körperhälfte inklusive Gesichtsfeld ignoriert wird; tritt meist nach rechtsseitiger<br />
Parietallappenschädigung auf und kann folgendermaßen getestet werden:<br />
Uhrentest => Neglectpatienten tragen alle Zahlen in einer Hälfte ein<br />
Halbierung horizontaler Linien => Neglectpatienten vernachlässigen die Linien<br />
auf der einen Seite ganz und „halbieren“ die beachteten Linien (bei<br />
rechtshemisphärischer Störung) rechts vom Mittelpunkt<br />
18
6. Methoden zur Untersuchung gestörten Verhaltens<br />
6.1. Wissenschaftstheoretisches<br />
6.1.1. Was ist Wissenschaft?<br />
Wissenschaft ist das Streben nach systematisiertem Wissen durch Beobachtung.<br />
Dazu gehört einerseits die systematische Erhebung und Bewertung von<br />
Informationen, andererseits die Entwicklung von Theorien zur Erklärung dieser<br />
Informationen.<br />
Wissenschaftliche Aussagen müssen eine Vielzahl von Gütekriterien erfüllen; die<br />
wichtigsten sind:<br />
Sie müssen überprüfbar sein (=> präzise Formulierung und Falsifizierbarkeit)<br />
Sie müssen zuverlässig sein (=> Replizierbarkeit, Reliabilität und Objektivität)<br />
Sie müssen valide sein (=> d.h. auf die Wirklichkeit übertragbar sein)<br />
6.1.2. Was sind Theorien und theoretische Konstrukte?<br />
Wissenschaftliche Theorien dienen dazu, Zusammenhänge zu erklären. Sie müssen<br />
empirisch überprüft werden („context of justification“); erlauben aber gleichzeitig die<br />
Bildung von Hypothesen und geben so der empirischen Forschung erst ihre Richtung<br />
(„context of discovery“)!<br />
Theorien enthalten Konstrukte (z.B. das Konstrukt „Angst“), die sich zwar nicht<br />
unmittelbar beobachten lassen, dafür aber die beobachteten Zusammenhänge<br />
vereinfachen und damit überhaupt erst verständlich machen! Solche theoretischen<br />
Konstrukte überbrücken häufig Zeit-Raum-Beziehungen und können auf<br />
unterschiedliche Weise operationalisiert werden!<br />
„Angst“ z.B. kann erklären, warum Personen auf ganz unterschiedliche<br />
Situationen (Gewitter, Prüfung etc.) auf ähnliche Weise reagieren; das Konstrukt<br />
überbrückt somit die Lücke zwischen Situation und Reaktion und vereinfacht<br />
dadurch die beobachteten Zusammenhänge. Operationalisiert werden kann<br />
„Angst“ z.B. durch einen Fragebogen oder physiologische Maße (Zittern,<br />
Herzrate, Schweiß etc.).<br />
6.2. Forschungsmethoden der klinischen Psychologie<br />
6.2.1. (Einzel-)Fallstudien<br />
Eine Einzelfallstudie beruht auf der Sammlung von familiengeschichtlichen,<br />
biographischen und anderen krankheitsrelevanten Informationen zu einem einzelnen<br />
Patienten. Auf welche Art von Infos dabei besonders Wert gelegt wird, hängt vom<br />
zugrunde gelegten Paradigma ab.<br />
Eine berühmte Fallstudie ist Freuds Studie über „Anna O.“; sie bildete den<br />
Ausgangspunkt für Freuds Theorie der Hysterie und legte damit den Grundstein<br />
für die Psychoanalyse!<br />
Einzelfallstudien erlauben weder Kausalitätsaussagen, noch dürfen sie verallgemeinert<br />
werden. Trotzdem sind sie in bestimmten Zusammenhängen durchaus sinnvoll!<br />
Sie ermöglichen die detaillierte Darstellung eines seltenen Phänomens bzw.<br />
einer neuen Diagnose- oder Therapiemethode!<br />
Besonders zur dissoziativen Identitätsstörung (s.u.) gibt‟s viele<br />
Einzelfallstudien, da sie sehr selten und recht spektakulär ist!<br />
Entkräftung angeblich universal gültiger Aussagen einer Theorie!<br />
Entwicklung neuer Forschungshypothesen!<br />
19
6.2.2. Epidemiologische Forschung<br />
Die Epidemiologie untersucht a) die Häufigkeit und b) die Verteilung einer Störung<br />
in einer Population; sie versucht dabei v.a., folgende 3 Merkmale zu bestimmen:<br />
1) Die Prävalenz: ist eine Kenngröße für die Häufigkeit einer Krankheit; sie<br />
entspricht dem Anteil erkrankter Personen einer Population zu einem<br />
bestimmten Zeitpunkt bzw. über einen bestimmten Zeitraum.<br />
Berechnung: Anzahl der Kranken / Anzahl aller Untersuchten<br />
Drei Arten von Prävalenz können unterschieden werden:<br />
a) Punktprävalenz: Anteil der Kranken zu einem bestimmten Zeitpunkt<br />
b) Periodenprävalenz: Anteil der Kranken über einen bestimmten<br />
Zeitraum (z.B. im Jahr 2009)<br />
c) Die Lebenszeitprävalenz: Anteil derjenigen Personen, die bis zum<br />
Zeitpunkt der Befragung mindestens ein Mal von der Krankheit<br />
betroffen waren.<br />
2) Die Inzidenz: entspricht der Anzahl der Neuerkrankten in einer definierten<br />
Population während einer bestimmten Zeit (üblicherweise einem Jahr)!<br />
Randbemerkung: Die so ermittelten Prävalenz- und Inzidenzraten sind jedoch<br />
keineswegs eindeutig, sondern hängen u.a. von der gewählten Population<br />
(Männer, Frauen, Jugendliche, Deutsche, Amis etc.), den zugrundegelegten<br />
Diagnosekriterien (DSM-IV, ICD-10 etc.) und den verwendeten<br />
Interviewverfahren zur Ermittlung der Symptome ab.<br />
Die Angaben schwanken daher z.T. enorm!<br />
3) Risikofaktoren: Bedingungen, deren Vorliegen die Wahrscheinlichkeit einer<br />
Erkrankung erhöht!<br />
Z.B. Geschlecht; sozioökonomischer Status; genetische Vorbelastung etc.<br />
Eine Größe, die im Zusammenhang mit Risikofaktoren oft berechnet wird,<br />
ist der „Odds Ratio“:<br />
Ein „Odds“ entspricht der Erkrankungswahrscheinlichkeit innerhalb<br />
einer bestimmten Gruppe (p); geteilt durch die zugehörige<br />
Gegenwahrscheinlichkeit (1-p)<br />
Der „Odds Ratio“ ist der Quotient aus den Odds zweier Gruppen; ist<br />
das Risiko für die beiden untersuchten Gruppen (z.B. Männer und<br />
Frauen) gleich groß, liegt er bei 1!<br />
Zum Nutzen epidemiologischer Untersuchungen:<br />
Bilden die Grundlage für gesundheitspolitische Entscheidungen (Planung<br />
ausreichender Therapiemöglichkeiten, Initiierung präventiver Maßnahmen etc.)<br />
Erlauben die Generierung neuer Hypothesen (von den Risikofaktoren zu<br />
genaueren Erklärungen; z.B.: „Nicht der sozioökonomische Status selbst,<br />
sondern die schlechte Ernährung könnte entscheidend sein!“…)<br />
6.2.2. Korrelationsstudien<br />
Die Korrelationsmethode untersucht, ob zwischen zwei oder mehr Variablen ein<br />
Zusammenhang besteht; anders als in einem Experiment wird dabei jedoch keine<br />
Manipulation vorgenommen; die Variablen werden also so untersucht, wie sie<br />
natürlich auftreten!<br />
Die Korrelationsmethode ist in der klinischen Psychologie weit verbreitet:<br />
Sie bildet beispielsweise die Grundlage für die Ermittlung von Risikofaktoren<br />
(s.o.): Korreliert die klassifikatorische Variable Krankheit (ja/nein) mit anderen<br />
20
Variablen (wie z.B. dem Cortisolspiegel, dem sozioökonomischen Status oder<br />
der Reaktionsbereitschaft auf Stressoren)?!<br />
Wichtig: Die Korrelationsmethode findet keineswegs nur in der<br />
Feldforschung, sondern auch in Laboruntersuchungen Anwendung! Ein<br />
gängiges korrelatives Design ist der Vergleich zwischen einer<br />
Patientenstichprobe und einer gesunden Kontrollgruppe.<br />
Ob ein Zusammenhang statistisch signifikant ist, hängt zum einen von der Höhe der<br />
Korrelation, zum anderen von der Größe der Stichprobe ab. Dabei gilt: Je größer die<br />
Stichprobe, desto geringer kann r sein, um noch signifikant zu werden!<br />
Das Problem der Korrelationsmethode besteht darin, dass Korrelationen keine<br />
Aussagen über Kausalität erlauben.<br />
1) Ist die Wirkrichtung nicht bekannt, sprich: selbst wenn ein kausaler<br />
Zusammenhang bestehen sollte, kann nicht geklärt werden, welche Variable<br />
welche verursacht!<br />
2) Kann nicht ausgeschlossen werden, dass der gefundene Zusammenhang auf den<br />
Einfluss einer dritten Variable (= Kovariable) zurückgeht und dementsprechend<br />
gar nicht kausal ist!<br />
Dass die Anzahl der Kirchen in einer Stadt mit der Anzahl der dort<br />
begangenen Straftaten korreliert, liegt z.B. an der Einwohnerzahl!<br />
Vorteile von Korrelationsstudien:<br />
Korrelationsstudien ermöglichen die Generierung neuer Hypothesen!<br />
Korrelationsstudien können dazu genutzt werden, vorhergesagte<br />
Verursachungen zu wider-legen!<br />
Longitudinal angelegte Korrelationsstudien erlauben durchaus Aussagen über<br />
die Wirkrichtung des Zusammenhangs, schließlich wird die Ursache in ihnen<br />
vor der Wirkung erhoben.<br />
Das gängigste Design sind in diesem Zusammenhang sog. Risikostudien,<br />
bei denen die Pbn nach bestimmten Risikofaktoren ausgewählt - (z.B.<br />
schizophrenes Elternteil) und dann über einen längeren Zeitraum<br />
beobachtet werden.<br />
6.2.3. Das Experiment<br />
Das Experiment erlaubt die Feststellung kausaler Beziehungen zwischen 2 oder mehr<br />
Variablen.<br />
Dazu müssen v.a. folgende Voraussetzungen erfüllt sein:<br />
1) Zufällige Zuteilung (Randomisierung) der Pbn zu den Versuchsgruppen<br />
(Experimentalgruppe und Kontrollgruppe) und Kontrolle von<br />
Störvariablen<br />
2) Manipulation der unabhängigen Variable (UV = angenommene Ursache)<br />
3) Objektive und reliable Messung der abhängigen Variable (AV =<br />
angenommene Wirkung)<br />
Die wichtigsten Schritte bei der Versuchsplanung:<br />
1) Aufstellen einer experimentellen Hypothese<br />
z.B.: „Seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen hat einen positiven Effekt<br />
auf die Gesundheit!“<br />
2) Identifizierung und Operationalisierung der Experimentalvariablen<br />
UV (die Pbn Aufsätze über traumatische Ereignisse oder über<br />
Alltäglichkeiten schreiben lassen)<br />
AV (Anzahl der Besuche des Gesundheitszentrums in den Wochen vor<br />
dem Treatment und den Wochen nach dem Treatment)<br />
3) Beurteilung der Messergebnisse (=> Signifikanztest)<br />
21
Interne- vs. externe Validität:<br />
Interne Validität bedeutet, dass die gefundenen Effekte eindeutig auf die<br />
Manipulation der UV zurückführbar sind. Gewährleistet wird die interne<br />
Validität durch…<br />
Eine Kontrollgruppe, die abgesehen vom Treatment (also der UV) genauso<br />
behandelt wird wie die Experimentalgruppe(n).<br />
In Studien zur Wirksamkeit bestimmter Interventionsmaßnahmen<br />
werden meist Placebo-Kontrollgruppen eingesetzt, da bereits die<br />
Tatsache, dass eine Intervention vorgenommen wird (unabhängig<br />
davon, ob sie eine spezifische Wirkung hat oder nicht!) einen Einfluss<br />
auf den Genesungsprozess hat (was hilft, ist oft schon der<br />
Therapeutenkontakt an sich oder die Hoffnung auf Besserung). Solche<br />
Placebostudien sind freilich ethisch bedenklich und bedürfen einer<br />
vorherigen Einverständniserklärung!<br />
Eine andere Möglichkeit sind Kontrollgruppen, an denen gar keine<br />
Behandlung durchgeführt wird (sog. Wartelisten-Gruppen)<br />
Zufällige Zuordnung zu den besagten Gruppen<br />
Doppel-Blind-Methode (um den Rosenthal-Effekt auszuschließen)<br />
Nur bei Medikamentenstudien einsetzbar, da der Psychotherapeut<br />
schließlich wissen muss, was er tut!<br />
Kontrolle von Störvariablen<br />
Externe Validität bedeutet, dass sich die Ergebnisse einer Untersuchung über<br />
das unmittelbare Experiment hinaus verallgemeinern lassen! Besonders bei<br />
Labor- und Tierexperimenten ist die externe Validität oft fraglich.<br />
Ähnliche Untersuchungen unter neuen Bedingungen mit neuen<br />
Teilnehmern (Replikation)<br />
Feldstudien<br />
In der klinischen Psychologie werden experimentelle Designs v.a. dazu eingesetzt, die<br />
Wirksamkeit von Therapien zu untersuchen! Dabei ist Folgendes zu beachten:<br />
Unterscheidung zwischen Efficacy und Effectiveness:<br />
Efficacy-Studien sind experimentelle Laborstudien (RCT-Studien =<br />
Randomized Controlled Trials); ihr Vorteil besteht darin, dass sie eine hohe<br />
interne Validität aufweisen; ihre externe Validität ist jedoch fraglich!<br />
Effectiveness-Studien sind Feldstudien ohne randomisierte<br />
Gruppenzuteilung und Treatment-Manipulation (=> Post-hoc-Vergleiche).<br />
Ihr Vorteil besteht in der hohen externen Validität, ihre Schwachstelle ist<br />
die interne Validität!<br />
Auftretende Effekte: Verschlechterung, keine Veränderung, spontane<br />
Verbesserung, therapeutische Veränderung!<br />
Unterscheidung zwischen statistischer und klinischer Signifikanz:<br />
Eine statistisch signifikante Veränderung liegt vor, wenn sie mit einer<br />
hohen (meist 95%igen) Wahrscheinlichkeit nicht zufällig aufgetreten ist!<br />
Klinisch signifikant ist eine Veränderung nur dann, wenn sie darüber<br />
hinaus einen klinisch bedeutsamen Unterschied macht. Wenn Depressive<br />
sich nach einer bestimmten Therapie statistisch gesehen besser fühlen, aber<br />
trotzdem noch depressiv sind, ist das z.B. nicht der Fall!<br />
22
6.2.4. Analogie-Experimente<br />
Viele wichtige Fragen, insbesondere was die Ursachen von Störungen betrifft, können<br />
aus ethischen Gründen nicht experimentell untersucht werden!<br />
Beispiele: Wie viel Stress muss induziert werden, damit jemand eine<br />
Schizophrenie entwickelt?! Entwickeln Kinder, mit denen nur wenig<br />
gesprochen wird, eher eine Depression? Etc. etc.<br />
Man versucht sich in diesen Fällen mit sog. Analogieexperimenten zu behelfen;<br />
kennzeichnend für diese Art von Experimenten ist, dass ein verwandtes Phänomen<br />
untersucht wird.<br />
Untersuchung von gesunden Pbn, die einer klinischen Stichprobe ähneln<br />
(weil sie z.B. hohe Werte auf einer Depressionsskala haben)<br />
Tierversuche<br />
Experimentelle Induktion von störungsspezifischen Symptomen: z.B. kann<br />
Angst induziert werden, indem man die Pbn einen Vortrag halten lässt)<br />
Das Problem von Analogieexperimenten ist die externe Validität, also die Frage, ob<br />
die durch sie gewonnenen Ergebnisse tatsächlich generalisierbar sind!<br />
6.2.5. Experimentelle Einzelfalluntersuchung<br />
Bei der experimentellen Einzelfalluntersuchung werden einzelne Pbn verschiedenen<br />
Bedingungen ausgesetzt.<br />
Ein gängiges Vorgehen ist dabei die Umkehrtechnik (ABAB-Versuchsplan):<br />
Dabei folgt 2 Mal hintereinander auf eine Baselineerhebung (A) ein Treatment<br />
(B); ändert sich die AV (z.B. der Depressionsgrad) in Abhängigkeit von der<br />
jeweiligen Untersuchungsphase, spricht das für die Wirksamkeit des<br />
Treatments!<br />
Die experimentelle Einzelfalluntersuchung ist lediglich ein quasi-experimentelles<br />
Design: da es keine Kontrollgruppe gibt und lediglich eine Person untersucht wird<br />
(anstelle einer repräsentativen Stichprobe) ist weder die interne, noch die externe<br />
Validität gesichert. Trotzdem können experimentelle Einzelfalluntersuchungen unter<br />
bestimmten Bedingungen sinnvoll sein:<br />
Vorabuntersuchungen (zur Frage, ob eine größer angelegte Untersuchung sich<br />
überhaupt lohnen könnte)<br />
Kausalzusammenhänge können erschlossen, aber kaum verallgemeinert<br />
werden!<br />
6.2.6. Gemischte Versuchspläne<br />
Gemischte Versuchspläne kombinieren korrelative und experimentelle Methoden; sie<br />
enthalten nämlich sowohl klassifikatorische, als auch experimentelle Variablen;<br />
manipuliert werden können lediglich letztere.<br />
Probanden aus 2 oder mehr diskreten Populationen (z.B. Schizophrene,<br />
Phobiker und Gesunde) werden zu gleichen Teilen den verschiedenen<br />
Versuchsbedingungen (z.B. verschiedenen Therapieformen) zugewiesen.<br />
Nutzen: Gemischte Versuchspläne können zeigen, dass experimentelle Variablen (z.B.<br />
Therapieform) je nach klassifikatorischer Variable (z.B. Krankheitsbild oder<br />
Störungsgrad) unterschiedlich wirken kann!<br />
23
5. Affektive Störungen<br />
5.1. Allgemeine Merkmale affektiver Störungen<br />
5.1.0. Die wichtigsten affektiven Störungen im Überblick<br />
Affektive Störungen sind Störungen der Stimmungslage, die die Betroffenen stark<br />
beeinträchtigen.<br />
Zwei Hauptgruppen affektiver Störungen lassen sich unterscheiden:<br />
1. Depressive Störungen (auch als unipolare Störungen bezeichnet): liegen<br />
vor, wenn nur depressive Symptome auftreten<br />
2. Bipolare affektive Störungen: liegen vor, wenn sowohl depressive als auch<br />
manische, nur manische (sehr selten!) oder gemischte Episoden auftreten<br />
Darüber hinaus lassen sich 2 chronische affektive Störungen unterscheiden:<br />
1. Dysthymie: chronische Depressivität<br />
2. Zyklothymie: Chronischer Wechsel zwischen Phasen mit depressiven und<br />
solchen mit hypomanen Symptomen<br />
Das DSM IV unterscheidet zwischen:<br />
Affektiven Episoden:<br />
1. Episode einer Major Depression (=> minore Depression = subklinisch)<br />
2. Manische Episode<br />
3. Gemischte Episode<br />
4. Hypomane Episode<br />
Depressiven Störungen (monopolare Depression):<br />
1. Major Depression: eine oder mehrere Episoden einer Major Depression<br />
2. Dysthyme Störung: depressive Verstimmung über 2 Jahre, aber keine volle<br />
Major Depression-Episode<br />
Bipolaren Störungen:<br />
1. Bipolare I-Störung: eine oder mehrere manische oder gemischte Episoden,<br />
meist durch depressive Episoden unterbrochen<br />
2. Bipolare II-Störung: eine oder mehrere depressive Episoden, mind. eine<br />
hypomane Episode<br />
3. Zyklothyme Störung: hypomane und depressive Symptome über 2 Jahre,<br />
die nicht die Kriterien eigener Episoden erfüllen<br />
Affektive Störungen nach dem ICD-10:<br />
F 30: Manische Episode<br />
F 31: Bipolare Störung<br />
F 32: Depressive Episode<br />
F 33: Rezidivierende depressive Störung<br />
F 34: Anhaltende affektive Störung<br />
F 38: Sonstige Affektive Störungen<br />
F 39: Andere affektive Störungen NNB<br />
F 43: Anpassungsstörung<br />
F53.0: Postpartum-Depression (in den ersten 4 Wochen nach einer Entbindung)<br />
F 06.3: Organische affektive Störung<br />
Früher unterschied man zw. endogenen- (= „von innen kommenden“); neurotischen-<br />
und reaktiven Depressionen: erstere führte man auf rein biologische Ursachen zurück;<br />
letztere wurden als Reaktion auf aktuell belastende Ereignisse verstanden und die<br />
neurotischen Depressionen (auch als „Erschöpfungsdepression“ bezeichnet) wurden<br />
auf lang anhaltende Belastungen zurückgeführt.<br />
24
5.1.1. Depressive Episoden<br />
Definition: Bei der Depression handelt es sich um einen emotionalen Zustand, der<br />
durch starke Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, Gefühle der Wertlosigkeit und<br />
Schuld, sozialen Rückzug, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, mangelnde Libido sowie<br />
Interessen- und Freudlosigkeit gekennzeichnet ist. Sie tritt in Phasen auf, die<br />
unbehandelt zw. 6 und 8 Monaten andauern, und wird häufig von anderen<br />
psychischen Problemen (Konzentrationsproblemen, sexueller Dysfunktion etc.)<br />
begleitet.<br />
Verhalten/Motorik/Erscheinungsbild:<br />
Körperhaltung: kraftlos, gebeugt<br />
Bewegung: motorische Immobilität (Katatonie) oder ziellose Aktivität<br />
(Agitiertheit), sprich: nervöses Händereiben usw.<br />
Gesichtsausdruck: traurig, besorgt; starre, maskenhafte Mimik usw.<br />
Unfähigkeit, Alltagsprobleme zu bewältigen<br />
Vernachlässigung der Körperhygiene<br />
Affektive Symptome:<br />
Gefühle von Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Hilflosigkeit, Schuld,<br />
Einsamkeit etc.<br />
Gefühl der Gefühllosigkeit und Distanz zur Umwelt<br />
Gefühl des Überfordert-Seins<br />
Interessen- und Freudlosigkeit<br />
Kognitive Symptome:<br />
Negatives Selbstbild, Pessimismus etc.<br />
Verlangsamtes Denken, Konzentrations- und Gedächtnisprobleme,<br />
Entscheidungsprobleme<br />
Z.T. Wahnvorstellungen (Erwartung von Katastrophen usw.)<br />
Motivationale Symptome:<br />
Misserfolgsorientierung; Hilflosigkeit; Antriebslosigkeit<br />
Suizidideen<br />
Physiologisch-vegetative Symptome:<br />
Innere Unruhe und Erregtheit oder Energieverlust<br />
Schlafstörungen<br />
Libidoverlust<br />
Appetit- und Gewichtsverlust<br />
Allg. vegetative Beschwerden (Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen etc.)<br />
Veränderungen der sozialen Interaktion:<br />
Sozialer Rückzug<br />
Zunehmende Abhängigkeit von anderen<br />
Häufigkeit typischer Symptome bei Depression:<br />
Die fünf häufigsten Symptome sind Insomnie (bei 100%), traurige<br />
Verstimmung (bei 100%), Weinerlichkeit (bei 94%),<br />
Konzentrationsschwierigkeiten (bei 91%) und Suizidgedanken (bei 82%!)<br />
Recht selten sind: Selbstmordversuche (bei 15%) und akustische<br />
Halluzinationen (bei 6%)<br />
Morgens ist die depressive Verstimmung i.d.R. schlimmer!<br />
25
Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV: Major Depression, einzelne Episode<br />
Die formale Diagnose einer Major Depression setzt das Vorhandensein einer<br />
depressiven Episode voraus, die mindestens 5 der folgenden Symptome über<br />
mindestens 2 Wochen erfüllt, wobei entweder die depressive Stimmung oder<br />
der Verlust an Interesse und Freude zu den Symptomen gehören muss:<br />
1) Depressive Verstimmung an fast allen Tagen, die meiste Zeit des Tages<br />
!<br />
!<br />
Beachte: kann sich bei Kindern und Jugendlichen auch als reizbare<br />
Verstimmung äußern!<br />
2) Deutlich vermindertes Interesse oder Freude an allen oder fast allen<br />
Aktivitäten<br />
3) Verminderter Appetit und Gewichtsverlust oder gesteigerter Appetit und<br />
Gewichtszunahme<br />
Bei Erwachsenen: mehr als 5% des Körpergewichts in einem Monat!<br />
Bei Kindern: Ausbleiben der zu erwartenden Gewichtszunahme!<br />
4) Schlafstörungen: Schlaflosigkeit (Insomnie) oder (seltener) vermehrter<br />
Schlaf an fast allen Tagen<br />
5) Auffällige (= von anderen beobachtbare) Veränderung des<br />
Aktivitätsniveaus, genauer: psychomotorische Unruhe oder<br />
Verlangsamung<br />
6) Müdigkeit oder Energieverlust an fast allen Tagen<br />
7) Gefühl der Wertlosigkeit und/oder unangemessene (z.T. wahnhafte)<br />
Schuldgefühle an fast allen Tagen<br />
8) Verminderte Denk-, Konzentrations- und Entscheidungsfähigkeit<br />
(entweder nach subjektivem Ermessen oder von anderen beobachtet)<br />
9) Wiederkehrende Gedanken an den Tod oder einen Suizid<br />
Alle genannten Symptome müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:<br />
a) Sie dürfen nicht die Kriterien einer gemischten Episode erfüllen<br />
b) Sie müssen Leiden verursachen und das berufliche oder soziale Leben des<br />
Betroffenen beeinträchtigen<br />
c) Die Symptome dürfen weder auf einen medizinischen Krankheitsfaktor<br />
(z.B. Hypothyreose), noch auf die direkte Wirkung von Substanzen (z.B.<br />
Medikamente oder Drogen) zurückgeführt werden können.<br />
d) Die Symptome dürfen nicht durch einfache Trauer besser erklärt werden<br />
können (dazu müssen sie z.B. nach einem Todesfall über 2 Monate<br />
andauern)<br />
Diagnostische Kriterien nach der ICD-10: Depressive Episode (F 32.X)<br />
Die Dauer einer depressiven Episode muss (genau wie nach dem DSM-IV)<br />
mindestens 2 Wochen betragen.<br />
In dieser Zeit müssen mindestens 2 der folgenden 3 Symptome vorliegen:<br />
1. Depressive Stimmung<br />
2. Interessen- und Freudlosigkeit<br />
3. Verminderter Antrieb oder erhöhte Ermüdbarkeit<br />
Darüber hinaus müssen mehrere weitere Symptome vorliegen:<br />
Die im ICD-10 genannten Symptome entsprechen dabei weitgehend denen<br />
des DSM-IV, mit dem einzigen Unterschied, dass statt neun insgesamt zehn<br />
Symptome genannt werden: Verlust des Selbstwertgefühls und<br />
Schuldgefühle werden nämlich getrennt aufgeführt!<br />
Die ICD-10 unterscheidet im Unterschied zum DSM-IV zwischen…<br />
a) einer leichten depressiven Episode (F 32.0): bei insgesamt 4 Symptomen<br />
b) einer mittelgradigen depressiven Episode (F 32.1): bei 5 Symptomen<br />
c) einer schweren depressiven Episode (F 32.2): bei 7 Symptomen<br />
26
4.1.2. Manische Episoden<br />
Definition: Die Manie ist ein emotionaler Zustand, der durch eine intensive, aber<br />
unbegründete Euphorie, Hyperaktivität, Geschwätzigkeit, Ideenflucht, Ablenkbarkeit,<br />
unrealistische Pläne und ziellose Aktivitäten gekennzeichnet ist. Sie entwickelt sich<br />
meist plötzlich, innerhalb von ein bis zwei Tagen, und kann einige Tage bis mehrere<br />
Monate andauern.<br />
Häufigkeit typischer Symptome bei Manie:<br />
Am häufigsten sind u.a.: Irritierbarkeit (bei 100%), ein übersteigerter<br />
Rededrang (bei 99%), Euphorie (bei 98%), Labilität (bei 95%),<br />
Ideenflucht (bei 93%), Insomnie (bei 90%) und Größenideen (bei 86%)<br />
Etwas seltener, aber immer noch recht häufig, treten u.a. Depressionen (bei<br />
68%), Wahnideen (bei 48%) und eine gesteigerte Libido (bei 32%) auf.<br />
Promiskuität (11%) und Selbstmordgedanken (7%) sind eher selten.<br />
Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV: Manische Episode<br />
Eine mindestens einwöchige (bei Hospitalisierung auch kürzere) abgegrenzte<br />
Periode mit abnorm und anhaltend gehobener, expansiver oder reizbarer<br />
Stimmung.<br />
Während der Periode der Stimmungsveränderung bestehen mindestens 3 (bei<br />
nur reizbarer Stimmung min. 4) der folgenden Symptome in einem deutlichen<br />
Ausmaß:<br />
1. Übersteigertes Selbstwertgefühl oder Größenideen<br />
2. Vermindertes Schlafbedürfnis (nach 3 Stunden ausgeruht)<br />
3. Vermehrte Gesprächigkeit oder Rededrang<br />
4. Ideenflucht oder subjektives Empfinden des Gedankenrasens<br />
5. Erhöhte Ablenkbarkeit<br />
6. Psychomotorische Unruhe oder gesteigerte Betriebsamkeit (im sozialen,<br />
beruflichen oder sexuellen Bereich)<br />
7. Übermäßige Beschäftigung mit angenehmen Aktivitäten, die mit hoher<br />
Wahrscheinlichkeit unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen (z.B.<br />
ungezügeltes Einkaufen, sexuelle Eskapaden, törichte Investitionen etc.)<br />
Alle genannten Symptome müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:<br />
a) Sie dürfen nicht die Kriterien einer gemischten Episode erfüllen<br />
b) Sie müssen das berufliche oder soziale Leben des Betroffenen<br />
beeinträchtigen, eine Hospitalisierung erforderlich machen (Selbst- oder<br />
Fremdgefährdung) oder mit psychotischen Symptomen einhergehen.<br />
c) Die Symptome dürfen weder auf einen medizinischen Krankheitsfaktor<br />
(z.B. Hypothyreose), noch auf die direkte Wirkung von Substanzen (z.B.<br />
Drogen, Medikamente) zurückgeführt werden können.<br />
Vorsicht: Manieähnliche Symptome können auch durch somatische<br />
Behandlungen bei Depression (Antidepressiva, Lichttherapie etc.)<br />
hervorgerufen werden!<br />
Diagnostische Kriterien nach der ICD-10: Manische Episode (F 30)<br />
Definition ist dieselbe wie im DSM-IV; ebenso die Anzahl der erforderlichen<br />
Symptome (3 oder 4)<br />
Der einzige Unterschied: Statt 7 Symptomen werden im ICD-10 9 Symptome<br />
genannt:<br />
Verlust normaler sozialer Hemmungen<br />
Gesteigerte sexuelle Energie und sexuelle Taktlosigkeiten<br />
27
4.1.3. Hypomane Episoden<br />
Definition: Bei einer Hypomanie (griech. „hypo“ = „unter“) handelt es sich um eine<br />
Veränderung von Verhalten und Stimmung, die weniger ausgeprägt ist als bei einer<br />
richtigen Manie.<br />
Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV: Hypomane Episode<br />
Über 4 Tage anhaltend gehobene, expansive oder reizbare Stimmung, auffällig<br />
gegenüber normaler Stimmungslage<br />
Vgl. manische Episode: Eine mindestens einwöchige (bei Hospitalisierung<br />
auch kürzere) abgegrenzte Periode mit abnorm und anhaltend gehobener,<br />
expansiver oder reizbarer Stimmung.<br />
Mindestens 3 Symptome einer manischen Episode (s.o.: z.B. Größenideen,<br />
verringertes Schlafbedürfnis etc.) müssen erfüllt sein (genau wie bei der<br />
Manie) – im Unterschied zur Manie sind die Symptome jedoch nicht so stark,<br />
dass es zu Funktionsstörungen kommt, eine Hospitalisierung erforderlich wäre<br />
oder psychotische Symptome auftreten. Die Symptome müssen lediglich für<br />
andere erkennbar sein und dürfen nicht auf die Wirkung einer Substanz oder<br />
eines Krankheitsfaktors zurückgeführt werden können.<br />
Kurz: Der Hauptunterschied zw. Manie und Hypermanie besteht darin, dass<br />
letztere zu einer weniger deutlichen Beeinträchtigung des alltäglichen Lebens<br />
führt!<br />
4.1.4. Gemische Episoden<br />
Definition: Unter gemischten Episoden versteht man Phasen, in denen sowohl<br />
Symptome der Manie, als auch solche der Depression auftreten – und zwar in kurzem<br />
zeitlichen Abstand.<br />
4.1.5. Depressive Störungen<br />
Major Depression, einzelne Episode:<br />
Vorhandensein einer einzelnen Episode eine Major Depression, wobei diese<br />
Episode keine andere Störung (z.B. eine Schizophrenie oder Psychose)<br />
überlagern darf.<br />
In der im Rahmen der Anamnese erhobenen Vorgeschichte des Patienten darf<br />
keine manische, hypomane oder gemischte Epsiode aufgetreten sein (es sei<br />
denn diese waren substanz-, behandlungs- oder krankheitsbedingt)<br />
Major Depression, rezidivierend (ICD-10: rezidivierende depressive Störung)<br />
Vorhandensein von mindestens zwei Episoden einer Major Depression, wobei<br />
diese Episoden keine andere Störung (z.B. eine Schizophrenie oder Psychose)<br />
überlagern dürfen.<br />
Als eigenständig betrachtet werden depressive Episoden, wenn sie durch<br />
ein mindestens 2-monatiges Intervall ohne gravierende Symptome<br />
voneinander getrennt sind.<br />
Ausschluss von manischen-, hypomanen- oder gemischte Episoden (s.o.).<br />
Dysthyme Störung:<br />
Depressive Verstimmung, die die meiste Zeit des Tages an mehr als der Hälfte<br />
aller Tage über einen mindestens 2-jährigen Zeitraum andauert.<br />
Beachte: Bei Kindern und Jugendlichen kann reizbare Verstimmung<br />
vorliegen und die Daher muss mindestens 1 Jahr betragen!<br />
Während der depressiven Verstimmung müssen mindestens 2 der folgenden<br />
Symptome vorliegen: Gewichtszunahme oder –abnahme, Schlafstörungen,<br />
Energiemangel, geringes Selbstwertgefühl, Konzentrations- und<br />
Entscheidungsschwierigkeiten, Hoffnungslosigkeit etc.<br />
28
Innerhalb der ersten 2 Jahre darf weder eine Unterbrechung von 2 oder mehr<br />
Monaten-, noch eine Major Depression-Episode aufgetreten sein.<br />
Beachte: Vor der Entwicklung einer Dysthymen Störung kann eine MD-<br />
Episode aufgetreten sein, vorausgesetzt es fand eine vollständige<br />
Remission statt; nach den ersten 2 Jahren kann eine Dysthyme Störung<br />
durch MD-Episoden überlagert werden; in diesem Fall können beide<br />
Diagnosen gestellt werden.<br />
Zu keinem Zeitpunkt ist eine manische, hypomane oder gemischte Episode<br />
aufgetreten<br />
Die Störung tritt nicht ausschließlich im Verlauf einer chronischen<br />
psychotischen Störung auf!<br />
Sonderformen: Winterdepression (saisonal bedingt); post-partum Depression (nach<br />
der Schwangerschaft); psychotische Depression (Wahnideen und Hallos);<br />
Depressionen mit „somatischen“(ICD-10) bzw. „melancholischen“(DSM-IV)<br />
Merkmalen (bes. hohe Komorbidtät; Appetitlosigkeit; Symptome morgens am<br />
schlimmsten,…)<br />
4.1.6. Bipolare Störungen<br />
Bipolar I-Störung: Eine oder mehrere manische oder gemischte Episoden, meist mit<br />
MD-Episoden<br />
Facts:<br />
In 90% der Fälle rezidiv<br />
Unbehandelt kommt es in 10 Jahren durchschnittlich zu 4 affektiven<br />
Episoden<br />
Nur manische Episoden – ohne MD-Episoden sind äußerst selten<br />
60-70% der manischen Episoden treten unmittelbar vor oder nach einer<br />
MD-Episode auf<br />
Diagnostische Kriterien:<br />
Mindestens eine manische oder gemischte Episode in der Vorgeschichte<br />
Ausschluss einer schizoaffektiven Störung oder Schizophrenie<br />
Bipolar II-Störung: Rezidivierende Episoden einer Major Depression mit hypomanen<br />
Episoden<br />
Diagnostische Kriterien: Eine oder mehrere Episoden einer MD; mindestens<br />
eine hypomane Episode; keine manische oder gemischte Episode; nicht besser<br />
erklärbar durch schizoaffektive Störung oder Schizophrenie<br />
Innerhalb von 5 Jahren geht die Störung in 5-15% aller Fälle in eine Bipolar I-<br />
Störung über!<br />
Zyklothyme Störung: Über 2 Jahre hypomane und depressive Symptome, die jeweils<br />
nicht die Kriterien einer handfesten Episode erfüllen.<br />
Diagnostische Kriterien: Über min. 2 Jahre zahlreiche Perioden mit<br />
hypomanen und depressiven Symptomen; aber keine Unterbrechung von 2<br />
oder mehr Monaten und keine manische, gemischte oder Major-Depression-<br />
Episode, keine schizoaffektive Störung oder Schizophrenie etc.<br />
In 15-50% der Fälle geht eine zyklothyme Störung in eine bipolare über!<br />
29
4.1.7. Differentialdiagnose<br />
Differentialdiagnostisch müssen v.a. ausgeschlossen bzw. berücksichtigt werden:<br />
Organische Ursachen (Schilddrüsenunterfunktion, Eisenmangel etc.)<br />
Substanzinduzierte Störungen<br />
Andere affektive Störungen (Dysthymia, bipolare Störung,<br />
Anpassungsstörung…)<br />
Wichtig, weil die versch. Arten von Depressionen unterschiedlich<br />
behandelt werden müssen!<br />
Bei Wahnvorstellungen eine schizophrene oder schizoaffektive Störung<br />
4.2. Epidemiologie und Verlauf<br />
4.2.1. Major Depression<br />
Die Major Depression ist die am weitesten verbreitete affektive Störung; Frauen<br />
sind dabei rund doppelt so häufig von ihr betroffen wie Männer (2:1).<br />
Die Lebenszeitprävalenz liegt zw. 13 und 21%; sie ist in den letzten 50 Jahren<br />
kontinuierlich angestiegen!<br />
Bei Frauen: 10-25% [20-26%]<br />
Bei Männern: 5-12%<br />
Die Punktprävalenz:<br />
Bei Frauen: 5-9%<br />
Bei Männern: 2-3%<br />
Die Inzidenz liegt bei 2% (pro Jahr 2 Neuerkrankungen auf 100 Personen)<br />
Nach der „Burden of Disease“ - Studie der WHO (2001) ist die unipolare<br />
Depression in den Industrieländern die häufigste Ursache für mit<br />
Beeinträchtigung gelebte Lebensjahre; weitaus häufiger als z.B. Demenzen,<br />
Diabetes oder altersbedingte Sehschwächen.<br />
Es kann davon ausgegangen werden, dass in Deutschland ca. 4 Mio.<br />
Menschen an Depressionen leiden, davon sind zwar rund 60-70% in<br />
hausärztlicher Behandlung, nur bei wenigen wird die Depression jedoch<br />
erkannt und adäquat behandelt.<br />
Durch eine bessere Kooperation mit den Hausärzten und entsprechende<br />
Fortbildungen könnte die Versorgung demnach erheblich verbessert<br />
werden (großer Optimierungsspielraum)!<br />
Populationsspezifische Unterschiede in der Prävalenz:<br />
Geschlechtsunterschiede: Das Verhältnis Frauen-Männer ist ca. 2:1 (s.o.); ein<br />
weiterer Unterschied besteht darin, dass das Erkrankungsrisiko bei Frauen nach<br />
45 (Wechseljahre etc.) noch einmal massiv zunimmt, während es bei Männern<br />
ab 40 kontinuierlich abnimmt!<br />
Kohortenunterschiede: Vor 40 Jahren lag das Durchschnittsalter bei<br />
Erkrankungsbeginn zwischen 29 und 30 Jahren; heute liegt es bei Mitte 20!<br />
Während die Suizidrate bei älteren Menschen (über 65) seit 1930 im<br />
Sinken begriffen ist, ist die Jugendlicher (15-24) seit den 60ern im Steigen<br />
begriffen (trotzdem ist erstere allerdings nach wie vor höher: s.u.)<br />
Die Prävalenz steigt nach der Pubertät von ca. 3% auf 6,4% an!<br />
Bei Künstlern und Schriftstellern ist die Prävalenz affektiver Störungen um<br />
ein Vielfaches höher als in der Normalpopulation!<br />
Nach den DSM-IV besteht keine Korrelation zwischen Major Depression und<br />
ethnischen Gruppen, Bildungsgrad, Einkommen oder Familienstand.<br />
Bei Verwandten ersten Grades ist die Prävalenz massiv erhöht (s.o.)<br />
30
Verlauf:<br />
Den ersten Episoden einer Major Depression gehen häufig psychosoziale<br />
Belastungsfaktoren voraus (z.B. der Tod eines Angehörigen).<br />
Depressionen haben eine sehr hohe Komorbiditätsrate: In 77% aller Fälle liegt<br />
mindestens eine weitere Diagnose vor; am häufigsten sind: Angststörungen,<br />
substanzinduzierte Abhängigkeiten und somatoforme Störungen<br />
2/3 der Patienten (50-65%) remittieren vollständig, 1/3 nur z.T. oder gar<br />
nicht<br />
Bei 10-20% chronischer Verlauf (> 2 Jahre)!<br />
Die erste Remissionsphase dauert ca. 2 Jahre, wird aber im Krankheitsverlauf<br />
kürzer.<br />
50%-60% der Patienten haben nach einer ersten eine zweite MD-Episode, nach<br />
2 Episoden sind es bereits 70%, nach 3 Episoden 90%!<br />
Je mehr Episoden erlebt werden, desto höher ist also die<br />
Wahrscheinlichkeit weiterer Episoden!<br />
Hohe Mortalitätsrate: 15% der Erkrankten begehen Suizid!<br />
4.2.2. Die übrigen affektiven Störungen<br />
Dysthymie:<br />
Lebenszeitprävalenz: 2-4%<br />
Verhältnis Frauen-Männer: zw. 3:2 und 2:1<br />
Übliches Alter bei Beginn: 10-25 Jahre<br />
Bipolare Störung:<br />
Lebenszeitprävalenz: 0,6- 3,3%<br />
Bei Störungstyp I im Allgemeinen etwas höher als bei Typ II<br />
Verhältnis Frauen-Männer: 1:1<br />
Übliches Alter bei Beginn: 15-44 Jahre<br />
Verlauf: In 90% der Fälle rezidiv<br />
Zyklothymie:<br />
Niedrigste Prävalenz; Geschlechterverhältnis: 1:1; übliches Alter bei Beginn:<br />
15-25 Jahre<br />
4.3. Biologische Ätiologiefaktoren<br />
4.3.1. Genetische Faktoren<br />
Diverse Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien zeigen, dass genetische Faktoren<br />
bei der Entstehung affektiver Störungen eine nicht unerhebliche Rolle spielen.<br />
Familienstudien:<br />
Lebenszeitprävalenz ohne genetische Vorbelastung:<br />
Bipolare Störung: 0,8%<br />
Unipolare Depression: 5,4%<br />
Lebenszeitprävalenz bei Personen, die einen Verwandten ersten Grades mit<br />
bipolarer Störung haben:<br />
Bipolare Störung: 6% (rund 6 Mal höher!)<br />
Unipolare Depression: 12%<br />
* Bemerkenswert: Auch Verwandte von Patienten mit bipolarer Störung<br />
haben häufiger unipolare Depressionen als bipolare Störungen!<br />
Lebenszeitprävalenz bei Personen, die einen Verwandten ersten Grades mit<br />
unipolarer Depression haben:<br />
Bipolare Störung: 2,6%<br />
Unipolare Depression: 15% (knapp 3 Mal so hoch!)<br />
31
Zwillingsstudien:<br />
Die Konkordanzrate der bipolaren Störung ist bei eineiigen Zwillingen<br />
deutlich höher (72-79%) als bei zweieiigen (14-19%), was ein klarer Hinweis<br />
auf eine genetische Komponente ist!<br />
Dasselbe gilt, wenn auch in weitaus schwächerem Maße, für die unipolare<br />
Depression: Auch hier sind die Konkordanzraten eineiiger Zwillinge (25-50%)<br />
höher als die zweieiiger Zwillinge (11-40%)<br />
Untersuchungen nach dem Diathese-Stress-Modell:<br />
Kendler et al. (1995): Die genetische Disposition für eine Major Depression<br />
kommt nur dann zum Tragen, wenn „Stressful Life Events“ hinzukommen.<br />
Nur dann ist das Risiko vorbelasteter Zwillinge nämlich deutlich erhöht!<br />
Caspi et al. (2003): Ein Transportergen für Serotonin, das in zwei<br />
Ausprägungen (=Allelen) auftritt, nämlich einer kurzen und einer langen Form,<br />
hat sich als genetischer Vulnerabilitätsfaktor für Depression erwiesen.<br />
Homozygote Träger des kurzen Allels (s/s) reagieren nämlich empfindsamer<br />
auf psychosoziale Stressbelastungen und haben damit nach schweren „Lifeevents“<br />
(z.B. einer Misshandlung zw. 3 und 11 Jahren) ein bis zu doppelt so<br />
großes Risiko, an einer Depression zu erkranken, wie die homozygoten Träger<br />
des langen Allels (l/l).<br />
Wahrscheinlichkeit, nach einer Misshandlung zw. 3 und 11 Jahren an einer<br />
Depression zu erkranken: s/s (65%); s/l (45%); l/l (30%)<br />
4.3.2. Biochemische Faktoren<br />
Die Noradrenalin- und die Serotonintheorie (auch „Monoaminmangel-Hypothese“<br />
genannt) wurden in den 50er Jahren aufgrund der Wirksamkeit von bestimmten<br />
Medikamenten (s.u.) entwickelt.<br />
Die Serotonintheorie besagt, dass ein niedriger Serotoninspiegel Depression<br />
verursacht.<br />
Die Noradrenalintheorie besagt, dass ein zu niedriger Noradrenalinspiegel<br />
zu Depression, ein zu hoher zu Manie führt.<br />
Befunde, die für die Monoaminmangel-Hypothese sprechen:<br />
Die depressionslindernde Wirkung folgender Medikamente und Drogen<br />
spricht für die Bedeutsamkeit von Serotonin und Noradrenalin:<br />
Trizyklika (z.B. Imipramin, Handelsname: Tofranil) hemmen die<br />
Wiederaufnahme von Noradrenalin und Serotonin (Re-Uptake-Hemmer),<br />
so dass mehr Neurotransmitter im synaptischen Spalt zurückbleiben und<br />
die Transmission des jeweils folgenden Nervenimpulses erleichtert wird.<br />
Monoaminoxidase-Hemmer (z.B. Iproniazid): hemmen das Enzym<br />
Monoamionoxidase (MAO) und verhindern so den Abbau des<br />
wiederaufgenommenen Serotonins und Noradrenalins.<br />
Spezifische Serotonin-Reuptake-Hemmer, kurz: SSRIs (z.B. Fluoxetin,<br />
Handelsname: Fluctin) wirken selektiver und verhindern speziell die<br />
Wiederaufnahme von Serotonin.<br />
Amphetamine und Kokain: Erstere erhöhen die Ausschüttung von<br />
Noradrenalin und Dopamin, letzteres hemmt deren Wiederaufnahme.<br />
Die depressionsfördernde Wirkung folgender Substanzen weist unter<br />
umgekehrten Vorzeichen in dieselbe Richtung:<br />
AMPT (α-Methyl-p-Tyrosin) hemmt die Umwandlung von Tyrosin zu<br />
Dopa und blockiert damit die Synthese von Noradrenalin. Bei rund 70%<br />
remittierter Patienten führt die Gabe von AMPT zu einem Rückfall in die<br />
32
Depression; verabreicht man ein Placebo, sind es dagegen nicht einmal<br />
10%, die einen Rückfall erleiden!<br />
Durch die Gabe von Reserpin, das die Speicherung von Serotonin und<br />
Noradrenalin in Vesikeln hemmt, kann eine Depression induziert werden.<br />
Messungen der Transmitter- bzw. Metabolitenkonzentration im Urin, im<br />
Blut oder der zerebrospinalen Flüssigkeit (Problem der Validität: Da<br />
Neurotransmitter im ganzen Organismus eingesetzt werden, Serotonin z.B. v.a.<br />
im Darm, geben solche Messungen nicht unmittelbar die<br />
Transmitterkonzentration im Gehirn wieder).<br />
Der Noradrenalinspiegel im Urin nimmt bei bipolaren Patienten während<br />
depressiver Phasen ab und während manischer Phasen zu. Dasselbe gilt für<br />
die Konzentration der Metaboliten, von denen der wichtigste 3-Methoxy-4-<br />
Hydroxyphenyl-Glykol (MHPG) ist!<br />
* Problem: Die erhöhte Konzentration von Noradrenalin (Metaboliten)<br />
während manischer Phasen könnte auch auf die erhöhte motorische<br />
Aktivität während solcher Phasen zurückzuführen sein! Der<br />
Zusammenhang zw. Noradrenalinspiegel und Depression bzw. Manie<br />
darf also nicht vorschnell kausal interpretiert werden!<br />
Um den Serotoninspiegel zu bestimmen, misst man einen seiner<br />
Hauptmetaboliten, die 5-Hdroxyindolessigsäure (5-HIAA); diese sind in<br />
der Zerebrospinalflüssigkeit von Depressiven deutlich reduziert.<br />
„Tryptophandepletionstest“: L-Tryptophan ist ein Serotoninvorläufer und<br />
wirkt depressionslindernd. L-Tryptophan-arme Ernährung führt bei<br />
Depressiven zu einer Verschlimmerung der Symptome und bei symptomfreien,<br />
aber genetisch vorbelasteten Personen (depressive Verwandte) zu einer<br />
Stimmungsverschlechterung. Bei unbelasteten Personen hat die Diät keinen<br />
Effekt.<br />
Neuere Einwände gegen die Serotonin- und Noradrenalintheorie:<br />
1. MAO-Hemmer und Trizyklika erhöhen den NA- und Serotonin-Spiegel nur<br />
während der ersten Tage; ihre depressionslindernde Wirkung setzt jedoch erst<br />
nach 7-14 Tagen ein, also zu einem Zeitpunkt, zu dem der Transmitter-Spiegel<br />
sich schon wieder auf sein ursprüngliches Niveau eingependelt hat!<br />
2. Neuere Antidepressiva (wie z.B. Lithium) wirken auch ohne direkte<br />
Einwirkung auf NA und Serotonin (s.u.).<br />
Ergo: Ein einfacher Anstieg des Noradrenalin- oder Serotoninspiegels ist keine<br />
hinreichende Erklärung dafür, warum die Medikamente Depression lindern!<br />
Aktuelle Forschung: Aufgrund der genannten Einwände konzentriert sich die neuere<br />
Forschung v.a. auf postsynaptische Prozesse. Vermutet wird, dass die Antidepressiva<br />
postsynaptisch wirken, indem sie a) die Sensibilität der Rezeptoren verändern, b) ihre<br />
Anzahl vergrößern oder c) die postsynaptische Transmission modulieren.<br />
Zu c: Die Wirkung von Lithium, das sowohl in manischen als auch in<br />
depressiven Episoden hilft, wird z.B. darauf zurückgeführt, dass es auf G-<br />
Proteine einwirkt. Letztere bestehen aus einer α-, β-, und γ-Untereinheit. Nach<br />
dem Andocken eines Transmitters an einen metabotropen Rezeptor (kein<br />
Ionenkanal => indirektes Gating), bindet dieser Rezeptor an der Innenseite der<br />
postsynaptischen Membran ein solches G-Protein; die α-Einheit des G-Proteins<br />
wird abgespalten und öffnet entweder direkt einen in der Nähe befindlichen<br />
Ionenkanal oder indirekt über ein Effektorprotein und die Aktivierung eines<br />
second messenger.<br />
Bei Patienten mit Manie wurden große Mengen an G-Proteinen-, bei<br />
Patienten mit Depression geringe Mengen davon festgestellt.<br />
33
4.3.3. Neuroendokrine (=hormonelle) Faktoren<br />
Einschub: Basics zum hormonellen System<br />
Die endokrine Übertragung ist der klassische Weg der hormonellen Übertragung:<br />
Endokrine Zellen (die sich meist in Hormondrüsen befinden), schütten Hormone aus,<br />
die ihrerseits über die Blutbahn zu den z.T. weit entfernten Empfängerzellen<br />
gelangen, wo sie verschiedene biologische Prozesse auslösen (Proteinproduktion...)<br />
Andere hormonelle Übertragungswege sind die autokrine und die parakrine<br />
Übertragung: Bei ersterer sind Sender- und Empfängerzelle identisch, bei<br />
letzterer liegen sie nebeneinander.<br />
Der Hypothalamus (im Zwischenhirn gelegen) und die Hypophyse (daran<br />
angeschlossen) bilden das Zentrum des endokrinen Systems.<br />
Der Hypothalamus bildet die Schnittstelle zwischen neuronalem und<br />
endokrinem System und ist das Steuerungsorgan der Hormonproduktion.<br />
Durch die Ausschüttung von Inhibiting- oder Releasing-Hormonen<br />
reguliert der Hypothalamus die Hormonproduktion der Adenohypophyse<br />
(Hypophysenvorderlappen); durch die Versorgung mit Oxytocin und<br />
Vasopressin die Hormonausschüttung der Neurohypophyse (Hypophysenhinterlappen).<br />
Reguliert wird die Aktivität des Hypothalamus dabei v.a. vom limbischen<br />
System, aber auch v. höheren Gehirnzentren, Zeitgebern, dem Feedback…<br />
Die Hypophyse ist das Ausführungsorgan des Hypothalamus:<br />
Die Adenohypophyse segregiert in Abhängigkeit von den „Befehlen“ des<br />
Hypothalamus glandotrope Hormone, die die Produktion in anderen Drüsen<br />
(s.u.) anregen, und effektorische Hormone, die direkt am Zielorgan wirken<br />
(z.B. das Wachstumshormon)<br />
Die Neurohypophyse schüttet das vom Hypothalamus erhaltene<br />
Vasopressin und Oxytocin aus.<br />
Die wichtigsten Hormondrüsen und<br />
34
Einschub: Basics zum hormonellen System<br />
Die wichtigsten Hormondrüsen (neben der Hypophyse) sind: die Schilddrüse<br />
(unterhalb des Kehlkopfs), die Bauchspeicheldrüse, das Nebennierenmark, die<br />
Nebennierenrinde und die Keimdrüsen (Eierstöcke bzw. Hoden); sie produzieren<br />
jeweils unterschiedliche Hormone und werden zum größten Teil durch die<br />
glandotropen Hormone der Adenohypophyse gesteuert.<br />
Die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin und Glucagon und reguliert auf diese<br />
Weise den Blutzuckerspiegel.<br />
Das Nebennierenmark schüttet z.B. in Stresssituationen kurzfristig Adrenalin und<br />
Noradrenalin in die Blutbahn aus, was zu einer Funktionssteigerung verschiedener<br />
innerer Organe führt (=> Erhöhung der Herzfrequenz, Erweiterung der Bronchien<br />
etc.); reguliert wird die Hormonausschüttung des Nebennierenmarks durch den<br />
sympathischen Teil des autonomen Nervensystems.<br />
Die Nebennierenrinde (!) schüttet Glukokortikoide (v.a. Kortisol) aus, die<br />
einerseits für zirkadiane Regulationsmechanismen (wie z.B. die morgendliche<br />
Aktivierung nach dem Aufwachen), andererseits in psychischen und physischen<br />
Stresssituationen für die Energiebereitstellung (Glukose = Zucker)<br />
verantwortlich sind. Reguliert wird die Nebennierenrinde durch die<br />
Adenohypophyse (s.u.).<br />
Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (kurz: „HPA-Achse“):<br />
ist ein Regelkreis, der v.a. langfristigen Stressreaktionen zugrundeliegt.<br />
CRH (Cortikotropin-<br />
Releasing-Hormon) CRH<br />
Stressor<br />
limbisches System<br />
Hypothalamus<br />
Adenohypohyse Cortisol: hemmt die CRH-Ausschüttung<br />
Nebennierenrinde<br />
Glukokortikoide fördern den Abbau von Glykogen (Stärke) aus der Leber und die<br />
Bildung von Glukose (Zucker) aus Fett und Proteinen; sie dienen damit der<br />
Bereitstellung von Energie. Ist der Kortisolspiegel jedoch über längere Zeit erhöht, hat<br />
das diverse Nebenwirkungen:<br />
Immunsuppression (Schwächung des Immunsystems); Schädigung der<br />
Serotonin- und noradrenergen Rezeptoren (=> depressive Verstimmungen;<br />
Beeinträchtigung des Gedächtnisses); Schlafstörungen etc.<br />
Es muss zwischen einer kurzfristigen und einer langfristigen (auf chronischen Stress<br />
folgenden) Stressreaktion unterschieden werden:<br />
Kurzfristige Stressreaktion: Stressor Gehirn Sympathisches Nervensystem<br />
Nebennierenmark Noradrenalin und Adrenalin<br />
Längerfristige Stressreaktion: Stressor Gehirn Hypophysenvorderlappen<br />
Nebennierenrinde Glukokortikoide (insbes. Kortisol)<br />
<br />
ACTH<br />
(Adrenocortikotropin)<br />
(=negative Rückkopplung)<br />
35
Verschiedene Befunde legen nahe, dass die HPA-Achse bei Depression überaktiv ist:<br />
1) Die vegetativen Symptome einer Depression (Appetit- und Schlafstörungen)<br />
könnten durch eine solche Überaktivität bedingt sein.<br />
2) Tatsächlich zeigt sich, dass depressive Patienten einen erhöhten<br />
<br />
Kortisolspiegel aufweisen.<br />
Die Veränderung des Kortisolspiegels über den Tag hinweg ist zwar bei<br />
Depressiven und Gesunden im Großen und Ganzen recht ähnlich<br />
(Höhepunkt zw. 6:00 und 10:00; mehr oder minder stetiger Abfall bis<br />
02:00), unterliegt bei Depressiven aber größeren Schwankungen.<br />
3) Das sog. Cushing-Syndrom, das durch ein abnormes Wachstum der<br />
Nebennierenrinde und einen erhöhten Kortisolspiegel gekennzeichnet ist, geht<br />
häufig mit Depression einher.<br />
4) Der erhöhte Kortisolspiegel bei Depressiven kann mit deren Monoaminmangel<br />
(s.o.) in Zusammenhang stehen. Eine übermäßige Sekretion von Kortisol kann<br />
nämlich sowohl die Dichte der Serotonin-Rezeptoren reduzieren, als auch die<br />
Funktion der noradrenergen Rezeptoren beeinträchtigen.<br />
5) Depressive Patienten mit besonders erhöhtem Kortisolspiegel scheinen häufiger<br />
Suizid zu begehen.<br />
6) Der Dexamethason-Suppressionstest (DST): s.u.<br />
Der Dexamethason-Suppressionstest (DST) ist ein biologischer Test für<br />
Depression.<br />
Dexamethason (DXM) wirkt auf den Hypothalamus wie Kortisol und reduziert<br />
so (durch negative Rückkopplung) die Ausschüttung von CRH. Normalerweise<br />
wird durch Dexamethason die Kortisolsekretion also unterdrückt. Bei manchen<br />
Depressiven tritt eine solche Suppression jedoch nur kurzfristig oder gar nicht<br />
auf. Erklärt wird dieser Effekt mit der Überaktivität der HPA-Achse. Nach<br />
einer depressiven Episode verschwindet er wieder.<br />
Studie von Salmon: Salmon verabreichte Depressiven und einer nichtdepressiven<br />
Kontrollgruppe um 23:00 Uhr Dexamethason und erhob in den<br />
folgenden 24 h die Entwicklung des Kortisolspiegels.<br />
Ergebnis: Während der Kortisolspiegel in der Kontrollgruppe bis 15h<br />
stark, danach schwach abfiel, fiel er bei den Depressiven nur bis 7:00 Uhr<br />
morgens ab, und stieg danach (zumindest bis 15:00 Uhr) erneut an.<br />
Cortikotropin-Releasing Faktor (CFT)-Theorie (von Nemeroff et al.):<br />
Der erhöhte Cortisolspiegel bei Depressiven ist durch eine übermäßige<br />
Ausschüttung des Cortikotropin-Releasing-Hormons bedingt.<br />
Der CRH-Spiegel ist in der Zerebrospinalflüssigkeit von Depressiven<br />
erhöht; bei Therapie normalisiert sich dieser Spiegel.<br />
Postmortem wurde bei Depressiven eine erhöhte Anzahl CRHproduzierender<br />
Neuronen beobachtet.<br />
CRH-Infusion ins Gehirn bedingt bei Ratten „depressive“ Symptome<br />
(Gewichtsverlust, Insomnie, Angst, reduzierte Libido)<br />
Eine CRH-Übersekretion ist auf frühe Traumata zurückzuführen (z.B.<br />
sexuellen Missbrauch in der Kindheit), bei vulnerablen Personen kann später<br />
auch bei mildem Stress eine Depression entstehen.<br />
Ein Stress-Diathese-Modell (Früher Stress kann eine Diathese<br />
<br />
hervorrufen!)<br />
Zusammenfassung: Die bei Depressionen beschriebene Dysregulation der HPA-Achse<br />
zeigt sich: a) in einer erhöhten basalen Sekretion von CRH, ACTH und Cortisol, b) in<br />
einer verminderten Suppression von Cortisol im Dexamethason-Suppressionstest und<br />
c) in einer verminderten ACTH-Sekretion nach Gabe von CRH (=CRF).<br />
36
4.3.4. Schlaf<br />
Einschub: Basics zum Schlaf-Wach-Rhythmus<br />
3 Arten von biologischen Rhythmen lassen sich unterscheiden:<br />
A) Circadiane Rhythmen: Periodenlänge ca. 24 h<br />
Z.B. Schlaf-Wach-Rhythmus (ca. 25 h); wird v.a. durch den Nucleus<br />
Suprachiasmaticus (SCN) im vorderen Teil des Hypothalamus gesteuert,<br />
der v.a. auf Licht reagiert und so die nächtliche Melatoninausschüttung der<br />
Epiphyse (Zirbeldrüse) reguliert<br />
B) Ultradiane Rhythmen: Periodenlänge deutlich kürzer als 24 h<br />
Z.B. der Wechsel von Tiefschlaf- (Slow-Wave-Sleep) und REM-Phasen<br />
(ca. 90 Minuten)<br />
C) Infradiane Rhythmen: Periodenlänge deutlich länger als 24 h<br />
Z.B. der monatliche Menstruationszyklus (rund 28 Tage)<br />
Die verschiedenen Schlafstadien:<br />
Anhand von EEG-Messungen lassen sich insgesamt 4 Schlafstadien<br />
unterscheiden:<br />
Wachzustand: alternierende Alpha- und Beta-Wellen<br />
Stadium 2 ist durch schnelle und niedrigamplitudige Aktivität<br />
gekennzeichnet und nimmt über 50% des Gesamtschlafs ein (v.a. in den<br />
letzten REM-NonREM-Zyklen stark vertreten)<br />
Stadium 3 und 4 sind durch langsame (niedrigfrequente) und<br />
hochamplitudige Delta-Wellen gekennzeichnet und bilden die<br />
Tiefschlafstadien (v.a. in der ersten Hälfte der Nacht).<br />
Die REM-Phasen sind, was das EEG betrifft, der ersten Phase sehr ähnlich<br />
(schnelle und niedrigamplitudige Beta- und Gamma-Aktivität)<br />
Besonderheiten der REM-Phasen: Schnelle Augenbewegungen, Muskelatonie<br />
(steht im Kontrast zur regen Hirnaktivität, weshalb der REM-Schlaf auch als<br />
„paradoxer Schlaf“ bezeichnet wird), verstärkte Genitaldurchblutung, lebendige<br />
Träume<br />
Wichtig für die Konsolidierung von Gelerntem!<br />
Eine REM-Non-REM-Periode dauert im Schnitt 90 Minuten; die REM-Phasen<br />
werden dabei mit fortschreitender Nacht länger (von 5-10 Minuten in der ersten<br />
bis zu 22 Minuten in der letzten Periode); der durchschnittliche Anteil der REM-<br />
Phasen am Gesamtschlaf beträgt ca. 17 bis 24%<br />
Die Regulation der verschiedenen Schlafstadien erfolgt über sog. REM-on- und<br />
REM-off-Neurone.<br />
Die REM-on-Neurone liegen v.a. im Pons und sind cholinerg, sprich: der von<br />
ihnen freigesetzte Transmitter ist Acetylcholin (ACh); ihre Funktion besteht<br />
darin, den REM-Schlaf auszulösen und zu erhalten.<br />
Die REM-off-Neurone sind aminerg und liegen im Nucleus raphé (Serotonin)<br />
und Nucleus Coeruleus (Noradrenalin)<br />
Serotonin hemmt die Aktivität der REM-on-Neurone und löst damit<br />
Tiefschlafphasen (SWS) aus.<br />
Noradrenalin hemmt ebenfalls die Aktivität der REM-on-Zellen und wirkt<br />
darüber hinaus aktivierend auf das Vorderhin (=> fördert Wachheit)<br />
<br />
37
Depressive zeigen (bedingt durch den Mangel an Serotonin und Noradrenalin) eine<br />
Vorverlagerung und Verlängerung der REM-Phasen sowie eine erhöhte<br />
Augenbewegungsdichte (REM-Intensität)<br />
Die aminerge Hemmung ist reduziert; die cholinerge Stimulation erhöht!<br />
Schlafentzug wirkt bei 60-70% der Depressiven depressionsmildernd!<br />
Wirkmechanismus: Nucleus Raphé setzt Serotonin frei, um SWS einzuleiten!<br />
Wird im therapeutischen Rahmen nur sehr selten eingesetzt; Ziel ist ein<br />
kurzfristiges Durchbrechen schwerer Depressionen!<br />
4.3.5. Neuroanatomische Faktoren<br />
Mehrere Befunde sprechen dafür, dass die rechte Hemisphäre (genauer: der rechte<br />
Präfrontalkortex) bei der Verarbeitung und Generierung von Emotionen dominant ist:<br />
Das emotionale Ausdrucksverhalten (Mimik) beginnt linksseitig und ist dort<br />
auch deutlicher als rechts.<br />
Die Wahrnehmung und Nachahmung emotionaler Gesichtsausdrücke und<br />
Sprachäußerungen (Prosodie) ist nach rechtshemisphärischen Läsionen<br />
häufiger gestört als nach linkshemisphärischen.<br />
Trotzdem ist auch die linke Hemisphäre an der Emotionsverarbeitung beteiligt.<br />
Depressionen gehen häufig mit Läsionen im linken Frontallappen einher;<br />
Manien mit Läsionen im rechten Orbitofrontal- und Temporallappen.<br />
Davidsons Konzept der frontalen Asymmetrie des Kortex nimmt einer genauere<br />
Differenzierung der Hemisphären vor: Im linken Präfontalkortex werden nach<br />
Davidson eher positive Emotionen generiert (Annäherungssystem); im rechten<br />
dagegen eher negative (Vermeidungs- und Rückzugssystem).<br />
Vorgehen: Davidson induzierte positiven bzw. negativen Affekt, indem er Pbn<br />
entsprechende Videos präsentierte oder sie entsprechende Gesichtsausdrücke<br />
aufsetzen ließ. Parallel dazu leitete er ein Spontan-EEG ab und interpretierte<br />
die Alpha-Reduktion in den jeweiligen Regionen als Maß für deren<br />
Aktivierung.<br />
Alpha-Wellen überwiegen im entspannten Wachzustand (etwa bei<br />
geschlossenen Augen), Beta-Wellen überwiegen, wenn mentale oder<br />
körperliche Aktivität vorliegt.<br />
Ergebnis: Ob die Aktivierung im rechten oder linken Präfrontalkortex größer<br />
ist, hängt ab von: der Stimmung, der generellen Verhaltenstendenz („Affective<br />
Style“) und den präsentierten Stimuli.<br />
Ist die Aktivierung rechts stärker (geringere Alpha-Power),…<br />
liegt ein negativer Affekt vor<br />
ist die negative Reaktion auf einen unangenehmen Filmausschnitt<br />
intensiver (Vermeidungsverhalten, negativer Affekt)<br />
haben die betroffenen Pbn höhere Depressions-Werte nach dem „Beck<br />
Depression Inventory“ (BDI)<br />
Ist die Aktivierung links stärker (geringere Alpha-Power), ist es genau<br />
umgekehrt: positiver Affekt (z.B. bei echtem Lächeln); stärkere Tendenz zu<br />
Annäherungsverhalten usw.<br />
38
4.4. Psychologische Ätiologiefaktoren<br />
4.4.1. Kritische Lebensereignisse („Life-Events“) und Stress<br />
Depressive Episoden werden am besten vorhergesagt durch:<br />
Eine vorhergehende Episode<br />
Eine genetische (familiäre) Prädisposition<br />
Mehrere Studien haben jedoch gezeigt, dass auch kritische Lebensereignisse (sog.<br />
„Life-Events“) die Wahrscheinlichkeit einer depressiven Episode erhöhen.<br />
Pionierarbeit haben in diesem Zusammenhang Brown & Harris geleistet:<br />
Im Zuge einer Längsschnittstudie (Anfang der 80er) befragten sie z.B.<br />
Arbeiterfrauen aus Islington (Londoner Stadtbezirk) sowohl zu ihrem<br />
psychischen Befinden, als auch zu kritischen Lebensereignissen (LEDS: „Life<br />
Events and Difficulty Shedule“) und untersuchten, inwiefern das Auftreten<br />
einer Depression durch letztere vorhergesagt werden kann.<br />
Die wichtigsten Ergebnisse der „Islington-Studie“:<br />
Den meisten Manifestationen einer Depression gehen „Auslöser“ („provoking<br />
agents“) voraus: entweder ein schwerwiegendes bedrohliches Ereignis, das<br />
noch 10-14 Tage später präsent ist (z.B. Krankheit) oder eine größere<br />
Schwierigkeit von mind. 2-jähriger Dauer (z.B. Beziehungsprobleme).<br />
Von den 130 befragten Frauen hatten insgesamt 22% im<br />
Untersuchungszeitraum (1 Jahr) eine depressive Episode. Nahm man nur<br />
die Frauen, die mindestens ein schwerwiegendes Ereignis in einem Bereich<br />
ausgeprägten Engagements erlebt hatten, in den Blick, erhöhte sich dieser<br />
Anteil auf 40%. Von den Frauen, die so ein „Life Event“ nicht hatten,<br />
erlitten dagegen nur 14% eine depressive Episode.<br />
Ein schwerwiegendes „Life-Event“ scheint jedoch nur dann zu einer<br />
Depression zu führen, wenn ein zusätzlicher psychosozialer<br />
Vulnerabilitätsfaktor vorliegt: Fehlendes Vertrauen in der Kernbeziehung;<br />
mehr als 3 Kinder unter 14; Verlust der Mutter vor dem 11. Lebensjahr etc.<br />
Darüber hinaus haben Anzahl und Art der „Life-Events“ einen Einfluss auf<br />
die Depressionsrate.<br />
Je mehr kritische Lebensereignisse auftreten, desto höher die<br />
Wahrscheinlichkeit einer Depression.<br />
Demütigende Erfahrungen (Misserfolg, Missbrauch etc.) bergen dabei das<br />
größte-, Verlusterfahrungen (Tod, Trennung, liebgewonnene Idee,<br />
materieller Verlust etc.) das zweitgrößte Risiko. Gefahrenereignisse führen<br />
nicht zu Depressionen.<br />
Das Vorhandensein eines Risikofaktors (Kindheitsbelastung oder<br />
interpersonelle Probleme während der Depression) erhöht die<br />
Wahrscheinlichkeit eines chronischen Verlaufs:<br />
44% (mit Risikofaktor) zu 7% (ohne Risikofaktor)<br />
Der Anteil von Patienten, bei denen ein positives Ereignis vor einer Remission<br />
zu beobachten war, liegt generell bei über 50%, hängt aber im Einzelnen davon<br />
ab, ob und wenn ja, welche Medikamente eingesetzt wurden.<br />
Schutz zu bieten scheinen u.a. ein außer-häusiger Beruf (Teilzeit oder<br />
Vollzeit), eine stabile Kernbeziehung und eine religiöse Überzeugung.<br />
Bedenke: Bei 25 % der depressiven Patienten liegt kein „kritisches Lebensereignis“<br />
vor; darüber hinaus nimmt der Einfluss von „Life-Events“ mit zunehmender Anzahl<br />
der Episoden ab.<br />
39
4.4.2. Kognitive Theorie der Depression nach Beck<br />
BECK führt Depressionen auf 3 sich wechselseitig bedingende Faktoren zurück:<br />
1) Die „kognitive Triade der Depression“ (negative Beurteilung der eigenen Person,<br />
der Umwelt und der Zukunft)<br />
2) Negative Schemata und dysfunktionale Annahmen<br />
3) Kognitiven Verzerrungen / kognitive Fehler<br />
Negative Schemata werden durch negative Lebenserfahrungen (z.B.<br />
Verlusterlebnisse, Zurückweisung, Kritik oder depressive Modelle) in der Kindheit<br />
und Adoleszenz oder durch aktuelle Belastungen erworben und wirken meist<br />
unbewusst.<br />
Kognitive Schemata bestimmen die Reizwahrnehmung und<br />
Informationsverarbeitung, indem sie automatische Gedanken aktivieren.<br />
Ein Beispiel für ein solches Schema ist z.B. der Anspruch, immer perfekt zu<br />
sein oder von allen geliebt zu werden.<br />
Dysfunktional sind solche Annahmen bzw. Schemata deshalb, weil sie zu<br />
Fehlschlüssen bzw. kognitiven Verzerrungen führen, die ihrerseits die negativen<br />
Schemata zu bestätigen scheinen (=Teufelskreislauf)!<br />
So führt z.B. die unbewusste Annahme, immer perfekt sein zu müssen, bei<br />
Misserfolg zu der zweifelhaften Schlussfolgerung, wertlos zu sein (bewusst),<br />
was wiederum die Annahme verstärkt.<br />
Kognitive Verzerrungen sind Denkfehler, die durch negative Schemata bedingt<br />
werden. Typische Denkfehler sind z.B.:<br />
Übertriebene Verallgemeinerungen (Übergeneralisierung): Eine schlechte Note<br />
als Beweis für die eigene Dummheit!<br />
Über- oder Untertreibung: Positives klein reden, Negatives überbewerten.<br />
Voreilige bzw. willkürliche Schlussfolgerungen: Hans hat sich nicht gemeldet –<br />
er mag mich nicht!<br />
Dinge persönlich nehmen (Personalisierung): Dass ich die Praktikum nicht<br />
bekommen habe, liegt nicht daran, dass kein Platz mehr war, sondern daran, dass<br />
man mich nicht wollte!<br />
Alles-oder-nichts-Denken (= Schwarz-Weiß-Denken): Alles, was nicht der erste<br />
Platz ist, ist eine Niederlage!<br />
Zugrundeliegendes Menschenbild: Der Mensch ist nicht passives Opfer seiner<br />
Passionen (z.B. Freud) – diese unterliegen vielmehr seiner intellektuellen Kontrolle!<br />
Empirische Befunde und Evaluation:<br />
Dass depressive Patienten tatsächlich durch negative Schemata und kognitive<br />
Verzerrungen gekennzeichnet sind, konnte in einer Vielzahl von Studien<br />
nachgewiesen werden.<br />
Untersuchungen: „Skala Dysfunktionaler Einstellungen“ (DAS); Vp<br />
schenken traurigen Gesichtern größere Aufmerksamkeit als fröhlichen,…<br />
Problematisch ist jedoch Becks Annahme, dass diese kognitiven Faktoren die<br />
Depression kausal bedingen. Schließlich kann es sich bei ihnen genauso gut<br />
um eine Folge von Depression handeln!<br />
Allgemeine Studien zum Zusammenhang von Kognition und Emotion<br />
zeigen, dass sich die beiden Größen wechselseitig beeinflussen: Eine<br />
Manipulation der Kognitionen hat Einfluss auf den Affekt – umgekehrt hat<br />
aber auch die Manipulation der Stimmung Einfluss auf die Kognition!<br />
Die Ergebnisse prospektiver Studien sind meist nicht minder uneindeutig:<br />
Es konnte bisher also nicht belegt werden, dass negative Kognitionen<br />
depressiven Verstimmungen zwangsläufig vorausgehen.<br />
40
Fazit: Am besten erscheint eine bidirektionale Sichtweise, der zufolge sich<br />
Kognition und Depression wechselseitig beeinflussen. Trotzdem kann aber<br />
davon ausgegangen werden, dass negative Denkmuster einen Risikofaktor<br />
darstellen!<br />
4.4.3. Theorie der gelernten Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit<br />
Es gibt mehrere kognitive Theorien, die Depression auf eine generalisierte<br />
Hilflosigkeit bzw. Hoffnungslosigkeit zurückführen. 3 Varianten lassen sich<br />
unterscheiden:<br />
1) Die ursprüngliche Theorie der gelernten Hilflosigkeit (von Seligman)<br />
2) Die attributionsbezogene Umformulierung dieser Theorie (Seligman, Abramson)<br />
3) Die Theorie der Hoffnungslosigkeit (Abramson, Metalsky & Alloy)<br />
Theorie der gelernten Hilflosigkeit (Seligman, 1974): Unangenehme Erfahrungen<br />
und Traumata, die ein Individuum erfolglos zu überwinden versucht hat, führen zu<br />
Passivität und Kontrollverlust auch in anderen Situationen Depression.<br />
Experimentelle Grundlage: Hunde, die in einer ersten Phase unkontrollierbare<br />
Elektroschocks erleiden mussten, lernen in einer zweiten Phase, in denen diese<br />
vermieden werden können, das dazu nötige Verhalten langsamer als Tiere, die<br />
zuvor keine unkontrollierbaren Schocks appliziert bekommen hatten.<br />
Erklärung: In den kognitiven, motivationalen und emotionalen Defiziten<br />
der „geschockten“ Hunde äußert sich eine „gelernte Hilflosigkeit“!<br />
Gelernte Hilflosigkeit + Attributionsstil: Da sich die Ergebnisse nicht 100%-ig auf<br />
Menschen übertragen ließen, legten Seligman und Abramson 1978 eine revidierte<br />
Fassung der Theorie vor: Darin wird davon ausgegangen, dass der Effekt durch den<br />
Attributionsstil einer Person moderiert wird.<br />
Probleme: Bei Versuchen mit Menschen zeigte sich, dass induzierte<br />
Hilflosigkeit auch dazu führen kann, dass nachfolgend die notwendigen<br />
Vermeidungshandlungen einfacher gelernt werden. Darüber hinaus schreiben<br />
sich viele Depressive selbst die Verantwortung für ihre Misserfolge zu - ein<br />
Umstand, der mit dem Begriff „Hilflosigkeit“ nur schwer zu vereinbaren ist!<br />
Lösung: Ob gelernte Hilflosigkeit auftritt oder nicht, hängt nicht nur von der<br />
Situation, sondern auch von deren Interpretation ab, genauer: davon, wie eine<br />
Person ihre eigenen Misserfolge attribuiert.<br />
Mit WEINER können Attributionen dabei anhand dreier Dimensionen<br />
unterschieden werden:<br />
1. Internale vs. externale Attribution<br />
2. Stabile vs. variable Attribution<br />
3. Globale vs. spezifische Attribution<br />
Ein negativer Attributionsstil äußert sich in internalen (=> schlechter<br />
Selbstwert), stabilen (=> Hilflosigkeit) und globalen<br />
Ursachenzuschreibungen. (=> Verstärkung dieser beiden Aspekte)<br />
Die Mathearbeit war weder dumm gestellt (external, variabel,<br />
spezifisch), noch hab ich mich zu wenig angestrengt (internal, variabel).<br />
Stattdessen war ich zu dumm (internal, stabil) – und zwar nicht nur,<br />
weil ich mathematisch unbegabt bin, sondern weil ich generell nichts<br />
drauf habe (global).<br />
These: Machen Menschen mit einem negativen Attributionsstil (Diathese)<br />
negative Erfahrungen (Stress) sind sie besonders gefährdet, depressiv zu<br />
werden. Erstens: halten ihre negativen Gefühle nach solchen Erlebnissen<br />
länger an als bei Personen mit einem positiven Attributionsstil; zweitens:<br />
entwickeln sie eine „gelernte Hilflosigkeit“.<br />
41
Hoffnungslosigkeit: Die neueste Fassung der Theorie erweitert das Konzept um den<br />
Begriff der Hoffnungslosigkeit; letztere äußert sich nicht nur im Gefühl der<br />
Hilflosigkeit (mangelnde Kontrollüberzeugung), sondern darüber hinaus in der<br />
pessimistischen Zukunftserwartung, dass positive Ereignisse ausbleiben, negative<br />
dagegen eintreten werden.<br />
Der Vorteil dieser Fassung besteht darin, dass neben dem Attributionsstil<br />
weitere Diathesen in Betracht gezogen werden: dazu zählen v.a. der erwähnte<br />
Pessimismus, zum anderen ein geringes Selbstwertgefühl.<br />
Darüber hinaus bietet die Theorie eine gute Erklärung für den engen<br />
Zusammenhang von Depression und Angststörungen: Pessimistische<br />
Erwartungen führen zu Angst; treten die erwarteten Ereignisse ein, kommt es<br />
zu Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit!<br />
Empirische Befunde und Evaluation:<br />
Positive Befunde:<br />
Tatsächlich zeigt sich, dass Pbn, die im „Attributionsstil-Fragebogen“<br />
(ASQ) einen negativen Attributionsstil erkennen lassen, höhere<br />
Depressionswerte aufweisen!<br />
Studenten, die einen positiven Attributionsstil aufweisen, reagieren auf eine<br />
schlechte Note zunächst nicht minder enttäuscht als Studenten mit einem<br />
negativen Attributionsstil - ihre Enttäuschung hält jedoch nicht so lange an!<br />
Erklärung: unmittelbare emotionale Reaktion erfolgt vor den<br />
Attributionen!<br />
Probleme:<br />
Die meisten Studien sind Analogstudien: sie wurden also nicht an<br />
klinischen Stichproben erhoben, sondern an Studenten mit hohen<br />
Depressionswerten. Validität?!<br />
Das Modell wurde ursprünglich zur Erklärung reaktiver Depressionen<br />
entwickelt, ob es auch auf andere Typen von Depression anwendbar ist,<br />
wäre näher zu prüfen.<br />
Es ist fraglich, ob die Theorien depressionsspezifisch sind. Auf Angst oder<br />
Sorgen im Allgemeinen scheinen sie genauso zuzutreffen!<br />
Ob kognitive Prozesse, in dem Fall: die Attribution von Ereignissen,<br />
tatsächlich so entscheidend sind, wie es die Theorie nahelegt, ist streitbar.<br />
Schließlich gibt es viele Studien, die zeigen, dass der Mensch sich der<br />
Ursachen seines Verhaltens oft gar nicht bewusst ist und auch die<br />
Alltagserfahrung zeigt, dass wir nur selten so rational und überlegt<br />
vorgehen, wie es kognitive Modelle nahelegen.<br />
Die besagten Theorien gehen davon aus, dass es sich bei dem<br />
Attributionsstil um eine Diathese und damit um ein stabiles<br />
Persönlichkeitsmerkmal handelt; es konnte jedoch gezeigt werden, dass der<br />
negative Attributionsstil nach einer depressiven Episode wieder<br />
verschwindet!<br />
Wie bei Becks Theorie stellt sich die Frage, ob Hilf- bzw.<br />
Hoffnungslosigkeit tatsächlich die Ursache oder lediglich eine Folge von<br />
Depressionen ist.<br />
42
4.4.4. Sonstige Theorien zur Depression<br />
Das Verstärker-Verlust-Modell von Lewinsohn (1974) ist ein<br />
verhaltenstheoretisches Modell: Depression wird dabei auf einen sich durch die<br />
Depression weiter verschärfenden Mangel an positiver Verstärkung zurückgeführt.<br />
Die Menge positiver Verstärkung hängt dabei von 3 Faktoren ab:<br />
1) Der Anzahl und Qualität möglicher verstärkender Ereignisse<br />
Was wirkt auf eine Person zumindest potenziell verstärkend (ist es<br />
beruflicher Erfolg, Glück in der Liebe oder ein großer Freundeskreis?)<br />
2) Der Erreichbarkeit solcher Verstärker in der Umgebung<br />
Ist die Person berufstätig und wenn ja, inwiefern besteht in diesem<br />
Beruf die Möglichkeit, für das eigene Handeln verstärkt zu werden<br />
(Arbeitsloser vs. Lehrer vs. Schauspieler)? Hat eine Person Familie?...<br />
3) Dem instrumentellen Verhalten einer Person<br />
Ist eine Person dazu in der Lage, die potenziellen Verstärker in der<br />
Umgebung auch zu erhalten (berufliche Fähigkeiten, soziale<br />
Kompetenz etc.)?<br />
Wer über längeren Zeitraum keine Verstärkung erhält, befindet sich nach<br />
behavioristischer Theorie unter Löschungsbedingungen und hört im<br />
Extremfall ganz auf, irgendetwas zu tun. Die Folge ist eine Depression.<br />
Letztere lässt sich damit als Teufelskreislauf beschreiben: Ein Mangel an<br />
Verstärkern führt zu Depression – und diese führt wiederum zu einer weiteren<br />
Reduktion an Verstärkern (berufliches Desinteresse, sozialer Rückzug etc.).<br />
Interpersonale Theorien der Depression: bauen auf Lewinsohns Modell auf und<br />
betonen die negativen Reaktionen, die Depressive in ihrer Umwelt hervorrufen.<br />
In mehreren Studien (Telefongespräche oder Face-to-Face-Interaktionen)<br />
konnte gezeigt werden, dass das Verhalten von Depressiven (sogar unabhängig<br />
vom Inhalt) Ablehnung hervorruft.<br />
Depressive verfügen über geringere Sozialkompetenzen und leben meist in<br />
einem weitmaschigeren sozialen Netz.<br />
Multifaktorieller Ansatz: Am sinnvollsten ist es, die verschiedenen Theorien zu<br />
integrieren.<br />
In diesem Fall lassen sich folgende Einflussfaktoren unterschieden:<br />
1. Genetische Prädisposition<br />
2. Traumatische Erfahrungen („Life-Events“)<br />
3. Persönlichkeitsfaktoren<br />
Gelernte Hilflosigkeit<br />
Attributionsstil<br />
Kognitive Schemata<br />
4. Physikalische Einwirkungen<br />
Z.B. Lichtentzug<br />
5. Aktuelle psychosoziale Belastungen (Stress)<br />
Alle diese Faktoren werden neurobiologisch vermittelt (Serotoninmangel etc.)<br />
und führen so zu einer Depression.<br />
43
4.4.5. Psychologische Ursachen der bipolaren Störung<br />
Zur bipolaren Störung gibt es insgesamt weniger Forschung als zur unipolaren<br />
Depression.<br />
Was die depressiven Episoden betrifft, sind die Theorien dieselben!<br />
Was die manischen Episoden betrifft, wird allgemein davon ausgegangen, dass<br />
es sich dabei um einen Abwehr- bzw. Schutzmechanismus handelt, kurz: um<br />
der Depression zu entfliehen, stürzen sich die Patienten in die Manie!<br />
4.4. Therapie:<br />
4.4.1. Allgemeines [ Intervention]<br />
Interventionsebenen:<br />
Niederschwellige Maßnahmen: bei subklinischen (minoren) Depressionen<br />
Als „wirksam“ haben sich erwiesen: Bibliotherapie (Selbsthilfe mit Hilfe<br />
von Fachbüchern) und Kurzzeittherapie (einige Sitzungen)<br />
„Möglicherweise wirksam“ sind internetbasierte KVT-Programme<br />
Akuttherapie: beginnt meist am Tiefpunkt und dauert so lange, bis eine<br />
spürbare Besserung eingetreten ist (bis zu einem Monat)<br />
Als „wirksam“ haben sich erwiesen: Medikamentöse Behandlung<br />
(Antidepressiva); kognitive Verhaltenstherapie (KVT); Interpersonelle<br />
Psychotherapie (IPT); Psychodynamische Kurzzeittherapie (STPP);<br />
Kombinationstherapien (Antidepressiva + Psychotherapie)<br />
„Bislang ohne ausreichende Wirknachweise“: Psychoanalyse,<br />
psychodynamische Langzeittherapie und alle anderen Therapien<br />
Erhaltungstherapie: beginnt nach der Remission und dauert 3-6 Monate; Ziel<br />
ist die Verhinderung bzw. Hinauszögerung von Rückfällen<br />
Prophylaktische Therapie: kann je nach Schwere der Depression Jahre<br />
dauern<br />
4.4.2. Pharmakologische Behandlung<br />
Drei Hauptkategorien von Antidepressiva lassen sich unterscheiden:<br />
1) Trizyklika:<br />
hemmen die Wiederaufnahme der ausgeschütteten Neurotransmitter in die<br />
präsynaptische Zelle (Serotonin, Noradrenalin, Dopamin etc.)<br />
haben eine sehr breite (unspezifische) Wirkung<br />
ihr Name beruht auf der chemischen Struktur (drei Ringe)<br />
2) MAO-Hemmer:<br />
hemmen den Abbau von Serotonin und Noradrenalin durch das Enzym<br />
Mono-Amino-Oxydase (MAO)<br />
haben die schwersten Nebenwirkungen und werden daher heute nur noch<br />
selten eingesetzt!<br />
3) Selektive Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI; NaRI; SNRI)<br />
Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRIs) hemmen das<br />
Transportmolekül, das Serotonin wieder in seine Speicher zurückführt;<br />
wirken daher nur an den Synapsen, deren Übertragung mittels Serotonin<br />
erfolgt (spezifischer Wirkort).<br />
Weitere selektive Wiederaufnahme-Hemmer sind: Noradrenalin-<br />
Wiederaufnahme-Hemmer (NaRI) und Serotonin-Noradrenalin-<br />
Wiederaufnahme-Hemmer (SNRI)<br />
44
Hinzu kommen atypische und pflanzliche Antidepressiva:<br />
4) Atypische Antidepressiva:<br />
Erhöhen die Ausschüttung von Serotonin und Noradrenalin!<br />
5) Johanneskrautpräparate:<br />
Die Wirksamkeit ist, zumindest bei leichten und mittelschweren<br />
Depressionen, empirisch belegt; der Wirkmechanismus jedoch nicht<br />
abschließend geklärt => Auch Johanneskraut scheint aber auf die neuronale<br />
Transmission einzuwirken!<br />
Darüber hinaus lassen sich Antidepressiva hinsichtlich ihrer Wirkung auf die<br />
Aktiviertheit des Patienten in 3 Typen unterteilen:<br />
Typ I: wirkt stärker sedierend<br />
Typ II: ist neutral<br />
Typ III: wirkt eher stimulierend und antriebssteigernd<br />
Eines der wichtigsten Kriterien bei der Medikamentenauswahl stellt das<br />
Nebenwirkungsprofil dar.<br />
Häufige Nebenwirkungen: Mundtrockenheit, Akkomodationsstörungen beim<br />
Sehen, Schwindel, Kopfschmerz, Erektionsstörungen, Gewichtszunahme,<br />
hypomane Nachschwankungen etc. etc.<br />
Problematisch sind v.a. solche Medikamente, die für suizidzwecke<br />
missbraucht werden können!<br />
Was ihre depressionslindernde Wirkung betrifft, sind Trizyklika, MAO-<br />
Hemmer und SSRIs mehr oder minder gleichwertig; der große Vorteil von<br />
letzteren besteht jedoch in der besseren Verträglichkeit (weniger<br />
Nebenwirkungen)<br />
Kleine Auswahl wichtiger Antidepressiva (inklusive Nebenwirkungen):<br />
Kategorie Substanz-Handelsname Nebenwirkungen<br />
Trizyklika Imipramin (Typ II) – Trofanil<br />
Amitriptylin (Typ I) - Saroten<br />
MAO-<br />
Hemmer<br />
SSRIs<br />
Erhöhtes Schlaganfall-/Herzinfarktrisiko;<br />
niedriger Blutdruck, Angst, Müdigkeit,<br />
unscharfes Sehen, trockener Mund,<br />
Verdauungsstörungen, Errektionsstörungen,<br />
Gewichtszunahme<br />
Tranylcypromin (III) – Parnat Möglicherweise letaler Bluthochdruck;<br />
trockener Mund; Übelkeit; Schwindel;<br />
Kopfschmerzen<br />
Fluoxetin (II) – Fluctin Nervosität, Schläfrigkeit, Schwindel,<br />
Kopfweh, Schlafstörungen, Magenbeschwerden<br />
4.4.3. Nicht-medikamentöse, somatische Therapieformen:<br />
Wachtherapie (=Schlafentzug):<br />
Unterschieden werden kann zwischen partiellem (2.Nachthälfte) und totalem<br />
Schlafentzug.<br />
Wird v.a. bei schweren Fällen (im Rahmen stationärer Behandlung)<br />
angewandt und dient dazu, die Depression vorübergehend zu durchbrechen.<br />
Tatsächlich zeigt sich bei 60% der Patienten am Folgetag eine<br />
Stimmungsverbesserung; diese hält jedoch ohne begleitende Maßnahmen nicht<br />
lange an.<br />
Angenommener Wirkmechanismus: Nucleus Raphé setzt Serotonin frei, um<br />
SWS einzuleiten!<br />
45
Lichttherapie:<br />
Regelmäßige Exposition mit Licht (bis zu mehreren Stunden täglich)<br />
V.a. bei saisonal abhängigen Depressionen (Winterdepressionen) indiziert<br />
Angenommener Wirkmechanismus: Erhöhung der Transmitterkonzentration<br />
(v.a. Serotonin)<br />
Elektrokrampftherapie (=Elektrokonvulsionstherapie; kurz: EKT):<br />
Elektrische Stimulation des Kortex löst epileptischen Krampfanfall aus;<br />
während die Stimulation früher ohne Betäubung und auf beiden Seiten<br />
(bilaterale EKT), wird heute meist nur noch eine Seite (die rechte) stimuliert<br />
und der Patienten vorher unter Vollnarkose gesetzt.<br />
Wird nur bei sehr schweren und behandlungsresistenten Depressionen<br />
angewandt<br />
Kann massive Nebenwirkungen haben: dauerhafte Verwirrung, Löschung von<br />
Gedächtnisinhalten etc.<br />
Wirkmechanismus: unbekannt!<br />
Transkranielle Magnetstimulation (TMS):<br />
Nicht-invasives Verfahren, bei dem bestimmte Gehirnregionen durch starke<br />
Magnetfelder stimuliert werden, was zu einer Steigerung der dortigen<br />
Gehirnaktivität führt.<br />
Mögliche Alternative zur EKT<br />
4.4.4. Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)<br />
Die Ansätze der kognitiven Verhaltenstherapie zur Behandlung von Depression<br />
basieren v.a. auf Becks Modell der negativen Triade und Lewinsohns „Verstärker-<br />
Verlust-Modell“.<br />
Sofern die KVT sowohl kognitive, als auch behaviorale Elemente enthält, kann<br />
sie als Kombinationstherapie beschrieben werden.<br />
Nach Hautzinger lässt sich der Ablauf einer kognitiven Verhaltenstherapie in 6 Phasen<br />
untergliedern:<br />
1) Problemanalyse und Aufbau einer therapeutischen Beziehung<br />
Anamnese; Benennung der Schlüsselprobleme (Kriterien: Wichtigkeit,<br />
Dringlichkeit, Veränderbarkeit); Aufstellung einer Zielmatrix: was will der<br />
Patient kurz-, mittel- und langfristig in den verschiedenen Lebenskontexten<br />
(Beruf, Familie etc.) erreichen!<br />
Therapeutische Beziehung: Empathie, positive Wertschätzung, Kongruenz<br />
2) Vermittlung des therapeutischen Modells und Psychoedukation bezüglich<br />
der jeweiligen Störung<br />
Grundannahmen der KVT: Verhalten, Denken und Fühlen beeinflussen<br />
sich wechselseitig, was in der Therapie passieren wird etc. pp.<br />
Aufklärung über die biologischen und psychologischen Grundlagen der<br />
Depression<br />
3) Aktivitätsaufbau<br />
Einstieg: Erläuterung der „Depressionsspirale“ (soz. Rückzug und<br />
Passivität führen zu einer Reduktion positiver Verstärkung und damit zu<br />
einer Verschlimmerung der Depression => Ausweg: sich aufraffen und<br />
positive Aktivitäten aufsuchen!)<br />
Aufstellung eines Wochenplans, in dem sowohl die Aktivitäten als auch<br />
die damit einhergehenden Stimmungen protokolliert werden sollen => der<br />
Plan dient zunächst zur Erhebung des Ist-Zustandes (Baseline); in einem<br />
zweiten Schritt werden positiv erlebte Aktivitäten gesammelt und<br />
46
zunehmend in den Plan integriert (langfristiges Ziel: Etablierung einer<br />
neuen Tagesstruktur)!<br />
Wichtig: Keine allgemeinen, sondern konkrete Aktivitäten (wie z.B. 2 Mal<br />
die Woche eine halbe Stunde spazieren gehen)<br />
4) Bearbeitung und Modifikation kognitiver Muster<br />
Aufklärung über die Wirkweise von Kognitionen (automatisch,<br />
stimmungsinduzierend etc.)<br />
Beobachten und Erkennen automatischer Gedanken<br />
Vermittlung der ABC-Technik: Gefühle sind die Konsequenz (C)<br />
einer auslösenden Situation (A) und deren Bewertung (B), die meist<br />
automatisch abläuft. Entscheidend ist, das die auslösende Situation<br />
(Hans grüßt nicht) und deren Bewertung (er mag mich nicht)<br />
voneinander getrennt werden müssen, da es v.a. letztere ist, die das<br />
Gefühl auslöst!<br />
Wird dieser Zusammenhang erkannt, können alternative Bewertungen<br />
(B„) in Betracht gezogen und angenommen werden (Hans war wohl<br />
gerade gestresst), was wiederum zu einer veränderten Konsequenz<br />
(C„), einem anderen Gefühl, führt!<br />
Wichtig: Der Patient darf weder zu neuen Bewertungen überredet werden,<br />
noch dürfen seine gewohnten Bewertungen von vornherein als irrational<br />
abgetan werden. Stattdessen muss der Patient selbst zu seinen Einsichten<br />
kommen => Mögliche Methoden:<br />
„Sokratischer Dialog“ (gelenktes Fragen):<br />
Negative Schemata auf ihren Realitätsgehalt überprüfen: „Ich weiß<br />
von nichts bescheid!“ – „Von welchen Themen z. B.?“ – „Z. B. von<br />
Politik“ – „Wie viele Politiker werden sie wohl kennen, wenn ich<br />
ihnen etwas aus der Zeitung vorlese?!“ – „10 %“ – „Mal sehen: …“<br />
Kognitive Verzerrungen erkennen und benennen: „Keiner mag<br />
mich!“ = Übergeneralisierung!<br />
Reattribuierung; Rollenspiele; eine Situation nicht nur aus der<br />
eigenen Perspektive, sondern auch aus der eines unbeteiligten<br />
„Dritten“ beurteilen usw. usw.<br />
5) Verbesserung der sozialen Kompetenz<br />
Ziele: Erkennen und Durchsetzen eigener Wünsche, Äußern positiver<br />
Gefühle, Aufbau und Pflege sozialer Kontakte, Problemlösefähigkeit etc.<br />
Methoden: Verhaltensübungen, Rollenspiele (im stationären Setting meist<br />
in Gruppen)<br />
6) Rückfallprophylaxe<br />
Sensibilität für Warnsignale um depressive Episoden frühzeitig zu<br />
bemerken; Training der gelernten Techniken; „Notfallkoffer“ (Karteikarten<br />
mit positiven Aktivitäten etc.),…<br />
„Booster-Sitzungen“: Bearbeitung aktueller Rückschläge, Auffrischen der<br />
gelernten Strategien<br />
4.4.5. Weitere Therapieformen<br />
MBCT: Die „Mindfullness Based Cognitive Therapy“ (MBCT) wurde speziell für<br />
die Erhaltungstherapie bei unipolaren Depressionen entwickelt; sie enthält neben den<br />
kognitiv-behavioralen Elementen (Aktivitätsaufbau etc.) Achtsamkeitsübungen, die<br />
auf das bewusste Erleben von Situationen zielen (Yoga, Atemmeditation,<br />
Aufmerksamkeit auf alltägliche Handlungen) etc.<br />
MBCT ist „möglicherweise wirksam“ (Evidenzgrad II)<br />
47
IPT: Die Interpersonale Therapie (IPT) ist als ambulante Kurzzeittherapie angelegt<br />
(12-20 Einzelsitzungen) und gehört zur Gruppe der psychodynamischen<br />
Kurzzeittherapien (STPP); sie zielt v.a. darauf die konkreten Lebensbezüge des<br />
Klienten zu verbessern; der Hauptfokus liegt dementsprechend auf der Bearbeitung<br />
zwischenmenschlicher und psychosozialer Probleme im Hier und Jetzt:<br />
Trauerbewältigung, Rollenwechsel/Lebensveränderungen, Einsamkeit, zwischenmenschliche<br />
Konflikte etc.<br />
IPT gilt bei Depressionen als „wirksam“ (Evidenzgrad I)<br />
4.4.5. Therapie bei anderen affektiven Störungen<br />
Chronische Depressionen:<br />
Die einzige Therapieform, die speziell zur Behandlung von chronischen<br />
Depressionen und Dysthymie entwickelt wurde, ist das „Cognitive Behavioral<br />
Analysis System for Psychotherapy“ (CBASP); es vereint interpersonelle,<br />
psychodynamische, kognitive und behaviorale Strategien und zielt v.a. auf eine<br />
Erhöhung der sozialen Kompetenz und eine adäquatere Wahrnehmung der<br />
Umwelt ab.<br />
Als „wirksam“ erwiesen haben sich folgende Kombinationstherapien: KVT +<br />
Antidepressiva; CBASP + Antidepressiva<br />
Bipolare Störungen:<br />
Bei bipolaren Störungen ist eine Kombination aus Psychotherapie und<br />
Pharmakotherapie angeraten; erstere erhöht nicht nur die<br />
Medikamentencompliance, sondern fördert u.a. die Akzeptanz der Krankheit<br />
und eine Sensibilität für Warnsignale.<br />
Das Medikament, das bei bipolaren Störungen verschrieben wird, ist Lithium<br />
(Handelsname: Quilonium); es hilft sowohl in manischen als auch in<br />
depressiven Phasen (in letzteren sogar besser als herkömmliche<br />
Antidepressiva, was für den prinzipiellen Unterschied zw. bi- und unipolarer<br />
Störung spricht); die Einnahme des Medikaments sollte ständig erfolgen!<br />
Problematisch an Lithium sind dessen massive Nebenwirkungen: Tremor,<br />
Magenprobleme, Koordinationsstörungen, Schwindel, Herzrythmusstörungen,<br />
unscharfes Sehen, Schläfrigkeit => bei Überdosis: tödlich!<br />
4.4.6. Wirksamkeit<br />
Die wichtigsten Evidenzen im Überblick:<br />
Die wirksamste Psychotherapie bei Depression ist (über alle Bedingungen<br />
hinweg: Akuttherapie, Erhaltungstherapie, Gruppensetting, Einzelsetting etc.)<br />
die kognitive Verhaltenstherapie (KVT), ebenfalls als wirksam erwiesen<br />
haben sich die Interpersonale Therapie (IPT) und (zumindest in der akuten<br />
Einzeltherapie) die psychodynamische Kurzzeittherapie (STPP)<br />
Keine Wirksamkeit konnte bisher für die klassische Psychoanalyse und alle<br />
anderen Therapieformen nachgewiesen werden.<br />
Was die kurzfristige Wirkung betrifft, sind psychotherapeutische (genauer:<br />
KVT und IPT), medikamentöse und kombinierte Interventionen gleichwertig!<br />
Sie alle sind einer Placebobehandlung überlegen!<br />
Verbesserung liegt im Schnitt zw. 60 und 65%!<br />
Langfristig sind jedoch psychotherapeutische (KVT / IPT) oder kombinierte<br />
Interventionen rein medikamentösen Behandlungen vorzuziehen, da bei ihnen<br />
die Abbrecher- und Rückfallquote geringer ausfällt und weniger<br />
Nebenwirkungen auftreten!<br />
48
Die KVT ist auch bei schweren Depressionen der medikamentösen<br />
Behandlung nicht (unbedingt) unterlegen; trotzdem ist bei schweren<br />
Depressionen eine kombinierte Therapie die Methode der Wahl.<br />
Bei chronischen Depressionen ist eine Kombination von Pharmakotherapie und<br />
spezifischer Psychotherapie (KVT oder CBASP) angezeigt (Erhöhung der<br />
Medikamentencompliance, Verringerung der Abbrecherquote etc.).<br />
Bei subklinischer Symptomatik reichen meist Psychoedukation, Bibliotherapie<br />
oder kurzzeitige, kogitiv-verhaltenstherapeutische Gruppenbehandlung aus<br />
(Evidenzgrad I)<br />
Eine Metanalyse (2008!) zur Frage der Wirksamkeit von SSRIs und ob diese vom<br />
Schweregrad der Depression abhängt, erbrachte folgende Ergebnisse:<br />
SSRIs sind in ihrer Wirkung Placebos klinisch nicht signifikant überlegen!<br />
Die durchschnittliche Verbesserung auf der „Hamilton Rating Scale for<br />
Depression“ (HRSD) beträgt nach einer Behandlung mit SSRIs 9,6 Punkte,<br />
nach einer Placebo-Behandlung 7,8 Punkte. Dieser Unterschied (1,8<br />
Punkte) ist zwar statistisch-, nicht aber klinisch signifikant.<br />
Placebos erreichen 80% der Medikamentenwirkung (zum Vgl.: bei<br />
Schmerzen lediglich 50%); Depressive scheinen also extrem gut auf sie<br />
anzusprechen!<br />
Ausnahme: Nur bei extrem schweren Depressionen wird der Unterschied<br />
klinisch signifikant; dieser Umstand ist allerdings nicht darauf zurückzuführen,<br />
dass besonders schwere Fälle besser auf die Medikation ansprechen würden,<br />
sondern darauf, dass schwere Fälle schlechter auf Placebos ansprechen.<br />
Die Wirkung der Medikation ist also vom Schwergrad der Depression mehr<br />
oder minder unabhängig; es besteht jedenfalls keine lineare Beziehung<br />
zwischen beidem!<br />
Fazit der Autoren: Antidepressiva sollten nur dann eingesetzt werden, wenn<br />
die Depression besonders schwer ist und/oder andere Interventionsformen<br />
keine Wirkung gezeigt haben!<br />
49
5.1. Darstellung des Störungsbilds<br />
5. Schizophrenie<br />
5.1.1. Die wichtigsten Konzepte und Symptome<br />
Definition: Der Begriff „Schizophrenie“ umfasst eine Gruppe psychotischer<br />
Störungen, die durch massive Beeinträchtigungen des Denkens, emotionalen Erlebens<br />
und Verhaltens gekennzeichnet sind, die ihrerseits zu einem Bruch mit der Realität<br />
führen (Rückzug in eine Phantasiewelt aus Wahnideen und Halluzinationen).<br />
Denken: mangelnde Logik, mangelnder Realitätsbezug, Wahrnehmungsfehler<br />
und Aufmerksamkeitsstörungen<br />
Emotionales Erleben: Flacher oder unangemessener Affekt<br />
Verhalten: Motorische Störungen und/oder bizarres Verhalten<br />
Etymologie: Der Begriff „Schizophrenie“ kommt aus dem Griechischen und heißt<br />
übersetzt „gespaltene Seele“.<br />
Anders als oft angenommen wird, haben Schizophrene jedoch keine gespaltene<br />
Persönlichkeit (ein extrem verbreitetes Missverständnis)!<br />
Stattdessen bezieht sich der 1908 von Eugen Bleuler (s.u.) geprägte Begriff auf<br />
den fehlenden Zusammenhalt schizophrener Assoziationen, den dadurch<br />
bedingten Bruch mit der Realität und die Tatsache, dass bei Schizophrenen,<br />
anders als bei der Demenz, nicht alle, sondern nur ein Teil der kognitiven<br />
Funktionen verloren geht.<br />
Historisches: Das Konzept der Schizophrenie wurde erstmals Anfang des 20. Jh. von<br />
den beiden Psychiatern Emil Kraeplin und Eugen Bleuler formuliert.<br />
Emil Kraeplin: unterschied zwei Hauptgruppen von Psychosen: das manisch<br />
depressive Irrsein und die „Dementia praecox“. Zu letzterer zählte er die<br />
Störungsbilder, die heute als schizophren bezeichnet werden: nämlich die<br />
Paranoia, die Katatonie und die Hebephrenie (s.u.). Das gemeinsame Merkmal<br />
dieser heterogenen Störungsbilder sah Kraeplin in einer allgemeinen und im<br />
Unterschied zur Demenz nicht erst im Alter auftretenden „geistigen<br />
Schwäche“. Der Begriff „Dementia praecox“ zielt demnach a) auf den frühen<br />
Beginn der Störung (praecox) und b) auf den fortschreitenden geistigen Verfall<br />
(Demenz)<br />
Ein deskriptives, relativ eng gefasstes Konzept<br />
Eugen Bleuler: fasste dagegen weder das Alter bei Beginn, noch den<br />
progressiven geistigen Verfall als das Charakteristische der Störungen auf,<br />
sondern die mit ihnen einhergehende Zerrissenheit der Assoziationen. Vor<br />
diesem Hintergrund prägte er den Begriff „Schizophrenie“!<br />
Symptomgruppen: Die Symptome der Schizophrenie werden Allgemein in 2<br />
Gruppen eingeteilt: „Positive Symptome“ sind durch eine Übersteigerung des<br />
normalen Erlebens gekennzeichnet; „negative Symptome“ durch dessen<br />
Einschränkung. In jüngerer Zeit wird darüber hinaus eine dritte Gruppe von<br />
Symptomen abgegrenzt, die ihrerseits v.a. durch Desorganisation gekennzeichnet ist.<br />
1) Positive Symptomatik: kennzeichnet i.d.R. einen akuten schizophrenen Schub<br />
Halluzinationen und andere Wahrnehmungsstörungen<br />
Akustische Halluzinationen (sind am häufigsten: bei 70%):<br />
Gedankenlautwerden, kommentierende Stimmen, streitende Stimmen<br />
Außerdem: Optische Hallos (31%), taktile und olfaktorische Hallos<br />
50
Inhaltliche Denkstörungen (=Wahnideen)<br />
Verfolgungswahn (ist am häufigsten: bei 60-70%)<br />
Religiöser Wahn (bei ca. 25%); Größenwahn (22%) etc.<br />
Gedankenlesen (34%): Patient hat das Gefühl, die Gedanken anderer<br />
lesen zu können!<br />
Gedankeneingebung (19%): Patienten haben das Gefühl, nicht die<br />
eigenen Gedanken, sondern die eines anderen zu denken!<br />
Gedankenentzug (17%): Patienten haben das Gefühl, ihre Gedanken<br />
würden aufgesogen.<br />
Gedankenausbreitung (14%): P. haben das Gefühl, ihre Gedanken<br />
würden auf andere übertragen, so dass diese sie lesen können.<br />
„Gemachte“ Körperempfindungen: Patienten haben somatische<br />
Empfindungen (Wärme, Prickeln etc.), die aus ihrer Sicht von einer<br />
äußeren Macht gesteuert werden.<br />
„Gemachte“ Gefühle: Patienten haben das Gefühl, die von ihnen<br />
erlebten Emotionen seien nicht die eigenen, sondern würden ihnen<br />
von anderen eingegeben bzw. aufoktroyiert!<br />
„Gemachte“ Handlungen: Patienten haben das Gefühl, dass ihre<br />
Handlungen ohne ihr willentliches Zutun vonstattengehen.<br />
„Gemachte“ Impulse: Patienten folgen Impulsen, die ihnen von einer<br />
äußeren Macht eingegeben werden („Pinkel aufs Buffet!“)<br />
Formale Denkstörungen<br />
Gelockerte Assoziationen und Entgleisungen (Überflutung mit<br />
vielfältigen Assoziationen; Schwierigkeit, beim Thema zu bleiben)<br />
Unlogisches oder tangentiales Denken<br />
Desorganisierte Sprache (den sprachlichen Äußerungen fehlt nahezu<br />
jeder inhaltliche Zusammenhang) wird heute oft zur dritten<br />
Symptomgruppe („Desorganisation“) gezählt: s.u.<br />
2) Negative Symptomatik: hält auch über eine akute Episode hinaus an;<br />
bestimmt die Residualphase und stellt während der Behandlung ein großes<br />
Problem dar!<br />
Apathie (Antriebs- und Willensschwäche): Patienten fehlt es an Interesse<br />
und Energie (mangelnde Körperpflege, Vernachlässigung der Pflichten,<br />
sozialer Rückzug, chronisches „Nichtstun“ etc.)<br />
Alogie (Sprachverarmung): Patienten reden weniger (quantitative<br />
Sprachverarmung) oder inhaltlich Bedeutungsloses (inhaltliche<br />
Sprachverarmung)<br />
Anhedonie (Unfähigkeit, Freude zu erleben): Mangelndes Interesse an<br />
Freizeitbeschäftigungen, Beziehungen und Sex, wobei sich die Patienten<br />
durchaus bewusst sind, dass das mal anders war!<br />
Affektverflachung (bei 2/3 = 66% der Patienten): Patienten zeigen keine<br />
emotionalen Reaktionen mehr; das betrifft jedoch lediglich den äußeren<br />
Eindruck (eingeschränkte Mimik, verminderte Spontanbewegungen,<br />
tonlose Stimme etc.) und nicht unbedingt das Innenleben!<br />
Mangelnde Aufmerksamkeit<br />
3) Weitere Symptome (oft als „desorganisierte“ Symptomatik bezeichnet):<br />
Katatonie: äußert sich in verschiedenen motorischen Auffälligkeiten; zum<br />
Beispiel dem katatonen Stupor (Körperstarre in ungewöhnlicher Haltung),<br />
Katalepsie (Beibehaltung der Körperstellung nach passiver Bewegung),<br />
einer wächsernen Biegsamkeit der Gliedmaßen, ungewöhnlichen<br />
Bewegungsmustern, Anfällen etc.<br />
51
Inadäquater Affekt (eher selten, aber recht spezifisch für Schizophrenie):<br />
unangemessene emotionale Reaktionen und rascher Wechsel emotionaler<br />
Zustände<br />
Bizarre Verhaltensweisen: P. führen laute Selbstgespräche, hamstern<br />
Lebensmittel, sammeln Müll etc.<br />
[Desorganisierte Sprache]<br />
5.1.3. Tests & Fremdbeurteilungsverfahren zur Diagnose und Verlaufsbeurteilung<br />
PANNS: Die „Positive and Negative Syndrome Scale“ (PANSS) erfasst nicht nur<br />
die Symptome als solche, sondern auch ihre jeweilige Ausprägung! Zur Anwendung<br />
des Tests liegt ein strukturiertes klinisches Interview (SCI-PANNS) vor, das genau<br />
vorgibt, was wann zu fragen ist.<br />
Fragen zur Skala „Wahnideen“ sind z.B.: „Geht es Ihnen gut?“; „Haben sie<br />
eine bestimmte Lebensphilosophie?“ „Manche glauben an den Teufel – Sie<br />
auch?“… Die Fähigkeit zu abstraktem Denken wird untersucht, indem man<br />
die Patienten Sprichwörter interpretieren lässt („Viele Köche verderben den<br />
Brei“ etc.).<br />
Auswertung: Den Angaben zu den verschiedenen Symptomen wird am Ende<br />
jeweils ein Punktwert zw. 1 („nicht vorhanden“) und 7 („extrem vorhanden“)<br />
zugeordnet!<br />
IMPS: Die „Impatient Multidimensional Psychiatric Scale“ (IMPS) ist ein<br />
Fremdbeurteilungsverfahren mit 90 operational definierten Symptomen.<br />
BPRS: Die „Brief Psychiatric Rating Scale” (BPRS) ist ebenfalls ein<br />
Fremdbeurteilungsverfahren und wird v.a. zur Verlaufsbeurteilung eingesetzt; es bietet<br />
einen Leitfaden zur Einschätzung von 18 Symptomen, wobei der Gesamtrohwert das<br />
Ausmaß der Störung wiedergibt!<br />
5.1.3. Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV und der ICD-10<br />
Wichtig: Anders als für andere Störungen gibt es für Schizophrenie kein zentrales<br />
Symptom, das für eine Diagnose vorhanden sein müsste; Ausprägung und Verlauf<br />
einer Schizophrenie können daher sehr heterogen sein. Hinzu kommt eine hohe<br />
Komorbidität mit Suchtmittelabhängigkeiten (50%!) und körperlichen Erkrankungen<br />
(stationär: 46-80%; ambulant: 20-43%!).<br />
Die Differentialdiagnose (s.u.) kann vor diesem Hintergrund äußerst schwierig<br />
sein!<br />
Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV:<br />
A) Mindestens 2 der folgenden 5 Symptome müssen (ohne Behandlung) für<br />
mindestens einen Monat vorhanden sein:<br />
1) Wahn<br />
2) Halluzinationen<br />
3) Desorganisiertes Sprechen (z.B. häufiges Engleisen oder Zerfahrenheit)<br />
4) Grob desorganisiertes oder katatones Verhalten<br />
5) Negative Symptome, d.h. flacher Affekt, Alogie oder Willensschwäche<br />
Beachte: Sind die Hallos Stimmen oder ist der Wahn bizarr, reicht 1 Symptom!<br />
B) Soziale und/oder berufliche Leistungseinbußen<br />
C) Dauer: „Zeichen des Störungsbildes“ für mindestens 6 Monate; zwei der<br />
oben genannten Symptome für mindestens einen Monat (oder weniger, falls<br />
erfolgreich behandelt)<br />
52
Diagnostische Kriterien nach der ICD-10: Schizophrenie (F 20)<br />
Für mindestens einen Monat muss mindestens eins der unter A genannten<br />
oder mindestens 2 der unter B genannten Symptome bestehen:<br />
A) 1. Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung, -entzug oder –ausbreitung<br />
2. Kontroll- oder Beeinflussungswahn; Gefühl des Gemachten;<br />
Wahnwahrnehmungen<br />
3. Kommentierende oder dialogische Stimmen<br />
4. Anhaltender, kulturell unangemessener oder unrealistischer Wahn<br />
B) 1. Halluzinationen<br />
2. Gedankenabreißen oder -einschiebungen<br />
2. Katatone Symptome (s.o.)<br />
3. Negative Symptome (s.o.)<br />
4. Auffällige Verhaltensänderungen (wie sozialer Rückzug, Trägheit etc.)<br />
Folgende Typen der Schizophrenie werden von der ICD-10 und dem DSM-IV<br />
unterschieden:<br />
ICD-10 DSM-IV<br />
F 20.0: Paranoide Schizophrenie = Paranoider Typus<br />
F 20.1: Hebephrene Schizophrenie = Desorganisierter Typus<br />
F 20.2: Katatone Schizophrenie = Katatoner Typus<br />
F 20.3: Undifferenzierte Schizophrenie = Undifferenzierter Typus<br />
F 20.4: Postschizophrene Depression = Residualer Typus<br />
F 20.5: Schizophrenes Residuum<br />
F 20.6: Schizophrenia Simplex<br />
Die 3 Hauptgruppen der Schizophrenie sind die ersten 3; sie treten am häufigsten auf<br />
und wurden bereits von Kraeplin unterschieden.<br />
Die paranoide Schizophrenie: ist am allerhäufigsten; betroffen von ihr sind<br />
v.a. Wahrnehmung und Denken; die typischen Symptome sind Halluzinationen<br />
und Wahnvorstellungen (meist Verfolgungswahn)<br />
Die hebephrene (= „jugendliche“) bzw. desorganisierte Schizophrenie:<br />
beginnt meist in der Adoleszenz (daher der Name); betroffen von ihr sind v.a.<br />
Emotion und Motivation; die typischen Symptome sind inadäquater Affekt,<br />
Albernheit, formale Denkstörungen, Ziel- und Planlosigkeit<br />
Der katatone Schizophrenie: ist eher selten; betroffen von ihr sind<br />
Motivation und Motorik; die typischen Symptome sind Wechsel von Stupor<br />
(Starre) und Erregung; Haltungsanomalien, Gedankenarmut und<br />
Antriebslosigkeit.<br />
Die Schizophrenia simplex: beginnt schleichend (zunehmende<br />
<br />
Verhaltensauffälligkeiten) und äußert sich v.a. in sozialem Rückzug,<br />
Affektverflachung und Antriebslosigkeit.<br />
Die Unterteilung der Schizophrenie in die besagten Untergruppen ist problematisch:<br />
1) Sind die genannten Typen oft zeitlich instabil<br />
2) Sind sie phänomenologisch eher unspezifisch<br />
3) Sind sie nur begrenzt valide (d.h. sie haben kaum prognostischen oder<br />
therapeutischen Wert)<br />
In jüngerer Zeit wird daher zunehmend zw. folgenden Typen unterschieden:<br />
1) Typ I-Schizophrenie: ist gekennzeichnet durch positive Symptome<br />
Prämorbide Anpassung: relativ gut<br />
Reaktion auf herkömmliche Neuroleptika: gut<br />
Endzustand der Störung (Prognose): günstig<br />
Biologische Merkmale: auffällige Neurotransmitteraktivität<br />
53
2) Typ II-Schizophrenie: ist gekennzeichnet durch negative Symptome<br />
Prämorbide Anpassung: relativ schlecht<br />
Reaktion auf herkömmliche Neuroleptika: schlecht<br />
Endzustand der Störung (Prognose): schlecht<br />
Biologische Merkmale: strukturelle Gehirnauffälligkeiten<br />
5.1.4. Differentialdiagnose<br />
Die folgenden organischen bzw. somatischen Krankheitsfaktoren müssen<br />
ausgeschlossen werden:<br />
Delir oder Demenz<br />
Epilepsie (insbes. im Temporallappen)<br />
Tumor (insbes. im Frontal- und Tempoallappen)<br />
Schädel-Hirn-Trauma<br />
ZNS-Infektion (z.B. Neurosyphilis, AIDS etc.)<br />
Chorea Huntington (wird autosomal-dominant vererbt - Nachkommen<br />
homozygoter Träger haben„s also 100%ig - und geht ebenfalls mit motorischen<br />
Störungen, Sprachverarmung, geistigem Verfall etc. einher)<br />
Intoxikationen (z.B. Schwermetallvergiftung)<br />
Substanzinduzierte Psychosen (durch Kokain, Halluzinogene, Alkohol etc.)<br />
…<br />
Darüber hinaus müssen die folgenden psychischen Störungen ausgeschlossen werden:<br />
Schizotypische Störung (F 21) bzw. schizotypische Persönlichkeitsstörung<br />
(Achse II; DSM-IV)<br />
Leichte Form der Schizophrenie (anderer Schweregrad also)<br />
Wahnhafte Störung (F 22)<br />
Ist sehr selten; Patienten leiden unter ständigen Wahnideen<br />
(Verfolgungswahn. Liebeswahn etc.), ihr Wahn ist jedoch weniger bizarr<br />
als der von Schizophrenen und sie weisen im Unterschied zu diesen weder<br />
eine desorganisierte Sprache noch Halluzinationen auf!<br />
Akute, vorübergehende psychotische Störungen (F 23)<br />
Daher die lange Dauer: 6 Monate (s.o.)!<br />
Schizoaffektive Störung (F 25)<br />
besteht aus einer Mischung von Symptomen der Schizophrenie und der<br />
affektiven Störungen<br />
Depressive Episode (Major Depression)<br />
Zwangsstörung<br />
Autismus<br />
Simulation<br />
…<br />
54
5.2. Epidemologie und Verlauf<br />
5.2.1. Epidemologie:<br />
Lebenszeitprävalenz: 1 % (unabhängig von Kultur und Rasse)<br />
Beginn der Störung: 20-25 Jahre (Männer); 25-30 Jahre (Frauen)<br />
Die Krankheit setzt also meist in der späten Adoleszenz bzw. im frühen<br />
Erwachsenenalter an, wobei Männer im Schnitt 3 Jahre früher betroffen sind<br />
als Frauen. Sie kann jedoch auch früher (Kindheit) oder später (bis 40-50)<br />
einsetzen!<br />
Geschlechterverteilung: 1:1<br />
Inzidenzrate pro Jahr: 1/10.000<br />
5.2.2. Verlauf:<br />
Schizophrenie verläuft in den meisten Fällen zyklisch, wobei sich 3 Phasen<br />
voneinander abgrenzen lassen:<br />
1) Prodomalphase<br />
Zeitlich und inhaltlich variabel:<br />
In über 80% der Fälle erhöhte Nervosität und Angespanntheit<br />
Außerdem: Konzentrations- und Schlafstörungen; Depression etc.<br />
Deutliches Absinken des Leistungsniveaus<br />
Sozialer Rückzug<br />
2) Akutphase<br />
Zeitlich variabel (min. ein Monat)<br />
Auftreten der positiven Symptomatik<br />
Meist mangelnde Krankheitseinsicht<br />
3) Residualphase<br />
Variable, meist chronisch bleibende Restsymptomatik; meist negativ<br />
Im Einzelnen ist der Verlauf einer Schizophrenie sehr variabel; in der ICD-10 werden<br />
sechs Verlaufstypen unterschieden (F.20.X0-5):<br />
1. Kontinuierlicher Verlauf: konstantes Vorhandensein der Symptome<br />
2. Episodisch mit zunehmendem Residuum (schubförmig progredient): Die<br />
Symptomatik in den Residualphasen nimmt von Schub zu Schub zu<br />
3. Episodisch mit stabilem Residuum (schubförmig): Zwischen den Schüben<br />
(Akutphasen) liegen gleichbleibende Residualphasen (Restsymptomatik)<br />
4. Episodisch-remittierender (phasenhafter) Verlauf: zwischen den<br />
Krankheitsepisoden liegen Phasen vollständiger Remission<br />
5. Unvollständige Remission<br />
6. Vollständige Remission<br />
Zur Häufigkeit bestimmter Verläufe:<br />
5-Jahres-Studie:<br />
Einzelne Episode mit vollständiger Remission: 22%<br />
Mehrere Episoden; Remission vollständig oder teilweise: 35%<br />
Kontinuierlicher Verlauf: 8%<br />
Episodisch-progredienter Verlauf: 35%<br />
Langzeitkatamnese:<br />
25% „geheilt“; 45% leichte bis mittelschwere Residualzustände; 30 %<br />
dauernde schwere Invalidisierung<br />
Lebenserwartung 10 Jahre geringer als bei der Allgemeinbevölkerung; 10<br />
Mal so hohe Suizidrate (10%)<br />
55
Die Vermont-Längsschnittstudie (1987) untersuchte die Lebensbedingungen<br />
von 168 Patienten 32 Jahre nach der ersten Klinikbehandlung<br />
50% in eigener Wohnung; 40% im Wohnheim; 10% stationär; nur 19%<br />
verheiratet; der Rest: ledig, geschieden oder verwitwet; nur 40% mit Job<br />
(meist ungelernt); nur 55% keine oder nur leichte Beeinträchtigungen!<br />
Prognose:<br />
Prädiktoren für einen günstigen Verlauf sind:<br />
Unauffällige Primärpersönlichkeit<br />
Höheres Ausbildungsniveau<br />
Bessere soziale Anpassung<br />
Ungestörte Familienverhältnisse (bei Frauen)<br />
Akuter Krankheitsbeginn (ohne Promodalphase)<br />
Erkennbare psychosoziale Auslösefaktoren<br />
Vermehrt affektive oder paranoide Symptome<br />
Prädiktoren für einen ungünstigen Verlauf sind:<br />
Soziale Isolation<br />
Späte Behandlung<br />
Unverheiratet<br />
Vorangegangene psychiatrische Behandlung<br />
Frühere Verhaltensauffälligkeiten<br />
Fehlende Beschäftigung<br />
5.3. Biologische Ätiologiefaktoren<br />
5.3.1. Genetische und psychophysiologische Faktoren<br />
Mehrere Studien belegen, dass es eine Prädisposition für Schizophrenie gibt, die<br />
genetisch weitergegeben wird:<br />
Während die Lebenszeitprävalenz in der Normalpopulation bei einem Prozent<br />
liegt (s.o.), liegt sie bei eineiigen Zwillingen (von denen ein Geschwisterteil<br />
erkrankt ist) bei knapp 50%, bei zweieiigen Zwillingen bei 17%!<br />
Adoptionsstudien zeigen ferner, dass auch Kinder, die nicht bei ihrer<br />
pathogenen Mutter aufwachsen (Umwelteinfluss), ein erhöhtes<br />
Erkrankungsrisiko haben.<br />
Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass die Negativsyptomatik (Typ II) stärker<br />
von genetischen Faktoren abhängt als die Positivsymptomatik (Typ II)<br />
Ein genetischer Marker für Schizophrenie könnte die Fähigkeit zu<br />
Augenfolgebewegungen sein. Letztere ist bei Schizophrenen und 50% ihrer<br />
Angehörigen beeinträchtigt. Messen lässt sie sich, indem man Pbn ein Pendel<br />
beobachten lässt und dabei mittels Elektrookulographie (EOG) die Augenbewegungen<br />
(glatte Folgebewegungen und Antisakkaden) misst.<br />
Ein genetischer Marker sind DNA-Abschnitte deren Ort bekannt ist und mit<br />
deren Hilfe sich weitere Genorte entdecken lassen; die Fähigkeit, bewegten<br />
Objekten mit den Augen zu folgen, wird auf Chromosom 6 vermutet;<br />
neurologisch hängt sie v.a. mit dem Frontal- und Temporallappen zusammen;<br />
also Arealen, die bei der Schizophrenie oft geschädigt sind (s.u.)<br />
56
Einschub: Das dopaminerge System<br />
Dopamin (DA) gehört zusammen mit Adrenalin und Noradrenalin zur Gruppe der<br />
Katecholamine; der Hauptbildungsort von Dopamin ist die „Substantia nigra“ (ein<br />
Nervenkern im Mesencephalon)<br />
Die Synthese erfolgt in mehreren Schritten mittels verschiedener Enzyme:<br />
L-Phenyalanin L-Tyrosin L-Dopa Dopamin Noradrenalin Adrenalin<br />
Der Dopaminabbau erfolgt über die Enzyme MAO (Monoaminooxidase) und COMT<br />
(Catechyl-O-Methyltransferase) zu Homovanillinsäure (HNA)<br />
Es lassen sich 5 Rezeptortypen unterscheiden: D1-D5; bei allen 5 handelt es sich um<br />
metabotrope Rezeptoren (indirektes Gating)<br />
Der D2-Rezeptor dient häufig als Autorezeptor in der präsynaptischen Membran<br />
und hemmt dort die Wiederaufnahme des ausgeschütteten Dopamins (?!).<br />
4 dopaminerge Systeme lassen sich unterscheiden:<br />
1) Mesostriatales System: Motorik<br />
Von der Substantia nigra aus wird das inhibitorisch auf Bewegungsimpulse wirkende<br />
Striatum (Teil der Basalganglien) mittels Dopamin gehemmt.<br />
Erhöhte Verfügbarkeit von DA im mesostriatalen System: Hyperaktivität und<br />
Verhaltensstereotypien<br />
Verminderte Verfügbarkeit: Parkinson-Symptomatik (Parkinson =><br />
Untergang der dopaminergen Neurone in der Substantia nigra)<br />
2) Mesolimbisches System: Motivation und Verstärkung<br />
Vom ventralen Tegmentum (VTA) zum Nucleus accumbens, zur Amygdala, dem<br />
Hypothalamus und dem Hippocampus<br />
Erhöhte DA-Konzentration im mesolimbischen System: gesteigerte<br />
Nahrungsappetenz und Sexualität; positive Symptomatik der Schizophrenie<br />
(Halluzinationen etc.)<br />
3) Mesokortikales System:<br />
Vom ventralen Tegmentum zum Neocortex, v.a. zu präfrontalen Gebieten<br />
Unteraktivität der mesokortikalen Bahn: Negativsymptomatik der<br />
Schizophrenie (Denkstörungen; Verflachung der Affekte etc.)<br />
4) Tuberohypophysäres System: Hormonsteuerung<br />
Vom Hypothalamus zum Hypophysenhinterlappen<br />
5.3.2. Biochemische Faktoren<br />
Die Dopamin-Hypothese: führt Schizophrenie auf einen Überschuss an Dopamin<br />
zurück! Sie stützt sich dabei v.a. auf folgende Befunde:<br />
1) Die Wirkung von Neuroleptika: Neuroleptika (s.u.) hemmen die dopaminerge<br />
Aktivität und führen (dadurch?) zu einer Linderung der schizophrenen<br />
Symptome!<br />
2) Die Nebenwirklungen von Neuroleptika: erinnern an die Parkinson-Krankheit<br />
(Muskelstarre; Muskelzittern= Tremor etc.), die ihrerseits durch einen Mangel an<br />
Dopamin bedingt ist (Untergang der dopaminergen Zellen in der Substania<br />
nigra).<br />
Zur Behandlung von Parkinson wird L-Dopa verabreicht, das seinerseits<br />
psychose-induzierend wirken kann!<br />
3) Die psychose-induzierende Wirkung von Drogen: Amphetamine können einen<br />
Zustand erzeugen, der dem der paranoiden Schizophrenie sehr ähnlich ist<br />
(Paranoia, Hallos etc.); zurückzuführen ist diese Wirkung auf eine Erhöhung der<br />
Dopamin-Ausschüttung!<br />
57
Probleme der klassischen Dopamin Hypothese und neuere Modifikationen:<br />
Anders als die klassische Dopamin-Hypothese vermuten ließe, liegt der<br />
Hauptmetabolit von Dopamin, die Homovanillinsäure (HVA), bei<br />
Schizophreniepatienten nicht in erhöhter Konzentration vor! Ergo: Bei<br />
Schizophreniepatienten sind vermutlich nicht die Dopamin-freisetzenden<br />
Neurone überaktiv, sondern die Dopamin-Rezeptoren.<br />
Tatsächlich wurde bei Schizophrenen post mortem eine erhöhte Anzahl<br />
von Dopamin-Rezeptoren, v.a. vom D2-Subtyp, gefunden (dieser Befund<br />
lässt sich allerdings auch auf die medikamentöse Behandlung der<br />
betreffenden Patienten zurückführen)<br />
Die negative Symptomatik kann durch Neuroleptika kaum verbessert werden!<br />
Amphetamine führen keineswegs bei allen Patienten zu einer Symptom-<br />
Verschlechterung; bei manchen (nämlich denen mit überwiegend negativer<br />
Symptomatik) bewirken sie sogar eine Besserung! Neuere Ansätze ordnen die<br />
positive- und negative Symptomatik daher je unterschiedlichen Dopamin-<br />
Systemen zu. Die positive Symptomatik wird auf eine Überaktivität der<br />
mesolimbischen Nervenbahnen, die negative auf eine Unteraktivität der<br />
mesokortikalen Nervenbahnen zurückgeführt.<br />
Sowohl die mesolimbischen, als auch die mesokortikalen Nervenbahnen<br />
(s.o.) beginnen im ventralen Tegmentum (Teil des Mesencephalons).<br />
Während letztere von dort zum präfrontalen Kortex verlaufen, führen<br />
erstere jedoch zum Hypothalamus, der Amygdala, dem Hippocampus und<br />
dem Nucleus accumbens (=Belohnungs- und Verstärkungszentrum).<br />
Da präfrontaler Kortex und limbisches System ihrerseits wiederum durch<br />
dopaminerge Nervenbahnen verbunden sind, sind die beiden Systeme<br />
jedoch nicht unabhängig voneinander! Die Dopamin-Neuronen im<br />
präfrontalen Kortex wirken z.B. hemmend auf die Dopaminneuronen im<br />
limbischen Bereich!<br />
Zusammenfassung des Modells:<br />
Verletzung des PFC<br />
Geringe Aktivität der<br />
Dopaminneuronen im PFC<br />
Geringere Hemmung der mesolimbischen<br />
DA-Neuronen<br />
Negative Symptome der<br />
Schizophrenie<br />
Positive Symptome der<br />
Schizophrenie<br />
Bewertung der biochemischen Befunde: Auch die neuere Dopamin-Theorie vermag<br />
Schizophrenie letztlich nicht befriedigend zu erklären; darüber hinaus gilt sie<br />
vermutlich ohnehin nur für Typ II-Schizophrenien.<br />
Folgende Probleme sind nach wie vor ungeklärt:<br />
Allgemeine methodische Probleme: Die therapeutische Wirksamkeit von<br />
Medikamenten ist kein Beweis, da der Einfluss von Drittvariablen nicht<br />
ausgeschlossen werden kann! Darüber hinaus kann die dopaminerge<br />
Überaktivität bei Schizophrenen auch auf andere Faktoren, wie z.B. deren<br />
übermäßigen Substanzmissbrauch (Alkohol, Kaffee etc.), die Ernährung<br />
oder mangelnde körperliche Aktivität zurückgehen.<br />
58
Neuroleptika blockieren die Dopaminrezeptoren schon kurz nach der<br />
Einnahme; ihre therapeutische Wirkung tritt jedoch erst nach Tagen oder<br />
Wochen auf!<br />
Möglicher Weise wirkt die Blockade der D2-Rezeptoren nicht als<br />
solche therapeutisch, sondern lediglich indirekt, indem sie<br />
Auswirkungen auf andere Gehirnregionen und Transmittersysteme<br />
hat!<br />
Rätselhaft ist auch, warum Neuroleptika den Dopaminspiegel bzw. die<br />
Aktivität der Dopaminrezeptoren unter das normale Niveau senken<br />
müssen, um therapeutisch wirksam zu sein! – Der Theorie zufolge müsste<br />
ein normales Niveau ausreichend sein!<br />
Es ist wenig wahrscheinlich, dass nur ein einziger Transmitter für die<br />
vielen versch. Symptome einer Schizophrenie verantwortlich sein soll!<br />
Atypische Neuroleptika (s.u.) wirken, obwohl sie die D2-Rezeptoren nur<br />
schwach blockieren.<br />
Fazit: Vermutlich sind mehrere Transmittersysteme an der Genese einer<br />
Schizophrenie beteiligt, so dass die dopaminergen Systeme lediglich einen<br />
modulierenden Teil der Krankheit darstellen.<br />
Vermehrt untersucht werden in jüngerer Zeit u.a. die Bedeutung von<br />
Serotonin und Glutamat (das bei Schizophrenen in niedrigerer<br />
Konzentration vorhanden ist als bei „normalen“ Pbn)<br />
5.3.3. Neuroanatomische und neuropsychologische Faktoren<br />
Post-Mortem-, CT- und MRT-Untersuchungen haben folgende strukturellen<br />
Auffälligkeiten zu Tage gebracht:<br />
Erweiterte Ventrikel: Schizophrene Patienten haben oftmals erweiterte<br />
Ventrikel – und damit weniger subkortikale Gehirnzellen (betrifft v.a. den<br />
frontalen und temporalen Bereich).<br />
Studie: 12 von 15 eineiigen Zwillingen, die hinsichtlich der Schizophrenie<br />
diskordant waren, konnten anhand dieses Merkmals voneinander<br />
unterschieden werden. Aus dieser Studie folgt zweierlei: 1. Besteht<br />
zwischen der Erweiterung der Ventrikel und Schizophrenie ein<br />
Zusammenhang. 2. Kann die Erweiterung der Ventrikel nicht bzw. nicht<br />
nur genetisch bedingt sein.<br />
Auch wenn die Erweiterung der Ventrikel zu den am häufigsten<br />
nachgewiesenen Befunden zählt, ist sie weder notwendig, noch spezifisch<br />
für eine Schizophrenie. Nicht alle Schizophrenen haben also erweiterte<br />
Ventrikel und nicht alle, die erweiterte Ventrikel haben, sind schizophren<br />
(eine Erweiterung findet sich auch oft bei anderen Psychosen, wie z.B. der<br />
Manie)<br />
Hypofrontalität und präfrontale Athrophie (Gewebeschwund):<br />
Verschiedene Befunde sprechen dafür, dass Schizophrenie mit einer<br />
Unteraktivierung und/oder mangelnden Ausprägung des präfrontalen Kortex<br />
einhergeht.<br />
Der PFC ist u.a. bedeutsam für eine adäquate Handlungsplanung und<br />
-steuerung und die Regulation von Emotionen. Beide Funktionsbereiche<br />
sind bei Schizophrenen massiv beeinträchtigt!<br />
MRT-Untersuchungen an Schizophrenen weisen auf eine Abnahme der<br />
grauen Substanz im präfrontalen Kortex hin.<br />
Funktionale bildgebende Verfahren (fMRT etc.) zeigen, dass im PFC von<br />
Schizophrenen eine geringere Stoffwechselaktivität und Durchblutung<br />
59
stattfindet – und zwar auch dann, wenn die Pbn psychologische Aufgaben<br />
bearbeiten, deren Bearbeitung bei gesunden Pbn zu einer<br />
Aktivitätssteigerung im PFC führt.<br />
Beispiel: Der „Wisconsin Cart Sorting Test“ (WCST) erfasst<br />
kognitive Flexibilität; Aufgabe ist es, Karten mit unterschiedlichen<br />
Farben, Symbolen und Zahlen nach wechselnden Regeln zu ordnen<br />
(entweder nach Farbe, Symbol oder Zahl); Schizophrene schneiden<br />
bei dieser Aufgabe nicht nur wesentlich schlechter ab, sondern weisen<br />
bei der Bearbeitung weniger Stoffwechselaktivität im PFC auf!<br />
Hippocampus-Veränderungen: Der Hippocampus ist paarig angelegt und<br />
liegt im medialen Temporallappen; seine Hauptfunktion besteht in der<br />
Konsolidierung und Koordinierung von Gedächtnisinhalten.<br />
Bei schizophrenen Patienten ist der anteriore (vordere) Hippocampus oft<br />
verkleinert; darüber hinaus weist er vielfach eine andere Zytoarchitektur<br />
auf: die in ihm enthaltenen Neuronen (in 3 Schichten von CA1- CA3) sind<br />
bei Schizophrenen nämlich oftmals nicht in eine Richtung ausgerichtet,<br />
sondern desorganisiert!<br />
Den neuroanatomischen Defiziten entsprechen verschiedene neuropsychologische<br />
Mängel: Die meisten Schizophrenen (80%) zeigen deutliche<br />
Aufmerksamkeits-, Arbeitsgedächtnis-, Wortflüssigkeits-, Handlungskontroll- und<br />
Intelligenzdefizite! Die Aufmerksamkeitsdefizite von Schizophrenen äußern sich in<br />
einer erhöhten Ablenkbarkeit durch irrelevante Reize; letztere ist vermutlich auf eine<br />
gestörte Reizselektion (sprich: einen defekten Aufmerksamkeitsfilter)<br />
zurückzuführen.<br />
Bei Tests zur Gedächtnisspanne mit ablenkenden Reizen schneiden<br />
Schizophrene schlechter ab als Gesunde; ihre Defizite hängen dabei v.a. mit<br />
dem ausbleibenden Primacy-Effekt zusammen.<br />
Ausbleibender Primacy-Effekt => Gestörter Enkodierungsprozess<br />
Auch beim „Continous Performance Test“ (CPT), der zur Testung der<br />
selektiven Aufmerksamkeit und der Daueraufmerksamkeit dient, sind<br />
Schizophrene schlechter. Die Pbn bekommen beim CPT über längere Zeit<br />
verschiedene Buchstaben dargeboten und sollen, immer wenn auf ein „O“ ein<br />
„X“ folgt, mit einem Tastendruck reagieren (s.u.).<br />
Die sog. „Prepulse Inhibition“ (PPI) fällt bei Schizophrenen deutlich geringer<br />
oder sogar ganz aus; man versteht darunter das Phänomen, dass die Startle-<br />
Reaktion auf einen Reiz (lauter Ton, Berührung etc.) geringer ausfällt, wenn<br />
diesem Reiz ein anderer Reiz (prepulse) unmittelbar vorangeht. Erklärung: Der<br />
erste Reiz (prepulse) muss erst fertig verarbeitet werden, bevor man sich ganz<br />
einem zweiten Reiz widmen kann (Schutz für Reizüberflutung = „sensory<br />
gating“).<br />
Dass die PPI bei Schizophrenen geringer ist, deutet auf eine gestörte<br />
Informationsverarbeitung hin: Jeder Reiz scheint als neu und bedeutsam<br />
erachtet zu werden.<br />
Nebenbemerkung: Bei Rauchern ist die PPI am höchsten; vielleicht<br />
rauchen auch deshalb so viele Schizophrene (zu Selbstheilungszwecken!)<br />
50% der Schizophrenen (v.a. die mit negativer Symptomatik) zeigen auf<br />
harmlose Töne normaler Lautstärke keine elektrodermale<br />
Orientierungsreaktion (kurzfristige Erhöhung der Hautleitfähigkeit?).<br />
Die Orientierungsreaktion tritt normalerweise bei neuen Reizen geringer<br />
physikalischer Intensität auf; sie dient der Aufmerksamkeitsausrichtung<br />
und äußert sich u.a. in einem kurzfristigen Absinken der Herzrate.<br />
60
Schizophrene begehen beim dichotischen Hörtest mehr Fehler, aber eher, weil<br />
sie relevante Reize einfach nicht beachten oder vergessen – und nicht so sehr,<br />
weil sie sich von der 2. Tonspur ablenken lassen.<br />
Schlussfolgerungen:<br />
Die genannten Befunde legen nahe, dass eine anticholinerge Medikation<br />
(wie sie gegen motorische Nebenwirkungen häufig eingesetzt wird) evtl.<br />
problematisch ist (schließlich spielt ACh auch für<br />
Aufmerksamkeitsprozesse eine entscheidende Rolle)<br />
Wie die Aufmerksamkeitsdefizite mit der sonstigen Symptomatik<br />
zusammenhängen, ist noch nicht wirklich geklärt. Es liegt jedoch nahe, sie<br />
zu den formalen Denk- und Sprachstörungen in Bezug zu setzen.<br />
5.3.4. Sonstige biologische Faktoren<br />
Geburtskomplikationen: Bei Personen, die später schizophren werden, sind<br />
besonders häufig Geburtskomplikationen aufgetreten (Frühgeburt, vermindertes<br />
Geburtsgewicht, Sauerstoffunterversorgung etc.); darüber hinaus scheinen<br />
<br />
Infektionen während der Schwangerschaft (v.a. im 3-7 Monat => Entwicklung des<br />
Kortex) das Risiko für Schizophrenie zu erhöhen.<br />
Die meisten schizophrenen Patienten sind in den Wintermonaten (November,<br />
Dezember) geboren (Temperaturminderung; Infektionen; Medikamenteneinnahme<br />
etc. werden als mögliche Moderatoren diskutiert)<br />
Nach Influenza- und Grippeepidemien treten schizophrene Erkrankungen<br />
häufiger auf (dieser Effekt wird jedoch nicht in allen Studien gefunden)<br />
Problem und Lösung: Warum brechen Schizophrenien, wenn die sie<br />
bedingenden Gehirnläsionen schon während der Schwangerschaft oder bei der<br />
Geburt erfolgen, dann erst im frühen Erwachsenenalter aus? - Weil der<br />
präfrontale Kortex erst in der Adoleszenz voll ausreift und vorher noch nicht<br />
die entscheidende Rolle spielt, die er danach inne hat!<br />
Um mögliche Vulnerabilitätsfaktoren einer Krankheit zu ermitteln, lassen sich<br />
folgende Arten von Studien durchführen:<br />
1) Prospektive High-risk-Studien: untersuchen die Entwicklung von Kindern<br />
und Jugendlichen mit hohem Risiko (schizophrene Mutter); die bisher<br />
wichtigsten Ergebnisse solcher Studien:<br />
Pbn, die später tatsächlich erkranken, weisen oft eine verzögerte<br />
motorische Entwicklung und einen geringeren IQ auf; sie erbringen<br />
schlechtere Schulleistungen und werden eher als schwierig empfunden.<br />
Darüber hinaus sind bei ihrer Geburt häufiger Komplikationen aufgetreten<br />
(s.o.) als bei den Kontrollpersonen und denen, die nicht erkranken!<br />
Die Wahrscheinlichkeit einer negativen Symptomatik wird erhöht<br />
durch:<br />
Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen<br />
Elektrodermale Non-Responsivität (s.o.: Orientierungsreaktion)<br />
Die Wahrscheinlichkeit einer positiven Symptomatik wird erhöht durch:<br />
Unstabile Familienverhältnisse (Trennung der Eltern…)<br />
Vorübergehender Heimunterbringung<br />
2) Retrospektive Studien (Follow-back-Studien): rekonstruieren nachträglich<br />
die Entwicklungsgeschichte von Schizophrenen (methodisch problematisch)<br />
Mehr Schuleinträge; stärkerer sozialer Rückzug; schlechtere Noten<br />
Analysen von Familienvideos zeigen, dass Schizophrene schon als Kinder<br />
weniger positive Emotionen zeigten und in der motorischen Entwicklung<br />
hinter normalen Kindern (z.B. ihren Geschwistern) zurück waren.<br />
61
3) Kohorten-Studien: untersuchen gesamte Geburtskohorten über lange<br />
Zeiträume, so z.B. in England geschehen (5000 Vpn über 30 Jahre; 30 davon<br />
wurden schizophren)<br />
5.4. Soziale und psychologische Ätiologiefaktoren<br />
5.4.1. Labelling-Ansatz<br />
Der Labelling- bzw. Etikettierungsansatz (in den 60ern entstanden) geht davon aus,<br />
dass psychische Störungen die Folge gesellschaftlicher Stigmatisierungen sind.<br />
Menschen sind demnach nicht von sich aus „abnorm“, sondern werden erst durch die<br />
Gesellschaft in diese Rolle gezwängt; nur, wer von der Mehrheit als „gestört“<br />
angesehen- und entsprechend behandelt wird, entwickelt tatsächlich eine bleibende<br />
„Störung“!<br />
Rosenhan-Experiment (1972): Rosenhan schickte 8 normale Personen an<br />
verschiedene Kliniken, um sich dort als „Patienten“ auszugeben und über<br />
akustische Halluzinationen zu klagen: Die betreffenden Personen wurden in<br />
fast allen Fällen eingewiesen und erst nach 19 Tagen (in einem Fall sogar 59<br />
Tagen!) wieder entlassen. Obwohl sie sich nach dem Diagnosegespräch wieder<br />
völlig normal verhielten, wurde (außer von einigen Mitpatienten!) von<br />
niemandem bemerkt, dass sie gesund waren!<br />
Während des Klinikaufenthalts protokollierten die „Pseudopatienten“<br />
genauestens, wie mit ihnen umgegangen wurde: Ihre Fragen wurden nicht<br />
ernst genommen, es wurden keine ernsthaften Gespräche geführt etc. etc.<br />
Kritik: Es gibt außer dem Rosenhan-Experiment kaum empirische Befunde, die den<br />
Labelling-Ansatz stützen könnten, dafür aber eine Vielzahl von Befunden, die gegen<br />
ihn sprechen.<br />
1) Gibt es keine gesellschaftspezifischen Unterschiede, was die Häufigkeit von<br />
Schizophrenie betrifft<br />
2) Bestehen, was die Zeit vor und nach einem Klinikaufenthalt betrifft, i.d.R. keine<br />
Unterschiede in sozialen Variablen wie dem Beruf oder Beziehungen; sprich:<br />
die Patienten sind nachher nicht weniger angepasst als vorher!<br />
5.4.2. Sozioökonomischer Status<br />
Die Schizophrenierate ist in den untersten Sozial-Schichten (sprich: in Slums und<br />
Arbeitervierteln) am höchsten!<br />
Dazu gibt es 2 Erklärungen:<br />
1) Soziogenetische Hypothese („social stress“): Das Leben unter den<br />
schlechten Bedingungen ist eine Ursache der Krankheit (mehr Stress, mehr<br />
kritische Life-Events, schlechtere Ernährung, schlechtere medizinische<br />
Versorgung, weniger Bildung etc.)<br />
2) Social-Drift Hypothese („social selection“): Nicht die soziale Schicht<br />
bedingt die Krankheit, sondern die Krankheit die soziale Schicht. Schon<br />
im Vorfeld der akuten Krankheit driften Schizophrene aufgrund der<br />
Symptomatik der Promodalphase (Antriebslosigkeit, sozialer Rückzug<br />
etc.) in die unterste Schicht ab.<br />
Die empirischen Daten sprechen eher für die Social-Drift Hypothese (man<br />
braucht sich dazu nur die Herkunftsfamilien der Schizophrenen anzuschauen,<br />
die in den meisten Fällen einen besseren sozioökonomischen Status innehaben)<br />
62
5.4.3. Familiäre Interaktion<br />
Familientherapeutische Ansätze führen Schizophrenien auf eine gestörte familiäre<br />
Interaktion zurück.<br />
Bateson, Watzlawick & Co (1956): stellten in diesem Zusammenhang die<br />
Theorie der „Doppelbindung“ („Double bind“) auf; sie verstehen darunter<br />
paradoxe Botschaften, auf die nicht adäquat reagiert werden kann; also z.B.<br />
wenn Mama mit Tränen in den Augen und zittriger Stimme (nonverbale<br />
Ebene) meint: „Nein, nein, du brauchst dir keine Sorgen machen; mir geht’s<br />
wunderbar!“<br />
Die These: Werden Kinder von ihren Bezugspersonen gehäuft mit<br />
derartigen Double-Bind-Botschaften konfrontiert, entwickeln sie im<br />
Extremfall eine Schizophrenie; sie verlieren jedwedes Gespür für<br />
zwischenmenschliche Kommunikation!<br />
Singer et al. (1975): sprechen von „kommunikativer Abweichung“<br />
(„communication deviance“); ihre These ist jedoch letztlich dieselbe:<br />
Schizophrenien sind auf gestörte Kommunikationsformen in der<br />
Herkunftsfamilie zurückzuführen.<br />
Kritik:<br />
Die Gültigkeit der beiden genannten Ansätze ist empirisch nicht belegt!<br />
Auch wenn gestörte Kommunikationsmuster einen Risikofaktor darstellen<br />
sollten, ist dieser wohl kaum schizophreniespezifisch!<br />
5.4.4. Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell (VSM) und Expressed Emotion (EE)<br />
Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell (von Liberman) geht von einer starken genetischen<br />
Komponente aus, betont aber, dass dispositionelle Vulnerabilitätsfaktoren nur im<br />
Zusammenspiel mit Umweltfaktoren zu einer Schizophrenie führen!<br />
Zu berücksichtigen sind dementsprechend nicht nur biologische, sondern auch<br />
psychosoziale und familiäre Faktoren!<br />
Ein zentraler Forschungszweig innerhalb des Vulnetabilitäts-Stress-Modells<br />
beschäftigt sich dementsprechend mit dem Einfluss, den die nächsten Angehörigen<br />
schizophrener Patienten auf deren Krankheitsverlauf haben.<br />
Als die entscheidende Variable wird dabei die „Expressed Emotion“ (EE) der<br />
Familie angesehen; die EE (~emotionales Klima) äußert sich in<br />
offener/verdeckter Feindseligkeit gegenüber dem kranken Familienmitglied<br />
(kritische Bemerkungen etc.) und/oder in emotionalem Überengagement<br />
(Überbehütung); ist sie hoch, besteht ein hohes Rückfallrisiko (ca. 50% nach 9-<br />
12 Monaten), ist sie niedrig, eher nicht (rund 20%!).<br />
Das „Camberwell Family Interview“ ist ein halbstandardisiertes Interview<br />
zur Erfassung des emotionalen Klimas in Familien psychisch kranker<br />
Menschen; es zielt dabei speziell auf die Messung der „Expressed Emotion“.<br />
Zu diesem Zweck werden die erhobenen Aussagen von ausgebildeten<br />
Ratern anhand von 4 Skalen beurteilt:<br />
a) Kritik (Ausdruck von Missbilligung, Ärger, Abneigung,… gegenüber<br />
dem Patienten)<br />
b) Feindseligkeit (Wird der Patient aufgrund überdauernder<br />
Persönlichkeitsmerkmale oder wegen umschriebener Verhaltensweisen<br />
missbilligt?)<br />
c) Emotionales Überengagement (extreme Sorgen um den Patienten,<br />
Aufopferung für den Patienten; übertriebene Fürsorglichkeit etc.)<br />
d) Wärme (Sympathie, Sorge,…)<br />
63
Das CFI wird im klinischen Alltag bedauerlicherweise kaum eingesetzt, da<br />
zu zeitaufwendig (1-2 h) und kaum relevant für die<br />
Indikationsentscheidung!<br />
Weitere Ergebnisse zur EE:<br />
Der kausale Zusammenhang zw. EE und Krankheitsverlauf ist vermutlich<br />
bidirektional: Neuere Studien zeigen z.B., dass kritische Bemerkungen in<br />
Familien mit hoher EE durch bizarre Äußerungen des Patienten verstärkt<br />
werden, so wie umgekehrt, Patienten, die von ihrer Familie viel kritisiert<br />
werden, mehr bizarre Gedanken äußern!<br />
Der Zusammenhang von EE und Krankheitsverlauf ist nicht spezifisch für<br />
Schizophrenie, sondern findet sich auch bei anderen Störungen wie der<br />
Depression oder bipolaren Störungen!<br />
Das Ausmaß der EE ist kulturabhängig: In Indien z.B. ist der Anteil an<br />
Familien mit „high EE“ wesentlich geringer (22%) als im<br />
angloamerikanischen Raum (knapp 70%)!<br />
EE bzw. Stress allgemein wirkt vermutlich über die Hypothalamus-<br />
Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (s.u.)<br />
Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA): Stress<br />
aktiviert die HPA, die ihrerseits in einem bidirektionalen Zusammenhang zur<br />
dopaminergen Aktivität steht!<br />
Stress (etwa durch eine hohe EE) aktiviert die HPA und führt dadurch zur<br />
Sekretion von Kortisol. Kortisol wiederum erhöht die Dopaminaktivität und<br />
kann dadurch die Schizophreniesymptome verstärken. Darüber hinaus steigert<br />
eine erhöhte Dopaminaktivität die Aktivierung der HPA, was die Betroffenen<br />
besonders stressempfindlich macht!<br />
Stress (EE etc.) HPA Kortisol Dopaminaktivität<br />
Positive Rückkopplung<br />
Darüber hinaus führt Stress zu verstärktem Substanzmissbrauch; Drogen<br />
wiederum stimulieren die Dopaminsysteme (=> positive Symptomatik)<br />
Zusammenfassung: Robuste (in mehreren Studien nachgewiesene) Prädiktoren für<br />
den Verlauf einer Schizophrenie sind:<br />
Soziodemographische und familienbezogene Daten<br />
Gute Prognose: verheiratet, niedrige EE<br />
Schlechte Prognose: ledig/geschieden/getrennt; hohe EE<br />
Prämorbide Persönlichkeit und Anpassung<br />
Gute Prognose: gute Anpassung im Arbeits- und Freizeitbereich;<br />
extrovertierte oder zyklothyme Persönlichkeit<br />
Schlechte Prognose: Soziale Isolation<br />
Vorausgegangene Krankheitsepisoden<br />
Gute Prognose: seltener und von kürzerer Dauer<br />
Schlechte Prognose: häufiger und von längerer Dauer<br />
Art des Krankheitsbeginns<br />
Gute Prognose: akut<br />
Schlechte Prognose: schleichend; Negativsymptomatik<br />
64
5.5. Behandlung<br />
5.5.1. Medikamentöse Behandlung<br />
Neuroleptika (auch „Antipsychotika“ genannt) haben eine antipsychotische und<br />
sedierende Wirkung; sie sind daher bei der Behandlung von Schizophrenien und<br />
anderen psychotischen Störungen unverzichtbar!<br />
Neuroleptika werden sowohl zur Akutbehandlung, als auch zur<br />
Rückfallprophylaxe eingesetzt.<br />
Der biochemische Wirkmechanismus von Neuroleptika ist hochkomplex und<br />
noch immer nicht bis ins Letzte geklärt:<br />
Gemeinsam ist allen Neuroleptika ihre hemmende Wirkung auf die<br />
dopaminerge Übertragung; erreicht wird diese durch die antagonistische<br />
Besetzung der Dopaminrezeptoren; für die antipsychotische Wirkung ist<br />
dabei insbes. die Blockade der D2-Rezeptoren bedeutsam.<br />
Neuroleptika interagieren aber auch mit anderen Transmittersystemen:<br />
Rezeptoren für Serotonin (insbes. 5-HT2A), Acetylcholin (meist α1),<br />
Histamin und Noradrenalin z.B. werden von ihnen, wenn auch in<br />
geringerem Maße, teilweise ebenfalls blockiert!<br />
Neuroleptika haben eine Vielzahl von Nebenwirkungen – besonders ins<br />
Gewicht fallen dabei die extrapyramidal-motorischen Nebenwirkungen (s.u.),<br />
die sich folgendermaßen erklären lassen:<br />
Blockiert werden nicht nur die Dopaminrezeptoren des mesolimbischen<br />
und mesokortikalen Systems (schizophrene Symptomatik), sondern auch<br />
die des mesostriatalen Systems (Motorik) Parkinson-Symptomatik<br />
Wechselwirkung mit anderen Transmittersystemen, insbes. Verminderung<br />
der ACh-Aktivität im Striatum (die für die Motorik überaus wichtig ist)<br />
Je nachdem, ob die antipsychotische oder die sedierende Wirkung im<br />
Vordergrund steht (wovon zumindest bei den typischen Neuroleptika das<br />
Ausmaß der motorischen Nebenwirkungen abhängt), wird zwischen hoch-,<br />
mittel- und niedrigpotenten Neuroleptika unterschieden.<br />
Bei ersteren (z.B. bei Haloperidol) sind die antipsychotische Wirkung und<br />
damit die motorischen Nebenwirkungen im Verhältnis zur sedierenden<br />
Wirkung hoch, bei den niedrig-potenten Neuroleptika ist es umgekehrt!<br />
Alle Neuroleptika wirken symptomatisch; d.h. sie führen zu keiner Heilung im<br />
eigentlichen Sinne, sondern bekämpfen lediglich die Symptomatik!<br />
Zumindest die klassischen bzw. typischen Neuroleptika haben dabei kaum<br />
lindernde Wirkung auf die Negativsymptomatik, sondern können diese im<br />
schlimmsten Fall sogar noch verschlimmern!<br />
Neuroleptika bewirken keine Bewusstseinsveränderung und führen nicht zu<br />
Toleranzentwicklung und Gewöhnung!<br />
Geschichtliches:<br />
Früher (1. Hälfte des 20.Jh.): Zwangsjacken, Elektrokrampftherapie und<br />
präfrontale Lobotomie (Durchtrennung der Nervenbahnen zw. Frontallappen<br />
und den unteren Gehirnzentren)!<br />
1. Revolution: Neuroleptika wurden erstmals in den 50ern (1952 in Europa,<br />
1954 in den USA) eingesetzt; das erste Neuroleptikum war dabei<br />
Chlorpromazin. Der Anteil dauerhaft hospitalisierter Patienten wurde dadurch<br />
enorm reduziert (ein gigantischer Erfolg)!<br />
2. Revolution: Seit rund 30 Jahren wird vermehrt auf atypische Neuroleptika<br />
gesetzt (s.u.); das erste atypische Neuroleptikum war Clozapin!<br />
65
Zum Unterschied zwischen typischen (z.B. Chlorpromazin, Haloperidol,…) und<br />
atypischen (z.B. Clozapin und Risperidon) Neuroleptika: Letztere haben a) weniger<br />
Nebenwirkungen (v.a. die extrapyramidal-motorischen Störungen treten hier in den<br />
Hintergrund) und b) ein weiteres Wirkungsfeld, sofern durch sie auch die negative<br />
Symptomatik gelindert werden kann. Bezüglich ihrer chemischen Beschaffenheit sind<br />
sie jedoch äußerst heterogen (sie zu einer Gruppe zusammenzufassen ist daher nicht<br />
unproblematisch).<br />
Typische Neuroleptika: blockieren vorwiegend die Dopaminrezeptoren, und<br />
zwar insbes. die D2-Rezeptoren!<br />
Resultat: sämtliche Dopamin-Systeme werden mehr oder minder<br />
lahmgelegt (=> EPMS); die serotoninerge Übertragung bleibt dagegen<br />
weitgehend unbeeinflusst (=> Negativsymptomatik);<br />
Atypische Neuroleptika: blockieren zwar ebenfalls die D2-Rezeptoren, aber<br />
in wesentlich geringerem Ausmaß; darüber hinaus besetzten sie u.a. (und zwar<br />
recht umfassend) die serotinergen 5-HT2A-Rezeptoren. Bei letzteren handelt es<br />
sich um Autorezeptoren, die nicht nur die Serotoninausschüttung regulieren,<br />
sondern, zumindest indirekt, auch Einfluss auf die Freisetzung von Dopamin<br />
haben.<br />
Resultat: Da nicht alle D2-Rezeptoren besetzt werden, kommt es zu<br />
weniger extrapyramidalen-motorischen Störungen; durch die Blockade der<br />
5-HT2A-Rezeptoren (=> vermehrte Serotoninfreisetzung) wird die<br />
Negativsymptomatik gelindert.<br />
Einige Neuroleptika (und Substanzgruppen) im Überblick:<br />
Trizykl.Neuroleptika Thioxanthene Butyrophenone „Atypische“ N.<br />
Chlorpromazin<br />
(Propaphenin)<br />
Perazin<br />
(Taxilan)<br />
Promethazin<br />
(Atosil)<br />
Haloperidol<br />
Benperidol<br />
(Haldol)<br />
Clozapin<br />
(Leponex)<br />
Risperidon<br />
(Risperidal)<br />
Zu den Nebenwirkungen:<br />
Extrapyramidale Nebenwirkungen:<br />
Parkinsonoide Symptomatik (bei 20-30% der Patienten): Rigor<br />
(Muskelstarre); Tremor (Muskelzittern); Hypokinese (Bewegungsarmut:<br />
kleinschrittiger Gang etc.), Akinese etc.<br />
Akute Dystonien = Verkrampfungen und Fehlhaltungen (ca. bei 20%;<br />
v.a. anfangs): Zungen-Schlund-Krampf; Blickkrämpfe; Retrocollis (Kopf<br />
durch Krampf nach hinten gebeugt); Torticollis („verdrehter Hals“),…<br />
Akathisie = „Sitzunruhe“ (bei ca. 20%)<br />
Früh- und Spätdyskinesien (bei ca. 20 %): unwillkürliche Bewegungen<br />
v.a. im Mundbereich; Spätdyskinesien sind dabei besonders problematisch;<br />
sie treten erst nach längerfristiger Medikation (manchmal erst nach Jahren)<br />
auf und sind oft irreversibel!<br />
„Malignes Postsynaptisches Syndrom“ (bei 1% der Patienten): Schwere<br />
Muskelstarre, begleitet von Fieber, Herzrasen und erhöhtem Blutdruck; in<br />
20% der Fälle tödlich!<br />
Anticholinerge Nebenwirkungen:<br />
Mundtrockenheit; Miktionsstörungen (Probleme beim Pinkeln);<br />
Obstipation (chronische Verstopfung)<br />
Gewichtszunahme (vermutlich eine antiserotonerge Nebenwirkung, die v.a.<br />
bei atypischen Neuroleptika auftritt)<br />
Brustwachstum, Milchfluss, sexuelle Dysfunktionen<br />
66
Zur Wirkung:<br />
Die Wirksamkeit von Neuroleptika ist eindeutig nachgewiesen: Sie führen<br />
nicht nur bei den meisten Patienten zu einer signifikanten Besserung der<br />
Symptome, sondern senken auch die Rückfallwahrscheinlichkeit<br />
(Erhaltungstherapie).<br />
Non-Responder: Lediglich 5-25% der Patienten sprechen auf Neuroleptika<br />
nicht an; dem Rest ist mit ihnen geholfen (wenn auch in unterschiedlichen<br />
Ausmaß).<br />
Zum Vergleich: Bei Placebo-Gabe kommt es lediglich (bzw. immerhin) bei<br />
15% der Patienten zu einer Remission!<br />
Neuroleptika sind der wirksamste Faktor der Rückfallprophylaxe! Werden sie<br />
abgesetzt, erleiden auf Dauer 70-80% der Patienten einen Rückfall; das gilt<br />
auch, wenn die Medikation erst nach 1 bis 5 Jahren Symptomfreiheit beendet<br />
wird.<br />
Durch Symptomfreiheit wird das Rückfallrisiko also nicht reduziert; durch<br />
dauerhafte Medikation dagegen ganz gewaltig (zum Vergleich: unter<br />
Placebo gibt es mehr als doppelt so viele Rückfälle als unter Medikation!)<br />
Zur Anwendung:<br />
Frühinterventions- vs. Niedrigdosierungsstrategie<br />
Ersterer geht es darum, einer Verfestigung der Störung von vornherein den<br />
Boden zu entziehen; letzterer darum, die Nebenwirkungen so gering wie<br />
möglich zu halten!<br />
Problem: Mehr als die Hälfte der Patienten beendet die Medikation nach der<br />
Entlassung (Gründe: Nebenwirkungen; verzögerte Wirkung;<br />
Negativsymptomatik, fehlende Krankheitseinsicht etc.)<br />
Daher oft Depotgabe (Neuroleptikum wird intramuskulär appliziert, sprich:<br />
gespritzt, und bleibt dort, je nach Präparat, ein bis vier Wochen aktiv)!<br />
Außerdem: Psychotherapie (s.u.), da diese die Compliance erhöht<br />
„Konsensus-Richtlinien“: medikamentöse Rezidivprophylaxe nach<br />
Erstmanifestation für 1 Jahr, nach einer weiteren Episode für mindestens 5<br />
Jahre!<br />
Risiken der Langzeitmedikation:<br />
Spätdyskinesien (s.o.)<br />
Verstärkung der „Minus-Symptomatik“ (kognitive Defizite,<br />
Affektverflachung etc.)<br />
67
5.5.2. Psychotherapie<br />
Auch wenn auf Neuroleptika bei der Behandlung von Schizophrenien nicht verzichtet<br />
werden kann, sollte die Medikation immer von psychotherapeutischen Maßnahmen<br />
begleitet werden.<br />
Dass Psychotherapie die Effektivität medikamentöser Behandlung erhöht,<br />
konnte für folgende therapeutischen Programme nachgewiesen werden:<br />
1) Interpersonale Therapie (Trainingsprogramme zur Verbesserung kognitiver<br />
und sozialer Fertigkeiten)<br />
2) Psychoedukative bzw. verhaltenstherapeutische Familienbetreuung (nach<br />
Falloon et al.)<br />
3) Kognitive Verhaltenstherapie<br />
Psychoanalyse, Tiefenpsychologie etc. haben sich dagegen als nicht wirksam<br />
erwiesen.<br />
Dass Psychotherapie wirksam ist, hat dabei v.a. folgende Gründe:<br />
1. Erhöhung der Medikamenten-Compliance (=> Medikamente werden seltener<br />
abgesetzt => geringere Rückfallraten)<br />
2. Senkung der „Expressed Emotion“ (=> weniger Stress für die Patienten =><br />
geringere Rückfallraten)<br />
3. Bessere Reintegration der Patienten (durch eine Minderung der kognitiven<br />
und sozialen Defizite)<br />
4. Besserer Umgang mit den Symptomen<br />
Die psychoedukative bzw. verhaltenstherapeutische Familienbetreuung (nach<br />
Falloon et al., 1984): basiert auf dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell (von Libermann)<br />
und den Erkenntnissen der EE-Forschung: Ziel ist es, die Lage des Patienten zu<br />
beruhigen, indem die Lage der Familie beruhigt wird (=> Rückfallprophylaxe).<br />
Das Konzept umfasst dabei folgende Komponenten:<br />
1) Neuroleptikamedikation<br />
2) Diagnostik (Analyse familiärer Konflikte und Belastungen)<br />
3) Psychoedukation (Information über Schizophrenie und Medikation)<br />
Um z.B. das nicht selten auftretende Missverständnis auszuräumen,<br />
der Patient könne seine Krankheit kontrollieren<br />
4) Kommunikationstraining<br />
5) Problemlösetraining<br />
6) Bei Bedarf: Einzeltherapie<br />
Evaluation (nach Falloon):<br />
Während die Rückfallrate bei gängiger Einzeltherapie nach 2 Jahren bei<br />
über 60% lag, lag sie bei Familienbetreuung bei rund 30% (ist also weniger<br />
als halb so hoch)!<br />
Patienten mit Familienbetreuung wiesen seltener schizophreniespezifische<br />
Symptome auf und waren besser angepasst.<br />
Die Belastung in der Familie wurde von allen Beteiligten geringer<br />
eingeschätzt.<br />
Verbesserung der familiären Kommunikationsmuster<br />
Kostenreduktion (20-30%)<br />
Kognitiv-verhaltenstherapeutische Maßnahmen: können helfen, mit den Symptomen,<br />
die auch durch die Medikation nicht in den Griff zu bekommen sind, besser<br />
umzugehen. Bei 20-25% (!) der Patienten gehört zu diesen Symptomen auch das<br />
Stimmenhören; es tritt bei ihnen chronisch auf, weshalb es in der Therapie lediglich<br />
darum gehen kann, es „erträglicher“ zu machen.<br />
Focusing-Techniken<br />
Veränderung von Bewertungsprozessen (die Stimme als „Freund“)<br />
68
Verbesserung der Bewältigungsstrategien<br />
6.1. Darstellung der Störungsbilder<br />
6. Essstörungen<br />
6.1.1. Die verschiedenen Arten von Essstörungen<br />
Drei Hauptarten von Essstörungen lassen sich unterscheiden:<br />
1) „Anorexia nervosa“ (= Magersucht): Essstörung, bei der der Betroffene sich<br />
weigert, ein normales Gewicht zu halten, starke Angst vor Gewichtszunahme<br />
und eine so gestörte Körperwahrnehmung hat, dass er sich noch immer zu dick<br />
fühlt, selbst wenn er abgemagert ist.<br />
Der Begriff „Anorexia“ meint einen schweren Appetitverlust; „nervosa“<br />
bedeutet, dass die Gründe für diesen Gewichtsverlust emotionaler Art sind!<br />
2) „Blulimia nervosa“ (=Bulimie): Essstörung, bei der der Betroffene<br />
Heißhungeranfälle erleidet und danach Ausgleichsmaßnahmen wie Erbrechen,<br />
Fasten oder übermäßige körperliche Betätigung ergreift, um eine<br />
Gewichtszunahme zu verhindern.<br />
Der Begriff „Bulimie“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel<br />
wie „Ochsenhunger“; der Unterschied zur Magersucht besteht darin, dass<br />
Bulimiker/innen keinen Gewichtsverlust erleiden!<br />
3) „Binge-Eating-Disorder“: Essstörung, die durch unkontrollierbare<br />
Fressattacken gekennzeichnet ist, über die der Betroffene verzweifelt ist. Es<br />
kommt aber weder zu Gewichtsverlust (Magersucht), noch zu Gegenmaßnahmen<br />
(Bulimie)<br />
Fällt in der ICD-10 und im DSM-IV noch unter die „Nicht näher<br />
bezeichneten Essstörungen“, ist also noch keine formale Diagnose; wird<br />
aber zunehmend erforscht, wobei sich die Hinweise mehren, dass es sich<br />
um ein eigenständiges Störungsbild handelt.<br />
ICD-10 und DSM-IV unterscheiden zwischen folgenden Arten von Essstörungen:<br />
ICD-10 DSM-IV<br />
Anorexia nervosa (F 50.0)<br />
Ohne aktive Maßnahmen zur Gewichtsabnahme<br />
(F 50.00)<br />
Mit aktiven Maßnahmen zur Gewichtsabnahme<br />
(F 50.01)<br />
Bulimia nervosa (F 50.2)<br />
Anorexia nervosa<br />
Restriktiver Typus<br />
„Binge-Eating / Purging“-Typus<br />
Bulimia nervosa<br />
„Purging“-Typus<br />
Atypische Bulimia nervosa (F 50.3) „Non-Purging“-Typus<br />
Essattacken bei sonstigen psychischen<br />
-<br />
Störungen (F 50.4)<br />
Erbrechen bei sonstigen psychischen<br />
-<br />
Störungen (F 50.5)<br />
Sonstige Essstörungen (F 50.8) -<br />
Nicht näher bezeichnete Essstörungen Nicht näher bezeichnete Essstörungen<br />
(F 50.9)<br />
69
„Binge-Eating“ bzw. „Purging“-Subtypus: mit Fressattacken und Kotzen<br />
„Bulimia nervosa“ nach der ICD-10:<br />
Kriterien:<br />
1) Andauernde Beschäftigung mit Essen, regelmäßige Heißhungeranfälle und<br />
„Fressattacken“<br />
2) Versuche, dem dickmachenden Effekt der Nahrung entgegenzuwirken: z.B.<br />
durch selbstinduziertes Erbrechen oder den Missbrauch von Abführmitteln,<br />
wiederkehrende Hungerperioden oder den Gebrauch von Appetitzüglern<br />
und Diurektika; bei Diabetikern: Vernachlässigung der Insulinbehandlung<br />
möglich<br />
3) Krankhafte Furcht davor, dick zu werden<br />
„Bulimia nervosa nach dem DSM-IV:<br />
Kriterien:<br />
A. Wiederholte Episoden von „Fressanfällen“, wobei diese a) durch eine<br />
übertriebene Nahrundmenge in kurzer Zeit und b) durch Kontrollverlust<br />
über das eigene Essverhalten gekennzeichnet sind!<br />
B. Wiederholte Anwendung von unangemessenen, gegensteuernden<br />
Maßnahmen<br />
C. Dauer: Mindestens 3 Monate mit durchschnittlich 2 Attacken pro Woche<br />
D. Figur und Gewicht haben großen Einfluss auf den Selbstwert<br />
Subtypen:<br />
Purging-Typus: Zu den gegensteuernden Maßnahmen gehören Erbrechen<br />
oder der Missbrauch von Laxantien (Abführmittel)<br />
Non-Purging-Typus: andere gegensteuernde Maßnahmen wie Fasten oder<br />
körperliche Betätigung<br />
„Nicht näher bezeichnete Essstörungen“: Rest-Kategorie, zu der alle Essstörungen<br />
gehören, die nicht die vollen Kriterien einer spezifischen Störung erfüllen, bei denen<br />
aber dennoch Handlungsbedarf besteht: es fallen darunter z.B. Mädels, die zwar<br />
offensichtlich anorektisch sind, deren BMI aber noch über 17,5 liegt, oder die „Binge-<br />
Eating-Störung“, die von vielen als abgeschwächte Form der Bulimie angesehen wird,<br />
die sich aber in Zukunft evtl. als spezifische Störung etablieren wird.<br />
Merkmale der Binge-Eating-Störung (nach DSM-IV):<br />
A. Wiederholte „Fressattacken“ (siehe: Bulimie), die…<br />
B. …mit mindestens 3 der folgenden Symptome einhergehen:<br />
Übertrieben schnelles Essen<br />
Unangenehmes Völlegefühl<br />
Unabhängig vom Hunger<br />
Alleine essen (um nicht unangenehm aufzufallen)<br />
Ekel- und Schuldgefühle<br />
C. Deutliches Leiden unter den Fressanfällen<br />
D. Häufigkeit der Fressanfälle: mindestens an 2 Tagen/Woche über 6 Monate<br />
E. Fressanfälle gehen nicht mit dem regelmäßigen Einsatz gegensteuernder<br />
Maßnahme einher ( Bulimie)<br />
71
6.1.3. Diagnostische Verfahren und Dokumentationshilfen<br />
Strukturierte Interviews:<br />
Strukturiertes klinisches Interview für DSM-IV (SKID):<br />
Vorteil: ermöglicht auch eine Klassifikation der Binge-Eating-Störung<br />
Nachteil: ist nicht sehr genau bei der Erfassung spezifischer<br />
psychopathologischer Merkmale essgestörter Patienten (Perfektionismus<br />
etc.)<br />
Eating Disorder Examination (EDE):<br />
Umfasst 4 Subskalen: 1) Restraint-Scale; 2) Eating-Scale; 3) Weight-Scale;<br />
4) Shape-Concern-Scale<br />
Strukturiertes Interview für Anorexia und Bulimia Nervosa (SIAB):<br />
Enthält ein Experteninterview (SIAB-Ex) und einen<br />
Selbsteinschätzungsbogen (SIAB-S)<br />
Ermöglicht Diagnose von AN, BN und NNB und erfasst auch allgemeine<br />
psychopathologische Merkmale (Perfektionismus, Depression etc.)<br />
Selbstbeurteilungsbögen:<br />
Eating Disorder Inventory (EDI-2): für AN und BN<br />
Skalen: „Streben nach Dünnsein“; „Bulimie“; „Körperliche<br />
Unzufriedenheit“; „Ineffektivität“; „Perfektionismus“; „Zwischenmenschliches<br />
Misstrauen“; „Interzeption“ und „Angst vorm<br />
Erwachsenwerden“<br />
Eating Attitudes Test (EAT): Maß für gestörtes Essverhalten und übermäßige<br />
Beschäftigung mit Essen<br />
Anorexia Nervosa Inventar zur Selbstbeurteilung (ANIS): Erfassung<br />
anorektischer Verhaltensweisen und Einstellungen<br />
Fragebogen zum Essverhalten (FEV):<br />
Erhoben werden folgende 3 Dimensionen: 1) kognitive Kontrolle des<br />
Essverhaltens; 2) Störbarkeit und Labilität des Essverhaltens bei<br />
Enthemmung durch situative Situationen; 3) Hungergefühle und<br />
Verhaltenskorrelate<br />
Test zur Erfassung des Körperschemas: den Pbn wird eine Skala vorgelegt, auf der<br />
verschiedene Körperstaturen (von extrem dünn bis beleibt) abgetragen sind; Aufgabe<br />
der Pbn ist es, a) einzutragen, wo auf der Skala sie ihre momentane Figur verorten<br />
würden, b) welches ihre Idealfigur ist und c) welche Figur ihrer Meinung nach vom<br />
anderen Geschlecht am attraktivsten gefunden wird.<br />
Pbn mit gestörtem Körperschema halten sich für dicker, als sie tatsächlich sind;<br />
und geben eine extrem dünne Idealfigur an (die noch weit unterhalb dessen<br />
liegt, was ihrer Ansicht nach vom anderen Geschlecht als attraktiv empfunden<br />
wird!)<br />
Bei normalen Pbn ist das nicht so: Die Einschätzung der eigenen Figur ist<br />
realistischer und ihre Idealfigur weniger dünn und nur geringfügig unterhalb<br />
dessen, was ihrer Ansicht nach vom anderen Geschlecht als attraktiv<br />
empfunden wird.<br />
6.1.4. Körperliche Begleiterscheinungen und Komorbidität<br />
Körperliche Begleiterscheinungen:<br />
Bei Anorexia Nervosa:<br />
Schlechte Elekrolytwerte (z.B. Natrium, Kalium) => Beeinträchtigung des<br />
Hirnstoffwechsels => Müdigkeit, Schwäche, Herzrhythmusstörungen, im<br />
schlimmsten Fall: plötzlicher Tod<br />
72
Gestörter Hormonhaushalt (Amenorrhoe; mangelnde Libido etc.)<br />
Außerdem: Niedriger Blutdruck, niedrige Herzfrequenz; Magen-Darm-<br />
und Nieren-Probleme; trockene Haut, in manchen Fällen: Haarausfall und<br />
Laguna (weißer Flaum am ganzen Körper) etc.<br />
Bei Bulimia Nervosa:<br />
Häufiges Erbrechen (=> Kaliummangel); Abführmittel (=> Diarrhöe) =><br />
gestörter Elektrolythaushalt (s.o.)<br />
Häufiges Erbrechen => Verletzungen der Magen- und Rachenschleimhaut;<br />
Verlust von Zahnschmelz etc.<br />
Depression: Sowohl AN als auch BN gehen häufig (bei 50-75% der Patienten) mit<br />
einer Major Depression oder Dysthymie einher.<br />
Mögliche Erklärungen dafür:<br />
1) Die besagten Störungen verursachen Depression (etwa durch biochemische<br />
Veränderungen oder die zum Krankheitsbild gehörenden Scham- und<br />
Schuldgefühle)<br />
2) Depression führt zu Essstörungen (AN und BN als Sonderform der<br />
Depression; daher auch die ähnlichen Symptome: Gewichtsverlust;<br />
niedrige Serotoninwerte etc.)<br />
3) Essstörungen und Depression gehen auf eine gemeinsame Disposition<br />
und/oder ähnliche Umwelteinflüsse zurück (z.B. eine gestörte familiäre<br />
Umgebung)<br />
Alle 3 Hypothesen sind plausibel, welche stimmt, kann bisher nicht mit<br />
Sicherheit gesagt werden.<br />
Persönlichkeitsstörungen (bei 42-75% der Patienten):<br />
Cluster B- Störungen: häufiger bei BN und der bulimischen Form der AN<br />
Cluster C- Störungen: bei beiden Störungen!<br />
Angststörungen: AN geht v.a. mit Zwangsstörungen einher (bis zu 25%); BN v.a. mit<br />
sozialer Phobie (30%)<br />
Substanzmissbrauch und –abhängigkeit: häufiger bei BN (30-37%); oft Folge der<br />
Essstörung<br />
Sexuelle Störungen: V.a. anorektische Patientinnen zeigen oft kein sexuelles<br />
Verlangen und hatten vielfach noch keinen Geschlechtsverkehr!<br />
6.1.5. Differentialdiagnose<br />
Somatische Differentialdiagnosen: Ausgeschlossen werden müssen…<br />
Malabsorbationssyndrome (bestimmte Substrate können nicht aufgenommen<br />
werden => Gewichtsverlust)<br />
Gastritis (Magenschleimhautentzündung => die sich v.a. bei chronischen<br />
Verlauf nicht nur in Bauchschmerzen, sondern auch in Appetitlosigkeit äußern<br />
kann)<br />
Anämie (zu geringer Sauerstoffgehalt im Blut => Blässe, Spliss, brüchige<br />
Nägel etc.)<br />
Cushing-Syndrom (s.o.: zu hoher Cortisonspiegel im Blut)<br />
Diabetes (Insulinmangel => Überzuckerung des Bluts)<br />
Lebererkrankungen<br />
Außerdem: Darmparasiten, Tumorerkrankungen, Lebererkrankungen,<br />
Schilddrüsenfunktionsstörungen, chronische Infektionen, …<br />
Psychologische Differentialdiagnosen:<br />
Anorektische Reaktion oder psychogenes Erbrechen im Rahmen von<br />
Belastungs- und Anpassungsstörungen<br />
73
Somatoforme und dissoziative Störungen<br />
Borderline-Persönlichkeitsstörung<br />
Zwangsstörungen<br />
Depressive Syndrome im Rahmen anderer Erkrankungen (z.B. einer MD-<br />
Episode)<br />
Schizophrene Psychosen oder andere wahnhafte Störungen<br />
6.1.6. Epidemiologie und Verlauf<br />
Häufigkeit: Ansätze gestörten Essverhaltens (z.B. übertriebene Diäten) finden sich<br />
bei jungen Frauen (Adoleszenz; Studium) so häufig (bei über 2/3!), dass sie statistisch<br />
gesehen fast schon „normal“ sind. Die Kriterien für eine Diagnose erfüllen jedoch nur<br />
wenige:<br />
Prävalenz von Anorexia Nervosa: etwas unter einem Prozent (0,2-0,8%)<br />
Prävalenz von Bulimia Nervosa: 1-2%<br />
Verhältnis Frauen – Männer: 11 : 1<br />
Risikogruppen: Balletttänzerinnen, Turnerinnen, Modells, Jockeys, etc.<br />
Krankheitsbeginn: Eine kritische Phase für die Entwicklung von Essstörungen stellt<br />
die Pubertät dar, sofern diese mit diversen körperlichen Veränderungen einhergeht,<br />
mit denen die Betroffenen oft nicht umgehen können.<br />
Die Anorexia Nervosa: setzt typischerweise in den frühen bis mittleren<br />
Jugendjahren ein; das Durchschnittsalter bei Krankheitsbeginn liegt zw. 15 und<br />
16 Jahren (zweigipflige Verteilung mit Häufung bei 14,5 und 18 Jahren)<br />
Die Bulimia Nervosa: setzt meist etwas später ein; das Durchschnittsalter bei<br />
Krankheitsbeginn liegt zw. 18 und 19 Jahren; viele der Betroffenen waren vor<br />
Beginn der Störung leicht überwichtig – ihre ersten Fressanfälle setzten<br />
während einer Diät ein!<br />
Verlauf:<br />
Prinzipiell gilt: der Verlauf von Bulimie ist günstiger als der von Magersucht<br />
(geringere Mortalität, höhere Remissionsrate etc.)!<br />
Auch bei AN ist die Remissionsrate jedoch relativ hoch: Etwa 70% der in der<br />
Adoleszenz (!) erkrankten Patienten genesen wieder (wenn auch oft erst nach<br />
Jahren und mehreren Rückfällen)<br />
Aber bedenke: Anorexia Nervosa ist lebensgefährlich! Die Mortalität der<br />
Patienten (1,4 -16%) ist (aufgrund der Mangelernährung und Suizid) 10 Mal so<br />
hoch wie in der Allgemeinbevölkerung und doppelt so hoch wie bei anderen<br />
psychischen Störungen!<br />
Prognose:<br />
Prädiktoren für einen negativen Verlauf von AN:<br />
Niedriger BMI zu Behandlungsbeginn und bei Entlassung<br />
Später Beginn (> 20)<br />
Längere Krankheitsdauer<br />
Komorbide psychische Störungen (z.B. Depression)<br />
Höheres Ausmaß sozialer und psychischer Probleme (z.B. Perfektionismus,<br />
familiäre Konflikte)<br />
Heißhunger-Anfälle und Erbrechen („Purging“-Typus)<br />
Körperliche Folgeschäden<br />
Prädiktoren für einen negativen Verlauf von BN:<br />
Höhere Frequenz von Fressanfällen und Erbrechen bei Behandlungsbeginn<br />
Geringe bzw. langsame Reduktion dieser Frequenz während der Therapie<br />
(um weniger als 70% nach den ersten 6 Sitzungen)<br />
Impulsivität; Substanzmissbrauch<br />
74
6.2. Zur Ätiologie von Essstörungen<br />
6.2.1. Biologische Faktoren<br />
Genetik: Wie für fast alle psychischen Störungen liegen auch für AN und BN Belege<br />
für eine genetische Disposition vor.<br />
Befunde:<br />
Familienanamnesen zeigen, dass Essstörungen in Familien von<br />
Essgestörten gehäuft auftreten: Bei Verwandten ersten Grades tritt die<br />
Krankheit etwa viermal so häufig auf!<br />
Die Konkordanzrate bei monozygoten Zwillingen ist höher als die von<br />
zweieiigen Zwillingen.<br />
Interpretation: Genetische Faktoren haben einen Einfluss; wie stark dieser ist,<br />
ist jedoch noch nicht hinreichend geklärt.<br />
Die aktuellen Schätzungen bewegen sich zw. 30 und 85%!<br />
Geschlecht: Das Geschlecht stellt eindeutig einen Risikofaktor dar: Männer - Frauen<br />
(11:1)<br />
Erklärung: Frauen scheinen für kulturelle Schlankheitsideale (s.u.) anfälliger<br />
zu sein als Männer, was daran liegen könnte, dass sie häufiger nach ihrem<br />
Aussehen beurteilt werden.<br />
Neurochemie: Die Regulation von Hunger und Sättigung erfolgt u.a. durch endogene<br />
Opioide und Serotonin; erstere werden in Hungerphasen freigesetzt und heben die<br />
Stimmung; letzteres fördert das Sättigungsgefühl.<br />
Beide Substanzen scheinen bei Essgestörten in geringerer Konzentration<br />
vorzuliegen.<br />
Durch Hungern werden Opioide freigesetzt und damit das Hungern positiv<br />
verstärkt.<br />
Der Serotoninmangel könnte den Fressattacken von Bulemikern<br />
zugrundeliegen (essen, ohne satt zu werden)<br />
Fazit: Die biologischen Befunde zu Essstörungen sind bisher eher spärlich und z.T.<br />
noch recht spekulativ!<br />
6.2.2. Soziokulturelle Faktoren<br />
In westlichen Gesellschaften lassen sich gegenwärtig zwei gegenläufige Trends<br />
ausmachen: Einerseits steigt der Anteil an Übergewichtigen (überreiches<br />
Nahrungsangebot, Bewegungsarmut) – andererseits wird die Idealfigur immer<br />
schlanker! Die Idealvorstellung gerät dadurch immer mehr in Konflikt mit der<br />
Realität!<br />
Letzteres zeigt sich z.B., wenn man das Durchschnittsgewicht von Pin-ups<br />
oder Misswahl-Siegerinnen zu dem der Normbevölkerung in Bezug setzt.<br />
Schönheitsideale sind kulturell bedingt und unterliegen damit einem stetigen Wandel.<br />
Während im Barock eher „pummelige“ Frauen als schön galten (Rubens), liegt das<br />
heutige Schönheitsideal (zumindest im Westen) unter dem Normalgewicht!<br />
Schlankheit wird dabei nicht zuletzt mit Erfolg und Selbstbeherrschung assoziiert.<br />
Vermittelt wird dieses Ideal v.a. über die Medien.<br />
Die Analyse von Modezeitschriften, Frauen- und Männermagazinen<br />
(„Vogue“, „Playboy“ & Co) zeigt: das Gewicht der darin abgelichteten Frauen<br />
hat seit den 50ern kontinuierlich abgenommen.<br />
Die Diätindustrie („Weight Watchers“, Zeitschriftenartikel, Ratgeber etc.) ist<br />
in demselben Zeitraum enorm angewachsen.<br />
75
Barbie-Puppen stellen ein unrealistisches Rollenmodell dar: Um ihre Figur zu<br />
erreichen, müsste die Durchschnittsfrau ihre Oberweite um ca. 30 Zentimeter<br />
vergrößern und ihre Taille um 25 cm reduzieren. Die Größe müsste ca. 2, 15 m<br />
betragen!<br />
Dass soziokulturelle Faktoren bei der Entstehung von Essstörungen tatsächlich eine<br />
große Rolle spielen, zeigen folgende Befunde:<br />
Essstörungen werden meist durch eine Diät eingeleitet (73 – 91% erkranken<br />
während einer Diätphase); das gilt v.a. für die Fressattacken bei Bulimie, die<br />
nahezu immer auf vorangegangene Diäten zurückzuführen sind<br />
(„Disinhibition“-Effekt).<br />
Der Übergang zwischen gesellschaftlich akzeptierter Schönheitspflege und<br />
krankhaftem Schönheitswahn ist dementsprechend fließend!<br />
Essstörungen treten primär in westlichen Industrienationen auf; in<br />
Entwicklungsländern gibt es sie kaum!<br />
Noch gibt es diesbezüglich aber leider zu wenige Studien; die These, es<br />
gäbe kulturspezifische Unterschiede, ist daher nur bedingt empirisch<br />
abgesichert!<br />
Einfluss der Medien<br />
6.2.3. Kognitiv-verhaltenstheoretisches Modell<br />
Das kognitiv-verhaltenstheoretische Modell versucht v.a., die aufrechterhaltenden<br />
Bedingungen von Essstörungen herauszuarbeiten, womit nichts anderes gemeint ist<br />
als die das gestörte Verhalten verstärkenden Faktoren.<br />
Grundannahme: Im Zentrum von Essstörungen stehen Probleme mit dem eigenen<br />
Gewicht und ein gestörtes Verhältnis zum Essen – ausgelöst werden Essstörungen<br />
jedoch meist durch andere Probleme (zwischenmenschliche Konflikte, mangelnde<br />
soziale Kompetenz, Belastungen in der Kindheit, übertriebener Perfektionismus etc.).<br />
Diese Probleme führen dazu, dass die Patientin sich selbst als inkompetent und<br />
unfähig erlebt und sich beim Auftreten konkreter Probleme (spezifische Auslöser) in<br />
die Essstörung „flüchtet“!<br />
Bei der restriktiven AN lassen sich folgende Verstärker ausmachen:<br />
Der vielleicht zentralste Verstärker ist der Erfolg bei der<br />
Nahrungseinschränkung selbst.<br />
Beides gibt den Patientinnen das Gefühl der Selbstkontrolle, was<br />
wiederum zu einem gesteigerten Selbstwert und Selbstwirksamkeitsgefühl<br />
führt. Darüber hinaus kompensieren die Patientinnen mit ihrer Kontrolle<br />
über das Essen vielfach den Kontrollverlust in anderen Lebensbereichen.<br />
AN-Patientinnen haben häufig ein hohes Maß an Perfektionismus, sie<br />
streben Gewichtsreduktion an wie andere Schulerfolg! Auf Pro-Ana-Seiten<br />
werden regelrechte Wettbewerbe ausgerufen!<br />
Ein weiterer Verstärker ist der mit erfolgreicher Nahrungseinschränkung<br />
einhergehende Gewichtsverlust.<br />
Je dünner die Patientinnen, desto schöner fühlen sie sich!<br />
Die permanente Auseinandersetzung mit Essen und Gewicht verhindert eine<br />
Auseinandersetzung mit anderen Schwierigkeiten und Defiziten, wodurch die<br />
Störung negativ verstärkt wird!<br />
Negativ verstärkend wirken außerdem die permanente Angst vor<br />
Gewichtszunahme und Kontrollverlust sowie die körperlichen Symptome<br />
nach vermehrter Nahrungsaufnahme (Völlegefühl, Blähungen etc.).<br />
76
Bulimie und die bulimische Form der Anorexie lassen sich als Teufelskreislauf<br />
beschreiben:<br />
Geringes Selbstwertgefühl Diät, um sich besser zu fühlen (s.o.: positive<br />
Verstärkung) zu strake Nahrungsreduktion Diät wird nicht eingehalten;<br />
negative Affekte („Disinhibition“-Effekt) Fressattacke (emotionsregulierende<br />
Funktion) Schlechtes Gewissen und Angst vor<br />
Gewichtszunahme Kompensatorische Maßnahmen (Spannungsreduktion)<br />
körperliche, psychische und soziale Folgeschäden geringes<br />
Selbstwertgefühl …<br />
6.2.4. Andere psychologische Modelle<br />
Psychodynamische Theorien: deuten Essstörungen als missglückten Ablöseversuch<br />
von den Eltern; einerseits gehe es den Betroffenen darum, Autonomie zu gewinnen<br />
und sich als selbstwirksam zu erleben; andererseits wollen sie nicht erwachsen<br />
werden.<br />
Letzteres zeigt sich nicht nur daran, dass sich ihr Autonomiestreben auf ein so<br />
infantiles Feld wie das Essen beschränkt; sondern auch daran, dass durch die<br />
Nahrungsverweigerung die sexuelle Reifung verzögert bzw. verhindert wird<br />
(Angst davor, einen weiblichen Körper zu bekommen).<br />
Systemische Theorien: betrachten essgestörte Patienten als „Symptomträger“ in<br />
einem dysfunktionalen Familiensystem; durch ihre Störung verhindern sie familiäre<br />
Konflikte (etwa zwischen den Eltern); die Krankheit hat demnach eine „positive“<br />
Funktion.<br />
Merkmale essgestörter Familien (nach Minuchin):<br />
Übermaß an Bindung: Eltern sprechen und denken für ihre Kinder<br />
Überbesorgtheit: Die Familienmitglieder sind extrem um das gegenseitige<br />
Wohl besorgt<br />
Rigidität: Der Familie geht‟s um den Erhalt des Status quo; sie ist<br />
dementsprechend wenig flexibel und tut sich schwer mit Veränderungen<br />
Fehlende Konfliktlösung: Die Familie vermeidet entweder Konflikte oder<br />
befindet sich in chronischen Konflikten<br />
6.2.5. Zusammenfassung (die wichtigsten Risikofaktoren)<br />
Risikofaktoren für Anorexie (in der Reihenfolge ihres zeitlichen Auftretens):<br />
Genetische Prädisposition<br />
Weibliches Geschlecht<br />
Ethnische Zugehörigkeit („westlich“ sozialisiert)<br />
Schwangerschaftskomplikationen<br />
Kindliche Schlafstörungen<br />
Überbehütender Erziehungsstil<br />
Sexueller Missbrauch<br />
Zwanghafte Persönlichkeitsstörung<br />
Perfektionismus<br />
Angststörung<br />
Negatives Selbstbild<br />
„Weight concerns“ (Gedanken über Gewicht)<br />
Adoleszentes Alter<br />
Spezifische Auslöser (Schulstress, Beziehungsstress, Identitäts- und<br />
Autonomiekonflikte etc.<br />
…<br />
77
Risikofaktoren für Bulimie (in der Reihenfolge ihres zeitlichen Auftretens)<br />
Genetische Prädisposition<br />
Weibliches Geschlecht<br />
Ethnische Zugehörigkeit („westlich“ sozialisiert)<br />
Geburtskomplikationen<br />
Kindliches Übergewicht (erhöhter BMI)<br />
Adoleszentes Alter<br />
Elterliches Übergewicht<br />
Störungen der Eltern (z.B. Depression oder Alkoholismus)<br />
„Weight Concerns“<br />
Soziale Phobie<br />
…<br />
6.3. Behandlung:<br />
6.3.1. Praktische Hinweise zu Diagnostik und Indikation<br />
Im Erst- bzw. Vorgespräch geht es um Folgendes:<br />
Der Therapeut: erstellt eine erste Diagnose (psychopathologischer Befund) und<br />
checkt die Therapie- und Veränderungsmotivation des Klienten ab.<br />
Die Erhebung des psychopathologischen Befundes sollte folgende Schritte<br />
umfassen:<br />
1) Strukturierte Interviews (s.o.: SCID, EDE etc.) zur Erstellung einer<br />
Diagnose und zur Feststellung von Komorbiditäten<br />
2) Liegen komorbide Störungen vor: Behandlungsart und -reihenfolge<br />
festlegen (parallel/eigenständig)<br />
Bei Substanzabhängigkeit erst mit Therapie beginnen, wenn<br />
Patient abstinent ist (Anti-Substanzvertrag)<br />
Bei schweren affektiven Störungen oder ausgeprägten<br />
Zwangsstörungen evtl. medikamentöse Zusatzbehandlung<br />
3) Folgestörungen/–probleme und deren Schweregrad abklären<br />
Eine medizinische Untersuchung vor Therapiebeginn ist dabei<br />
aufgrund der vielfältigen gesundheitlichen Risiken von<br />
Essstörungen unumgänglich!<br />
Der Klient: erhält einen ersten Eindruck vom Therapeuten und der Therapie<br />
Beide: einigen sich auf einen Behandlungsauftrag mit spezifischen Zielen und<br />
erstellen ausgehend davon einen Behandlungsvertrag.<br />
Besonderheiten bei Anorektikerinnen:<br />
Leidensdruck, Therapie- und Veränderungsmotivation fehlen häufig<br />
(mangelnde Krankheitseinsicht)<br />
Meist ist die Haltung der Patienten/innen ambivalent: einerseits wollen sie<br />
eine Behandlung – andererseits haben sie große Angst vor Kontrollverlust und<br />
Gewichtszunahme<br />
Einigung auf ein Mindestnormalgewicht (BMI = 20)<br />
Transparenz im therapeutischen Vorgehen schaffen und den Patienten<br />
selbst Verantwortung übertragen (damit sie nicht das Gefühl haben, die<br />
Kontrolle zu verlieren)<br />
Normalisierung des Essverhaltens (s.u.) hochgradig angstbesetzt; v.a. unter<br />
Beobachtung fällt den Patienten das Essen meist schwer!<br />
78
Besonderheiten bei BN-Patienten:<br />
Haben meist schon Mindestnormalgewicht und brauchen nicht zuzunehmen;<br />
wollen in der Therapie aber meist abnehmen!<br />
Muss überprüft und verhindert werden!<br />
Indikation:<br />
Grundsätzlich gilt: bei AN sollte die Behandlung stationär, bei BN ambulant<br />
erfolgen<br />
Unbedingt notwendig ist eine stationäre Behandlung bei AN, wenn folgende<br />
Kriterien erfüllt sind:<br />
Verlust von mehr als 30% des Ausgangsgewichts, v.a. bei rascher<br />
Gewichtsabnahme (innerhalb von 3 Monaten oder weniger)<br />
BMI < 14<br />
Ausgeprägte somatische Folgeerscheinungen (Elektrolytentgleisungen,<br />
Hypothermie, Niereninsuffizienz etc.)<br />
Schwerwiegende Begleiterscheinungen (z.B. bewusste Vernachlässigung<br />
der Stoffwechselkontrolle bei Diabetes)<br />
Problem: AN-Patienten sind meist nicht von einer stationären Behandlung<br />
überzeugt; eine ambulante Therapie muss in diesem Fall klar als Versuch<br />
herausgestellt werden, der an verschiedene Vereinbarungen gebunden ist:<br />
Behandlung nur, wenn Allgemeinärzte mit einbezogen werden<br />
Verpflichtende Therapieziele:<br />
Kontinuierliche Gewichtszunahme um min. 500g/Woche<br />
Aufgabe des restriktiven Essverhaltens und Einbezug bisher<br />
vermiedener Lebensmittel<br />
Zielgewicht: BMI = 20<br />
Bei weiterer Gewichtsabnahme: Therapieabbruch, evtl. Zwangseinweisung<br />
Ist man in diesem Punkt nicht konsequent, besteht die Gefahr einer<br />
Chronifizierung!<br />
6.3.2. Kognitive Verhaltenstherapie<br />
Die kognitive Verhaltenstherapie verfolgt 3 Ziele:<br />
1) Normalisierung des Essverhaltens und des Gewichts<br />
Psychoedukation und Aufklärung über die Therapieziele<br />
Problemanalyse:<br />
Bedingungen<br />
Analyse auslösender und aufrechterhaltender<br />
<br />
Normalisierung des Essverhaltens (regelmäßiges Essen, Abbau der<br />
„schwarzen Liste“ etc.): v.a. durch operante Methoden<br />
2) Bearbeitung relevanter Problembereiche<br />
Problemanalyse (Welche tieferen Probleme liegen der Krankheit<br />
zugrunde?)<br />
Zielorientierte Problembereichsbearbeitung<br />
Vermittlung kognitiver und anderer Techniken<br />
3) Verbesserung der Körperwahrnehmung und –akzeptanz<br />
Körperübungen, Körpererfahrung<br />
Kognitive Techniken<br />
Psychoedukation und Aufklärung über die Therapieziele:<br />
Chronisches Diäthalten soll niedriges Selbstwertgefühl und andere Probleme<br />
kompensieren, führt aber zu keiner Lösung, sondern in einen Teufelskreislauf<br />
(s.o.), der durch die Therapie durchbrochen werden soll, indem die Funktion<br />
des gestörten Essverhaltens aufgedeckt und alternative Problemlösestrategien<br />
vermittelt werden!<br />
79
Kurz: Die übermäßige Abhängigkeit des Selbstwertgefühls von Figur und<br />
Gewicht soll durch die KVT reduziert und dadurch das Essverhalten<br />
dauerhaft normalisiert werden.<br />
Die Notwendigkeit ein bestimmtes Gewicht zu erreichen und zu halten, muss<br />
den Patienten vermittelt werden. Dazu bietet es sich an, auf folgende Aspekte<br />
einzugehen:<br />
Set-Point-Theorie (Nisbett): Das Gewicht eines Menschen (Set-Point-<br />
Gewicht) ist genetisch vorprogrammiert; daraus folgt, dass es a) individuell<br />
verschieden ist und b) nur bedingt der willkürlichen Kontrolle unterliegt.<br />
Aufklärung über Folgeschäden: Menstruationsstörungen, gestörter<br />
Elektrolythaushalt, eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit, sozialer<br />
Rückzug etc. etc. (s.o.)<br />
„Minnesota-Starvation-“ bzw. „Keys-Study“ (1944): Pbn wurden 1 Jahr in<br />
dem sog. „Hunger-Camp“ untersucht; nach 3-monatiger Baseline-Erhebung<br />
wurde für 6 Monate die Kalorienzufuhr für jeden der Teilnehmer<br />
individuell halbiert; in den letzten 3 Monaten wurde die Kalorienzufuhr<br />
sukzessive wieder an ihr Ursprungsniveau angepasst. Ergebnis: die Pbn<br />
zeigten ähnliche Symptome wie Essgestörte (mangelnde<br />
Konzentrationsfähigkeit, Depressionen, übermäßige Beschäftigung mit<br />
Essen, sozialer Rückzug, Heißhungeranfälle etc.)!<br />
Aufklärung über die Problematik kompensatorischer Maßnahmen:<br />
Restriktives Essverhalten ist der Auslöser für die Fressattacken!<br />
Trotz Erbrechens bleibt ein Großteil der während einer Fressattacke<br />
aufgenommenen Kalorien im Körper!<br />
Restriktives Essverhalten führt häufig zu verringerter Stoffwechselaktivität<br />
und damit zu schweren kognitiven Defiziten.<br />
Erbrechen führt schnell wieder zu Hunger!<br />
Abführmittel führen selbst in großen Mengen nur zu einer geringen<br />
Reduktion der Kalorienaufnahme<br />
Aufklärung über soziokulturelle Einflüsse (übertriebenes Schlankheitsideal)<br />
Problemanalyse: dient der Identifikation auslösender und aufrechterhaltender<br />
Bedingungen; man erhofft sich davon a) ein besseres Verständnis der Störung, insbes.<br />
was deren Funktionalität betrifft, b) mögliche Interventionsansätze und c) ein besseres<br />
Gespür für Rückfallsituationen (im Sinne einer Rückfallprophylaxe)<br />
Erfolgt durch Selbstbeobachtungsprotokolle und Anamnese (wozu natürlich<br />
auch die Familienverhältnisse usw. zählen)<br />
Oft werden in diesem Zusammenhang anamnestische Gewichtskurven<br />
aufgestellt: Wann hat der Patient wie viel gewogen und welche Ereignisse<br />
gingen mit Gewichtsschwankungen einher (Abitur, Beendigung einer<br />
Beziehung, Hänseleien etc. etc.)?<br />
Stationäre Maßnahmen zur Gewichtszunahme: bilden zumindest in der<br />
Anfangszeit der Schwerpunkt der Behandlung; es geht dabei einerseits um den Abbau<br />
restriktiven Essverhaltens, andererseits um den Aufbau normalen Essverhaltens.<br />
Die Methoden, die dabei verwendet werden, sind überwiegend operante<br />
Verfahren; meist werden Verträge ausgehandelt, in denen genau festgelegt<br />
wird, welche Konsequenz auf welches Verhalten folgt („Contract-<br />
Management“).<br />
Beispiel: wöchentliche Gewichtszunahme von min. 500 Gramm und<br />
Aufnahme bisher gemiedener Lebensmittel in den Speiseplan wird mit<br />
Besuchen, Telefonaten etc. belohnt.<br />
Zum Teil auch Expositionsübungen: Essen im Restaurant etc.<br />
80
Etablierung eines regelmäßigen Essensplans (3 Hauptmahlzeiten + 2<br />
Zwischenmahlzeiten); tägliche Kalorienaufnahme von min. 2000 kcal!<br />
In jeder Woche werden neue, vormals verbotene Lebensmittel in den<br />
Speiseplan aufgenommen!<br />
Therapeut als Modell (muss also selbst ein normales Verhältnis zum Essen<br />
haben)<br />
Die Erfahrung weniger zuzunehmen als erwartet führt zu dem positiven<br />
Gefühl, die Kontrolle zu behalten.<br />
Identifikation und Bearbeitung zugrundeliegender Problembereiche:<br />
Gerade bei BN werden die zugrundeliegenden Probleme häufig erst nach<br />
Reduktion der Symptomatik erkennbar; schließlich liegt in der Verschleierung<br />
der Probleme ja gerade die Funktion der Störung!<br />
Die häufigsten Problembereiche: Geringer Selbstwert, Leistungs- und<br />
Perfektionismusstreben, Kontroll- und Autonomiestreben,<br />
Beziehungsprobleme, Ablösung vom Elternhaus, mangelnde Selbständigkeit,<br />
Angst vor Verantwortung<br />
Entlarvung und Aufhebung kognitiver Verzerrungen; Erschließung neuer<br />
Lebensbereiche, die eine selbstwertstabilisierende Funktion haben können etc.<br />
etc.<br />
Bearbeitung der Körperschemastörung: Ziel ist es, neue Erfahrungen mit dem<br />
eigenen Körper zu ermöglichen und die verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers<br />
zu korrigieren, damit dieser besser akzeptiert werden kann.<br />
Besonders geeignet ist in diesem Zusammenhang gruppentherapeutische<br />
Settings, da hier direkte Vergleiche und Rückmeldungen möglich sind.<br />
Konkrete Beispiele:<br />
Übungen zur Kontaktaufnahme: sich und andere anfassen lernen<br />
Vertrauensübungen: sich von einem anderen auffangen oder führen lassen<br />
Übungen zur Körpererfahrung: bestimmte Körperregionen (z.B. Rücken)<br />
abtasten; Konfrontationsübungen vor dem Spiegel oder mittels<br />
Videoaufnahmen, Entspannungsübungen, Massagen etc.<br />
Übungen zum Körperausdruck: z.B. freies Tanzen oder Pantomime<br />
Stabilisierung, Rückfallanalyse und –prophylaxe: Schrittweises Ausblenden der<br />
Therapie an regelmäßige Kontrollen koppeln, Rückfallsituationen erkennen und<br />
entsprechende Strategien erlernen, mit ihnen umzugehen etc.<br />
6.3.3. Zur Wirksamkeit:<br />
Zur Wirksamkeit von Therapien bei AN: gibt es leider nur wenig kontrollierte<br />
Studien; die Studien, die es bis dato gibt, zeigen Folgendes:<br />
Die Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer (insbes. der operanten Verfahren)<br />
und familientherapeutischer Maßnahmen ist zumindest kurzfristig belegt!<br />
Pharmakologische Therapien haben dagegen nur geringe Effekte.<br />
Lediglich nach bzw. zusätzlich zur stationären Behandlung scheint der<br />
Einsatz von Fluoxetin (Antidepressivum) hilfreich!<br />
Zur Wirksamkeit von Therapien bei BN: liegen v.a. Studien zur (K)VT und IPT<br />
vor.<br />
Sowohl die KVT als auch die IPT erzielen langfristig positive Effekte<br />
(Reduktion der Heißhungerattacken und des anschließenden Erbrechens um<br />
durchschnittlich 75%!); die KVT wirkt jedoch etwas schneller.<br />
Die KVT ist der reinen VT (ohne Einstellungsänderung) überlegen.<br />
81
Durch Exposition und Reaktionsverhinderung (nicht Kotzen dürfen) kann<br />
keine Verbesserung erzielt werden!<br />
Der Einsatz von Antidepressiva ist zwar wirksam, aber lange nicht so wie die<br />
KVT und IPT.<br />
Kombinationstherapien: sind einer reinen KVT leicht überlegen (was<br />
Symptomfreiheit, Rückfallrate und Sekundärsymptomatik betrifft), gehen aber<br />
mit erheblich größerem Drop-Out einher!<br />
Selbsthilfeansätze: nicht ganz so effektiv wie KVT, aber wirksam!<br />
Behandlungsformen bei BED: wurden überwiegend aus der BN-Behandlung<br />
abgeleitet.<br />
Prinzipiell gilt: Die Normalisierung des Essverhaltens (d.h. die Reduktion der<br />
Fressattacken) hat Priorität vor der Gewichtsreduktion.<br />
Als wirksam erwiesen hat sich – wie sollte es anders sein ;–) die KVT!<br />
Auch Psychopharmaka haben sich zumindest kurzfristig als wirksam erwiesen.<br />
82
7. Substanzinduzierte Störungen<br />
7.1. Allgemeines zu substanzinduzierten Störungen<br />
7.1.1. Psychoaktive Substanzen und ihre Wirkung<br />
Psychoaktive Substanzen (=Rauschmittel) wirken auf das zentrale Nervensystem und<br />
werden i.d.R. als wohltuend empfunden! Sie werden in der ein oder anderen Form in<br />
nahezu allen Kulturen verwendet.<br />
Werden mehrere Substanzen parallel konsumiert, spricht man von<br />
„Polytoxikomanie“!<br />
Einige wichtige psychoaktive Substanzen und ihre Wirkung:<br />
Sedativa (Beruhigungsmittel bzw. Tranquilizer): verlangsamen die<br />
Aktivität des Körpers und mindern die Reaktionsbereitschaft<br />
Opiate bzw. dessen Derivate (Heroin, Morphium): binden an die sog.<br />
Opioidrezeptoren (körpereigene Opioide sind z.B. Endorphine); sie haben<br />
eine beruhigende, schmerzlindernde Wirkung und führen zu einem<br />
euphorischen, träumerischen Zustand (bei Heroin kommt unmittelbar nach<br />
der Injektion der sog. „Rush“ hinzu)<br />
Synthetische Sedativa (Barbiturate und Benzodiazepine wie Valium):<br />
wirken agonistisch auf die GABAA-Rezeptoren, verstärken also die<br />
GABAerge (=hemmende) Übertragung und haben damit eine<br />
schmerzlindernde, beruhigende, einschläfernde und angstlösende Wirkung!<br />
Stimulanzien: wirken anregend auf Gehirn und sympathisches Nervensystem<br />
und damit aktivierend.<br />
Kokain (=natürliches Stimulans): blockiert die Wiederaufnahme von<br />
Dopamin und Noradrenalin, insbes. im mesolimbischen Bereich =><br />
Wachheit, Euphorie<br />
Amphetamine (=synthetische Stimulanzien): fördern die Freisetzung von<br />
Dopamin und Noradrenalin und blockieren deren Wiederaufnahme =><br />
Wachheit, Euphorie<br />
Halluzinogene (LSD, Meskalin, Ecstasy etc.): führen zu Halluzinationen und<br />
Bewusstseinsveränderungen<br />
Alkohol (Ethanol): bindet an die Glutamat- und GABA-Rezeptoren (s.o) und<br />
hat sowohl eine stimulierende, als auch sedierende Wirkung (Zwei-Phasen-<br />
Wirkung)<br />
Nikotin: wirkt agonistisch auf die nikotinergen ACh-Rezeptoren<br />
(exzitatorisch)<br />
7.1.2. Diagnostische Kriterien<br />
Einteilung substanzinduzierter Störungen:<br />
Der pathologische Konsum von psychoaktiven Substanzen gliedert sich in 2<br />
Kategorien:<br />
1. Substanzmissbrauch: liegt vor, wenn der Konsum das eigene Leben<br />
beeinträchtigt, sprich: zur Vernachlässigung der Pflichten oder<br />
Gefährdungen führt, ohne dass eine Abhängigkeit besteht.<br />
2. Substanzabhängigkeit: liegt vor, wenn eine körperliche und/oder<br />
psychische Abhängigkeit von der betreffenden Substanz besteht.<br />
83
Darüber hinaus gehören zu den substanzinduzierten Störungen:<br />
Substanzintoxikation: z.B. Alkoholvergiftung<br />
Substanzentzug: z.B. Delirium tremens (s.u.)<br />
Symptome diverser Achse-I-Störungen: Demenz, amnestische Störung,<br />
psychotische Störungen, affektive Störungen, Angststörungen und sexuelle<br />
Funktionsstörungen<br />
Kriterien für Substanzmissbrauch nach dem DSM-IV:<br />
Mindestens eines der folgenden 4 Kriterien muss innerhalb eines Jahres<br />
wiederholt aufgetreten sein:<br />
1. Versagen bei der Erfüllung wichtiger Pflichten (z.B. Fernbleiben von der<br />
Arbeit oder Vernachlässigung der Kinder)<br />
2. Körperliche Gefährdung (z.B. durch Alkohol am Steuer)<br />
3. Probleme mit dem Gesetz (z.B. wegen ungebührlichen Verhaltens oder<br />
Verkehrsdelikten etc.)<br />
4. Fortgesetzte soziale und zwischenmenschliche Probleme (z.B. Ehestreit<br />
wegen des Drogenkonsums)<br />
Es darf keine Abhängigkeit von der betreffenden Substanz bestehen!<br />
Kriterien für Substanzabhängigkeit nach dem DSM-IV:<br />
Mindestens 3 der folgenden 7 Kriterien müssen sich innerhalb eines Jahres<br />
manifestiert haben:<br />
1. Toleranzentwicklung: äußert sich entweder in dem Verlangen nach<br />
Dosissteigerung oder in einer verminderten Wirkung bei fortgesetzter<br />
Einnahme derselben Dosis.<br />
2. Entzugssymptome: äußern sich entweder in den charakteristischen<br />
psychischen und physischen Entzugssymptomen der jeweiligen Substanz<br />
oder darin, dass die betreffende Substanz eingenommen wird, um diese<br />
Symptome zu lindern oder zu vermeiden.<br />
3. Ausmaß des Konsums: Die Substanz wird in größeren Mengen oder länger<br />
als beabsichtigt eingenommen.<br />
4. Vergeblicher Umkehrversuch: Anhaltender Wunsch oder erfolglose<br />
Versuche, den Substanzgebrauch zu verringern oder zu kontrollieren.<br />
* Findet sich nicht im ICD-10: dort gilt stattdessen der starke Wunsch, die<br />
Substanz zu konsumieren, als ein Kriterium für Abhängigkeit!<br />
5. Zeitaufwand: Es wird viel Zeit darauf verwendet, die Substanz zu<br />
Im ICD-10<br />
ein Kriterium!<br />
beschaffen, zu konsumieren oder sich von ihren Wirkungen zu erholen.<br />
6. Einschränkung: Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten<br />
werden aufgrund des Substanzkonsums aufgegeben oder eingeschränkt.<br />
7. Irrationalität: Der Substanzgebrauch wird trotz der psychischen und<br />
körperlichen Probleme, die dieser verursacht, fortgesetzt (z.B. wird Kokain<br />
genommen, obwohl es zu regelmäßigen Depressionen führt)<br />
Körperliche Abhängigkeit wird diagnostiziert, wenn entweder (1)<br />
Toleranzentwicklung oder (2) Entzugssymptome zu den erhobenen Merkmalen<br />
zählen!<br />
7.1.3. Epidemologie und Folgen<br />
Prävalenzraten (in Deutschland):<br />
Tabakabhängigkeit: ca. 10 Mio.<br />
27% der Erwachsenenbevölkerung in Deutschland raucht!<br />
Die meisten durch Drogenkonsum verursachten Todesfälle gehen auf das<br />
Konto von Nikotin!<br />
Alkoholabhängigkeit: ca. 1,5 Mio. (2, 4%)<br />
84
Männer: 4%; Frauen: 1%<br />
Alkoholmissbrauch: ca. 2, 7 Mio. (4%)<br />
Männer: 5%; Frauen: 2%<br />
Medikamentenabhängigkeit: ca. 1,4 Mio. (2, 3%)<br />
Abhängigkeit von illegalen Drogen: ca. 100.000 – 150.000<br />
Lebenszeitprävalenz für den Konsum illegaler Drogen: über 16%<br />
Das Einstiegsalter liegt für alle Drogen (Tabak, Alkohol und illegale Drogen) meist in<br />
der Jugend bzw. im frühen Erwachsenenalter. Nach 24 fängt kaum noch jemand an<br />
zu rauchen, trinken, kiffen oder koksen.<br />
Rückfälle sind die Regel: Innerhalb der ersten 2 Jahre nach einer Remission werden<br />
je nach Substanz 50-70% rückfällig!<br />
7.1.4. Zur Ätiologie substanzinduzierter Störungen<br />
Die Entstehung einer Abhängigkeit erfolgt meist in mehreren Stufen, wobei auf den<br />
verschiedenen Stufen jeweils unterschiedliche Faktoren wirksam sind.<br />
1) Positive Einstellung<br />
Zunächst müssen die Betroffenen der Substanz gegenüber positiv<br />
eingestellt sein.<br />
Beeinflusst wird die Einstellung zu einer Substanz (z.B. Nikotin) u.a. durch<br />
die Familie (rauchende Eltern), die Medien (Werbung) und das generelle<br />
gesellschaftliche Klima (in einer Gesellschaft, in der viel geraucht wird,<br />
hält man Nikotin naturgemäß für weniger gefährlich).<br />
2) Experimentieren<br />
s.u.<br />
3) Regelmäßiger Konsum<br />
Wenn die Betroffenen eine positive Einstellung zu der Substanz entwickelt<br />
haben, beginnen sie, mit ihr zu experimentieren und sie schließlich<br />
regelmäßig einzunehmen.<br />
Von Bedeutung sind dabei v.a. die Verfügbarkeit der Substanz<br />
(Zigarettenautomaten etc.) und der von den Peers ausgehende<br />
<br />
Gruppendruck. Der Erstkonsum selbst führt nämlich i.d.R. noch nicht zu<br />
positiven Folgen („Hust! Würg!“) – verstärkend wirkt daher zunächst<br />
lediglich die Zuwendung der Bezugsgruppe („Ich gehör dazu!“) oder die<br />
Wirkung auf Dritte („Schau her, wie cool ich bin!“)<br />
4) Starker Konsum<br />
Die Substanz selbst wirkt meist erst nach mehrmaligem Konsum<br />
verstärkend; dabei spielen sowohl biologische als auch psychologische und<br />
soziale Mechanismen eine Rolle (s.u.); sie führen dazu, dass der Anreiz der<br />
Substanz steigt und ihr Konsum automatisiert wird; die Folge ist ein<br />
zunehmend stärkerer Konsum!<br />
5) Physische Abhängigkeit oder Missbrauch<br />
Ausbildung diskriminativer Stimuli für erneuten Drogenkonsum<br />
Stoffwechselmangel bei Fehlen der Droge => Entzugserscheinungen<br />
Verschiebung im Verhaltensrepertoire: Alles dreht sich um den Erwerb und<br />
Konsum der Droge<br />
Rückfallmodelle: Dass es so häufig zu Rückfällen kommt (nach 2 Jahren 50-70%!),<br />
kann folgendermaßen erklärt werden:<br />
1) Lerntheoretisches Modell: konditionierte Auslöser (= diskriminative Stimuli)<br />
als Ursache (klassische Konditionierung)<br />
2) Kognitives Modell: Fehlende Bewältigungsstrategien in kritischen Lebenssituationen<br />
und negative Einschätzung der eigenen Bewältigungsfähigkeit<br />
85
3) Integratives Modell: Es gibt klassisch konditionierte Auslöser; sie führen<br />
jedoch nicht automatisch zu einem Rückfall, sondern nur im Zusammenspiel<br />
mit kognitiven Mechanismen!<br />
7.1.5. Die Teufelskreise der Sucht (siehe genauer: 7.2.5)<br />
In Gang gesetzt wird Suchtverhalten durch die unmittelbar verstärkende Wirkung<br />
einer Substanz!<br />
Negative Verstärkung = Entspannung; Ablenkung etc.<br />
Positive Verstärkung = Stimmungsförderung, Stimulierung etc.<br />
In Gang gehalten wird eine Sucht dadurch, dass der Anreiz der Substanz<br />
kontinuierlich erhöht- und ihr Konsum zunehmend automatisiert wird! Dabei spielen<br />
sowohl psychologische, als auch biologische und soziale Mechanismen eine Rolle.<br />
Unterschieden werden kann dementsprechend zwischen…<br />
1. Einem intrapsychischen Teufelskreis<br />
Beeinträchtigte Selbstwahrnehmung, unrealistische Wirkungserwartung,<br />
Copingdefizite, suchtbezogene Grundannahmen, Abstinenzverletzungssyndrom<br />
2. Einem neurobiologischen Teufelskreis<br />
1) Toleranzentwicklung, 2) Endorphinmangel, 3) Suchtgedächtnis<br />
3. Einem psychosozialen Teufelskreis<br />
Gesellschaftliches Klima, veränderte Familieninteraktion, soziale<br />
Folgeschäden, Mangel an Alternativressourcen<br />
* Zur Auswirkung sozialen Stresses auf den Drogenkonsum: Ratten, die<br />
Isolationsstress ausgesetzt wurden, erhöhen ihren Kokainkonsum<br />
deutlich schneller als Kontrolltiere!<br />
7.1.6. Der neurobiologische Teufelskreis<br />
Suchttheorie der positiven Verstärkung:<br />
Toleranzentwicklung und Entzugssymptomatik: lassen sich mit der<br />
Gegensatz-Prozess-Theorie erworbener Motivation erklären.<br />
Diese geht davon aus, dass jeder affektive Reiz nicht nur den Affekt, sondern<br />
zugleich den jeweiligen Gegenaffekt auslöst. Die affektive Reaktion entspricht<br />
der Summe aus diesen hedonisch gegensätzlichen Reaktionen.<br />
1) Bei Darbietung eines affektiven Reizes (positiv oder negativ) wird<br />
zunächst der a-Prozess (Affekt) ausgelöst, der in der Dauer, Intensität und<br />
Qualität proportional zum dargebotenen Reiz ist.<br />
2) Etwas zeitverzögert löst der a-Prozess die Aktivierung des gegensätzlichen<br />
b-Prozesses (Gegenaffekt) aus. Der b-Prozess weist die umgekehrte<br />
hedonische Qualität von a auf; setzt zeitversetzt ein, steigt langsamer an<br />
und hat (zumindest anfangs) eine deutlich kleinere Amplitude als der a-<br />
Prozess.<br />
3) Sowohl die a- als auch die b-Komponente senden ihr Signal an einen<br />
Summator, wo die beiden Signale addiert (a-b) und so die Stärke des<br />
Affektes, der Motivation und des Verstärkerwertes bestimmt werden.<br />
Wird der Reiz zum ersten Mal oder nur selten dargeboten, hat die resultierende<br />
Kurve eine typische Form: Maximum der primären affektiven Reaktion (z.B.<br />
Freude) Adaptationsphase Gleichgewichtsniveau Affektive<br />
Nachreaktion (schaler Nachgeschmack)<br />
Entscheidend an dem Modell ist jedoch, dass der a-Prozess bei Wiederholung<br />
konstant bleibt, während der b-Prozess durch Wiederholung verstärkt wird.<br />
86
Dadurch wird die Summe der affektiven Reaktionen bei häufiger<br />
Wiederholung kleiner (Toleranzentwicklung); die affektive Nachreaktion<br />
größer (Entzugssymptomatik).<br />
Beispiel Drogenkonsum: Einnahme wird bei häufigem Konsum weniger<br />
positiv erlebt (Toleranzentwicklung aufgrund Zunahme des negativen b-<br />
Prozesses) und von zunehmend längeren und stärkeren negativen<br />
Nachschwankungen begleitet (Entzugsymptome).<br />
Das Suchtgedächtnis: manifestiert sich in einer subkortikalen (im<br />
Belohnungszentrum angesiedelten) Hypersensibilität gegenüber substanzbezogenen<br />
Stimuli („Cue Reactivity“).<br />
Diese Hypersensibilität äußert sich auf verschiedenen Ebenen:<br />
Subjektive Ebene: erhöhtes Verlangen („Craving“)<br />
Physiologische Ebene: Anstieg der Herzrate, verringerte Startle-Reaktion<br />
(s.u.); Salivation (=<br />
Neuronale Ebene: Anstieg der BOLD-Response in best. Hirnregionen<br />
Verhaltensebene: Kontrollverlust<br />
Pauli et al. (2000): Experiment zur emotionalen Valenz rauchbezogener Bilder<br />
Rauchern und Nichtrauchern wurden negative, neutrale, positive und<br />
rauchbezogene Bilder dargeboten.<br />
Um die emotionale Valenz der rauchbezogenen Bilder zu messen, wurden<br />
folgende Maße erhoben:<br />
a) Subjektive Angaben<br />
b) Gesichtsausdruck (Corrugator: „Stirnrunzeln“; Zygomaticus „Lächeln“)<br />
c) Modulation des Schreck-Reflexes: dazu wurde kurz nach dem<br />
Erscheinen der Bilder lautes „weißes Rauschen“ eingespielt, um den<br />
Schreckreflex auszulösen, der mittels EMG (Aktivität des M.<br />
orbicularis oculi) gemessen werden kann. Je positiver die emotionale<br />
Valenz der Hintergrundreize, desto geringer die Startle-Reaktion!<br />
Ergebnisse:<br />
Nicht-Raucher: ordneten die rauchbezogenen Bilder beim subjektiven<br />
Rating zw. neutralen und negativen Bildern ein die Startle-Reaktion<br />
war kongruent dazu, d.h. schwächer als bei negativen und stärker als bei<br />
neutralen Bildern; dasselbe gilt für den Gesichtsausdruck<br />
Raucher: ordneten die rauchbezogene Bilder beim subjektiven Rating<br />
zw. neutralen und positiven Bildern ein die Startle-Reaktion war<br />
inkongruent dazu, sprich: bei rauchbezogenen Bildern geringer als bei<br />
positiven Bildern. Bei Rauchern gehen physiologische Reaktion u.<br />
subjektives Empfinden auseinander!!!<br />
Fazit: Bei starken Rauchern gehen physiologische Reaktion<br />
(Startlereflex/Gesichtsausdruck) und subjektives Empfinden auseinander!<br />
Die Cue-Reactivity wirkt subkortikal und ist dementsprechend nur bedingt<br />
steuerbar!<br />
Hinweisreize können aversiv und appetitiv wirken:<br />
„Craving“ (Verlangen / Drang): ist ein zentraler Bestandteil von Sucht; es<br />
bewirkt nicht nur die Aufrechterhaltung des Suchtverhaltens, sondern ist auch für<br />
Rückfälle verantwortlich!<br />
Sowohl im ICD-10, als auch im DSM-IV wird „Craving“ als wichtiges<br />
Kriterium genannt:<br />
Die ICD-10: spricht von einem „starken Wunsch oder einer Art Zwang“,<br />
eine bestimmte Substanz zu konsumieren.<br />
87
Im DSM-IV: wird „Craving“ („unwiderstehlicher Drang“) zusammen mit<br />
Toleranzentwicklung und Entzugserscheinungen explizit als eines der<br />
zentralen Merkmale von Abhängigkeit genannt.<br />
Erfasst werden kann das „Craving“ entweder mit Hilfe von Fragebögen, z.B.<br />
dem „Questionaire on Smoking Urges“ (QSU), oder mittels<br />
biopsychologischer Methoden (s.o.: Modulation des Schreckreflexes in<br />
Abhängigkeit von der emotionalen Valenz der Hintergrundreize)<br />
Der QSU wurde von Mucha, Pauli u.a. ins deutsche übersetzt (QSU-G); er<br />
enthält 37 Items, die jeweils auf einer 7-stufigen Antwortskala (stimmt<br />
überhaupt nicht – stimmt völlig) beurteilt werden sollen.<br />
4 a priori Skalen:<br />
Verlangen zu rauchen (z.B. „Ich muss jetzt rauchen!“)<br />
Erwartung einer sofortigen positiven Wirkung (z.B. „Ich würde eine<br />
Zigarette jetzt nicht genießen“)<br />
Erwartung einer sofortigen Reduktion von Nikotinentzug oder<br />
negativen Gefühlen (z.B. „Rauchen würde meine schlechte Stimmung<br />
deutlich verbessern.“)<br />
Absicht zu rauchen (z.B. „Ich werde rauchen, sobald ich die<br />
Möglichkeit dazu habe.“)<br />
Hohe Reliabilität (zw. 0.93 und 0.95) und Validität (gemessen an den<br />
Auswirkungen von Deprivation und Rauchen)<br />
Eine Faktorenanalyse zeigt, dass sich diese Skalen zu 2 Faktoren<br />
zusammenfassen lassen:<br />
1. Absicht zu rauchen + Antizipation positiver Wirkung<br />
2. Verlangen zu rauchen + Entzugsreduktion<br />
Rauchen (vorher/nachher) und Deprivation wirken stärker auf Skala 1<br />
(Absicht zu rauchen/ positive Rauchwirkung) als auf Skala 2 (Verlangen zu<br />
rauchen / Entzugsreduktion), was diese Erkenntnis bringt, wissen Gott und<br />
Pauli allein!<br />
7.1.7. Allgemeine Hinweise zur Therapie<br />
Die wichtigsten Therapieziele bei Sucht sind:<br />
Aufbau einer Veränderungsbereitschaft<br />
Problem: die schlimmsten Konsequenzen des Substanzmissbrauchs<br />
(körperliche Beschwerden etc.) klingen zu Beginn der Behandlung recht<br />
schnell ab, während die positiven Konsequenzen abstinenten Verhaltens<br />
(z.B. beruflicher Erfolg) meist erst nach längerer Zeit erfahrbar werden.<br />
Methode: kognitive Verfahren, wobei ein Schwerpunkt auf der positiven<br />
Bewertung abstinenten Verhaltens liegt)<br />
Behandlung begleitender Störungen<br />
„Harm Reduction“: dient der Sicherung des Überlebens und hat absolute<br />
Priorität<br />
Behandlung von Störungen mit Auslöserfunktion und sonstigen<br />
komorbiden Störungen (z.B. soziale Unsicherheit, Depression,<br />
Persönlichkeitsstörung, ungünstige Interaktionsmuster in der Familie etc.)<br />
Rückfallprävention<br />
Kombination von kognitiven und verhaltensübenden Verfahren, die dazu<br />
dienen, Rückfallrisiken zu erkennen und zu meiden bzw. besser zu<br />
„handlen“!<br />
88
Wichtige Behandlungskomponenten sind:<br />
1) Entzugsbehandlung (unter ärztlicher Aufsicht und mit medikamentöser<br />
Unterstützung; meist stationär; bei harten Drogen: Substitutionstherapie)<br />
2) Entwöhnungsbehandlung (Aufbau einer stabilen Abstinenz)<br />
3) Nachsorge (v.a. im ersten Jahr der Abstinenz wichtig; erfolgt z.B. in Form von<br />
Selbsthilfegruppen oder ambulanter Weiterbehandlung)<br />
Der Genesungsprozess kann in 4 Veränderungsphasen unterteilt werden:<br />
1) Precontemplation<br />
Der Betroffene sieht keinen Anlass für Veränderung (mangelnde<br />
Krankheitseinsicht); stattdessen: Verleugnung und andere<br />
Abwehrmechanismen<br />
2) Contemplation<br />
Beginn einer kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen<br />
Konsumverhalten; ambivalente Haltung und Abwägungsprozesse, wobei<br />
die Betroffenen zunächst meist zu oberflächlichen Lösungsversuchen<br />
neigen<br />
3) Action<br />
Ernsthafter Abstinenzvorsatz und konkrete Umsetzungsversuche<br />
4) Maintenence<br />
Stabilisierung der Abstinenz<br />
7.2. Alkoholabhängigkeit im Speziellen<br />
7.2.0. Einordnung der Störung<br />
Die ICD-10 unterscheidet 10 verschiedene alkoholbedingte Syndrome (F 10):<br />
1) F 10.0: Akute Intoxikation (=akuter Rausch)<br />
2) F 10.1: Schädlicher Gebrauch<br />
3) F 10.2: Abhängigkeitssyndrom<br />
4) F 10.3: Entzugssyndrom (z.B. Tremor, Schweißausbrüche etc.)<br />
5) F 10.4: Entzugssyndrom mit Delir („Delirium Tremens“)<br />
6) F 10.5: Psychotische Störung (z.B. Alkoholhalluzinose)<br />
7) F 10.6: Alkoholbedingtes amnestisches Syndrom (z.B. Korsakow-Syndrom)<br />
8) F 10.7: Alkoholbedingter Restzustand<br />
9) F 10.8: Sonstige alkoholbedingte psychotische Verhaltensstörungen<br />
10) F 10.9: Nicht näher bezeichnete alkoholbedingte psychische-/Verhaltensstörung<br />
7.2.1. Beschreibung der Störung<br />
Lange Zeit wurde Alkoholismus als selbstverschuldetes Laster angesehen und obwohl<br />
Alkoholabhängigkeit seit 1968 gesetzlich als Krankheit anerkannt ist, herrscht in der<br />
Bevölkerung nach wie vor ein negatives Bild von Alkoholikern vor.<br />
Kurzdefinition von Alkoholabhängigkeit (als Faustregel, v.a. für die Kommunikation<br />
mit Patienten):<br />
Alkoholabhängig ist entweder,<br />
- wer den Konsum von Alkohol nicht beenden kann, ohne dass unangenehme<br />
Zustände psychischer oder körperlicher Art eintreten oder<br />
- wer nicht aufhören kann zu trinken, obwohl er sich oder anderen immer wieder<br />
schweren Schaden zufügt.<br />
89
Kriterien für das Alkoholabhängigkeitssyndrom nach der ICD-10 (F 10.2):<br />
Mindestens 3 der folgenden 6 folgenden Kriterien waren innerhalb des letzten<br />
Jahres vorhanden:<br />
1. Starker Wunsch bzw. Zwang, Alkohol zu konsumieren<br />
2. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und<br />
der Menge des Konsums (s.o.)<br />
3. Körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des<br />
Konsums (s.o.)<br />
4. Toleranzentwicklung (s.o.)<br />
5. Vernachlässigung anderer Interessen und erhöhter Zeitaufwand, um<br />
Alkohol zu beschaffen, zu konsumieren bzw. sich von den Folgen des<br />
Konsums zu erholen (s.o.)<br />
6. Anhaltender Alkoholkonsum trotz Nachweises schädlicher Folgen (s.o.)<br />
Typen von Alkoholabhängigkeit:<br />
Die wohl bekannteste Klassifikation stammt von Jellinek (1960):<br />
1. Konflikttrinker (Alpha-Typ): trinken, um Konflikte und Probleme zu<br />
bewältigen (sind nicht alkoholkrank, aber sehr gefährdet, v.a. nach<br />
kritischen Life-Events)<br />
2. Gelegenheitstrinker (Beta-Typ): trinken bei sozialen Anlässen große<br />
Mengen, bleiben aber sozial und psychisch unauffällig (aufgrund ihres<br />
alkoholnahen Lebensstils trotzdem gefährdet)<br />
3. Rauschtrinker (Gamma-Typ): haben zwar immer wieder abstinente<br />
Phasen, verlieren aber in den Phasen, in denen sie trinken, die Kontrolle<br />
über ihren Alkoholkonsum, hören also auch dann nicht mit dem Trinken<br />
auf, wenn sie genug haben (sind alkoholkrank)<br />
4. Spiegeltrinker (Delta-Typ): halten einen bestimmten Alkoholspiegel, um<br />
Entzugssymptome zu vermeiden und sind dementsprechend nicht<br />
abstinenzfähig (sind alkoholkrank)<br />
5. Quartalstrinker (Epsilon-Typ): haben trotz abstinenter Phasen immer<br />
wieder Phasen exzessiven Alkoholkonsums (sind alkoholkrank)<br />
Cloninger unterscheidet zwischen Typ-A- und Typ-B-Alkoholikern:<br />
Typ-A-Alkoholismus: Neurotischer Suchttypus (Hauptziel des Trinkens ist<br />
die Angstminderung: „harm avoidance“); später Beginn (nach 25), tritt bei<br />
Frauen und Männern gleichermaßen auf; weniger ausgeprägte<br />
Suchtsymptomatik; sozial eher unauffällig; bessere Prognose<br />
Typ-B-Alkoholismus: Psychopathologischer Suchttypus (Hauptziel des<br />
Trinkens ist die Verstärkung des Vergnügen: „sensation seeking“); früher<br />
Beginn (vor 25); tritt familiär gehäuft (genetische Komponente) und<br />
überwiegend bei Männern auf; ausgeprägtere Suchtsymptomatik; sozial<br />
auffällig (antisoziales Verhalten, Aggressionen etc.); schlechtere Prognose<br />
7.2.2. Zur kurz- und langfristigen Wirkung von Alkohol<br />
Alkohol (Ethanol) wirkt antagonistisch auf die NMDA- und auf GABAA-Rezeptoren.<br />
Erstere sind erregend (Glutamat), letztere hemmend (Gamma-Amino-Buttersäure);<br />
darüber hinaus erhöht Alkohol den Serotonin- und Dopaminspiegel. Was die<br />
kurzfristige Wirkung von Alkohol betrifft, kann vor diesem Hintergrund zwischen 2<br />
Phasen unterschieden werden (2-Phasen-Wirkung):<br />
1) Solange der Spiegel steigt, hat Alkohol eine stimulierende Wirkung; es<br />
überwiegen positive Emotionen.<br />
90
2) Singt der Spiegel dagegen, hat Alkohol eine sedierende Wirkung und es<br />
überwiegen negative Emotionen.<br />
Randbemerkung: Die kurzzeitige Wirkung von Alkohol scheint, zumindest wenn nur<br />
geringe Mengen konsumiert wurden, nicht zuletzt von den Erwartungen des Trinkers<br />
anzuhängen.<br />
Gibt man Pbn ein nach Alkohol schmeckendes, aber in Wahrheit alkoholfreies<br />
Getränk, verspüren diese die von ihnen erwartete Wirkung (z.B. erhöhte<br />
Aggressivität und sexuelle Erregung)<br />
Zu den langfristigen Wirkungen von Alkohol gehören:<br />
Toleranzsteigerung und Entzugserscheinungen: Um die hemmende Wirkung<br />
des Alkohols auszugleichen, steigern bestimmte Nervenbahnen ihre Aktivität;<br />
wird kein Alkohol mehr zugeführt, fehlt seine hemmende Wirkung und es<br />
kommt zu einem Zustand der Übererregtheit!<br />
Letzterer äußert sich in Schlafstörungen, Ruhelosigkeit, Tremors etc.<br />
(F 10.3: Entzugssyndrom); in besonders schlimmen Fällen kann es zu<br />
einem „Delirium tremens“ (F 10.4: Entzugssyndrom mit Delir) kommen.<br />
Leberzirrhose: Absterben und Entzündung von Leberzellen<br />
Amnestisches Syndrom (auch Korsakow-Syndrom genannt): Vitaminmangel<br />
führt zu Gedächtnislücken<br />
Unterernährung: Da Alkohol hochkalorisch ist, nehmen Alkoholiker oft nur<br />
noch wenig Nahrung zu sich; das Problem ist jedoch, dass Alkohol trotz der<br />
hohen Kalorienzahl kaum Nährstoffe enthält!<br />
Alkohol während der Schwangerschaft: Alkoholembryopathie (kleiner Kopf,<br />
weit auseinanderstehende Augen, flache Nase, verminderte Intelligenz,<br />
geschwächtes Immunsystem etc.)<br />
Außerdem: Bluthochdruck und Gefäßerkrankungen (=> daher die roten<br />
Nasen); Schädigung von Hirnzellen etc.<br />
Gesellschaftliche und familiäre Auswirkungen des Alkoholkonsums:<br />
Die von Personen mit Alkoholproblemen verursachten Kosten für das<br />
Gesundheitssystem sind rund doppelt so hoch wie die Kosten, die Abstinente<br />
verursachen.<br />
Alkoholismus führt auf Dauer zu Arbeitsunfähigkeit und Frühberentung!<br />
Annähernd die Hälfte aller Autounfälle ist auf übermäßigen Alkoholkonsum<br />
zurückzuführen (die stärkste Risikogruppe sind junge Männer)!<br />
Kriminalität: Etwa ein Drittel aller Festnahmen erfolgt wegen oder unter<br />
Beteiligung von Trunkenheit; über die Hälfte aller Gewaltverbrechen (Mord,<br />
Vergewaltigung etc.) wird unter Alkoholeinfluss begangen!<br />
Alkoholismus ist nicht zuletzt eine „Familienkrankheit“ – schließlich leiden<br />
auch die Angehörigen von Alkoholikern unter den Folgen der Störung<br />
(Unzuverlässigkeit, Arbeitslosigkeit, sexuelle und gewalttätige Übergriffe etc.)<br />
und entwickeln in Folge dessen häufig selbst psychische Störungen!<br />
Konsequenz: Nahestehende Personen sollten in die Therapie mit<br />
einbezogen werden!<br />
7.2.3. Komorbiditäten und Differentialdiagnose<br />
Alkoholismus weist eine extrem hohe Komorbiditätsrate auf: Die<br />
Lebenszeitprävalenz für zusätzliche psychiatrische Störungen (Angststörungen,<br />
Depression etc.) liegt bei Alkoholabhängigen bei 80%!<br />
Geschlechtsspezifische Unterschiede: Bei Frauen ist die Komorbiditätsrate<br />
insgesamt höher als bei Männern; besonders häufig sind dabei Angststörungen<br />
91
und affektive Störungen. - Bei Männern geht Alkoholismus häufig mit einer<br />
antisozialen Persönlichkeitsstörung einher.<br />
Alkoholabhängigkeit geht meist mit der Abhängigkeit von weiteren Substanzen einher<br />
(„Polytoxikomanie“); z.B. sind über 90% der Alkoholiker auch nikotinabhängig<br />
(was möglicherweise auf eine Kreuztoleranz von Alkohol und Nikotin zurückzuführen<br />
ist)!<br />
Hinzu kommen zahlreiche Begleit- und Folgeerkrankungen (z.B. alkoholinduzierte<br />
Psychosen, Suizidalität, Unterernährung etc.), die bei der Behandlung zwecks „Harm<br />
Reduction“ Vorrang haben (s.u.).<br />
Entzugssymptome: Patient fühlt sich ängstlich, depressiv, ruhelos, kann nicht<br />
schlafen; Tremor der Finger, Augenlider, Lippen und Zunge; Erhöhter Puls,<br />
erhöhter Blutdruck, erhöhte Körpertemperatur etc.<br />
Entzugssyndrom mit Delir (auch „Delirium tremens“ genannt): tritt bei 15%<br />
aller Alkoholabhängigen auf – und zwar 3 bis 4 Tage nach Beginn der<br />
Abstinenz; dauert 3 – 7 Tage und führt unbehandelt bei 10-20% der Fälle zum<br />
Tod (Herz-Kreislauf-Versagen)!<br />
Prodromalerscheinungen: Schlaflosigkeit, Unruhe, Angst, Zittern<br />
Symptome: Bewusstseinstrübung und Desorientierung, motorische Unruhe,<br />
überwiegend visuelle, z.T. aber auch taktile Halluzinationen (Patienten<br />
sehen die berühmten „weiße Mäuse“ und anderes Getier)<br />
Ein Delir ist ein akuter und lebensbedrohlicher psychiatrischer Notfall!!<br />
Alkoholabhängigkeit muss von riskantem bzw. schädlichem Alkoholkonsum<br />
unterschieden werden; bei letzterem kommt es laut ICD-10 zwar zu Schäden, es liegt<br />
aber keine Abhängigkeit vor.<br />
Faustregel (Grenzwerte):<br />
Frauen: max. 5 Mal in der Woche 20 g Alkohol/Tag (~ ½ l Bier)<br />
Männer: max. 5 Mal in der Woche 40g Alkohol/Tag (~ 1 l Bier)<br />
7.2.4. Epidemologie, Verlauf und Prognose<br />
Häufigkeit (in Deutschland):<br />
Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch reinen Alkohols liegt in Deutschland bei<br />
ca. 10 Litern; das entspricht einem halben Liter Bier und einem Glas Wein<br />
(0,2 Liter) pro Tag!<br />
50 % dieses Verbrauchs gehen dabei auf 7% der Bevölkerung zurück!<br />
Epidemiologie:<br />
1, 5 Mio. sind abhängig (= 2,4%)<br />
2,7 Mio. betreiben Alkoholmissbrauch (= 4%)<br />
7,9 Mio. legen einen riskanten Alkoholkonsum an den Tag (= 11%)<br />
Geschlechterspezifität: Männer trinken im Schnitt etwa 3 Mal so viel wie<br />
Frauen und sind daher auch wesentlich häufiger von alkoholbedingten<br />
Syndromen betroffen (s.o.).<br />
Alkoholabhängigkeit: 4 % zu 1%<br />
Alkoholmissbrauch: 5% zu 2%<br />
Fazit: Alkoholbedingte Störungen stellen bei Männern die häufigste, bei<br />
Frauen (nach Angststörungen) die zweithäufigste psychische Erkrankung dar!<br />
Kulturelle Unterschiede und aktuelle Tendenzen:<br />
Am höchsten ist der Alkoholkonsum in Nordamerika und Europa; auch dort<br />
bestehen jedoch zwischen den einzelnen Staaten z.T. große Unterschiede; am<br />
höchsten ist der Konsum in Gegenden, in denen viel Wein produziert wird<br />
(Italien, Frankreich, Californien etc.).<br />
92
Längsschnittstudien zeigen, dass sich die Länderunterschiede im Westen in<br />
den letzten Jahrzehnten verringert haben; darüber hinaus war zumindest bis<br />
in die 80er in fast allen Ländern ein Anstieg des Alkoholkonsums zu<br />
beobachten.<br />
In den letzten 25 Jahren ist dagegen ein stetiger Rückgang des<br />
Alkoholkonsums zu verzeichnen. Dem entgegen steht jedoch ein dramatischer<br />
Anstieg akuter Alkoholvergiftungen unter Jugendlichen (Stichwort:<br />
„Komasaufen“!).<br />
Als Reaktion auf diese Entwicklung wurde in Deutschland 2004 eine<br />
Sondersteuer auf Alkopops eingeführt!<br />
Krankheitsverlauf:<br />
Während man die Entwicklung zum Alkoholismus früher als kontinuierliche<br />
Abwärtsspirale auffasste (vom Geselligkeitstrinker zum Spiegeltrinker), weiß<br />
man heute, dass es keinen einheitlichen Krankheitsverlauf gibt. Stattdessen<br />
muss zwischen 3 Verlaufsformen unterschieden werden:<br />
1. Progrediente Verschlechterung<br />
2. Wechsel zwischen Trinkexzessen und kontrolliertem Konsum bzw.<br />
Abstinenz<br />
3. Spontanremission (bei ca. 20%): meist nach einschneidendem Ereignis<br />
(Geburt eines Kindes; spirituelles Erlebnis, Autounfall etc.)<br />
Alkoholiker haben ein um das 2-4-fache erhöhtes Mortalitätsrisiko (16.000-<br />
40.000 pro Jahr)<br />
Geschlechtsspezifische Unterschiede: Frauen fangen in der Regel später an zu<br />
trinken als Männer und der Anlass ist sehr häufig ein belastendes<br />
Lebensereignis (Familienkrise, Tod des Ehemanns etc.)<br />
Im Schnitt vergehen 6 - 9 Jahre, bis Alkoholismus effektiv behandelt wird!<br />
Damit ist Alkoholismus eine der am schlechtesten behandelten<br />
Krankheiten!<br />
Prognose:<br />
Günstige Bedingungen für Suchtausstieg:<br />
„Ersatzabhängigkeiten“ (z.B. Religion, Hobbys, Anonyme Alkoholiker…)<br />
Rituelle Erinnerung an Bedeutung der Abstinenz (Selbsthilfegruppen)<br />
Soziale und medizinische Unterstützung (z.B. Reintegration)<br />
Wiederherstellung der Selbstachtung der Betroffenen<br />
Typische Rückfallauslöser: unangenehme Gefühle (Ärger, Trauer etc.),<br />
Konflikte, soziale Verführung<br />
Fazit: Eine sichere individuelle Prognose ist nicht möglich; am besten scheint<br />
eine abstinenzfördernde Lebensumstellung und ein gezieltes Training im<br />
Umgang mit Rückfallsituationen zu wirken!<br />
7.2.5. Störungsmodelle<br />
Wie alle Drogen hat auch Alkohol eine verstärkende Wirkung: Er wirkt einerseits<br />
enthemmend und stimulierend (positive Verstärkung), andererseits dämpfend und<br />
beruhigend (negative Verstärkung). Darüber hinaus führt er zu einer Erhöhung der<br />
Dopaminkonzentration im Belohnungszentrum und zu vermehrter<br />
Endorphinausschüttung (s.o.).<br />
Die unmittelbar verstärkende Wirkung von Alkohol ist im Vergleich zu<br />
anderen Drogen jedoch verhältnismäßig gering (Zum Vergleich: Kokain führt<br />
zu einer ca. 35-fachen Erhöhung der Dopaminkonzentration, Alkohol lediglich<br />
zu einer Verdopplung) – die Wirkung von Alkohol ist dementsprechend nicht<br />
93
nur biochemisch bedingt, sondern hängt nicht zuletzt von psychischen<br />
Faktoren (Lernprozessen, Erwartungshaltungen etc.) ab!<br />
Eine besondere Rolle spielen die Erwartungen, die man an die Wirkung<br />
von Alkohol knüpft (s.o.): Je positiver diese Erwartungen sind, desto<br />
positiver erscheint einem nämlich die tatsächliche Wirkung! Erwartung<br />
und Wirkung verstärken sich also (zumindest im unteren Dosis-Bereich)<br />
wechselseitig!<br />
Auch die spannungsmindernde Wirkung von Alkohol scheint nicht nur<br />
mit dessen Wirkung auf die GABA-Rezeptoren zusammenzuhängen,<br />
sondern nicht zuletzt von kognitiven Faktoren abzuhängen: Sofern durch<br />
Alkohol die Aufmerksamkeitskapazität reduziert wird, können Sorgen<br />
nämlich nicht mehr hinreichend verarbeitet werden – vorausgesetzt<br />
natürlich, es besteht eine Möglichkeit zur Ablenkung. Besteht eine solche<br />
Möglichkeit nicht, kann nämlich auch der gegenteilige Effekt eintreten,<br />
indem der Betroffene dann die gesamte, wenn auch eingeschränkte<br />
Verarbeitungskapazität auf unangenehme Gedanken richtet.<br />
Der intrapsychische Teufelskreislauf: Alkoholabhängigkeit wird<br />
aufrechterhalten, indem der Anreiz von Alkohol stetig erhöht und der Konsum<br />
desselben automatisiert wird. Das geschieht u.a. durch kognitive Mechanismen, die<br />
sich ihrerseits wechselseitig verstärken.<br />
Beeinträchtigte Selbstwahrnehmung (mangelndes Selbstwertgefühl,<br />
Unterschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit etc.): rechtfertigt den eigenen<br />
Alkoholkonsum und erhöht den Anreiz („Ich schaffe das nicht!“; „Ich kann<br />
mich an niemanden wenden!“ usw. Mir bleibt also gar nichts anderes<br />
übrig, als Alkohol zu trinken.“)<br />
Unrealistische Wirkungserwartung: verstärkt die Wirkung (s.o.) und<br />
führt zu vermehrtem Konsum („Alkohol beruhigt/hilft/macht mich<br />
originell/…“)<br />
Suchtbezogene Grundannahmen: werden reflexartig aktiviert und meist<br />
nicht bewusst reflektiert („Oh, das war stressig. Jetzt brauche ich erst mal ein<br />
Glas Schnaps!“ Dahinter steht die Grundannahme: „Alkohol hilft, Stress zu<br />
verarbeiten“)<br />
Coping-Defizite: Da keine anderen Lösungsstrategien außer Alkohol<br />
ausprobiert werden, Alkohol aber in Wahrheit keine Lösungs- sondern eine<br />
Vermeidungsstrategie darstellt, können die Betroffenen irgendwann tatsächlich<br />
nicht mehr mit Problemen umgehen. Zum einen fehlt es ihnen an einem<br />
entsprechenden Verhaltensrepertoire, zum anderen an der nötigen Resilienz<br />
(Widerstandsfähigkeit gegenüber aversiven Reizen)!<br />
Abstinenzverletzungssyndrom: Wenn ein Alkoholiker erst einmal gegen das<br />
eigene Abstinenzgebot verstoßen hat („lapse“ = Fehltritt, Ausrutscher), fällt er<br />
mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz in seine alten Trinkgewohnheiten zurück<br />
(„relapse“ = Rückfall)!<br />
Der dahinter liegende Mechanismus: Bleibt ein Alkoholiker auch in<br />
Risikosituationen (also bei negativen Gefühlen, Konflikten oder sozialen<br />
Verführungssituationen) standhaft, stärkt das seinen Selbstwert und die<br />
Abstinenzzuversicht; die Wahrscheinlichkeit, auch in der nächsten<br />
Situation standhaft zu bleiben, steigt. Bleibt er dagegen nicht standhaft, ist<br />
es genau umgekehrt: negativer Selbstwert, geringe Abstinenzzuversicht,<br />
soziale Zurückweisung etc. => erhöhte Rückfallwahrscheinlichkeit (nach<br />
dem Motto: „ist der Ruf erst ruiniert,…“)<br />
94
Der neurobiologische Teufelskreislauf: Auf neurobiologischer Ebene tragen v.a.<br />
die Toleranzsteigerung, der Endorphinmangel und das Suchtgedächtnis zur<br />
Aufrechterhaltung der Abhängigkeit bei! Genau wie die kognitiven (und<br />
psychosozialen: s.u.) Mechanismen führen sie zu einer Erhöhung des Anreizes von<br />
Alkohol und zur Automatisierung des Alkoholkonsums.<br />
Toleranzentwicklung: Bei regelmäßigem Alkoholkonsum wird eine bis zum<br />
Faktor 2 erhöhte Menge für die gleiche Wirkung benötigt; bei abruptem<br />
Absetzen kommt es zu Entzugserscheinungen.<br />
Verantwortlich für diese Prozesse sind:<br />
a) Beschleunigung der entsprechenden Leberfunktionen, so dass der<br />
Alkohol schneller abgebaut werden kann<br />
b) Erhöhung der durch Alkohol gehemmten Neurotransmitteraktivitäten;<br />
Vermehrung von Rezeptoren; Neubildung von Synapsen<br />
c) Nach der Gegensatz-Prozess-Theorie (s.o.) die Verstärkung des<br />
b-Prozesses!<br />
Endorphinmangel: Da dauerhafter Alkoholkonsum zu einem Überschuss an<br />
Dopamin und Endorphinen führt, wird die köpereigene Produktion dieser<br />
Stoffe zurückgefahren. Mangelnde Selbstaktivierung des<br />
Belohnungssystems!<br />
Suchtgedächtnis: Dauerhafter Alkoholkonsum führt zu einer subkortikalen<br />
Sensitivierung Hypersensibilität des Belohnungszentrums für<br />
Alkoholstimuli („Cue-Reactivity“); es werden „Schlüsselreize“ gelernt, die<br />
Sichtverhalten auslösen.<br />
Der psychosoziale Teufelskreislauf:<br />
Problematische Trinkkultur in der Gesellschaft: Alkohol ist fester<br />
Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens (Sektempfänge, Stammtische etc.)<br />
und wird von den Medien z.T. glorifiziert (Werbung usw.) Gruppendruck<br />
Veränderte Familieninteraktion: Die Abhängigkeit eines Familienmitglieds<br />
hat Einfluss auf das Verhalten der anderen Familienmitglieder; vielfach<br />
geraten letztere in eine sog. „Co-Abhängigkeit“: sie übernehmen Aufgaben<br />
des Abhängigen, opfern sich für ihn auf und versuchen, dessen Abhängigkeit<br />
nach außen hin zu vertuschen. Dadurch wird die Abhängigkeit des Betroffenen<br />
latent oder direkt unterstützt („Enabling“)!<br />
Sozialer Abstieg: Alkoholismus führt häufig zu Scheidung,<br />
Arbeitsplatzverlust, Ablehnung durch die Umwelt und anderen Problemen,<br />
wobei diese negativen Erfahrungen erneut Anlass zum Trinken geben<br />
(Verwechslung von Ursache und Wirkung!)<br />
Mangel an Alternativressourcen: Ressourcen, die eine Alternative zum<br />
Alkoholkonsum darstellen (wie z.B. soziale Anerkennung oder beruflicher<br />
Erfolg) sind meist erst nach längerer Abstinenz verfügbar; durch diese<br />
Zeitverzögerung wird die Rückfallwahrscheinlichkeit enorm erhöht!<br />
Verhaltensökonomisches Rückfallmodell: Nicht die Suchtvergangenheit<br />
ist entscheidend, sondern die Lebensumstände im Anschluss an die<br />
Suchtbehandlung!<br />
Schlussfolgerungen für die Therapie:<br />
Motivationspsychologische Niederschwelligkeit<br />
Keine konfrontative Grundhaltung, sondern Verständnis<br />
Ziel muss es sein, möglichst viele Betroffene möglichst früh in ihrer<br />
Suchtentwicklung zu erreichen<br />
95
Harm Reduction<br />
Die Sicherung des Überlebens und die Verhinderung bzw. Behandlung<br />
schwerer Folge- und Begleitschäden haben Vorrang!<br />
Beachtung subcortikaler Prozesse und eingeschränkter Willensfreiheit<br />
Ein gezieltes Training zur Überwindung des Suchtreflexes ist erforderlich<br />
Außerdem müssen Bewältigungsstrategien für Rückfallsituationen<br />
vermittelt werden<br />
Zukunftsorientierung der Behandlung<br />
Bedingungen im Anschluss an die Behandlung sind entscheidend<br />
(Abstinenzentwicklung); nicht zuletzt deshalb ist es sinnvoll, die<br />
Bezugspersonen in die Therapie mit einzubeziehen.<br />
7.2.6. Praktische Hinweise zu Diagnose und Indikation<br />
Patienten kommen i.d.R. nicht aus freien Stücken, sondern aufgrund körperlicher<br />
Probleme oder auf Druck anderer (Arbeitgeber, Familie etc.) in die Therapie! Daraus<br />
ergeben sich folgende Konsequenzen:<br />
Der Therapeut wird vielfach nicht als Helfer, sondern als Verbündeter<br />
derjenigen gesehen, von denen der Patient zur Behandlung gedrängt wurde; es<br />
gilt also bereits im Vorgespräch, Widerstände abzubauen und Vertrauen<br />
aufzubauen! Im Rahmen der Diagnostik geht es also nicht nur um<br />
Informationsgewinnung, sondern zugleich darum, den Patienten zu motivieren.<br />
„First things first“:<br />
Die Behandlung von Folge- und Begleiterkrankungen hat Vorrang vor der<br />
eigentlichen Entwöhnungstherapie (s.o.) => Ziel: „Harm Reduction“!<br />
Mit betrunkenen Patienten zu arbeiten macht keinen Sinn => Patienten also<br />
immer vorher ausnüchtern lassen!<br />
Ob eine stationäre oder eher eine ambulante bzw. teilstationäre Behandlung<br />
vorzuziehen ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Beides hat vor- und<br />
Nachteile.<br />
Stationäre Behandlung: ermöglicht eine intensivere Therapie und bietet eine<br />
stärkere Entlastung von Alltagsproblemen<br />
Sie ist indiziert: bei behandlungsbedürftigen psychischen Störungen (z.B.<br />
Delir oder Psychose), wenn der Patient schon mehrere Therapien<br />
abgebrochen hat bzw. wiederholt rückfällig wurde und kein soziales<br />
Stützsystem vorhanden ist.<br />
Ambulante/teilstationäre Behandlung: ist billiger und ermöglicht eine<br />
leichtere Einbeziehung von Bezugspersonen<br />
Sie ist indiziert: wenn der Patient nicht weit weg wohnt, ein soziales<br />
Stützsystem vorhanden ist, und davon auszugehen ist, dass es ungünstig<br />
wäre, ihn aus der Familie oder dem Beruf herauszureißen!<br />
7.2.7. Zur Behandlung von Alkoholismus<br />
Motivierung: Der erste und vielleicht wichtigste Schritt jeder Suchttherapie besteht<br />
darin, ein Problembewusstsein zu schaffen, sprich: Der Klient muss seine Sucht<br />
zugeben und beschließen, etwas dagegen zu unternehmen. Erreicht werden kann<br />
dieses Ziel durch die Methode des „Motivational Interviewing“ ( konfrontativer<br />
Interaktionsstil).<br />
„Motivational Interviewing“ (MI) ist eine motivierende Form der<br />
Gesprächsführung, im Zuge derer versucht wird, Ambivalenzen aufzuzeigen<br />
96
und zu überwinden, um auf diese Weise (und nicht etwa durch Überredung<br />
oder Druck) beim Klienten eine Veränderungsmotivation zu erzeugen.<br />
Die Methode basiert auf folgenden 4 Prinzipien:<br />
1. Empathie (nicht von der eigenen Wirklichkeit ausgehen, sondern von<br />
der des Patienten)<br />
2. Herausarbeitung von Diskrepanzen (dem Patienten die Diskrepanz<br />
zwischen seinem aktuellen Verhalten und seinen Wunschzielen vor<br />
Augen führen, die negativen Konsequenzen des aktuellen Verhaltens<br />
herausarbeiten etc.)<br />
3. Geschmeidiger Umgang mit Widerstand (Widerstand nicht auf den<br />
Patienten, sondern auf die Interaktion zurückführen und<br />
gegebenenfalls den eigenen Interaktionsstil ändern, etwa indem eine<br />
neue Perspektive eingenommen wird)<br />
4. Stärkung der Änderungszuversicht (dem Patienten das Gefühl geben,<br />
selbst verantwortlich zu sein und es selbst in der Hand zu haben, etwas<br />
zu ändern => Selbstwirksamkeit vermitteln)<br />
Techniken der motivierenden Gesprächsführung:<br />
Offene Fragen (die nicht mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten sind)<br />
Aktives Zuhören („mhmh“, „aha“; „sie meinen also, dass…“)<br />
Zusammenfassungen (um dem Patienten seine Äußerungen zu<br />
spiegeln)<br />
Würdigung und positive Wertschätzung (Verständnis und Lob<br />
äußern)<br />
Offener und sensibler Umgang mit Widerstand<br />
Förderung von „change talk“ (den Patienten darin bestärken,<br />
bejahend über die von ihm angestrebten Veränderungen zu sprechen)<br />
Förderung von „confidence talk“ (den Patienten darin bestärken,<br />
zuversichtlich über die Erfolgsaussichten seiner Vorhaben zu<br />
sprechen)<br />
Entgiftung: Vielfach ist eine Entgiftung notwendig; sie kann stationär oder ambulant<br />
durchgeführt werden und dauert ca. einen Monat; meist wird eine solche Entgiftung<br />
medikamentös begleitet (Tranquilizer, krampflösende Medikamente etc.), um die<br />
unangenehmen Entzugserscheinungen abzumildern.<br />
Medikamentöse Behandlung: kann psychotherapeutische Maßnahmen ergänzen,<br />
aber niemals ersetzen.<br />
Folgende Medikamente werden zur Behandlung von Alkoholismus eingesetzt:<br />
„Anti-Craving“-Medikamente (z. B. Acamprosat): haben eine<br />
erregungshemmende Wirkung und führen dadurch zu einer Reduktion des<br />
Alkoholverlangens; eingesetzt werden sie überwiegend im ambulanten<br />
Setting; da im stationären Setting eher auf die Vermeidung von<br />
Rückfallsituationen gesetzt wird; die Einnahmedauer liegt zwischen 6 und<br />
12 Monaten (Problem: hohes Drop out!); verschrieben werden sollten sie<br />
nur, wenn trotz Cravings eine eindeutige Abstinenzmotivation vorliegt und<br />
mit einer regelmäßigen Einnahme gerechnet werden kann!<br />
Antabus (Wirkstoff: Disulfiram): blockiert den Alkoholmetabolismus und<br />
führt dadurch, sobald Alkohol konsumiert wird, zu Übelkeit; Probleme:<br />
hohe Abbrecherquote (80%); wird das Medikament nach dem<br />
Alkoholkonsum eingenommen, besteht Lebensgefahr!<br />
Zusätzlich: medikamentöse Behandlung komorbider Störungen<br />
(Antidepressiva, Tranquilizer etc.)<br />
97
Der Einsatz von Medikamenten zur Behandlung von Alkoholismus ist aus 3<br />
Gründen problematisch:<br />
1. Ist die Leber von Alkoholikern meist beschädigt, so das die<br />
Metabolisierung des Medikaments gestört sein kann<br />
2. Führen Medikamente leicht in erneute Abhängigkeiten<br />
3. Ist die Behandlung eines Substanzmissbrauchs durch eine andere Substanz<br />
kaum dazu geeignet, ein Bewusstsein für neue Problemlösestrategien zu<br />
fördern!<br />
Wirksamkeit: Medikamentöse Behandlung ist durchaus wirksam, allerdings<br />
nur in Kombination mit Psychotherapie!<br />
Psychotherapeutische Maßnahmen: verfolgen im Wesentlichen 3 Ziele (s.o.), es<br />
geht ihnen a) um den Aufbau einer Veränderungsbereitschaft; b) um eine effektive<br />
Rückfallprävention und c) um die Behandlung begleitender Störungen!<br />
Verhaltenstherapeutische Maßnahmen:<br />
Aversionstherapie: Alkoholkonsum wird an aversive Reize<br />
<br />
(Elektroschocks, medikamentös erzeugte Übelkeit) geknüpft (Bestrafung).<br />
Andere operante Maßnahmen: Abstinenz, mäßiger Konsum (Nippen statt<br />
Schlucken, Verzicht auf harte Alkoholika etc.) und Vermeidung von<br />
Risikosituationen (Kneipenbesuche etc.) werden positiv verstärkt.<br />
Ablehnungstraining (Lernen, nein zu sagen)<br />
Expositionsübungen mit Reaktionsvermeidung<br />
Vermittlung alternativer Problemlösestrategien: Entspannungsübungen;<br />
Selbstsicherheits- und Sozialkompetenztrainings; Unterstützung bei der<br />
Arbeitssuche etc.<br />
Kognitive Maßnahmen:<br />
Informationsvermittlung & Auseinandersetzung mit Abhängigkeit (z.B.<br />
Aufklärung darüber, wie viel tatsächlich getrunken wird, da Alkoholiker<br />
dazu neigen, den Alkoholkonsum anderer zu überschätzen)<br />
Arbeit am Selbstbild (Konfrontation mit Videoaufzeichnungen von sich<br />
selbst im betrunkenen Zustand etc.)<br />
Familientherapeutische Maßnahmen:<br />
Verbesserung der familiären Interaktion<br />
Gruppentherapie: kann sehr motivierend wirken!<br />
„Anonyme Alkoholiker“ und anderen Selbsthilfegruppen: geht es darum, einen<br />
abstinenten Lebensstil und eine entsprechende Identität aufzubauen. Voraussetzung<br />
für die Aufnahme ist die Anerkennung der eigenen Sucht sowie die regelmäßige<br />
Teilnahme an den Treffen (bis zu 4 Mal die Woche!); meist dauert das Ganze ein Jahr<br />
(viele brechen jedoch vorher ab); die Mitglieder sind rund um die Uhr füreinander da<br />
und unterstützen sich in Risikosituationen (soziales Netz).<br />
Die AA fordern völlige Abstinenz und sind stark spirituell angehaucht; ihr<br />
12-stufiges Programm basiert auf dem Glauben, dass letztlich nur Gott den<br />
Einzelnen aus seiner Sucht befreien kann und zielt auf ein „spirituelles<br />
Erwachen“.<br />
Wirksamkeit: Selbsthilfegruppen wie die AA haben sich insbesondere bei der<br />
Vermeidung von Rückfällen als wirksam erwiesen.<br />
Streitfrage: Die Frage, ob Abstinenz oder kontrolliertes Trinken Ziel der<br />
Behandlung sein sollte, ist umstritten. Nachdem lange Zeit ausschließlich für ersteres<br />
plädiert wurde, wird in jüngerer Zeit zunehmend auch die 2. Position vertreten.<br />
Mäßigen Alkoholkonsum anstatt völlige Abstinenz anzustreben, hat folgende<br />
Vorteile: 1) ist ein derartiges Behandlungsziel näher an der gesellschaftlichen<br />
Wirklichkeit; 2) kann dadurch das Abstinenzverletzungssyndrom abgemildert<br />
98
werden, sofern ein „Ausrutscher“ nicht als komplette Niederlage angesehen<br />
werden muss; 3) fördert ein kontrollierter Umgang mit Alkohol die<br />
Selbstachtung.<br />
Das Problem ist jedoch, dass trotz vereinzelter Behandlungserfolge in den<br />
meisten Fällen eben doch die „Alles-oder-Nichts“-Devise zu gelten scheint!<br />
99
8. Persönlichkeitsstörungen<br />
8.1. Persönlichkeitsstörungen allgemein<br />
8.1.1. Zur Diagnose von Persönlichkeitsstörungen<br />
Im DSM-IV werden Persönlichkeitsstörungen als überdauernde, unflexible und<br />
tiefgreifende Erlebens- und Verhaltensmuster definiert, die von den Erwartungen der<br />
soziokulturellen Umwelt abweichen.<br />
A. Dabei müssen sich ein solches Muster in mindestens 2 der folgenden<br />
Bereichen manifestieren:<br />
Kognition<br />
Affektivität<br />
Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen<br />
Impulskontrolle<br />
B. Es muss unflexibel und tiefgreifend sein (s.o.) und in vielen persönlichen<br />
und sozialen Situationen zum Tragen kommen.<br />
C. Leiden oder Beeinträchtigungen in wichtigen Funktionsbereichen<br />
D. Stabiles und lang andauerndes Muster mit Beginn im Jugend- oder frühen<br />
Erwachsenenalter<br />
Dient zur Abgrenzung von Persönlichkeitsveränderungen, die erst im<br />
Erwachsenenalter einsetzen und meist auf Substanzmissbrauch oder<br />
hirnorganische Schädigungen zurückgehen!<br />
Die Diagnose von Persönlichkeitsstörungen ist aus mehreren Gründen problematisch:<br />
1) Persönlichkeitsstörungen treten oft komorbid mit anderen Störungen auf,<br />
wobei sie großen Einfluss auf deren jeweilige Ausprägung haben. M.a.W.:<br />
Persönlichkeitsstörungen können den Kontext für andere psychische Störungen<br />
bilden und diese auf verschiedene Weise prägen.<br />
2) Das Phänomen der „Ich-Syntonie“: Persönlichkeitsstörungen werden von<br />
Patienten meist nicht als solche erkannt, sondern für normal gehalten.<br />
3) Dem entspricht, dass Leute mit einer Persönlichkeitsstörung meistens nicht<br />
wegen der Persönlichkeitsstörung, sondern wegen einer anderen Störung (z.B.<br />
Depression) in die Behandlung kommen.<br />
Im DSM-IV werden Persönlichkeitsstörungen vor diesem Hintergrund auf<br />
einer getrennten Achse, der Achse II, angeordnet (s.o.). Dadurch soll darauf<br />
aufmerksam gemacht werden, dass Persönlichkeitsstörungen oft zusätzlich<br />
zu anderen Störungen auftreten und daher einer gesonderten Diagnose<br />
bedürfen.<br />
4) Komorbidität mehrerer Persönlichkeitsstörungen: Häufig erfüllen<br />
Patienten die Kriterien mehrerer Persönlichkeitsstörungen.<br />
Beispiel: Auf über 50 % der Patienten mit einer Borderline-Störung treffen<br />
auch die Kriterien für eine schizotypische-, antisoziale- oder histrionische<br />
Persönlichkeitsstörung zu!<br />
5) Bei den Merkmalen einer Persönlichkeitsstörung handelt es sich um<br />
kontinuierliche Variablen, die bei „normalen“ Persönlichkeiten lediglich<br />
weniger stark ausgeprägt sind!<br />
Vor diesem Hintergrund wird diskutiert, ob im Zusammenhang mit<br />
Persönlichkeitsstörungen nicht ein dimensionaler Klassifikationsansatz<br />
passender wäre!<br />
100
6) Die Restest-Reliabilitäten, die oft recht niedrig ausfallen, zeigen, dass<br />
keineswegs alle Persönlichkeitsstörungen so stabil sind, wie oft angenommen<br />
wird!<br />
Trotzdem ist die Postulierung verschiedener Persönlichkeitsstörungen sinnvoll.<br />
1) Haben sie einen jeweils spezifischen Einfluss auf die Ausprägung anderer<br />
Störungen (Validität)<br />
2) Sind die Interrater-Reliabilitäten durchweg hoch; versch. Diagnostiker<br />
kommen also meist zu demselben Ergebnis.<br />
8.1.2. Die verschiedenen Persönlichkeitsstörungen im Überblick<br />
Insgesamt wird zwischen 10 verschiedenen Persönlichkeitsstörungen<br />
unterschieden. Im DSM-IV werden sie 3 Hauptgruppen bzw. Clustern zugeordnet:<br />
Cluster A: Persönlichkeitsstörungen mit absonderlichem oder exzentrischem<br />
Verhalten<br />
Paranoide Persönlichkeitsstörung (~ 1%)<br />
Schizoide Persönlichkeitsstörung (< 1%)<br />
Schizotypische Persönlichkeitsstörung (~ 3%)<br />
Cluster B: Persönlichkeitsstörungen mit dramatischem, emotionalem oder<br />
launenhaften Verhalten<br />
Borderline- oder emotional instabile Persönlichkeitsstörung (1-2%)<br />
Histrionische Persönlichkeitsstörung (2-3%)<br />
Narzisstische Persönlichkeitsstörung (< 1%)<br />
Dissoziale bzw. antisoziale Persönlichkeitsstörung (♂ ca. 3%; ♀ ca. 1%)<br />
Cluster C: Persönlichkeitsstörungen mit ängstlichem oder furchtsamen<br />
Verhalten<br />
Vermeidend-selbstunsichere, ängstliche Persönlichkeitsstörung (~1%)<br />
Dependente Persönlichkeitsstörung (> 1,5%)<br />
Zwanghafte Persönlichkeitsstörung (~1%)<br />
A) Cluster A<br />
Die Persönlichkeitsstörungen aus Cluster A zeichnen sich durch absonderliches oder<br />
exzentrisches Verhalten aus und gelten für gewöhnlich als weniger schwerwiegende<br />
Varianten der Schizophrenie. Sie zeichnen sich nämlich nicht nur durch Symptome<br />
aus, die denen der prodromalen bzw. residualen Phase der Schizophrenie ähneln,<br />
sondern treten bei Verwandten von Schizophrenie-Patienten besonders gehäuft auf,<br />
was für eine gemeinsame genetische Basis spricht!<br />
Im ICD-10 wird die schizotypische Persönlichkeitsstörung daher als schizotype<br />
Störung (F 21) zu den schizophrenen und paranoiden Störungen gezählt!<br />
Die paranoide Persönlichkeitsstörung (~1%): ist durch übertriebenes Misstrauen<br />
und einen ausgeprägten Pessimismus gekennzeichnet. Betroffene erwarten immer nur<br />
Schlechtes, zweifeln permanent an den Absichten ihrer Mitmenschen, sind extrem<br />
eifersüchtig und oft feindselig.<br />
Differentialdiagnose:<br />
Anders als bei der Schizophrenie und der wahnhaften Störung treten jedoch<br />
weder Halluzinationen, noch vollausgeprägte Wahnvorstellungen auf.<br />
Starke Überlappung mit den übrigen Cluster-A-, der Borderline- und der<br />
vermeidend-selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung.<br />
Die schizoide Persönlichkeitsstörung (< 1%): zeichnet sich durch Emotionslosigkeit,<br />
Gleichgültigkeit und extreme soziale Zurückgezogenheit aus.<br />
Differentialdiagnose: Starke Überlappung mit den übrigen Cluster-A-<br />
Störungen und der vermeidend-selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung!<br />
101
Die schizotypische Persönlichkeitsstörung (~3%): zeichnet sich durch soziale<br />
Ängste, extreme Zurückgezogenheit und verschiedene exzentrische Symptome aus,<br />
die an die Schizophrenie erinnern: besonders häufig sind paranoide Vorstellungen,<br />
massiver Aberglaube und Beziehungsideen (die Überzeugung, dass Ereignisse etwas<br />
mit einem selbst zu tun haben).<br />
Differentialdiagnose: starke Überlappung zu den übrigen Cluster-A-Störungen,<br />
der Borderline-, der narzisstischen- und der vermeidend-selbstunsicheren<br />
Persönlichkeitsstörung<br />
Laut ICD-10 keine Persönlichkeitsstörung, sondern eine schizophrene Störung<br />
(s.o.)<br />
B) Cluster B<br />
Die Borderline- oder emotional instabile Persönlichkeitsstörung (1-2%): zeichnet<br />
sich v.a. durch instabile, extrem wechselhafte Emotionen und Verhaltensweisen und<br />
ein hohes Maß an Impulsivität aus.<br />
Siehe: Kapitel 8.2.<br />
Die histrionische (früher: hysterische) Persönlichkeitsstörung (2-3%): zeichnet<br />
sich durch übertrieben dramatisches Verhalten, extreme Ich-Zentriertheit,<br />
Oberflächlichkeit und ein enormes Aufmerksamkeitsbedürfnis aus. Betroffene (meist<br />
Frauen) versuchen verzweifelt, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen: sie beschäftigen<br />
sich übermäßig mit ihrem Äußeren, sind gewollt verführerisch und übertreiben<br />
maßlos.<br />
Hohe Komorbidität mit der Borderline-Störung und Depression!<br />
Beispiel: Tessa!<br />
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung (
C) Cluster C<br />
Die vermeidend-selbstunsichere, ängstliche Persönlichkeitsstörung (~1%): wird<br />
von manchen als schwere Form der generalisierten Sozialphobie betrachtet.<br />
Betroffene haben ein schlechtes Selbstbild, lassen sich nur sehr zögerlich auf<br />
Beziehungen ein und haben große soziale Ängste.<br />
Hohe Komorbidität mit der dependenten- und der Borderline-PS sowie mit<br />
Depression und der generalisierten sozialen Phobie.<br />
Die dependente (=abhängige) Persönlichkeitsstörung (etwas über 1,5%): zeichnet<br />
sich durch fehlendes Selbstvertrauen, Entscheidungsunfähigkeit und eine hohe<br />
Abhängigkeit von anderen aus. Betroffene haben große Angst davor, verlassen zu<br />
werden, und ein starkes Bedürfnis danach, versorgt zu werden.<br />
Komorbiditäten mit nahezu allen Persönlichkeitsstörungen, der bipolaren<br />
Störung, Depressionen, Angststörungen und Bulimie.<br />
Die zwanghafte Persönlichkeitsstörung (~1%): Perfektionismus, Detailversessenheit,<br />
Entscheidungsunfähigkeit, Inflexibilität, Arbeit geht über Freizeit etc.<br />
Differentialdiagnose: Anders als bei der Zwangsstörung treten keine<br />
Zwangsgedanken und Zwangshandlungen auf!<br />
Komorbiditäten: Die zwanghafte PS betrifft nur bei einer Minderheit der<br />
Patienten mit Zwangsstörung! Am häufigsten tritt sie zusammen mit der<br />
vermeidend-selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung auf!<br />
8.2. Die Borderline-Störung im Speziellen<br />
8.2.1. Geschichte des Störungsbegriffes:<br />
Adolf Stern (1938): Der Begriff „Borderline“ basiert auf der psychoanalytischen<br />
Grundannahme, dass sich psychische Störungen auf einem Kontinuum zwischen<br />
„neurotisch“ und „psychotisch“ bewegen, wobei Borderline-Patienten auf der Grenze<br />
(„Borderline“) zwischen diesen beiden Zuständen angesiedelt wurden.<br />
Neurose = weniger schlimm, da nur einen Teil der Persönlichkeit betreffend<br />
und entwicklungsbedingt (nicht verarbeiteter Konflikt)<br />
Psychose = die gesamte Persönlichkeit betreffend, biologisch bedingt!<br />
Kernberg (1967): Patienten mit einer „Borderline-Persönlichkeitsorganisation“<br />
unterscheiden zwar zwischen „gut“ und „böse“, haben in ihrer Kindheit aber nicht<br />
gelernt, das Selbst von anderen Objekten zu trennen. Einerseits projizieren sie eigene<br />
Gedanken und Gefühle in andere (projektive Identifikation), andererseits<br />
übernehmen sie die Gedanken und Gefühle anderer als ihre eigenen (Introjektion).<br />
Historisch lassen sich 4 Hauptströmungen unterscheiden:<br />
1) Die Borderline-Störung als subschizophrene Störung (ca. 1920-1965)<br />
2) Die Borderline-Störung als subaffektive Störung<br />
3) Die Borderline-Störung als Störung der Impulskontrolle<br />
4) Die Borderline-Störung als schwere Form der Posttraumatischen Belastungsstörung<br />
(wird v.a. in jüngster Zeit häufig vertreten)<br />
Seit dem DSM III (1980): operationalisierte Kriterien!<br />
8.2.2. Diagnostik<br />
Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV: Die Borderline-Persönlichkeitsstörung<br />
beginnt i.d.R. im frühen Erwachsenenalter und ist durch ein hohes Maß an<br />
Impulsivität und extreme Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen, im<br />
Selbstbild und in den Affekten gekennzeichnet.<br />
103
Dabei müssen mindestens 5 der folgenden 9 Symptome vorliegen:<br />
1. Verzweifeltes Bemühen, Verlassenwerden zu vermeiden<br />
2. Intensive, aber instabile zwischenmenschliche Beziehungen, die durch<br />
einen Wechsel von Idealisierung und Entwertung gekennzeichnet sind<br />
3. Identitätsstörung, genauer: Instabilität des Selbstbildes und der<br />
Selbstwahrnehmung<br />
4. Impulsivität in mindestens 2 potenziell selbstschädigenden Bereichen<br />
5. Wiederholte suizidale Handlungen, Selbstmordandeutungen und<br />
-drohungen oder Selbstverletzungen<br />
6. Affektive Instabilität (z.B. erhöhte Reizbarkeit, Angstattacken usw.)<br />
7. Chronisches Gefühl von Leere<br />
8. Unangemessene oder unkontrollierbare Wut<br />
9. Vorübergehende paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative<br />
Symptome (z.B. Depersonalisationsercheinungen)<br />
In der ICD-10 ist die Borderline-Störung keine eigene Persönlichkeitsstörung, sondern<br />
eine Unterform der „emotional instabilen Persönlichkeitsstörung“ (F 60.3), die<br />
sich in einen „impulsiven Typus“ (F 60.30) und einen „Borderline-Typus“ (F 60.31)<br />
unterteilt; die Kriterien für letzteren entsprechen weitegehend denen des DSM-IV.<br />
Die Symptomatik der Borderline-Störung lässt sich auf klinischer Ebene in 5<br />
Problembereiche gliedern:<br />
1) Affektregulation<br />
Niedrige Reizschwelle (=> Überempfindlichkeit)<br />
Hohes Erregungsniveau (=> sehr heftige Emotionen)<br />
Widersprüchlichkeit (=> aversive Spannungszustände)<br />
2) Selbstbild<br />
Unsicherheit bezüglich der eigenen Identität und Integrität („weit entfernt<br />
von sich selbst“; „sich selbst ausgeliefert“); Patienten schwanken oft<br />
zwischen Minderwertigkeitskomplexen und Omnipotenzfantasien; haben<br />
widersprüchliche Überzeugungen, Werte usw.<br />
3) Psychosoziale Integration<br />
Gefühl der Andersartigkeit und Einsamkeit<br />
Schwierigkeiten in der Nähe-Distanz-Regulation (Patienten haben<br />
einerseits Sehnsucht nach Nähe, andererseits Angst davor; sind anderen<br />
gegenüber oft verletzend, empfinden physische Abwesenheit als<br />
Verlassenheit etc.)<br />
„Passive Aktivität“ (Patienten demonstrieren Hilflosigkeit, um<br />
Aufmerksamkeit und Zuwendung zu bekommen)<br />
Überlastung der Sozialkontakte (Patienten erwarten zu viel von ihrem<br />
Umfeld und sind extrem anstrengend!)<br />
4) Kognitive Funktionsfähigkeit<br />
Ca. 65% leiden unter ausgeprägter dissoziativer Symptomatik<br />
(Depersonalisations- und Derealisationserleben)<br />
Intrusionen (Erinnerung und Wiedererleben traumatischer Ereignisse)<br />
Pseudopsychotische Symptomatik (akustische und optische<br />
Halluzinationen, die jedoch als ichsynton, d.h. von innen kommend, erlebt<br />
werden; magisches und paranoides Denken; übertriebener Argwohn etc.)<br />
Extremes „Schwarz-Weiß-Denken“, so dass z.B. gute und schlechte Seiten<br />
eines Menschen nicht in ein Ganzes integriert werden können<br />
Neuropsychologische Leistungsfähigkeit ist nicht eingeschränkt<br />
104
5) Verhaltensebene<br />
Selbstverletzungen bei 70-80% der Patienten (Schnittverletzungen,<br />
Brandverletzungen mit Zigaretten oder Bügeleisen; Head-banging etc.),<br />
wobei diese meist nicht als schmerzhaft, sondern als entspannend und<br />
beruhigend, in manchen Fällen sogar als euphorisierend (Kick) erlebt<br />
werden.<br />
Hochrisikoverhalten zur Regulation der Ohnmachtsgefühle (z.B.<br />
gefährliches Balancieren auf Brücken etc.)<br />
Impulsivität (z.B. im Geldausgeben oder sexuellen Kontakten)<br />
Zentrale Hypoxie (Sauerstoffreduktion im Gehirn)<br />
Störungen des Ess- und Trinkverhaltens<br />
8.2.3. Epidemiologie und Komorbiditäten<br />
Epidemiologie:<br />
Die Lebenszeitprävalenz liegt zwischen 1 und 2 % (s.o.)<br />
60-70% der Erkrankten sind Frauen; diese sind demnach deutlich häufiger<br />
betroffen als Männer!<br />
Ca. 80% der Erkrankten befinden sich in Behandlung<br />
Nur rund 1/3 der Betroffenen lebt in fester Beziehung oder ist verheiratet.<br />
Nur rund 1/3 steht im Berufsleben.<br />
Verlauf:<br />
Alter bei Erstmanifestation: bimodale Verteilung<br />
Bereits im Alter von 14 Jahren Verhaltensauffälligkeiten (Essstörungen,<br />
Suizidversuche, affektive Störungen, selbstverletzendes Verhalten)<br />
Im Alter von 24 Jahren Ausbruch der Störung<br />
Suizidrate: 7-10%<br />
Therapie-Abbruchquote: 75%!!<br />
Komorbiditäten:<br />
Komorbide Achse-I-Störungen:<br />
Depressive Störungen: Lebenszeitprävalenz ca. 98%<br />
Angststörungen: Lebenszeitprävalenz ca. 90%<br />
Schlafstörungen: 50%<br />
Substanzmissbrauch: Frauen: 40%; Männer: 60%<br />
Essstörungen: Frauen: 60%<br />
Psychotische Störungen: 1%<br />
Komorbide Persönlichkeitsstörungen:<br />
Dependente: 50%<br />
Ängstlich-vermeidende: 40%<br />
Paranoide: 40% (v.a. bei Männern)<br />
Antisoziale: 25%<br />
Histrionische: 15%<br />
8.2.4. Praktische Hinweise zu Diagnostik und Therapie<br />
Stufenplan der klinischen Diagnostik:<br />
Leitsymptom (!): Häufig einschießende, äußerst unangenehme Spannung<br />
ohne differenzierte emotionale Qualität!<br />
Überprüfung der DSM-IV-Kriterien<br />
Evtl. unter Zuhilfenahme des IPDE („International Personality Disorder<br />
Eximination“) => strukturiertes Experteninterview zur allgemeinen<br />
105
Diagnose von Persönlichkeitsstörungen, das die Kriterien des DSM-IV und<br />
der ICD-10 integriert!<br />
SKID-I zur Diagnostik von Komorbiditäten und evtl. Ausschluss<br />
schizophrener Erkrankungen<br />
Ausschluss organischer Faktoren<br />
Diagnostisches Interview für das Borderline-Syndrom, revidierte Fassung<br />
(DIB-R) => internationaler Standard!<br />
Borderline-Symptom-Liste (BSL) => dient zur Erfassung des Schwergrads<br />
und des Verlaufs!<br />
8.2.5. Das neurobehaviorale Störungsmodell<br />
Das neurobehaviorale Modell der Borderline-Störung ist ein Diathese-Stressmodell,<br />
Es führt die Störung auf ein Zusammenspiel neurobiologischer und psychosozialer<br />
Variablen sowie negative Rückkopplungsprozesse zurück.<br />
(Frühe) Traumata<br />
- Frühe sexuelle oder körperliche<br />
Gewalt<br />
- Vernachlässigung durch die primäre<br />
Bezugsperson<br />
- Fehlende zweite Bezugsperson<br />
- Gewalt im Erwachsenenalter<br />
Störung der Affektregulation<br />
Neurobiolologische Prädisposition<br />
- Konkordanzen: EE (55%) vs. ZZ (14%)<br />
- Weibliches Geschlecht (oder<br />
Sozialisation?!)<br />
- Niedriger Seritoninspiegel (=><br />
Impulsivität?)<br />
- Übersensibilität und Verkleinerung der<br />
Amygdala und des Hippocampus<br />
(~limbisches System)<br />
- Erhöhte Sensibilität gegenüber emotionalen Reizen, Verzögerung der Emotionsrückbildung<br />
und Schwierigkeiten, Emotionen zu differenzieren<br />
- Erhöhte Impulsivität<br />
Hohe Dissoziationsneigung (v.a. in Stresssituationen)<br />
Probleme beim kontextabhängigen, assoziativen Lernen<br />
- Wer sich selbst nicht als kohärente Einheit erlebt, kann aus den Konsequenzen des<br />
eigenen Handelns nichts lernen!<br />
Dysfunktionale Grundannahmen und inkompatible Schemata<br />
Mangelnde psychosoziale Realitätsorientierung<br />
Rückgriff auf dysfunktionale Bewältigungsstrategien (Selbstschädigung)<br />
106
8.2.6. Behandlung: Die Dialektisch Behaviorale Therapie (DBT)<br />
Die dialektisch-behaviorale Therapie wurde von MARSHA LINEHAN speziell für die<br />
Behandlung von Borderline-Patienten entwickelt. Das Konzept basiert auf dem<br />
neurobehavioralen Störungsmodell und verbindet Elemente der kognitiven VT, der<br />
humanistischen Psychologie und des Zen-Buddhismus.<br />
Eine feste Behandlungsreihenfolge gibt es nicht; stattdessen ist das Programm<br />
bewusst so offen, dass es flexibel auf die Probleme des jeweiligen Patienten<br />
abgestimmt werden kann.<br />
Der Begriff „dialektisch“ bringt zweierlei zum Ausdruck:<br />
Erstens beschreibt er die paradoxe Haltung, die der Therapeut dem<br />
Borderline-Patienten gegenüber einnehmen muss: Der Therapeut muss<br />
letzteren nämlich nicht zu einer Veränderung seines Verhaltens bewegen,<br />
sondern ihn zugleich so annehmen, wie er ist (Rogers).<br />
Zweitens bringt der Begriff zum Ausdruck, worum es in der Therapie geht:<br />
nämlich die Gegensätze in der Welt des Patienten schrittweise<br />
aufzulösen und zu integrieren.<br />
Grundannahmen:<br />
Entscheidend für den Erfolg der Therapie ist die Grundhaltung des<br />
Therapeuten und dessen Beziehung zum Klienten; erstere muss im Sinne der<br />
humanistischen Psychologie empathisch, wertschätzend und kongruent sein.<br />
Der Therapeut muss sich darüber bewusst sein, dass Borderline-Patienten unter<br />
ihrer Störung leiden und sich bessern wollen, ihnen aber genau das besonders<br />
schwer fällt.<br />
Das Verhalten der Patienten macht im subjektiven Kontext des Patienten<br />
durchaus Sinn und darf daher nicht pauschal als „gestört“ abgetan werden.<br />
Stattdessen gilt es, die jeweiligen Auslöser und Konsequenzen sowie die<br />
zugrundeliegenden Schemata herauszuarbeiten!<br />
Die Patienten können in der DBT nicht versagen – die Therapeuten brauchen<br />
ihrerseits Unterstützung (Supervision)<br />
Die DBT umfasst 4 Module:<br />
1. Einzeltherapie<br />
2. Fertigkeitstraining in der Gruppe („Skills“-Gruppe)<br />
3. Telefonberatung (in Notfällen)<br />
4. Supervisionsgruppe für Therapeuten<br />
Die Beziehungsgestaltung: ist aus 2 Gründen eines der wichtigsten Elemente der<br />
Einzeltherapie. Erstens, sind Beziehungsprobleme ein Leitsymptom der Borderline-<br />
Störung! Zweitens, soll durch eine positive Beziehung ein vorzeitiger<br />
Therapieabbruch, der bei Borderline-Patienten beinahe die Regel ist (s.o.: 75%!),<br />
verhindert werden.<br />
Der Therapeut versteht sich als Coach (sprich: er übernimmt die<br />
Hauptverantwortung für Verlauf und Ergebnis der Therapie)<br />
Der Therapeut benennt seine eigenen Emotionen (auf diese Weise soll dem<br />
Patienten die Wirkung seines Verhaltens authentisch gespiegelt- und dabei<br />
geklärt werden, ob diese tatsächlich intendiert war)<br />
Der Therapeut achtet stärker auf die verbalen als auf die nonverbalen Signale<br />
(da letztere bei Borderline-Patienten oft beeinträchtigt sind und ihre<br />
tatsächlichen Emotionen nicht adäquat wiedergeben)<br />
Jede Sitzung wird auf Video oder Audiokassette aufgenommen (zur<br />
Nachbearbeitung durch den Patienten)<br />
Der Therapeut sorgt für „Objektkonstanz“ (z.B. durch das Aufnehmen von<br />
Tonbändern, um mit ihrer Hilfe Abwesenheitsphasen zu überbrücken)<br />
107
Der Therapeut beachtet seine eigenen Grenzen (man ist nur zu bestimmten<br />
Zeiten telefonisch erreichbar, kann nur eine begrenzte Anzahl von<br />
Zusatzterminen anbieten etc.)<br />
Der Therapeut balanciert zwischen Akzeptanz und Drängen auf Veränderung<br />
Der Therapeut balanciert zwischen Einhaltung der Regeln und Flexibilität (um<br />
weder den therapeutischen Erfolg, noch die Beziehung zu gefährden)<br />
Der Therapeut balanciert zwischen stützender und zutrauender, fordernder<br />
Haltung<br />
Der Therapeut gibt eigene Fehler zu und dient dem Patienten dadurch als<br />
Modell!<br />
Der Therapeut ist optimistisch und ressourcenorientiert!<br />
Die Einzeltherapie: gliedert sich in eine Vorbereitungs- und drei Hauptphasen, wobei<br />
es in all diesen Phasen nicht zuletzt darum geht, eine positive Beziehung zum Klienten<br />
aufzubauen (s.o.).<br />
0) Vorbereitungsphase:<br />
Aufklärung über das Störungsbild (Psychoedukation) und die Methodik der<br />
DBT<br />
Klärung gemeinsamer Behandlungsziele und –foki; Aufsetzen eines<br />
Behandlungsvertrages (Klient verpflichtet sich zur Einhaltung von Regeln,<br />
etwa dazu, keinen Suizid zu begehen, der Therapeut zu bestmöglicher<br />
Hilfestellung)<br />
Verhaltensanalyse des letzten Suizidversuchs / des letzten<br />
Therapieabbruchs<br />
1) Die erste Therapiephase dient der Behandlung problematischer<br />
Verhaltensweisen<br />
Suizidales und parasuzidales Verhalten: hat oberste Priorität Ziel ist<br />
es, einen adäquaten Umgang mit suizidalen Krisen und Problemen zu<br />
fördern<br />
Therapiegefährdendes Verhalten: dazu zählen z.B. unentschuldigtes<br />
Fernbleiben, eine Überbeanspruchung des Therapeuten (nächtliche Anrufe,<br />
Drohungen etc.) Ziel ist es, die Compliance zu erhöhen!<br />
Verhaltensweisen, die die Lebensqualität einschränken: dazu zählen z.B.<br />
Drogenmissbrauch, Essstörungen, Dissoziationen etc. Ziel ist es,<br />
Verhaltensweisen, die die emotionale Balance und damit die Lebensqualität<br />
beeinträchtigen, zu reduzieren. (Methode: Vermeidung von Auslösereizen<br />
(z.B. Umfeld, Filme etc.) und besserer Umgang mit traumaassoziierten<br />
Emotionen)<br />
Verbesserung von Verhaltensfertigkeiten: erfolgt zwar primär in der<br />
Skillsgruppe; in der Einzeltherapie muss der Klient jedoch dazu angehalten<br />
werden, das dort Gelernte auch anzuwenden!<br />
2) Die zweite Therapiephase dient v.a. dazu, traumatische Erfahrungen<br />
aufzuarbeiten, um dadurch deren negativen Konsequenzen für das Verhalten des<br />
Patienten zu reduzieren. Eine solche Aufarbeitung ist allerdings erst dann<br />
indiziert, wenn die Patienten bereits gelernt haben, ihre Emos einigermaßen zu<br />
regulieren und keine akute Suizidgefahr mehr besteht (Belastbarkeit).<br />
Identifikation traumassoziierter Schemata (Wochenprotokoll;<br />
Verhaltensanalysen etc.)<br />
Modifikation dieser Schemata (durch Methoden der kognitiven<br />
Umstrukturierung, Expositionsverfahren, Kontingenzmanagement etc.)<br />
Umgang mit Dissoziationen und „Stuck-States“ (Zuständen, in denen der<br />
Patient kognitiv und emotional nicht mehr zugänglich ist): Dissoziative<br />
108
Zustände sind oft konditioniert, sofern sie durch spezifische Reize<br />
ausgelöst werden und zu einer kurzfristigen Spannungsreduktion führen.<br />
Unterbrochen werden können sie durch starke sensorische Reize (z.B.<br />
lautes Geräusch, Eiswürfel); wichtig ist: sie treten nur auf, wenn der Patient<br />
es zulässt!<br />
3) Die dritte und letzte Therapiephase zielt auf die generelle Lebensführung des<br />
Klienten; Ziel dieser Phase ist es, das Gelernte zu integrieren und sich neu zu<br />
orientieren!<br />
Das Fertigkeitstraining in der Gruppe: erfolgt parallel zur Einzeltherapie und<br />
sollte möglichst von einem anderen Therapeuten durchgeführt werden (da das<br />
Skillstraining die therapeutische Beziehung gefährden kann). Das Programm gliedert<br />
sich in 4 Module (s.u.) à 8 Sitzungen und sollte 2 Mal komplett durchlaufen werden;<br />
8-10 Teilnehmer, wobei Neueinsteiger immer zu Beginn eines neuen Moduls<br />
aufgenommen werden können.<br />
1. Das Modul „innere Achtsamkeit“ zielt darauf, ein bewussteres Erleben des<br />
Alltags zu fördern sowie die Gefühle und Gedanken der Patienten miteinander in<br />
Einklang zu bringen (=> Einflüsse des Buddhismus)!<br />
Zu den „Was“-Fertigkeiten der inneren Achtsamkeit gehören die<br />
Komplexe „Wahrnehmen“, „Beschreiben“ und „Teilnehmen“, sprich: Die<br />
Klienten sollen lernen, sich etwas zuzuwenden (Gedanken, Objekte,<br />
Situationen), auch wenn es unangenehm ist (= wahrnehmen), das eigene<br />
Verhalten und die Umweltereignisse zu benennen (=beschreiben) und in<br />
einer Tätigkeit aufzugehen, ohne sich ablenken zu lassen (= teilnehmen)<br />
Zu den „Wie“-Fertigkeiten der inneren Achtsamkeit gehört a) die<br />
Fertigkeit, Ereignisse zu beobachten, ohne sie zu werten (erst die<br />
Bewertung macht die Emotion!), b) die Fertigkeit, sich von den eigenen<br />
Emotionen zu distanzieren („innerer Beobachter“) und c) die Fertigkeit zu<br />
wirkungsvollem Handeln.<br />
2. Das Modul „Stresstoleranz“ zielt darauf, einen besseren Umgang mit<br />
Stresssituationen zu fördern. Zu diesem Zweck werden den Patienten<br />
verschiedene Strategien vermittelt, die auf insgesamt 4 Ebenen ansetzen.<br />
Sensorische Ebene:<br />
Angesprochener Sinn Bei Hochstress Bei moderatem Stress<br />
Fühlen Eiswürfel in die Hand Schaumbad nehmen,<br />
oder d. Mund nehmen sich massieren lassen<br />
Hören Laute, knallende Ge- Aufmunternde,<br />
räusche direkt am Ohr rhythmische Musik<br />
Riechen Ammoniak zufächeln Parfüm zufächeln<br />
Schmecken Chilischoten kauen Versch.<br />
probieren<br />
Eissorten<br />
Sehen Zeiger eines Me- Kunstband<br />
tronoms beobachten durchblättern etc.<br />
Physiologische Ebene: Haltungsübungen, Atmungsübungen, Sport etc.<br />
Kognitive Ebene: „Den Augenblick verändern“<br />
Bei Hochstress: „Flick-Flacks“ (z.B. von 100 je 7 abziehen)<br />
Phantasie: z.B. Visualisierung eines Ortes, an dem der Patient sich<br />
geborgen fühlt („save place“)<br />
Gebet/Meditation: sich einem höheren Wesen anvertrauen<br />
Sinngebung (Absicht oder Sinn im Schmerz finden; Vgl. Frankl)<br />
Konzentration auf den Augenblick<br />
109
Vergleichen (mit Leuten, denen es noch schlechter geht, z.B. den<br />
Kindern in Afrika)<br />
Optimistische Gedanken fördern<br />
Handlungsebene: „Überbrückung“<br />
- Ablenkende Aktivitäten (Freunde treffen, Holz hacken etc.)<br />
- Mentaler „Kurzurlaub“ (für 20 Minuten)<br />
3. Das Modul „Emotionsregulation“ zielt darauf, Fertigkeiten zur<br />
Emotionsregulation zu vermitteln.<br />
Dabei stützt sich das Modul auf die neurobehaviorale Emotionstheorie, der<br />
zufolge Emotionen das Resultat zweier Bewertungsprozesse sind.<br />
- Emotionale Reize führen zu physiologischer und neuronaler Erregung<br />
(Arousal), die ihrerseits eine kognitive Interpretation der<br />
betreffenden Reize erforderlich macht.<br />
- Dabei werden die eingehenden Reize in einem ersten Schritt danach<br />
beurteilt, ob sie angenehm oder unangenehm sind und ob sie wichtig<br />
oder unwichtig sind.<br />
- In einem zweiten Schritt wird geprüft, ob die eingehenden Reize<br />
bekannt- und wenn ja, wie sie genau einzuordnen sind, sprich: wie<br />
angenehm/unangenehm und wie wichtig sie sind!<br />
- Die aus diesen Bewertungsprozessen resultierende Emotion führt zu<br />
einem entsprechenden Handlungsentwurf, dessen Adäquatheit<br />
seinerseits an den zuvor gemachten Überlegungen überprüft wird.<br />
Aus diesem Modell ergeben sich 4 Möglichkeiten zur Emotionsregulation:<br />
a) Veränderung der Reizexposition<br />
Anders als Phobiker tendieren Borderline-Patienten dazu,<br />
traumarelevante Reize nicht zu vermeiden, sondern gezielt<br />
aufzusuchen; es gilt daher, sie einerseits zu aktiver Reiz-Prävention,<br />
andererseits zum bewussten Aufsuchen positiver Reize zu ermutigen<br />
(Problem: Borderliner haben oft das Gefühl haben, „es nicht zu<br />
verdienen“)<br />
b) Veränderung der zentralen neuronalen Reizverarbeitung<br />
Borderliner haben eine erhöhte Sensitivität für emotionale Reize<br />
(s.o.); diese kann jedoch durch so „banale“ Dinge wie Sport, eine<br />
ausgewogene Ernährung und eine vernünftige Tagesstruktur<br />
reduziert werden (Problem: den Patienten fehlt es dazu oft an der<br />
nötigen Motivation).<br />
c) Veränderung der Bewertungsprozesse<br />
Wenn ihre Interpretation offensichtlich unrealistisch ist, sollten die<br />
Patienten das Gegenteil von dem tun, was ihre Emotion ihnen<br />
vorgibt (verlangt viel Mut)!<br />
Wenn ihnen ihre Interpretation dagegen auch bei nochmaliger<br />
Überprüfung stimmig erscheint und nicht abzumildern ist, sollte<br />
diese nach dem Prinzip der „radikalen Akzeptanz“ angenommen<br />
werden!<br />
d) Umsetzung der Emotion in adäquate Handlungs- und<br />
Kommunikationsformen<br />
4. Das Modul „zwischenmenschliche Fertigkeiten“ enthält Elemente gängiger<br />
Trainings zur Förderung der sozialen Kompetenz (Rollenspiele etc.)!<br />
Borderliner haben eigentlich gute soziale Fertigkeiten (Ressourcen), sie<br />
können diese aber in bestimmten Situationen nicht adäquat anwenden<br />
110
(schwanken zwischen Konfliktvermeidung und radikaler Konfrontation<br />
etc.).<br />
Zur Wirksamkeit: DBT ist sowohl im ambulanten als auch im stationären Setting<br />
überaus effektiv. Schon nach 4 Monaten werden signifikante Verbesserungen erzielt<br />
und die Abbrecherquote ist deutlich niedriger als bei unspezifischen Therapien!<br />
Medikation: Die Datenlage zur Wirkung pharmakologischer Therapien ist überaus<br />
unbefriedigend; die am häufigsten eingesetzten Medikamente sind SSRIs und<br />
Benzodiazepine; sie dienen jedoch lediglich der Symptombekämpfung und haben<br />
zudem eine hohe Suchtgefahr!<br />
111
9.1. Somatoforme Störungen<br />
9. Somatoforme und dissoziative Störungen<br />
9.1.1. Die verschiedenen Arten somatoformer Störungen<br />
Definition: Somatoforme Störungen (griech. „soma“ = „Körper“) äußern sich in<br />
körperlichen Symptomen, für die es bisher keine physiologische Ursache gibt und die<br />
sich nicht willkürlich kontrollieren lassen. Man nimmt an, dass sie psychische<br />
Ursachen haben und insbesondere mit Angst zusammenhängen.<br />
Im DSM-IV wird zwischen 6 Arten somatoformer Störungen unterschieden:<br />
1) Eine Somatisierungsstörung: liegt vor, wenn vielfältige (!) körperliche<br />
Beschwerden über einen Zeitraum von mehreren Jahren (!) immer<br />
wiederkehren, ohne dass eine organische Ursache dafür angegeben werden<br />
könnte.<br />
2) Eine undifferenzierte somatoforme Störung: liegt vor, wenn über einen<br />
Zeitraum von mindestens 6 Monaten eine oder mehrere körperliche<br />
Beschwerden auftreten, ohne dass eine organische Ursache dafür angegeben<br />
werden könnte.<br />
Unterscheidet sich von der Somatisierungsstörung durch die Anzahl der<br />
Symptome und deren Dauer!<br />
3) Eine Konversionsstörung: liegt vor, wenn sensorische oder motorische<br />
Symptome (z.B. eine Lähmung) auftreten, die zwar eine neurologische oder<br />
andere körperliche Ursache nahelegen, in Wirklichkeit aber mit psychologischen<br />
Faktoren in Zusammenhang stehen.<br />
Folgende Untertypen werden unterschieden:<br />
- Konversionsstörungen mit motorischen Symptomen oder Ausfällen:<br />
z.B. Lähmungen der Arme oder Beine, Koordinationsstörungen,<br />
Aphonie (Stimmverlust) etc.<br />
- Konversionsstörungen mit sensorischen Symptomen oder Ausfällen:<br />
z.B. plötzlicher Verlust des Sehvermögens, „Tunnelblick“<br />
(Einschränkung des Gesichtsfelds), Anästhesie (Schmerzunempfindlichkeit<br />
/ Verlust taktiler Empfindungen), Anosmie (Verlust<br />
des Geruchssinns); Gefühle des Stechens, Kribbelns oder Prickelns auf<br />
der Haut etc.<br />
- Konversionsstörungen mit Anfällen oder Krämpfen<br />
- Konversionsstörungen mit gemischtem Erscheinungsbild<br />
Konversationsstörungen (früher als „Hysterie“ bezeichnet) treten meist im<br />
Zusammenhang mit psychischen Belastungssituationen auf. Mögliche<br />
Ursachen: Aufmerksamkeitsbedürfnis, Vermeidungsreaktion (um<br />
bestimmten Anforderungen zu entgehen) => kurz: Angst und seelische<br />
Konflikte werden in körperliche Symptome umgewandelt bzw.<br />
„konvertiert“; wird heute im Ggs. zu Freuds Zeiten nur noch selten<br />
diagnostiziert!<br />
4) Eine somatoforme Schmerzstörung: äußert sich in anhaltenden Schmerzen<br />
ohne organische Ursache<br />
5) Hypochondrie: äußert sich in der Fehlinterpretation körperlicher Zeichen oder<br />
Empfindungen und in der daraus resultierenden, aber objektiv unbegründeten<br />
Angst oder Überzeugung, eine schwere Krankheit zu haben. Diese Angst hält<br />
trotz ärztlicher Rückversicherung an und dauert mindestens 6 Monate!<br />
112
6) Eine körperdysmorphe Störung (Dsymorphophobie): äußert sich in der<br />
intensiven Beschäftigung mit einem eingebildeten oder übertriebenen Mangel<br />
der eigenen Erscheinung.<br />
Die Unzufriedenheit kann sich auf alle möglichen Körperteile und<br />
–eigenschaften beziehen (Behaarung, Brustgröße, Nasenform etc.), sie<br />
beginnt meistens gegen Ende der Pubertät und tritt bei Frauen häufiger auf<br />
als bei Männern; Schönheits-OPs helfen in aller Regel wenig!<br />
Manche Forscher halten die Dismorphophobie nicht für eine eigene<br />
Störung, sondern für ein Symptom, das bei mehreren Störungen auftreten<br />
kann (Zwangsstörung, Wahnstörung, Depression etc.); tatsächlich ist die<br />
Differentialdiagnose nicht ganz einfach (s.u.)!<br />
Im ICD-10 sind die aufgelisteten Diagnosen etwas spezifischer; darüber hinaus<br />
werden Konversionsstörungen unter den dissoziativen Störungen geführt!<br />
F 44: „Dissoziative Störung der Bewegung und der Sinnesempfindung“:<br />
„Dissoziative Bewegungsstörungen“; „Dissoziative Krampfanfälle“ etc.<br />
Halitophobie (auch somatoforme Halitosis genannt): ist die unbegründete Angst und<br />
Überzeugung, Mundgeruch zu haben.<br />
9.1.2. Die Somatisierungsstörung<br />
Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV:<br />
A. Vorgeschichte mit vielen körperlichen Beschwerden, wobei diese vor dem<br />
30. LJ begonnen- und über mehrere Jahre angehalten haben müssen.<br />
B. Erfüllung folgender 8 Kriterien:<br />
Vier Schmerzsymptome (z.B. Kopf-, Gelenk-, Rücken-, Bauch- oder<br />
Menstruationsschmerzen; Schmerzen Wasserlassen oder beim<br />
Geschlechtsverkehr = Dyspareunie)<br />
Zwei gastrointestinale Symptome (z.B. Völlegefühl, Übelkeit, Erbrechen,<br />
Durchfall oder Unverträglichkeit bestimmter Speisen)<br />
Ein sexuelles Symptom (z.B. sexuelle Gleichgültigkeit, Erektions- oder<br />
Ejakulationsstörungen, unregelmäßige oder ungewöhnlich starke<br />
Menstruation, Erbrechen während der gesamten Schwangerschaft)<br />
Ein pseudoneurologisches Symptom (entweder ein Konversionssymptom<br />
wie z.B. Gleichgewichts- oder Koordinationsstörungen, Lähmungen,<br />
lokalisierte Muskelschwäche, Schluckschwierigkeiten, Aphonie, Hallos,<br />
Anästhesien, Blindheit oder Taubheit oder ein dissoziatives Symptom wie<br />
z.B. Amnesie)<br />
C. Keine organische Ursache; D. keine Simulation<br />
Die Kriterien des ICD sind etwas ungenauer: eine Somatisierungsstörung liegt hier<br />
vor, wenn mehrere verschiedene körperliche Symptome ohne ausreichende somatische<br />
Erklärung über mindestens 2 Jahre andauern.<br />
Der „Somatische Symptom-Index - 4/6“ (SSI – 4/6): dient zur Diagnose eines<br />
„Somatisierungssyndroms“, wobei deutlich weniger Symptome verlangt werden als<br />
im DSM-IV. Während letzterer den Cut-off-Wert für eine Somatisierungsstörung auf 8<br />
Symptome festlegt, verlangt der SSI bei Männern lediglich 4-, bei Frauen 6 Symptome<br />
– und zwar über einen Zeitraum von 6 Monaten!<br />
Es hat sich gezeigt, dass Patienten oberhalb des SSI (ohne Erfüllung der<br />
vollständigen Kriterien einer Somatisierungsstörung) ähnliche Probleme haben<br />
wie Patienten mit einer vollständigen Somatisierungsstörung (Krankheitstage,<br />
Komorbiditäten, Arztbesuche etc.)<br />
113
9.1.3. Hypochondrie<br />
Diagnostische Kriterien nach dem DSM-IV:<br />
A. Übermäßige Beschäftigung mit der Angst oder Überzeugung, eine ernsthafte<br />
Krankheit zu haben, was auf einer Fehlinterpretation körperlicher Symptome<br />
beruht.<br />
B. Die Beschäftigung mit den Krankheitsängsten bleibt trotz angemessener<br />
medizinischer Abklärung und Rückversicherung durch den Arzt bestehen.<br />
Unterschieden werden kann zwischen Patienten mit und solchen ohne<br />
Einsicht in die Unbegründetheit der eigenen Sorgen!<br />
C. Die Überzeugung ist weder von wahnhaftem Ausmaß ( Wahnhafte<br />
Störung), noch handelt es sich dabei um eine umschriebene Sorge über die<br />
äußere Erscheinung ( Körperdysmorphe Störung)<br />
D. Leiden und Beeinträchtigung<br />
E. Dauer: mindestens 6 Monate<br />
F. Nicht besser durch eine generalisierte Angststörung, Zwangsstörung,<br />
Panikstörung Major Depression oder andere somatoforme Störung zu erklären!<br />
Die „Illness Attitude Scale“ (IAS): ist ein Verfahren zur Erfassung von<br />
Hypochondriesymptomen.<br />
Die IAS umfasst 29 Items, die auf einer 5stufigen Skala (von „Nein“ bis „fast<br />
immer“) zu beantworten sind.<br />
Beispielitems: „Machen Sie sich über ihre Gesundheit Sorgen?“;<br />
„Beängstigt Sie der Gedanke an eine ernste Erkrankung?“; „Prüfen Sie<br />
ihren Körper, um herauszufinden, ob irgendetwas nicht stimmt?“ …<br />
Die Items lassen sich 8 Skalen zuordnen, die da sind: „Worry about illness“;<br />
„Concern about Pain“; „Health Habits“; „Hypochondrical Beliefs“;<br />
„Thanatophobia“ (=Angst vor dem Tod); „Disease Phobia“; „Bodily<br />
Preoccupation“; „Treatment Experience“<br />
Hypochonder haben auf allen Subskalen erhöhte Werte!<br />
9.1.4. Epidemiologie, Komorbiditäten und Differentialdiagnose<br />
Lebenszeitprävalenzen:<br />
Somatoforme Störungen generell: 12-13%<br />
Verhältnis Frauen – Männer: 2:1<br />
Häufig auftretende somatische Beschwerden wie Brustschmerz,<br />
Erschöpfung, Schwindel, Kopfschmerz oder Rückenschmerzen, haben in<br />
den seltensten Fällen organische Ursachen!<br />
Somatisierungsstörung: unter 0,1% (am seltensten!)<br />
Undifferenzierte somatoforme Störung: ca. 9%<br />
Konversionsstörung: weniger als 1%<br />
Hypochondrie: ca. 0,2%<br />
Die häufigsten psychosomatischen Symptome sind: Rückenschmerzen, Kopf- und<br />
Gesichtsschmerzen, Schweißausbrüche, leichte Erschöpfbarkeit, Bauchschmerzen,<br />
Völlegefühl/Blähungen, Palpitationen (ein vom Patienten als unregelmäßig und<br />
ungewöhnlich stark empfundener Herzschlag), Druckgefühl im Bauch.<br />
Alle diese Symptome treten bei über 50% der Patienten einer<br />
psychosomatischen Klinik auf!<br />
Komorbiditäten: Nur 23% der Personen, die an einer somatoformen Störung leiden,<br />
haben keine weitere Diagnose; in den meisten Fällen sind somatoforme Störungen also<br />
komorbid!<br />
114
Am häufigsten treten somatoforme Störungen zusammen mit Depressionen auf<br />
(Lebenszeitprävalenz für eine MD: 47%; für Dysthymia: 40%).<br />
Aber auch Zwangs- und Angststörungen (insbes. Panikattacken und<br />
Agoraphobie) sowie Alkoholmissbrauch treten bei Personen mit somatoformer<br />
Störung gehäuft auf!<br />
Diagnose- und Dokumentationshilfen:<br />
Das „Screening für somatoforme Störungen“ (SOMS): ist ein Fragebogen,<br />
bei dem der Patient selbst Angaben über körperliche Beschwerden macht.<br />
„In den vergangenen 2 Jahren habe ich unter folgenden Beschwerden<br />
gelitten [ja/nein]“: Erbrechen, Bauch- und Unterleibsschmerzen, Übelkeit,<br />
Blähungen, Durchfall, Schwindel, etc.<br />
Differentialdiagnose:<br />
Simulation (vorgetäuschte Störung)<br />
Organische Ursachen<br />
Der Ausschluss organischer Ursachen ist bei somatoformen Störungen<br />
natürlich ganz besonders wichtig; das gilt insbesondere für<br />
Konversionsstörungen, die früher oft zu Unrecht als psychische Störungen<br />
diagnostiziert wurden. Es bedarf dementsprechend immer einer<br />
eingehenden medizinischen Untersuchung (Röntgenaufnahmen,<br />
Spiegelungen, CT etc.)!<br />
Beispiel: Hysterische Anästhesien können von neurologischen<br />
Dysfunktionen dadurch unterschieden werden, dass sich die Bereiche, in<br />
denen sie auftreten, meist nicht mit den Bereichen neuronaler Innervation<br />
decken! Ist dem so, fehlt ihnen eine anatomische Grundlage!<br />
Hysterische Anästhesien treten häufig auf: an Händen und<br />
Unterarmen; im Gesicht; im Bereich der Knie; an den Waden und<br />
Füßen; am Hinterkopf und dem oberen Teil des Rückens!<br />
Psychische Faktoren, die medizinische Krankheitsfaktoren beeinflussen<br />
Affektive Störungen<br />
Angststörungen<br />
Wahnhafte Störung (mit körperbezogenem Wahn)<br />
9.1.5. Risikofaktoren<br />
Genetische Risikofaktoren:<br />
Alkoholismus, Soziopathie (= dissoziale Persönlichkeitsstörungen), affektive<br />
Störungen und somatoforme Störungen in der Familie<br />
Epidemiologische Risikofaktoren:<br />
Weibliches Geschlecht (2:1-Verhältnis)<br />
Niedriger Sozialstatus<br />
Kulturkreis (somatoforme Störungen treten besonders häufig bei Leuten mit<br />
lateinamerikanischem Background und in Kulturen auf, in denen Emotionen<br />
nicht offen gezeigt werden)<br />
Entwicklungspsychologische Risikofaktoren:<br />
Sexuelle Übergriffe<br />
Familiäre Krankheitsmodelle<br />
Organmedizinisch orientierter Gesundheitsbegriff<br />
Auslösende Faktoren:<br />
Kritische Lebensereignisse (Missbrauch, Trennung etc.)<br />
Organische Erkrankungen<br />
Psychische Dauerbelastungen (Ehekonflikte etc.)<br />
115
Tägliche Belastungen (= „Mikrostressoren“ bzw. „Daily hazzles“)<br />
Aufrechterhaltende Faktoren:<br />
Inadäquate Coping-Strategien<br />
Verstärkende Bedingungen in der familiären oder partnerschaftlichen Interaktion<br />
Z.B. wenn psychische Probleme ein Tabuthema sind oder physische<br />
Probleme mit vermehrter Fürsorge belohnt werden<br />
Z.B. wenn die Frau keinen Sex mehr will – und die körperlichen<br />
Beschwerden sie vor selbigem beschützen!<br />
Soziale Vorteile<br />
Fehlendes soziales Stützsystem<br />
9.1.6. Modelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung somatoformer Störungen<br />
Allgemeines Modell (nach Rief):<br />
Umweltfaktoren: Biologische Faktoren:<br />
Reduzierte externale Stimulation - Genetische Prädisposition<br />
(bedingt durch Depression oder Ängste) - Erhöhte psychophysiologische Reaktivität<br />
Modelle für Krankheitsverhalten<br />
Verstärkung von Krankheitsverhalten<br />
(z.B. durch Aufmerksamkeit anderer oder<br />
indem die Symptome als Entschuldigung<br />
für schlechte Leistungen genutzt werden,<br />
einen aus der Verantwortung entlassen,<br />
andere Konflikte überlagern etc.)<br />
Störungsspezifische Einstellungen und<br />
Bewertungsmuster (z.B.: „Ernste Krank-<br />
heiten werden von Ärzten oft übersehen!“)<br />
Gewalterfahrungen<br />
Störungen der Körperwahrnehmung<br />
Verstärkte Wahrnehmung der Beschwerden<br />
Aufmerksamkeitsfokussierung<br />
erhöhtes Erregungsniveau<br />
Schon- und Vermeidungsverhalten<br />
Reduzierte externe Stimulation<br />
Verstärkung dysfunktionaler Annahmen<br />
Somatoforme Beschwerden<br />
Werden durch „Checking-Verhalten“<br />
(z.B. ständiges Schlucken, Betasten etc.)<br />
verschlimmert<br />
Bewertung als krankhaft<br />
Erhöhtes Arousal und<br />
Aufmerksamkeitsfokussierung<br />
116
Entstehung und Aufrechterhaltung der Hypochondrie:<br />
Vorgeschichte: z.B. Krebserkrankung und Tod der Eltern<br />
Entwicklung dysfunktionaler (=irrationaler) Annahmen: z.B. „Wenn ich<br />
nicht ständig meinen Körper beobachte, wird etwas Furchtbares<br />
passieren.“; „Ernste Krankheiten werden von Ärzten oft übersehen“;<br />
„Ängste können keine Symptome auslösen.“<br />
Psychische Probleme: z.B. chronische Überforderung mit der Erziehung der<br />
Kinder, Ängste etc.<br />
Auslöser / Trigger: z.B. eine Reportage über Krebs, einzelne „Symptome“<br />
(verschieden große Brüste etc.), Krankheit etc.<br />
Aktivierung der dysfunktionalen Annahmen => erhöhte Aufmerksamkeit<br />
und erhöhtes Arousal<br />
Körperliche Veränderungen: z.B. Unwohlsein, Schmerzen in der Brust etc.<br />
Automatische negative Gedanken und Vorstellungen => Fehlinterpretation<br />
der Symptome („Das muss Krebs sein!“)<br />
Gesundheitsängste:<br />
Verhaltensebene: Vermeidung und Schonung; Selbstbeobachtung; Suche<br />
nach Rückversicherung; Arztkonsultationen; Medikamenteneinnahme<br />
Affektive Ebene: Angst; Dysphorie („banale Alltagsverstimmung“) etc.<br />
Kognitive Ebene: Fokussierung der Aufmerksamkeit auf den eigenen<br />
Körper<br />
Physiologische Ebene: Symptomverschlechterung; erhöhtes „Arousal“<br />
9.1.7. Empirische Studien<br />
Windacher Studie<br />
Pauli et al.: Bildvalenz und Druckschmerz<br />
Durchführung: 24 Pbn (12 Frauen; 12 Männer) bekamen jeweils 7 positive,<br />
neutrale, negative und schmerzbezogene Bilder dargeboten, während der<br />
Darbietung (à 8 Sek.) wurden sie einem objektiv gleichbleibenden Druckschmerz<br />
(650 g) ausgesetzt, den sie per manuellem Schieber (0-50) raten sollten.<br />
Die Bilder wurden dem „International affective Picture System“ (IAPS)<br />
entnommen<br />
Ergebnis: Wie stark der Schmerz empfunden wurde, hing von der Valenz der<br />
Bilder ab: am stärksten war der wahrgenommene Schmerz bei schmerzbezogenen<br />
Bildern, am zweitstärksten bei negativen Bildern und am geringsten bei positiven<br />
Bildern.<br />
Pauli et al.; Hypochondrie und Gedächtnis (recall): Getestet wurde, inwiefern sich<br />
die Gedächtnisleistung von Hypochondern und/oder Patienten mit somatoformer<br />
Schmerzstörung von denen gesunder Pbn unterscheidet – und zwar in Abhängigkeit<br />
vom Inhalt der zu merkenden Wörter.<br />
Durchführung: Die Pbn bekamen positive, neutrale, negative und<br />
schmerzbezogene Wörter dargeboten und sollten diese unmittelbar danach und<br />
nach einer gewissen Verzögerung noch einmal wiederholen (immediate und<br />
delayed Recall).<br />
Ergebnisse: Die Hypochonder und die Patienten, die sowohl an Hypochondrie als<br />
auch an einer somatoformen Schmerzstörung litten, merkten sich von den<br />
positiven weniger - und von den schmerzbezogenen Wörtern mehr als die<br />
Kontrollgruppe!<br />
Interpretation: Das Gedächtnis von Hypochondern ist verzerrt (signifikanter<br />
„memory bias“)<br />
117
Hautzinger, Pauli et al.: Effekte von hypochondrischen Einstellungen auf das<br />
Krankheitsverhalten am Beispiel von Patienten mit funktionellen Herzbeschwerden<br />
Durchführung: Fragebogenstudie an einer Patientenstichprobe mit funktionellen<br />
Herzbeschwerden<br />
Ergebnisse:<br />
Der Ausprägungsgrad der Hypochondrie korreliert hoch mit Todesangst,<br />
Gesundheitssorgen, Beunruhigung über Schmerzen und Arztbesuchen!<br />
Hypochonder fühlen sich nach Mitteilung des negativen<br />
Untersuchungsergebnisses weniger erleichtert als die Kontrollgruppe und<br />
haben häufiger vor, sich noch weiteren Untersuchungen unterziehen zu<br />
lassen.<br />
Gesetz von Pennebaker:<br />
f (Intensität der internalen Signale / Intensität der externalen Signale)<br />
9.1.8. Zur Behandlung somatoformer Störungen:<br />
Haltung des Patienten:<br />
Patienten mit somatoformen Störungen begeben sich meistens nur widerwillig in<br />
psychologische Behandlung; schließlich sind sie davon überzeugt, dass ihre<br />
Beschwerden physiologische Ursachen haben!<br />
Somatoformen Störungen liegen meistens Ängste oder Depressionen zugrunde;<br />
sie lassen sich in dem Fall indirekt behandeln, indem die Ängste und<br />
Depressionen angegangen werden.<br />
Es muss darauf geachtet werden, dass der Patient durch eine plötzliche Besserung<br />
nicht das Gesicht verliert (etwa vor seinen Angehörigen oder Arbeitgebern)<br />
Haltung des Therapeuten:<br />
Es geht nicht darum, dem Patienten zu vermitteln, was sein Problem nicht ist,<br />
sondern darum, ihm aufzuzeigen, was sein Problem ist!<br />
Die körperlichen Beschwerden des Patienten dürfen nicht geleugnet, sondern<br />
müssen ernst genommen werden!<br />
Zwischen psychogenem und somatogenem Schmerz zu unterscheiden, ist<br />
ohnehin nicht sonderlich sinnvoll, da Schmerz immer beide Aspekte<br />
umfasst!<br />
Die Annahmen des Patienten dürfen nicht pauschal verworfen, sondern müssen<br />
mit ihm zusammen kritisch überprüft werden.<br />
Es geht nicht darum, den Patienten zu etwas zu überreden, sondern darum, ihn<br />
durch geschicktes Fragen zu eigenen Einsichten zu bewegen (sokratischer<br />
Dialogstil)<br />
Behandlungsrichtlinien bei somatoformen Störungen<br />
Ausschluss organischer Ursachen?!<br />
Anamnese und Diagnose<br />
Motivation für eine zeitlich befristete Therapie schaffen und Zielhierarchie<br />
aufstellen<br />
Kognitive Maßnahmen:<br />
Gesundheitsbegriff des Patienten hinterfragen und modifizieren (meist liegt<br />
ein zu enger Gesundheitsbegriff vor)<br />
Krankheitsbegriff hinterfragen und modifizieren (behutsame Einführung<br />
psychologischer Begriffe wie Angst, Belastung, Stress etc.)<br />
Modifikation dsyfunktionaler Annahmen<br />
Arbeit am Selbstbild<br />
...<br />
118
Behaviorale Maßnahmen: zur Modifikation des Krankheitsverhaltens<br />
Symptomverstärkende Wirkung des Krankheitsverhaltens verdeutlichen<br />
Operante Maßnahmen (evtl. unter Einbezug der Bezugspersonen)<br />
Biofeedback (anhand dessen die Patienten lernen sollen, Körperfunktionen<br />
wie Herzschlag oder Atmung willentlich zu kontrollieren)<br />
…<br />
9.4. Dissoziative Störungen<br />
9.4.1. Die verschiedenen Arten dissoziativer Störungen<br />
Definition: Dissoziative Störungen sind durch einen Bruch des<br />
Bewusstseinszusammenhangs von Identität, Gedächtnis und Wahrnehmung<br />
gekennzeichnet.<br />
1. Dissoziative Amnesie: Partieller oder vollständiger Verlust des Gedächtnisses<br />
nach einer belastenden Erfahrung<br />
Die Dauer einer amnestischen Episode kann stark variieren (Stunden bis<br />
Jahre); die Inhalte des deklarativen Gedächtnisses (Weltwissen) bleiben<br />
erhalten, betroffen ist also lediglich das episodische Gedächtnis bzw. Teile<br />
davon.<br />
2. Dissoziative Fugue: Vollständiger Gedächtnisverlust, im Zuge dessen die<br />
Patienten ihre gewohnte Umgebung verlassen und eine neue Identität annehmen<br />
(Vgl. „Stiller“)<br />
Wird i.d.R. durch belastende bzw. traumatische Ereignisse ausgelöst, ist<br />
aber äußerst selten!<br />
3. Depersonalisationsstörung: Abrupte Veränderung der Selbstwahrnehmung und<br />
des Selbsterlebens (man kommt sich plötzlich fremd vor, erkennt seine eigene<br />
Stimme nicht wieder, betrachtet sich von außen etc. etc.)<br />
4. Dissoziative Identitätsstörung (Multiple Persönlichkeit): Existenz von 2 oder<br />
mehr verschiedenen, unabhängig voneinander handelnden Persönlichkeiten<br />
innerhalb eines Individuums<br />
Die Existenz dieser Störung ist trotz berühmter Fallbeispiele sehr<br />
umstritten; Kritiker behaupten, die versch. Persönlichkeiten würden den<br />
Patienten erst in der Therapie eingeredet!<br />
9.4.2. Therapie<br />
Sowohl psychodynamische als auch verhaltenstherapeutische Ansätze betrachten<br />
dissoziative Störungen als Abwehr- bzw. Verdrängungsmechanismus; verursacht<br />
werden sie durch schwerwiegende Belastungen bzw. traumatische Erfahrungen<br />
(insbes. sexuellen Missbrauch in der Kindheit!).<br />
Diese Erfahrungen aufzuarbeiten, ist ein wesentliches Ziel der Therapie! Nicht<br />
selten werden dabei Hypnosetechniken eingesetzt!<br />
Bei der Behandlung der dissoziativen Identitätsstörung geht es um die sukzessive<br />
Integration der verschiedenen Identitäten.<br />
119
10. Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS)<br />
10.1. Darstellung des Störungsbildes<br />
10.1.1. Diagnostische Kriterien<br />
Definition: ADHS äußert sich in häufiger Unaufmerksamkeit, übermäßiger<br />
motorischer Aktivität und erhöhter Impulsivität. Ob die besagten Merkmale<br />
tatsächlich störungsspezifisch sind oder sich noch im Rahmen des „Normalen“<br />
bewegen, hängt dabei vom Entwicklungsstand bzw. Alter des jeweiligen Kindes ab.<br />
Diagnostische nach dem DSM-IV:<br />
Das DSM-IV unterscheidet zwischen 3 Arten der „Aufmerksamkeits-<br />
/Hyperaktivitätsstörung“:<br />
1. Einem vorwiegend unaufmerksamen Typus<br />
2. Einem vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Typus<br />
3. Einem Mischtypus<br />
Dem entspricht die Unterscheidung zwischen 2 Arten von Symptomen,<br />
nämlich a) Symptomen der Unaufmerksamkeit und b) Symptomen von<br />
Hyperaktivität und Impulsivität. Für eine Diagnose müssen über einen Zeitraum<br />
von 6 Monaten mindestens 6 Symptome aus einer der beiden Gruppen<br />
vorhanden gewesen sein.<br />
Zu den Symptomen der Unaufmerksamkeit gehören u.a.:<br />
Nichtbeachten von Einzelheiten oder Flüchtigkeitsfehler<br />
Probleme mit der Daueraufmerksamkeit (sprich: damit, sich länger auf<br />
eine Sache zu konzentrieren)<br />
Ablenkbarkeit<br />
Vergesslichkeit<br />
Häufiger Verlust von Dingen<br />
Organisationsschwierigkeiten<br />
Probleme beim Zuhören<br />
Zu den Symptomen der Hyperaktivität und Impulsivität gehören u.a.:<br />
Ruhelosigkeit / Getriebenheit<br />
…redet übermäßig<br />
Hyperaktivität …zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum<br />
…steht oft auf, wenn Sitzenbleiben erwartet wird<br />
…platzt mit Antworten zu früh heraus<br />
Impulsivität<br />
…kann kaum erwarten, an die Reihe zu kommen (Ungeduld)<br />
…unterbricht und stört andere<br />
Zumindest einige dieser Symptome müssen nach dem DSM-IV schon vor dem<br />
7. Lebensjahr aufgetreten sein; darüber hinaus müssen sie in mindestens zwei<br />
Bereichen (z.B. Schule, Familie, Peers) zu Beeinträchtigungen führen!<br />
Diagnostische Kriterien nach der ICD-10:<br />
Die ICD-10 spricht anders als das DSM-IV von „hyperkinetischen Störungen“<br />
(F 90), wobei v.a. zwischen einer „einfachen Aufmerksamkeits- und<br />
Hyperaktivitätsstörung“ (F 90.0) und einer „hyperkinetischen Störung des<br />
Sozialverhaltens“ (F 90.1) unterschieden wird.<br />
Bei beiden Störungen handelt es sich um ADHS; die „hyperkinetische<br />
Störung des Sozialverhaltens“ zeichnet sich lediglich dadurch aus, dass zu<br />
den Aufmerksamkeitsdefiziten und hyperaktiven Symptomen noch eine<br />
Störung des Sozialverhaltens hinzutritt!<br />
120
Für eine Diagnose müssen sowohl Symptome der Unaufmerksamkeit, als auch<br />
der Hyperaktivität vorliegen, wobei offen gelassen wird, wie viele. Entscheidend<br />
ist, dass sie situationsübergreifend (also z.B. nicht nur bei langweiligen<br />
Aufgaben) auftreten, über längere Zeit andauern und bereits vor dem 6.<br />
Lebensjahr einsetzen!<br />
Die wichtigsten Unterschiede zwischen dem DSM-IV und der ICD-10:<br />
Die Kriterien des ICD-10 sind strenger, da für eine Diagnose sowohl<br />
Unaufmerksamkeit als auch Hyperaktivität vorausgesetzt werden!<br />
Die anhand der DSM-IV-Kriterien ermittelten Prävalenzen liegen<br />
dementsprechend deutlich über denen des ICD-10!<br />
Während die Symptome laut DSM-IV vor dem 7. Lebensjahr begonnen haben<br />
müssen, müssen sie laut ICD-10 schon vor dem 6. Lebensjahr einsetzen!<br />
Während das DSM-IV zwischen 3 Subtypen unterscheidet kann zur ADHS<br />
lediglich eine Störung des Sozialverhaltens hinzutreten, wobei letztere ersterer<br />
klar untergeordnet wird!<br />
Im DSM-IV wird zumindest sprachlich zwischen Hyperaktivität und<br />
Impulsivität differenziert, in der ICD-10 nicht – hier ist lediglich von<br />
Hyperaktivität die Rede!<br />
Die Vorgaben des DSM-IV sind detaillierter als die der ICD-10: Es wird genau<br />
festgelegt, welche Symptome und wie viele davon im Einzelnen diagnostiziert<br />
werden müssen; darüber hinaus wird festgelegt, dass die Symptome in<br />
mindestens zwei Bereichen zu Beeinträchtigungen führen müssen!<br />
Diagnose bei Erwachsenen:<br />
In der ICD-10 wird darauf hingewiesen, dass das hyperkinetische Syndrom auch<br />
im Erwachsenenalter diagnostiziert werden kann. Die Kriterien sind dabei<br />
dieselben; es müssen lediglich die zur der Beurteilung der Symptome<br />
herangezogenen Normen an das Erwachsenenalter angepasst werden!<br />
Die Wender-Utah-Kriterien für ADHS wurden speziell für das<br />
Erwachsenenalter entwickelt; neben einer Aufmerksamkeitsstörung und<br />
motorischer Hyperaktivität (die sich im Erwachsenenalter auch als eine<br />
„innere Unruhe“ äußern kann), müssen laut diesen Kriterien mindestens 2 der<br />
folgenden 5 Symptome vorliegen:<br />
1. Affektlabilität (Stimmungsschwankungen, Niedergeschlagenheit etc.)<br />
2. Desorganisiertes Verhalten (z.B. im Studium, in der Arbeit oder im<br />
Haushalt)<br />
3. Verringerte Affektkontrolle (erhöhte Reizbarkeit, niedrige<br />
Frustrationsschwelle etc.)<br />
4. Impulsivität (Ungeduld, Dazwischenreden usw.)<br />
5. Emotionale Überreagibilität (Patienten sind schnell gestresst, oft<br />
ängstlich…)<br />
Die „Adult ADHD Self-Repost Scale” (ASRS): ist ein Screeningfragebogen<br />
für Erwachsene; der Fragebogen umfasst 18 Fragen, die auf einer 5-stufigen<br />
Skala zu beantworten sind (von „nie“= 0 bis „sehr oft“ = 4)<br />
Beispielfragen:<br />
„Wie oft verlegen Sie Dinge zu Hause oder bei der Arbeit?“<br />
„Wie oft fühlen Sie sich ruhelos oder zappelig?“<br />
Auswertung (max. Punktzahl: 4 × 18 = 72):<br />
Bei 0-16 Punkten: ist ADHS eher unwahrscheinlich<br />
Bei 17-23 Punkten: ist ADHS möglich<br />
Bei über 24 Punkten: ist ADHS recht wahrscheinlich<br />
121
10.1.2. Epidemiologie und Verlauf<br />
Epidemiologische Daten:<br />
ADHS ist einer der häufigsten Gründe, derentwegen sich Eltern an<br />
Erziehungsberatungsstellen oder schulpsychologische Dienste wenden. Die<br />
Störung ist jedoch bei weitem nicht so weit verbreitet, wie oft von Lehrern und<br />
Eltern angenommen wird!<br />
Die Prävalenz liegt in Deutschland bei Schulkindern zwischen 3 und 8 %, bei<br />
Erwachsenen bei ca. 3%!<br />
Jungen scheinen dabei häufiger betroffen zu sein als Mädchen (die<br />
Schätzungen bewegen sich zwischen 2:1 und 9:1!). Es könnte aber auch<br />
sein, dass Jungen, die unter ADHS leiden, lediglich häufiger in Behandlung<br />
kommen, weil sie aggressiver sind und mehr soziale Probleme haben als<br />
Mädchen mit ADHS!<br />
ADHS ist keine kulturbedingte Störung: Sie taucht nicht nur in westlichen,<br />
sondern auch in anderen Kulturkreisen auf!<br />
Zum Verlauf der Störung:<br />
Säuglings- und Kleinkindalter:<br />
Fütter-, Schrei- und Schlafstörungen<br />
Entwicklungsverzögerungen<br />
Vorschulalter:<br />
Motorische Unruhe<br />
Starkes Mittelpunktsstreben<br />
Mangelhafte Regeleinhaltung und oppositionelles Verhalten<br />
Gestörtes Beziehungsverhalten (werden von Gleichaltrigen nicht sonderlich<br />
gemocht, streiten sich oft etc.)<br />
Geringere Spieldauer und -intensität<br />
Schulalter: hier wird die Störung meistens erstmals diagnostiziert!<br />
Hausaufgabenkonflikte<br />
Schulische Lern- und Leistungsprobleme<br />
Aggressives Verhalten<br />
Erziehungsstil: negative Interaktion, kontrollierend<br />
Jugendalter:<br />
Dissoziales Verhalten<br />
Suchtmittelmissbrauch (früher, länger und doppelt so häufig!)<br />
Selbstwertprobleme<br />
Erwachsenenalter:<br />
Dissoziale Persönlichkeitsstörung<br />
Gestörte Selbstorganisation<br />
Berufliche Probleme<br />
Suizidalität<br />
Erhöhte Unfallgefahr (50% der Fahrradunfälle werden angeblich von<br />
Leuten mit ADHS verursacht => Wer„s glaubt, wird selig! Schließlich wird<br />
wohl nach den wenigsten Fahrradunfällen eine ADHS-Diagnostik<br />
durchgeführt!)<br />
Die hyperaktive Symptomatik geht im Erwachsenenalter stark zurück (sie<br />
äußert sich dann v.a. in „innerer Unruhe“)<br />
122
10.1.3. Komorbiditäten und Differentialdiagnose<br />
Die wichtigsten Komorbiditäten:<br />
Störungen des Sozialverhaltens (40-60%)<br />
Angststörungen / Depression (25%)<br />
Tics (bis zu 30%)<br />
Umschriebene Entwicklungsstörungen: z.B. Lese-Rechtschreibschwäche,<br />
Dyskalkulie etc. (10-40%)<br />
Differentialdiagnose:<br />
Zur Diagnose von ADHS bedarf es einer multiaxialen Diagnostik; unbedingt<br />
berücksichtigt werden müssen:<br />
Klinisch-psychiatrische Syndrome (Tics, Depression etc.)<br />
Umschriebene Entwicklungsstörungen (Legasthenie etc.)<br />
Intelligenzniveau<br />
Körperliche Symptomatik (sehen, hören etc.)<br />
Aktuelle abnorme psychosoziale Umstände<br />
Vorrang haben Affektive Störungen, Angststörungen und reaktive Störungen<br />
(bei plötzlichem Einsetzen); liegen sie vor, wird keine ADHS diagnostiziert,<br />
sondern lediglich eine durch diese Störungen bedingte Unruhe „attestiert“.<br />
Nachrangig sind dagegen Störungen des Sozialverhaltens.<br />
10.1.4. Praktisches Vorgehen bei der Diagnose<br />
Grundsätzlich gilt: Viele ADHS-Symptome (Zappeln, übermäßiges Reden etc.) sind<br />
gerade bei jungen Kindern durchaus „normal“! Bei der Diagnose muss daher äußerst<br />
vorsichtig vorgegangen werden: zum einen muss immer der jeweilige<br />
Entwicklungsstand berücksichtigt werden, zum anderen sollte eine Diagnose nur bei<br />
wirklich extremen und hartnäckigen Fällen vergeben werden.<br />
Gerade Lehrer neigen dazu, Kinder vorschnell eine ADHS zu attestieren!<br />
Die Diagnostik bei ADHS umfasst mehrere Schritte:<br />
1. Exploration (Befragung) der Eltern und der Erzieher/Lehrer: Welche<br />
Probleme liegen vor, in welchen Kontexten treten sie auf, wann haben sie<br />
begonnen etc. etc.<br />
Z.B. Conners-Fragebogen für Eltern, Lehrer und Erzieher: Beurteilung<br />
mehrerer Items auf einer 4-stufigen Skala (von „überhaupt nicht“ bis „sehr<br />
stark“)<br />
„Ist unruhig oder übermäßig aktiv.“; „Ist erregbar oder impulsiv“;<br />
„Ist unaufmerksam oder ablenkbar“; „Beendet angefangene<br />
Aufgaben nicht“ etc. etc.<br />
2. Exploration des Kindes bzw. Jugendlichen<br />
Auch dafür stehen natürlich Fragebögen und standardisierte Interviews zur<br />
Verfügung<br />
3. Testpsychologische Untersuchung und Verhaltensbeobachtung<br />
Intelligenztests, evtl. weitere Tests zum Abchecken von Komorbiditäten<br />
(Lese-Rechtschreibtests etc.)<br />
Spezifische Tests wie der „Continuous Performance Test“ (CPT), der<br />
sowohl die Daueraufmerksamkeit als auch die Impulsivität misst. Die Pbn<br />
bekommen dabei über längere Zeit verschiedene Buchstaben dargeboten<br />
und sollen, immer wenn auf ein „O“ ein „X“ folgt, mit einem Tastendruck<br />
reagieren (s.o.). Drücken sie den Knopf, ohne dass dem „X“ ein „O“<br />
vorangegangen ist, spricht das für ihre Impulsivität (=> Unfähigkeit zur<br />
123
Verhaltenshemmung); drücken sie die Taste nicht, obwohl sie müssten,<br />
spricht das für eine eingeschränkte Daueraufmerksamkeit!<br />
Einschub: Der CPT kann auch in ein „virtuelles Klassenzimmer“<br />
integriert werden (die Buchstaben erscheinen dann auf der Tafel und es<br />
gibt ablenkende Reize); dadurch werden a) realitätsnähere Bedingungen<br />
geschaffen und b) die Möglichkeit eröffnet, Auslösefaktoren<br />
auszumachen.<br />
Noch handelt es sich dabei jedoch um ein Forschungsprojekt, das sich<br />
in der Diagnostik und Therapie noch nicht etabliert hat!<br />
4. Körperliche / neurologische Untersuchung<br />
Seh- und Hörfähigkeit überprüfen, neurologische Ursachen ausschließen...<br />
Eine eingehende neurologische Untersuchung ist v.a. vor medikamentöser<br />
Behandlung erforderlich!<br />
5. Verlaufskontrolle<br />
Wie wirkt die Therapie (Schulleistung, Verhalten in der Familie etc.)?<br />
10.2. Theorien und Erklärungsmodelle<br />
10.2.1. Ätiologiefaktoren<br />
Grundsätzlich gilt: Bei der Ätiologie von ADHS wird neurologischen und<br />
genetischen Faktoren i.d.R. mehr Einfluss zugeschrieben als psychologischen<br />
Faktoren.<br />
Biologische Ätiologiefaktoren:<br />
Es besteht eine genetische Prädisposition für ADHS: Die Konkordanzraten<br />
liegen bei eineiigen Zwillingen zwischen 55 und 70% und Kinder, deren Eltern<br />
ADHS haben, erkranken 8 Mal häufiger!<br />
Risikoallelle liegen u.a. auf dem Dopamintransporter-Gen (DAT1); einem<br />
Serotonintransporter-Gen, dem Gen MAO-A…<br />
Pränatale Einflüsse: Rauchen und Trinken während der Schwangerschaft<br />
wirken auf das dopaminerge System des Kindes und erhöhen die<br />
Wahrscheinlichkeit für ADHS um den Faktor 2 – 3!<br />
Lebensmittelzusatzstoffe: Von Feingold (1973) stammt die These, dass<br />
bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe zur Entstehung von Hyperaktivität beitragen<br />
(sofern sie das Nervensystem beeinträchtigen); diese These war lange Zeit sehr<br />
populär ( Verschreibung zusatzstofffreier Diäten), gilt aber vermutlich nur für<br />
einen sehr kleinen Teil der Betroffenen ( nur äußerst wenige Kinder sprechen<br />
nämlich positiv auf die besagten Diäten an)<br />
Psychologische Ätiologiefaktoren<br />
Chronische Konfliktsituationen und verminderter familiärer Zusammenhalt<br />
Psychopathologische Auffälligkeiten auf Seiten der Eltern (insbes. der Mutter)<br />
Modelllernen<br />
Operantes Lernen (Hyperaktivität wird mit erhöhter Aufmerksamkeit belohnt)<br />
124
10.2.2.: Integrative Modelle<br />
Das biopsychosoziale Modell nach Döpfner: geht von einer Wechselwirkung<br />
zwischen biologischen und psychosozialen Faktoren aus.<br />
Genetische<br />
Faktoren<br />
1. Genetische und erworbene biologische Faktoren führen zu<br />
Störungen der neuronalen Verarbeitung<br />
Betroffen sind dabei insbesondere das dopaminerge und das<br />
Erworbene biol.<br />
noradrenerge System.<br />
Faktoren 2. Störungen der Selbstregulation (=mangelnde Inhibition):<br />
Einschränkung der Daueraufmerksamkeit und des<br />
Arbeitsgedächtnisses, mangelnde Impulskontrolle und vermehrte<br />
Suche nach neuen Reizen, schlechte Aufmerksamkeitslenkung,<br />
beeinträchtigte Affektregulation, Mangel an metakognitivem Wissen,<br />
Störungen der Handlungsorganisation.<br />
Zur Handlungsorganisation: Betroffene führen nur<br />
unvollständige Problem- und Zielanalysen durch, prüfen selten<br />
alternative Lösungsmöglichkeiten und sind kaum dazu in der<br />
Lage, ihr Verhalten strategisch zu planen.<br />
3. ADHS-Symptomatik: Unaufmerksamkeit, Impulsivität,<br />
Ungünstige fam. Hyperaktivität<br />
und schulische 4. Negative Interaktionen mit Bezugspersonen und Umwelt:<br />
Bedingungen<br />
Misserfolge, Frustrationen, Sanktionen, soziale Isolation etc.<br />
5. Komorbide Symptome: Leistungsstörungen, Aggression,<br />
<br />
emotionale Störungen<br />
Die komorbiden Symptome sind z.T. als ungeschickte<br />
Kompensationsversuche zu verstehen<br />
Das Endophänotypen-Konzept der ADHS: beschreibt die Störung auf 4 Ebenen<br />
Genotyp-Ebene:<br />
Bestimmte Varianten (Allele) des Dopamintransporter-Gens (DAT1), eines<br />
Serotonintransporter-Gens, des Gens MAO-A...<br />
Neurobiologische Ebene:<br />
Hypoplasie (Verkleinerung) und Hypofunktion des Frontallappens und<br />
des ventralen Striatums (beide Regionen sind entscheidend für die<br />
Exekutivfunktionen des Gehirns: Planung, Regulation von Emotionen,<br />
Impulskontrolle etc.)<br />
Dysregulation der dopaminergen und noradrinergen Aktivität<br />
Beeinträchtigung des Verstärkungssystems (mesolimbisches System,<br />
ventrales Striatum)<br />
Endophänotypenebene (Endophänotypen = psychologische Konstrukte)<br />
Exekutivsystem: inhibitorische Defizite bei der Impulskontrolle<br />
Exekutivsystem: Defizite bei der Regulation des zentralnervösen<br />
„Arousals“ [aufgrund neurobiologischer Defizite (s.o.) können die<br />
Betroffenen ihre zentralnervöse Aktiviertheit („Arousal“ bzw. „geistige<br />
Wachheit“) nicht oder nur unzureichend auf die Anforderungen der<br />
jeweiligen Situation ausrichten, so dass es immer wieder zu Phasen der<br />
Über- und Unteraktivierung kommt]<br />
Verstärkungssystem:<br />
genaueres: s.u.)<br />
Manifestationsebene:<br />
„Delay-Aversion“ (ist ein Motivationsmuster,<br />
Unaufmerksamkeit (insbes. gestörte Daueraufmerksamkeit)<br />
Hyperaktivität/Impulsivität<br />
Mischtypus<br />
125
10.2.3.: Das 2-Pfad-Modell nach Sonuga-Barke<br />
Das 2-Pfad-Modell nach Sonuga-Barke (2003) führt ADHS einerseits auf ein<br />
gestörtes Verstärkungssystem (ventrales Striatum und mesolimbisches System),<br />
andererseits auf ein gestörtes Exekutivsystem (dorsales Striatum, Thalamus,<br />
Frontallappen) zurück.<br />
Verstärkungssystem: Verkürzter Verzögerungsgradient [ Elternverhalten<br />
] Delay Aversion ADHS<br />
Genauer: Kinder mit ADHS weisen einen verkürzten<br />
Verzögerungsgradienten auf; sie haben also nur eine geringe Toleranz<br />
gegenüber Zeitverzögerungen und daher Probleme damit, eigene<br />
Reaktionen hinauszuschieben bzw. die Reaktionen anderer abzuwarten.<br />
Aus diesem Grund neigen sie entweder zu Impulsivität oder dazu, die<br />
Wartezeit zu überbrücken, indem sie z.B. ihre Aufmerksamkeit auf andere<br />
Reize richten (=> Unaufmerksamkeit/Hyperaktivität); diese<br />
Verhaltensweisen rufen negative Reaktionen hervor (Elternverhalten), die<br />
wiederum die „Delay Aversion“ verstärken. Letztere ist nichts anderes als<br />
eine extreme Abneigung gegenüber Belohnungsverzögerungen und<br />
–aufschüben; sie äußert sich etwa darin, dass Betroffene lieber sofort eine<br />
kleine Belohnung nehmen, als auf eine große zu warten.<br />
Exekutivsystem: Inhibitorische Defizite Exekutive Dysfunktionen<br />
(Planung, Impulskontrolle, Emotionsregulation etc.) ADHS<br />
Befunde zum Verstärkungssystem:<br />
Die Aktivierung im ventralen Striatum ist bei ADHS-Patienten während der<br />
Antizipation einer Belohnung (0$, 1$, 5$) insgesamt geringer und weniger von<br />
der Höhe der Belohnung abhängig als bei Kontrollprobanden.<br />
Die Amygdala-Aktivierung (deren Ausmaß als Hinweis für negative Emotionen<br />
interpretiert werden kann) ist bei ADHS-Patienten bei verzögerten Reizen<br />
deutlich höher als bei unmittelbar hintereinander dargebotenen. Bei<br />
Kontrollprobanden ist es umgekehrt!<br />
Befunde zum Exekutivsystem:<br />
ADHS-Patienten schneiden in Aufgaben zur Impulskontrolle (Go/No-Go-<br />
Tasks, Stop-Signal-Tasks) schlechter ab; darüber hinaus zeigen EEG- bzw. ERP-<br />
Untersuchungen (ERP = Event-related Potenzial), dass ihre frontalen N2-Peaks<br />
(=Inhibitionsmerkmal) geringer ausfallen.<br />
10.4. Zur Therapie von ADHS<br />
Grundsätzlich gilt, dass die Heterogenität des Störungsbilds ein stark<br />
individualisiertes Vorgehen notwendig macht.<br />
Insbes. vor medikamentöser Behandlung sind neurologische Untersuchungen<br />
vonnöten.<br />
An der Würzburger Uni-Klinik gibt‟s eine Spezialambulanz für ADHS!<br />
10.4.1. Medikamentöse Therapie<br />
Bei ADHS werden v.a. 2 Arten von Medikamenten verschrieben: Stimulanzien (die<br />
die dopaminerge Aktivität erhöhen) und Noradrenergica (die die noradrenerge<br />
Aktivität erhöhen).<br />
1) Stimulanzien: Das am häufigsten verschriebene Präparat ist Methylphenidat<br />
(Handelsnamen: Ritalin, Concerta etc.); darüber hinaus können Amphetamine<br />
verschrieben werden; die Wirkdauer von Methylphenidat liegt bei ca. 3h<br />
126
(Retard: 7-12 h); für Erwachsene sind Stimulanzien nicht zugelassen, möglich<br />
ist jedoch eine „off-label“-Verschreibung (die Krankenkasse bezahlt bis zu<br />
einem Alter von max. 25 Jahren)<br />
Nebenwirkungen: Kopf- und Bauchschmerzen, Appetitminderung,<br />
Schlaflosigkeit, Benommenheit<br />
2) Noradrenergica: das am häufigsten verschriebene Präparat ist Atomoxetin (ein<br />
selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer); weitere Präparate sind<br />
Desipramin und Clonidin; die Wirkdauer liegt bei ca. 12 h (nach 1-2 Wochen)<br />
Appetitminderung, Benommenheit, Dermatitis (Ekzeme), Dyspepsie<br />
(Verdauungsstörungen)<br />
Zur Wirksamkeit:<br />
Durch die genannten Medikamente kann die Konzentrationsfähigkeit und das<br />
störende Verhalten der betroffenen Kinder signifikant verbessert werden!<br />
Die Effektstärken liegen bei ca. 0.8!<br />
Nur ca. 10% reagieren nicht auf die Gabe von Stimulantien (sog. „Non-<br />
Responder“)<br />
Es handelt sich bei der pharmakologischen Behandlung um eine symptomatische<br />
Behandlung ohne Ätiologiebezug. Warum genau die Medikamente wirken, ist<br />
nach wie vor unklar!<br />
10.4.2. Verhaltenstherapie<br />
Probleme auf familiärer Ebene: Inkonsistente Erziehung, mangelnde Kontrolle,<br />
negative Beziehung<br />
Interventionen:<br />
Psychoedukation<br />
Eltern-Kind-Therapie: Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion durch<br />
wenige, aber dafür klare und konsequent durchgehaltene Regeln, die<br />
Einführung von Routinen und Ritualen, evtl. Einführung von<br />
Tokenprogrammen, geeignete Situationsgestaltung (geordneter Arbeitsplatz,<br />
Entfernung ablenkender Reize etc.)<br />
Eltern- bzw. Paartherapie<br />
Probleme auf der Ebene des Kindes: Hyperaktivität, Impulsivität,<br />
Aufmerksamkeitsstörung, Störungen des Sozialverhaltens, Schulleistungsstörungen<br />
Interventionen:<br />
Psychoedukation<br />
Spieltraining (genaues Hinschauen und Hinhören)<br />
Selbstinstruktionstraining („Halt! Stopp! Erst nachdenken!“; „Jetzt<br />
mache ich mir einen Plan!“; „Jetzt fange ich an!“ etc. etc.)<br />
Selbstmanagement (durch verbale Selbstinstruktion und Verstärkung)<br />
Probleme auf institutioneller Ebene (Schule/Kindergarten): negative Lehrer-<br />
Schüler-Beziehung, Disziplinprobleme, Misserfolge etc.<br />
Interventionen:<br />
Psychoedukation und Tipps an den Lehrer: Klar strukturierte<br />
Unterrichtsmaterialien, unmittelbares Feedback, Token-Programme etc.<br />
Wirksamkeit - nach der Kölner Multimodalen Interventionsstudie (COMIS):<br />
Durch VT können hyperkinetische, aggressive und emotionale Auffälligkeiten<br />
signifikant reduziert werden, wobei die gefundenen Effekte über 18 Monate<br />
hinweg stabil waren<br />
Rund 60% zeigen nach der Therapie nur noch minimale<br />
Verhaltensauffälligkeiten in der Schule und zuhause<br />
127
30% benötigen zusätzlich Stimulanstherapie<br />
11.1. Angststörungen allgemein<br />
11. Angststörungen<br />
11.1.1. Allgemeines zu Emotionen:<br />
Paul Ekman postuliert 7 Basisemotionen; ihnen entsprechen jeweils spezifische<br />
Gesichtsausdrücke, die in allen Kulturen gleich sind (lediglich was das öffentliche<br />
Zeigen der Emotionen betrifft, gibt es kulturelle durch sog. „Display rules“ bedingte<br />
Unterschiede)!<br />
Die 7 Basisemotionen sind:<br />
1. Freude 4) Angst 7) Verachtung<br />
2. Trauer 5) Überraschung<br />
3. Ärger 6) Ekel<br />
Manche halten auch Verlegenheit für eine Basisemotion!<br />
Circumplex-Modell der Emotionen (Russell): Die Verschiedenen Emotionen lassen<br />
sich anhand zweier Dimensionen (nämlich „Ruhe-Erregung“ und „Lust-Unlust“)<br />
kategorisieren:<br />
„Angst“ zeichnet sich z.B. durch ein Höchstmaß an Erregung und<br />
verhältnismäßig starke Unlust aus. „Besorgtheit“ ist im Vergleich dazu durch ein<br />
geringeres Maß an Erregung, dafür aber mehr Unlust gekennzeichnet.<br />
Zwei-Faktoren-Theorie der Emotion (Schachter und Singer): Welche Emotion<br />
durch einen Reiz ausgelöst wird und wie stark diese ist, hängt von 2 Faktoren ab: Die<br />
physiologische Erregung (Arousal) ist unspezifisch und bestimmt die<br />
Emotionsintensität; die kognitive Interpretation bzw. Attribution der Erregung<br />
bestimmt die Art der Emotion bzw. die Emotionsqualität.<br />
11.1.2. Allgemeines zu Angst<br />
Unterschieden werden muss zwischen Angst und Furcht:<br />
Angst: ist eine ungerichtete (diffuse) motorische, peripher-physiologische,<br />
zentralnervöse und subjektive Überaktivierung bei der Antizipation von Gefahr!<br />
Furcht: ist eine spezifische motorische, peripher-physiologische, zentralnervöse<br />
und subjektive Reaktion bei der Identifikation einer Gefahr, die zur Auslösung<br />
einer Bewältigungsreaktion führt!<br />
Kurz: Furcht ist im Unterschied zur Angst objektbezogen und hat<br />
dementsprechend immer einen konkreten Anlass!<br />
Wie alle Emotionen äußert sich Angst bzw. Furcht auf 3 Ebenen:<br />
1. Verbal-kognitive (= subjektive) Ebene<br />
Dazu zählt sowohl das kognitive als auch das emotionale Erleben!<br />
2. Motorisch-behaviorale Ebene<br />
Mimik, Gestik, Vermeidungsverhalten etc.<br />
3. Physiologische Ebene<br />
Z.B. Kortisolausschüttung etc.<br />
Von pathologischer Angst spricht man, wenn folgende Kriterien gegeben sind:<br />
Die Angstreaktionen des Betroffenen sind der Situation nicht angemessen.<br />
Die Angstreaktionen sind überdauernd (d.h. chronisch).<br />
Der Betroffene hat keine Möglichkeit, die Angst zu erklären, zu reduzieren oder<br />
zu bewältigen (Mangel an Copingstrategien).<br />
Die Angstreaktionen führen zu einer massiven Beeinträchtigung des<br />
Lebensvollzugs!<br />
128
11.1.3. Neuronale Verarbeitung der Furcht<br />
Neuronale Verarbeitung von Furcht: Die Amygdala bildet das Zentrum der<br />
Furchtkonditionierung; hier werden CS (kortikal) und UCS (Amygdala) assoziativ<br />
miteinander verknüpft!<br />
Die Amgydala (auch Mandelkern genannt) ist ein paarig angelegtes Kerngebiet<br />
im medialen Teil des Temporallappens; sie ist Teil des limbischen Systems (zu<br />
dem darüber hinaus der Hippocampus, der Fornix, die Corpora mamillarae und<br />
der Gyrus Cinguli gehören)<br />
Traditionell ging man davon aus, dass sensorische Informationen im Neokortex<br />
semantisch interpretiert- und erst dann an die Amygdala weitergeleitet werden.<br />
LeDoux (1996) hat jedoch entdeckt, dass die Infos vom Thalamus auch direkt an die<br />
Amygdala weitergeleitet werden können („Low route“), weshalb zwischen 2 Arten der<br />
emotionalen Informationsverarbeitung zu unterscheiden ist:<br />
„Low Road“: Durch die direkte Weiterleitung emotional relevanter Infos vom<br />
Thalamus zur Amgydala wird der Körper in Alarmbereitschaft versetzt (wir<br />
schrecken vor einer Gummischlange oder einem Ast zurück, weil die Umrisse<br />
dieser Gegenstände Gefahr signalisieren)<br />
„High Road“: Erst in einem zweiten Schritt werden die sensorischen Infos im<br />
Neokortex genauer verarbeitet!<br />
Reiz<br />
„High road“<br />
SENSORISCHER THALAMUS NEOKORTEX<br />
„Low Road” - Primärer sensorischer Kortex<br />
(Umrisse)<br />
- unimodaler Assoziationskortex<br />
(Objekte)<br />
- polymodaler Assoziationskortex<br />
AMYGDALA (Konzepte)<br />
(Kontexte) Entorhinaler Kortex<br />
Hippocampus<br />
emotionale Wirkungen Subiculum<br />
Outputsysteme der Amygdala: Die Informationen (Afferenzen) kommen im<br />
lateralen Nucleus der Amygdala an (s.o.) und werden von dort über den basalen<br />
Nucleus zum Zentralen Nucleus („Output-Kern“) der Amygdala weitergeleitet.<br />
AMYGDALA<br />
(Zentraler Nucleus)<br />
4) Hypothalamus<br />
1) Nucleus Reticularis Pontis caudalis Autonomes Nervensystem<br />
Potenzierung des Startle-Reflexes Blutdruck, Herzrate,...<br />
2) Dorsales zentrales Grau 5) Locus coeruleus<br />
Verteidigung, Kampf, Flucht Noradrenalin (Vigilanz)<br />
3) Ventrales zentrales Grau 6) Ventrales Tegmentum (VTA)<br />
„Freezing“ (Verhaltensstarre) Dopamin (Verhaltenserreg.)<br />
129
Keine konditionierte Furcht ohne Amygdala:<br />
Anders als bei gesunden Tieren folgt bei Tieren ohne Amygdala keine SCR auf<br />
einen konditionierten Reiz (sondern nur auf den unkonditionierten).<br />
Bei Ratten ohne Amygdala kann der Startle-Reflex nicht potenziert werden!<br />
Bei einer Läsion der Amygdala führen weder explizite konditionierte Reize, noch<br />
konditionierte Kontextreize zu einer entsprechenden Reaktion; bei einer<br />
Kortexläsion erfolgt die konditionierte Reaktion sowohl auf Kontext- als auch auf<br />
explizite Reize (keine Beeinträchtigung); bei einer Läsion des Hippocampus ist<br />
nur die Reaktion auf Kontextreize beeinträchtigt!<br />
11.1.4. Die 3 Ebenen der Angst/Furcht<br />
Verbal-kognitive Ebene:<br />
Emotionales Empfinden: Furcht vor bestimmten Stimuli; Erwartungsangst (Angst<br />
vor angstbesetzten Situationen); evtl. Ekel (z.B. bei Spinnenphobie); Hilflosigkeit<br />
etc.<br />
Gedanken, Befürchtungen und Fantasien, die meist „automatisch“ auftreten,<br />
nicht kontrollierbar erscheinen und sich immer wieder aufdrängen und das<br />
emotionale Erleben begleiten!<br />
Unterschieden wird zwischen Befürchtungen, die von einem Objekt bzw.<br />
einer Situation ausgehen (z.B. Angst vor öffentlichen Plätzen), und<br />
Befürchtungen, die sich auf die Furchtreaktion beziehen (Angst umzufallen).<br />
Kognitive Verzerrungen zugunsten der Verarbeitung furchtassoziierter Reize in<br />
Wahrnehmung, Gedächtnis und Bewertung (s.u.)<br />
Motorisch-behaviorale Ebene (=Verhaltensebene):<br />
Mimik, Gestik<br />
Vermeidungsstrategien (können offen oder verdeckt sein)<br />
Physiologische Ebene:<br />
Symptome des autonomen Nervensystems:<br />
Herzrate und –variabilität: beschleunigter Herzschlag; Palpitationen<br />
(bewusste Wahrnehmung des eigenen Herzschlags)<br />
Atmung: erhöhte Atemfrequenz (Kurzatmigkeit); Zunahme des CO2-<br />
Partialdrucks (Atemnot; Erstickungsgefühle)<br />
Magen/Darm: Elektrogastrogramm (EGG) misst die Aktionspotenziale der<br />
Magenmuskulatur; bei Angst (z.B. Lügendetektor): Reduktion der<br />
Magenaktivität => Magen-Darm-Beschwerden; Übelkeit<br />
Haut: Hautleitfähigkeit (Skin Conductance Response) nimmt bei Angst zu<br />
(erhöhte Schweißproduktion); Parästhesien (Hitzewallungen, Kälteschauer,<br />
Kribbeln etc.)<br />
Protektive Reflexe: Schreckreflex (=Startle-Response)<br />
Hormonelle Veränderungen (Erhöhte Cortisolausschüttung; messbar am<br />
Cortisolgehalt im Speichel)<br />
Zentralnervöse Korrelate (EEG, fMRT)<br />
Untersuchungsbeispiele:<br />
1. Tunnelphobiker und Kontrollprobanden werden in virtueller Realität mit<br />
furchtauslösenden Stimuli (geschlossener Tunnel, halboffener Tunnel = Galerie)<br />
konfrontiert; dabei werden zu verschiedenen Zeitpunkten sowohl physiologische<br />
Reaktionen (Herzrate, Schreckreflex), als auch die subjektive Reaktion<br />
(Angstrating von 1 bis 100) erfasst!<br />
Das subjektive Angstempfinden: nimmt bei Phobikern im Tunnel sukzessive<br />
zu (bis zu 70) und fällt danach schlagartig ab; in der Gallerie nimmt die Angst<br />
130
im Vgl. zur offenen Straße zwar ebenfalls zu, fällt dann aber noch in der<br />
Gallerie allmählich ab.<br />
Die Herzrate (bpm: „beats per minute“): ist im Tunnel im Vergleich zur<br />
offenen Straße deutlich erhöht (ca. 66 bpm vs. 75 bpm)<br />
Der Schreckreflex fällt im Tunnel stärker aus als auf offener Straße und in der<br />
Gallerie!<br />
Fazit: Anhand des Angstratings und der Herzrate ist eine gute Trennung<br />
zwischen Phobikern und Kontrollpersonen möglich: 96% Sensitivität; 100%<br />
Selektivität; sprich: 96% der Phobiker werden als solche erkannt und kein<br />
Nicht-Phobiker wird zu Unrecht für einen gehalten.<br />
Angstrating: 93% Sensitivität; 100% Selektivität (Spezifität)<br />
Herzrate: 79% Sensitivität; 100% Selektivität<br />
Hautleitfähigkeit: n.s.<br />
2. Spinnenphobikern, Flugphobikern und Kontrollprobanden werden neutrale und<br />
phobische Bilder (z.B. Pilze, Spinnen, Flugzeugabstürze) dargeboten; gemessen<br />
wird die Hautleitfähigkeit, der Schreckreflex und die Hirnaktivität (EEG)<br />
11.1.5. Die verschiedenen Angststörungen<br />
Angststörungen lassen sich in 6 Hauptkategorien unterteilen (Vgl. DSM-IV und<br />
ICD-10):<br />
1. Phobien: Angst vor Gegenständen, Situationen oder Plätzen, die keine objektive<br />
Gefahr darstellen.<br />
Spezifische Phobien<br />
Soziale Phobie<br />
Agoraphobie (tritt aber nur selten in Reinform auf, sondern meistens als eine<br />
Komponente der Panikstörung)<br />
2. Panikstörung: Wiederholte Panikattacken mit plötzlichem Auftreten<br />
physiologischer Symptome (wie z.B. Schwindel, Herzrasen etc.) und panischer<br />
Angst<br />
Tritt meist zusammen mit Agoraphobie auf (s.u.)<br />
3. Generalisierte Angststörung: Anhaltende unkontrollierbare Besorgnis, häufig<br />
über belanglose Dinge<br />
4. Zwangsstörung: Die Erfahrung unkontrollierbarer Gedanken, Impulse oder<br />
Vorstellungen (Zwangsgedanken) und stereotyp ausgeführte Verhaltensweisen<br />
(Zwangshandlungen)<br />
5. Posttraumatische Belastungsstörung: Angstzustände nach schwer belastenden<br />
Erlebnissen (erhöhte Erregbarkeit, Vermeidung bestimmter Reize etc.)<br />
6. Akute Belastungsstörung: Die gleiche Symptomatik wie bei der<br />
<br />
posttraumatischen Belastungsstörung, aber kürzere Dauer (nur bis zu vier<br />
Wochen)<br />
Häufigkeit: Insgesamt leiden in Deutschland knapp 20% aller Frauen und ca. 9%<br />
aller Männer an einer Angststörung.<br />
Die häufigste Angststörung sind dabei spezifische Phobien<br />
Frauen: knapp 14% (Davison: 16%)<br />
Männer: ca. 6% (Davison: 7%)<br />
Soziale Phobien<br />
Frauen: knapp 4%<br />
Männer: rund 2%<br />
Panikstörungen<br />
Frauen: ca. 3%<br />
Männer: knapp 2%<br />
131
Agoraphobie<br />
Frauen: ca. 3%<br />
Männer: ca. 1%<br />
Generalisierte Angststörung<br />
Frauen: ca. 2%<br />
Männer: ca. 1%<br />
Komorbidität:<br />
Angststörungen treten sehr häufig zusammen mit Depressionen und/oder<br />
Substanzmissbrauch auf. Das zeigen u.a. die „Münchener Follow-up-Studie“<br />
(1981) und das „National Comorbidity Survey“ (1991)!<br />
Lebenszeitprävalenzen bei Generalisierter Angststörung:<br />
Depression: 50-60%<br />
Substanzmissbrauch: ca. 30%<br />
Lebenszeitprävalenzen bei spezifischen Phobien:<br />
Depression: ca. 40%<br />
Substanzmissbrauch: 20-30%<br />
Lebenszeitprävalenzen bei Panikstörungen:<br />
Depression: über 60%<br />
Substanzmissbrauch: 30-40%<br />
Lebenszeitprävalenzen bei posttraumatischer Belastungsstörung:<br />
Depression: knapp 50%<br />
Substanzmissbrauch: 50%<br />
In den allermeisten Fällen (ca. 80%) geht die Angststörung der Depression voraus<br />
(sekundäre depressive Episoden)!<br />
Erblichkeit: Angststörungen sind weniger erblich als z.B. Schizophrenie oder<br />
Depression! Trotzdem sind genetische Faktoren nicht völlig unbedeutend!<br />
Angststörungen, insbesondere Panikstörungen, treten familiär gehäuft auf (Odds<br />
ratios von 4 - 6); dass diese Häufig genetische Ursachen hat, wird durch<br />
Zwillingsstudien nahegelegt; Adoptionsstudien gibt es jedoch nicht!<br />
Die durch Vererbung erklärbare Varianz liegt für Angststörungen zw. 30 u. 40%;<br />
dieser Anteil ist signifikant geringer als z.B. für Schizophrenie oder Depression.<br />
Der größte Varianzanteil wird durch Umweltfaktoren erklärt!<br />
132
11.2. Spezifische Phobien<br />
11.2.1. Diagnostik und Epidemiologie<br />
Definition: Unter einer Phobie versteht man ein beeinträchtigendes,<br />
angstvermitteltes Vermeidungsverhalten, das in keinem Verhältnis zu der Gefahr<br />
steht, die von dem gemiedenen Gegenstand oder der gemiedenen Situation ausgeht,<br />
und das die Betroffenen auch als grundlos erkennen.<br />
Der Begriff „Phobie“ leitet sich vom griechischen Gott „Phobos“ ab, der seinen<br />
Feinden Angst machte!<br />
Im DSM IV werden 3 Arten von Phobien unterschieden:<br />
Spezifische Phobien (s.u.)<br />
Soziale Phobie: anhaltende, irrationale Angst vor sozialen<br />
Anforderungssituationen (z.B. Angst davor, in Gegenwart anderer zu essen,<br />
vor anderen zu sprechen etc.); beginnt meist im Kindes- und Jugendalter<br />
Agoraphobie (tritt meist zusammen mit der Panikstörung auf): Angst vor<br />
und Vermeidung von Orten und Situationen, aus denen eine Flucht<br />
schwierig wäre (z.B. Menschenmengen, öffentliche Plätze, U-Bahn,<br />
Warteschlangen etc.)<br />
Spezifische Phobien sind unbegründete Ängste, die durch spezifische Gegenstände<br />
oder Situationen bzw. deren Antizipation ausgelöst werden.<br />
Die DSM-Kriterien zur Diagnose spezifischer Phobien:<br />
A) Durch die Anwesenheit oder Erwartung eines spezifischen Objekts bzw.<br />
einer spezifischen Situation ausgelöste Furcht bzw. Angst<br />
B) Die Konfrontation mit dem phobischen Reiz löst fast immer eine<br />
unmittelbare Furchtreaktion aus, die die Form einer Panikattacke annehmen<br />
kann.<br />
C) Die Phobischen Reize werden vermieden oder nur mit starker Furcht<br />
ertragen.<br />
D) Die Person erkennt, dass die Angst/Furcht bzw. das Vermeiden übertrieben<br />
und unvernünftig ist!<br />
E) Ausgeprägtes Leiden und Beeinträchtigung der beruflichen und/oder<br />
privaten Funktionsfähigkeit!<br />
F) Bei Personen unter 18 Jahren hält die Furcht/Angst über mindestens 6<br />
Monate an!“<br />
Differentialdiagnose: Die Furcht/Angst darf nicht im Zusammenhang mit einer<br />
anderen psychischen Störung stehen, wie z.B.:<br />
mit Wahnvorstellungen oder Zwangsgedanken<br />
mit der Angst vor Verunreinigung (Zwangsstörung)<br />
mit der Angst vor Objekten/Situationen, mit denen der Patient traumatische<br />
Erfahrungen gemacht hat (Posttraumatische Belastungsstörung)<br />
mit der Vermeidung sozialer Situationen aufgrund der Angst vor<br />
Peinlichkeit (Sozialphobie)<br />
mit der Angst vor Panikattacken (Paniksyndrom)<br />
Je nach Auslöser können verschiedene Arten spezifischer Phobien unterschieden<br />
werden:<br />
Tier-Typus: z.B. Spinnenphobie, Schlangenphobie, Hundephobie etc.<br />
Umwelt-Typus: z.B. Angst vor Gewittern oder Dunkelheit<br />
Blut-Spritzen-Verletzungs-Typus<br />
Schulphobien<br />
133
Situativer Typus: z.B. Angst vorm Autofahren, Tunneln, Fliegen, Höhen, engen<br />
Räumen usw.<br />
Acrophobie = Höhenangst<br />
Aviophobie = Flugangst<br />
Klaustrophobie = Platzangst<br />
Sonstiger Typus: Angst vor Erbrechen; Angst vorm Ersticken, Angst, lebendig<br />
begraben zu werden etc. etc.<br />
Epidemiologie:<br />
Spezifische Phobien sind die mit Abstand am häufigsten vorkommende<br />
Angststörung; ihre Lebenszeitprävalenz liegt für Frauen bei 16%, für Männer bei<br />
7%<br />
Die am häufigsten auftretenden spezifischen Phobien sind Tierphobien!<br />
Verwandte ersten Grades von Indexfällen haben ein erhöhtes Erkrankungsrisiko,<br />
das gilt insbesondere für die Agoraphobie!<br />
11.2.2. Ätiologie<br />
Zur Ätiologie von Phobien gibt es verschiedene Theorien:<br />
Nach Rachman gibt es 3 Möglichkeiten, eine Phobie zu erwerben; sie alle<br />
beruhen auf assoziativen Lernprozessen.<br />
1. (Klassische und operante) Konditionierung<br />
2. Stellvertretendes Lernen (Modelllernen)<br />
3. Informationen<br />
In jüngerer Zeit wird betont, dass Phobien auch auf angeborenen Ängsten<br />
beruhen können und daher nicht unbedingt auf assoziativem Weg zustande<br />
kommen müssen (s.u.: Nicht-assoziative Modelle).<br />
Vier Modelle lassen sich unterscheiden:<br />
1. Konditionierungsmodelle<br />
2. Preparedness-Theorie<br />
3. Nichtassoziative Modelle<br />
4. Kognitive Modelle<br />
Konditionierungsmodelle: beruhen auf der 2-Faktoren-Theorie der Angst von<br />
Mowrer und Miller (s.o.); danach entstehen Phobien durch klassische<br />
Konditionierungsprozesse (1. Faktor => Akquisition) und werden durch operante<br />
Konditionierung aufrechterhalten (2. Faktor => Aufrechterhaltung); da das<br />
Vermeidungsverhalten negativ verstärkt wird, kann die konditionierte Angstreaktion<br />
nämlich nicht gelöscht werden!<br />
Beispiele: Hund (CS) + Hundebiss (UCS) Hundephobie; Party (CS) + Kotzen<br />
im Wohnzimmer (UCS) Soziale Phobie; Ratte (CS) + lautes Geräusch (UCS)<br />
Rattenphobie (Vgl. der kleine Albert!)<br />
Diathese-Stress-Modell: Nur bei Vulnerabilität bzw. Prädisposition (z.B.<br />
Neurotizismus) und zusätzlicher Stresserfahrung (z.B. Trauma) entsteht eine Phobie.<br />
Dabei gilt: Je geringer das Trauma (Biss, Kotzen etc.), desto größer muss die<br />
endogene Sensibilität sein, damit eine Phobie entstehen kann!<br />
Untersuchung von 7500 Zwillingen; erhoben wurde a) der Grad an<br />
Neurotizismus (als Marker für die endogene Sensibilität); b) Art und Ausmaß<br />
der Phobie (5 Subtypen) und c) mögliche Entstehungsursachen (schweres vs.<br />
leichtes Trauma; Beobachtung eines Traumas; Beobachtung von<br />
Furchtreaktionen; Anweisung/Information; keine Erinnerung bezüglich der<br />
Ursachen)<br />
134
Hypothesen: Genetische Ursachen spielen eine Rolle!<br />
- Die Geschwister von Indexfällen, die sich an keine Ursache erinnern<br />
können, sollten daher überzufällig häufig ebenfalls unter einer Phobie<br />
leiden!<br />
- Wenn der phobische Indexpatient eine traumatische Ursache erinnert,<br />
sollte dessen Bruder bzw. Schwester dagegen kein erhöhtes Risiko für eine<br />
Phobie haben.<br />
- Sollte Neurotizismus tatsächlich eine Diathese sein, sollten v.a. die<br />
phobischen Pbn ohne Trauma hohe Neurotizismuswerte aufweisen!<br />
Ergebnisse:<br />
49% (!) der phobischen Patienten hatten keine Ursachenerinnerung und<br />
lediglich 36% erinnerten sich an ein erlebtes Trauma. Dieser Befund<br />
widerspricht der Konditionierungshypothese!<br />
Auch der Zusammenhang zwischen endogener Sensibilität und Erblichkeit<br />
(Hypothesen a und b) konnte nicht bestätigt werden.<br />
Ergo: Das Diathese-Stress-Modell, das von einer Wechselwirkung zwischen<br />
angeborener Sensibilität und Konditionierungsprozessen ausgeht, ist zwar<br />
plausibel, vermag die Entstehung von Phobien aber nicht hinreichend zu<br />
erklären!<br />
Preparedness-Theorie oder Theorie des vorbereiteten Lernens (Seligman):<br />
Nicht alle Reize können gleich gut konditioniert werden. Stattdessen besteht für<br />
manche Reize (z.B. Spinnen, Schlangen, Dunkelheit oder Höhe) eine evolutionär<br />
bedingte und dementsprechend angeborene Lernbereitschaft („preparedness“).<br />
„Neutrale“ Reize, die sich leicht mit aversiven Reizen assoziieren lassen, sind<br />
durch folgende Charakteristika gekennzeichnet:<br />
1. Rasche Aneignung von (phobischem) Vermeidungsverhalten, oft schon nach<br />
einmaliger Konfrontation („ease of acquisition“)<br />
2. Erhöhte Löschungsresistenz („resistance to extinction“)<br />
3. Vorbereitete Assoziationen können durch kognitive Instruktionen nur wenig<br />
beeinflusst werden; vorbereitetes Lernen wird daher als eine primitive, nonkognitive<br />
Lernform interpretiert („irrationality“)<br />
Die Theorie des vorbereiteten Lernens wird durch verschiedene empirische<br />
Befunde gestützt:<br />
Wird Ratten nach dem Konsum eines süßen Getränks ein Elektroschock<br />
verpasst, meiden sie in der Testphase zwar den Trinkbehälter, an dem wie in<br />
der Konditionierungsphase ein Licht und ein Lautsprecher angebracht sind;<br />
sie assoziieren den Schock jedoch nicht mit dem Geschmack des Getränks,<br />
sondern trinken auch in der Testphase das gesüßte Wasser. Bei Ratten, bei<br />
denen mit Hilfe von Röntgenstrahlen Übelkeit induziert wurde, ist es<br />
dagegen umgekehrt: Sie präferieren in der Testphase das ungesüßte Wasser<br />
(Geschmack) und ignorieren Licht und Ton!<br />
Kurz: Ratten lernen zwar schnell, Geschmack mit Übelkeit zu<br />
assoziieren (Preparedness), nicht aber mit einem Stromschlag!<br />
Diskriminatives Konditionieren: In der einen Versuchsgruppe werden<br />
neutrale Reize (z.B. Pilzbilder) an einen aversiven Reiz gekoppelt,<br />
angstrelevante Reize (z.B. Spinnenbilder) dagegen nicht („normales“<br />
Lernen); in der anderen Versuchsgruppe ist es umgekehrt (vorbereitetes<br />
Lernen)<br />
135
Die Ergebnisse bestätigen die Preparedness-Theorie: Bei angstrelevanten<br />
Reizen wird die CR (Finger-Puls-Volumen) schneller gelernt und ist<br />
schwerer zu löschen!<br />
Emotionsauslösung ohne bewusste Ursache: Furchtreaktionen können<br />
unbewusst ausgelöst werden.<br />
Der erste empirische Hinweis auf ein implizites (unbewusstes) Furchtgedächtnis<br />
stammt von Edouard Claparède (1873-1940): Er stach einen Amnesiepatienten<br />
bei der Begrüßung mit einem Reißnagel in die Hand; bei darauffolgenden Treffen<br />
mit dem Patienten hatte dieser zwar keine explizite Erinnerung an das<br />
vorangegangene Treffen, verweigerte aber den Handschlag!<br />
Öhman et al. (1997): Schlangen-Phobikern, Spinnen-Phobikern und<br />
Kontrollprobanden wurden verschiedene Bilder (Schlangen-, Spinnen- und<br />
neutrale Bilder) dargeboten, allerdings nur für so kurze Zeit, dass sie diese nicht<br />
bewusst wahrnehmen konnten (subliminale Reizdarbietung): Bild SOA<br />
(Stimulus Onset Asynchrony): 13-30 Ms Maskierungsreiz<br />
Ergebnis: Obwohl die Pbn die Bilder nicht bewusst wahrnehmen konnten,<br />
zeigten die Spinnen-Phobiker bei Spinnenbildern und die Schlangen-Phobiker<br />
bei Schlangenbildern eine erhöhte Hautleitfähigkeit (z.T. war die Reaktion<br />
sogar noch deutlicher als bei bewusster Wahrnehmung!)<br />
Interpretation: Phobische Reize werden automatisch (unbewusst) verarbeitet!<br />
Vgl. LeDoux‟s „Low Road“!<br />
Kritik: Es gibt Hinweise, dass Phobiker phobische Reize schneller erkennen<br />
als Nicht-Phobiker; evtl. haben sie die Bilder also doch bewusst<br />
wahrgenommen!<br />
Modelllernen: Phobische Reaktionen können nicht nur durch eine unangenehme<br />
Erfahrung mit dem gefürchteten Gegenstand oder der gefürchteten Situation erlernt<br />
werden, sondern auch durch Nachahmung der Reaktion anderer.<br />
Kleinkinder zeigen ursprünglich keine Angst vor Schlangen oder Spinnen. Sie<br />
scheinen diese erst durch Beobachtung und Informationen „beigebracht“ zu<br />
bekommen.<br />
Gerull (2002): Kleinkinder bekommen eine Gummischlange und eine<br />
Gummispinne dargeboten; die anwesende Mutter reagiert darauf entweder<br />
mit positivem (fröhlich, ermutigend) oder negativem emotionalen Ausdruck<br />
(Ekel, Furcht)!<br />
Ergebnis: Nach negativer Reaktion der Mutter zeigen die Kinder (insbes.<br />
Mädchen) bei erneuter Darbietung der Gegenstände stärkere Furcht- und<br />
Vermeidungsreaktionen<br />
Interpretation: Furcht wird durch Modelllernen bzw. „Social referencing“<br />
gelernt!<br />
Ähnliche Befunde gibt es aus Tierversuchen:<br />
Mineka: Rhesusaffen, die im Labor aufgewachsen sind, zeigen keine Angst<br />
vor Schlangen; bietet man ihnen jedoch Videos dar, in denen andere Affen<br />
sich vor einer Schlange fürchten, zeigen sie danach ebenfalls Angst vor<br />
Schlangen. Interessant: Werden Videos dargeboten, in denen sich die anderen<br />
Affen vor einem neutralen Reiz (nämlich Blumen) fürchten, überträgt sich<br />
diese Furcht nicht.<br />
Ergo: Genetische Prädisposition und Modellernen wirken zusammen!<br />
136
Lernen durch Information: Phobien können auch durch Informationen über den<br />
betreffenden Gegenstand bzw. die betreffende Situation erzeugt werden.<br />
Kinder zwischen 6 und 9 Jahren bekommen Bilder von 3 unbekannten<br />
australischen Tieren gezeigt, dabei werden ihnen zu den Bildern entweder<br />
positive, negative oder keine Informationen gegeben (kurze Geschichte).<br />
AVn: a) Einstellungsfragebogen; b) Impliziter Assoziationstest (IAT);<br />
Vermeidungsverhalten (Touch box) direkt nach der Geschichte!<br />
Ergebnis: Signifikante Beeinflussung aller abhängigen Variablen durch<br />
positive und negative Informationen!<br />
Interpretation: an sich wenig überraschend; interessant ist jedoch der Aspekt,<br />
dass durch explizite Infos auch implizite, sprich: unbewusste, Einstellungen<br />
verändert werden können!<br />
Nicht-assoziative Modelle: gehen davon aus, dass die meisten Phobien evolutionär<br />
bedingt sind; die ihnen zugrunde liegenden Ängste sind dementsprechend angeboren<br />
(Angst vor Vergiftung etc.) und ihrem Ursprung nach adaptiv; ob sie sich zu einer<br />
Phobie entwickeln, hängt davon ab, wie oft man in einer kritischen Phase mit den<br />
betreffenden Reizen (z.B. Schlangen) konfrontiert wurde. Bei ungenügender<br />
Exposition kommt es zu keiner Habituation; die Folge ist eine Phobie!<br />
Bedenkt man, dass phobische Ängste ihrem Ursprung nach adaptiv sind, ist eher<br />
eine „Hypophobia“ (Mangel an Angst) problematisch!<br />
Empirische Belege für die nicht-assoziative Theorie bieten sowohl retrospektive<br />
als auch prospektive Studien:<br />
Retrospektive Fragebogenstudie: zeigt, dass sich die meisten Phobiker<br />
nicht an ein Konditionierungserlebnis erinnern können. Problem: mögliche<br />
retrospektive Verzerrungen (Erinnerungsverzerrungen, Neubewertungen<br />
etc.)<br />
Höhenphobie: 56% non-assoziative Entstehung; 11% Konditionierungserlebnis;<br />
außerdem: Nicht-ängstliche Personen hatten insgesamt mehr<br />
schmerzhafte Stürze und Verletzungen!<br />
Spinnenphobie: Unter 228 Befragten nur 3 mit direktem<br />
Konditionierungserlebnis<br />
Wasserphobie (Elternbefragung): 56% der Eltern geben an, ihr Kind<br />
hätte schon immer Angst vor Wasser gehabt ( Konditionierung)<br />
Prospektive Studie (von Dunedin): Mehrfache Untersuchung von über<br />
1000 Kindern (und zwar von Geburt an bis zum 18. LJ)!<br />
Höhenphobie: Stürze mit Brüchen, Verrenkungen und ernsthaften<br />
Verletzungen bis zum Alter von 9 Jahren reduzieren die<br />
Wahrscheinlichkeit einer späteren Phobie (mit 18 Jahren)!<br />
Wasserphobie: Schwimmerlebnisse bis zum 9. Lebensjahr sind nicht mit<br />
einer Wasserphobie mit 18 Jahren assoziiert!<br />
Aber: Karies bis zum Alter von 15 Jahren ist ein Prädiktor für eine<br />
Zahnarztphobie im Alter von 18 Jahren; hier scheinen<br />
Konditionierungsprozesse also sehr wohl eine Rolle zu spielen!<br />
Kognitive Theorien: führen Phobien auf kognitive Verzerrungen bei der<br />
Verarbeitung emotional relevanter Reize zurück; solche Verzerrungen fungieren dabei<br />
nicht nur als Diathese, sondern führen zugleich zur Aufrechterhaltung einer Phobie.<br />
Die wichtigsten Paradigmen zur Erfassung kognitiver Verzerrungen sind: a) der<br />
(emotionale) Stroop-Test; b) das Dot-Probe-Paradigma; c) Suchaufgaben (s.u.:<br />
„spider in the grass“); d) Blickbewegungsmessung und e) der implizite<br />
Assoziationstest (IAT)<br />
137
4 Arten von Verzerrungen können unterschieden werden: 1) Der<br />
Aufmerksamkeitsbias; 2) der Erwartungsbias; 3) der Kovariationsbias und<br />
4) der Gedächtnisbias!<br />
Fazit: Eine einheitliche Erklärung für die Entstehung von Phobien gibt es nicht!<br />
Konditionierungsprozesse scheinen nur für bestimmte Phobien (z.B.<br />
Zahnarztphobie) verantwortlich zu sein.<br />
1. Führt nicht jedes Trauma zu einer Phobie<br />
2. Haben nur wenige Phobiker tatsächlich ein traumatisches Ereignis erlebt!<br />
3. Können nicht alle Phobien gleich gut konditioniert werden (angeborene<br />
Lernbereitschaften)<br />
Dasselbe gilt für mangelnde Habituation aufgrund fehlender Exposition; auch<br />
dieser Mechanismus kann keineswegs alle Phobien erklären!<br />
11.2.3. Kognitive Verzerrungen<br />
Die Ausrichtung der selektiven Aufmerksamkeit kann aktiv (= zielgerichtet und<br />
willentlich kontrolliert) oder passiv (= reizgesteuert und unwillkürlich) erfolgen! In<br />
letzterem Fall spricht man vom Pop-out-Effekt! Er tritt u.a. bei bedrohlichen Reizen<br />
auf (und ist in diesem Fall adaptiv, sofern er die Überlebenswahrscheinlichkeit<br />
erhöht)!<br />
Aufmerksamkeitsbias:<br />
Alle Menschen haben die Tendenz, phylogenetisch furchtbesetzte Reize (wie<br />
Spinnen oder Schlangen) schneller wahrzunehmen als neutrale Reize (Pop-out-<br />
Phänomen!)<br />
Öhman: „Snake in the grass“ (Suchaufgabe)<br />
Phobische und nicht-phobische Vpn bekommen eine 2 x 2 oder 3 x 3<br />
Matrix mit Bildern von Schlangen, Spinnen, Blumen und Pilzen dargeboten<br />
und sollen mit einem Tastendruck reagieren, wenn der Targetreiz enthalten<br />
ist; letzterer ist entweder ein neutraler Reiz oder ein angstbesetzter Reiz!<br />
Ergebnisse:<br />
- Sowohl hochängstliche als auch niedrigängstliche Vpn finden den<br />
angstrelevanten Reiz in der 3 x 3-Matrix genauso schnell wie in der<br />
2 x 2-Matrix; bei neutralen Reizen brauchen sie bei der 3 x 3-Matrix<br />
dagegen länger (serielle Suche)!<br />
- Hochängstliche Vpn sind dabei, wenn das Target ein angstbesetzter<br />
Reiz ist, noch schneller als niedrigängstliche!<br />
Interpretation: Es gibt einen allgemeinen Pop-Out-Effekt für<br />
phylogenetisch angstbesetzte Reize; sie werden nicht seriell, sondern<br />
parallel gesucht!<br />
Phobiker haben Probleme damit, den emotionalen Gehalt phobischer Reize zu<br />
ignorieren (die „Neutral target representation“ wird durch die „threat<br />
representation“ gehemmt).<br />
Emotionaler Stroop-Test: Spinnen-Phobiker brauchen im Vgl. zu<br />
Kontrollprobanden und neutralen Wörtern signifikant länger, wenn sie die<br />
Farbe von Wörtern benennen sollen, die mit dem Begriff „Spinne“ assoziiert<br />
sind (z.B. „Spinne“, „haarig“, „Tarantel“ etc.).<br />
Hohe State- und Trait-Angst führt zu einer Verzerrung der selektiven<br />
Aufmerksamkeit hin zu angstbesetzten Reizen!<br />
Dot-Probe I: Vpn bekommen für kurze Zeit (ca. 500ms) zwei Bilder<br />
dargeboten, eines davon ist neutral (z.B. Pilz), eines ist angstbesetzt (z.B.<br />
Spinne); Aufgabe der Vpn ist es, auf einen unmittelbar nach den Bildern in<br />
einer der beiden Bildschirmhälften erscheinenden Reiz (z.B. einen Punkt)<br />
138
mit einem entsprechenden Tastendruck zu reagieren. Erscheint dieser Reiz<br />
hinter dem Bild, auf das der Pb zuvor seine Aufmerksamkeit gerichtet hatte,<br />
gelingt ihm das schneller!<br />
Ergebnis: Ängstliche Vpn reagieren signifikant schneller, wenn der der<br />
Punkt an der Stelle erscheint, an der zuvor der angstbesetzte Reiz<br />
eingeblendet wurde.<br />
Dot-Probe II: Um zu testen, ob dieser Effekt auf erhöhte Vigilanz für<br />
bedrohliche Reize oder reduziertes „Disengagement“ zurückzuführen ist,<br />
wird lediglich ein Bild verwendet.<br />
Ergebnis:<br />
Ursache oder Wirkung: Sind Aufmerksamkeitsverzerrungen nur ein<br />
Epiphänomen emotionaler Zustände oder verursachen sie diese?! Die<br />
empirischen Befunde sprechen eher für letzteres.<br />
Dreistufige Untersuchung (Mathews & MacLeod, 2002):<br />
1. Prä-Test: Dot-Probe Task und Stresstest (30 Anagramme unter<br />
Zeitdruck lösen + Befindlichkeitstest!)<br />
2. Lernphase: Dot-Probe-Task, wobei der Dot entweder immer hinter dem<br />
bedrohlichen oder hinter dem neutralen Reiz erscheint (experimentelle<br />
Manipulation der Aufmerksamkeitsausrichtung!)<br />
3. Post-Test: Dot-Probe-Task (mit neuen Reizen) und Stresstest (s.o.)<br />
Ergebnisse:<br />
a) Die Lerndurchgänge hatten deutlichen Einfluss auf die die<br />
Aufmerksamkeit, nicht aber auf die Stimmung und Angst!<br />
b) ABER: Wenn der Dot in der Lernphase immer hinter dem<br />
bedrohlichen Reiz erschien, zeigten die Pbn eine erhöhte<br />
Stressreaktion im Stresstest; umgekehrt konnte die Trait-Angst<br />
hochängstlicher Patienten reduziert werden, indem der Dot in der<br />
Lernphase immer hinter dem neutralen Reiz erschien.<br />
Interpretation: Aufmerksamkeitsprozesse haben einen Einfluss auf<br />
die Stressverarbeitung, woraus folgt, dass sie zumindest indirekt zur<br />
Entstehung und Aufrechterhaltung von Angststörungen beitragen!<br />
Hypervigilanz-Vermeidungs-Hypothese: Der Umgang mit phobischen Reizen<br />
erfolgt bei Phobikern in zwei zeitlich aufeinander folgenden Schritten: Auf<br />
anfängliche Hypervigilanz (Aufmerksamkeitsfokussierung auf bedrohliche<br />
Reize) folgt der Versuch, die bedrohlichen Reize zu vermeiden.<br />
Durch Eye-Tracking-Studien (bei denen die Pbn z.B. Spinnen suchen<br />
müssen) wird die Hypervigilanz-Vermeidungshypothese bestätigt.<br />
Kovariationsbias:<br />
Pbn bekommen neutrale und phobische Bilder gezeigt (z.B. Pilze, Spinne,<br />
Flugzeugabsturz), denen jeweils in 50% der Fälle ein lauter Ton folgt, um einen<br />
Startle-Reflex auszulösen. Zur Überprüfung des Kovariationsbias werden die<br />
Pbn anschließend gefragt, wie oft nach den einzelnen Bildern der Ton kam.<br />
Mühlberger et al.: Der Kovariationsbias tritt lediglich bei<br />
Spinnenphobikern (phylogenetische Phobie), nicht aber bei Flugphobikern<br />
(ontogenetische Phobie) auf!<br />
139
11.2.4. Therapie<br />
Generell gilt: Patienten mit spezifischen Phobien begeben sich eher selten in<br />
Behandlung (meist nur, wenn ein konkreter Anlass vorliegt); die<br />
Behandlungsmöglichkeiten bei spezifischen Phobien sind jedoch äußerst effektiv.<br />
Verblüffend: Öst behauptet, er brauche bei den meisten spezifischen Phobien<br />
nur 2 bis 7 Stunden, um sie zu heilen!<br />
Die am häufigsten angewandten Therapiemethoden sind:<br />
Systematische Desensibilisierung (nach Wolpe)<br />
Konfrontationstherapie (in vivo oder virtuell)<br />
Flooding<br />
Teilnehmendes Modelllernen<br />
140
11.3. Panikstörung und Agoraphobie<br />
11.3.1. Darstellung des Störungsbildes<br />
Panikstörung und Agoraphobie sind eng miteinander verknüpft!<br />
Ca. 2/3 aller Panikstörungen gehen mit einer Agoraphobie einher!<br />
Die Betroffenen meiden bestimmte Situationen, weil sie befürchten dort<br />
eine Panikattacke zu bekommen („Angst vor der Angst“).<br />
Umgekehrt geht auch die Agoraphobie meist mit Panikattacken, in jedem Fall<br />
aber mit Paniksymptomen einher!<br />
Sowohl mit als auch ohne Panikstörung geht die Agoraphobie mit der Angst<br />
vor einer Attacke einher.<br />
Im ICD 10 wird zwischen Agoraphobie mit und ohne Panikstörung<br />
unterschieden (F 40) und einer reinen Panikstörung (F 41) unterschieden; im<br />
DSM IV zwischen Panikstörung mit und ohne Agoraphobie und Agoraphobie<br />
ohne Panikstörung.<br />
IM ICD-10 wird dementsprechend die Panikstörung-, im DSM IV die<br />
Agoraphobie etwas höher gewichtet; dieser Unterschied ist jedoch marginal!<br />
Definition: Eine Panikstörung ist durch plötzliche und unerklärliche (=<br />
situationsunabhängige) Panikattacken gekennzeichnet; letztere umfassen einerseits<br />
somatische Symptome wie Herzrasen, Atemnot, Übelkeit, Schwindel oder<br />
Schweißausbrüche, andererseits kognitive Komponenten wie die Furcht vor<br />
Kontrollverlust oder sogar Todesangst; hinzu kommen können außerdem Gefühle der<br />
Depersonalisation und Derealisation!<br />
Klassifikationskriterien nach der ICD-10:<br />
Wiederholte Panikanfälle, die oft spontan auftreten und nicht ausschließlich<br />
auf eine spezifische Situation, ein spezifisches Objekt, eine reale Gefahr<br />
oder besondere Anstrengungen bezogen sind.<br />
Die besagten Attacken beginnen abrupt, erreichen innerhalb weniger<br />
Minuten ihren Höhepunkt und klingen meist nach einigen Minuten wieder<br />
ab. Sie können u.a. folgende Symptome umfassen (mindestens vier!):<br />
Palpitationen, erhöhte Herzfrequenz<br />
Schweißausbrüche<br />
Fein- oder grobschlägiger Tremor<br />
Mundtrockenheit<br />
Atembeschwerden<br />
Beklemmungsgefühl<br />
Thoraxschmerzen<br />
Derealisation oder Depersonalisation<br />
Angst vor Kontrollverlust oder verrückt zu werden<br />
Angst zu sterben<br />
…<br />
Mittelgradige Panikstörung (F 41.00): mindestens 4 Panikattacken in 4<br />
Wochen<br />
Schwere Panikstörung (F41.01): mindestens 4 Panikattacken pro Woche<br />
über einen Zeitraum von 4 Wochen<br />
Anmerkung: Über 80% der Patienten mit einer anderen Angststörung (z.B.<br />
einer spezifischen Phobie) erleben ebenfalls Panikattacken, aber nicht so häufig<br />
und spontan, dass die Diagnose einer Panikstörung gerechtfertigt wäre!<br />
141
Definition: Unter Agoraphobie versteht man die Angst vor weiten oder öffentlichen<br />
Plätzen (griech. „agora“ = „Marktplatz“) bzw. davor, keine Fluchtmöglichkeit zu<br />
haben (z.B. in der Mitte eines Kinos) oder im Notfall keine Hilfe zu bekommen (z.B.<br />
auf Flugreisen oder im Wald).<br />
Klassifikationskriterien nach der ICD-10:<br />
Eine deutliche und anhaltende Furcht vor oder Vermeidung von mindestens<br />
2 der folgenden Situationen:<br />
Menschenmengen (z.B. Warteschlangen, Einkaufsstraßen etc.)<br />
Öffentliche Plätze (z.B. Supermarkt, Kino, Straßenbahn etc.)<br />
Alleine Reisen<br />
Reisen mit weiter Entfernung von Zuhause<br />
Mindestens ein Mal nach Beginn der Störung müssen mindestens zwei<br />
Angstsymptome der Panik-Symptome (s.o.) gleichzeitig vorhanden<br />
gewesen sein – und zwar im Zusammenhang mit den gefürchteten<br />
Situationen (s.o.)<br />
Anmerkungen: Agoraphobiker verlassen, wenn überhaupt, nur selten ihre<br />
Wohnung, brauchen meist Begleitung, achten darauf, möglichst immer<br />
Medikamente oder die Telefonnummer des Arztes bei sich zu haben<br />
(„Sicherheitssignale“) etc. etc.<br />
11.3.2. Diagnostik<br />
Differentialdiagnose:<br />
Abgrenzung von anderen Angststörungen: Da Panikattacken auch bei anderen<br />
Angststörungen auftreten (s.o.: in 80% der Fälle!), ist es wichtig, a) die<br />
Häufigkeit der Attacken zu beachten und b) ihren Kontext und zentrale<br />
Befürchtungen herauszuarbeiten!<br />
Panikstörung: Angst vor körperlichen und/oder geistigen „Katastrophen“<br />
(„Ich werde sterben!“; „Ich werde verrückt!“)<br />
Soziale Phobie: Angst vor Bewertung und Blamage<br />
Spezifische Phobien: Angst vor spezifischen Situationen<br />
<br />
(situationsgebundene Befürchtungen)<br />
PTSD: Angst vor Reizen und Situationen, die an das Trauma erinnern<br />
Zwangsstörung: Angst für Objekt der Zwangsvorstellung!<br />
Die Abgrenzung von organischen Erkrankungen: ist bei der Panikstörung<br />
besonders wichtig, da sie sich v.a. in physiologischen Symptomen äußert und<br />
die meisten Patienten von einer physiologischen Ursache überzeugt sind!<br />
Hier nur einige Beispiele, was alles ausgeschlossen werden muss:<br />
Lungenerkrankungen (Atemnot, Enge-Gefühl etc.) => Röntgen und<br />
internistische Untersuchung<br />
Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion: Herzklopfen, Schwitzen,<br />
Angst, Atemnot etc.) => Laboruntersuchung<br />
Herzinfarkt (Brustschmerzen, Unruhe, Atemnot, Vernichtungsgefühl<br />
etc.)<br />
…<br />
Diagnostische Messinstrumente (klinische Fragebögen):<br />
„Agoraphobic Cognitions Questionnaire“ (Ehlers & Margraf): Fragebogen<br />
zu angstbezogenen Kognitionen, z.B. bezüglich körperlicher Krisen,<br />
Kontrollverlust oder Vermeidung.<br />
Wie oft („nie“ bis „immer“) haben sie folgende Gedanken, wenn sie nervös<br />
bzw. ängstlich sind: „Ich muss mich gleich übergeben!“; „Ich muss einen<br />
Hirntumor haben!“ etc.<br />
142
„Body Sensations Questionnaire“ (Ehlers & Margraf): Fragebogen zur Angst<br />
vor körperlichen Symptomen<br />
Wie viel Angst („gar nicht“ bis „extrem“) haben sie vor folgenden<br />
Empfindungen: Herzklopfen, Taubheit in Armen und Beinen etc.<br />
„Angst-Sensitivitäts-Index“ (ASI): misst ebenfalls, wie ängstlich Menschen<br />
auf ihre körperlichen Empfindungen reagieren.<br />
„Ungewöhnliche Körperempfindungen machen mir Angst“; „Ich bekomme<br />
Angst, wenn ich mich schwach fühle“ etc.<br />
„Mobilitätsinventar“ (Ehlers & Margraf): misst das Ausmaß agoraphobischen<br />
Vermeidungsverhaltens.<br />
Pbn müssen anhand einer 5-stufigen Skala (von „niemals“ bis „immer“)<br />
angeben, wie oft sie bestimmte Orte (z.B. Kinos oder Theater, Supermärkte<br />
etc.) alleine und in Begleitung vermeiden!<br />
„Marburger Angst- und Aktivitäts-Tagebuch“ (Margraf & Schneider): misst<br />
a) Anzahl und Ausmaß der Panikattacken, b) globales Angstniveau und c) das<br />
Ausmaß an Aktivitäten!<br />
a) Panikanfälle: Wann und in welcher Situation traten sie auf? Wie viele und<br />
welche Symptome traten auf? Was waren die ersten Anzeichen? etc. etc.<br />
b) Tagesbewertung: durchschnittliche Augst auf einer Skala von 1 bis 10<br />
c) Aktivitätstagebuch: ist v.a. deshalb wichtig, weil die Angst oft durch<br />
agoraphobisches Vermeidungsverhalten, nicht aber durch Genesung<br />
ausbleibt; erfasst wird, wann mit wem was gemacht wurde und wie groß die<br />
Angst dabei war!<br />
Angst-Tagebuch ist v.a. deshalb wichtig, weil bei der nachträglichen Beschreibung<br />
von Panikattacken meist retrospektive Verzerrungen auftreten:<br />
v.a. bei Fragebögen, aber auch bei Interviews wird die Anzahl der Symptome<br />
im Nachhinein überschätzt! Darüber hinaus haben Tagebücher nicht nur eine<br />
diagnostische, sondern auch eine therapeutische Funktion!<br />
11.3.3. Epidemiologie und Verlauf<br />
Epidemiologie: Patienten mit Panikstörung und/oder Agoraphobie machen den<br />
größten Anteil an Panikpatienten aus.<br />
Die Lebenszeitprävalenz liegt für die Panikstörung zwischen 2 und 3%, für<br />
Agoraphobie (mit und ohne Panikstörung) bei 5,7%.<br />
Das Geschlechterverhältnis (Frauen : Männer) liegt in etwa bei 2 : 1<br />
Verlauf:<br />
Der Krankheitsbeginn ist variabel, liegt aber meist zwischen 20 und 30 Jahren;<br />
bei Männern gibt es was Panikattacken betrifft einen zweiten Peak nach dem 40.<br />
Lebensjahr!<br />
In 80% der Fälle gehen dem erstmaligen Auftreten einer Panikstörung<br />
schwerwiegende Lebensereignisse voraus!<br />
Prognose: Eher schlecht; nur in rund 14% der Fälle kommt es zu einer<br />
Spontanremission<br />
Komorbidität: Nur eine Minderheit der Panikpatienten (rund 14%) weisen keine<br />
Komorbidität auf!<br />
Am häufigsten sind:<br />
- Affektive Störungen 71, 4%<br />
- Alkoholmissbrauch: 50%<br />
- Medikamentenmissbrauch: rund 29%<br />
143
11.3.4. Ätiologie<br />
Das psychophysiologische Modell der Panikstörung (von Ehlers und Margraf):<br />
beschreibt die Entstehung von Panik als einen durch positive Rückkopplung<br />
vermittelten Teufelskreis:<br />
Ein Anfall beginnt in der Regel mit körperlichen (Schwindel, Herzrasen etc.)<br />
und/oder psychischen Veränderungen (Gedankenrasen, Attribution von<br />
Kontrollverlust etc.), die ihrerseits durch interne oder externe Stressoren<br />
hervorgerufen werden.<br />
Diese Veränderungen werden wahrgenommen und mit Gefahr assoziiert,<br />
woraufhin der Betroffene mit Angst bzw. Panik reagiert, was wiederum mit<br />
physischen und/oder psychischen Veränderungen einhergeht, die als solche<br />
wahrgenommen und erneut mit Gefahr assoziiert werden etc. etc.<br />
Konkretes Beispiel: Wahrnehmung des eigenen (normalen) Herzschlags<br />
=> Assoziation mit Gefahr => Angst => Erhöhung der Herzrate => …<br />
Die physiologischen Reaktionen von Panikpatienten auf Stresssituationen<br />
unterscheiden sich kaum von denen gesunder Personen; sie interpretieren<br />
diese lediglich anders!<br />
Beeinflusst wird dieser Prozess außerdem durch individuelle Prädispositionen<br />
(z.B. Interozeptionsfähigkeit; Angstsensitivität etc.) und situative Faktoren (z.B.<br />
Hitze, Koffein etc.).<br />
In diesem Sinn ist das psychophysiologische Modell ein Diathese-Stress-<br />
Modell!<br />
Beendet wird eine Attacke entweder durch Bewältigungsstrategien<br />
<br />
(Vermeidung, Hilfe suchen etc.) oder durch negative Rückkopplungsprozesse<br />
(Habituation, Ermüdung), die irgendwann automatisch einsetzen, allerdings sehr<br />
viel langsamer vonstatten gehen als die positive Rückkopplung zwischen Panik<br />
und psychischen bzw. physischen Veränderungen!<br />
Die Zwei-Faktoren-Theorie der Angst (von Mowrer und Miller) wird auch zur<br />
Erklärung der Agoraphobie herangezogen.<br />
Erweiterung der Zwei-Faktoren-Theorie durch Chambless & Goldstein:<br />
Agoraphobiker haben nur selten Angst vor einer Situation als solcher (einfache<br />
Form); stattdessen ist es meist die „Angst vor der Angst“ (komplexe Form), die<br />
sie umtreibt. Sie meiden z.B. öffentliche Orte meistens nur deshalb, weil sie<br />
Angst davor haben, dort eine Panikattacke zu erleiden!<br />
Ein wichtiger Faktor bei der Entstehung von Panikattacken ist die<br />
„Angstsensitivität“ einer Person. Man versteht darunter, die Tendenz,<br />
körperliche Empfindungen als Hinweis auf Bedrohung oder Krankheit zu werten<br />
und dementsprechend ängstlich darauf zu reagieren!<br />
Schmidt et al. (1997): Angehenden US-Soldaten wurde vor der<br />
Grundausbildung der ASI vorgelegt und die erzielten Werte zum späteren<br />
Stressempfinden (Anzahl der Panikattacken, Angst- und<br />
<br />
Depressionsfragebogen etc.) in Bezug gesetzt.<br />
Die Pbn, die hohe ASI-Werte hatten, hatten auch in den späteren Stress-<br />
Messungen signifikant höhere Werte; insbesondere die Frequenz von<br />
Panikattacken ließ sich durch Werte auf dem ASI vorhersagen!<br />
Kognitive Verzerrungen bei Panikpatienten:<br />
Aufmerksamkeitsbias:<br />
Stroop-Test: Panikpatienten brauchen bei der Farbbenennung länger als<br />
Kontrollprobanden, wenn die Wörter sich auf Angst, körperliche<br />
Empfindungen oder Katastrophen beziehen. Am deutlichsten ist die<br />
Verzögerung bei Katastrophenwörtern!<br />
144
Erwartungs- und Kovariationsbias:<br />
Pbn bekommen Bilder aus 4 unterschiedlichen Kategorien (Erotik, neutral,<br />
Spinnen, Unfälle) gezeigt, die in 50% der Fälle von einem lauten Ton<br />
begleitet werden; dabei sollen sie einmal vorab (Erwartungsbias) und<br />
einmal danach (Kovariationsbias) einschätzen, bei welchen Bildern der Ton<br />
am häufigsten auftritt.<br />
Ergebnis: Sowohl a priori als auch a posteriori überschätzen<br />
Panikpatienten die Kovariatin bei Unfallbildern!<br />
Biologische Theorien und Thesen:<br />
Die Tatsache, dass Panikstörungen familiär gehäuft auftreten sowie die<br />
Tatsache, dass die Konkordanz bei monozygoten Zwillingen höher ist als bei<br />
dizygoten, sprechen für eine genetische Diathese!<br />
Panik wird durch eine übermäßige Aktivität der noradrenergen Systems<br />
verursacht.<br />
Die Stimulation des Locus coeruleus (im Pons gelegen) scheint bei Affen<br />
Panikattacken auszulösen.<br />
ABER: Substanzen, die die Aktivität des Locus coeruleus blockieren, haben<br />
sich bei der Behandlung von Panikstörungen bisher nicht als wirksam<br />
erwiesen!<br />
Ley: Panikattacken werden durch Hyperventilation (schnelles, flaches Atmen)<br />
hervorgerufen; Hyperventilation aktiviert nämlich das autonome Nervensystem<br />
und kann dadurch die einschlägigen körperlichen Symptome hervorrufen, die<br />
ihrerseits die Panik und die damit verbundene Rückkopplungsschleife auslösen.<br />
Klein: Panikattacken könnten auch durch überempfindliche CO2-Rezeptoren<br />
ausgelöst werden (=> Erstickungsgefühl => Positive Rückkopplung)<br />
Durch die Gabe kohlendioxid-angereicherter Luft können Panikattacken<br />
ausgelöst werden, allerdings nur bei Panikpatienten bzw. Pbn mit hohen ASI-<br />
Werten! Darüber hinaus kommt es nach einiger Zeit zu einer Habituation,<br />
sprich: die subjektive Angst nimmt bei längerer Gabe CO2-angereicherter<br />
Luft wieder ab!<br />
Einfluss der Einstellung: Insgesamt scheint Panik weniger durch die<br />
physiologischen Reaktionen an sich, als vielmehr durch deren Interpretation<br />
ausgelöst zu werden.<br />
Durch Laktat (ein Salz der Michsäure und Abbauprodukt der<br />
Muskeltätigkeit) können Panikattacken ausgelöst werden, allerdings nur,<br />
wenn vorher entsprechende Erwartungen geschürt werden, sprich: wenn den<br />
Pbn gesagt wird, sie müssten mit angstvoller Spannung (anstatt angenehmer<br />
Erregung) rechnen.<br />
Dasselbe gilt für die Gabe CO2-angereicherter Luft. Wird den Pbn gesagt,<br />
CO2 führe zu starker Erregung, reagieren sie öfter mit Panik als wenn ihnen<br />
gesagt wird, CO2 führe zu Entspannung!<br />
11.3.5. Therapie<br />
Pharmakologische Behandlung:<br />
Einsatz von Antidepressiva (SSRIs, Trizyklika) und Anxiolytika<br />
(Benzodiazepine wie z.B. Tavor)<br />
Nachteile:<br />
Erneutes Auftreten der Symptome nach Absetzen<br />
Abbruch der Behandlung wegen Nebenwirkungen (Gewichtszunahme,<br />
Herzrasen etc.)<br />
Bei Benzodiazepinen besteht eine hohe Suchtgefahr!<br />
145
Psychotherapeutische Behandlungen: umfassen nahezu immer die folgenden 3<br />
Komponenten:<br />
Konfrontation mit internen und externen Reizen<br />
Vermittlung von Bewältigungsstrategien (Entspannungstraining etc.)<br />
kognitive Umstrukturierung<br />
Das kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungsprogramm nach Margraf und<br />
Schneider zielt darauf, das Sicherheits- bzw. Vermeidungsverhalten zu reduzieren und<br />
umfasst folgende Komponenten:<br />
1. Informationsvermittlung (psychophysiologischer Teufelskreislauf: s.o.)<br />
2. Kognitive Maßnahmen:<br />
Aufdeckung typischer Fehlinterpretationen: eine erhöhte Herzfrequenz ist<br />
kein Hinweis auf einen Herzinfarkt; Schweißausbrüche führen nicht zum Tod<br />
etc.<br />
3. Konfrontation mit angstauslösenden Reizen: und zwar zuerst mit internen<br />
und dann mit externen Reizen (Verhaltensexperimente)<br />
Exploration der Symptome und Konzentration auf das Leitsymptom<br />
Bei Herzrasen => z.B. Treppensteigen, Kniebeugen oder Koffeinkonsum<br />
Bei Atembeschwerden => Hyperventilationstest (s.u.) oder die<br />
Aufforderung, die Atmung willentlich zu stoppen<br />
Bei Schwindel => Hyperventilationstest (s.u.) oder Drehstuhl<br />
Der Hyperventilationstest erfolgt in mehreren Schritten:<br />
Exploration der Symptome während eines typischen Panikanfalls<br />
Erläuterung des Hyperventilationstests<br />
Durchführung: Zwei Minuten Brustatmung mit einem Atemzug pro<br />
Sekunde!<br />
Danach: Introspektion<br />
Eine Metaanalyse von Clum (1993) zur Effektivität unterschiedlicher<br />
Behandlungsformen bei Panikstörungen mit und ohne Agoraphobie ergab folgende<br />
mittleren Effektstärken:<br />
Kognitiv-verhaltenstherapeutische Programme: 1.41 (am wirksamsten!)<br />
Flooding: 1.36<br />
Antidepressiva: 0.82<br />
Hochpotente Benzodiazepine: 0.29<br />
146
11.4. Zwangsstörung<br />
11.4.1. Darstellung des Störungsbildes und Diagnose<br />
Definition: Die Zwangsstörung (engl.: „Compulsive Obsessive Disorder“) ist eine<br />
Angststörung, bei der das Bewusstsein von beständigen und unkontrollierbaren<br />
Gedanken (Zwangsgedanken) überflutet wird und/oder das Individuum sich dazu<br />
genötigt sieht, bestimmte Handlungen (z.B. Putzen oder Händewaschen) immer und<br />
immer wieder auszuführen (Zwangshandlungen).<br />
Diagnosekriterien nach der ICD-10:<br />
Es treten über mindestens 2 Wochen an den meisten Tagen entweder<br />
Zwangsgedanken (Obsessionen) oder Zwangshandlungen (Compulsionen)<br />
auf, die ihrerseits durch folgende Merkmale gekennzeichnet sind:<br />
Sie werden als Produkte des eigenen Geistes betrachtet (keine Eingebungen<br />
durch andere)!<br />
Sie treten wiederholt auf, werden als unangenehm empfunden und<br />
vergeblich zu unterdrücken versucht.<br />
Mindestens eine Obsession oder Compulsion wird als übertrieben oder<br />
unangemessen erkannt.<br />
Beeinträchtigung der beruflichen und privaten Funktionsfähigkeit<br />
Nicht auf andere psychische Störungen wie Schizophrenie oder affektive<br />
Störungen zurückführbar!<br />
DSM IV:<br />
Insgesamt genauere Beschreibung der Zwangsstörung und strengere Kriterien<br />
Ausschlusskriterien sind z.B. besser umschrieben (Drogenmissbrauch und<br />
körperliche Krankheiten)<br />
Spezifikation: Zwangsstörungen gehen oft mit wenig Einsicht einher!<br />
Keine Unterscheidung zwischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen (?!)<br />
Erscheinungsform: 80% der Patienten leiden sowohl unter Zwangsgedanken als<br />
auch unter Zwangshandlungen. Dabei ist der Zusammenhang i.d.R. so, dass die<br />
Zwangsgedanken beängstigend sind - und die Zwangshandlungen dazu dienen, diese<br />
Angst zu reduzieren.<br />
Zwangsgedanken…<br />
sind ungewollt, belastend und rufen inneren Widerstand hervor<br />
sind ich-fremd (ichdyston) und unkontrollierbar (= Intrusionen)<br />
werden als sinnlos bzw. irrational erkannt (Einsicht)<br />
haben häufig aggressive oder sexuelle Inhalte<br />
Zwangshandlungen…<br />
sind stereotype und ritualisierte Verhaltensweisen, die als unangenehm und<br />
unkontrollierbar empfunden werden<br />
werden als sinnlos bzw. irrational erkannt (Einsicht)<br />
Formen der Vermeidung:<br />
- Passive Vermeidung: Vermeidung von Situationen und Stimuli, die<br />
Zwangsgedanken (z.B. Angst vor Kontamination) und –handlungen (z.B.<br />
Händewaschen) hervorrufen könnten (z.B. werden bestimmte Objekte nicht<br />
mehr angefasst, etwa alles, was braun ist)<br />
- Aktive Vermeidung: Zwangshandlungen (z.B. ständiges Kontrollieren oder<br />
Waschen)<br />
- Neutralisierende Gedanken: dienen dazu, die durch die Zwangsgedanken<br />
ausgelöste Angst zu reduzieren.<br />
147
Beispiele für Zwangsphänomene:<br />
Angst vor Kontamination (z.B. durch Schmutz, Keime, Blut, Gift oder<br />
Radioaktivität) Ständiges Waschen des eigenen Körpers, Sterilisieren der<br />
Wohnung, häufige Arztbesuche (man könnte sich ja beim Friseur Aids<br />
eingefangen haben…) etc.<br />
Angst vor eigener oder fremder physischer Gewalt (z.B. „Ich werde mein<br />
Kind verletzen!“) Es wird vermieden, mit dem Kind allein zu sein; Messer<br />
werden weggesperrt etc.<br />
Angst davor anderen unbemerkt Schaden zugefügt zu haben (z.B. „Ich habe<br />
jemanden überfahren ohne es zu merken!“) Anrufe bei Kliniken und Polizei,<br />
wiederholtes Abfahren der Strecke; Absuchen des Autos nach Beulen<br />
Sexuelle Ängste (z.B. „Ich werden jemanden vergewaltigen!“) Es wird<br />
vermieden, allein mit Frauen zu sein, Unterdrückung sexueller Gedanken etc.<br />
Religiöse Ängste (z.B. Angst vor blasphemischen Gedanken oder religiösem<br />
Zweifel) Ständiges Beten, Beichten etc.<br />
Zur Häufigkeit einzelner Zwangsphänomene:<br />
Zwangsgedanken<br />
Kontamination: 45%<br />
Pathologische Sorge (z.B. um körperliche Fehlfunktionen): 42%<br />
Aggressive Zwangsgedanken: 28%<br />
Multiple Obsessionen: 60%<br />
Zwangshandlungen<br />
Kontrollieren: 63%<br />
Waschen: 50%<br />
Zählen (z.B. die Badfließen): 36%<br />
Sammeln/Horten: 18%<br />
Multiple Zwangshandlungen: 48% (am häufigsten ist die Kombination aus<br />
Wasch- und Kontrollzwang)<br />
Diagnostische Verfahren:<br />
SKID-I: „Strukturiertes Klinisches Interview für die Achse I des DSM-IV“<br />
DIPS: „Diagnostische Interview bei psychischen Störungen“<br />
Y-BOCS: „Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale”<br />
Strukturiertes Interview, bestehend aus 10 Items<br />
misst die Schwere der Zwangssymptome und Therapieeffekte<br />
wird eher zur Therapieplanung als zur Diagnose eingesetzt<br />
MOCI: „Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory“<br />
Umfasst 30 Items die mit „richtig” oder „falsch“ zu beurteilen sind:<br />
z.B.: „Ich vermeide es, öffentliche Telefone wegen möglicher<br />
Beschmutzung zu benutzen.“<br />
11.4.2. Epidemiologie und Verlauf<br />
Die wichtigsten epidemiologischen Daten:<br />
Lebenszeitprävalenz: ca. 2%<br />
Geschlechterverteilung: 1:1<br />
Männer leiden häufiger unter Kontrollzwang, Frauen häufiger unter<br />
Reinigungszwang<br />
Beginn der Störung: meist zwischen 20 und 25 Jahren , in seltenen Fällen vor<br />
dem 10. oder nach dem 40. Lebensjahr<br />
Oft gehen belastende Lebensereignisse voraus (z.B. Schwangerschaft,<br />
Ehekonflikt oder Probleme am Arbeitsplatz)<br />
Männer bekommen die Störung i.d.R. früher als Frauen<br />
148
Verlauf und Prognose:<br />
Drei Verlaufstypen können unterschieden werden:<br />
- Kontinuierlicher Verlauf (am häufigsten: 85%)<br />
- Verschlechterung<br />
- Episodischer Verlauf (am seltensten: 2%)<br />
Häufige Folgeprobleme: Depression, Alkoholmissbrauch, Beziehungsprobleme<br />
Prinzipiell gilt: Unbehandelt verlaufen Zwangsstörungen meist chronisch und<br />
selbst mit Behandlung kann vielen Patienten nicht wirklich geholfen werden! Die<br />
Zwangsstörung gilt daher als eine der am schwersten zu behandelnden<br />
psychischen Störungen.<br />
Es treten nur äußerst selten Spontanheilungen auf und je länger die<br />
Krankheit bereits dauert (> 1 Jahr), desto unwahrscheinlicher ist eine<br />
Spontanremission!<br />
Rund 30% aller Betroffenen lehnen eine Behandlung ab und nur bei 15-40%<br />
derjenigen, die sich einer Behandlung unterziehen, können klinisch relevante<br />
Verbesserungen erzielt werden (Vgl. dazu Katamnesestudien)!<br />
Für eine gute Prognose sprechen folgende Faktoren:<br />
Guter psychischer und physischer Gesundheitszustand vor dem Auftreten der<br />
Zwangsstörung („prämorbide Anpassung“)<br />
Episodischer Verlauf der Zwangssymptomatik (Phasen vorübergehender<br />
Besserung)<br />
„Atypische“ Zustände (wie z.B. extreme Angst oder Depression), die<br />
ihrerseits Ansatzpunkte für die Therapie bieten<br />
Kurze Dauer (nicht unbedingt geringe Intensität)<br />
Identifikation kritischer Lebensereignisse (ist umstritten)<br />
Für eine schlechte Prognose sprechen folgende Faktoren:<br />
Prämorbide Störung (z.B. Depression)<br />
Lange Dauer der Störung bei Beginn der Therapie<br />
Unverheiratet<br />
„Overvalued Ideas“: wenn der Patient meint, dass seine Ängste im Kern eine<br />
berechtigte Grundlage haben!<br />
11.4.3. Störungstheorien und -modelle<br />
Bedeutsam sind v.a. zwei Modelle: nämlich das lerntheoretische Modell und das<br />
kognitive Modell; darüber hinaus gibt es Theorien zu biologischen Ätiologiefaktoren.<br />
Das lerntheoretische Modell: basiert auf der 2-Faktoren-Theorie von Mowrer und<br />
geht dementsprechend davon aus, dass Zwangsstörungen durch klassische<br />
Konditionierung gelernt und durch operante Konditionierung aufrechterhalten werden.<br />
Die Theorie:<br />
1. Klassische Konditionierung: UCS (eine aversive Konfliktsituation) + NS<br />
bzw. CS (z.B. Schmutz) CR (gelernte Angstreaktion)<br />
Der gewalttätige Stiefvater (UCS) hat am Bau gearbeitet und kam daher<br />
immer dreckig (CS) nach Hause!<br />
2. Operante Konditionierung: Zwangshandlungen werden negativ verstärkt,<br />
sofern durch sie die gelernte Angst vermieden wird!<br />
Durch ständiges Waschen wird die Angst, die durch Schmutz<br />
hervorgerufen wird, reduziert!<br />
Kritik: Der erste Faktor (klassische Konditionierung) ist problematisch: erstens<br />
führen nicht alle Traumata zu einem Zwang; zweitens lassen sich nur bei wenigen<br />
Zwangsstörungen Traumata identifizieren!<br />
Der zweite Faktor (operante Konditionierung) ist dagegen hilfreich!<br />
149
Die wichtigste Implikation der Theorie: Die Angst wird auch (bzw. nur) dann<br />
abnehmen oder sogar verschwinden (Extinktion), wenn das Vermeidungsverhalten<br />
bzw. die Zwangshandlungen nicht(!) ausgeführt werden!<br />
Die Zwei-Faktoren-Theorie bildet damit die Grundlage für<br />
Expositionsverfahren mit Reaktionsverhinderung (z.B. einen Türgriff<br />
anfassen, ohne sich danach die Hände zu wachsen)<br />
Das kognitive Modell von Salkovskis: greift die Zwei-Faktoren-Theorie auf,<br />
erweitert sie aber um kognitive Faktoren<br />
Unterscheidung zwischen sich aufdrängenden Gedanken (= Zwangsgedanken<br />
bzw. Intrusionen) und automatischen Gedanken.<br />
Intrusionen: sind irrational, ichdyston und nicht kontrollbierbar (sie treten in<br />
unterschiedlichem Ausmaß bei allen Menschen auf!)<br />
Automatische Gedanken: werden durch die Intrusionen ausgelöst und<br />
werden durch dysfunktionale Überzeugungen (z.B. „Was ich denke, wird<br />
auch passieren!“) bestimmt. Im Gegensatz zu den Intrusionen sind<br />
automatische Gedanken ichsynton und direkt beeinflussbar!<br />
Annahme dysfunktionaler Überzeugungen:<br />
Überschätzung der Bedeutung von Zwangsgedanken (z.B.: „Was ich denke,<br />
wird auch passieren!“)<br />
Überschätzung der Wahrscheinlichkeit der Folgen eines Ereignisses (z.B.: An<br />
einem Kamm können HI-Vieren sein“)<br />
Überschätzung der eigenen Verantwortlichkeit<br />
Bedürfnis nach Perfektion<br />
Fehleinschätzung der Konsequenzen der Angst<br />
Annahme verschiedener Rückkopplungsschleifen:<br />
1) Aufdringlicher Gedanke (Intrusion):<br />
- z.B. „Ich könnte ein Kind verletzen!“<br />
2) Automatischer Gedanke (Bewertung)<br />
- z.B. „Dieser Gedanke ist fürchterlich!“<br />
3) Emotionale Reaktion<br />
- Unruhe, Angst, Erregung (Arousal)<br />
4) Neutralisierung/Abwehr (Zwangshandlung)<br />
- z.B. Wegsperren von Messern<br />
Die Zwangshandlung führt zwar zur kurzfristigen Reduktion der Angst,<br />
verstärkt aber zugleich die dysfunktionalen Annahmen und erhöht die<br />
Bedeutsamkeit bzw. Häufigkeit intrusiver Gedanken!<br />
Durch die emotionale Reaktion werden die automatischen Gedanken verstärkt<br />
und durch die automatischen Gedanken (z.B. „Ich darf so etwas nicht<br />
denken!“) die Intrusionen. Der Versuch, die Intrusionen zu unterdrücken,<br />
wirkt nämlich paradox!<br />
+<br />
+<br />
-<br />
150
Experimentelle Bestätigung:<br />
Salkovskis (2003): Patienten mit Zwangsstörung werden mit ihren<br />
individuellen auf Tonband aufgenommenen Intrusionen konfrontiert; in der<br />
ersten Phase sollen sie sich entweder durch Zählen ablenken oder das übliche<br />
neutralisierende Verhalten zeigen (UV), in der zweiten Phase dürfen sie sich<br />
weder ablenken, noch neutralisierendes Verhalten zeigen.<br />
Ergebnisse:<br />
- Zu Beginn der ersten Phase ist die Angst („Discomfort“) in beiden<br />
Gruppen gleich stark, im Gegensatz zur Ablenkungsgruppe nimmt sie<br />
in der Neutralisierungsgruppe jedoch bis zum Ende dieser Phase stark<br />
ab.<br />
- In der zweiten Phase nimmt die Angst in der Neutralisierungsgruppe<br />
bis zum Ende massiv zu, in der Ablenkungsgruppe dagegen nicht!<br />
Interpretation: Zwangshandlungen sind zwar kurzfristig effektiv,<br />
langfristig wirken sie jedoch verstärkend auf die Angst!<br />
Ansatzpunkte für die Therapie:<br />
Automatische Gedanken / dysfunktionale Überzeugungen: Neubewertung /<br />
Entkatastrophisierung der Intrusionen<br />
Emotionale Reaktion: Emotionale Distanzierung<br />
Zwangshandlungen: Konfrontation mit Reaktionsvermeidung<br />
Biologische Theorien:<br />
Serotoninhypothese: Die (wenn auch nur sehr begrenzte) Wirksamkeit von<br />
Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern spricht dafür, dass Zwangsstörungen mit<br />
einem Serotoninmangel zusammenhängen.<br />
Überaktivität des Frontallappens<br />
Defekt der Basalganglien<br />
13.4.5. Experimentelle Befunde:<br />
Patienten mit Zwangsstörung haben ein geringeres Vertrauen in sich selbst und das<br />
eigene Gedächtnis!<br />
Gibt man Zwangsgestörten (mit zwanghaftem Kontrollverhalten) einen<br />
Allgemeinwissenstest vor und lässt sie a) nach jedem Item einschätzen, wie sicher<br />
sie sich bei der Antwort sind und b) nach dem Test einschätzen, wie gut sie<br />
insgesamt abgeschnitten haben, unterschätzen sie ihre Leistung in beiden Maßen!<br />
Zwangsstörungen hängen kausal mit der empfundenen Verantwortlichkeit<br />
zusammen.<br />
Patienten mit Zwangsstörung und Kontrollprobanden bekommen die Aufgabe,<br />
Pillen der Farbe nach zu ordnen; einem Teil wird dabei vermittelt, dass diese<br />
Aufgabe sehr wichtig sei (hohe Verantwortlichkeit), einem anderen nicht<br />
(niedrige Verantwortlichkeit).<br />
Ergebnis: Das Kontrollverhalten und das subjektive Empfinden von Zwang<br />
waren in der Bedingung mit hoher Verantwortlichkeit bei Zwangspatienten<br />
signifikant höher als bei den Kontrollprobanden!<br />
151
13.5. Posttraumatische Belastungsstörung<br />
13.5.1. Beschreibung des Störungsbildes und Diagnose<br />
Hintergrundinfo: Die posttraumatische Belastungsstörung wurde erst verhältnismäßig<br />
spät als eigenständiges Störungsbild (an)erkannt.<br />
Die Symptome wurden erstmals Ende des 19./ Anfang des 20. Jahrhunderts<br />
beschrieben.<br />
Anlass waren schwere Eisenbahnunfälle, die Weltkriege und später die<br />
Holocaustopfer!<br />
Entscheidende Ereignisse waren: der Vietnamkrieg (zahllose „unehrenhafte<br />
Entlassungen“ gestörter Soldaten) und die Frauenbewegung (offenerer Umgang<br />
mit sexuellem Missbrauch)<br />
Definition: Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine auf extreme<br />
Belastungserfahrungen zurückgehende Angststörung, die durch folgende<br />
Kernsymptome gekennzeichnet ist:<br />
1. (Ungewolltes) Wiedererleben des traumatischen Ereignisses im Gedächtnis,<br />
Tagträumen oder Träumen<br />
Das Wiedererleben ist dabei durch extreme Realitätsnähe gekennzeichnet!<br />
2. Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die mit dem Trauma assoziiert sind<br />
und Unterdrückung der Erinnerung an das Trauma (bis hin zur Amnesie).<br />
3. Symptome autonomer Überregung (Hypervigilanz, übertriebene Schreckreaktion,<br />
Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen etc.)<br />
4. Emotionale Stumpfheit, Teilnahmslosigkeit und Anhedonie<br />
Kriterien nach der ICD-10:<br />
Traumatisches Ereignis, das „bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen<br />
würde“<br />
Problematisch, da weniger die objektiven Merkmale eines Traumas, als<br />
vielmehr dessen subjektive Bedeutung entscheidend für die Entstehung einer<br />
posttraumatischen Belastungsstörung sind!<br />
Typische Traumata sind: Vergewaltigung, sexueller Missbrauch,<br />
Raubüberfälle, Kriegseinsätze, schwere Unfälle, Naturkatastrophen etc.<br />
Symptome:<br />
notwendig: Beharrliches Wiedererleben des Traumas (s.o.)<br />
typisch: Vermeidung; vegetative Überregung; Gefühlstaubheit<br />
Dauer: Die Symptome treten i.d.R. innerhalb von 6 Monaten nach dem Ereignis<br />
auf und dauern mindestens einen Monat an!<br />
Die Komorbidität bei der PTB ist sehr hoch: In 80-90% der Fälle liegen weitere<br />
Störungen vor; am häufigsten sind affektive Störungen, weitere Angststörungen,<br />
Substanzmissbrauch und Somatisierung (die zeitliche Abfolge ist ungewiss)<br />
Diagnostische Verfahren:<br />
Semistrukturierte Interviews zur Diagnose und Erfassung der Komorbiditäten:<br />
DIPS, SKID-I<br />
Strukturiertes Interview zur Erfassung des Schweregrades der Störung: CAPS<br />
(„Clinician Administered PTSD Scale“)<br />
Differentialdiagnose: Ausgeschlossen werden müssen…<br />
Anpassungsstörung (liegt vor, wenn das traumatische Ereignis weniger drastisch<br />
ist und die Kriterien für die posttraumatische Belastungsstörung nicht ganz erfüllt<br />
werden: z.B. nach dem Tod eines geliebten Menschen)<br />
Trauerreaktion<br />
152
Akute Belastungsstörung (liegt vor, wenn die Symptome der PTB weniger als<br />
einen Monat andauern)<br />
Andauernde Persönlichkeitsveränderung nach einem Trauma (liegt bei einer<br />
Dauer von mindestens 2 Jahren vor)<br />
Andere Angststörungen und Depressionen: Falls schon vor dem traumatischen<br />
Erlebnis eine Depression oder Angststörung vorlag, muss geklärt werden, ob die<br />
Symptome (Vermeidung, Gefühlstaubheit etc.) lediglich eine Verschlimmerung<br />
der bestehenden Störung darstellen!<br />
Hirnverletzungen<br />
13.5.2. Epidemiologie und Verlauf<br />
Die Mehrheit der Bevölkerung erlebt im Lauf des Lebens mindestens eine<br />
traumatische Situation!<br />
Männer erleben dabei im Schnitt häufiger traumatische Ereignisse<br />
(berufsbedingt) als Frauen; trotzdem liegt das Geschlechterverhältnis bei 2:1,<br />
was wohl daran liegt, dass Frauen mehr Ereignisse mit traumatischer Wirkung<br />
erleben!<br />
Knapp 13% aller amerikanischen Frauen wurden nach Schätzungen<br />
mindestens ein Mal in ihrem Leben vergewaltigt. Die Wahrscheinlichkeit,<br />
nach einer Vergewaltigung eine PTSD zu entwickeln liegt bei ca. 50%<br />
Vorlesung: Die Lebenszeitprävalenz liegt zw. 5% (Männer) und 10%<br />
(Frauen)! Davison: Lebenszeitprävalenz liegt zwischen 1 und 3%!<br />
Die Schätzung der Lebenszeitprävalenz ist bei der PTSD natürlich stark<br />
kohortenabhängig; in Kriegszeiten beispielsweise ist sie höher als in<br />
Friedenszeiten!<br />
Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer PTSD nach einem traumatischen Ereignis<br />
erhöhen, sind:<br />
Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit des traumatischen Ereignisses<br />
Heftigkeit der initialen Reaktion auf das Ereignis<br />
„Sich-Aufgeben“ in der Trauma-Situation<br />
Dissoziative Symptome (z.B. Depersonalisation oder Derealisation) während des<br />
traumatischen Ereignisses<br />
Vulnerabilität (frühkindliche Traumata, Anzahl bereits erlebter Traumata etc.)<br />
13.5.3. Störungsmodelle<br />
A) Kognitives Modell nach Ehlers und Clark<br />
Die Angst von PTB-Patienten unterscheidet sich von anderen Ängsten dadurch, dass<br />
sie nicht auf eine zukünftige Bedrohung gerichtet ist, sondern aufgrund eines<br />
vergangenen Ereignisses entsteht.<br />
Eine chronische posttraumatische Belastungsstörung entsteht dabei dann, wenn das<br />
traumatische Ereignis so verarbeitet wird, dass der Betroffene das Gefühl hat,<br />
gegenwärtig bedroht zu sein!<br />
Die Wahrnehmung einer gegenwärtigen Bedrohung basiert nach Ehlers und Clark<br />
auf 2 Prozessen: Zum einen auf der Interpretation des Traumas und seiner<br />
Konsequenzen, zum anderen auf den Eigenheiten des Traumagedächtnisses.<br />
1. Personen, die eine PTB entwickeln, interpretieren das traumatische<br />
Ereignis und dessen Konsequenzen durchweg negativ.<br />
Trauma: „Ich wurde vergewaltigt, weil man mir ansieht, dass ich ein<br />
leichtes Opfer bin.“; „Es kann jederzeit wieder passieren!“ etc.<br />
153
Konsequenzen: Reizbarkeit: „Ich habe mich als Person zum Negativen<br />
hin entwickelt!“; Alpträume: „Ich werde nie darüber hinwegkommen!“;<br />
Konzentrationsprobleme: „Mein Hirn hat Schaden genommen!“;<br />
Unterstützung durch andere: „Ich werde mich anderen nie wieder nahe<br />
fühlen!“ etc.<br />
2. Das Traumagedächtnis ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:<br />
- Ungenügende Elaboration (Verarbeitung) der Inhalte und mangelnde<br />
Einbettung in das sonstige autobiographische Gedächtnis:<br />
Traumatische Erinnerungen sind dementsprechend meist ungeordnet,<br />
bruchstückhaft und kontextlos; einzelne Aspekte werden dafür umso<br />
lebhafter wiedererlebt!<br />
- Starke Reiz-Reiz- und Reiz-Reaktions-Assoziationen: Die Inhalte im<br />
Traumagedächtnis sind besonders eng und vielfältig miteinander<br />
verknüpft und können dementsprechend leicht getriggert werden (z.B.<br />
löst ein Donner die Erinnerung ans Schlachtfeld aus, die wiederum mit<br />
Flucht assoziiert ist etc. etc.)<br />
- Starkes Priming: Reize, die ein Wiedererleben des Traumas auslösen<br />
können, werden besonders leicht bemerkt und schlecht diskriminiert<br />
(sind also wenig spezifisch)!<br />
Verhaltensweisen und kognitive Verarbeitungsstrategien, die zur Kontrolle<br />
bzw. Vermeidung der gegenwärtigen Bedrohung dienen, halten die Störung<br />
aufrecht und sind daher dysfunktional!<br />
1. Erzeugen sie viele Symptome der PTSD (paradoxer Effekt der<br />
Gedankenunterdrückung, Gefühlstaubheit etc.)!<br />
2. Verhindern sie die Veränderung der negativen Interpretation des Traumas und<br />
seiner Konsequenzen!<br />
3. Verhindern sie die Elaboration des Trauma-Gedächtnisses!<br />
Beispiele für dsyfunktionale Einstellungen von Patienten mit PTSD:<br />
…fühlen sich verletzt und verletzbar<br />
…halten die Welt für bedeutungslos, unverständlich und unkontrollierbar<br />
…betrachten sich selbst als beschädigt und wertlos<br />
B) Zwei-Faktoren-Theorie der Angst (zum tausendsten Mal!)<br />
PTSD entsteht durch klassische Konditionierung und wird durch operante<br />
Konditionierung aufrechterhalten!<br />
Beispiel:<br />
Klassische Konditionierung: UCS (z.B. Vergewaltigung) + CS (z.B.<br />
Stadtpark/braunhaarige Männer/Dunkelheit etc.) => CR<br />
Operante Konditionierung: Betroffene vermeidet Spaziergänge im Park,<br />
Dunkelheit und braunhaarige Männer<br />
Neuere Befunde legen nahe, dass die PTSD darüber hinaus durch<br />
Konditionierungsprozesse zweiter Ordnung (CS + NS => CR) aufrechterhalten<br />
wird: Traumarelevante Hinweisreize (z.B. Stadtpark) scheinen von Patienten mit<br />
PTSD nämlich schnell mit neuen Reizen assoziiert zu werden (z.B. Herr P., der immer<br />
im Park spazieren geht); die auf diese Weise neu konditionierten Reize weisen darüber<br />
hinaus eine hohe Löschungsresistenz auf!<br />
Patienten mit PTSD, Personen mit traumatischer Erfahrung, aber ohne PTSD und<br />
gesunden Kontrollprobanden werden zwei Bilder mit jeweils unterschiedlichen<br />
geometrischen Formen dargeboten. Auf eines dieser Bilder folgt dabei immer ein<br />
(un)konditionierter Reiz (nämlich ein Trauma-Bild), auf das andere nie. Die eine<br />
Form ist somit ein „Sicherheitssignal“, die andere ein „Warnsignal“; erhoben<br />
154
wurde die subjektiv eingeschätzte Valenz der 3 Bilder, das Arousal (SCR,<br />
Herzrate, Startle) und EEG.<br />
Ergebnisse:<br />
- Sowohl die PTSD-Patienten als auch die Personen mit traumatischer<br />
Erfahrung lernten, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, zwischen<br />
den beiden Hinweisreizen zu diskriminieren (das Warnsignal wurde<br />
nach einigen Durchgängen schlechter bewertet, führte zu höherem<br />
Arousal und einem anderen EKP); bei den Kontroll-Pbn war das nicht<br />
der Fall.<br />
- Die PTSD-Patienten unterschieden sich von den trauma-erfahrenen Pbn<br />
ohne Störung dadurch, dass die konditionierte Reaktion auf das<br />
Warnsignal bei ihnen wesentlich löschungsresistenter war!<br />
C) Biologische These<br />
Ein kleineres Volumen des Hippocampus scheint ein Vulnerabilitätsfaktor für die<br />
Entstehung einer posttraumatischen Belastungsstörung zu sein.<br />
Je geringer das Hippocampus-Volumen von Kriegsveteranen mit PTSD, desto<br />
ernster die Symptomatik! Dass das geringe Hippocampusvolumen dem Trauma<br />
vorausging und nicht erst durch dieses ausgelöst wurde, konnte dadurch<br />
sichergestellt werden, dass man sich auch die Zwillingsbrüder der Soldaten<br />
anschaute, die nicht im Krieg waren, und feststellte, dass auch sie ein geringeres<br />
Hippocampusvolumen aufwiesen.<br />
13.5.4. Prävention gegen PTSD bei Einsatzkräften<br />
Eine epidemiologische Studie der LMU München zur Belastung von<br />
Feuerwehrmännern in Bayern brachte folgende Ergebnisse:<br />
2-3% der Befragten erfüllten die Diagnosekriterien einer PTSD!<br />
Damit ist das Risiko einer PTSD bei Feuerwehrmännern 3 Mal so hoch wie<br />
bei Männern (≤ 25 Jahren) der Allgemeinbevölkerung!<br />
Im Durchschnitt litten die Betroffenen bereits seit 6 Jahren an der Störung!<br />
(Risiko-)Faktoren, die die Entstehung einer PTSD begünstigen, waren:<br />
Hohe Einsatzzahlen (Allgemeine Belastung)<br />
Persönliche unmittelbare Betroffenheit<br />
Führungsaufgaben (besonderer Dienstgrad)<br />
Negative Bewertung eines Einsatzes und Selbstvorwürfe<br />
Diese Faktoren klärten jedoch lediglich 40% der Gesamtvarianz auf!<br />
Die größte Ressource ist Unterstützung durch Kameraden<br />
Es besteht der Wunsch nach angemessener Beratung<br />
Ein Problem ist, dass Einsatzkräfte die Symptome einer PTSD selten eingestehen:<br />
Zum einen aus Angst davor, gekündigt zu werden, zum anderen weil solche<br />
Symptome dem Stereotyp des tapferen Feuerwahrmanns widersprechen!<br />
Prävention:<br />
Es lassen sich 2 Arten von Prävention unterscheiden:<br />
1. Primäre Prävention: Vermittlung spezifischen Wissens und spezifischer<br />
Fertigkeiten an Risikogruppen, Stärkung vorhandener Ressourcen und<br />
Etablierung von Hilfsnetzwerken!<br />
Bisher gibt es dazu in Deutschland kaum übergreifende Konzepte<br />
2. Sekundäre Prävention: Psychosoziale Akutversorgung nach belastenden<br />
Einsätzen<br />
Bisher sind die Nachbesprechungen nach Feuerwehreinsätzen in<br />
Deutschland vorwiegend technischer Art!<br />
155
Experimentelle Befunde:<br />
Eine ebenfalls von der LMU durchgeführte Studie zur Wirksamkeit<br />
sekundärer Prävention bei der freiwilligen Feuerwehr zeigte, dass es zwischen<br />
verschiedenen Formen des „Debriefings“ (Nachbesprechung) keine(!)<br />
signifikanten Unterschiede gibt: Verglichen wurden a) eine Kontrollgruppe<br />
ohne Nachsorge („Screening“, b) „Standard Debriefing“, c) eine abgewandelte<br />
Form dieses Debriefings und e) eine unspezifische Nachsorge.<br />
Ergebnis: Die PTSD-Symptomatik war 6 Monate nach dem Einsatz in<br />
allen Gruppen mehr oder weniger gleich (wie gut, dass man so eine Studie<br />
in die Vorlesung mit aufnimmt!)!<br />
13.5.5. Therapie<br />
Die wichtigsten Behandlungsziele sind:<br />
1. Elaboration des Traumagedächtnisses und kontextuelle Einordung der<br />
traumatischen Gedächtnisinhalte, um auf diese Weise die Intrusionen zu<br />
reduzieren!<br />
2. Veränderung der problematischen Interpretationen, die das Gefühl aktueller<br />
Bedrohung hervorrufen!<br />
3. Aufgabe der dysfunktionalen Verhaltensweisen und kognitiven<br />
Verarbeitungsstrategien, mit Hilfe derer die Patienten das Gefühl der<br />
Bedrohung zu kontrollieren bzw. zu vermeiden versuchen!<br />
Die Methode der Wahl sind Expositionsverfahren (in vivo, in sensu oder in virtueller<br />
Realität)<br />
Vorgehensweise: Z.B. mit einem Vergewaltigungsopfer an den Tatort<br />
zurückkehren und den Tathergang rekonstruieren<br />
Wirkweise: Habituation an traumarelevante Reize, Löschung der konditionierten<br />
Furchtreaktion, Aufgabe des Vermeidungsverhaltens, Elaboration und kognitive<br />
Umstrukturierung (Gefahr wird nicht mehr übergeneralisiert, zwischen „damals“<br />
und „heute“ kann besser unterschieden werden,…) etc.<br />
Probleme: Starke Widerstände auf Seiten des Patienten; vorübergehende<br />
Belastungssteigerung; es besteht die Gefahr, den Kontakt zum Hier und Jetzt zu<br />
verlieren; viele traumatische Ereignisse lassen sich nur schwer simulieren (z.B.<br />
Umweltkatastrophen, Krieg etc.) => Lösung: Virtuelle Realität!<br />
Expositionsverfahren in virtuellen Realitäten haben sich bei unterschiedlichen<br />
Traumata als äußerst wirksam erwiesen:<br />
11. September: graduelle Exposition in 11 Stufen (1. Stufe: Tag in New York mit<br />
Blick aufs WTC 11. Stufe: vollständige Simulation des Anschlags)<br />
Ergebnis: Bei 5 von 9 Patienten (von denen 6 mit Hilfe traditioneller<br />
Verfahren nicht geheilt worden waren) konnten die Symptome in 14<br />
Sitzungen so weit reduziert werden, dass sie keine Diagnose mehr erfüllten!<br />
Ähnlich positive Ergebnisse konnten z.B. mit Vietnam-Veteranen (virtuelles<br />
Kriegsszenario) und Verkehrsunfallopfern erreicht werden!<br />
156
13.6. Generalisierte Angststörung<br />
13.6.1. Das Wichtigste in vier Sätzen:<br />
Definition: Die generalisierte Angststörung (auch frei fluktuierende Angst genannt)<br />
ist durch übermäßige Sorgen und Angst gekennzeichnet – und zwar bezogen auf<br />
mehrere, meist alltägliche Situationen (Krankheit, Arbeitsplatz, soziale Beziehungen<br />
etc.)<br />
Weitere Symptome: Ruhelosigkeit, vegetative Übererregtheit, erhöhte<br />
Muskelanspannung, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten etc.<br />
Das Hauptsymptom der generalisierten Angst ist die Sorge; sofern sie von<br />
negativen Emotionen ablenkt wird sie negativ verstärkt!<br />
Epidemiologie:<br />
Die Prävalenz der Störung liegt bei etwa 5%; nur wenige begeben sich aber in<br />
Behandlung!<br />
Das Geschlechterverhältnis liegt bei 2:1 (Frauen sind also doppelt so häufig<br />
betroffen wie Männer)<br />
Ätiologie:<br />
Kognitiv-Lerntheoretischer Ansatz: Generalisierung konditionierter<br />
Angstreaktionen, negative Verstärkung der Sorge; gelernte Hilflosigkeit!<br />
Biologischer Ansatz: Blockierung des GABA-Systems, aufgrund derer die Angst<br />
nicht mehr gehemmt werden kann!<br />
Therapie:<br />
Entspannungstraining<br />
Vermittlung von Kompetenz und Selbstwirksamkeit<br />
Entkatastrophisieren<br />
Anxiolytika (z.B. Benzodiazepine wie Valium)<br />
157
14. Sonstige Störungen<br />
14.1. Psychophysiologische Störungen:<br />
14.1.1. Allgemeines:<br />
Definition: Psychophysiologische Störungen haben im Gegensatz zu somatoformen<br />
Störungen tatsächlich eine physiologische Grundlage, ihre Entstehung und<br />
Verschlimmerung wird jedoch durch psychische Faktoren, insbesondere Stress, stark<br />
beeinflusst.<br />
Beispiele sind: Tinnitus, Asthma, Neurodermitis, Magen-Darm-Geschwüre,<br />
kardiovaskuläre Erkrankungen (Störungen des Herzkreislaufsystems)!<br />
Im DSM-IV und der ICD-10 bilden psychophysiologische Faktoren keine eigene<br />
Kategorie, sondern werden unter physiologischen Krankheiten geführt.<br />
Im DSM-IV gibt es die Möglichkeit, psychophysiologische Störungen auf Achse<br />
III („medizinische Krankheitsfaktoren“) zu kodieren.<br />
Psychophysiologische Störungen werden v.a. durch Stress hervorgerufen bzw.<br />
verschlimmert (s.o.):<br />
Über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse kann Stress auf<br />
lange Sicht zu einer Beeinträchtigung des Immunsystems führen.<br />
Um Stress adäquat zu verarbeiten und die subjektive Belastung möglichst gering<br />
zu halten, bedarf es geeigneter Copingstrategien (kontraproduktiv sind Flucht<br />
und Vermeidung)<br />
14.1.2. Konkrete Beispiele<br />
Kardiovaskuläre Erkrankungen (Störungen des Herz-Kreislauf-Systems):<br />
Bluthochdruck (essentielle Hypertonie): erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen<br />
Herzinfarkt oder Schlaganfall; ein prädisponierender Faktor für die Entwicklung<br />
von Hypertonie scheint Ärger zu sein!<br />
Koronare Herzkrankheiten (Angina Pectoris und Herzinfarkt =><br />
Durchblutungsstörungen): Risikofaktoren sind ein hohes Alter, männliches<br />
Geschlecht, Nikotin- und Alkoholkonsum, hoher Blutdruck (s.o.), erhöhter<br />
Cholesterinspiegel, Fettleibigkeit und Bewegungsarmut sowie ein stark<br />
leistungs- und wettbewerbsorientierter Lebensstil (Typ-A-Verhaltensmuster)<br />
Asthma:<br />
Wird meist durch Allergene oder Infektionen ausgelöst, wird aber auch durch<br />
psychische Faktoren beeinflusst!<br />
Chronische Schmerzen:<br />
Eine rein medizinische Behandlung chronischer Schmerzen reicht nicht aus;<br />
darüber hinaus muss den Patienten beigebracht werden, mit den Schmerzen<br />
besser zu leben (Training kognitiver Bewältigungsstrategien, Vermittlung von<br />
Copingstrategien, Entspannungsübungen, Biofeedback etc.)<br />
Aids: Hier kann die Psychologie präventiv wirksam werden!<br />
158
14.2. Sonstiges<br />
14.2.1.Sexuelle Störungen:<br />
Im DSM-IV und ICD-10 werden 3 Hauptgruppen von sexuellen Störungen<br />
unterschieden:<br />
1. Geschlechtsidentitätsstörung („Transsexualität“):<br />
Personen, die sich i.d.R. von früher Kindheit an dem entgegengesetzten<br />
Geschlecht zugehörig fühlen.<br />
Als Ursachen werden diskutiert: hormonelle Einflüsse und<br />
Sozialisationseinflüsse<br />
Behandlung: Operative Geschlechtsumwandlung und/oder<br />
psychotherapeutische Begleitung<br />
2. Paraphilien:<br />
Liegen vor, wenn sich die Betroffenen für ungewöhnliche („para“=„neben“)<br />
Objekte und/oder Praktiken begeistern („philia“=„Liebe“)<br />
Beispiele: Fetischismus (sexuelle Attraktion unbelebter Objekte),<br />
Transvestismus (Frauenkleider), Exhibitionismus, Pädophilie, Voyeurismus,<br />
sexueller Masochismus, sexueller Sadismus, Nekrophilie etc.<br />
Behandlung: kognitiv-behavioral, medikamentös<br />
3. (Nichtorganische) sexuelle Funktionsstörungen:<br />
Sexuelle Störungen sind Störungen des normalen sexuellen Reaktionszyklus<br />
(Masters & Johnson: Appetenzphase => Erregungsphase => Orgasmusphase<br />
=> Entspannungsphase); sie werden in vier Gruppen unterteilt:<br />
Störungen der sexuellen Appetenz (z.B. Lustlosigkeit)<br />
Störungen der sexuellen Erregung (z.B. Erektionsprobleme)<br />
Orgasmusstörungen (z.B. Ejaculatio Praecox)<br />
Störungen mit sexuell bedingten Schmerzen (z.B. Vaginismus)<br />
14.2.2. Störungen in Kindheit und Jugend<br />
Geistige Behinderung (DSM-IV) / Intelligenzminderung (ICD-10):<br />
Diagnosekriterien:<br />
deutlich unterdurchschnittlicher IQ<br />
IQ zwischen 55 und 70: leichte geistige Behinderung<br />
IQ unter 25: schwerste geistige Behinderung<br />
eingeschränkte Anpassungsfähigkeit<br />
Beginn vor dem 18. Lebensjahr<br />
Ursache meist organischer Art: z.B. Drogenkonsum während der<br />
Schwangerschaft; Hirnhautentzündung; Trisomie 21 (=Down-Syndrom) etc.<br />
Umschriebene Entwicklungsstörungen:<br />
Lernstörungen: Legasthenie und Diskalkulie<br />
Kommunikationsstörungen: was der Name sagt<br />
Störungen der motorischen Fertigkeiten: was der Name sagt<br />
Tiefgreifende Entwicklungsstörungen: ausgeprägte und tiefgreifende<br />
Beeinträchtigung in mehreren Bereichen<br />
Frühkindlicher Autismus:<br />
Manifestiert sich vor dem 3. Lebensjahr<br />
Die Kernsymptome sind:<br />
- Starke Beeinträchtigung der sozialen Interaktion<br />
- Starke Beeinträchtigung der Sprach- und Kommunikationsfähigkeit<br />
159
- Stark eingeschränkte (stereotype und repetitive) Interessen und<br />
Verhaltensweisen (zwanghaftes Festhalten an Ritualen etc.)<br />
Geht meist mit drastischer Intelligenzminderung einher!<br />
Asperger Syndrom:<br />
Manifestiert sich nach dem 3. Lebensjahr<br />
Soziale Interaktion, Kommunikationsfähigkeit und Interessen sind zwar<br />
ebenfalls eingeschränkt, aber: keine gravierende Beeinträchtigung der<br />
Sprachentwicklung und meist normale bis überdurchschnittliche Intelligenz<br />
(Hochbegabung!)<br />
Unterkontrollierte Verhaltensstörungen: Störungen mit unterkontrolliertem<br />
Verhalten<br />
ADHS: siehe oben<br />
Störung des Sozialverhaltens<br />
Störung mit oppositionellem Trotzverhalten<br />
Überkontrollierte Verhaltensstörungen:<br />
Trennungsangst<br />
Phobische, überempfindliche, depressive Störungen<br />
Störungen der Nahrungsaufnahme und der Ausscheidung:<br />
Fütter- und Essstörungen im Säuglings- oder Kleinkindalter<br />
Enuresis (Bettnässen)<br />
Wird u.a. mit Hilfe von Warnsystemen behandelt (klassisch: das<br />
„Klingelkissen“); außerdem: Training der Beckenbodenmuskulatur,<br />
operante Verfahren etc.<br />
Ticstörungen:<br />
Vorübergehende Ticstörungen<br />
Chronische motorische oder vokale Ticstörungen<br />
Kombinierte vokale und multiple motorische Ticstörung (Tourette-Syndrom)<br />
Störungen sozialer Funktionen:<br />
Z.B. selektiver Mutismus<br />
Darüber hinaus können die meisten Störungen, die üblicherweise erst im<br />
Erwachsenenalter auftreten (substanzinduzierte Störungen, Schizophrenie,<br />
Angststörungen etc.), auch schon im Kindesalter einsetzen!<br />
14.2.3. Psychische Störungen im Alter<br />
Unter Demenz versteht man eine progressive Verschlechterung der intellektuellen<br />
Fähigkeiten.<br />
Demenzen können verschiedene Ursachen haben:<br />
Alzheimer (der häufigste Grund): fortschreitende Atrophie der<br />
Großhirnrinde durch Proteinablagerungen (sog. Plaques) in den Zellkörpern<br />
der Neuronen; starke genetische Komponente (Mutation des Chromosoms<br />
21)<br />
Fronto-temporale Demenzen: Atrophie von Neuronen im Frontal- und<br />
Temporallappen<br />
Vaskuläre Demenzen: durch Durchblutungsstörungen im Gehirn<br />
hervorgerufen (Risikofaktoren sind dieselben wie bei kardiovaskulären<br />
Erkrankungen: s.o.)<br />
160
Abgegrenzt werden müssen Demenzen von Depressionen und Delirien: bei<br />
letzteren handelt es sich um plötzliche Bewusstseinstrübungen, die mit massiven<br />
Denk-, Gefühls- und Verhaltensstörungen einhergehen.<br />
Im Ggs. zu Demenzen sind Delirien, wenn ihre Ursache (z.B. Fieber, Mangelernährung,<br />
Substanzmissbrauch) frühzeitig erkannt wird, meist reversibel.<br />
Die Häufigkeit psychischer Störungen ist in der Altersgruppe der über 65-Jährigen<br />
zwar am geringsten; trotzdem leiden ca. 20% unter Depression, Angst oder anderen<br />
Störungen.<br />
Die Suizidrate ist bei den über 65-Jährigen (Männern) um das 3-fache erhöht!<br />
Die häufigsten Gründe sind: körperliche Krankheiten, finanzielle Bedrängnis,<br />
Verlust geliebter Menschen, soziale Isolation und Depression!<br />
The End<br />
161