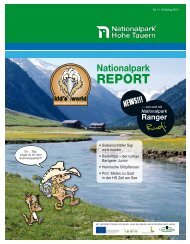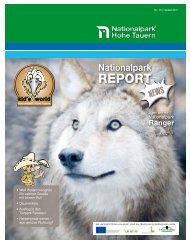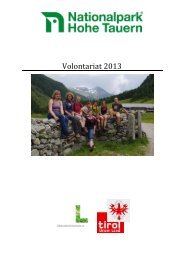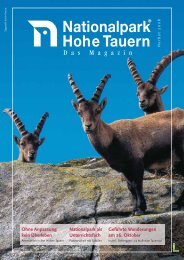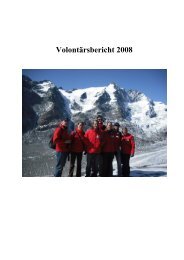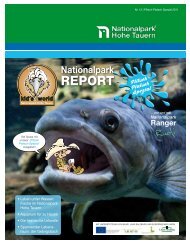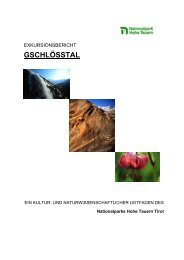Nationalpark Hohe Tauern
Nationalpark Hohe Tauern
Nationalpark Hohe Tauern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Harald Stadler<br />
Zur Siedlungsgeschichte der <strong>Hohe</strong>n <strong>Tauern</strong> vom ersten Auftreten des Menschen bis<br />
zum Beginn der Neuzeit<br />
___________________________________________________________________<br />
17<br />
und ein Bronzemesser; Lienz-Schloßberg/Geierbichl; Obermauern/Burg; Burghügel von<br />
Heinfels; Lavanter Kirchbichl; Dazu kommen verschiedene Streufunde aus Bronze:<br />
Tüllenbeil von Nikolsdorf, Lanzenspitze mit geschweiftem Blatt aus Lienz, schlanke<br />
mittel- und endständige Lappenbeile aus Matrei in Osttirol und einige Nadeln mit<br />
geschwollenem, verziertem Hals aus Virgen. Besonders zu erwähnen sind noch eine<br />
steinerne Mehrfachgußform für Sicheln und Beile aus Mitteldorf bei Virgen und ein in<br />
Assling im vorigen Jahrhundert im Gamsbach gefundenes bronzenes Dreiwulstschwert,<br />
das leider im Bozner Kunsthandel verschwunden ist. Grabfunde stehen für diese<br />
Periode noch aus.<br />
Im Salzburger Anteil erweist sich hingegen der Fundacker als weit besser bestellt. Vier<br />
Urnengräber von Gries und fünf ebensolche westlich von St. Georgen stellen dies<br />
augenfällig unter Beweis. Charakteristisch sind die enge Nachbarschaft der Gräber und<br />
das Unbrauchbarmachen der Bronzebeigaben durch absichtliches Zerbrechen. Für<br />
Bruck an der Glocknerstraße sind vier frühhallstattzeitliche Brandgräber mit<br />
Steinsetzungen und für Markt Taxenbach ein zeitgleiches Einzelgrab überliefert.<br />
Auch der Anteil an Einzelfunden ist hier besonders hoch. Mittel- bis endständige<br />
Lappenbeile wurden etwa am Ausgang des Sulzbachtales bei Neukirchen entdeckt.<br />
Für den Kärntner Anteil sind bis auf eine Bronzenadel aus Sagritz keine Funde aus<br />
dieser Periode überliefert.<br />
12. Alpines Wanderhirtentum<br />
Eine wesentliche Rolle im alpinen Gebiet spielt seit der Domestikation des Schafes<br />
und der Ziege im 8. Jahrtausend v. Chr. das Wanderhirtentum. Über diese<br />
Wanderungen findet der Transfer einer Reihe von Objekten, die gelegentlich bis<br />
weit über tausend Kilometer vom Herstellungsgebiet entfernt gefunden werden,<br />
eine mögliche Erklärung. Als besonders markantes Beispiel sei ein aus dem 13. Jh.<br />
v. Chr. stammender Bronzedolch von einem Almgebiet bei Kirchdorf (Abb. 12)<br />
____________________________________________________<br />
<strong>Nationalpark</strong> <strong>Hohe</strong> <strong>Tauern</strong>