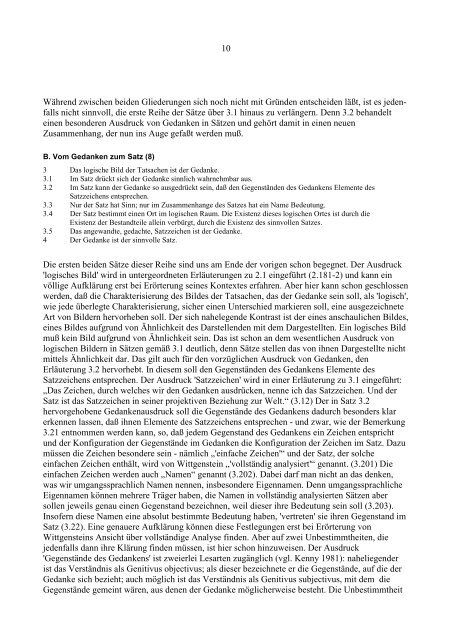10Während zwischen beiden Gliederungen sich noch nicht mit Gründen entscheiden läßt, ist es jedenfallsnicht sinnvoll, die erste Reihe der Sätze über 3.1 hinaus zu verlängern. Denn 3.2 behandelteinen besonderen Ausdruck von Gedanken in Sätzen und gehört damit in einen neuenZusammenhang, der nun ins Auge gefaßt werden muß.B. Vom Gedanken zum Satz (8)3 Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke.3.1 Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus.3.2 Im Satz kann der Gedanke so ausgedrückt sein, daß den Gegenständen des Gedankens Elemente desSatzzeichens entsprechen.3.3 Nur der Satz hat Sinn; nur im Zusammenhange des Satzes hat ein Name Bedeutung.3.4 Der Satz bestimmt einen Ort im logischen Raum. Die Existenz dieses logischen Ortes ist durch dieExistenz der Bestandteile allein verbürgt, durch die Existenz des sinnvollen Satzes.3.5 Das angewandte, gedachte, Satzzeichen ist der Gedanke.4 Der Gedanke ist der sinnvolle Satz.Die ersten beiden Sätze dieser Reihe sind uns am Ende der vorigen schon begegnet. Der Ausdruck'logisches Bild' wird in untergeordneten Erläuterungen zu 2.1 eingeführt (2.181-2) und kann einvöllige Aufklärung erst bei Erörterung seines Kontextes erfahren. Aber hier kann schon geschlossenwerden, daß die Charakterisierung des Bildes der Tatsachen, das der Gedanke sein soll, als 'logisch',wie jede überlegte Charakterisierung, sicher einen Unterschied markieren soll, eine ausgezeichneteArt von Bildern hervorheben soll. Der sich nahelegende Kontrast ist der eines anschaulichen Bildes,eines Bildes aufgrund von Ähnlichkeit des Darstellenden mit dem Dargestellten. <strong>Ein</strong> logisches Bildmuß kein Bild aufgrund von Ähnlichkeit sein. Das ist schon an dem wesentlichen Ausdruck vonlogischen Bildern in Sätzen gemäß 3.1 deutlich, denn Sätze stellen das von ihnen Dargestellte nichtmittels Ähnlichkeit dar. Das gilt auch für den vorzüglichen Ausdruck von Gedanken, denErläuterung 3.2 hervorhebt. In diesem soll den Gegenständen des Gedankens Elemente desSatzzeichens entsprechen. Der Ausdruck 'Satzzeichen' wird in einer Erläuterung zu 3.1 eingeführt:„Das Zeichen, durch welches wir den Gedanken ausdrücken, nenne ich das Satzzeichen. Und derSatz ist das Satzzeichen in seiner projektiven Beziehung zur Welt.“ (3.12) Der in Satz 3.2hervorgehobene Gedankenausdruck soll die Gegenstände des Gedankens dadurch besonders klarerkennen lassen, daß ihnen Elemente des Satzzeichens entsprechen - und zwar, wie der Bemerkung3.21 entnommen werden kann, so, daß jedem Gegenstand des Gedankens ein Zeichen entsprichtund der Konfiguration der Gegenstände im Gedanken die Konfiguration der Zeichen im Satz. Dazumüssen die Zeichen besondere sein - nämlich „'einfache Zeichen'“ und der Satz, der solcheeinfachen Zeichen enthält, wird von <strong>Wittgenstein</strong> „'vollständig analysiert'“ genannt. (3.201) Dieeinfachen Zeichen werden auch „Namen“ genannt (3.202). Dabei darf man nicht an das denken,was wir umgangssprachlich Namen nennen, insbesondere Eigennamen. Denn umgangssprachlicheEigennamen können mehrere Träger haben, die Namen in vollständig analysierten Sätzen abersollen jeweils genau einen Gegenstand bezeichnen, weil dieser ihre Bedeutung sein soll (3.203).Insofern diese Namen eine absolut bestimmte Bedeutung haben, 'vertreten' sie ihren Gegenstand imSatz (3.22). <strong>Ein</strong>e genauere Aufklärung können diese Festlegungen erst bei Erörterung von<strong>Wittgenstein</strong>s Ansicht über vollständige Analyse finden. Aber auf zwei Unbestimmtheiten, diejedenfalls dann ihre Klärung finden müssen, ist hier schon hinzuweisen. Der Ausdruck'Gegenstände des Gedankens' ist zweierlei Lesarten zugänglich (vgl. Kenny 1981): naheliegenderist das Verständnis als Genitivus objectivus; als dieser bezeichnete er die Gegenstände, auf die derGedanke sich bezieht; auch möglich ist das Verständnis als Genitivus subjectivus, mit dem dieGegenstände gemeint wären, aus denen der Gedanke möglicherweise besteht. Die Unbestimmtheit
11kann natürlich auch beabsichtigt sein, dann wäre beides zugleich gemeint.Die zweite Unbestimmtheit ist folgende: Ausweislich seiner Formulierung mit dem Modalwort'kann' erwähnt die Erläuterung 3.2 eine bloße Möglichkeit der Formulierung oder des Ausdruckseines Gedankens. Wenn aber die Formulierung 'Gegenstände des Gedankens' jedenfalls auch imSinne eines Genitivus objectivus zu verstehen wäre, dann implizierte sie, daß Gedanken es immerschon mit Gegenständen zu tun hätten, ob sich das nun im Satzzeichen, das zum Ausdruck desGedankens verwendet wird, zeigte oder nicht. Über 'Gegenstände' handelt die LPA in Erläuterungenzu Satz 2, insbesondere in 2.01ff. Und 2.02-2.032. Dabei zeigt sich, daß unter Gegenständen imUnterschied zu Dingen und Sachen die Endpunkte einer vollständigen Analyse verstanden werdensollen. Wenn die zuletzt erwähnte Unbestimmtheit im Sinne der genannten Möglichkeit affirmativaufgelöst werden kann, hieße das, daß das Denken von Gedanken immer schon analytisch wäre, esimmer schon mit den Endpunkten einer Analyse von Sätzen zu tun hätte. <strong>Wittgenstein</strong> verträte danneine Hypothese, die in zeitgenössischer Philosophie und Cognitive Science als die Annahme einerSprache des Denkens (language of thought) bekannt ist. Das muß zunächst bis zu Abschnitt III(S.26 ff.) dahingestellt bleiben. (vgl. VI.C, 42 ff.) Satz 3.3 legt fest, daß nur Sätze Sinn haben undNamen nur im Zusammenhang von Sätzen Bedeutung. Man muß sich hier an die Erklärung vonSatz aus 3.12 erinnern, der zufolge Sätze Satzzeichen in ihrer projektiven, darstellenden Beziehungzur Welt sind. Nicht die Satzzeichen für sich, noch viel weniger aus dem Zusammenhang derSatzzeichen isolierte Zeichen haben Sinn, sondern nur Sätze - also zum Ausdruck eines Gedankensverwendete Satzzeichen. Auch wenn sich Gedanken eo ipso auf Gegenstände bezögen, wie bzgl.3.2 nahegelegt worden ist, hätte das noch nicht Sinn, sondern erst, was über den Zusammenhang derGegenstände im Satz als Gedanke ausgedrückt wäre. Ob an dieser Stelle unter Namen die in derLPA technisch so genannten Bestandteile in vollständig analysierten Sätzen allein zu verstehensind, oder auch die Ausdrücke, die wir umgangssprachlich Namen nennen, ist nicht klar. Immerhinkann darauf hingewiesen werden, daß umgangssprachlich isoliert verwendete Namen durchauseinen Sinn, eine Funktion haben: sie können z.B. zur Anrede von Personen, zur Bezeichnung vonÖrtern ('Mainz') und Zeiten ('das Rokoko') etc. verwendet werden. Aber auch hier gilt, daß dieisolierte Verwendung eines Namens in der Regel unverständlich wäre, wenn der Sprecher nachseiner Äußerung des Namens nicht irgendwie fortsetzte. Auch diese Unbestimmtheit könnte alsointendiert sein. Das wird auch dadurch wahrscheinlich gemacht, daß <strong>Wittgenstein</strong> das Prinzip desSatzzusammenhangs als der kleinsten <strong>Ein</strong>heit von Sinn in 3.314 für Ausdrücke reformuliert undunter Ausdrücken alle Bestandteile von Sätzen verstanden wissen will, die den Sinn der Sätzecharakterisieren ((3.31 (1)).3.3 formuliert mit dem Prinzip des Satzzusammenhangs als kleinster selbständiger Sinneinheit denwichtigsten bedeutungstheoretischen Grundsatz der LPA für kleinere <strong>Ein</strong>heiten als Sätze (für Wörter):sie haben Sinn nur in einem möglichen Satzzusammenhang, nicht für sich. Daß wir bei Sätzenin erster Linie an Aussagesätze denken müssen, ist einem auf Sätze selber bezogenenbedeutungstheoretischen Prinzip zu entnehmen, das schon in der allgemeinen, noch nicht auf Sätzeeingeschränkten Bildtheorie formuliert wurde: „2.21 Das Bild stimmt mit der Wirklichkeit übereinoder nicht; es ist richtig oder unrichtig, wahr oder falsch.“ Diese Wesensbestimmung von Bildernhat <strong>Wittgenstein</strong> im Blick auf die Sätze auch Bipolarität genannt, so daß das bedeutungstheoretischePrinzip für Sätze das Bipolaritätsprinzip genannt werden kann. Es geht dembedeutungstheoretischen Prinzip für die Elemente von Sätzen, dem Satzzusammenhangsprinzip,noch voraus. Dieser bedeutungstheoretische Grundsatz ist das semantische Pendant zu derontologischen Festsetzung, daß die Welt aus Tatsachen, nicht aus Dingen besteht. Denn eineTatsache (daß das-und-das der Fall ist mit Dingen) macht einen Aussagesatz wahr, nicht die Dinge
- Seite 1 und 2: 1E.M. LangeWITTGENSTEINS ABHANDLUNG
- Seite 3 und 4: 3XIII. Folgerung (51) 56XIV. Wahrsc
- Seite 5 und 6: 5chung von Wittgensteins Buch abgel
- Seite 7 und 8: 7Hier soll also zunächst der inten
- Seite 9: 9Bestehen von Sachverhalten erklär
- Seite 13: 13vernünftiger anzunehmen, daß du
- Seite 18 und 19: 18E. Vom Satz als Wahrheitsfunktion
- Seite 20 und 21: 20Subjekt (5.633) oder das 'Ich' in
- Seite 22 und 23: 22III. Das Argument für das philos
- Seite 24 und 25: 24Auf eine Konzeption von 'Form des
- Seite 26 und 27: 26muß unsere Darstellung der Wirkl
- Seite 28 und 29: 28der die vagen Sätze der Umgangss
- Seite 30 und 31: 30„Jetzt wird klar, warum ich dac
- Seite 32 und 33: 32IV. OntologieA. Welt und Tatsache
- Seite 34 und 35: 34der logisch problematische Status
- Seite 36 und 37: 36So wie Gegenstände eine Form hab
- Seite 38 und 39: 38transzendentalphilosophische Weis
- Seite 40 und 41: 40C. Die Form der Abbildung als Mö
- Seite 42 und 43: 42Projektion der möglichen Sachlag
- Seite 44 und 45: 44deutlich.C. Vollständig analysie
- Seite 46 und 47: 46sondern müssen im Zweifel gegebe
- Seite 48 und 49: 483.5 Das angewandte, gedachte, Sat
- Seite 50 und 51: 50Sätze wahr oder falsch sein kön
- Seite 52 und 53: 52daher jedenfalls sicher nicht all
- Seite 54 und 55: 54X. Elementarsatz und eigentliche
- Seite 56 und 57: 56F W FW F FF F F4.4 Der Satz ist d
- Seite 58 und 59: 58in ihrer gemeinsamen und daher al
- Seite 60 und 61:
60Weltbeschreibung durch die Gesamt
- Seite 62 und 63:
625.41 begründet einerseits 5.4 -
- Seite 64 und 65:
64(d.h. über Aufreihungen der Elem
- Seite 66 und 67:
66Mit dieser Satzsequenz wird die i
- Seite 68 und 69:
686.12 Daß die Sätze der Logik Ta
- Seite 70 und 71:
70sollte das diesen Vorgang charakt
- Seite 72 und 73:
72wenn sie unser nichtausdrückbare
- Seite 74 und 75:
74Stellungnahme verstanden werden (
- Seite 76 und 77:
765.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5Dies ist
- Seite 78 und 79:
78VERZEICHNIS DER REIHEN (Abschnitt
- Seite 80 und 81:
80( 66) 2.05, 2.06, 2.061, 2.062, 2
- Seite 82 und 83:
82(132) 6.24, 6.241, 6.3, 6.31, 6.3
- Seite 84 und 85:
84Bogen 1972 - J., Wittgenstein's P
- Seite 86:
86hermeneutisch naiven, rationalist