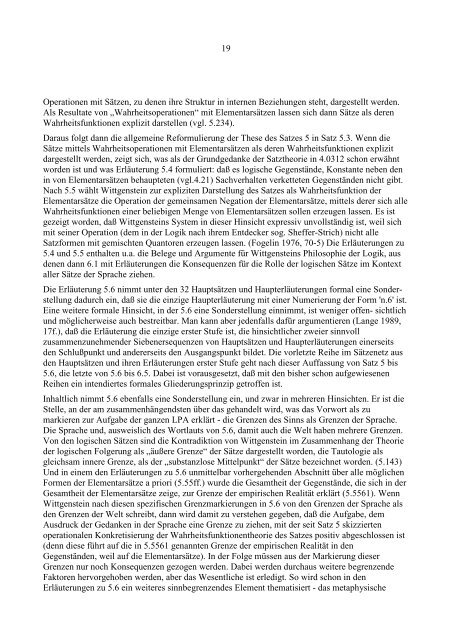18E. Vom Satz als Wahrheitsfunktion zu den Grenzen der Sprache (20)5 Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze.(Der Elementarsatz ist eineWahrheitsfunktion seiner selbst.)5.1 Die Wahrheitsfunktionen lassen sich in Reihen ordnen.Das ist die Grundlage der Wahrscheinlichkeitslehre.5.2 Die Strukturen der Sätze stehen in internen Beziehungen zueinander.5.3 Alle Sätze sind Resultate von Wahrheitsoperationen mit den Elementarsätzen. ... Jeder Satz ist dasResultat von Wahrheitsoperationen mit Elementarsätzen.5.4 Hier zeigt es sich, daß es 'logische Gegenstände', 'logische Konstante' (im Sinne Freges und Russells)nicht gibt.5.5 Jede Wahrheitsfunktion ist ein Resultat der successiven Anwendung der Operation (-----W)( ξ ,....)auf Elementarsätze ...,...ich nenne sie die Negation dieser Sätze.5.6 Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.Satz 5 ist im Verhältnis zu den Erläuterungen unter Satz 4 wie zuvor Satz 4 im Verhältnis zu denErläuterungen unter Satz 3 einerseits ein Fazit des bis dahin Dargestellten, andererseitsAusgangspunkt der anschließenden operationalen Konkretisierung seiner These. Daß der Satz eineWahrheitsfunktion der Elementarsätze ist, soll in einer logisch inspirierten Philosophie, die derenProbleme auf logische Weise behandelt (das ist sicher eine der intendierten Deutungen des Titelsder LPA), nicht nur behauptet, sondern auch in den Grundzügen bzw. skizzenhaft demonstriertwerden. Die Grundlage dafür legen die Hinweise in der ersten Erläuterung 5.1. Der These, daß derSatz eine Funktion der Elementarsätze ist, wird zunächst formale Allgemeinheit gegeben durch denHinweis, der von der These selbst nicht erfaßte, weil vorausgesetzte Elementarsatz ließe sich selberals Funktion von Elementarsätzen darstellen und sei insofern Wahrheitsfunktion seiner selbst. <strong>Ein</strong>eWeise dieser Darstellung ist die der Bildung von Satzzeichen mittels Wahrheitstafelkolumnen, diein Satz 4.442 eingeführt wurde und für die Elementarsätze p und q in der zehnten und elften Zeiledes Schemas in Erläuterung 5.101 aufgenommen wird. Dieses Schema im ganzen ist auch dieErläuterung des ersten Satzes in Bemerkung 5.1. (5.101)Bzgl. 5.1 ist erläuterungsbedürftig, warum im zweiten Satz ein Schema der Art wie in 5.101 auchals Grundlage der Wahrscheinlichkeitslehre angesprochen wird. Wahrscheinlichkeitssätze könntenin zweierlei Hinsicht als eine Schwierigkeit für die Satztheorie der LPA angesehen werden. Erstensscheinen sie ein Gegenbeispiel gegen die aus dem Bipolaritätsprinzip folgende Bivalenz der Sätzezu sein, insofern Sätze eben nicht nur entweder wahr oder falsch, sondern eben auch mehr oderweniger wahrscheinlich sein und von daher eine dritte generische Möglichkeit neben Wahrheit undFalschheit für Sätze zu bestehen scheint. Indem die logische Theorie der Wahrscheinlichkeit, die<strong>Wittgenstein</strong> in Erläuterungen zu 5.15 skizziert, Wahrscheinlichkeit als ein Verhältnis zwischenverschiedenen Sätzen, nicht als mögliche interne Eigenschaft eines Satzes für sich, erklärt, wird diescheinbar bestehende dritte Möglichkeit neben Wahrheit und Falschheit als scheinhaft ausgeräumt.Spezifischer wendet sich die logische Theorie der Wahrscheinlichkeit dann dagegen,Wahrscheinlichkeit als eine Verknüpfung der Sachverhalte selber, als eine selber gegenständlicheVerknüpfung der Verkettungen von Gegenständen, die Sachverhalte sein sollen, mißzuverstehen(vgl. 5.1511).Der Ausdruck 'Struktur eines Satzes', der beiläufig schon in 4.1211 auftrat, wird von <strong>Wittgenstein</strong>im Zusammenhang der Theorie logischer Folgerung eingeführt, die in 5.11 bis 5.14 mitErläuterungen der Theorie der Wahrscheinlichkeit vorhergehend behandelt wird. In 5.2 wird dieallgemeine Grundlage der Möglichkeit logischen Folgerns hervorgehoben: „Die Strukturen derSätze stehen in internen Beziehungen zu einander.“ Und in Erläuterungen zu 5.2 wird skizziert, wiediese internen Beziehungen hervorgehoben werden können, indem die Sätze als Resultate von
19Operationen mit Sätzen, zu denen ihre Struktur in internen Beziehungen steht, dargestellt werden.Als Resultate von „Wahrheitsoperationen“ mit Elementarsätzen lassen sich dann Sätze als derenWahrheitsfunktionen explizit darstellen (vgl. 5.234).Daraus folgt dann die allgemeine Reformulierung der These des Satzes 5 in Satz 5.3. Wenn dieSätze mittels Wahrheitsoperationen mit Elementarsätzen als deren Wahrheitsfunktionen explizitdargestellt werden, zeigt sich, was als der Grundgedanke der Satztheorie in 4.0312 schon erwähntworden ist und was Erläuterung 5.4 formuliert: daß es logische Gegenstände, Konstante neben denin von Elementarsätzen behaupteten (vgl.4.21) Sachverhalten verketteten Gegenständen nicht gibt.Nach 5.5 wählt <strong>Wittgenstein</strong> zur expliziten Darstellung des Satzes als Wahrheitsfunktion derElementarsätze die Operation der gemeinsamen Negation der Elementarsätze, mittels derer sich alleWahrheitsfunktionen einer beliebigen Menge von Elementarsätzen sollen erzeugen lassen. Es istgezeigt worden, daß <strong>Wittgenstein</strong>s System in dieser Hinsicht expressiv unvollständig ist, weil sichmit seiner Operation (dem in der Logik nach ihrem Entdecker sog. Sheffer-Strich) nicht alleSatzformen mit gemischten Quantoren erzeugen lassen. (Fogelin 1976, 70-5) Die Erläuterungen zu5.4 und 5.5 enthalten u.a. die Belege und Argumente für <strong>Wittgenstein</strong>s Philosophie der Logik, ausdenen dann 6.1 mit Erläuterungen die Konsequenzen für die Rolle der logischen Sätze im Kontextaller Sätze der Sprache ziehen.Die Erläuterung 5.6 nimmt unter den 32 Hauptsätzen und Haupterläuterungen formal eine Sonderstellungdadurch ein, daß sie die einzige Haupterläuterung mit einer Numerierung der Form 'n.6' ist.<strong>Ein</strong>e weitere formale Hinsicht, in der 5.6 eine Sonderstellung einnimmt, ist weniger offen- sichtlichund möglicherweise auch bestreitbar. Man kann aber jedenfalls dafür argumentieren (Lange 1989,17f.), daß die Erläuterung die einzige erster Stufe ist, die hinsichtlicher zweier sinnvollzusammenzunehmender Siebenersequenzen von Hauptsätzen und Haupterläuterungen einerseitsden Schlußpunkt und andererseits den Ausgangspunkt bildet. Die vorletzte Reihe im Sätzenetz ausden Hauptsätzen und ihren Erläuterungen erster Stufe geht nach dieser Auffassung von Satz 5 bis5.6, die letzte von 5.6 bis 6.5. Dabei ist vorausgesetzt, daß mit den bisher schon aufgewiesenenReihen ein intendiertes formales Gliederungsprinzip getroffen ist.Inhaltlich nimmt 5.6 ebenfalls eine Sonderstellung ein, und zwar in mehreren Hinsichten. Er ist dieStelle, an der am zusammenhängendsten über das gehandelt wird, was das Vorwort als zumarkieren zur Aufgabe der ganzen LPA erklärt - die Grenzen des Sinns als Grenzen der Sprache.Die Sprache und, ausweislich des Wortlauts von 5.6, damit auch die Welt haben mehrere Grenzen.Von den logischen Sätzen sind die Kontradiktion von <strong>Wittgenstein</strong> im Zusammenhang der Theorieder logischen Folgerung als „äußere Grenze“ der Sätze dargestellt worden, die Tautologie alsgleichsam innere Grenze, als der „substanzlose Mittelpunkt“ der Sätze bezeichnet worden. (5.143)Und in einem den Erläuterungen zu 5.6 unmittelbar vorhergehenden Abschnitt über alle möglichenFormen der Elementarsätze a priori (5.55ff.) wurde die Gesamtheit der Gegenstände, die sich in derGesamtheit der Elementarsätze zeige, zur Grenze der empirischen Realität erklärt (5.5561). Wenn<strong>Wittgenstein</strong> nach diesen spezifischen Grenzmarkierungen in 5.6 von den Grenzen der Sprache alsden Grenzen der Welt schreibt, dann wird damit zu verstehen gegeben, daß die Aufgabe, demAusdruck der Gedanken in der Sprache eine Grenze zu ziehen, mit der seit Satz 5 skizziertenoperationalen Konkretisierung der Wahrheitsfunktionentheorie des Satzes positiv abgeschlossen ist(denn diese führt auf die in 5.5561 genannten Grenze der empirischen Realität in denGegenständen, weil auf die Elementarsätze). In der Folge müssen aus der Markierung dieserGrenzen nur noch Konsequenzen gezogen werden. Dabei werden durchaus weitere begrenzendeFaktoren hervorgehoben werden, aber das Wesentliche ist erledigt. So wird schon in denErläuterungen zu 5.6 ein weiteres sinnbegrenzendes Element thematisiert - das metaphysische
- Seite 1 und 2: 1E.M. LangeWITTGENSTEINS ABHANDLUNG
- Seite 3 und 4: 3XIII. Folgerung (51) 56XIV. Wahrsc
- Seite 5 und 6: 5chung von Wittgensteins Buch abgel
- Seite 7 und 8: 7Hier soll also zunächst der inten
- Seite 9 und 10: 9Bestehen von Sachverhalten erklär
- Seite 11 und 12: 11kann natürlich auch beabsichtigt
- Seite 13: 13vernünftiger anzunehmen, daß du
- Seite 20 und 21: 20Subjekt (5.633) oder das 'Ich' in
- Seite 22 und 23: 22III. Das Argument für das philos
- Seite 24 und 25: 24Auf eine Konzeption von 'Form des
- Seite 26 und 27: 26muß unsere Darstellung der Wirkl
- Seite 28 und 29: 28der die vagen Sätze der Umgangss
- Seite 30 und 31: 30„Jetzt wird klar, warum ich dac
- Seite 32 und 33: 32IV. OntologieA. Welt und Tatsache
- Seite 34 und 35: 34der logisch problematische Status
- Seite 36 und 37: 36So wie Gegenstände eine Form hab
- Seite 38 und 39: 38transzendentalphilosophische Weis
- Seite 40 und 41: 40C. Die Form der Abbildung als Mö
- Seite 42 und 43: 42Projektion der möglichen Sachlag
- Seite 44 und 45: 44deutlich.C. Vollständig analysie
- Seite 46 und 47: 46sondern müssen im Zweifel gegebe
- Seite 48 und 49: 483.5 Das angewandte, gedachte, Sat
- Seite 50 und 51: 50Sätze wahr oder falsch sein kön
- Seite 52 und 53: 52daher jedenfalls sicher nicht all
- Seite 54 und 55: 54X. Elementarsatz und eigentliche
- Seite 56 und 57: 56F W FW F FF F F4.4 Der Satz ist d
- Seite 58 und 59: 58in ihrer gemeinsamen und daher al
- Seite 60 und 61: 60Weltbeschreibung durch die Gesamt
- Seite 62 und 63: 625.41 begründet einerseits 5.4 -
- Seite 64 und 65: 64(d.h. über Aufreihungen der Elem
- Seite 66 und 67: 66Mit dieser Satzsequenz wird die i
- Seite 68 und 69:
686.12 Daß die Sätze der Logik Ta
- Seite 70 und 71:
70sollte das diesen Vorgang charakt
- Seite 72 und 73:
72wenn sie unser nichtausdrückbare
- Seite 74 und 75:
74Stellungnahme verstanden werden (
- Seite 76 und 77:
765.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5Dies ist
- Seite 78 und 79:
78VERZEICHNIS DER REIHEN (Abschnitt
- Seite 80 und 81:
80( 66) 2.05, 2.06, 2.061, 2.062, 2
- Seite 82 und 83:
82(132) 6.24, 6.241, 6.3, 6.31, 6.3
- Seite 84 und 85:
84Bogen 1972 - J., Wittgenstein's P
- Seite 86:
86hermeneutisch naiven, rationalist