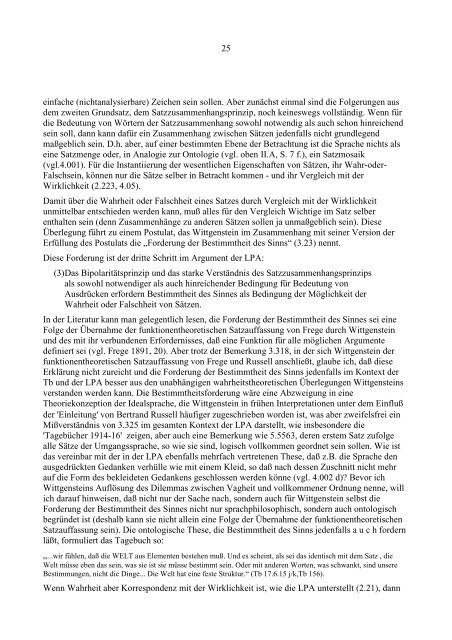24Auf eine Konzeption von 'Form des Satzes' aber ist die Formulierung des Bipolaritätsprinzips in derLPA aufgebaut.Die erste These oder der erste Grundsatz, das Bipolaritätsprinzip, formuliert ein Kriterium für dieVerwendung des Ausdrucks 'Satz': nur das ist ein Satz, was sowohl wahr als auch falsch sein kann.Die zweite These bezieht sich nicht mehr auf Sätze als ganze, sondern auf deren konstitutiveElemente und formuliert ein Kriterium für ihren Sinn. Es handelt sich um das propositionale oderSatzzusammenhangsprinzip (vgl. Carruthers 1990, Kap.2; Kienzle 1983, Kap. 1 bis 3), das in seinerallgemeinen Formulierung in LPA lautet:(2) “Der Ausdruck hat nur im Satz Bedeutung.“(3.314)Zunächst ist erklärungsbedürftig, wieso dies die allgemeinere Formulierung gegenüber dem übergeordnetenSatz 3.3 „Nur der Satz hat Sinn; nur im Zusammenhange eines Satzes hat ein NameBedeutung.“ sein soll. Dafür gibt es zwei Gründe: das Zusammenhangsprinzip ist in derFormulierung 3.3 nur Teilsatz, und der Ausdruck 'Ausdruck' ist allgemeiner als der Ausdruck'Name', der nicht nur, aber ganz überwiegend die Bestandteile von Elementarsätzen bezeichnet. (Fürdie anderen Verwendungen muß übrigens der genaue Wortlaut von 4.23 stets beachtet werden. Vgl.unten IV.B., S.32) <strong>Wittgenstein</strong> hat das Satzzusammenhangsprinzip von Frege übernommen, esaber sehr viel strikter verstanden. Während Frege mit seinen Formulierungen vor allem abweisenwollte, daß nach der Bedeutung von Wörtern unabhängig von ihren möglichen Satzkontextengefragt wird (Frege 1884, XXII), versteht <strong>Wittgenstein</strong> den Grundsatz so, daß das Auftretenkönnenin Sätzen für die Bedeutung von Ausdrücken nicht nur notwendig, sondern auch schon hinreichendist. Das ist zunächst für Elementarsätze offensichtlich eine Implikation der für sie stipuliertenlogischen Unabhängigkeit voneinander (4.211; vgl.1.21, 2.061). Für Sätze im allgemeinen gilt esaber nicht nur indirekt über den Zusammenhang der Sinnfunktionalität zwischen ihnen undElementarsätzen (vgl.4.2 in Verb. m. 5.2341), sondern ist ein Korollar der Formulierung einesSatzzusammenhangsprinzips mit theoretischem Anspruch, dessen Erklärung zugleich zu einerVerständigung über den Sinn des Vordersatzes von 3.3 führen kann. Wenn nämlich einSatzzusammenhangsprinzip mit allgemeinem Geltungsanspruch formuliert wird, dann wirdoffenbar unterstellt, Sätze seien notwendigerweise strukturierte, zusammengesetzte Zeichen. (vgl.Tb 144, 28.5.1915) Dieses Korollar ist Grundlage von <strong>Wittgenstein</strong>s Kritik an FregesVerdinglichung von Wahrheit und Falschheit zu den durchgängigen Bedeutungen allerSatzfunktionen als 'das Wahre' und 'das Falsche', die ihm zufolge unvermeidlich ein Mißverständnisvon Sätzen als (komplexen) Namen involviert (3.143 c, 4.063 c, 4.431 c, 5.02 c), und seinereigenen, daraus gefolgerten These: „Nur Tatsachen können einen Sinn ausdrücken, eine Klasse vonNamen kann es nicht.“(3.142) Daß 'nur der Satz Sinn hat' (3.3), heißt neben der offensichtlichenHervorhebung von Sätzen als den kleinsten Sinneinheiten der Sprache, mit denen sich etwas sagenläßt, a u c h, daß Sätze Tatsachen und als solche notwendigerweise „zusammengesetzte Zeichen“(Tb 144) sind.In dieser Folgerung aus der Frege-Kritik steckt freilich die zusätzliche Annahme, daß Sätze nichtnur zusammengesetzte Zeichen sein müssen, sondern solche Komplexe, die Elemente mitverschiedenartigen Funktionen enthalten. An diesem Punkt wird eine Verbindung dersprachtheoretischen Grundsätze 1 und 2, Bipolaritäts- und Zusammenhangsprinzip, mit demKonzept eines ontologischen Fundaments der Sprache in den Formen der Gegenstände absehbar.Diese Formen der Gegenstände müssen am Fundament der Sprache, den Elementarsätzen, für dieVerschiedenartigkeit der Funktionen der Satzbestandteile aufkommen müssen, insofern die Syntaxdas nicht kann, weil die Bestandteile von Elementarsätzen syntaktisch sämtlich Namen, d.h.
25einfache (nichtanalysierbare) Zeichen sein sollen. Aber zunächst einmal sind die Folgerungen ausdem zweiten Grundsatz, dem Satzzusammenhangsprinzip, noch keineswegs vollständig. Wenn fürdie Bedeutung von Wörtern der Satzzusammenhang sowohl notwendig als auch schon hinreichendsein soll, dann kann dafür ein Zusammenhang zwischen Sätzen jedenfalls nicht grundlegendmaßgeblich sein. D.h. aber, auf einer bestimmten Ebene der Betrachtung ist die Sprache nichts alseine Satzmenge oder, in Analogie zur Ontologie (vgl. oben II.A, S. 7 f.), ein Satzmosaik(vgl.4.001). Für die Instantiierung der wesentlichen Eigenschaften von Sätzen, ihr Wahr-oder-Falschsein, können nur die Sätze selber in Betracht kommen - und ihr Vergleich mit derWirklichkeit (2.223, 4.05).Damit über die Wahrheit oder Falschheit eines Satzes durch Vergleich mit der Wirklichkeitunmittelbar entschieden werden kann, muß alles für den Vergleich Wichtige im Satz selberenthalten sein (denn Zusammenhänge zu anderen Sätzen sollen ja unmaßgeblich sein). DieseÜberlegung führt zu einem Postulat, das <strong>Wittgenstein</strong> im Zusammenhang mit seiner Version derErfüllung des Postulats die „Forderung der Bestimmtheit des Sinns“ (3.23) nennt.Diese Forderung ist der dritte Schritt im Argument der LPA:(3) Das Bipolaritätsprinzip und das starke Verständnis des Satzzusammenhangsprinzipsals sowohl notwendiger als auch hinreichender Bedingung für Bedeutung vonAusdrücken erfordern Bestimmtheit des Sinnes als Bedingung der Möglichkeit derWahrheit oder Falschheit von Sätzen.In der Literatur kann man gelegentlich lesen, die Forderung der Bestimmtheit des Sinnes sei eineFolge der Übernahme der funktionentheoretischen Satzauffassung von Frege durch <strong>Wittgenstein</strong>und des mit ihr verbundenen Erfordernisses, daß eine Funktion für alle möglichen Argumentedefiniert sei (vgl. Frege 1891, 20). Aber trotz der Bemerkung 3.318, in der sich <strong>Wittgenstein</strong> derfunktionentheoretischen Satzauffassung von Frege und Russell anschließt, glaube ich, daß dieseErklärung nicht zureicht und die Forderung der Bestimmtheit des Sinns jedenfalls im Kontext derTb und der LPA besser aus den unabhängigen wahrheitstheoretischen Überlegungen <strong>Wittgenstein</strong>sverstanden werden kann. Die Bestimmtheitsforderung wäre eine Abzweigung in eineTheoriekonzeption der Idealsprache, die <strong>Wittgenstein</strong> in frühen Interpretationen unter dem <strong>Ein</strong>flußder '<strong>Ein</strong>leitung' von Bertrand Russell häufiger zugeschrieben worden ist, was aber zweifelsfrei einMißverständnis von 3.325 im gesamten Kontext der LPA darstellt, wie insbesondere die'Tagebücher 1914-16' zeigen, aber auch eine Bemerkung wie 5.5563, deren erstem Satz zufolgealle Sätze der Umgangssprache, so wie sie sind, logisch vollkommen geordnet sein sollen. Wie istdas vereinbar mit der in der LPA ebenfalls mehrfach vertretenen These, daß z.B. die Sprache denausgedrückten Gedanken verhülle wie mit einem Kleid, so daß nach dessen Zuschnitt nicht mehrauf die Form des bekleideten Gedankens geschlossen werden könne (vgl. 4.002 d)? Bevor ich<strong>Wittgenstein</strong>s Auflösung des Dilemmas zwischen Vagheit und vollkommener Ordnung nenne, willich darauf hinweisen, daß nicht nur der Sache nach, sondern auch für <strong>Wittgenstein</strong> selbst dieForderung der Bestimmtheit des Sinnes nicht nur sprachphilosophisch, sondern auch ontologischbegründet ist (deshalb kann sie nicht allein eine Folge der Übernahme der funktionentheoretischenSatzauffassung sein). Die ontologische These, die Bestimmtheit des Sinns jedenfalls a u c h fordernläßt, formuliert das Tagebuch so:„...wir fühlen, daß die WELT aus Elementen bestehen muß. Und es scheint, als sei das identisch mit dem Satz , dieWelt müsse eben das sein, was sie ist sie müsse bestimmt sein. Oder mit anderen Worten, was schwankt, sind unsereBestimmungen, nicht die Dinge... Die Welt hat eine feste Struktur.“ (Tb 17.6.15 j/k,Tb 156).Wenn Wahrheit aber Korrespondenz mit der Wirklichkeit ist, wie die LPA unterstellt (2.21), dann
- Seite 1 und 2: 1E.M. LangeWITTGENSTEINS ABHANDLUNG
- Seite 3 und 4: 3XIII. Folgerung (51) 56XIV. Wahrsc
- Seite 5 und 6: 5chung von Wittgensteins Buch abgel
- Seite 7 und 8: 7Hier soll also zunächst der inten
- Seite 9 und 10: 9Bestehen von Sachverhalten erklär
- Seite 11 und 12: 11kann natürlich auch beabsichtigt
- Seite 13: 13vernünftiger anzunehmen, daß du
- Seite 18 und 19: 18E. Vom Satz als Wahrheitsfunktion
- Seite 20 und 21: 20Subjekt (5.633) oder das 'Ich' in
- Seite 22 und 23: 22III. Das Argument für das philos
- Seite 26 und 27: 26muß unsere Darstellung der Wirkl
- Seite 28 und 29: 28der die vagen Sätze der Umgangss
- Seite 30 und 31: 30„Jetzt wird klar, warum ich dac
- Seite 32 und 33: 32IV. OntologieA. Welt und Tatsache
- Seite 34 und 35: 34der logisch problematische Status
- Seite 36 und 37: 36So wie Gegenstände eine Form hab
- Seite 38 und 39: 38transzendentalphilosophische Weis
- Seite 40 und 41: 40C. Die Form der Abbildung als Mö
- Seite 42 und 43: 42Projektion der möglichen Sachlag
- Seite 44 und 45: 44deutlich.C. Vollständig analysie
- Seite 46 und 47: 46sondern müssen im Zweifel gegebe
- Seite 48 und 49: 483.5 Das angewandte, gedachte, Sat
- Seite 50 und 51: 50Sätze wahr oder falsch sein kön
- Seite 52 und 53: 52daher jedenfalls sicher nicht all
- Seite 54 und 55: 54X. Elementarsatz und eigentliche
- Seite 56 und 57: 56F W FW F FF F F4.4 Der Satz ist d
- Seite 58 und 59: 58in ihrer gemeinsamen und daher al
- Seite 60 und 61: 60Weltbeschreibung durch die Gesamt
- Seite 62 und 63: 625.41 begründet einerseits 5.4 -
- Seite 64 und 65: 64(d.h. über Aufreihungen der Elem
- Seite 66 und 67: 66Mit dieser Satzsequenz wird die i
- Seite 68 und 69: 686.12 Daß die Sätze der Logik Ta
- Seite 70 und 71: 70sollte das diesen Vorgang charakt
- Seite 72 und 73: 72wenn sie unser nichtausdrückbare
- Seite 74 und 75:
74Stellungnahme verstanden werden (
- Seite 76 und 77:
765.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5Dies ist
- Seite 78 und 79:
78VERZEICHNIS DER REIHEN (Abschnitt
- Seite 80 und 81:
80( 66) 2.05, 2.06, 2.061, 2.062, 2
- Seite 82 und 83:
82(132) 6.24, 6.241, 6.3, 6.31, 6.3
- Seite 84 und 85:
84Bogen 1972 - J., Wittgenstein's P
- Seite 86:
86hermeneutisch naiven, rationalist