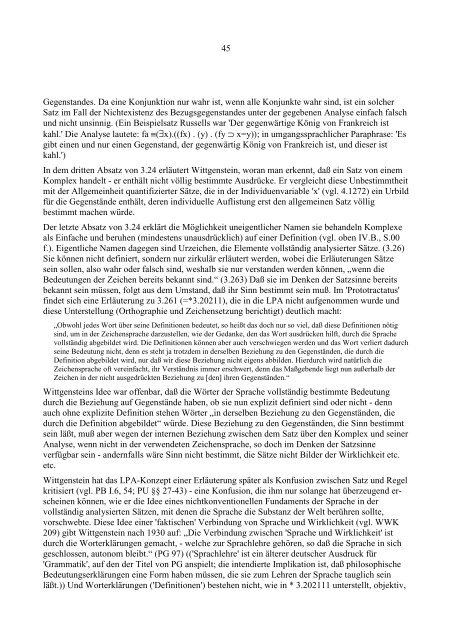44deutlich.C. Vollständig analysierte Sätze als unmittelbarer Gedankenausdruck (42)3.2 Im Satz kann der Gedanke so ausgedrückt sein, daß den Gegenständen des Gedankens Elemente desSatzzeichens entsprechen.3.21 Der Konfiguration der einfachen Zeichen im Satzzeichen entspricht die Konfiguration der Gegenständein der Sachlage.3.22 Der Name vertritt im Satz den Gegenstand.3.23 Die Forderung der Möglichkeit der einfachen Zeichen ist die Forderung der Bestimmtheit des Sinnes.3.24 Der Satz, welcher vom Komplex handelt, steht in interner Beziehung zum Satze, der von dessenBestandteil handelt. .......3.25 Es gibt eine und nur eine vollständige Analyse des Satzes.3.26 Der Name ist durch keine Definition weiter zu zergliedern: er ist ein Urzeichen.Satz 3.2 scheint prima facie nur eine kontingente Möglichkeit des Ausdrucks eines Gedankenseinzuführen. Aber es ist schon darauf hingewiesen worden, daß die Formulierung 'Gegenstände desGedankens' andeuten soll, daß es Gedanken immer schon mit Gegenständen als den absoluteinfachen Bestandteilen der Substanz zu tun haben müssen. (vgl.II.B., S. 10; III. S. 26 ff.) Wennman dies ablehnt, müßte angenommen werden, daß ein deviante Verwendung von 'Gegenstand'vorliegt, die aber in der LPA einen systematischen Ort nur unter 2.01, vor der Differenzierungzwischen Dingen und Gegenständen haben könnte. Hier wird die erste Deutung bevorzugt. Dannkann der Gedankenausdruck in vollständig analysierten Sätzen, den 3.2 gemäß 3.201 einführt, nichtnur eine kontingente Möglichkeit sein. Er ist erforderlich für die Bestimmtheit des Sinns (3.23) unddiese ist erforderlich, damit Sätze Bilder der Wirklichkeit sein können, über deren Wahrheit oderFalschheit nur im Blick auf sie selber entschieden werden kann (vgl. 2.0211-2). DerGedankenausdruck in vollständig analysierten Sätzen bringt den Gebrauch der Sprache in Kontakt(vgl. 'berühren' in 2.15121; 'Verbindung mit der Welt' in 6.124) mit der Substanz der Welt, die esgeben muß, wenn es Bilder der Tatsachen geben soll. Es gibt diesen Gedankenausdruck in dervollständigen Analyse des Satzes, für die es für jeden Satz nur eine Möglichkeit geben soll (3.25;vgl. 3.3442). Und erst diese vollständige Analyse macht den Sinn eines Satzes bestimmt. Sie stehtdeshalb in interner Beziehung zu dem Satz, der vom Komplex handelt (3.24). Es gibt diesevollständige Analyse des Satzes, die für die gesprochene Sprache erst noch entdeckt werden muß(und für <strong>Wittgenstein</strong> noch 1929 in seinem Aufsatz 'Some Remarks on Logical Form' in keinemeinzigen Fall durchgeführt war - VüE 28), schon im Denken der Satzsinne, das dieProjektionsmethode des Satzzeichens bildet ((3.11 (2)). Es gibt die vollständige Analyse des Satzesschon in 'innerer logischer Analyse', in der Denksprache (language of thought - vgl. Malcolm 1986,Chs. VI, VII). Denn eine interne Beziehung ist eine Sinnbeziehung, und die Beziehung aufElementarsätze betrifft schon den Sinn des Satzes als Wahrheitsfunktion der Elementarsätze(vgl.4.2).Aus der Erläuterung 3.24 ist oben (S.42) nur der erste Absatz angeführt worden. Im zweiten unterschreibt<strong>Wittgenstein</strong> der Sache nach Russells Theorie der Kennzeichnungen (definite descriptions)als Bestandteil einer Theorie der Beschreibungen (theory of descriptions), die ihm als Paradigmaeiner Sprachkritik durch logische Analyse galt (4.0031). Diese Analyse betrifft Sätze mit einemSubjektausdruck der Form 'Der so- und-so...', die für die Wahrheitswertbestimmung Problemeaufwerfen für den Fall, daß der Bezugsgegenstand nicht existiert. Russell analysierte dieumgangssprachlichen Sätze mit Kennzeichnungen in eine Konjunktion von expliziterExistenzbehauptung, <strong>Ein</strong>zigkeitsbedingung und Charakterisierung des so spezifizierten
45Gegenstandes. Da eine Konjunktion nur wahr ist, wenn alle Konjunkte wahr sind, ist ein solcherSatz im Fall der Nichtexistenz des Bezugsgegenstandes unter der gegebenen Analyse einfach falschund nicht unsinnig. (<strong>Ein</strong> Beispielsatz Russells war 'Der gegenwärtige König von Frankreich istkahl.' Die Analyse lautete: fa ≡(∃x).((fx) . (y) . (fy ⊃ x=y)); in umgangssprachlicher Paraphrase: 'Esgibt einen und nur einen Gegenstand, der gegenwärtig König von Frankreich ist, und dieser istkahl.')In dem dritten Absatz von 3.24 erläutert <strong>Wittgenstein</strong>, woran man erkennt, daß ein Satz von einemKomplex handelt - er enthält nicht völlig bestimmte Ausdrücke. Er vergleicht diese Unbestimmtheitmit der Allgemeinheit quantifizierter Sätze, die in der Individuenvariable 'x' (vgl. 4.1272) ein Urbildfür die Gegenstände enthält, deren individuelle Auflistung erst den allgemeinen Satz völligbestimmt machen würde.Der letzte Absatz von 3.24 erklärt die Möglichkeit uneigentlicher Namen sie behandeln Komplexeals <strong>Ein</strong>fache und beruhen (mindestens unausdrücklich) auf einer Definition (vgl. oben IV.B., S.00f.). Eigentliche Namen dagegen sind Urzeichen, die Elemente vollständig analysierter Sätze. (3.26)Sie können nicht definiert, sondern nur zirkulär erläutert werden, wobei die Erläuterungen Sätzesein sollen, also wahr oder falsch sind, weshalb sie nur verstanden werden können, „wenn dieBedeutungen der Zeichen bereits bekannt sind.“ (3.263) Daß sie im Denken der Satzsinne bereitsbekannt sein müssen, folgt aus dem Umstand, daß ihr Sinn bestimmt sein muß. Im 'Prototractatus'findet sich eine Erläuterung zu 3.261 (=*3.20211), die in die LPA nicht aufgenommen wurde unddiese Unterstellung (Orthographie und Zeichensetzung berichtigt) deutlich macht:„Obwohl jedes Wort über seine Definitionen bedeutet, so heißt das doch nur so viel, daß diese Definitionen nötigsind, um in der Zeichensprache darzustellen, wie der Gedanke, den das Wort ausdrücken hilft, durch die Sprachevollständig abgebildet wird. Die Definitionen können aber auch verschwiegen werden und das Wort verliert dadurchseine Bedeutung nicht, denn es steht ja trotzdem in derselben Beziehung zu den Gegenständen, die durch dieDefinition abgebildet wird, nur daß wir diese Beziehung nicht eigens abbilden. Hierdurch wird natürlich dieZeichensprache oft vereinfacht, ihr Verständnis immer erschwert, denn das Maßgebende liegt nun außerhalb derZeichen in der nicht ausgedrückten Beziehung zu [den] ihren Gegenständen.“<strong>Wittgenstein</strong>s Idee war offenbar, daß die Wörter der Sprache vollständig bestimmte Bedeutungdurch die Beziehung auf Gegenstände haben, ob sie nun explizit definiert sind oder nicht - dennauch ohne explizite Definition stehen Wörter „in derselben Beziehung zu den Gegenständen, diedurch die Definition abgebildet“ würde. Diese Beziehung zu den Gegenständen, die Sinn bestimmtsein läßt, muß aber wegen der internen Beziehung zwischen dem Satz über den Komplex und seinerAnalyse, wenn nicht in der verwendeten Zeichensprache, so doch im Denken der Satzsinneverfügbar sein - andernfalls wäre Sinn nicht bestimmt, die Sätze nicht Bilder der Wirklichkeit etc.etc.<strong>Wittgenstein</strong> hat das LPA-Konzept einer Erläuterung später als Konfusion zwischen Satz und Regelkritisiert (vgl. PB I.6, 54; PU §§ 27-43) - eine Konfusion, die ihm nur solange hat überzeugend erscheinenkönnen, wie er die Idee eines nichtkonventionellen Fundaments der Sprache in dervollständig analysierten Sätzen, mit denen die Sprache die Substanz der Welt berühren sollte,vorschwebte. Diese Idee einer 'faktischen' Verbindung von Sprache und Wirklichkeit (vgl. WWK209) gibt <strong>Wittgenstein</strong> nach 1930 auf: „Die Verbindung zwischen 'Sprache und Wirklichkeit' istdurch die Worterklärungen gemacht, - welche zur Sprachlehre gehören, so daß die Sprache in sichgeschlossen, autonom bleibt.“ (PG 97) (('Sprachlehre' ist ein älterer deutscher Ausdruck für'Grammatik', auf den der Titel von PG anspielt; die intendierte Implikation ist, daß philosophischeBedeutungserklärungen eine Form haben müssen, die sie zum Lehren der Sprache tauglich seinläßt.)) Und Worterklärungen ('Definitionen') bestehen nicht, wie in * 3.202111 unterstellt, objektiv,
- Seite 1 und 2: 1E.M. LangeWITTGENSTEINS ABHANDLUNG
- Seite 3 und 4: 3XIII. Folgerung (51) 56XIV. Wahrsc
- Seite 5 und 6: 5chung von Wittgensteins Buch abgel
- Seite 7 und 8: 7Hier soll also zunächst der inten
- Seite 9 und 10: 9Bestehen von Sachverhalten erklär
- Seite 11 und 12: 11kann natürlich auch beabsichtigt
- Seite 13: 13vernünftiger anzunehmen, daß du
- Seite 18 und 19: 18E. Vom Satz als Wahrheitsfunktion
- Seite 20 und 21: 20Subjekt (5.633) oder das 'Ich' in
- Seite 22 und 23: 22III. Das Argument für das philos
- Seite 24 und 25: 24Auf eine Konzeption von 'Form des
- Seite 26 und 27: 26muß unsere Darstellung der Wirkl
- Seite 28 und 29: 28der die vagen Sätze der Umgangss
- Seite 30 und 31: 30„Jetzt wird klar, warum ich dac
- Seite 32 und 33: 32IV. OntologieA. Welt und Tatsache
- Seite 34 und 35: 34der logisch problematische Status
- Seite 36 und 37: 36So wie Gegenstände eine Form hab
- Seite 38 und 39: 38transzendentalphilosophische Weis
- Seite 40 und 41: 40C. Die Form der Abbildung als Mö
- Seite 42 und 43: 42Projektion der möglichen Sachlag
- Seite 46 und 47: 46sondern müssen im Zweifel gegebe
- Seite 48 und 49: 483.5 Das angewandte, gedachte, Sat
- Seite 50 und 51: 50Sätze wahr oder falsch sein kön
- Seite 52 und 53: 52daher jedenfalls sicher nicht all
- Seite 54 und 55: 54X. Elementarsatz und eigentliche
- Seite 56 und 57: 56F W FW F FF F F4.4 Der Satz ist d
- Seite 58 und 59: 58in ihrer gemeinsamen und daher al
- Seite 60 und 61: 60Weltbeschreibung durch die Gesamt
- Seite 62 und 63: 625.41 begründet einerseits 5.4 -
- Seite 64 und 65: 64(d.h. über Aufreihungen der Elem
- Seite 66 und 67: 66Mit dieser Satzsequenz wird die i
- Seite 68 und 69: 686.12 Daß die Sätze der Logik Ta
- Seite 70 und 71: 70sollte das diesen Vorgang charakt
- Seite 72 und 73: 72wenn sie unser nichtausdrückbare
- Seite 74 und 75: 74Stellungnahme verstanden werden (
- Seite 76 und 77: 765.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5Dies ist
- Seite 78 und 79: 78VERZEICHNIS DER REIHEN (Abschnitt
- Seite 80 und 81: 80( 66) 2.05, 2.06, 2.061, 2.062, 2
- Seite 82 und 83: 82(132) 6.24, 6.241, 6.3, 6.31, 6.3
- Seite 84 und 85: 84Bogen 1972 - J., Wittgenstein's P
- Seite 86: 86hermeneutisch naiven, rationalist