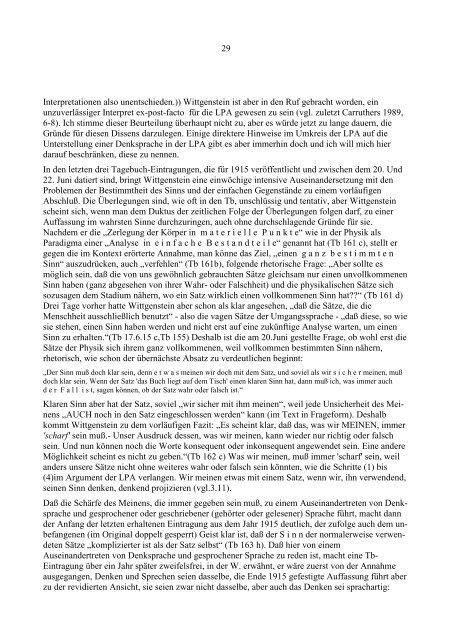28der die vagen Sätze der Umgangssprache vollständig und eindeutig (3.25) analysiert sind. DieseAnnahme wird von der dominanten Interpretationstradition der LPA abgelehnt, weil sie extremkontraintuitiv sei (Carruthers 1990, 73). Carruthers zeigt auch, daß man in systematischerInterpretation, die nur das Verteidigbare an der LPA retten will (und dabei sehr viel mehr alsverteidigbar erweist, als oft angenommen wird), ohne die Annahme auch einer 'Mythologie derPsychologie' auskommen kann. Ich glaube aber, daß diese Annahme in historischer Interpretationunverzichtbar ist, weil nur sie zweierlei zu verstehen erlaubt: warum <strong>Wittgenstein</strong> seine Kritik desSolipsismus unter 5.6 (die Carruthers für systematisch entbehrlich hält) für einen konstituierendenBestandteil seiner Sinnkritik nicht nur hat halten können, sondern hat halten müssen; und warumein Philosoph der Logik und der Sprache in seiner (über die gemeinhin so gelesenenAnfangspassagen der PU weit hinausreichenden) Selbstkritik in so großem Maße, wie das bei<strong>Wittgenstein</strong> der Fall war, zu einem Philosophen der Psychologie geworden ist.Ich meine also, daß <strong>Wittgenstein</strong> in der LPA die 'Mythologie des Symbolismus' durch eine'Mythologie der Psychologie' überboten hat. Hier ist der Punkt, an dem ich meine Rekonstruktiondes teilweise latenten Arguments der LPA methodisch in Schwierigkeiten sehen muß, die freilichzu beheben sind. Daß <strong>Wittgenstein</strong> nämlich die Operation einer language of thought durch dieVerwender der normalen Sprache unterstellt, läßt sich, wenn, wie für eine Interpretation des Textesstrikt erforderlich, die LPA selber der absolut vorrangige Bezugstext sein soll, nur mit einembeträchtlichen Argumentationsaufwand zeigen, der zudem auf meine wenig gebräuchlichen unddaher Ungläubigkeit provozierende Argumente aus der Darstellungsform der LPA rekurrieren muß(vgl. Lange 1989, Kap. 3). Der unzweideutigste Beweis für diese These ist wohl ein entsprechendesGeständnis <strong>Wittgenstein</strong>s im § 81 der PU, demzufolge es ihn dazu „verleitet hat ... zu denken, daß,wer einen Satz ausspricht und ihn m e i n t, oder v e r s t e h t, damit einen Kalkül betreibt nachbestimmten Regeln.“ Das Geständnis verdient deshalb besondere Glaubwürdigkeit, weil<strong>Wittgenstein</strong> in ihm nicht, wie anderswo, distanziert vom „Verfasser der <strong>Logisch</strong>-<strong>Philosophische</strong>nAbhandlung“ (PU 23) schreibt, sondern sich distanzlos in erster Person äußert (wie selten<strong>Wittgenstein</strong>s eigene Stimme unter der Vielzahl von Dialogstimmen in PU so zu hören ist, betontWinch 1993, 129, ohne es auf diese Stelle zu beziehen.). Es ist auch nicht anzunehmen, daß sich<strong>Wittgenstein</strong>s Geständnis auf eine Auffassung bezieht, die er erst nach seinem Wiederbeginn in derPhilosophie nach 1929 vertreten hat. Denn die Annahmen einer 'Mythologie der Psychologie'stehen jedenfalls im Blauen Buch und der <strong>Philosophische</strong>n Grammatik schon unzweideutig zuKritik (BlB 71, PG 152).Gegen die Standardinterpretation ist auch zu sagen, daß die Annahme einer Denksprache gebrauchtwird, weil eine bloße analytische Äquivalenz zwischen vagem Satz und einem entsprechenden Satz,der eine Wahrheitsfunktion von Elementarsätzen ist, für die Erfüllung der Forderung nach Sinnbestimmtheitnicht genügt. Denn, mit dem späteren <strong>Wittgenstein</strong> zu reden, eine Regel wirkt nicht aufdie Entfernung (vgl. BlB 32), sondern muß angewandt sein. Sprecher und Hörer der Umgangssprachemüssen wissen können, wann die Wahrheitsbedingungen der Sätze, die sie verwenden, erfülltsind (vgl. 4.024 a), und dazu müssen sie diese in aller Spezifität mindestens implizit kennen.<strong>Wittgenstein</strong> behauptet daher auch explizit, wenn wir als analysierende Philosophen wissen, daß esElementarsätze gibt, „dann muß es jeder wissen, der die Sätze in ihrer unanalysierten Formversteht.“ ((5.5562; (Carruthers interpretiert diese Bemerkung, indem er eineNichtstandardverwendung von 'wissen' annimmt - wer die Umgangssprache versteht, weiß, daß esElementarsätze geben muß, weil er es a priori aus dem, was er versteht, ableiten kann; die Annahmeeiner 'language of thought' nimmt eine andere Nichtstandardverwendung von 'wissen' an, die in derCognitive Science als 'tacit knowledge' häufig beansprucht wird - hier ist die Konkurrenz der
29Interpretationen also unentschieden.)) <strong>Wittgenstein</strong> ist aber in den Ruf gebracht worden, einunzuverlässiger Interpret ex-post-facto für die LPA gewesen zu sein (vgl. zuletzt Carruthers 1989,6-8). Ich stimme dieser Beurteilung überhaupt nicht zu, aber es würde jetzt zu lange dauern, dieGründe für diesen Dissens darzulegen. <strong>Ein</strong>ige direktere Hinweise im Umkreis der LPA auf dieUnterstellung einer Denksprache in der LPA gibt es aber immerhin doch und ich will mich hierdarauf beschränken, diese zu nennen.In den letzten drei Tagebuch-<strong>Ein</strong>tragungen, die für 1915 veröffentlicht und zwischen dem 20. Und22. Juni datiert sind, bringt <strong>Wittgenstein</strong> eine einwöchige intensive Auseinandersetzung mit denProblemen der Bestimmtheit des Sinns und der einfachen Gegenstände zu einem vorläufigenAbschluß. Die Überlegungen sind, wie oft in den Tb, unschlüssig und tentativ, aber <strong>Wittgenstein</strong>scheint sich, wenn man dem Duktus der zeitlichen Folge der Überlegungen folgen darf, zu einerAuffassung im wahrsten Sinne durchzuringen, auch ohne durchschlagende Gründe für sie.Nachdem er die „Zerlegung der Körper in m a t e r i e l l e P u n k t e“ wie in der Physik alsParadigma einer „Analyse in e i n f a c h e B e s t a n d t e i l e“ genannt hat (Tb 161 c), stellt ergegen die im Kontext erörterte Annahme, man könne das Ziel, „einen g a n z b e s t i m m t e nSinn“ auszudrücken, auch „verfehlen“ (Tb 161b), folgende rhetorische Frage: „Aber sollte esmöglich sein, daß die von uns gewöhnlich gebrauchten Sätze gleichsam nur einen unvollkommenenSinn haben (ganz abgesehen von ihrer Wahr- oder Falschheit) und die physikalischen Sätze sichsozusagen dem Stadium nähern, wo ein Satz wirklich einen vollkommenen Sinn hat??“ (Tb 161 d)Drei Tage vorher hatte <strong>Wittgenstein</strong> aber schon als klar angesehen, „daß die Sätze, die dieMenschheit ausschließlich benutzt“ - also die vagen Sätze der Umgangssprache - „daß diese, so wiesie stehen, einen Sinn haben werden und nicht erst auf eine zukünftige Analyse warten, um einenSinn zu erhalten.“(Tb 17.6.15 c,Tb 155) Deshalb ist die am 20.Juni gestellte Frage, ob wohl erst dieSätze der Physik sich ihrem ganz vollkommenen, weil vollkommen bestimmten Sinn nähern,rhetorisch, wie schon der übernächste Absatz zu verdeutlichen beginnt:„Der Sinn muß doch klar sein, denn e t w a s meinen wir doch mit dem Satz, und soviel als wir s i c h e r meinen, mußdoch klar sein. Wenn der Satz 'das Buch liegt auf dem Tisch' einen klaren Sinn hat, dann muß ich, was immer auchd e r F a l l i s t, sagen können, ob der Satz wahr oder falsch ist.“Klaren Sinn aber hat der Satz, soviel „wir sicher mit ihm meinen“, weil jede Unsicherheit des Meinens„AUCH noch in den Satz eingeschlossen werden“ kann (im Text in Frageform). Deshalbkommt <strong>Wittgenstein</strong> zu dem vorläufigen Fazit: „Es scheint klar, daß das, was wir MEINEN, immer'scharf' sein muß.- Unser Ausdruck dessen, was wir meinen, kann wieder nur richtig oder falschsein. Und nun können noch die Worte konsequent oder inkonsequent angewendet sein. <strong>Ein</strong>e andereMöglichkeit scheint es nicht zu geben.“(Tb 162 c) Was wir meinen, muß immer 'scharf' sein, weilanders unsere Sätze nicht ohne weiteres wahr oder falsch sein könnten, wie die Schritte (1) bis(4)im Argument der LPA verlangen. Wir meinen etwas mit einem Satz, wenn wir, ihn verwendend,seinen Sinn denken, denkend projizieren (vgl.3.11).Daß die Schärfe des Meinens, die immer gegeben sein muß, zu einem Auseinandertreten von Denkspracheund gesprochener oder geschriebener (gehörter oder gelesener) Sprache führt, macht dannder Anfang der letzten erhaltenen <strong>Ein</strong>tragung aus dem Jahr 1915 deutlich, der zufolge auch dem unbefangenen(im Original doppelt gesperrt) Geist klar ist, daß der S i n n der normalerweise verwendetenSätze „komplizierter ist als der Satz selbst“ (Tb 163 h). Daß hier von einemAuseinandertreten von Denksprache und gesprochener Sprache zu reden ist, macht eine Tb-<strong>Ein</strong>tragung über ein Jahr später zweifelsfrei, in der W. erwähnt, er wäre zuerst von der Annahmeausgegangen, Denken und Sprechen seien dasselbe, die Ende 1915 gefestigte Auffassung führt aberzu der revidierten Ansicht, sie seien zwar nicht dasselbe, aber auch das Denken sei sprachartig:
- Seite 1 und 2: 1E.M. LangeWITTGENSTEINS ABHANDLUNG
- Seite 3 und 4: 3XIII. Folgerung (51) 56XIV. Wahrsc
- Seite 5 und 6: 5chung von Wittgensteins Buch abgel
- Seite 7 und 8: 7Hier soll also zunächst der inten
- Seite 9 und 10: 9Bestehen von Sachverhalten erklär
- Seite 11 und 12: 11kann natürlich auch beabsichtigt
- Seite 13: 13vernünftiger anzunehmen, daß du
- Seite 18 und 19: 18E. Vom Satz als Wahrheitsfunktion
- Seite 20 und 21: 20Subjekt (5.633) oder das 'Ich' in
- Seite 22 und 23: 22III. Das Argument für das philos
- Seite 24 und 25: 24Auf eine Konzeption von 'Form des
- Seite 26 und 27: 26muß unsere Darstellung der Wirkl
- Seite 30 und 31: 30„Jetzt wird klar, warum ich dac
- Seite 32 und 33: 32IV. OntologieA. Welt und Tatsache
- Seite 34 und 35: 34der logisch problematische Status
- Seite 36 und 37: 36So wie Gegenstände eine Form hab
- Seite 38 und 39: 38transzendentalphilosophische Weis
- Seite 40 und 41: 40C. Die Form der Abbildung als Mö
- Seite 42 und 43: 42Projektion der möglichen Sachlag
- Seite 44 und 45: 44deutlich.C. Vollständig analysie
- Seite 46 und 47: 46sondern müssen im Zweifel gegebe
- Seite 48 und 49: 483.5 Das angewandte, gedachte, Sat
- Seite 50 und 51: 50Sätze wahr oder falsch sein kön
- Seite 52 und 53: 52daher jedenfalls sicher nicht all
- Seite 54 und 55: 54X. Elementarsatz und eigentliche
- Seite 56 und 57: 56F W FW F FF F F4.4 Der Satz ist d
- Seite 58 und 59: 58in ihrer gemeinsamen und daher al
- Seite 60 und 61: 60Weltbeschreibung durch die Gesamt
- Seite 62 und 63: 625.41 begründet einerseits 5.4 -
- Seite 64 und 65: 64(d.h. über Aufreihungen der Elem
- Seite 66 und 67: 66Mit dieser Satzsequenz wird die i
- Seite 68 und 69: 686.12 Daß die Sätze der Logik Ta
- Seite 70 und 71: 70sollte das diesen Vorgang charakt
- Seite 72 und 73: 72wenn sie unser nichtausdrückbare
- Seite 74 und 75: 74Stellungnahme verstanden werden (
- Seite 76 und 77: 765.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5Dies ist
- Seite 78 und 79:
78VERZEICHNIS DER REIHEN (Abschnitt
- Seite 80 und 81:
80( 66) 2.05, 2.06, 2.061, 2.062, 2
- Seite 82 und 83:
82(132) 6.24, 6.241, 6.3, 6.31, 6.3
- Seite 84 und 85:
84Bogen 1972 - J., Wittgenstein's P
- Seite 86:
86hermeneutisch naiven, rationalist