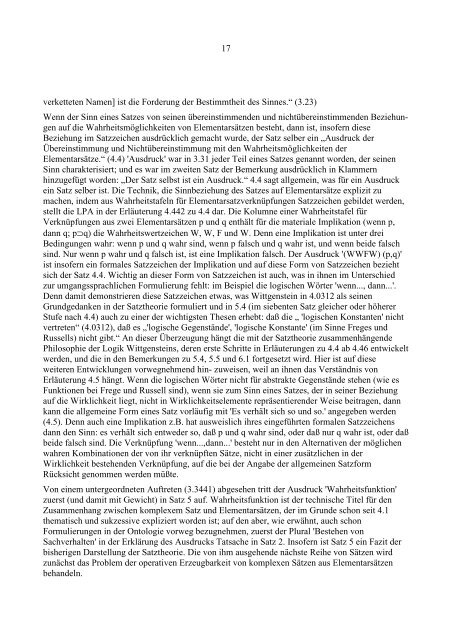Ludwig Wittgenstein: >Logisch-Philosophische Abhandlung< - Ein ...
Ludwig Wittgenstein: >Logisch-Philosophische Abhandlung< - Ein ...
Ludwig Wittgenstein: >Logisch-Philosophische Abhandlung< - Ein ...
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
17verketteten Namen] ist die Forderung der Bestimmtheit des Sinnes.“ (3.23)Wenn der Sinn eines Satzes von seinen übereinstimmenden und nichtübereinstimmenden Beziehungenauf die Wahrheitsmöglichkeiten von Elementarsätzen besteht, dann ist, insofern dieseBeziehung im Satzzeichen ausdrücklich gemacht wurde, der Satz selber ein „Ausdruck derÜbereinstimmung und Nichtübereinstimmung mit den Wahrheitsmöglichkeiten derElementarsätze.“ (4.4) 'Ausdruck' war in 3.31 jeder Teil eines Satzes genannt worden, der seinenSinn charakterisiert; und es war im zweiten Satz der Bemerkung ausdrücklich in Klammernhinzugefügt worden: „Der Satz selbst ist ein Ausdruck.“ 4.4 sagt allgemein, was für ein Ausdruckein Satz selber ist. Die Technik, die Sinnbeziehung des Satzes auf Elementarsätze explizit zumachen, indem aus Wahrheitstafeln für Elementarsatzverknüpfungen Satzzeichen gebildet werden,stellt die LPA in der Erläuterung 4.442 zu 4.4 dar. Die Kolumne einer Wahrheitstafel fürVerknüpfungen aus zwei Elementarsätzen p und q enthält für die materiale Implikation (wenn p,dann q; p⊃q) die Wahrheitswertzeichen W, W, F und W. Denn eine Implikation ist unter dreiBedingungen wahr: wenn p und q wahr sind, wenn p falsch und q wahr ist, und wenn beide falschsind. Nur wenn p wahr und q falsch ist, ist eine Implikation falsch. Der Ausdruck '(WWFW) (p,q)'ist insofern ein formales Satzzeichen der Implikation und auf diese Form von Satzzeichen beziehtsich der Satz 4.4. Wichtig an dieser Form von Satzzeichen ist auch, was in ihnen im Unterschiedzur umgangssprachlichen Formulierung fehlt: im Beispiel die logischen Wörter 'wenn..., dann...'.Denn damit demonstrieren diese Satzzeichen etwas, was <strong>Wittgenstein</strong> in 4.0312 als seinenGrundgedanken in der Satztheorie formuliert und in 5.4 (im siebenten Satz gleicher oder höhererStufe nach 4.4) auch zu einer der wichtigsten Thesen erhebt: daß die „ 'logischen Konstanten' nichtvertreten“ (4.0312), daß es „'logische Gegenstände', 'logische Konstante' (im Sinne Freges undRussells) nicht gibt.“ An dieser Überzeugung hängt die mit der Satztheorie zusammenhängendePhilosophie der Logik <strong>Wittgenstein</strong>s, deren erste Schritte in Erläuterungen zu 4.4 ab 4.46 entwickeltwerden, und die in den Bemerkungen zu 5.4, 5.5 und 6.1 fortgesetzt wird. Hier ist auf dieseweiteren Entwicklungen vorwegnehmend hin- zuweisen, weil an ihnen das Verständnis vonErläuterung 4.5 hängt. Wenn die logischen Wörter nicht für abstrakte Gegenstände stehen (wie esFunktionen bei Frege und Russell sind), wenn sie zum Sinn eines Satzes, der in seiner Beziehungauf die Wirklichkeit liegt, nicht in Wirklichkeitselemente repräsentierender Weise beitragen, dannkann die allgemeine Form eines Satz vorläufig mit 'Es verhält sich so und so.' angegeben werden(4.5). Denn auch eine Implikation z.B. hat ausweislich ihres eingeführten formalen Satzzeichensdann den Sinn: es verhält sich entweder so, daß p und q wahr sind, oder daß nur q wahr ist, oder daßbeide falsch sind. Die Verknüpfung 'wenn...,dann...' besteht nur in den Alternativen der möglichenwahren Kombinationen der von ihr verknüpften Sätze, nicht in einer zusätzlichen in derWirklichkeit bestehenden Verknüpfung, auf die bei der Angabe der allgemeinen SatzformRücksicht genommen werden müßte.Von einem untergeordneten Auftreten (3.3441) abgesehen tritt der Ausdruck 'Wahrheitsfunktion'zuerst (und damit mit Gewicht) in Satz 5 auf. Wahrheitsfunktion ist der technische Titel für denZusammenhang zwischen komplexem Satz und Elementarsätzen, der im Grunde schon seit 4.1thematisch und sukzessive expliziert worden ist; auf den aber, wie erwähnt, auch schonFormulierungen in der Ontologie vorweg bezugnehmen, zuerst der Plural 'Bestehen vonSachverhalten' in der Erklärung des Ausdrucks Tatsache in Satz 2. Insofern ist Satz 5 ein Fazit derbisherigen Darstellung der Satztheorie. Die von ihm ausgehende nächste Reihe von Sätzen wirdzunächst das Problem der operativen Erzeugbarkeit von komplexen Sätzen aus Elementarsätzenbehandeln.