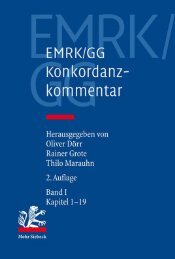Wıssenschaftsrecht
Wıssenschaftsrecht
Wıssenschaftsrecht
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
218 Alexander Reetz<br />
WissR<br />
lichung ohne Verwertung setzt die Freigabeerklärung des Dienstherrn voraus.<br />
Im Einzelfall kann sich für den eigenverantwortlichen Hochschulerfinder<br />
indes die sozial-ethische Problematik stellen, ob er es für vertretbar<br />
hält, dass seine Erfindung über die Verwertung ein Zwischenglied in der<br />
Wertschöpfungskette der Industrie bilden oder aber auf anderem Wege<br />
nutzbringend an die Allgemeinheit weitergegeben werden soll. Zwar ist es<br />
richtig, dass es die Wissenschaftsfreiheit des Hochschulerfinders nicht gebietet,<br />
dass der Hochschullehrer auch Inhaber der Verwertungsrechte an<br />
seiner Erfindung bleiben muss. 50 Die Verwertungsentscheidung der Hochschule<br />
ist zunächst jedoch nur die mittelbare Folge einer durch den Wissenschaftler<br />
selbständig zu verantwortenden Offenbarungsentscheidung.<br />
Die wissenschaftliche Folgenverantwortung ist ein ganz wichtiger Bestandteil<br />
der Wissenschaftsfreiheit. Sie ist Ausprägung des Erfinderpersönlichkeitsrechts<br />
aus Art. 5 III 1 GG. Dass – wie der Bundesgerichtshof<br />
ausführt – der Hochschulerfinder seine Nichtnennung in den Patentveröffentlichungen<br />
(§ 63 I 3 PatG; Regel 18 der Ausführungsverordnung zum<br />
EPÜ) herbeiführen könne, wenn er sich ausschließlich durch von ihm<br />
pub lizierte Erfindungen in der Fachwelt einen Namen machen möchte, 51<br />
ändert nichts daran, dass der Wissenschaftler es in der Hand hat, ob die<br />
Erfindung überhaupt der Öffentlichkeit preisgegeben wird .<br />
Dem Erfinder bleibt also im Zweifel nur die Flucht in die Geheimhaltung<br />
(§ 42 Nr. 2 ArbEG). 52 Diese „wissenschaftsautonome“ Entscheidung<br />
ist nicht justitiabel. Die geltende Rechtslage muss vor allem dann als zutiefst<br />
unbefriedigend empfunden werden, wenn eine Veröffentlichung<br />
ohne Verwertung durchaus im Allgemeinwohlinteresse läge. Wer weiss,<br />
wie viele Erfindungen bereits alleine deshalb nicht offenbart worden sind,<br />
weil der Hochschulwissenschaftler die Folgen einer wirtschaftlichen Verwertung<br />
nicht verantworten wollte.<br />
Es ist daher erstrebenswert, de lege ferenda einen Mechanismus zur<br />
Verfügung zu stellen, der es dem Wissenschaftler ermöglicht, auf die Art<br />
50 So zutreffend bereits D. Leuze, in Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Arbeitnehmererfindung<br />
(7. Aufl. 2000), § 42 Rdn. 16.<br />
51 So der BGH, GRUR 2008, 150, 152 (Rdn. 20).<br />
52 Einige Autoren bestreiten, dass geheim gehaltene Forschungsergebnisse überhaupt<br />
in den Schutzbereich des Art. 5 III 1 GG fallen, andere Autoren möchten den<br />
Grundrechtsschutz von der Erfüllung weiterer subjektiver Voraussetzungen abhängig<br />
machen. Die hierzu vorgetragenen Argumente können allesamt nicht überzeugen. Ihre<br />
Darstellung würde jedoch den Rahmen sprengen, vgl. dazu die vorzüglichen Ausführungen<br />
von M. Kamp, Forschungsfreiheit und Kommerz (2004), S. 72 ff. und J. Fenchel,<br />
Negative Informationsfreiheit – Zugleich ein Beitrag zur negativen Informationsfreiheit<br />
(1997), S. 53 ff.