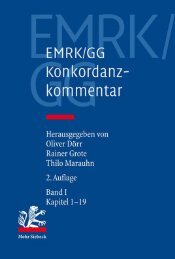Wıssenschaftsrecht
Wıssenschaftsrecht
Wıssenschaftsrecht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
224 Alexander Reetz<br />
WissR<br />
tungserlösen letztlich auch die mit der Patentierung entstehenden Kosten<br />
bewältigt werden müssen. 75<br />
Deshalb billigt der Bundesgerichtshof, in Übereinstimmung mit den gesetzgeberischen<br />
Zielen, aber entgegen der Systematik des Arbeitnehmererfindungsgesetzes,<br />
der jeweiligen Hochschule, aus der die Erfindung<br />
stammt, das Verwertungsrecht zu. Die weitreichenden Schlüsse, die er im<br />
Hinblick auf den fiskalischen Nutzen der Hochschulen zieht, sind allerdings<br />
nicht haltbar: Es bestehen in der beabsichtigten Verteilung nach der<br />
sog. Drittel-Regelung, auch soweit sich diese in außeruniversitären Forschungseinrichtungen<br />
bewährt haben mag, aus prinzipiellen Gründen<br />
nicht unerhebliche Gefahren für die Hochschulforschung. Es liegt auf der<br />
Hand, dass durch die unmittelbare Gratifikation einer erfolgreichen Verwertung<br />
von Hochschulerfindungen eine Motivationslage für die Verlagerung<br />
von Forschungsschwerpunkten auf solche Gebiete geschaffen wird,<br />
bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen schnellen Transfer in die<br />
industrielle Verwertung besteht. Wenn auch die Hochschulen konkret<br />
profitieren, d.h. eine Verwertungsrendite erzielen, so kann sich dies in Zeiten<br />
der staatlichen Unterfinanzierung für die Grundlagenforschung nur<br />
negativ auswirken. Es fehlt an einem Mechanismus der wissenschaftsadäquaten<br />
Verteilung der Mittel. Die Drittel-Regelung mag als gerecht empfunden<br />
werden, wo Forschungseinrichtungen nicht auch zur Grundlagenforschung<br />
verpflichtet sind. Die großzügige Verteilung der erzielten Einnahmen<br />
zielt dort nämlich darauf ab, einen „Incentive“ für die zielstrebige<br />
Erfindungstätigkeit zu geben. Soweit an den öffentlichen Hochschulen<br />
dieselben Wissenschaftler zugleich Grundlagen-, Drittmittel- und Auftragsforschung<br />
betreiben, wird die Verwertungspräferenz auf unheilsame<br />
Weise in den Vordergrund gerückt. Der Bundesgerichtshof legt nicht überzeugend<br />
dar, wie die Mittelerschließung überhaupt zur Stärkung der Autonomie<br />
der Hochschulen beitragen soll. 76 Im Gegenteil: Wenn sich die<br />
Hochschulen gegenüber dem Land eine größere Autonomie verschaffen<br />
wollten, so müsste dies um den Preis einer Vernachlässigung der Grundlagenforschung<br />
geschehen, da insofern ein Wettbewerb um die zusätzlichen<br />
Einnahmen aus der Erfindungsverwertung entfacht worden und die<br />
Grundfinanzierung als nicht leistungsbezogene Zuwendung ohnehin garantiert<br />
ist. 77<br />
75 Gegenüber den Vorstellungen des Gesetzgebers im Hinblick auf die Kostensituation<br />
deutlich pessimistischer K. Bartenbach/O. Hellebrand, MittdtPatAnw 2002,<br />
165, 169 f.; R. Bodenburg, F&L 2003, 601, 602, bezeichnet es als „komplexes Hochrisiko“.<br />
76 BGH GRUR 2008, 150, 152 (Rdn. 21).<br />
77 Ähnlich bereits D. Leuze, WissR 35 (2002), S. 348, 351 f.