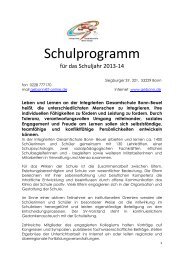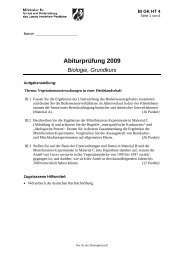Fertig AnjaJohanna-2 - Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel
Fertig AnjaJohanna-2 - Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel
Fertig AnjaJohanna-2 - Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
durch die ersten integrativen Schulversuche ab 1960 in Dänemark und ab 1970in den USA.In Deutschland wurde in dem von dem Kinderarzt Heilbrügge geschaffeneninterdisziplinären Kinderzentrum 1970 eine private Montessori-Schule von derAktion Sonnenschein eingerichtet, in der erstmals behinderte und nichtbehinderteKinder gemeinsam in Integrationsklassen unterrichtet wurden. Basierendauf der Montessori-Pädagogik wurde in diesen Klassen Sinn- und Handlungsorientierungverknüpft und dabei die physischen, emotionalen und sozialenBedürfnisse der Kinder berücksichtigt. Diese Schule wird als eine Wurzel fürdas spätere Wachstum der Integrationsbewegung aufgefasst (vgl. Rosenberger1998, S. 17).1973 ging der deutsche Bildungsrat erstmalig ein auf die elterlichen Ansprüchemit einer Empfehlung zur pädagogischen Förderung behinderter und nichtbehinderterKinder und Jugendlicher (vgl. Krach 2009, S. 384). Die unter derLeitung von Jakob Muth erarbeitete Empfehlung löste große Diskussionen darüberaus, welcher Ort der bestmögliche zur schulischen Förderung von behindertenKindern sei (vgl. Schuck/ Borchert 1992, S. 26).Die bis dahin ausgebauten und ausdifferenzierten eigenständigen Sonderschulenwurden nun angeklagt, die gesellschaftliche Integration der Kinder zu beeinträchtigen(siehe auch Kapitel 2.4.2.3). Ihre ursprüngliche Intention, durcheine separierte Beschulung und den daraus resultierenden homogeneren Lernumgebungen,die Lernchancen der behinderten Schülerinnen und Schüler zuverbessern, geriet in große Kritik (vgl. Wlaschek 2010, S. 4). Man erkannte,dass Sonderschulen nicht in erster Linie das eigene Klientel begünstigten, sondernvielmehr den Regelschulen als Entlastung dienten (vgl. Rosenberger1998, S. 12).Statistiken zeigten, dass ein hoher Anteil der Sonderklassen von Kindern aussozial schwachen und Migrationsfamilien geformt wurde. Dieser Tatbestandgab Hinweise darüber, dass nicht nur feststellbare Behinderungen, sondernscheinbar auch soziale Faktoren als ‚Aussonderungskriterien’ ausschlaggebendwaren (vgl. Schär/ Parmentier 1996, S. 15).Die aus der Empfehlung heraus formulierte These „soviel Integration wie möglich,soviel Separation wie nötig“ (Rosenberger 1998, S. 9) brachte das inhaltlicheErgebnis des Bildungsrates hervor, das für eine Öffnung des Sonderschulwesenshin zu dem allgemeinen Schulsystem plädierte. Die Zielsetzung42