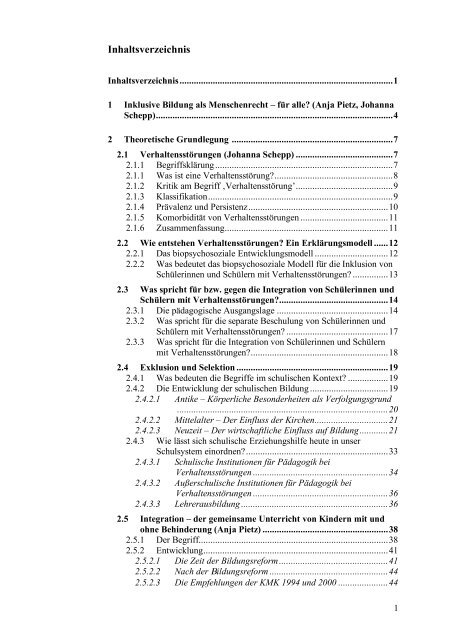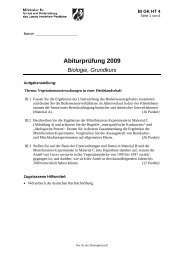Fertig AnjaJohanna-2 - Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel
Fertig AnjaJohanna-2 - Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel
Fertig AnjaJohanna-2 - Integrierte Gesamtschule Bonn-Beuel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis..........................................................................................1 1 Inklusive Bildung als Menschenrecht – für alle? (Anja Pietz, JohannaSchepp)....................................................................................................4 2 Theoretische Grundlegung ....................................................................7 2.1 Verhaltensstörungen (Johanna Schepp) .........................................7 2.1.1 Begriffsklärung...........................................................................7 2.1.1 Was ist eine Verhaltensstörung?..................................................8 2.1.2 Kritik am Begriff ‚Verhaltensstörung’.........................................9 2.1.3 Klassifikation..............................................................................9 2.1.4 Prävalenz und Persistenz...........................................................10 2.1.5 Komorbidität von Verhaltensstörungen .....................................11 2.1.6 Zusammenfassung.....................................................................11 2.2 Wie entstehen Verhaltensstörungen? Ein Erklärungsmodell ......12 2.2.1 Das biopsychosoziale Entwicklungsmodell ...............................12 2.2.2 Was bedeutet das biopsychosoziale Modell für die Inklusion vonSchülerinnen und Schülern mit Verhaltensstörungen? ...............13 2.3 Was spricht für bzw. gegen die Integration von Schülerinnen undSchülern mit Verhaltensstörungen?..............................................14 2.3.1 Die pädagogische Ausgangslage ...............................................14 2.3.2 Was spricht für die separate Beschulung von Schülerinnen undSchülern mit Verhaltensstörungen? ...........................................17 2.3.3 Was spricht für die Integration von Schülerinnen und Schülernmit Verhaltensstörungen?..........................................................18 2.4 Exklusion und Selektion ................................................................19 2.4.1 Was bedeuten die Begriffe im schulischen Kontext? .................19 2.4.2 Die Entwicklung der schulischen Bildung .................................19 2.4.2.1 Antike – Körperliche Besonderheiten als Verfolgungsgrund.........................................................................................20 2.4.2.2 Mittelalter – Der Einfluss der Kirchen...............................21 2.4.2.3 Neuzeit – Der wirtschaftliche Einfluss auf Bildung............21 2.4.3 Wie lässt sich schulische Erziehungshilfe heute in unserSchulsystem einordnen?............................................................33 2.4.3.1 Schulische Institutionen für Pädagogik beiVerhaltensstörungen .........................................................34 2.4.3.2 Außerschulische Institutionen für Pädagogik beiVerhaltensstörungen .........................................................36 2.4.3.3 Lehrerausbildung ..............................................................36 2.5 Integration – der gemeinsame Unterricht von Kindern mit undohne Behinderung (Anja Pietz) .....................................................38 2.5.1 Der Begriff................................................................................38 2.5.2 Entwicklung..............................................................................41 2.5.2.1 Die Zeit der Bildungsreform..............................................41 2.5.2.2 Nach der Βildungsreform ..................................................44 2.5.2.3 Die Empfehlungen der KMK 1994 und 2000 .....................44 1
2.5.2.3.1 Sonderpädagogische Förderung durch vorbeugendeMaßnahmen...................................................................45 2.5.2.3.2 Sonderpädagogische Förderung im gemeinsamenUnterricht ......................................................................46 2.5.2.3.3 Sonderpädagogische Förderung in Sonderschulen..........48 2.5.2.3.4 Sonderpädagogische Förderung in kooperativen Formen49 2.5.2.3.5 Sonderpädagogische Förderung im Rahmen vonSonderpädagogischen Förderzentren..............................49 2.5.2.3.6 Sonderpädagogische Förderung im berufsbildendenBereich und beim Übergang in die Arbeitswelt..............51 2.5.3 Heutiger Stand ..........................................................................52 2.6 Integrative Konzepte......................................................................53 2.6.1 Kooperation ..............................................................................54 2.6.2 Integrative Modelle in Deutschland...........................................55 2.6.3 Rahmenbedingungen für integrative Prozesse ...........................56 2.7 Integration von Schülerinnen und Schülern mitVerhaltensstörungen......................................................................58 2.7.1 Entwicklung der Schülerzahlen im Förderschwerpunktemotionale und soziale Entwicklung .........................................58 2.7.2 Forschungsstand zum gemeinsamen Unterricht mit Kindern mitdem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung...60 2.7.2.1 Das Projekt ‚emsoz’ ..........................................................62 2.7.3 Optimale Rahmenbedingungen integrativer Förderungverhaltensauffälliger Kinder......................................................65 2.7.4 Integrative Modelle im Förderschwerpunkt emotionale undsoziale Entwicklung ..................................................................67 2.7.5 <strong>Integrierte</strong> schulische Erziehungshilfe.......................................68 2.7.6 Ambulante schulische Erziehungshilfe......................................70 2.8 Blick auf Europa............................................................................71 2.8.1 Italien........................................................................................71 2.8.2 Dänemark .................................................................................72 2.8.3 Schweden..................................................................................72 2.8.4 Norwegen .................................................................................72 2.8.5 Deutschland ..............................................................................73 2.8.6 Zusammenfassung.....................................................................75 2.9 Inklusion.........................................................................................78 2.9.1 Die frühen Entwicklungen.........................................................79 2.9.2 Die Formung des Inklusionsbegriffs im internationalen Raum...80 2.9.3 Gründe für die Einführung des neuen Inklusions-Begriffs .........82 2.9.4 Kritische Betrachtung der Gründe für die Einführung desInklusionsbegriffs .....................................................................84 2.9.5 Was unterscheidet Inklusion von Integration? ..........................85 2.9.6 Erste Innovationen in Deutschland zur Erreichung einesinklusiven Schulsystems ...........................................................88 2.10 Zusammenfassung (Anja Pietz, Johanna Schepp)........................90 3 Hypothesen............................................................................................94 4 Praktische Grundlegung.......................................................................95 2
4.1 Methodik (Anja Pietz) ...................................................................95 4.1.1 Der Lehrerfragebogen ...............................................................95 4.1.2 Fragebogen zur Überprüfung der Rahmenbedingungen.............98 4.2 Die Einrichtungen (Johanna Schepp) ...........................................99 4.2.1 Die Burgschule in Frechen........................................................99 4.2.1.1 Integration an der Burgschule...........................................99 4.2.2 Förderschule und Kompetenzzentrum Berliner Straße.............100 4.2.2.1 Das Kompetenzzentrum ...................................................101 4.2.3 Die <strong>Gesamtschule</strong> <strong>Bonn</strong> <strong>Beuel</strong> (IGS) ......................................103 4.2.3.1 Integration an der IGS <strong>Bonn</strong> ...........................................104 4.3 Durchführung ..............................................................................105 4.4 Auswertung ..................................................................................105 5 Ergebnisse und Interpretationen .......................................................107 5.1 Darstellung der Ergebnisse..........................................................107 5.1.1 A: Integration/Inklusion von verhaltensauffälligen SchülerInnenan der Schule ..........................................................................108 5.1.2 B: Integration/Inklusion von verhaltensauffälligen SchülerInnenim Unterricht...........................................................................109 5.1.3 C: Persönliche Zufriedenheit...................................................111 5.1.4 Offene Frage: Würden Sie die Integration/ Inklusion an ihrerSchule als erfolgreich ansehen?...............................................112 5.1.5 Offene Frage: Rahmenbedingungen, die Sie noch als hilfreichempfinden würden ..................................................................113 5.1.6 Offene Frage: Denken Sie, dass man verhaltensauffälligeSchülerinnen und Schüler inkludieren kann bzw. halten Sie es fürsinnvoll? .................................................................................114 5.2 Überprüfung der ersten Hypothese.............................................115 5.3 Überprüfung der zweiten Hypothese ..........................................116 5.4 Überprüfung der dritten Hypothese ...........................................117 6 Ausblick – Inklusion: Realität oder Utopie? (Anja Pietz, JohannaSchepp)................................................................................................119 7 Reflexion .............................................................................................122 Literaturverzeichnis ..................................................................................123 Anhang.......................................................................................................134 3
1 Inklusive Bildung als Menschenrecht – für alle?Erstmals wird in einem Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationendem Inklusionsprinzip Rechtsqualität zugebilligt (vgl. Lindmeier 2008, S. 354).Zu Beginn des Jahres 2009 ratifiziert Deutschland die bereits 2006 verabschiedeteKonvention der Vereinten Nationen (UN) über die Rechte von Menschenmit Behinderung (vgl. ebd.; Wlaschek/ Michael 2010, S. 4). Seitdem gelten dasÜbereinkommen und das Fakultativprotokoll für die Bundesrepublik als verbindlich(vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2009, Internetquelle).Inklusion ist damit auch in Deutschland ein Menschenrecht. Das bedeutet,der Staat ist dafür verantwortlich, seine Gesetze so zu ändern, dass die Rechteder Konvention umgesetzt werden können.Mit Artikel 24, Inklusion in Bildung und Erziehung (‚education’), wird eininklusives Bildungssystem auf allen Ebenen gefordert. Schülerinnen und Schülerdürfen nicht vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden, imGegenteil muss Ihnen der Zugang zu einer inklusiven, qualitativen und unentgeltlichenBildung ermöglicht werden. Um dies zu realisieren, muss im allgemeinenBildungssystem die notwendige Unterstützung bereit gestellt werden:“Persons with disabilities receive the support required, within the general educationsystem, to facilitate their effective education” (United Nations, Article24, 2d, Internetquelle).Deutschland, bisher die soziale Exklusion von Kindern mit Behinderungen undsozialen Benachteiligungen praktizierend (siehe auch Kapitel 2.4), muss sichumstellen. Die Politik versucht den Eindruck zu erwecken, die bereits bestehendenintegrativen Konzepte müssten lediglich optimiert werden (vgl. Schumann2009, S. 52f., Internetquelle). Auch die kritisch zu sehende Übersetzungdes Begriffs ‚inclusion’ in ‚Integration’ trägt zu dieser Vermutung bei (sieheauch Kapitel 2.9). Trotzdem geschieht etwas. Eine befristete Arbeitsgruppe mitdem Namen ‚Sonderpädagogik’, die den Auftrag hat, die ‚Empfehlung zursonderpädagogischen Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland(1994)’ fortzuführen, wurde gegründet (vgl. Ministerium für Schule undWeiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2010e, Internetquelle). Einerseitssollen bestehende Strukturen überarbeitet werden um den Forderungen inArtikel 24 gerecht zu werden, andererseits sollen die Strukturen beibehaltenwerden. In einem Diskussionspapier der Arbeitsgruppe wird formuliert, dassman an den Begrifflichkeiten und der Systematik der Förderschwerpunkte so-4
wie der Schulform Förderschule festhalten möchte, gleichzeitig wird von dernotwendigen Zusammenarbeit der Pädagogik und der Sonderpädagogik gesprochen,der Begriff Inklusion wird konsequent verwendet und Vorteile wiewohnortnahe Beschulung werden betont (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildungdes Landes Nordrhein-Westfalen 2010e, Internetquelle).Für die Pädagogik bei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungenstellt sich die Frage, ob Inklusion überhaupt sinnvoll und möglich ist. Zwargibt es Studien, die belegen, dass neben anderen Förderschülern auch von derProblematik der Verhaltensstörungen betroffene Kinder von dem GemeinsamenUnterricht (GU) profitieren (vgl. Klemm/ Preuss-Lausitz 2008, S. 14ff.,Internetquelle), es ist jedoch auch unumstritten, dass diese Schülerinnen undSchüler spezielle Rahmenbedingungen für eine positive Entwicklung benötigen(vgl. ebd., S. 52f.).Um der Frage nachzugehen, ob eine inklusive Beschulung verhaltensauffälligerSchülerinnen und Schüler realistisch ist, werden wir in der Arbeit beginnenddas Phänomen Verhaltensstörung vorstellen um zu diskutieren, welche Argumentefür und gegen eine gemeinsame Beschulung sprechen. Um eine geeigneteGrundlage für die Auseinandersetzung mit der Thematik der schulischenInklusion zu schaffen, werden in den folgenden Kapiteln die mit Inklusion zusammenhängendenBereiche Selektion und Integration vorgestellt. Dazu gehörtjeweils die historische und theoretische Auseinandersetzung wie auch dieWahrnehmung aktueller Strömungen von und Diskussionen um Separation,Integration und Inklusion. Unter ‚Integration’ werden konkrete Rahmenbedingungenfür die erfolgreiche integrative Beschulung von Kindern und Jugendlichenmit Verhaltensauffälligkeiten aufgelistet. Im praktischen Grundlagenteilwerden die Methodik und unser Vorgehen erläutert. Für unsere Untersuchunghaben wir uns entschlossen, Lehrerinnen und Lehrer zu befragen, da dies die‚praktischen Experten und Expertinnen‘ sind. Aufgrund ihrer Erfahrung undder Tatsache, dass sie diejenigen sind, die die Konzepte zur Inklusion umsetzen,halten wir ihre Einschätzung für unumgänglich und wegweisend. Dabeiist die Meinung von sonderpädagogisch qualifiziertem Personal genauso wichtigwie die der Regelschullehrkräfte, da in einem Inklusiven System beide Qualifikationengebraucht werden. Anschließend werden Ergebnisse der Befragungpräsentiert und die Frage diskutiert, ob die Auflösung der Förderschule für e-motionale und soziale Entwicklung zugunsten von Inklusion sinnvoll ist.5
Begrifflicher HinweisIn dieser Arbeit werden bei Begriffen immer die feminine wie auch die maskulineForm verwendet. Wenn an Textstellen nur eine Form verwendet wird, sodient dies der besseren Lesbarkeit. Es sind dann jedoch immer beide Gruppengemeint.6
2 Theoretische GrundlegungIm theoretischen Grundlagenteil werden wir das Phänomen der Verhaltensstörungerläutern und aufzeigen, wie die Gesellschaft versucht, diesem in Exklusion,Separation und Integration mit entsprechenden Beschulungsformen gerechtzu werden. Dabei werden begriffliche, historische und konzeptionelleGrundlagen der Beschulungen mit einbezogen. Anschließend werden Inklusionsowie Unterschiede zu Integration vorgestellt, bevor in der Zusammenfassungnoch einmal resümiert wird, was gelungene Inklusion ausmacht und wie Schülerinnenund Schüler mit Verhaltensstörungen im inklusiven System zu beschulensind.2.1 VerhaltensstörungenDa diese Arbeit die Inklusion von verhaltensauffälligen Schülerinnen undSchülern thematisiert, soll geklärt sein, welche Schüler und Schülerinnen diesemPhänomen entsprechen und welche Besonderheiten in der Arbeit mit entsprechendenKindern und Jugendlichen zu beachten sind.2.1.1 BegriffsklärungFür das Phänomen Verhaltensstörung gibt es zahlreiche Begriffe, von erziehungsschwierigüber psychopathisch oder verhaltensbehindert bis hin zu emotionalgestört oder verhaltensauffällig (vgl. Hillenbrand 2006, S. 28; Hillenbrand2008, S. 7f.). Der Begriff der Verhaltensstörung hat sich in der Diskussionum einen Terminus aus verschiedenen Gründen durchgesetzt, weshalber auch in dieser Arbeit für die theoretische Grundlegung verwendet wird. Erermöglicht die gemeinsame Verständigung verschiedener wissenschaftlicherArbeitsgebiete, da er nicht nur in pädagogischen Kontexten sondern auch in derKlinischen Psychologie sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie verwendetwird. Zusätzlich ist er eindeutig zu übersetzten (z.B. behaviour disorder) undsomit international verwendbar, was sich ebenfalls positiv auf die Kommunikationauswirkt (vgl. ebd., S. 8f.).Trotz dieser Vorteile schlagen Opp und Unger (vgl. 2003, S. 54) den Begriffder Gefühls- und Verhaltensstörung vor, der ihrer Ansicht nach den engen Zusammenhangvon Kognition, Emotion, subjektivem Erleben und Verhaltenfokussiert. In ihrem Artikel ist eine sehr umfassende Definition des größten7
amerikanischen Fachverbandes vorgestellt (für mehr Informationen vgl. Opp/Unger 2003, S. 55).Wir haben uns im Titel unserer Untersuchung für die Verwendung des Begriffsder ‚Verhaltensauffälligkeiten’ entschlossen, da er theoretisch als neutraler imVergleich zum Begriff ‚Verhaltensstörungen’ gilt und diejenigen mit eingeschlossensind, die das Verhalten aufgrund ihrer Wahrnehmung beurteilen (vgl.Bach 1993, S. 9f.). Da Lehrereinschätzungen erfragt wurden, spielt die subjektiveWahrnehmung von Verhalten eine große Rolle. Aufgrund der Neutralitätdes Begriffs erhoffen wir uns, möglichen Beeinflussungen durch terminologischeInformationen vorzubeugen.Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, verwenden wir in der gesamtenArbeit mehrere Begriffe (Verhaltensauffälligkeit, Probleme in der emotionalenund sozialen Entwicklung), die wir mit Verhaltensstörungen synonym verwenden.2.1.1 Was ist eine Verhaltensstörung?Im Handbuch der Sonderpädagogik definiert Bach ‚Verhaltensstörung’ wiefolgt:Unter Verhaltensstörung soll die Art des Umgang eines Menschen mit anderen, mitsich selbst und mit Sachen verstanden werden, die von der erwarteten Handlungsweisenegativ abweicht, indem sie als sinnvolle Zustände oder Handlungsabläufe, Zusammenlebenoder individuale Entwicklung gefährdend, beeinträchtigend oder verhinderndangesehen wird. (1993, S. 6, Hervorhebung im Original)Bach bezieht damit die persönliche Wahrnehmung eines Beurteilers mit ein.Das gezeigte Verhalten wird somit in Relation zu der entsprechenden Erwartunggesetzt, womit die Störung erst durch den Zusammenhang mit dem Betrachterin der Situation entsteht (vgl. ebd.).Eine verbreitetere Definition hat Myschker vorgelegt. Seine Definition istgründlich entwickelt und sehr umfassend (vgl. Hillenbrand 2008, S. 10f.):Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendesmaladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingtist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-,Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umweltbeeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht odernur unzureichend überwunden werden kann. (Myschker 2005, S. 45, zit. nach Hillenbrand2008, S. 10f.)Myschkers Definition berücksichtigt fünf Ebenen (Phänomen, Ursache, Klassifikation,Konsequenzen für betroffene Personen, Forderung nach Hilfen) undspiegelt so den komplexen Charakter des Phänomens der Verhaltensstörung8
wieder (vgl. Hillenbrand 2006, S. 31). Wie auch bei Bach, wird das Verhaltenbzw. eine Störung als abhängig von spezifischen Normen und Erwartungenvon Beobachtern gesehen. Die Definition kommt so der Forderung nach, denBegriff nicht als Wertung einer Person zu verstehen, sondern als Kennzeichnungder personenbezogenen Verhaltensweisen (vgl. ebd., S. 29).2.1.2 Kritik am Begriff ‚Verhaltensstörung’Trotz der verbreiteten Anwendung bleibt der Begriff der Verhaltensstörungnicht ohne Kritik. Schlee nennt vier Kritikpunkte:1. Heimliche Wertigkeit2. Unklarer Objektbereich3. Prinzip der Selbstanwendung4. Unterschiedliche Menschenbildannahmen (Schlee 1993, S. 40ff.).Die begriffstheoretischen wie auch moralisch begründeten Unzulänglichkeitendes Begriffs ‚Verhaltensstörung’ gelten auch für die Parallel- und Partialbegriffe(Verhaltensauffälligkeiten, Erziehungsschwierigkeit, gemeinschaftsschwierigetc.). Folglich können die Defizite der Terminologie nicht mit einem einfachenWechsel behoben werden (vgl. ebd., S. 44).Die Kultusministerkonferenz (KMK) möchte die Begriffsproblematik umgehen,indem sie von Kindern und Jugendlichen mit dem ‚Förderschwerpunktsoziale und emotionale Entwicklung’ spricht (vgl. Opp 2009, S. 227).2.1.3 KlassifikationUnter dem Begriff ‚Verhaltensstörung’ sind viele verschiedene Verhaltensweisenzusammengefasst (vgl. Hillenbrand 2006, S. 36). ICD-10 (InternationalClassification of Deseases, 10. Version) der Weltgesundheitsorganisation undDSM-IV (Diagnostic and Statistic Manual) der Amerikanischen Gesellschaftfür Psychiatrie sind zwei weltweit anerkannte kategoriale Klassifikationssysteme,die Verhaltensweisen medizinisch einordnen (vgl. Becker/ Schmidt2008, S. 35; Holtmann/ Schmidt 2008, S. 25). Daneben gibt es die Möglichkeitder dimensionalen Klassifizierung. Hierbei gehen Diagnostiker davon aus, dasssich psychische Auffälligkeiten als gleich verteilte Merkmale darstellen, welcheÜbergänge zwischen normalen und unnormalen psychischen Erscheinungenbeinhalten. So lässt sich das Verhalten von Kindern und Jugendlichen ambeobachtbaren Symptom beschreiben (vgl. ebd., S. 25).9
Myschker nennt vier Bereiche von Verhaltensstörungen, von denen besondersdie beiden erstgenannten empirisch gut belegt sind (vgl. Hillenbrand 2006, S.36f.):1. Externalisierende Störungen: Aggression, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörungen,Impulsivität.2. Internalisierenden Störungen: Angst, Trauer, Minderwertigkeit,Schlafstörungen, Interesselosigkeit, somatische Störungen.3. Sozial unreifes Verhalten: Konzentrationsschwäche, altersunangemessenesVerhalten, schnelle Ermüdung, Leistungsschwäche, fehlendeBelastbarkeit.4. Sozialisiert delinquentes Verhalten: Gewalttätigkeit, Reizbarkeit,Verantwortungslosigkeit, leichte Erregbarkeit und Frustration, Beziehungsstörungen,niedrige Hemmschwelle (vgl. Myschker 2005,S. 52, zit. nach Hillenbrand 2006, S. 36f.).Jungen mit Verhaltensstörungen zeigen eher externalisierendes, Mädchen dagegeninternalisierendes Verhalten, was auch erklärt, warum mehrheitlich Jungenin der Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeitenzu finden sind. Externalisierende Störungen fallen schneller auf als internalisierende,die im normalen Schulalltag wenig bis keine Probleme für das Umfeldverursachen (vgl. Hillenbrand 2006, S. 37).2.1.4 Prävalenz und PersistenzPrävalenz (Häufigkeit) und Persistenz (Stabilität) begründen notwendige Maßnahmenin der Erziehungshilfe. Bereits Kinder im Vorschul- sowie im Primarbereichsind von Verhaltensauffälligkeiten betroffen und das Risiko für dieEntwicklung, grade bei früh auftretenden externalisierenden Störungen, ist empirischbestätigt. Nicht nur Intervention sondern vor allem Prävention gewinntsomit an Bedeutung (vgl. Hillenbrand/ Hennemann 2006, S. 42).Insgesamt gehen die Zahlen verhaltensauffälliger Kinder und Jugendlicherstark auseinander (vgl. Hillenbrand 2006, S. 37f.). Opp fasst wichtige Studienzusammen und nennt eine Häufigkeit von 16 - 20% auftretender Verhaltensstörungenbei 10- bis 16-Jährigen in Deutschland. Eine deutliche Anhäufung vonRisikofaktoren ist bei Kindern aus ärmeren Familien belegt worden. Dabeifinden sich in risikoreichen Umfeldern von Kindern gleichzeitig die wenigstenRessourcen für eine unproblematische Entwicklung (vgl. Opp 2009, S. 229f.).10
Opp sieht Verhaltensstörungen nicht nur als symptomatisches Problem einesKindes, sondern auch als Ausdruck des entsprechend wenig optimalen Umfeldes„oder eben auch gesellschaftlicher Ausgrenzungserfahrungen“ (Opp 2009,S. 230). Unter diesem Gesichtspunkt sollte man gelungene Inklusion als sinnvollePrä- oder Interventionsmaßnahme sehen.Mehreren Längsschnittstudien in verschiedenen Ländern zufolge weisen Verhaltensstörungeneine Persistenzrate von bis zu 50% auf (vgl. Ihle/ Esser 2008,S. 56). Die Risikomöglichkeit von sozialen, kulturellen und materiellen Faktorenist ausreichend belegt. Vor allem früh ausgeprägtes aggressives Verhaltenist mit einer ungünstigen Prognose belegt und wird mit erhöhter Komorbiditätin Zusammenhang gebracht (vgl. Opp 2009, S. 230).Sowohl Hillenbrand (vgl. 2006, S. 38) als auch Opp (vgl. 2009, S. 230) gehendavon aus, dass ein Großteil der betroffenen Schülerinnen und Schüler wedermedizinisch noch heilpädagogisch versorgt ist.2.1.5 Komorbidität von VerhaltensstörungenHäufig treten Lern- und Verhaltensstörungen gemeinsam auf. Dabei ist oftnicht zu erkennen, welche Störung sich zuerst manifestiert hat, da zwischenbeiden ein Bedingungszusammenhang besteht. Wenn Verhaltensstörungen imZusammenhang mit anderen Behinderungen auftreten, sind sie häufig sekundär,also erst aufgrund der Reaktionen des Umfelds entstanden (vgl. Myschker2005, S. 63). Dies zeigt, dass sich positive soziale Erfahrungen, die in gelungenerInklusion gefördert werden könnten, positiv auf das Verhalten auswirkenkönnen.2.1.6 ZusammenfassungVerhaltensstörungen können sehr unterschiedliche Formen annehmen. ExternalisierendeStörungen fallen Beobachtern direkt auf. Sind sie dagegen internalisierend,bereiten sie dem Umfeld im schulischen Kontext wenige Probleme.Die Prävalenz- und Persistenzraten zeigen, dass das Phänomen der Verhaltensstörungein ernstzunehmendes Problem darstellt. Vor allem wenn sie früh inder Entwicklung des Kindes beginnt, ist ein stabiler Verlauf prognostiziert. DieTatsache, dass negative Erfahrungen mit dem Umfeld Verhaltensstörungenbegünstigen oder stabilisieren, ist ein wichtiges Argument, Schülerinnen undSchüler inklusiv zu beschulen, so dass Ausgrenzungserfahrungen vermieden11
werden können. Unbedingt erforderlich ist hierbei eine gelungene Inklusion,um die Stigmatisierungsproblematik nicht einfach zu verlagern. Was genaugelungene Inklusion ausmacht, wird am Ende der theoretischen Grundlegungerläutert.2.2 Wie entstehen Verhaltensstörungen? Ein ErklärungsmodellWissenschaftlich legitimierte Erklärungsmodelle sind wichtig, um Interventionenbegründen und nachvollziehen zu können. Je nach wissenschaftlichemStandpunkt gibt es verschiedene Erklärungen zu der Entstehung von Verhaltensstörungen.Im Folgenden wird das biopsychosoziale Entwicklungsmodellvon Beelmann (2000, modifiziert nach Lösel/ Bender 1997) vorgestellt. Esentstand aus einem multiplen Forschungsansatz und kann daher ein komplexes,mehrdimensionales Ergebnis vorweisen, weshalb Hillenbrand es für zukunftsfähigerklärt (vgl. Hillenbrand 2008, S. 18).2.2.1 Das biopsychosoziale Entwicklungsmodelllungstheoretischen Bereich der kindlichen Entwicklung zu integrieren. Risiko-Multi-Problem-MilieuPsychopathologie der Eltern,Familiäre Konflikte,Defizite der ErziehungskompetenzAblehnung durch Gleichaltrige,problematische soziale Erfahrungen/Bindungen,Anschluss andeviante PeergruppenSchwangerschafts-undGeburtskomplikationenSchwierigesTemperament,ImpulsivitätGeringe soziale KompetenzOppositionelles undaggressives VerhaltenVerzerrte soziale InformationsverarbeitungOffenes undverdecktesdissozialesVerhalten,frühe KriminalitätundGewaltKriminalität,PersistentdissozialerLebensstilGenetischeFaktoren,neurologischeBeeinträchtigungenKognitive EntwicklungsdefiziteAufmerksamkeitsprobleme,HyperaktivitätSchulische Probleme, geringeQualifikationen, Probleme inArbeit und BerufGeburt Frühe Kindheit Mittlere Kindheit Jugendalter/ Junge ErwachseneAbb. 1: Kumulatives Entwicklungsmodell persistent dissozialer Entwicklungen (Beelmann2000, modifiziert nach Lösel/ Bender 1997, zitiert nach Hillenbrand 2008, S. 19)Das abgebildete Modell (Abb. 1) gehört zu den transaktionalen Entwicklungsmodellen,da es versucht, sowohl den biologischen, sozialen als auch hand-12
faktoren können aus allen drei Bereichen auf das Kind und die Entwicklungeinwirken. Die Abbildung wichtiger Lebensabschnitte des Kindes macht deutlich,dass die möglichen Risiken von den entsprechenden altersbezogenen Veränderungenbeeinflusst werden und umgekehrt. Es spiegelt die Vielfalt undInterdependenz der Entwicklung des Kindes wider. Zu beachten ist, dass sozialeund biologische Prozesse relativiert werden, sobald die selbstgesteuerteEntwicklungsregulation des Kindes mit der fortschreitenden Entwicklung zunimmt(vgl. Hillenbrand/ Hennemann 2005, S. 136f.). Nach Hillenbrand/ Hennemannwird „Entwicklung […] damit zum Ergebnis komplexer Regulationsprozesseund ist selbst wieder Anstoß für neue Entwicklungen“ (2005, S. 37).2.2.2 Was bedeutet das biopsychosoziale Modell für die Inklusionvon Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensstörungen?Das Modell zeigt Risikofaktoren auf, die umgekehrt auch als Resilienzen gesehenwerden können. Grade im sozialen und handlungstheoretischen Bereichlassen sich Chancen erkennen, die Regulationsprozesse durch die Stabilisierungvon Widerstandskräften zu beeinflussen.In der Schule können vor allem die handlungstheoretischen Aspekte beeinflusstwerden. Verhaltenstheoretische Modelle, welche wie das beschriebene Modelllegitimiert sind, gehen davon aus, dass Verhalten erlernt ist und somit auchVerhaltensstörungen in Lernprozessen angeeignet werden (vgl. Hillenbrand2006, S. 70). Wenn Kinder mit Verhaltensstörungen zusammen mit Kindernbeschult werden, die wenig bis keine Probleme in der Interaktion mit ihrenMitschülern haben, oder sogar Stärken in dem Bereich zeigen, besteht dieChance, dass das positive Verhalten imitiert und übernommen wird. Mit positivenErfahrungen könnten die im kumulativen Modell enthaltenen Aspekte ‚geringesoziale Kompetenz’, ‚oppositionelles und aggressives Verhalten’ sowie‚verzerrte soziale Informationsverarbeitung’ positiv beeinflusst werden. Wieoben beschrieben, macht das Modell die komplexen Zusammenhänge der kindlichenEntwicklung deutlich. Durch die Komplexität kann der positive Effektdes imitierenden Lernens auf zusammenhängende Aspekte ausgesehnt werden.Gelingt es, schützende Faktoren der Kinder zu fördern und stabilisieren, kannder Einfluss negativer Faktoren gemindert werden.Allerdings müssen die notwendigen positiven Erfahrungen gesichert sein, dasonst die Gefahr besteht, dass die Interaktion des Kindes aufgrund seiner ein-13
geschränkten sozialen Kompetenzen und fehlerhaften Informationsverarbeitungweiterhin negativ geprägt ist. In den Empfehlungen der KMK wird angemerkt,dass Schülerinnen und Schüler angemessene Interventionen der Lehrkräftesowie anderer beteiligter Personen benötigen, um das emotionale Erlebenund soziale Handeln in Konfliktsituationen nicht negativ zu verstärken(vgl. KMK 2000, S. 7, Internetquelle).2.3 Was spricht für bzw. gegen die Integration von Schülerinnen undSchülern mit Verhaltensstörungen?Bevor der Frage nachgegangen wird, welche Förderung für Kinder und Jugendlichemit Verhaltensstörungen geeigneter ist, wollen wir zunächst klären,was diese Schüler charakterisiert.2.3.1 Die pädagogische AusgangslageWie bereits im biopsychosozialen Modell zu erkennen ist, sind Verhaltensstörungenmultifaktoriell bedingt. Auch die KMK betont die Wechselwirkung derverschiedenen Faktoren, die eine Verhaltensstörung bzw. die emotionale undsoziale Entwicklung beeinflussen. Verhaltensstörungen unterliegen Entwicklungsprozessen,die nicht auf unveränderliche Eigenschaften der Persönlichkeitdes Kindes zurückzuführen sind, sondern als Folge von Interaktionsprozessenmit den verschiedenen Umfeldern anzusehen ist. Ziele pädagogischer Arbeitsind daher die Veränderung innerer Verhaltensmuster, so dass eine Anpassungan äußerer Bedingungen sowie die Unterstützung der Entwicklung emotionalerund sozialer Fähigkeiten möglich ist (vgl. ebd., S. 4f.). Bedingt sind diese Verhaltensmusterdurch verschiedene Ebenen.Persönliche EbenePersönliche Eigenschaften sind ebenfalls in Abhängigkeit des Umfeldes zubetrachten. Hierzu gehören „Selbstwertgefühl, Ich-Stärke, Sicherheit, Selbstverantwortung,Impulskontrolle, Stetigkeit und Verlässlichkeit, Entwicklungvon Lebensmut und Zukunftsperspektive, Realitätssinn“ (ebd., S. 5). Vor allemwidersprüchliche Erfahrungen beeinflussen die Selbst- und Fremdwahrnehmung,aber auch Über- und Unterschätzung eigener Kompetenzen stellen Problemeim alltäglichen Leben dar. Durch verschiedenste Erfahrungen und Erlebnisse(Angst, Hilflosigkeit, Armut, sozialer Ausschluss, emotionale Überforde-14
ung, Trennungsängste, sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, etc.) entwickelnKinder externalisierende oder internalisierende Verhaltensweisen, die imschlimmsten Fall zu psychosomatischen oder psychischen Erkrankungen führen(vgl. KMK 2000, S. 5f., Internetquelle).Familiäre EbeneFamiliäre Probleme und Verhaltensweisen können hohe Belastungsfaktoren fürdie Entwicklung eines Kindes darstellen. Hierzu gehören Partnerschaftsproblemeder Eltern, Inkonsequenz und Unberechenbarkeit des Verhaltens der Eltern,ungeklärte Familientabus bei Krankheit und Sucht sowie Arbeitslosigkeitund Straffälligkeit. Solche Gegebenheiten verweigern Kindern Geborgenheit,Zuwendung, Sicherheit und angemessene Versorgung. Auch Überbehütung,eine unsichere Bindung oder geringes Zutrauen in das Kind können die sozialeund emotionale Entwicklung beeinträchtigen. Zusätzliche traumatische Erlebnissewie Vertreibung, Tod oder Unfälle können den Entwicklungsprozess weitereinschränken oder zeitweilig stoppen (vgl. ebd., S. 6).Schulische EbeneHohe Ablenkbarkeit sowie kurze Konzentrationsspannen hängen mit der geringenMotivation der Schülerinnen und Schüler zusammen. Übereifer und spontaneArbeitsbereitschaft klingen schnell wieder ab und werden durch Mutlosigkeitund Enttäuschung ersetzt. Auch das Lerntempo und die Belastbarkeit unterliegenstarken Schwankungen. Die Forderung nach Aufmerksamkeit ist typischfür Schülerinnen und Schüler mit diesem Förderbedarf. Aufgrund vonanstrengenden Interaktionsprozessen sowie der Komorbidität mit Sprach- undLernstörungen ist die schulische Leistungsfähigkeit teilweise erheblich eingeschränkt.Unklare Regeln, persönliche Entwertungen, Über- und Unterforderungenim Leistungsbereich, Strafen ohne Beziehung zur Tat oder unbegründeteBeschuldigungen lösen bei verhaltensauffälligen Kindern affektive Reaktionenaus. Der Einfluss subjektiver Wahrnehmung erschwert die Klärung vonKonflikten häufig.Regelverstöße und unangemessenes Verhalten bringen die Schülerinnen undSchüler häufig in eine soziale Außenseiterposition. Innere Spannungen wirkensich auf die Psycho-Motorik aus, die Anfälligkeit für Krankheiten oder Substanzmissbrauchsowie permanente innere Unruhe können externalisierend15
auftreten. Internalisierende Lösungen werden häufig falsch gedeutet bzw. alsvom Umfeld nicht störend wahrgenommen (vgl. KMK 2000, S. 7f., Internetquelle).Gesellschaftliche EbeneDa die oben beschriebenen Bereiche von gesellschaftlichen Rahmenbedingungenbeeinflusst werden können, ist auch dieses Gebiet von Bedeutung. Diefinanzielle Situation einer Familie kann weitreichende Folgen haben. Bei geringerfinanzieller Ausstattung haben die Kinder unzureichend Möglichkeiten,am konsumorientierten Leben teilzunehmen, so dass sie sich aus Freundeskreisenund Vereinen zurück ziehen. Auf diese Weise verlieren sie Möglichkeiten,soziale Erfahrungen zu sammeln und wichtige Bindungen einzugehen. DasWohnumfeld kann mit fehlenden Spiel- und Bewegungsräumen die Bewegungs-und Gruppenerfahrungen mindern.Unkontrollierter Medienkonsum kann für die Kinder und Jugendlichen eineständige Überforderung darstellen und zusätzlich die eigene normative Unsicherheitstärken, indem Gewalt, Kriminalität und Sucht als alltäglich undselbstverständlich abgebildet werden. Die undifferenzierten und beliebig dargestelltenNormen erschweren oder behindern den Aufbau eines eigens gefestigtenWertesystems. Zusätzlich wird eine aggressionsfreie Selbststeuerung derKinder durch die Gewaltbereitschaft der Gesellschaft oder eigene Gewalterfahrungenerheblich beeinträchtigt.Dadurch, dass Drogen eine Fluchtmöglichkeit aus der Realität darstellen, zueinem angesehenen Status in der Peer-Gruppe verhelfen und gleichzeitig helfen,den Gruppendruck zu bewältigen, sind verhaltenssauffällige Kinder durchSubstanzmissbrauch besonders gefährdet. Durch den Missbrauch ergeben sichweitere Probleme, wie zum Beispiel Missachtung von Regeln und Normensowie Beschaffungskriminalität. Daher muss die Schule für die effektive Förderungvon entsprechenden Schülerinnen und Schülern mit außerschulischenInstitutionen zusammenarbeiten. Neben Jugendhilfe und therapeutischen Einrichtungenzählen dazu auch Polizei und Strafvollzug (vgl. ebd., S. 8f.).ZusammenfassungDie Wechselwirkungen von verschiedenen Faktoren verschiedener Bereichestellen Risikofaktoren für die gesunde Entwicklung eines Kindes dar. Sie müs-16
sen dabei nicht zwangsläufig zu einer Verhaltensstörung führen, sind aber alsRisiko anzusehen. Gravierender sind fehlerhafte Kommunikationsstruktureninnerhalb der Familie sowie die Verarbeitung äußerer Lebensumstände. Gewalt,Missbrauch, Missachtung, Vernachlässigung etc. erschweren die Lebensumständeund wirken somit negativ auf die Entwicklung des Kindes ein (vgl.Preuss-Lausitz 2004, S. 13). „Bei der Analyse der Biografien von Kindern mitVerhaltensproblemen zeigt sich, dass diese […] häufig aus desorientierten, imErziehungsverhalten widersprüchlichen und hilflosen oder aus gewalttätigenHaushalten kommen“ (ebd.).Wie diese Kinder am besten beschult und gefördert werden können, wird in derWissenschaftlich kontrovers diskutiert. Dabei gibt es Befürworter und Befürworterinnensowohl für Separation als auch für Integration.2.3.2 Was spricht für die separate Beschulung von Schülerinnen undSchülern mit Verhaltensstörungen?Viele Fachleute sind der Meinung, die beschriebene pädagogische Ausganglageverlange sowohl die Kenntnis um die Ursachen von Verhaltensstörungen alsauch ein Repertoire an Interventionsmöglichkeiten bei Verhaltensstörungen,und legitimieren somit die Förderschule für den Förderschwerpunkt sozialeund emotionale Entwicklung. Unumstritten ist, dass Lehrkräfte für den Umgangmit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern besondere <strong>Fertig</strong>keitenbenötigen (vgl. Hillenbrand 2003, S. 22).Auch die KMK Empfehlungen sagen aus, dass die allgemeinpädagogischenMethoden und sonderpädagogischen Maßnahmen aufgrund von „stark reduzierterGruppenfähigkeit, ausgeprägter Schulmüdigkeit, sich wiederholenderMisserfolgserlebnisse, fehlender Lernmotivation, Perspektivlosigkeit oder erheblicherLern- und Leistungsprobleme“ (KMK 2000, S. 10, Internetquelle)nicht ausreichen. Das Schulministerium NRW argumentiert, dass verhaltensauffälligeSchülerinnen und Schüler aufgrund von Ablehnung der Mitschülerinnenund Mitschüler Hilfen benötigen, um ihre Umwelt angemessen wahrnehmenzu können, akzeptierte Verhaltensweisen zu entwickeln und ein positivesSelbstbild aufbauen zu können (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildungdes Landes Nordrhein-Westfalen 2010c, Internetquelle).Diese Argumente reichen jedoch nicht aus, um eine separate Beschulung im‚Schonraum Förderschule’ zu rechtfertigen. Hillenbrand nennt eine Reihe von17
Argumenten, die dagegen sprechen, unter anderem, dass sich ein eigenständigesProfil von der genannten Förderschule kaum empirisch nachweisen lässt(vgl. Hillenbrand 2003, S. 22f.). Dazu kommen negative Effekte des Besuchseiner Förderschule, wie z.B. Stigmatisierung, fehlende kognitive Anregungen,mangelnde positive Modelle, ungünstigere Bildungs- und Berufschancen sowieAbbau pädagogischer Kompetenzen der Regelschule (vgl. ebd., S. 232). AuchPreuss-Lausitz weist darauf hin, dass „es zur Arbeit in den Schulen für Erziehungshilfekeinerlei quantitative Evaluationsstudien für die emotionale, sozialeund leistungsmäßige Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler gibt, die dieseAussonderung rechtfertigen könnte“ (2005, S. 19, Hervorhebungen im Original).Damit wird dem allgemeinen Schulsystem die Verantwortung übertragen,was auch der Deutsche Bildungsrat bereits 1974 in seinem Gutachten festhielt(vgl. Bittner/ Ertle/ Schmid 1974, S. 91).2.3.3 Was spricht für die Integration von Schülerinnen und Schülernmit Verhaltensstörungen?Aus der Kritik heraus ergibt sich die Forderung nach integrativen Formen derFörderung (vgl. Stein/ Stein 2006, S. 62f.). Im Gegensatz zu den negativenEffekten der separaten Beschulung sind diese bei der Integration als positiveEffekte zu sehen, wie z.B. Modelle um angemessenes Verhalten einzuüben,positiver sozialer Gruppendruck, Vermeidung von Etikettierung (vgl. ebd., S.63; Hillenbrand 2003, S. 232). In Kapitel 2.1.7. haben wir die positiven Wirkungenvon Integration bereits angesprochen. Für wesentlich halten Stein undStein die veränderte Sichtweise auf das Phänomen Verhaltensstörungen. Verhaltensstörungenwerden in Interaktion mit Personen und Situation betrachtet,anstatt wie zuvor einseitig dem Schüler zugeschrieben. Diese kontextbezogeneSichtweise erfordert eine Förderung, die nicht nur außerhalb des betroffenenSettings stattfindet (vgl. Stein/ Stein 2006, S. 63). Auch Hillenbrand hält dieintegrative Beschulung für die Form, die dem Phänomen am ehesten gerechtwird (vgl. Hillenbrand 2003, S. 232). Integration ermöglicht neben angemessenenEntwicklungsanreizen und Lernimpulsen (vgl. Eberwein/ Mand 2008, S.7f.) zusätzlich eine wohnortnahe Beschulung, die den Vorteil hat, dass eineFörderung kurzfristiger und effektiver organisiert werden kann als bei Schulenmit weiten Einzugsgebieten (vgl. KMK 2000, S. 22, Internetquelle).18
Problematisch bei der Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensstörungenist, dass diese, aufgrund von mangelnden sozialen Kompetenzen,von Mitschülern häufig als unbeliebt eingestuft werden, wie mehrere Studiengezeigt haben (vgl. Eberwein/ Mand 2008, S. 10). Kinder, die abweichendesVerhalten zeigen, bringen schlechte Bedingungen für Integration mit. EmpirischeStudien in den USA belegten u.a., dass integrative Schülerinnen undSchüler im Vergleich zu separat geförderten Schülerinnen und Schülern einschlechteres Selbstkonzept zeigen (vgl. Hillenbrand 2003, S. 232). Dagegenkonnte Preuss-Lausitz in einer aktuellen Studie in Berlin zahlreiche Hinweiseentdecken, die bei allen Schülerinnen und Schülern zur Verbesserung des Verhaltensund der Stärkung des Selbstbildes beitragen. Somit konnten Ansätzegefunden werden, die eine gelungene Integration von verhaltensauffälligenKindern möglich macht (vgl. Preuss-Lausitz 2005, S. 260).2.4 Exklusion und SelektionWer sich mit den Themen Integration und Inklusion in unserem Schulsystembeschäftigt, stößt in der Auseinandersetzung immer auch auf die Begriffe Selektionbzw. Segregation und Exklusion (vgl. Bürli 1997, S. 63f). Aus diesemGrund werden wir sie im Folgenden näher betrachten.2.4.1 Was bedeuten die Begriffe im schulischen Kontext?Exklusion bedeutet die Phase, in der bestimmte Personen von Bildung und Erziehungvöllig ausgeschlossen werden, Selektion bezieht zwar alle Menschenmit ein, sortiert sie aber nach bestimmten Kriterien. In dem Bereich der Bildungstellen Leistung und die soziale Herkunft Merkmale dar, nach denen sortiertwird. Je nachdem werden Kinder und Jugendliche für mehr oder wenigernormal befunden und auf entsprechende Institutionen verteilt (vgl. Boban/ Hinz2004, S. 4f., Internetquelle).2.4.2 Die Entwicklung der schulischen BildungDer geschichtliche Rückblick ist notwendig, um die Entstehung unseres selektivenSchulsystems nachvollziehen zu können und trägt dazu bei, aktuelle Prozessezu verstehen (vgl. Hillenbrand 2006, S. 44). Das Wissen um die Geschichteist somit Voraussetzung für das Verständnis aktueller Entwicklungs-19
prozesse sowie für die intensive Beschäftigung mit schulischer Integration undInklusion.Da Förderschulen zum allgemeinen Bildungswesen gehören, werden wir dieheilpädagogische Geschichte verknüpft mit der Entwicklung der allgemeinenSchule unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Zusammenhänge darstellen.2.4.2.1 Antike – Körperliche Besonderheiten als VerfolgungsgrundExklusion, die schon früh in der Geschichte der Menschheit anfängt, lässt sichnoch im letzten Jahrhundert beobachten. Lediglich zwei Ausnahmen sind zufinden. Die Ägypter zeigen sich aus Glaubensgründen ehrfurchtsvoll gegenüberMenschen mit Behinderungen. In Mesopotamien (ca. 5000 v. Chr.) sindbehinderte Menschen sogar beruflich vollständig anerkannt. Die Normalität istjedoch die Ausgrenzung von behinderten Menschen. Exklusion bezieht sichzunächst auf Einstellungen und Reaktionen, welche von der Abwehr über dieVerfolgung bis hin zur Vernichtung reichen (vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone2006, S. 23f.). Schon im antiken Griechenland, ab ca. 1500 v. Chr., gibt es E-lementarschulen. Die sind jedoch privat und ihr Bildungsangebot ist für männlicheNachkommen freier Bürger reserviert. Später werden auch öffentlicheErziehungsanstalten sowie staatlicher Schulzwang eingerichtet (vgl. Kocyigit-Baumgartner 2008, S. 72f.; Inckemann 1997, S. 123f.). Menschen mit Behinderungenhaben kaum eine Überlebenschance, denn körperliche Besonderheitenwerden als Unglücksbotschaften der Götter interpretiert und Menschen mitsolchen gelten zusätzlich als sozial unbrauchbar, da sie nicht zum politischen,wirtschaftlichen und kriegerischen Geschehen beitragen können (vgl. Vijtová/Bloemers/ Johnstone 2006, S. 23f.). Man strebt die Formung und Veredelungdes Menschen an, der nicht als Individuum, sondern als Teil der Gemeinschaftgesehen wird. Tapferkeit bildet als höchste Tugend die Grundidee der antikenBildung, neben einem ansehnlichen Körper und gebildeten Geist (vgl. Kocyigit-Baumgartner2008, S. 72). Aus diesen Gründen ‚entsorgt’ man Menschen,die nicht dem Ideal entsprechen, zum Beispiel indem man sie in Schluchtenwirft. Auch im antiken Rom haben behinderte Menschen keinen besseren Status.Hier beherrscht das Leitbild der Schönheit, Tüchtigkeit und Sittlichkeit dasDenken der Menschen. Missgebildete Kinder werden normalerweise ertränktoder ausgesetzt, Erwachsene dienen als Sklaven.20
2.4.2.2 Mittelalter – Der Einfluss der KirchenIm Mittelalter wird die Separation und Exklusion von Menschen, die nicht alsnormal angesehen werden, vom Rest der Gesellschaft fortgesetzt (vgl. Vijtová/Bloemers/ Johnstone 2006, S. 23f.). Das Christentum und somit auch diechristliche Erziehung gewinnen zunehmend an Bedeutung und Einfluss (vgl.Lauer 2008, S.68). Zahlreiche Kloster-, Stifts- und Domschulen, die allerdingsdem Klerus vorbehalten sind, stabilisieren und unterstützen den Einfluss derKirche, die bis zur Aufklärung eine machtvolle Stellung in der Gesellschaftinne hat (vgl. Lauer 2008, S.68; Kocyigit-Baumgartner 2008, S. 76; Vijtová/Bloemers/ Johnstone 2006, S. 26ff.). Allmählich wird das Schulsystem auchNicht-Geistlichen zugänglich gemacht und unter Karl dem Großen (747-814)durch eine dreiteilige Gliederung (Elementarstufe, Mittelstufe, Oberstufe)grundlegend erneuert. Trotzdem ist Bildung nach wie vor ein Vorrecht der Reichen,die Unterschicht bekommt kaum Zugang zu Bildung (vgl. Kocyigit-Baumgartner 2008, S. 76f.). In Bezug auf behinderte Menschen herrschen teilweisekaritative Gedanken, die christliche Fürsorglichkeit steht jedoch im Gegensatzzu ihrer Abwehrhaltung gegenüber Unnormalem. Klöster nehmen zwarverwaiste Kinder auf, haben Babyklappen eingerichtet und versuchen die Seelender Kinder mit Strenge und Autorität zu retten (vgl. Hillenbrand 2006, S.45), der christliche Glaube verursacht aber auch die Annahme, dass Menschenmit Anomalien, seien es körperliche oder verhaltensbezogene, als Teufelsbeitragund ihre Missbildungen als Strafe von Sünden verstanden werden. In demZusammenhang sind Folterungen, Hexenprozesse und Verbrennungen bekannt(vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 23f.).2.4.2.3 Neuzeit – Der wirtschaftliche Einfluss auf BildungDie Neuzeit, beginnend mit der Renaissance, ist durch die Aufhebung der mittelalterlichenStrukturen gekennzeichnet. Die Reformation, in der Luther(1483-1546) die Menschen von der kirchlichen Autorität freispricht (vgl. Hergenröder2008, S. 92ff.), und der Buchdruck verhelfen dem Schulwesen einenAufschwung, bei dem die Schulen unter kirchlicher Aufsicht stehen (vgl.Specht 2008, S. 81). Zusätzlich gewinnt im 15. Jahrhundert das Bürgertum inden Städten aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs mehr und mehr an21
Bedeutung und hat so die Möglichkeit, Bildung zu verlangen. Es entstehenBürgerschulen, die Lesen, Rechnen und Schreiben lehren, Kenntnisse, die fürden Handel von Bedeutung sind (vgl. Specht 2008, S. 80). Gleichzeitig verarmenaufgrund der wirtschaftlichen und politischen Veränderungen breite Bevölkerungsschichten,was wiederum die Verwahrlosung der Familien und ihrerKinder zu Folge hat. Mit Hilfe des Engagements christlicher Persönlichkeitenentstehen Waisenhäuser, die während des Pietismus, einer wichtigen protestantischenReformbewegung, fortbestehen können und erweitert werden, indemdie Vorbereitung auf den Beruf hinzu kommt. Später im 18. Jahrhundert werdenviele Waisenhäuser aufgrund übertriebener religiöser Übungen, derschlechten Lebensbedingungen und der hohen Kindersterblichkeit immer mehrkritisiert und schließlich geschlossen (vgl. Hillenbrand 2006, S. 45).AufklärungDas Zeitalter der Aufklärung birgt viele positive pädagogische Entwicklungen.Jean Jaques Rousseau als bekannter Vertreter sieht im Menschen ein von Naturaus gutes Wesen. Die Idee der allgemeinen Volksbildung entsteht und der Erziehungwird viel Aufmerksamkeit entgegengebracht, auch dadurch dass Rousseaudie Kindheit als eigene Entwicklungsstufe anerkennt (vgl. Bruchmann2008, S. 129ff.). Der zentrale Aufklärungsgedanke, dass man alle Menschendurch Bildung und Erziehung zu mündigen Mitbürgern machen könne, giltjedoch zunächst nicht für Menschen mit Behinderung, da noch viele Vorurteiledas Denken der Menschen beherrschen. Durch die Abwendung von Gott hinzur Wissenschaft und zu rationalen Formen von Erkenntnis, strebt man zumersten Mal an, Dinge, die bisher als unnatürlich gelten, rational zu erforschen(vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 28).Erstmals unternehmen einzelne Personen zielgerichtete, intensive Erziehungsversuche.Auch pädagogische Konzepte und Methoden für Menschen mit Behinderungwerden entwickelt. Vijtová, Bloemers und Johnstone sehen hier denAnfang der Pionierphase, die über die Restaurationszeit bis zum Ende des 19.Jahrhunderts andauert, in der systematische Erziehungsbemühungen um behinderteMenschen stattfinden (vgl. ebd., S. 27f.), auch wenn eine ausgereifte heilpädagogischeTheorie noch fehlt (vgl. Möckel 2007, S. 61). Vor allem dieEntwicklungen in der Gehörlosenerziehung sind bedeutend für die Entstehungder anderen sonderpädagogischen Fachrichtungen. Taubstumme haben einen22
so schlechten Stand in der Gesellschaft, weil die Sprache als angeboren angesehenwird. Hier gilt der französische Abt Charles Michel de l´Èpée (1712-1789) als Initiator des Schulunterrichts für gehörlose Kinder. Aber auch andereeinzelne Personen bemühen sich in verschiedenen europäischen Ländern umdie Bildung Taubstummer, die bis dahin noch als im Dienste der Menschenstehende Tiere betrachtet werden. Zunächst findet Einzelunterricht statt, derstaatlich nicht unterstützt und sehr teuer ist, denn die Lehrer hüten ihre Unterrichtskunstwie ein handwerkliches Berufsgeheimnis (vgl. Vijtová/ Bloemers/Johnstone 2006, S. 30; Möckel 2007, S. 30ff.). Aufgrund der vielen Vorurteilewerden die Erfolge des Unterrichts als sensationell wahrgenommen (vgl. ebd.,S. 33) und die Öffentlichkeit kann so mehr und mehr von dem Sinn des Unterrichtsüberzeugt werden (vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 30). Del´Épée beweist zudem, dass man gehörlose Kinder nicht nur einzeln sondernauch im Klassenverband unterrichten kann.Die Bildungsfähigkeit von Blinden wird noch länger unterschätzt als die derGehörlosen, sogar de l´Épée liegt hier falsch (vgl. Möckel 2007, S 37ff.). Schulenfür Blinde gibt es Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts erstmals in Paris(vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 30). Dennis Diderot (1713-1784)recherchiert, beobachtet und schreibt viel in diesem heilpädagogischen Bereich.Er beschreibt auch die Bedeutung der Sprache für das Lernen (vgl. Möckel2007, S. 50f.).Das Argument für den Ausbau und die Verbreitung der Erziehungssysteme fürMenschen mit Behinderung liegt im ökonomisch-utilitaristischen Denken. DieUnterrichtung von Blinden und Gehörlosen hat das Ziel, sie für die Gesellschaftnutzbar zu machen. Unterricht wird also nur Kindern erteilt, für die ersich aus wirtschaftlicher Sicht zu lohnen scheint. Bürgerlich brauchbar undsomit politisch integriert kann nur jemand sein, der die Grenze der Bildungsfähigkeitintellektuell nicht unterschreitet (vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone2006, S. 30f.; Möckel 2007, S. 54ff.).In der Geistigbehindertenpädagogik ist Jean Itard (1774–1838), ein französischerArzt, derjenige, der an die Erziehungsfähigkeit geistig behinderter bzw.psychisch gestörter Kinder glaubt. Er ist der Meinung, dass mangelnde Erziehungund schwere Verwahrlosung Gründe für die ‚moralische Idiotie’ sind(vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 31). Er entwickelt ein Sinnesschulungsprogrammfür ein Kind, was jahrelang ohne menschlichen Kontakt lebte23
(vgl. ebd., S. 33; Hillenbrand 2006, S. 51). Da sein Training die grundsätzlicheEntwicklungsfähigkeit des Menschen voraussetzt, erkennt er das Phänomen dergeistigen Behinderung als pädagogisch an, womit er einen Integrationsansatzfür bisher exkludierte Menschen schafft. Édouard Séguin (1812-1880) präzisiertdie Methodik Itards und bringt das erste Lehrbuch heraus, das sich systematischmit der Erziehung von geistig behinderten Menschen befasst. Das Idealdes am Ende des Bildungsprozesses sozial denkenden und handelnden Menschengesteht Séguin ohne Ausnahme allen Menschen zu. Beeinflusst sind seineGedanken unter anderem von John Locke (1632-1704) (vgl. Vijtová/ Bloemers/Johnstone 2006, S. 31f.), der die Theorie vertrat, dass der Mensch durchErfahrung zu Erkenntnis gelangt. Erfahrung besteht dabei aus äußeren und innerenSinneswahrnehmungen, die zusammen verknüpft werden müssen, umErkenntnis zu erlangen (vgl. Bruchmann 2008, S. 131). Auch Johann JakobGuggenbühl und Carl Wilhelm Saegert können in praktischen Beispielennachweisen, dass ‚blödsinnige’ Kinder erziehungsfähig sind und tragen somitdazu bei, dass sich die bisherige Grenze der Bildungsfähigkeit immer mehrauflöst. Trotzdem braucht es noch Zeit, bis geistig behinderte Menschen überallals bildungsfähig anerkannt werden (vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone2006, S. 33). Als Sachsen 1873 als erster deutscher Staat eine Schulpflicht fürgeistig behinderte, gehörlose und blinde Kinder festlegt (vgl. ebd., S. 33; Möckel2007, S. 108), hat die allgemeine Unterrichtspflicht am Ende des 18. Jahrhundertsbereits alle deutschen Länder erreicht, zumindest in ihrer theoretischenFestlegung (vgl. Schmid 2006, S. 31f.). Während der Aufklärung findetzum ersten Mal, abgesehen von den anfangs genannten Ausnahmen, schulischeIntegration von Menschen mit Behinderung statt, welche immer noch von Exklusionbegleitet ist.Das 19. Jahrhundert ist geprägt von der Industrialisierung, welche Mitte des 18.Jahrhunderts ihren Ursprung in England hat (vgl. Purr 2008, S. 191; Vijtová/Bloemers/ Johnstone 2006, S. 34). Die dadurch entstehenden Veränderungsprozessesind ökonomischer, sozialstruktureller und sittlich-moralischer Natur.Die enorme Zunahme der Bevölkerung bewirkt, dass kleine Betriebe maschinell,technisch und spezialisiert zu industriellen Großbetrieben umgerüstetwerden, der Mensch als Arbeitskraft wird austauschbar. Die rücksichtsloseAusbeutung der Arbeiter zieht Massenverelendung und wachsende Klassengegensätzenach sich (vgl. ebd., S. 34).24
Die RettungshausbewegungHier beginnt die Verbreitung von Einrichtungen für die Unterstützung vonverwahrlosten Kindern, es sind die Anfänge der Verhaltensauffälligenpädagogik(vgl. Hillenbrand 2006, S. 46; Möckel 2007, S. 14). Es gibt zwar auchschon Industrieschulen gegen Ende des 18. Jahrhunderts, die Arbeit und Schuleeng miteinander verbinden und als Mittel gegen Armut gesehen werden, dieArbeit stellt jedoch auch ein Disziplinierungsmittel für Kinder dar, die alsschwer erziehbar gelten (vgl. Hillenbrand 2006, S. 46; Vijtová/ Bloemers/Johnstone 2006, S. 37; Möckel 2007, S. 86). Pestalozzi dagegen sieht, wie dieIndustrialisierung die soziale Ordnung der Gemeinden auflöst, in welche Notlageviele Familien kommen und erkennt die Erziehungsnot und –unfähigkeitsowie die damit zusammenhängende Verwahrlosung und wachsende Kriminalität(vgl. ebd., S. 66; Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 35). Er möchte diegesellschaftlichen Verhältnisse nicht sich selbst überlassen, sondern Erziehungund Bildung der Schichten unterstützen, die damit alleine überfordert sind (vgl.Möckel 2007, S. 66). Dazu gründet er das erste Haus der Rettungshausbewegung,indem er ein Heim nach dem Familienprinzip ausrichtet und dort verwahrlosteKinder aufnimmt (vgl. Hillenbrand 2006, S. 46; Vijtová/ Bloemers/Johnstone 2006, S. 36). Allerdings kann er sich nicht von dem ständischenDenken lösen, er will die Armen für die Armut erziehen. Positiv ist jedoch,dass er die Bedeutung von qualifiziertem Personal erkennt (vgl. Möckel 2007,S. 67f.). Seine Leitidee, die Verbindung von gemeinsamem Leben, Beruf undBildung, geht in die Rettungshausbewegung mit ein (vgl. Vijtová/ Bloemers/Johnstone 2006, S. 36; Möckel 2007, S. 68) und beeinflusst die zukünftigeVolksschule in methodischen und inhaltlichen Aspekten (vgl. Inckemann 1997,S. 174). Andere bekannte Begründer von Rettungshäusern sind Zeller, Falk,Wichern und Recke, die mit ihren Institutionen zu einer wirtschaftlichen undmoralischen Existenz der Kinder beitragen wollen. Das Rauhe Haus von Wichernist gesondert zu nennen, da es hier Kleingruppen gibt, zu denen nachdem Familienprinzip auch Gruppeneltern gehören. Er will nicht nur Armenlehrerausbilden, was bei Pestalozzi kritisiert wird, sondern geschickte Erzieherund Helfer, für die er sogar ein eigenes Institut einrichtet (vgl. Hillenbrand2006, S. 46; Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 36; Möckel 2007, S. 71ff.).25
Die Erziehung in der Gemeinschaft steht im Gegensatz zu den strengen Gesetzenund Gefängnisstrafen, mit denen der Staat der wachsenden Kriminalitätbeizukommen versucht. Auch in den Häusern herrschen strenge Regeln undKontrollen, welche aber zu dieser Zeit Merkmale des Zusammenlebens vonErwachsenen und Kinder sind (vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 35;Möckel 2007, S. 73).Die Institution Kirche bzw. religiöse Erziehung spielt in den Heimvorläuferneine große Rolle, denn primär geht es darum, die Seelen der Kinder und Jugendlichenzu retten, damit sie dem Christentum erhalten bleiben (vgl. Vijtová/Bloemers/ Johnstone 2006, S. 36). Wichern ist Begründer der Inneren Mission,ein Zusammenschluss von christlichen Vereinen, die die Rettungshäuser undihre gesellschaftliche Stellung stärkt (vgl. Hillenbrand 2006, S. 46). Der Neupietismusbringt der Bewegung großen Ernst entgegen, isoliert sie aber auchvon den aktuellen pädagogischen Bewegungen, in denen weiterhin Utilitarismusvorherrscht, zusammen mit Intellektualisierung und Mechanisierung (vgl.Möckel 2007, S. 69; Purr 2008, S. 192; Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S.35). Im Vordergrund steht weiterhin der utilitaristische Gedanke (vgl. Inckemann1997, S. 158; Purr 2008, S. 191), was auch daran zu erkennen ist, dassdie Rettungshäuser im Gegensatz zu den Blinden- und Gehörloseninstitutionenkleine Wirtschaftsunternehmen darstellen (vgl. Möckel 2007, S. 77).Als sozialpädagogische Maßnahmen reichen die Institutionen nicht aus, um dieproblematischen Folgen der Industrialisierung zu beheben (vgl. ebd., S. 77).Sie sind eine Antwort auf fehlgeschlagene Erziehung und versuchen so, auf dieArmut der Städte und Isolation einzelner Familien zu reagieren. Was die Bewegungnicht wahrnimmt, ist, dass die sozialen Probleme, gegen die sie anzukämpfenversucht, Symptome der Zeit sind. Ihre wirklichen Ursachen werdennoch nicht erkannt (vgl. ebd., S. 76; Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S.36f.). Die Bedeutung der Rettungshausbewegung liegt darin, dass der Zusammenhangzwischen der Armut und der Erziehungsunfähigkeit aufgrund ökonomischerund sozialer Lebensverhältnisse hergestellt wird. Die Kinder werdennicht mehr als allein verantwortlich für ihre Situation angesehen, wobei sichder entstandene sozialrehabilitative Gedanke mehr auf das Individuum als aufumfassende gesamt-gesellschaftliche Veränderungen bezieht (vgl. ebd., S. 36f.;Möckel 2007, S. 73). Diejenigen, die bisher zum Schutz der Gesellschaft ausgegrenztwurden, werden nun zu ihrem eigenen Vorteil isoliert. Der Gedanke26
der separierenden Rettungsinsel ist pädagogisch legitimiert und bleibt bis ins20. Jahrhundert erhalten (vgl. Vijtová/ Bloemers/ Johnstone 2006, S. 37).ModerneAuch Kinder mit körperlichen Behinderungen werden mittlerweile im Schulsystemintegriert, wie auch Menschen mit anderen Behinderungen, in separatenInstitutionen. Anfangs des 19. Jahrhunderts entstehen orthopädische Institutefür körperlich behinderte Menschen, die den Zweck der medizinischen Behandlunghaben. Unterricht findet nur statt, wenn die Behandlung länger andauert.Falls Kinder mit körperlichen Behinderungen dem Elementarschulunterrichtnachkommen können, besuchen sie die Volksschule. Nach der Absolvierungder Schulpflichtzeit werden sie häufig in Industrieschulen aufgenommen,wo sie Schulgeld zahlen müssen und sich für drei Jahre verpflichten. Hiergibt es keine spezielle ärztliche Versorgung, die Institutionen sind eine Mischungaus ökonomischem Unternehmen und humaner Einrichtung, in derSchüler zur Berufsfähigkeit erzogen werden. Sie ist auch Mittel gegen Arbeitslosigkeit(vgl. Möckel 2007, S. 80ff.).Der Unterschied zu den bisherigen heilpädagogischen Einrichtungen liegt inder Funktion. In der Institution für ‚krüppelhafte’ Kinder folgen auf ein Lernjahrzwei Arbeitsjahre, da sich die Schulen aufgrund ihres privaten Daseinsselbst um den Unterhalt der Lehrer kümmern. Erst mit der Verstaatlichung gegenMitte des 19. Jahrhunderts werden sie von dieser Erfordernis entlastet. Einweiterer Unterschied liegt in den Voraussetzungen der Schüler: Während Kindermit körperlichen Behinderungen die Volksschule besuchen können, nehmenBlinden- und Gehörloseninstitute Kinder auf, die nicht in Industrie- oderVolksschulen unterrichtet werden (vgl. ebd., S. 85).Wilhelm von Humbold (1767-1835) distanziert sich von dem in der Aufklärungentstandenen schulischen System, denn für ihn ist allgemeine Menschenbildungwichtiger als eine spezielle Berufsausbildung (vgl. Inckemann 1997, S.174). Der Mensch soll nicht mehr um der Verbesserung des Staates und derGesellschaft Willen optimal integriert werden, sondern sich in seiner Gesamtpersönlichkeitindividuell und selbständig entwickeln (vgl. Groppe 2006, S.47). Zusammen mit Johann Wilhelm Süvern (1775-1829) und Georg HeinrichNicolovius (1767-1839) entwickelt er das Konzept eines öffentlichen, gestuftenSchulsystems, in dem sie dem Staat die Verantwortung für dasselbe übertragen.27
In den Reformjahren bis 1819 versuchen sie erfolglos, ihre Forderungen durchzusetzen(vgl. Inckemann 1997, S. 174f.). Es wird eine ähnliche Schulformentworfen, die in Stufen spezifische Ziele vermittelten. Die Stufen und ihreAbschlüsse sind auf die Klassen der Gesellschaft abgestimmt, aufbauend aufden Elementarunterricht gibt es die Bürgerschule als unterste zwei Klassen, mitdem Abschluss zur Handwerkslehre, dann folgen zwei Klassen der Künstlerschule,dessen Abschluss den Zugang zu künstlerisch-produktiven Handwerkenermöglichen soll, und schließlich bilden die oberen beiden Klassen die gelehrteSchule, die nach erfolgreichem Abschluss die allgemeine Hochschulreife verleiht.Gymnasien verbinden in Städten häufig alle Stufen in einer Schulform.Hier ist eine Unterscheidung von höheren und niederen Schulen kaum möglich,lediglich die Armenschulen sind klar der niederen Bildung zuzuordnen undkönnen somit ausgesondert betrachtet werden (vgl. Groppe 2006, S. 57ff.).Die Anzahl der Industrieschulen verringert sich erheblich, als die deutschenStaaten die elementare Ausbildung aller Kinder als politisches Ziel nennen. Inden Schuldebatten der Nationalversammlung 1848/49 hat die Industrieschulekeine Bedeutung mehr (vgl. Möckel 2007, S. 88). Das Scheitern der Revolutionhat zufolge, dass eine freie Berufswahl, Schulgeldfreiheit für Mittellose unddie Abschaffung der geistlich besetzten Schulaufsicht gestrichen wird. Es wirdversucht, die höhere und niedere Bildung weiter voneinander abzugrenzen, dasNiveau der Volksschule und deren Lehrerausbildung wird gesenkt und der Kirchewieder mehr Bedeutung zugesprochen, um die Erziehung in der Volksschuleauf christlichen Gehorsam herabzusetzen. Schule soll nicht mehr dieallgemeine Bildung beinhalten, sondern auf das praktische Leben vorbereiten,das sich in Kirche, Familie, Beruf, Gemeinde und Staat abspielt. Inhalte wieReligion und Gesang verdrängen Lesen, Schreiben und Rechnen, die nur nochreduziert gelehrt werden. Hauptanliegen ist, die Schüler gehörig zu machenund ihre Achtung vor den Obrigkeiten zu schulen. Auch die Lehrerausbildungwird inhaltlich erheblich begrenzt, z.B. sollen Grundsätze des Unterrichtens derBibel entnommen werden (vgl. Inckemann 1997, S. 181ff.).Im Bereich der Heilpädagogik gibt es 1859 einen preußischen Erlass zur Bildungund Erziehung geistig behinderter Kinder. Der Fortschritt liegt darin, dassder Staat die Bildungsfähigkeit von geistig beeinträchtigten Kindern anerkenntund somit nun die Erziehung und nicht mehr nur die Pflege bekräftigt. Die Personen,die die Kinder zu brauchbaren Mitgliedern der Gesellschaft bilden sol-28
len, will Preußen jedoch nicht ausbilden. Erst gegen Ende des 19. Jahrhundertsgibt es Weiterbildungen für Taubstummen- und Blindenlehrer (vgl. Möckel2007, S. 109f.).1871 wird das Deutsche Reich gegründet, in dem die Privatwirtschaft einSchulwesen fordert, das die Schüler mit dem für die veränderte Berufsweltnötigen Wissen versorgt. Ebenfalls gegen Ende des 19. Jahrhunderts findet dieAblösung der Schule von der Kirche statt, hierzu verordnet Preußen in einemGesetzt die staatliche Aufsicht der Schulen. Sie werden inhaltlich und organisatorischverändert, um sie den wirtschaftlichen Veränderungen anzupassen.Um 1880 gilt die achtjährige Unterrichtspflicht fast überall und die Analphabetenquoteist bis zu dem Zeitpunkt erheblich gesunken.Trotz der vielen Verbesserungen bleibt die Trennung von höherer und niedererBildung erhalten (vgl. Inckemann 1997, S. 184ff.). Die Errichtung von Institutionenfür ‚Blödsinnige’ bleibt weiterhin in privaten Händen (vgl. Möckel2007, S. 109), zur Entlastung des Volksschulwesens wird die Hilfsschule gegründet(vgl. Häberlein-Klumpner 2009, S. 37) und das mittlere und höhereSchulwesen differenzieren sich weiter aus. Während das Schulgeld der Volksschule1888 endgültig abgeschafft wird, steigen die Kosten für diejenigenSchulen, die Studienberechtigungen erteilten (vgl. Inckemann 1997, S. 185f.).Mit der Einführung der Hilfsschule um 1880, die als Vorläuferin der heutigenFörderschulen gesehen werden kann, wird einerseits die schulische Förderung,andererseits auch soziale Diskriminierung begünstigt. Sie nimmt die Schülerauf, die von anderen Schulformen kommen und dort nicht mehr unterrichtetwerden (vgl. Möckel 2007, S. 135). Ihre Funktion besteht darin, genetisch wenigerwertvolle Kinder zu erfassen und auszusortieren (vgl. Häberlein-Klumpner 2009, S. 38). Da die Kinder aufgrund der Notwendigkeit einer medizinischenDiagnostik als intellektuell geringer begabt gelten, stellen die Hilfsschulenfür viele ihrer Schüler eine Demütigung dar. Es beginnt eine vorsichtigeDiskussion um die Frage, welche Schule besser für die Hilfsschüler sei, diesich jedoch nicht durchsetzen kann (vgl. Möckel 2007, S. 137f.).Während der Reformpädagogik, die Ende des 19. Jahrhunderts anfängt undetwa bis zur Machtergreifung Hitlers andauert, wird der Rückbesinnung aufden Menschen sowie dem pädagogischen Intellektualismus mehr Bedeutunggeschenkt. Maria Montessori gilt als bekannte Reformpädagogin, die sich vorrangigfür vernachlässigte Kinder engagiert (vgl. Purr 2008, S. 193). In29
Deutschland vertritt Berthold Otto die Ideale der Reformpädagogik, die späterauch den Wandel der Schulen in der Weimarer Republik beeinflussen sollte(vgl. van Ackeren/ Klemm 2009, S. 33).Bis ca. 1920 wird die Trennung von höherer und niederer Bildung seitens derSozialdemokratie und der Einheitsschulbewegung kritisiert, allerdings ohneentscheidende Veränderungen zu erreichen (vgl. Inckemann 1997, S. 187). DieWeimarer Verfassung führt 1919 zu Veränderungen im Bildungswesen. DasSchulsystem soll nun demokratischen Grundsätzen entsprechen; ein Aspekt istz. B. die Sicherstellung der freien Wahl der Bildungsinstitution oder die Schulgeldfreiheitfür entsprechende Institutionen. Auch die Schulpflicht wird biszum 18. Lebensjahr festgelegt. Kinder müssen mindestens acht Jahre dieVolksschule besuchen und danach eine berufliche Fortbildungsschule (vgl.ebd., S. 191ff.). Volksschulen, Mittelschulen und Gymnasien bleiben getrennteInstitutionen und somit ist das Schulsystem in der Hinsicht noch dem ständischenDenken verhaftet (vgl. van Ackeren/ Klemm 2009, S. 33). Auf derReichsschulkonferenz 1920 wird unter anderem über die Hilfsschulen debattiert.Die Politik ist sich einig darüber, dass die Hilfsschüler sich in Lebensweisenund Persönlichkeit von ‚normalen’ Schülern unterscheiden und besonderepädagogische Unterstützung benötigen. Die Ausbildung der Lehrer wird getrennt(vgl. Häberlein-Klumpner 2009, S. 38). Dieser Zeitpunkt ist auch alsBeginn der Grundschule als eigenständige Schulform anzusehen. Im Reichsgrundschulgesetzwird festgehalten, dass die unteren vier Jahrgänge die Aufgabehaben, auf alle weiterführenden Schulen vorzubereiten (vgl. Inckemann1997, S. 196).Wegen der immer noch einflussreichen Autoritäten aus der Kaiserzeit und derdeutschen wie auch weltweiten Wirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre kannsich die Republik nie richtig etablieren, worunter auch die Reform des Bildungswesensleidet. 1930 kommt es zur Auflösung des Parlaments. Bei denfolgenden Wahlen wird deutlich, dass extreme Parteien an Beliebtheit gewinnen,was sich auch bei Neuwahlen 1932 bestätigt, denn die NSDAP wirdstärkste Partei und so kann Hitler Anfang 1933 die Macht ergreifen (vgl. ebd.,S. 191).Nationalsozialismus30
Das Argument des volkswirtschaftlichen Nutzens einer Ausbildung von Kindernmit Behinderung wird im Nationalsozialismus umgekehrt. Charles DarwinsTheorie vom Überleben des Stärkeren wird auf gesellschaftliche Lebensgebieteangewendet. Der Sozialdarwinismus hat zur Folge, dass Menschen, dienicht der Norm entsprechen, zwangssterilisiert oder getötet werden (vgl. Möckel2007, S. 124ff.; Hillenbrand 2006, S. 47). Das gesellschaftliche Denkenund Handeln befindet sich auf dem Höhepunkt der Separation (vgl. Häberlein-Klumpner 2009, S. 38). Viele sozialpädagogische Einrichtungen werden fürdie Mitarbeit bei Tötungen oder Sterilisationen missbraucht. Die Erziehungsklassen,die Ende der 1920er als Klassen für schwererziehbare Kinder innerhalbder Volksschule entstanden sind, werden zu Beginn des Nationalsozialismussofort aufgelöst. In der Hilfsschule werden Schülerinnen und Schüler mitverschiedensten Störungen gesammelt. Zusammen mit straffälligen oder psychischkranken Kindern und Jugendlichen sind sie „Gemeinschaftsschädlinge“(Hillenbrand 2006, S. 48) und werden in eigenen Konzentrationslagern untergebracht,ebenfalls zwangssterilisiert oder in Tötungsanstalten ermordet (vgl.ebd., S. 47ff.; Möckel 2007, S. 163).PostmoderneNach dem Zweiten Weltkrieg beeinflussen die Besatzungsmächte das Bildungssystem,dabei wird hauptsächlich versucht, an die Situation vor 1933anzuknüpfen (vgl. Purr 2008, S. 194; Hillenbrand 2006, S. 48; Möckel 2007, S.108). Die Unterscheidung von höherer und niederer Bildung wird beibehaltenund weiterhin mit begabungstheoretischen und ökonomischen Argumentenbegründet (vgl. van Ackeren/ Klemm 2009, S. 39). In Großstädten werden fürkriegsgeschädigte Kinder mit emotionalen Problemen spezielle Klassen eingerichtet.Ursprünglich als provisorische Einrichtungen gedacht, nehmen sie baldauch Kinder auf, die aufgrund ihres Verhaltens eine Belastung für die Lehrerinnenund Lehrer der Volksschule darstellen. Hillenbrand sieht hier die Entstehungder Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung (vgl. Hillenbrand2006, S. 49). Außerdem lässt sich eine Psychologisierung von abweichendemVerhalten erkennen, die dem Phänomen der Verhaltensauffälligkeitmit therapeutischen Mitteln begegnet (vgl. Vernooij 1994, S. 44). Daneben gibtes die Erziehungsklassen, die 1949 wieder gegründet werden. Sie erfahren jedochkaum Weiterentwicklung. Trotz der lokalen Integration in die Volksschu-31
len nehmen die Schülerinnen und Schüler der Beobachtungsklassen, wie dieErziehungsklassen ebenfalls genannt werden, eine Außenseiterrolle ein (vgl.Hillenbrand 2006, S. 49f.). Auch die separaten Sonderschulen ziehen Kritik aufsich, die sich bis heute gehalten hat (vgl. ebd., S. 49f.; Möckel 2007, S. 161).Trotzdem sieht die Kultusministerkonferenz 1972 die Fortsetzung des Ausbausder Schule für Verhaltensgestörte vor, der jedoch aufgrund der Entwicklungder <strong>Gesamtschule</strong>n und der massiven Kritik an den Sonderschulen ins Stockengerät (vgl. Hillenbrand 2006, S. 50).Die Zeit von 1960 bis 1980 wird als Ära der Bildungsreform gesehen (vgl. Inckemann1997, S. 192; van Ackeren/ Klemm 2009, S. 40). Bisher trugen sonderpädagogischeSchulen immer noch den Titel der Hilfsschule (vgl. Ellger-Rüttgardt 2006, S. 271). Gegen Ende der 1960er gibt es Vorschläge, die separierteSekundarstufe in einer integrierten <strong>Gesamtschule</strong> zusammenzuführen, diejedoch ergänzend entsteht und die verschiedenen Formen der Sekundarstufekeinesfalls ersetzt (vgl. van Ackeren/ Klemm 2009, S. 41). Mit dem Gutachtendes Deutschen Bildungsrats 1973 entsteht die Integrations- (vgl. Hillenbrand2006, S. 50) und Normalisationsbewegung gegen die sich die Sonderpädagogikrechtfertigen muss. Ihr wird vorgeworfen, sich ausschließlich auf die negativeZuschreibung behinderter Kinder zu berufen (vgl. Möckel 2007, S. 209). DerBildungsrat spricht in seinem Gutachten das Ideal aus, behinderte Kinder inkooperativen Schulzentren zu integrieren, was von der weiteren Entwicklungder Sonderschulen abweicht (vgl. Hillenbrand 1996, S. 51).Innerhalb der Reihe sonderpädagogischer Gutachten stellte es eine besonders progressiveSchrift dar: Die Relativität von Verhaltensstörungen, die Ablehnung einer besonderenSchule für Verhaltensgestörte als Standardform der Beschulung und die notwendigenMaßnahmen als Aufgabe allgemeiner Pädagogik mit Sozialpädagogik signalisierenzukunftsweisende, z.T. bis heute nicht verwirklichte Initiativen. Das vorgeschlageneKonzept eines gestuften Fördersystems berücksichtigt aber auch die praktischeNotwendigkeit separierender Fördersysteme und deckt sich durchaus mit Erfahrungender Schulpraxis. (ebd.)Es finden über Jahrzehnte hinweg Versuche statt, dem Phänomen der Verhaltensstörungeffektiv zu begegnen. Neben der Einrichtung von öffentlichenSonderschulen für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Stein/ Stein 2006,S. 58; Vernooij 1994, S. 44ff.) besteht auch die Möglichkeit, ambulante Einzelhilfein Anspruch zu nehmen. Die weitestgehenden Misserfolge haben zurFolge, dass eine Medizinisierung während der 1980er entsteht, bei der versuchtwird, Verhaltensauffälligkeiten mit Medikamenten zu kontrollieren (vgl. Vernooij1994, S. 44ff.). Diese medizinische Sichtweise auf die Handhabung von32
Verhaltensstörungen bedingt das Fortbestehen der zweigliedrigen Teilung inSonderschulen und Normalschulen (vgl. Speck 1993, S. 199).2.4.3 Wie lässt sich schulische Erziehungshilfe heute in unser Schulsystemeinordnen?Die fortwährende Differenzierung des deutschen Schulsystems hat zur Folge,dass es immer noch sehr selektierend angelegt ist. Schon vor Beginn derGrundschule können Kinder aussortiert werden, wenn sie als ungeeignet für dieallgemeine Schule diagnostiziert und an einer Förderschule eingeschult werden(vgl. van Ackeren/ Klemm 2009, S. 49). Die Schullaufbahn der meisten Kinderbeginnt mit der Grundschule, die in Berlin und Brandenburg sechs Jahre dauert,in den anderen Bundesländern vier. Der Auftrag ist in jedem Bundeslandder gleiche: die Vermittlung eines Basiswissens in den wesentlichen Kulturtechnikensowie die Vorbereitung auf die weiterführende Schule. Auf dieGrundschule folgen die Sekundarstufen I und II, die je nach Bundesland in biszu fünf verschiedenen Formen vorkommen können (vgl. ebd., S. 49f.), davonausgenommen ist die Förderschule. In Nordrhein-Westfalen gibt es die Hauptschule,Realschule, <strong>Gesamtschule</strong>, das Gymnasium, eine einzige Volksschulesowie die Förderschule für unterschiedliche Förderschwerpunkte (vgl. Ministeriumfür Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2010a,Internetquelle). In anderen Bundesländern gibt es teilweise mehr oder wenigerSchulformen. Diese Schulen zusammen mit der Grundschule gelten als allgemeinbildendes Schulwesen und werden, wieder in unterschiedlichen Formen,durch Schulen des zweiten Bildungswegs ergänzt (vgl. van Ackeren/ Klemm2009, S. 51).In dem bevölkerungsreichsten Bundesland NRW gibt es im Schuljahr 2009/10649 öffentliche sowie 78 private Förderschulen, die meisten unterrichten nachden Richtlinien der Grund- und Hauptschule, 14% davon sind Förderschulenfür emotionale und soziale Entwicklung. Knapp 4% aller Schülerinnen undSchüler werden auf einer Förderschule beschult, ca. 0,4% aller Schüler bzw.ca. 10% der Förderschüler gehen auf eine Förderschule für emotionale undsoziale Entwicklung. Dazu kommen die Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten,die in anderen Schulformen unterrichtet werden. Speck(vgl. 1993, S. 206) hält den Anteil der verhaltensauffälligen Schülerinnen undSchüler an der Gesamtschülerzahl für nicht präzisierbar. Im Vergleich zu den33
in der Statistik festgehaltenen 0,4% der Schüler einer Förderschule für emotionaleund soziale Entwicklung sind über 40% aller Förderschüler auf einer FörderschuleLernen (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des LandesNordrhein-Westfalen 2010b, Internetquelle). Auf die Entwicklung der Schülerzahlensowie die Schülerzahlen in integrativen Formen gehen wir in Kapitel2.7.1 näher ein.2.4.3.1 Schulische Institutionen für Pädagogik bei VerhaltensstörungenDie Empfehlungen der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder inder Bundesrepublik Deutschland sehen vor, dass das Bildungssystem den unterschiedlichenFörderbedürfnissen von Kindern, die nach einem offiziellenVerfahren zur Feststellung über den sonderpädagogischen Förderbedarf in eineFörderschule emotionale und soziale Entwicklung eingeschult oder überwiesenwerden, in einer Förderschule gerecht wird (vgl. KMK 2000, S. 19f., Internetquelle).Mit der sonderpädagogischen Förderung soll das Recht der Kinder undJugendlichen auf schulische Bildung verwirklicht werden, womit ihnen dieErreichung der gesetzlich vorgesehenen Abschlüsse ermöglicht wird (vgl. ebd.,S. 3; Ministerium für Schule und Weiterbildung 2010d: Schulgesetz NRW, §20(4), Internetquellen).Die sonderpädagogische Förderung erfolgt schwerpunktmäßig im Primarbereich derSchulen und Klassen für Erziehungshilfe. Sie sind als Durchgangsschule konzipiert. Inihnen wird grundsätzlich nach den Lehrplänen der Grundschule unterrichtet. Ziel istdie frühestmögliche Rückführung in die Grundschule. (KMK 2000, S. 23)Ob dieses Ziel, vor allem die Rückschulung in der Primarstufe, in der Praxiserreicht wird, ist fraglich. Es gibt mehrere Studien, die das Erreichen diesesZiels anzweifeln lassen (vgl. Stein/ Stein 2006, S. 62). In der Sekundarstufe Iwird nach den Richtlinien der jeweiligen Bezugsschule, meist Hauptschule,unterrichtet.In einer Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung gilt eine zehnjährigeSchulpflicht. Im Durchschnitt lernen elf Schülerinnen und Schüler ineiner Klasse, dabei gilt das ‚Klassenlehrerprinzip’, was den Aufbau tragfähigerBeziehungen zu den Schülern unterstützen soll. Um der Individualität derSchülerinnen und Schüler gerecht zu werden, werden Lernziele und Fördermöglichkeitenin einem Förderplan festgehalten. Die Gestaltung der inhaltlichenSchwerpunkte des Unterrichts zielt auf den konkreten Umgang mit dem34
emotionalen Erleben sowie mit problematischen Situationen, in denen sichKinder und Jugendlichen wiederfinden können. Interaktions- und Kommunikationsfähigkeitensollen erweitert werden um das Sozialverhalten zu stabilisieren.Vor allem das Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler soll verbessertwerden. Regelmäßige Kontakte zwischen Eltern und Lehrkräften sind genauwie in anderen Schulformen vorgesehen. (vgl. Ministerium für Schule undWeiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2010c, Internetquelle).Es besteht die Möglichkeit, eine Förderschule für emotionale und soziale Entwicklungzu einem Kompetenzzentrum auszubauen (vgl. ebd.: SchulgesetzNRW, §20 (5)). Diese Form der Beschulung dient der Inklusion und demSchulbesuch in Wohnortnähe. Zurzeit gibt es in NRW vier Standorte, an denendie Kompetenzzentren im Rahmen einer Pilotphase getestet und evaluiert werden(vgl. Bezirksregierung Köln 2010, Internetquelle).Die meisten Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungen werden jedochin Regelschulen unterrichtet. Dies ist auch der Kerngedanke der gestuften Förderung(siehe Abb. 2). Zunächst soll versucht werden, Kinder und Jugendlichemit individuellen Hilfen oder Gruppenförderung in Regelschulen zu belassen.Erst wenn dieser Versuch scheitert, werden die separaten Förderschulen zur alsFörderort herangezogen. Als Stufe nach den Förderschulen gibt es mehrdimensionaleHilfen, die Heimschulen, Klinikschulen oder Schulen im Strafvollzugumfassen (vgl. Hillenbrand 2006, S. 162f.).separiertMehrdimensionaleHilfenFörderschulen, KompetenzzentrenSeparateInstitutionenGruppenförderungintegriertIndividuelle HilfenIn RegelschulenAbb. 2: Gestuftes System schulischer Hilfen bei Verhaltensstörungen, vereinfacht nach Hillenbrand2006, S. 16335
Auf die integrative Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten,den Forschungsstand sowie Chancen und Grenzen gehenwir in Kapitel 2.7 (Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensstörungen)näher ein.2.4.3.2 Außerschulische Institutionen für Pädagogik bei VerhaltensstörungenUm Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen gerecht zu werden gibtes neben verschiedenen schulischen auch sozialpädagogische Hilfen. In Tagesgruppenbzw. heilpädagogischen Tagesstätten können Kinder den Nachmittagnach der Schule verbringen (vgl. Hillenbrand 2006, S. 19f.).Die klassischen Institutionen sind Heime, in denen Schülerinnen und Schülermit Verhaltensstörungen außerhalb der leiblichen Familie untergebracht sind,wenn familiäre Not- oder Krisensituationen herrschen. Während der Zeit derBildungsreform entsteht massive Kritik an den Einrichtungen, da ihre Erziehungim Vergleich zu der der Familien defizitär erscheint. Um das alltäglicheLeben und die erzieherische Arbeit in den Fokus der Heimerziehung zu platzierenist die Größe und Organisationsform der Heime verändert worden. Dadurchentstanden zusätzliche Formen der mobilen Erziehungshilfe (vgl. ebd., S.166ff.; siehe hierzu auch Kapitel 2.7.4 und 2.7.5).Geschlossene Einrichtungen sind gewöhnlich der Jugendstrafvollzug sowie dieKinder- und Jugendpsychiatrie. Im Strafvollzug werden Erziehungs- und Bildungsverbesserungenaus verschiedenen Gründen selten realisiert (vgl. ebd., S.169). Zur Kinder- und Jugendpsychiatrie gehören mittlerweile häufig auchSchulen, die den Bildungsauftrag bei längeren Aufenthalten erfüllen können(vgl. ebd., S. 170).2.4.3.3 LehrerausbildungDa es in NRW verschiedene Schulforen gibt, gibt es auch entsprechend separateLehrerausbildungen. Wer heute ein Lehramtsstudium anfängt, ist wahrscheinlichschon im Bachelor-/ Masterstudiengang und macht erst den Bachelorinnerhalb sechs Semester, anschließend den Master in vier Semestern. Das2. Staatsexamen erlangt man nach dem Vorbereitungsdienst, der mit der Reformgestrafft wird. Mit einem Einführungspraktikum und einem Praxissemes-36
ter soll der praktische Anteil des Studiums erhöht werden. Bis zum Wintersemester2011/2012 haben die Hochschulen Zeit, ihre Studiengänge umzustellen.Auch in den bisherigen Studiengängen ist die Lehramtsausbildung separiert.Das führt dazu, dass Sonderpädagogen Inhalte der Elementarstufe fehlen undim Gegenzug Grundschulpädagogen Lücken bezüglich grundlegendem sonderpädagogischenWissen aufweisen. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft(GEW) ist der Meinung, dass sonderpädagogische Kompetenzen zumRegelschulsystem gehören sollten, um eine qualitative Förderung aller Kinderzu ermöglichen (vgl. GEW, S. 1f., Internetquelle).An der Heilpädagogischen Fakultät der Universität zu Köln läuft derzeit einModellstudiengang, der diesem Problem entgegenwirken möchte und sich amArtikel 24 der UN-Konvention orientiert, da er eine inklusive Lehrerausbildungals Ziel hat. Die Arbeitsgruppe, die den Studiengang beantragt hat, betont,dass sich die Inhalte des Modellstudiums an den Gegebenheiten orientieren,denen Studierende später im Praxissemester und in der Lehrtätigkeit gegenüberstehen.Dabei werden vier Kernkompetenzen (Erziehen, Unterrichten, Beurteilen,Innovieren) berücksichtig, die sich auch in den Empfehlungen der KMKzur Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium 2004 wiederfinden. Schlüsselthemensind dabeioooooDiversität bzw. Heterogenität hinsichtlich Geschlecht, Kultur, sozialer Lage, Behinderungmit Blick auf Inklusion bzw. IntegrationUnterrichts- und Schulentwicklung mit Blick auf Nachhaltigkeit in Qualität undKommunikationDiagnostik mit Blick auf individuelle Förderung und Beratungpädagogischer Raum als sozialarchitektonische GestaltungaufgabeProfessionalisierung mit Blick auf die Verknüpfung von Erziehungswissenschaft,Fachdidaktik und Fachwissenschaft (Modellkolleg Bildungswissenschaften, S. 2, Internetquelle).Das Modellstudium ist für etwa 60 Studentinnen und Studenten ausgelegt, jeweilszwölf Studierende aus den unterschiedlichen Lehramtsstudiengängen. Esist für vier Semester vorgesehen, begann im Sommersemester 2009 und endetim Wintersemester 2010/11 (vgl. ebd.; Kölner Stadtanzeiger 2009, Internetquellen).Über Erfolge, Evaluation, Änderungen oder Weiterführung ist nichtsbekannt.Die Lehramtsausbildung wird vorerst separat weitergeführt, auch wenn sich,wie im Folgenden zu sehen sein wird, immer größere Tendenzen in Richtungintegrativer Beschulung entwickeln.37
2.5 Integration – der gemeinsame Unterricht von Kindern mit undohne BehinderungDie Analyse gegenwärtiger bildungspolitischer Diskussionen und die Auseinandersetzungmit der zukünftigen Weiterentwicklung des deutschen Schulsystemsfordert einerseits einen Rückblick auf die historische Entwicklung desSonderschulwesens, auf die ihr entgegenwirkenden integrativen Prozesse undauf die aktuellen inklusiven Tendenzen. Außerdem fordert die Analyse einebegriffliche Zusammenschau dieser unterschiedlichen Beschulungsmuster hinsichtlichihrer Bedeutungen und Intentionen. Entwicklungen im Förderschwerpunktessozial und emotionale Entwicklung und Stellungen desselben werdendarauffolgend explizit dargestellt und in den allgemeinen Kontext eingeordnet.2.5.1 Der BegriffDer Integrationsbegriff erlangte besonders durch die Soziologie, Psychologieund Bildungspolitik des 19. Jahrhunderts seinen heutigen gesellschaftlichenBekanntheitsgrad (vgl. Markowetz 2007, S. 214). Die ursprüngliche Bedeutungder Integration leitet sich von den lateinischen Grundworten integrare (Verbum),‚in etwas ergänzen’, und integer (Adjektiv), in etwas unberührt, ganz’ ab(vgl. Kobi 1990, S. 54-62).Der Begriff wird heute sowohl in allen Wissenschaftsbereichen als auch in derAlltagssprache vielfach genutzt, wobei sich sein aktuelles Verständnis nichtmehr auf die ursprüngliche Übersetzung zurückführen lässt.Zudem werden mit dem Begriff Integration, in Abhängigkeit von dem jeweiligendisziplinären Bereich, unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte herausgegriffen,so dass der spezifische Kontext erst ersichtlich macht, was mit Integrationgenau gemeint ist (vgl. Markowetz 2007, S. 213).Von Seiten der Pädagogik wurde der Begriff zunächst ausschließlich im Kontextentwicklungs- und persönlichkeitspsychologischer Zusammenhänge verwendet.In den 60er Jahren wurde er vor allem in der Curriculumdiskussionangeführt. Gegenwärtig taucht der Begriff in der kritischen Auseinandersetzungum das gegliederte, selektive deutsche Schulsystem auf (vgl. ebd.).Je nachdem wie der Begriff ‚Behinderung’ verstanden wird und ‚der Menschmit einer Behinderung’ gesehen wird, treten auch in der (sonder-) pädagogischenDiskussion eine Reihe von Begriffsbestimmungen zur Integration auf,die uneinheitliche Auffassungen beinhalten. So kennzeichnet sich der Begriff38
durch seine Vieldeutigkeit, wodurch die Formulierung einer Definition erschwertwird.Eines ist allen Definitionen aber gemein, sie vertreten eine neue Sichtweise fürMenschen mit Behinderung und des Weiteren plädieren sie für eine Schulreform,die Separation und Segregation überwindet (vgl. Deppe-Wolfinger 2004,S. 31). Der Terminus der Integrationspädagogik enthält zu Gunsten gemeinsamenLernens und Lebens begriffslogisch die Aufhebung der Sonderpädagogikund damit eine weit reichende strukturelle Veränderung im Schul- und Bildungswesen(vgl. Eberwein/ Knauer 2002, S. 17).Nach dem allgemeinen pädagogischen Verständnis und auch in dem Zusammenhangdieser Arbeit meint Integration demnach grob formuliert, die gemeinsameUnterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder.Mit der Errichtung von Integrationsklassen soll jedem Kind „das Recht aufUnterschiedlichkeit“ (Wocken 1987, S. 87) zuteil werden.Der Integration als Ziel, was eine zeitweilige Erziehung und Unterrichtung ingesonderten Einrichtungen bedeutet, steht die Integration als Weg gegenüber,womit die Unterrichtung von behinderten und nichtbehinderten Kindern inderselben Schule und Klasse gemeint ist (vgl. Hillenbrand 2003, S. 231).Jakob Muth, der wichtige Schritte für die Integrationsgeschichte einleitete,plädiert dafür, den Integrationsbegriff nicht nur auf den schulischen Bereich zukonzentrieren. Nach Muth (1991, S. 1) ist Integration „ein Grundrecht im Zusammenlebender Menschen, das wir als Gemeinsamkeit aller zum Ausdruckbringen. Es ist ein Recht, auf das jeder Mensch einen Anspruch hat“. Demnachsollte die Gemeinsamkeit von behinderten und nichtbehinderten Menschen inallen Lebensbereichen der Gesellschaft realisiert werden.Für eine Erreichung bzw. Annäherung dieser Zielsetzung ist nach Richtliniendes Deutschen Bildungsrates (vgl. 1973, S. 16) eine gemeinsame integrierteSchulbildung behinderter Schüler und Schülerinnen eine wesentliche und notwendigeVoraussetzung, denn nurwenn die Selektions- und Isolationstendenz im Schulwesen überwunden und die Gemeinsamkeitenim Lehren und Lernen für Behinderte und Nichtbehinderte in denVordergrund gebracht werden (Deutscher Bildungsrat 1973, S. 16)kann eine soziale Integration in die Gesellschaft erst ermöglicht werden, „denneine schulische Aussonderung der Behinderten bringt die Gefahr ihrer Desintegrationim Erwachsenenleben mit sich" (ebd.).39
Die Einsicht, dass soziale Integration, die schon früh in der Geschichte daseigentliche Ziel der Sonderpädagogik gewesen ist (vgl. hierzu auch Kapitel2.4.2), nicht durch schulische Separation bewirkt werden kann, wurde inzwischenempirisch belegt. Es ist nicht möglich, eine Eingliederung durch Ausgliederungerreichen zu wollen (vgl. Eberwein/ Knauer 2002, S. 17).In der Integrationsdiskussion nimmt auch der Begriff der ‚Normalisierung’eine entscheidende Stellung ein. Aus der auf der Grundlage der skandinavischenNormalisierungsbewegung formulierten Auffassung, geht zwar eine annäherndgleiche Normalität für Behinderte hervor, jedoch impliziert diese nochnicht den Kontakt zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen. DerNormalitätsbegriff versichert lediglich, dass beide Gruppen isoliert voneinanderdie gleiche Normalität erfahren können (vgl. Markowetz 2007, S. 218).Eine bloße physische Anwesenheit behinderter Menschen im Umfeld vonNichtbehinderten gilt nur als Scheinintegration, die stets mit der Gefahr verbundenist, dass sich Vorurteile gegen Behinderte verstärken. Sie ist in ihrenFolgen und Auswirkungen nicht besser als eine gesonderte Beschulung. Umeine echte Integration zu erreichen, sind daher soziale Interaktionen und Akzeptanzausschlaggebend (vgl. ebd., S. 219).Wocken (1998, S. 180) äußert hierzu:der Preis von Integration kann weder die einseitige Anpassung Behinderter an dieNormalität Nichtbehinderter sein, noch eine einsichtige Aufgabe von EntfaltungsbedürfnissenNichtbehinderter aus Rücksichtsnahme auf die Behinderten. Ein einseitigerIdentitätsverzicht kann weder den Behinderten noch den Nichtbehinderten zugemutetund abgefordert werden. Integrative Prozesse sind durch Einigungen, durch wechselseitigeAnnäherung zwischen Behinderten und Nichtbehinderten gekennzeichnet.Integration soll nicht dazu dienen, die Andersartigkeiten von Behinderten undNichtbehinderten zu beseitigen, indem sie versucht, die beiden gleichzuschalten.Eine integrative Erziehung ist genauso wenig in der Lage, eine Behinderungzu heilen, wie eine Sonderschule. Die Intention integrativer Prozesse bestehtvielmehr darin, die vorherrschende Behinderung in ihrer Realität zu akzeptieren,und trotz aller Differenzen Gemeinsamkeit zu leben. Beachtet werdenmuss, dass Integration kein Zustand ist, der allein durch die Einrichtungvon Integrationsklassen vollzogen werden kann und damit für immer hergestelltist. Vielmehr muss durch schulorganisatorische Rahmenbedingungensichergestellt sein, dass sich integrative Prozesse in den zwischenmenschlichenBeziehungen zwischen Kindern und Lehrern immer wieder aufs Neue ereignenkönnen (vgl. ebd.).40
2.5.2 Entwicklung„Schule und die dort realisierten sonderpädagogischen Fördermaßnahmenmüssen darauf abzielen, behinderte Kinder und Jugendliche in Beruf und Gesellschaftzu integrieren“ (Borchert/ Schuck 1992, S. 25).Es besteht Einigkeit darüber, dass dies das Ziel ist, welches durch die Leistungenund Anstrengungen der Schule verfolgt wird. Allerdings gehen die Ansichtenüber den methodischen Weg zur Erreichung dieses Ziels in der Bundesrepublikauseinander. In dieser Debatte stehen sich die Verfechter von sonderschulischenEinrichtungen und die Befürworter des gemeinsamen Lebens undLernens nichtbehinderter und behinderter Kinder in der allgemeinen Schulegegenüber (vgl. ebd.).Die Anfänge dieser Diskussionen reichen Jahre zurück. Bereits 1803 entstandendurch die Bildung erster Nachhilfeklassen Ansätze zur Integration. IhreAufgabe bestand darin, Schülern, die dem Unterricht nicht folgen konnten,gezielt Unterstützungsmöglichkeiten zu bieten. Diese Hilfestellung für bestimmteKinder verfolgte das Ziel der Rückversetzung in die Volksschule.Die frühen Versuche der Voll- und Teilintegration von behinderten Schülernwarf vielseitige Probleme auf und konnte daher nicht durchgehalten werden.Aber schon in diesen Entwicklungen wird der hohe Stellungswert der integrativenAufgabe ersichtlich.Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Sonderschulwesen aufgewertet undausdifferenziert. Für behinderte Kinder wurde zu dieser Zeit das Ziel der Integrationüberwiegend über eine spezielle Förderung in Sonderschulen angesteuert.Andere Wege der Integration standen zunächst nicht zur Diskussion (vgl.Haupt 1985, S. 153).2.5.2.1 Die Zeit der BildungsreformIn den 70er Jahren formten sich Elternbewegungen, die eine gemeinsame Beschulungvon behinderten und nichtbehinderten Kindern in deutschen Regelschulenforderten. Angestoßen und bestärkt wurde diese Forderung vor allemdurch verschiedene internationale Entwicklungen, wie durch die Begründungdes Normalisierungsprinzips in den skandinavischen Ländern in den1950er/1960er Jahren, durch die italienische Psychiatriereform von 1970 sowie41
durch die ersten integrativen Schulversuche ab 1960 in Dänemark und ab 1970in den USA.In Deutschland wurde in dem von dem Kinderarzt Heilbrügge geschaffeneninterdisziplinären Kinderzentrum 1970 eine private Montessori-Schule von derAktion Sonnenschein eingerichtet, in der erstmals behinderte und nichtbehinderteKinder gemeinsam in Integrationsklassen unterrichtet wurden. Basierendauf der Montessori-Pädagogik wurde in diesen Klassen Sinn- und Handlungsorientierungverknüpft und dabei die physischen, emotionalen und sozialenBedürfnisse der Kinder berücksichtigt. Diese Schule wird als eine Wurzel fürdas spätere Wachstum der Integrationsbewegung aufgefasst (vgl. Rosenberger1998, S. 17).1973 ging der deutsche Bildungsrat erstmalig ein auf die elterlichen Ansprüchemit einer Empfehlung zur pädagogischen Förderung behinderter und nichtbehinderterKinder und Jugendlicher (vgl. Krach 2009, S. 384). Die unter derLeitung von Jakob Muth erarbeitete Empfehlung löste große Diskussionen darüberaus, welcher Ort der bestmögliche zur schulischen Förderung von behindertenKindern sei (vgl. Schuck/ Borchert 1992, S. 26).Die bis dahin ausgebauten und ausdifferenzierten eigenständigen Sonderschulenwurden nun angeklagt, die gesellschaftliche Integration der Kinder zu beeinträchtigen(siehe auch Kapitel 2.4.2.3). Ihre ursprüngliche Intention, durcheine separierte Beschulung und den daraus resultierenden homogeneren Lernumgebungen,die Lernchancen der behinderten Schülerinnen und Schüler zuverbessern, geriet in große Kritik (vgl. Wlaschek 2010, S. 4). Man erkannte,dass Sonderschulen nicht in erster Linie das eigene Klientel begünstigten, sondernvielmehr den Regelschulen als Entlastung dienten (vgl. Rosenberger1998, S. 12).Statistiken zeigten, dass ein hoher Anteil der Sonderklassen von Kindern aussozial schwachen und Migrationsfamilien geformt wurde. Dieser Tatbestandgab Hinweise darüber, dass nicht nur feststellbare Behinderungen, sondernscheinbar auch soziale Faktoren als ‚Aussonderungskriterien’ ausschlaggebendwaren (vgl. Schär/ Parmentier 1996, S. 15).Die aus der Empfehlung heraus formulierte These „soviel Integration wie möglich,soviel Separation wie nötig“ (Rosenberger 1998, S. 9) brachte das inhaltlicheErgebnis des Bildungsrates hervor, das für eine Öffnung des Sonderschulwesenshin zu dem allgemeinen Schulsystem plädierte. Die Zielsetzung42
der pädagogischen Förderung von behinderten Schülerinnen und Schülernstand von nun an unter dem Bestreben, die größtmöglichen Einbeziehungenvon allgemeinen Schulen zu gewährleisten und nicht auf die Sonderschule beschränktzu bleiben.Zur Umsetzung der integrativen Ansätze wurde vom Bildungsrat das Konzeptder kooperativen Schulzentren entwickelt, durch welche Regelschulen mitSonderschulen verknüpft werden sollten (vgl. Borchert/ Schuck 1992, S. 26).Es wurde vorgeschlagen, in den Klassen der Regelschulen konsequent Binnendifferenzierungumzusetzen sowie sonderpädagogische Inhalte in die Aus- undFortbildung aller beteiligten Berufsgruppen aufzunehmen (vgl. Rosenberger1998, S. 15). Die entwickelten Kooperationsmodelle, bei der z. B. eine Sonderschulklasse,wenn auch nur zeitweise, in einer Regelschule untergebracht wird,konnten die an sie gestellten Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Die dabei erforderlichenorganisatorischen Vorarbeiten waren zeitintensiv und aufwändig,während der integrative Gewinn nur gering blieb (vgl. ebd., S. 17). Zusätzlichregte der Bildungsrat den stärkeren Ausbau des Früh- und Elementarbereichsan, dessen Entwicklungszustand abhängig vom jeweiligen Bundesland variierte.Durch die Empfehlung wurde erstmals Integration als Ziel des Schulwesensformuliert und die Sonderschule als Ort der Förderung hinterfragt (vgl. Borchert/Schuck 1992, S. 26). Die damit vorgesehenen konzeptionellen Veränderungendes Schulsystems wurden allerdings nur sehr geringfügig in der Praxisaufgegriffen und spiegelten sich allenfalls in ersten Anfängen in einzelnenBundesländern wider (vgl. ebd., S. 27).Die Umsetzungserfolge blieben in den nächsten Jahren spärlich und waren aufdie Einrichtung einiger vereinzelter Integrationsklassen beschränkt (vgl. Rosenberg1998, S. 16).Es entstand der Gemeinsame Unterricht (GU), der aber zunächst nur vordergründigdie Integration von geistig behinderten Kindern erzielte. Der Rückgangder Schülerzahlen an den Sonderschulen, der von den Bildungspolitikern durchdie neuen Formen sonderpädagogischer Förderung erwartet wurde, blieb aus.Es zeigte sich sogar der gegenteilige Effekt. Sowohl an Sonderschulen als auchim GU stieg die Schülerpopulation weiter an (vgl. Wlaschek 2010, S. 5).43
2.5.2.2 Nach der ΒildungsreformDie mangelnden Fortschritte in der Schulpolitik klagte 1983 auch Jakob Muthauf einer Tagung in Berlin anlässlich des 10. Jahrestages der Bildungsempfehlungan (vgl. Rosenberger 1998a, S. 9). Dennoch waren rückblickend die durchdie Empfehlung angeregten Denkanstöße gegen die Monopolstellung des Sonderschulwesensausschlaggebende Antriebe für die Integrationsbewegung, dievon Lehrern, Hochschullehrern, Menschen mit Beeinträchtigungen und Elternvon Kindern mit Beeinträchtigungen geführt wurden (vgl. Rosenberger 1992,S. 16).1988 wird, durch das inoffizielle Ergebnisprotokoll der 110. Amtschefkonferenzder Kultusminister ‚Zum Unterricht für Schüler und Schülerinnen mitsonderpädagogischem Förderbedarf‘ eine neue schulische Richtung für diezukünftige Entwicklung gelegt. Von nun an soll vermieden werden, den Ortsonderpädagogischer Förderung festzuschreiben. Die Zukunftsgedanken richtensich gegen eine institutionsbezogene Förderung und sind darauf bedacht,die behinderte Person selbst - bei Entscheidungen über Formen und Orte derFörderung - in den Fokus zu stellen. Das Protokoll sieht in diesem Zusammenhangeine begriffliche Umformulierung vor. Der Begriff ‚Sonderschulbedürftigkeit‘wird durch den Begriff des sonderpädagogischen Förderbedarfs ersetztund als Leitbegriff für das neue Verständnis von sonderpädagogischer Förderunggestellt (vgl. Borchert/ Schuck 1992, S. 27).Die neue Begrifflichkeit des Protokolls verweist darauf, dass die sonderpädagogischeFörderung nicht mehr allein auf Sonderschulen beschränkt bleibensollte, sondern auch in unterschiedlichen Organisationsformen der allgemeinenSchule angemessen abgedeckt werden kann (vgl. ebd., S. 28).2.5.2.3 Die Empfehlungen der KMK 1994 und 2000Erst 1994 akzeptierte auch die Kultusministerkonferenz mit ihren „Empfehlungenzur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der BundesrepublikDeutschland“ die bereits im Protokoll formulierten Schulkonzepte. Sie bestärktevon nun an die moderne, personenbezogene und schulartenübergreifendeSichtweise sonderpädagogischer Förderung (vgl. Rosenberger 1998, S. 16).Bereits in dem Vorwort der Empfehlung wird diese Absicht ersichtlich:Die Erfüllung sonderpädagogischen Förderbedarfs ist nicht an Sonderschulengebunden; ihm kann auch in allgemeinen Schulen, zu denen auch berufliche44
Schulen zählen, vermehrt entsprochen werden. Die Bildung behinderter Menschenist verstärkt als gemeinsame Aufgabe für grundsätzlich alle Schulen anzustreben.Die Sonderpädagogik versteht sich dabei immer mehr als eine notwendigeErgänzung und Schwerpunktsetzung der allgemeinen Pädagogik.(KMK Empfehlungen 1994, S. 2f., Internetquelle)Im Gegensatz zu den Empfehlungen von 1972, die noch auf einer recht willkürlichenZuordnung der Kinder zu den zehn Sonderschulen basierten, werdennun sonderpädagogische Förderschwerpunkte beschrieben, auf die auch in denRegelschulen methodisch eingegangen werden kann (vgl. Rosenberger, S. 16).Die neu formulierten Empfehlungen streben zwei Ziele an, nämlichDie Weiterentwicklung der schulischen Förderung aller behinderter Kinder undvon Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlichen abzusichern und die Bemühungenum gemeinsame Erziehung und gemeinsamen Unterricht für Behinderteund Nichtbehinderte zu unterstützen. (KMK Empfehlungen 1994, S. 2f.,Internetquelle)Trotz dieser Bekräftigung der Integrationsentwicklung besteht die Kultusministerkonferenzweiterhin darauf, dass das Sonderschulsystem grundsätzlich erhaltenbleibt. Demzufolge werden einer ‚Schule ohne Aussonderung’ durch dieEmpfehlungen zwar noch nicht der Vorrang gegeben, aber durch sie entstehenjedoch Anstöße und Chancen für eine Weiterentwicklung, deren Ausgangspunkteine solche Schule sein könnte (vgl. Rosenberger 1998, S. 16f.).Für die Erreichung des von der Kultusministerkonferenz (1994, S. 2, Internetquelle)formulierten zweifachen Ziels sieht die Konferenz mehrere sonderpädagogischeFörderungsvarianten vor. Während die 1994 formulierten Empfehlungenallgemein alle Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in denBlick nehmen, wurden in den Folgejahren ergänzende Empfehlungen zu denjeweiligen einzelnen Förderschwerpunkten erarbeitet. Zunächst werden wir dievorgesehenen Formen schulischer Förderung für Kinder mit sonderpädagogischemFörderbedarf von den KMK-Empfehlungen von 1994 vorstellen, dieseim Darauffolgenden mit den im Jahre 2000 erschienenen KMK-Empfehlungenzum Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in Bezug setzenund die Empfehlungen dadurch für verhaltensauffällige Schülerinnen undSchüler konkretisieren.2.5.2.3.1 Sonderpädagogische Förderung durch vorbeugende MaßnahmenPräventive Maßnahmen können nach der KMK sowohl in der vorschulischenFrühförderung als auch in Schulen durchgeführt werden. Die Intention besteht45
darin, bei Kindern, die von Behinderung bedroht sind, einer Entstehung derBehinderung, falls möglich, entgegenzuwirken oder im Falle einer bereits bestehendenBehinderung, ungünstige Weiterentwicklungen zu verhindern (vgl.KMK 1994, S. 14, Internetquelle). Über die Umsetzung der geforderten Präventionsmaßnahmengibt die KMK allerdings nichts Näheres bekannt (vgl.Rosenberger 1998, S. 59).Im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sollen vorbeugendeMaßnahmen besonders dazu dienen, auf kritische Situationen für die kindlicheEntwicklung rechtzeitig Einfluss nehmen zu können. Häufige kritischeSituationen stellen dabei „Übergänge in neue Lebensabschnitte, zum Beispielbeim Beginn der Schulpflicht, beim Wechsel in eine andere Schule oder in denBeruf, aber auch in der Pubertät oder durch besondere Ereignisse wie Ortswechsel,schwere Krankheit oder Tod eines Elternteils, Scheidung der Eltern“(KMK 2000, S. 20f., Internetquelle) dar (siehe dazu auch Kapitel 2.3.1). Vorgesehenist die präventive Förderung im Förderschwerpunkt emotionale undsoziale Entwicklung in der Grundschule und in den Schulen im Sekundarbereichdurch kooperative Zusammenarbeit mit Sonderschulen, SonderpädagogischenFörderzentren oder mobilen Beratungs- und Unterstützungsdiensten, dieauch an allgemeinen Schulen eingerichtet sein können.Die wesentlichen Aufgabenbereiche der sonderpädagogischen Institutionenbilden:ooooInformation und Beratung von Lehrkräften und Eltern über die Wechselwirkungen gestörterInteraktionsprozesseBegründung von Interventionen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes stärkenund stützen,Hilfen zur Gestaltung vielfältiger sozialer und emotionaler Lernsituationen,Entwicklung eines Schulkonzepts, das in besonderer Weise die Förderung von Kindernund Jugendlichen dieses Förderschwerpunktes zum Ziel hat. (ebd., S. 21).Eine vorbeugende Wirkung hat die Vernetzung von unterschiedlichen Dienstbereichen,wobei vor allem eine Kooperation zwischen Jugend- und Jugendberufshilfeund der Schule entscheidend ist. Des Weiteren bewähren sich ganztägigeBetreuungsangebote, die über den Schulunterricht hinaus stattfinden, unddie schulische Unterstützung durch die Schulsozialarbeit (vgl. ebd.).2.5.2.3.2 Sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen UnterrichtDie KMK sieht in ihren Empfehlungen vor, dass behinderte Kinder dann eineallgemeine Schule besuchen können, wenn sichergestellt ist, dass die notwen-46
digen räumlichen, sächlichen und personellen Voraussetzungen gegeben sind,die eine ausreichende Förderung der Kinder, entsprechend ihres Förderbedarfs,ermöglichen. Die Förderung des Integrationsschülers findet primär im Klassenraumstatt und nur wenn notwendig auch neben dem Klassenraum (vgl. Sander1998, S. 60).Als notwendige Voraussetzung für die Umsetzung dieser Form schulischerIntegration gehören nach den Empfehlungen der KMKneben den äußeren Rahmenbedingungen, sonderpädagogisch qualifizierte Lehrkräfte,individualisierende Formen der Planung, Durchführung und Kontrolle der Unterrichtsprozesseund eine abgestimmte Zusammenarbeit der beteiligten Lehr- und Fachkräfte.Dabei ist eine inhaltliche, methodische und organisatorische Einbeziehung pädagogischerMaßnahmen, auch individueller Unterrichtziele und –inhalte, in die Unterrichtsvorhabenfür die gesamte Schulklasse vorzunehmen. (KMK 1994, S. 14, Internetquelle)Für Kinder mit Verhaltensstörungen bietet der Gemeinsame Unterricht dieChance, „ihr Handeln an den Normen einer weitgehend stabilen sozialenGruppe zu orientieren, aber auch zu erproben und zu kontrollieren“ (KMK2000, S. 22, Internetquelle).Ziel der sonderpädagogischen Förderung ist es, im Kontext der allgemeinenSchule Situationen zu schaffen, die das Selbstwertgefühl der Kinder festigen,gemeinschaftliches und kommunikatives Handeln anbahnen, die Selbst- undFremdwahrnehmung der Kinder fördern und dabei helfen, Konfliktlösungsstrategienzu entwickeln. Zur Erreichung dieser Ziele im Bereich des emotionalenErlebens und sozialen Handelns muss die allgemeine Schule bezogen auf dieinhaltlichen, personellen und räumlichen Aspekte über ein flexibles System derSchul- und Unterrichtsorganisation verfügen.So sollte die räumliche Ausstattung so konzipiert sein, „dass auch sonderpädagogischeFördermaßnahmen durchgeführt werden können, die individuelleLernangebote, Spiel- und Bewegungsübungen zum Abbau von Spannungszuständen,Selbstlernkonzepte sowie Lernen in Projekten ermöglichen“ (ebd.).Außerdem ist ein intensiver Austausch zwischen den Lehrern untereinander,sowie mit den Eltern und anderen Diensten notwendig. Abgestimmte sozialpädagogischeHilfen oder die Schulsozialarbeit stellen häufig eine notwendigeErgänzung der sonderpädagogischen Förderung dar (vgl. ebd.).47
2.5.2.3.3 Sonderpädagogische Förderung in SonderschulenDiese selektierende Beschulungsart kommt nach der KMK (vgl. 1994, S. 15,Internetquelle) nur für Kinder in Betracht, deren sonderpädagogischer Förderbedarfin einer allgemeinen Schule nicht abgedeckt werden kann. Die Überweisungan eine Sonderschule hängt nicht vordergründig von der Art und demSchweregrad der jeweiligen Behinderung ab, sondern vielmehr von den vorhandenenoder auch herstellbaren Förderungskapazitäten der wohnortnahenRegelschulen (vgl. Sander 1998, S. 60).Das Konzept der Sonderschulen unterscheidet sich hinsichtlich der Art desFörderschwerpunktes und des Angebots an Bildungsgängen. Die Förderungsoll alle Entwicklungen der Schüler und Schülerinnen fördern, die zu einemÜbergang an eine allgemeine Schule und in die Ausbildung führen können(vgl. KMK 1994, S. 15, Internetquelle).Die Förderung an Schulen des Förderschwerpunktes emotionale und sozialeEntwicklung erstreckt sich schwerpunktmäßig über den Primarbereich. DieSchulen fungieren als Durchgangsschule, mit dem Bestreben, eine frühestmöglicheRückführung in die Grundschule zu gewähren. Dabei unterrichten sienach den Lehrplänen der Grundschule. Schülerinnen und Schüler, die im SekundarbereichI weiterhin auf sonderpädagogische Förderung angewiesen sind,haben die Möglichkeit, einen Schulabschluss zu erlangen, „der ihren individuellenMöglichkeiten entspricht“ (KMK 2000, S. 23, Internetquelle). Die Trennungder sonderpädagogischen Förderung in Primar- und Sekundarbereich zieltdarauf ab, dass die „Auswirkungen negativer Vorbilder, Abhängigkeit undAusbeutung als problemverstärkende Faktoren abgeschwächt oder verhindertwerden“ (ebd.).Die Schule für Erziehungshilfe ermöglicht, dass Schüler und Schülerinnen besondere„auf die persönliche Situation zugeschnittene Förderangebote“ (ebd.,S. 24) erhalten. Durch die Zusammenarbeit mit anderen Diensten können Unterricht,Therapie und soziale Fürsorge auf ein Konzept abgestimmt werden.Eine detailliertere Beschreibung der Schule für Erziehungshilfe wurde bereitsin dem vorausgehenden Kapitel 2.4.3.1 vorgenommen, und wird daher an dieserStelle daher nicht weiter vertieft.48
2.5.2.3.4 Sonderpädagogische Förderung in kooperativen FormenBeruhend auf einer engen pädagogischen Zusammenarbeit, soll mit diesemKonzept „die Durchlässigkeit der Schularten und ihrer Bildungsgänge, die Erhöhunggemeinsamer Unterrichtsanteile und der Wechsel von Schülern aus denSonderschulen in allgemeine Schüler“ (KMK 1994, S. 15, Internetquelle) begünstigtwerden. Zwischen Sonderschule und Regelschule werden planvolleKontakte geschaffen. Kooperative Formen werden von manchen Schulen bevorzugt,da sie im Gegensatz zur Integration keine organisatorischen Veränderungenim Schulwesen mit sich ziehen.Bei der Umsetzung von Kooperation gibt es eine große Bandbreite von Möglichkeiten,die sich angefangen mit gemeinsamen Schulfesten und Ausflügenbis hin zu gemeinsamem Unterricht ziehen, und somit der Integration sehr nahekommen können (vgl. Sander 1998, S. 61).Kooperative Formen ereignen sich auch zwischen Schulen für Erziehungshilfeund allgemeinen Schulen. Die Zusammenarbeit ermöglicht den Beteiligten„Erfahrungen im unvoreingenommenen Umgang miteinander“ (KMK 2000, S.25, Internetquelle) zu sammeln. Außerdem tragen beispielsweise „Begegnungsveranstaltungen“(ebd.) für die Förderung des sozialen Handelns undemotionalen Erlebens aller Schülerinnen und Schüler bei.Eine Kooperation zwischen den Schülerinnen und Schülern kann nach verschiedenenMustern durchgeführt werden. Schüler der Schule oder Klasse fürErziehungshilfe können für eine gewisse Zeit in ausgewählten Fächern in derallgemeinen Schule unterrichtet werden. Ebenso können die Lehrpersonenzweier Schulen gemeinsam das Unterrichtsvorhaben planen. Weitere Möglichkeitensind „Probeunterricht im Rahmen einer Rückschulung, Austausch vonLehrkräften, gemeinsame Klassenfahrten, gegenseitige Einzelfallhilfe und Beratung,Maßnahmen der vorbeugenden Hilfe“ (ebd.).2.5.2.3.5 Sonderpädagogische Förderung im Rahmen von SonderpädagogischenFörderzentrenDie KMK Empfehlungen (vgl. 1994, S. 15f., Internetquelle) beschreiben diesenPunkt nur sehr vage. Sie geben lediglich an, dass sich im Hinblick auf die facettenreicherenDienstleistungen der sonderpädagogischen Förderung immermehr sonderpädagogische Förderzentren herausbilden. Bei ihrer Entwicklung49
sind verschiedene Richtungen auszumachen, „die einer fachlichen und organisatorischenWeiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung Rechnungtragen“ (KMK 1994., S. 15, Internetquelle). Die Förderzentren formen regionaleoder überregionale Institutionen, die sonderpädagogische Förderung „in präventiven,integrativen, stationären und kooperativen Formen möglichst wohnortnahund fachgerecht“ (ebd., S. 16) für einzelne oder mehrere Förderschwerpunktesicherstellen.Sander (vgl. 1998, S. 62) macht diesen undefinierten Sammelbegriff der sonderpädagogischenFörderzentren für die heutige Situation verantwortlich. Erbeklagt, dass die Erschaffung der Zentren auf sehr unterschiedlichen bildungspolitischenRichtungen beruht. In einigen Fällen kann ihr Aufgabenfeld demeiner Sonderschule sehr nahe kommen. Ihre Zuständigkeiten sind dann auf dieElternberatung sowie Absolventenbetreuung beschränkt und tragen relativ wenigzu dem Ziel ‚Schule ohne Aussonderung’ bei. Den gegensätzlichen Polformen Zentren, die keine eigenen Klassen und Schüler und Schülerinnen mehrhaben, sondern nur noch als Dienststellen von sonderpädagogischer Förderungfungieren und die Integration behinderter Kinder in der Region unterstützen.Zwischen diesen beiden Extrempunkten von Förderzentren gibt es zahlreicheZwischenformen. Eine eindeutige Zielsetzung des Förderzentrums kann dahernicht erfasst werden (vgl. Sander 1998, S. 62).Die KMK Empfehlungen von 2000 präzisieren die Aufgabenfelder der Förderzentrenfür den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Siebesagen, dass sie mit ihrer Förderung vor allem den gemeinsamen Unterrichtund die ambulante Arbeit unterstützen sollen. Sie führen verschiedene Formenvon Förderzentren auf. Hierzu zählen: „Sonderpädagogische Förderzentren mitSonderschulangebot und zusätzlicher sonderpädagogischer Förderung in allgemeinenSchulen sowie solche, die für alle Lehrkräfte, Eltern und andere Interessierte,sonderpädagogische Fachkompetenz bereitstellen und die Förderungunterschiedlicher Dienste koordinieren“ (KMK 2000, S. 26, Internetquelle).Sind die Förderzentren für mehrere Förderschwerpunkte zuständig, müssenLehrkräfte mit ausreichenden Kompetenzen für den jeweiligen Förderschwerpunktvorhanden sein sowie die nötige räumliche und sächliche Ausstattungvor Ort gegeben sein.50
Schüler und Schülerinnen, die neben ihrer sozialen und emotionalen Entwicklungzusätzlichen Förderbedarf in anderen Bereichen benötigen, brauchen einbesonders hohes „Maß an Kooperationsbereitschaft und Koordinierung bei derRealisierung eines ganzheitlichen und integrativen Förderansatzes“ (KMK2000, S. 26, Internetquelle).2.5.2.3.6 Sonderpädagogische Förderung im berufsbildenden Bereichund beim Übergang in die ArbeitsweltDieser Punkt behandelt die Vermittlung behinderter Jugendlicher von derSchule in die Arbeitswelt. Hierfür sieht die KMK vor, dass für jeden jungenMenschen „die Voraussetzung für eine dauerhafte Eingliederung in die Arbeitswelt“(KMK 1994, S. 16, Internetquelle) geschaffen werden soll. Wennder individuelle Förderbedarf es zulässt, sollen die Jugendlichen die Chance zueiner „qualifizierten Berufsbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf“(vgl. ebd.) erhalten. Ist dieser Weg nicht durchführbar, sollen berufliche Zukunftsperspektiven‚in einem für Behinderte vorgesehenen Ausbildungsberuf’bestehen. Für Jugendliche, die diese Möglichkeiten nicht wahrnehmen können,muss eine an die individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten des Jugendlichenangepasste Vorbereitung auf eine Berufstätigkeit mit selbständiger Lebensführungoder auf eine Beschäftigung in der Werkstatt angeboten werden.Für die berufliche Eingliederung ist eine Kooperation zwischen den zuständigenInstitutionen also den Schulen, Kammern, der Arbeitsverwaltung, denFachdiensten etc. vonnöten.Verhaltensauffällige Schüler und Schülerinnen haben erhöhte Schwierigkeitenbeim Übergang in die Berufs- und Arbeitswelt. „Neue personale Bezüge, ungewohnteAnforderungen, veränderte Kommunikationsstrukturen können zuUnsicherheiten im Verhalten, zu Leistungsversagen und Rückzug auf alte Verhaltensmuster,auch zu Aggressionen und zur Verweigerung führen“ (KMK2000, S. 26, Internetquelle).Daher ist es wichtig, dass diese Fördergruppe Unterstützung bei dem Übergangin die Berufs- und Arbeitswelt erfährt. Die Vorbereitung auf den Beruf und dasalltägliche Leben sind Kernthemen in den allgemeinen Schulen und Sonderschulendes Sekundarbereichs I. Für eine angemessene Berufswahlentschei-51
dung ist ein realistisches Selbstkonzept erforderlich. Betriebspraktika wirkenbegünstigend auf das Selbstkonzept, indem sie den Schülern und SchülerinnenErfahrung mit neuen Situationen und Personen einräumen und ihnen einenwirklichkeitsnahen Erprobungsrahmen für emotionale und soziale Handlungenbieten. Sie können einen Wechsel in das Berufsleben erleichtern. Im Förderschwerpunktemotionale und soziale Entwicklung erfolgt die Förderung „imberufsbildenden Bereich im gemeinsamen Unterricht, durch Kooperation vonSonderschulen mit beruflichen Schulen, in Sonderberufsschulen und in Berufsbildungswerken“(KMK 2000, S. 27, Internetquelle).Im berufsbildenden Bereich umfasst die sonderpädagogische Förderung imWesentlichen die Festigung erworbener emotionaler und sozialer Kompetenzen,die Unterstützung beim Erwerb der berufsbezogenen Kenntnisse und <strong>Fertig</strong>keitenund Hilfestellungen beim Austausch im Ausbildungsbetrieb.Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte der beruflichen Schulen und der sonderpädagogischenLehrkräfte mit den Ausbilderinnen und Ausbildern im Betrieb undmit der Arbeitsverwaltung ist dazu notwendig (vgl. ebd.).2.5.3 Heutiger StandWirft man einen Blick auf die heutige Situation im deutschen Schulsystem,zeigt sich, dass die gefassten Beschlüsse noch nicht wie vorgesehen umgesetztworden sind.Eltern eines behinderten Kindes haben in den meisten Bundesländern nicht dieWahl zwischen Sonderschule und integrativer Schule, sondern oft nur dieMöglichkeit, einen Antrag auf Integration zu stellen. Über eine Bewilligungoder Ablehnung des Antrags entscheidet die Schulbehörde. Ablehnungsargumentkönnen Haushaltsgründe sein, wodurch die Sonderschule vorgeschobenwird (vgl. Sander 2008a, S. 33).Das zeigt, dass trotz der größer gewordenen Öffnung des Schulwesens, dieIntegration immer noch nicht als widerstandsloses Schulkonzept umgesetztwird. Neben der Integration bestehen weiterhin die Separation und auch bestimmteFormen der Kooperation als konkurrierende Kräfte. Positiv zu beobachtenist, dass die Quote der integrativ beschulten Kinder immer mehr ansteigt,wenngleich sie im Vergleich zur Quote der Sonderschulen immer nochsehr gering ausfällt.52
Obwohl durch die KMK seit 1994 der Ausbau der Regelschulen hin zur Integrationfestgelegt worden ist, gelingt es immer noch vielen Schulbehörden, sichdiesem Beschluss zu entziehen (vgl. Sander 2008a, S. 33f.). Dabei ist die Umsetzungder Integration stark von den einzelnen Bundesländern sowie den existierendenacht Förderschwerpunkten abhängig. Im Förderschwerpunkt Lernenvariiert 2008 die Zahl der Förderschüler mit anerkanntem SonderpädagogischenFörderbedarf, die integrativ unterrichtetet werden von 61% in Bremenbis 1% in Sachsen, in Sprache von 100% in Bremen bis 3% in Sachsen-Anhalt,im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung von 100% inHamburg bis 5% in Niedersachsen, in Geistige Entwicklung von 18% in Hamburgbis 0,2% in Sachsen-Anhalt, Körperliche und motorische Entwicklungvon 79% in Brandenburg bis 3% in Bremen, Hören von 67% in Brandenburgbis 5% in Bayern und Sehen von 100% in Schleswig-Holstein bis 8% in Thüringen.Auch wenn die erfassten Zahlen nicht den Anspruch auf Validität haben,weisen sie dennoch auf große regionale Unterschiede hin (vgl. ebd., S.34).Dennoch sind die Änderungen, die die Integrationsbewegung im deutschenSchulwesen in den letzten Jahrzehnten hervorgerufen hat, als Erfolge zu verzeichnen,da mittlerweile tausenden behinderten Kindern und Jugendlicheneine Separation erspart bleiben kann (vgl. ebd.).2.6 Integrative KonzepteBei den Beschulungsarten von behinderten Kindern lassen sich integrierte undnicht integrierte sowie begrenzte und umfassende Formen der Integration unterscheiden.Von begrenzter Integration spricht man, wenn nur ein Teil einer Gruppe vonKindern mit Behinderung integriert wird. Dieser Fall war früher für gehörloseoder blinde Kinder zu beobachten, die zusätzlich noch eine geistige Behinderungaufwiesen. Für sie gab es keine Bildungsanstalten. Lediglich ein ausgewählterbegrenzter Teil der taubstummen und blinden Kinder wurde integriert.Umfassende Integration ist gewährleistet, wenn für alle Kinder mit Behinderung,unabhängig von ihren individuellen Ressourcen, Plätze im öffentlichenSchulwesen zur Verfügung stehen. In den Anfängen der Integration gab esSchulen für Kinder mit Behinderung, danach folgten Schulklassen für Kinder53
mit Behinderung in allgemeinen Schulen, heute wird Integration im gemeinsamenUnterricht angestrebt (vgl. Möckel 2002, S. 80f.).Seit den 70er Jahren entstanden im Rahmen der Integrationsbewegung zahlreicheSchulversuche und Modellprojekte zur Integration von behinderten Schülernund Schülerinnen in Regelschulen, von denen viele Formen in der Praxiserprobt wurden. Die einzelnen Organisationsformen unterscheiden sich dabeihinsichtlich der Höhe des Integrationsgrades (vgl. Sander 1998, S. 54).2.6.1 KooperationIn den Anfängen der integrativen Praxis ist das ‚Modell der Kooperation‘ entstanden,das eine Möglichkeit darstellt, behinderte Schüler und Schülerinnenschulisch in der Bundesrepublik zu integrieren. Die oben bereits angesprocheneWichtigkeit bezüglich der Art und Intensität der Kontakte zwischen behindertenund nichtbehinderten Menschen kann durch Kooperationsmodelle im schulischenKontext aufgegriffen und begünstigt werden. Die behinderten Schülerund Schülerinnen werden nicht mehr an Förderschulen, sondern an Regelschulenbeschult.An dem System Sonderschule wird allerdings weiter festgehalten, denn diebehinderten Schüler und Schülerinnen bleiben formal Schüler der Sonderschuleund werden weiterhin von ihr verwaltet. Sie werden zusammen mit ihren Lehrernräumlich in die Regelschule verlagert und dort wie gewohnt nach den sonderpädagogischenLehrplänen und –inhalten unterrichtet. Mit Hilfe einer Kooperationsklasseder Regelschule, die der Gruppe der Förderschulkinder zugeordnetist, werden integrative Schritte eingeleitet. Die aus Regelschülern bestehendeKooperationsklasse behält dabei bezüglich der Unterrichtung ebensoihren für sie vorgesehenen Lehrplan der Regelschule bei.Die kooperativen unterrichtlichen Vorgehensweisen stellen eine praktische,integrative Lösung dar, die sich kostenneutral, flächendeckend und unteilbarrealisieren lässt. Angesichts der Tatsache, dass sich die Entwicklung von Integrationsklassennur schleppend zeigt, gewinnt die Kooperation als integrativeVariante an Bedeutung (vgl. Markowetz 2007, S. 222).Auch die Deutsche Bildungskommission erkennt die sogenannten kooperativenSchulzentren als praktische, schulische Organisationsform der Integration an(vgl. Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates 1973, S. 87ff).54
Die Erfahrungen zur kooperativen Beschulung, wie sie beispielsweise in Baden-Württembergoder in Bayern gemacht wurden, sind ambivalent. Nebeneiner Reihe positiver Erkenntnisse zeichnen sich auf der anderen Seite ebensoMängel der Kooperation ab. Der Umfang und die Intensität der Kontakte zwischenbehinderten und nichtbehinderten Schülerinnen und Schülern können jenach Schule von gelegentlich spontanen bis hin zu regelmäßigen, dauerhaftenBegegnungen stark variieren. Ebenso reicht die Kooperation aufgrund der Zusammenstellungder ausgelagerten Klassen nicht immer an das Prinzip der Heterogenitätder Integration heran. Die Praxis zeigt, dass die in die Regelschulepositionierten Kleingruppen selten aus Schülern mit unterschiedlichen Behinderungenbestehen. Zudem sind die kooperativen Umsetzungen oft begrenztund umfassen nicht das gemeinsame Unterrichten in allen Fächern.Trotzdem eröffnet Kooperation in ihren Umsetzungen wichtige Schritte inRichtung Integration. Auch wenn sie nicht dem Idealbild der Integration entspricht,stellt sie gerade dann einen geeigneten Mittelweg dar, wenn die bei derIntegration benötigten umfassenden strukturellen und organisatorischen Veränderungensich nicht in absehbarer Zeit erfüllen lassen. Für Lehrer und Lehrerinnenbietet die Kooperation den Vorteil, sich zunächst kleinschrittig mit derqualitativen Integrationspädagogik vertraut zu machen (vgl. Markowetz 2007,S. 223).2.6.2 Integrative Modelle in DeutschlandBorchert und Schuck (vgl. 1992, S. 28) listen folgende integrativen Variantenauf, die für eine pädagogische Förderung in Frage kommen und sich teilweiseauch schon bewährt haben:• die Einzelintegration eines behinderten Kindes in der allgemeinenSchule mit eventueller Einbeziehung von Sonderpädagogen• die Unterstützung behinderter Kinder in allgemeinen Schulen durch dieZusammenarbeit mit Sonderschulen• die gemeinsame Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinderin Integrationsklassen unter Mitwirkung von Sonderpädagogen undSonderpädagoginnen• die Förderung schwerbehinderter Kinder in Sonderschulen, die nicht inallgemeinen Schulen aufgenommen werden können.55
Seit Mitte der 80er Jahre übernehmen immer mehr Bundesländer verschiedeneintegrative Organisationsformen in ihre Schulgesetze. Die Auflistung vonschulorganisatorischen Integrationsformen gestaltet sich nicht leicht, da trotzder 1994 durch die KMK formulierte neue einschlägige Rahmenempfehlungder Spielraum der einzelnen Bundesländer für die Umsetzung und Organisationvon Integration immer noch sehr groß ist, so dass die Entwicklung von neuenKonzepten nicht abgeschlossen ist (vgl. Sander 1998, S. 54).Ergänzende, detailreichere Erweiterungen zu integrativen Möglichkeiten imVergleich zu Schuck und Borchert enthält das Modell von Sander (vgl. 1998,S. 56), der insgesamt auf eine Bilanz von 13 Formen kommt. Auf der Skalazwischen Separation und Integration fallen nach ihm unter die stärksten separierendenEinrichtungen die segregierte Heimsonderschule, die offene Heimsonderschuleund die segregierte Sonderschule. Das Mittelfeld formen verschiedeneVarianten, die auf einer Kooperation von Sonderschullehrer und -lehrerin mit Regelschullehrer und -lehrerin an einer Regelschule beruhen. Derhöchste integrative Ausprägungsgrad findet in Regelklassen ohne Betreuungdurch Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen statt. Formen, bei denenkeine sonderpädagogische Förderung mit einfließt, sind allerdings nur dannangebracht und sinnvoll, wenn sich die bestehende Behinderung des Kindes imvorhandenen Schulumfeld lediglich leicht auswirkt (vgl. ebd., S. 57).Durch die möglichen integrativen Organisationsformen wird das sonderpädagogischeFeld im Hinblick auf seine Aufgaben und Zuständigkeiten weiterausgebreitet und seine Handlungen mit den Leistungen der allgemeinen Schulenverbunden. Die Förderschule wird zu einem sonderpädagogischen Unterstützungssystem,dessen fachliche Kompetenzen auch in andere Felder desSchulsystems einfließen und das so zu einer erhöhten Flexibilität des Schulwesensbeiträgt (vgl. Schuck/ Borchert 1992, S. 29).2.6.3 Rahmenbedingungen für integrative ProzesseDer schulische Integrationsprozess schließt einige notwendige Rahmenbedingungenfür ihre Umsetzung mit ein. So muss auch die personelle Besetzungabgestimmt werden. Innerhalb der schulischen Integration ist fast immer dieEinbeziehung einer sonderpädagogischen Kraft erforderlich, die die Regelschullehrkraftin ihrem Handeln berät und unterstützt. Ihre Aufmerksamkeit56
gilt aber auch dem behinderten Kind und den Mitschülern und Mitschülerinnen,denen sie in der Schulpraxis Hilfestellungen gibt.Meist wird die Zusammenarbeit der beiden Lehrkräfte im Unterricht, auch Ko-Unterricht genannt, so geregelt, dass die sonderpädagogische Kraft stundenweiseim Unterricht anwesend ist. In diesen Stunden bietet sich die Chance fürGruppenunterricht, Wochenplanarbeit und andere Formen binnendifferenziertenLernens und Arbeitens, während der Frontalunterricht zurückgedrängt werdenkann (vgl. Sander 2008a, S. 33). Sind mehrere Schüler und Schülerinneneiner Klasse auf sonderpädagogische Unterstützung im Unterricht angewiesen,so kann die Stundenzahl der Förderlehrerin erhöht werden. Die Stundenzahlder sonderpädagogischen Lehrkraft kann sogar soweit angezogen werden, dasssie die volle Unterrichtszeit einer Klasse begleitet, so dass sich ein Zwei-Lehrer-System einstellt.Sowohl der Ko-Unterricht als auch das Zwei-Lehrer-System können die Effizienzdes Unterrichts je nach dem Gelingen der Zusammenarbeit und der jeweiligenmethodischen Vorgehensweise erhöhen. Weitere Variablen, die durchdie Kooperation der Lehrkörper beeinflusst werden können, sind das sozialeKlassenklima, aber auch die Berufszufriedenheit der Lehrpersonen. Zudembelegen wissenschaftliche Untersuchungen, dass integrative Beschulungsformensowohl für behinderte als auch für nicht-behinderte Schüler förderlichersind, als eine separierte Beschulung. Die integrativ beschulten Kinder erreichenmindestens die gleichen Schulleistungen und zeigen sogar, bezogen auf diesoziale Entwicklung, größere Erfolge (vgl. Sander 2008a, S. 32).Die regulären Lehrplanziele der Regelschulklassen können teilweise durchsonderpädagogische Unterstützung von behinderten Kindern erreicht werden(zielgleiche Integration). Für einige jedoch müssen ungeachtet der sonderpädagogischenFörderung individuelle Lernziele formuliert und der Unterricht zudem‚zieldifferent’ gestaltet werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dassder Stoff zwar niedrigere Niveauanforderungen stellt, sich aber möglichst andem gleichen Themenbereich orientiert. Für Schüler, die zieldifferent unterrichtetwerden, gelten in der Regel andere Versetzungsbestimmungen, sie könnengrundsätzlich nicht die Klasse wiederholen und verlassen die Regelschul-Klasse nicht. Zieldifferentes Unterrichten eröffnet die Möglichkeit, den Leistungsdruckauf die Schüler, die zum Teil mit unerreichbaren Zielen konfrontiertwerden, erheblich zu senken. Auch die Lehrkraft wird vor realistische An-57
forderungen gestellt. Erfahrungen haben offenbart, dass ein als zieldifferenteingestufter Schüler nicht seine ganze Schullaufbahn auf diesem Status beharrenmuss, sondern es durchaus Schülerfälle gibt, denen es in einigen Fächerngelingt, zielgleich am Unterricht teilzunehmen (vgl. Sander 2008a, S. 32f.).„Integrationspädagogik hat dann ihren Auftrag erfüllt, wenn die Ausgrenzungvon Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung in Schulen und Vorschulenendgültig überwunden ist“ (Knauer 2002, S. 55).2.7 Integration von Schülerinnen und Schülern mit VerhaltensstörungenDie Integrationsbewegung hat auch im Förderschwerpunkt emotionale undsoziale Entwicklung ihre Spuren hinterlassen. Im Folgenden werden wir denForschungsstand zur integrativen Beschulung von verhaltensauffälligen Schülerinnenund Schülern darstellen, die daraus resultierenden Rahmenbedingungenund verschiedene Formen der Integrationsmöglichkeiten im Förderschwerpunktemotionale und soziale Entwicklung aufführen.2.7.1 Entwicklung der Schülerzahlen im Förderschwerpunkt emotionaleund soziale EntwicklungGenerell ist in diesem Schwerpunkt ein Wachstum der Schülerpopulation zubeobachten. Allein in dem Zeitraum 1999 bis 2003 ist in Deutschland der Anteilder Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt emotionale und sozialeEntwicklung um 28% gestiegen.Während die Zuwachsraten seit dem Jahre 2005 für alle neun sonderpädagogischenFörderschwerpunkte zusammen um die 26% beträgt, hat sich die Anzahlder Schüler und Schülerinnen mit sozial-emotionalem Förderbedarf nahezuverdoppelt (+96%).Eine Nebenentwicklung dieses Zeitraumes stellen die Zahlen dar, die diejenigenSchüler und Schülerinnen dieses Förderschwerpunkts bestimmen, die inallgemeinen Schulen unterrichtet werden. Es konnte ein erheblicher Anstiegvon Schülern (über 60%) verzeichnet werden, denen eine Beschulung an einerallgemeinen Schule zuteil wurde (vgl. Reiser/ Willmann/ Urban 2007, S. 7).28,4% aller Schüler und Schülerinnen mit emotional-sozialem Förderbedarfwerden in allgemeinen Schulen gefördert, 71,6% in Sonderschulen. In Relationzu dem hohen Integrationswert von 19,1% für diese Schülergruppe ist ihr pro-58
zentualer Anteil an Förderschulen, gemessen an allen Schülern und Schülerinnenmit sonderpädagogischem Förderbedarf, mit 7,1% niedrig (vgl. KMK2005, Internetquelle). Die Sonderschulbesuchsquote der betrachteten Schülergruppeliegt bei nur 0,34% (vgl. Willmann 2007, S. 21), im Schuljahr 2009/10liegt der Wert bei 0,4% (siehe Kapitel 2.4.3).Im Schuljahr 2003/2004 wurde nahezu ein Drittel aller Schüler und Schülerinnenmit Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung inRegelschulen unterrichtet. Hinzu kommt noch der Anteil der Schüler, die nichtexplizit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung zugeordnetsind, da ihnen kein sozial-emotionaler Förderbedarf zugesprochen wordenist, die jedoch aufgrund von Verhaltensproblemen in der allgemeinen Schuledurch eine Sonderpädagogin unterstützt werden (vgl. Reiser/ Willmann/ Urban2007, S. 7).Durch diese Zahlen kann der Eindruck erweckt werden, dass im besagten FörderschwerpunktBewegungen zu bestimmen sind, die der Monopolstellung derFörderschule entgegen wirken und integrative Prozesse immer weiter durchkommen.Die Tatsache, dass zwischen 3% und 6% (bzw. knapp 4% im Schuljahr2009/10) aller Schulpflichtigen eines Bundeslandes in eine Sonderschulformgehen, aber nur etwa 0,34% (bzw. 0,4% im Schuljahr 2009/10) allerSchulpflichtigen eine Förderschule im Bereich emotionale und soziale Entwicklungbesuchten, ist jedoch nicht klar, ob diese Werte als Indiz für besondersgelungene Integration verhaltensschwieriger Schüler und Schülerinnen zuinterpretieren sind, oder als eine Unterversorgung an Sondererziehungseinrichtungenfür diese Schülerschaft (vgl. Willmann 2007, S. 22).Ricking und Hennemann (2008, S. 362) führen dazu andaraus den Schluss zu ziehen, es läge eine hohe Integrationsquote vor, ist unzulässig.Ein großer Teil der zumindest 5-10% eines Schuljahrganges mit dem Förderbedarf inder sozialen und emotionalen Entwicklung bleibt ohne substanzielles schulisches Förderangebotun- oder unterversorgt.Und auch Cloerkes (2003, S. 21) kommt zu einer skeptischen Interpretation:Diese Unterschiede bewegen sich in einer Größenordnung, die es ausgeschlossen erscheinenlässt, dass es sich hier um eine natürliche Varianz in der Verteilung behinderterKinder und Jugendlicher handeln könnte.Des Weiteren bemängelt er: „die statistischen Angaben zur schulischen Integrationvon Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarfsind irreführend und deshalb hoch fragwürdig“ (ebd.).59
2.7.2 Forschungsstand zum gemeinsamen Unterricht mit Kindernmit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale EntwicklungNach empirischen Forschungsergebnissen erweist sich die schulische Integrationvon Schülern und Schülerinnen mit Verhaltensstörungen als schwierig.Wissenschaftliche Ergebnisse zu Integrationserfahrungen mit verhaltensauffälligenSchülern liegen allerdings erst in Ansätzen vor, wobei besonders inDeutschland die integrativen Kenntnisse hinsichtlich dieser Schülergruppe begrenztsind (vgl. Hillenbrand 2006, S. 211). Wissenschaftlichen Untersuchungenin den USA zufolge, besitzt diese Schülerpopulation die schlechtestenStartbedingungen für Integration (vgl. Hillenbrand 2003, S. 233). Die Schülererfahren im Rahmen integrativer Beschulung mehr soziale Ablehnung, Isolierungund Etikettierungen, weisen Mängel im Sozialverhalten auf, erhaltenmehr negative Zuwendung durch die Lehrkraft und belasten den Lehrer und dieKlassenatmosphäre (vgl. ebd., S. 234).Gemeinsamer Unterricht mit Schülern des Förderschwerpunkts emotionale undsoziale Entwicklung gilt unter Lehrkräften als besonders problematisch. Studienbestätigen, dass Lehrkräfte die Möglichkeiten zur Integration von Schülernmit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung kritischereinschätzen als bei Schülern und Schülerinnen mit dem Förderschwerpunktkörperliche und motorische Entwicklung oder im Bereich Lernen (vgl.Dumke/ Eberl 2002, S. 78). Des Weiteren wies Wocken (vgl. 1993, S. 97)nach, dass Mitschüler gegenüber Kindern mit dem Förderschwerpunkt emotionaleund soziale Entwicklung die höchste soziale Distanz haben und sie somitunbeliebter sind, als Schüler und Schülerinnen mit anderen Förderschwerpunkten.Reiser (vgl. 2002, S. 343) arbeitete in seinen Erhebungen aus Schulversuchenzum Unterricht mit Schülern mit sozialen Auffälligkeiten heraus, „dass derUnterrichtsstil und die Atmosphäre in integrativen Klassen positive Wirkungenauf diese Kinder“ (ebd.) hat. Soziale Kontakte und der verstärkte Akzent aufsoziales Lernen in den Integrationsklassen erlauben ein besseres Zurechtfindenin der Klasse dieser Kinder. Nach Reiser (vgl. ebd.) wiesen integrative Klassenpädagogische und didaktische Vorteile auf, die zu einer Reduktion von Verhaltensproblemenführen können. Dazu zählen: „höhere Toleranz für Verhaltensbesonderheiten,Betonung der Sozialerziehung, emotionaler Kontakt, Möglich-60
keiten hoher Eigenaktivität und Handlungsorientierung“ (ebd.). Trotz diesempositiven Rahmen, den integrative Klassen Schülern und Schülerinnen des betrachtetenFörderschwerpunkts bieten können, ist Reiser der Auffassung, dass„die Organisationsform ‚Integrative Klasse’ bei schwerwiegenden VerhaltensschwierigkeitenGrenzen hat“ (Reiser 2002, S. 343). Auch Goetze (vgl. 1990,S. 839) ist der Meinung, dass ‚verhaltensgestörte Schüler’ ungünstige Voraussetzungenfür die integrative Beschulung mit Regelschülern und -schülerinnenmitbringen. Seine Untersuchungsergebnisse weisen auf, dass das Selbstkonzeptdieser Schüler und Schülerinnen unter Sonderschulbedingungen vergleichsweisebesser ist als im Regelschulrahmen.Ein weiteres Problem stellt der Mangel an empirisch bewährten Konzepten zurpädagogisch-didaktischen Gestaltung des integrativen Unterrichts mit Schülernmit Verhaltensproblemen dar. Es zeigt sich, dass Lehrkräfte, die verhaltensauffälligeKinder in ihren Regelunterricht aufnehmen, ihren Unterricht meist nichtmerkbar verändern, sondern diesen Schülern und Schülerinnen eher mit Ablehnungund unangemessenen Handlungsweisen begegnen (vgl. Hillenbrand 2006,S. 211).Trotz dieser eher negativen Befunde hinsichtlich der integrativen Beschulungvon Schülerinnen und Schülern des Förderschwerpunktes emotionale und sozialeEntwicklung ist festzustellen, dass sie überdurchschnittlich häufig im GemeinsamenUnterricht beschult werden (vgl. KMK 2005, Internetquelle).Ein Problem zur Einschätzung der Eignung von integrativen Konzepten beidiesen Schülern besteht in der nur vereinzelten Zahl von Forschungsergebnissenauf diesem Gebiet. Zwar gibt es zahlreiche Studien, die nachweisen konnten,dass vom gemeinsamen Unterricht im Unterschied zur separierten Beschulungsowohl Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in vielenPunkten profitieren, jedoch sind diese Studien allgemein angesetzt undnicht speziell auf Schüler und Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt emotionaleund soziale Entwicklung bezogen (vgl. Textor 2007, S. 121).Die Politik hingegen begründet das Streben nach Gemeinsamem Unterrichtvon behinderten und nichtbehinderten Schülern und Schülerinnen allgemein füralle Förderschwerpunkte mit dem Aspekt der Chancengleichheit (vgl. ebd., S.122).Als Argumente für die Integration von Schülern mit Verhaltensstörungen gegeneine separierte Beschulung führen Goetze und Neukäter (vgl. 1994, S. 114)61
die Isolation der Betroffenen, die negative Etikettierung sowie das Defizit anpositiven Verhaltensmodellen an. Weitere negative Effekte der Sonderschulbeschulungfür diese Gruppe sind „fehlende kognitive Anregungen, schlechtereBildungs- und Berufschancen, Abbau pädagogischer Kompetenz der Regelschule,Personalisierung institutioneller Mängel“ (Hillenbrand 2003, S. 232).Im Gegenzug ergeben sich aus einer integrativen Beschulung die positivenFaktoren „normgerechte Modelle, positiver sozialer Gruppendruck, Vermeidungvon Stigmatisierung, pädagogische Verantwortlichkeit der Regelschulen“(ebd.).2.7.2.1 Das Projekt ‚emsoz’Um der Frage nachzugehen, wie sich Schüler und Schülerinnen mit dem Förderschwerpunktemotionale und soziale Entwicklung im integrativen Unterrichtentwickeln, wie sie gefördert werden und ob eine integrative Förderungerfolgreich ist, wurde unter der Leitung von Preuss-Lausitz (TU Berlin) undArnold (Universität Hildesheim) in Zusammenarbeit mit der Berliner Schulverwaltungvon 2001 bis 2004 das Projekt emotionale und soziale Entwicklung/Qualitätsentwicklung(‚emsoz‘) in zwei Ortsteilen Berlins durchgeführt.Im Rahmen des Projekts wurden Schüler und Schülerinnen des Förderschwerpunktsemotionale und soziale Entwicklung im Gemeinsamen Unterricht in derGrundschule beschult. Dabei wurde ein genauer Blick darauf geworfen, wiesich der Gemeinsame Unterricht unter Einbeziehung dieser Schüler und Schülerinnengestalten lässt und wie sich die Schülergruppe im Gemeinsamen Unterrichtverhält (vgl. Textor 2009, S. 113).Die Ergebnisse ergaben sich aus Unterrichtsbeobachtungen, die im Schuljahr2002/03 in 22 unterschiedlichen Klassen mit insgesamt 33 Schülern des Förderschwerpunktsemotionale und soziale Entwicklung organisiert wurden. DasBeobachtungsteam bildeten vier geschulte Sonderpädagoginnen sowie viergeschulte Studierende. Insgesamt wurden 82 Unterrichtsstunden beobachtet,wovon 28 Stunden mit zwei Lehrkräften besetzt waren. Bei den Lehrkräftenhandelte es sich zum Teil um Regelschullehrer und -lehrerinnen, die für diesenFörderschwerpunkt weiterqualifiziert wurden. Beide Lehrkräfte haben dabeieine vergleichbare Ausbildung durchlaufen und haben Erfahrungen, ihre Aufmerksamkeitauf die Arbeit mit der gesamten Gruppe zu lenken. Insgesamt62
elegen die Daten des Projektes ‚emsoz‘, dass Gemeinsamer Unterricht mitSchülern des Förderschwerpunktes emotionale und soziale Entwicklung prinzipiellmöglich ist und auch Erfolg haben kann. Die Resultate wurden von fastallen beteiligten Lehrern und Lehrerinnen als günstig bewertet.Die untersuchten Aspekte des Projektes beziehen sich auf die (1) Arbeitsteilungder Lehrkräfte und (2) das Schülerverhalten in doppelt besetzten Unterrichtsstundensowie die Wechselwirkung zwischen (3) Unterrichtsmethodikund (4) Klassenmanagement auf der einen Seite und Schülerverhalten auf deranderen Seite (vgl. Textor 2009, S. 114ff.).(1) Die Ergebnisse weisen auf, dass die Förderung der Schüler und Schülerinnenbegünstigt wird, wenn in doppelt besetzten Unterrichtsstunden beide Lehrkräftegemeinsam im Unterrichtsraum bleiben und sie die Unterstützung allerSchüler und Schülerinnen gemeinsam organisieren. In diesen Phasen zeigtesich, dass die Unterstützung der Schüler und Schülerinnen mit dem Förderschwerpunktemotionale und soziale Entwicklung und die der anderen Schülerund Schülerinnen zeitlich relativ ausgeglichen war.Trotz der gegebenen Möglichkeit zur separierten Förderung bevorzugen die inder Studie beobachtbaren Lehrkräfte es offensichtlich, beim GemeinsamenUnterricht zu zweit im Unterrichtsraum zu bleiben und die sonderpädagogischeFörderung in den Unterricht zu integrieren (vgl. ebd., S. 116f.).(2) Der doppelt besetzte Unterricht hat der Studie zufolge auch eine positiveWirkung auf das Schülerverhalten. Bei der Zusammenarbeit der beiden Lehrpersonenverhalten sich die Schüler und Schülerinnen in deutlich höherem Maßeaufgabenbezogen als in räumlich getrennten Unterrichtsphasen. Als einemögliche Erklärung für diesen Effekt zieht Textor (vgl. ebd., S. 118) in Betracht,dass die Anwesenheit von zwei Lehrpersonen bei den Schülern ein größeresGefühl von Sicherheit hervorruft. Diese Gegebenheit gewährt den Schülernbei der Bearbeitung ihrer Aufgaben die Gewissheit, bei Bedarf zeitnaheHilfe und Aufmerksamkeit erlangen zu können.(3) In Hinblick auf die Unterrichtsmethodik offenbaren die Beobachtungen,dass die Unterrichtstunden in relativ geringem Ausmaß geöffnet sind. Meist istdie Aufgabenstellung durch die Lehrkraft stark eingegrenzt, so dass eine indi-63
viduelle Entfaltung der einzelnen Schüler und Schülerinnen nicht möglich ist.Im Zusammenhang mit aufgabenbezogenem Verhalten der Schüler und Schülerinnendes Förderschwerpunktes emotionale und soziale Entwicklung erweistes sich als günstig, wenn dosierte Mitentscheidungsmöglichkeiten bestehenund Leistungsanforderungen differenziert werden. Kommt es zu geöffnetenArbeitsformen, wird meist Wochenplanarbeit angewendet, selten auch Freiarbeitund Stationenlernen. Diese offenen Formen werden jedoch meist ohneMitentscheidungsmöglichkeiten für die Schüler und Schülerinnen durchgeführt,so dass die genaue Aufgabenbearbeitung festgelegt ist. Stunden, in denendie Schüler und Schülerinnen Mitentscheidungsrechte erhalten, werden außerhalbder offenen Unterrichtsformen eingeräumt.Des Weiteren eröffnen die Ergebnisse einen signifikanten Zusammenhang zwischender Sozialform und dem Schülerverhalten. Die Studie deckt auf, dasssich die Schüler und Schülerinnen mit dem besagten Förderschwerpunkt inGruppen- oder Partnerarbeitsphasen in deutlich höherem Maße aufgabenbezogen(61%) verhalten als im Durchschnitt (46%). Bei kooperationsoffener Einzelarbeit,bei der die Schüler und Schülerinnen sich für die Lösung der Aufgabeabsprechen dürfen, erweist sich der Anteil aufgabenbezogenen Arbeitensmit 31% hingegen eher als gering.Generell lässt sich festhalten, dass die Rahmenbedingungen in der Klasse dieRealisierung von Kooperation nicht begünstigen, da viele Schüler und Schülerinnendes Förderschwerpunktes Schwierigkeiten haben, Mitschüler und Mitschülerinnenzu finden, die mit ihnen arbeiten möchten. Hinzu kommt, dassnach den Beobachtungen fast die Hälfte der Stunden diese Schüler und Schülerinnenauf Einzelplätzen verbrachten (vgl. Textor 2009, S. 118f.).(4) Der Zusammenhang zwischen dem Klassenmanagement der Lehrkraft unddem Schülerverhalten erweist sich nach den Beobachtungen zwar nicht als signifikant,deutet aber einen gewissen Trend an. So geben Schüler und Schülerinnendes Förderschwerpunkts emotionale und soziale Entwicklung bei einemgünstigen Klassenmanagement häufiger an, gerne anderen Kindern zu helfenund sich in der Klasse wohl zu fühlen. Nonverbale Verstärker durch die Lehrkraftwie z. B ein Lächeln oder ein kurzer Körperkontakt erweisen sich als positiveModifikatoren hinsichtlich des Schülerverhaltens. In Stunden, in denendie Schüler und Schülerinnen vorwiegend aufgabenbezogen arbeiten, kann64
signifikant häufiger nonverbales Verhalten von Seiten der Lehrkraft beobachtetwerden als in Stunden, in denen sich die Schüler und Schülerinnen unruhig,unkonzentriert und abgelenkt verhalten.So zeigt sich, dass es wichtig ist, dass die Lehrkräfte während der gesamtenUnterrichtstunde wertschätzendes und verständnisvolles Verhalten zeigen undaußerdem klar ihre Erwartungen an das Verhalten der Schüler und Schülerinnenformulieren (vgl. Textor 2009, S. 120f.).Die Ergebnisse der Studie decken auf, dass eine integrative Beschulung vonverhaltensauffälligen Schülern realistisch erscheint und vorteilhafte Wirkungenhaben kann.Es gibt aber auch Autoren, die einer Integration der Klientel kritisch gegenüberstehen. Reiser lehnt eine Abschaffung der Schulen für Erziehungshilfe ab (vgl.Reiser 1997, S. 271). Im Rahmen der Beschulungsüberlegungen von Selektionund Integration geht Reiser auf besondere Schwierigkeiten bei der Integrationvon Schülern und Schülerinnen mit Verhaltensauffälligkeiten ein.Die Schulen werden durch die sonderpädagogische Förderung, was immer das beiVerhaltensstörungen bedeuten mag, nicht durchweg in die Lage versetzt, massiveVerhaltensprobleme zu handhaben. Es kommt zur Selektion durch Schulverweise,Schulausschüsse, Schuleschwänzen, Heim- und Psychiatrieüberweisungen, wo dannwiederum Sonderbeschulung erforderlich wird. (ebd.).Preuss-Lausitz argumentiert gegen den Standpunkt, dass eine erfolgreiche Integrationverhaltensauffälliger Kinder nur bei ‚leichten Fällen‘ gelingen kann.Seiner Meinung nach ist die erfolgreiche integrative Beschulung vielmehr vonanderen Faktoren bzw. abgestimmten Rahmenbedingungen abhängig, die imFolgenden dargestellt werden (vgl. Klemm/ Preuss-Lausitz 2008, Internetquelle).2.7.3 Optimale Rahmenbedingungen integrativer Förderung verhaltensauffälligerKinderPreuss-Lausitz und Textor (vgl. 2005, S. 36f.) versuchen einen Katalog optimalerRahmenbedingungen schulischen Lernens für Kinder mit emotionalen undsozialen Problemen zu formulieren. Bei der Auswahl wesentlicher Kriterienachten sie weniger darauf, welche eindeutig zu verbesserten Ergebnissen führen,sondern vielmehr betrachten sie die Wahrscheinlichkeit, inwieweit mehrereFaktoren zusammenwirkend die Möglichkeit erhöhen, dass emotionalenBeeinträchtigungen und Verhaltensproblemen in der Schule entgegengewirktwerden kann und die Entwicklung der Kinder unterstützt wird. Im Folgenden65
werden wir die für unsere Arbeit bzw. unser Untersuchungsprojekt wichtigstenFaktoren aus der Liste optimaler Rahmenbedingungen vorstellen:• Ein verordnetes ‚Sitzenbleiben’ dieser Schüler und Schülerinnen soll,unabhängig von den individuellen Schwierigkeiten, untersagt werden.• Das vorhandene Personal, das für eine integrative Beschulung befähigtist, sollte an allgemeinen Schulen eingesetzt werden, um eine Überweisungder Kinder in Sonderschulen für verhaltensauffällige Kinder zuvermeiden.• Es sollten Einrichtungen und Ansprechpartner und -partnerinnen vorhandensein, die bei Krisen im Unterricht oder in anderen Konfliktfälleneinschreiten können. Ebenso können sie präventiv wirken, indemsie Schulstationen, Schülerclubs, Toberäume, Streitschlichter, AGs etc.initiieren, und so die lebensweltliche Bedeutung der Schule für dieKinder erhöhen.• Die Chance individuellen Lernens im sozialen und kognitiven Bereichkann durch jahrgangsübergreifende Lerngruppen, insbesondere in derPrimarstufe, gestärkt werden und zugleich Fähigkeiten wie Verantwortungund Hilfsbereitschaft bei den Kindern schulen.• Die Klassengröße sollte im Primarbereich nicht mehr als 20, im Sekundarbereichnicht mehr als 25 Kinder umfassen. Zwar sind für die Schulleistungder Kinder primär Faktoren wie die Art und Weise der Unterrichtsführung,Methodenvielfalt und innere Differenzierung entscheidend,aber günstige Klassengrößen wirken generell für das Klassenklimapositiv. Kleinere Klassen bieten daher für Kinder mit sozialen undemotionalen Problemen die Chance, auf ihre Schwierigkeiten bessereingehen zu können.• Lehrer und Lehrerinnen sollen die Möglichkeit haben, mit fachkompetentenUnterstützern zusammenzuarbeiten. Diese Personen können Sozialarbeiterund -arbeiterinnen, Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen,Erzieher und Erzieherinnen, Jugendtherapeuten und -therapeutinnen oder Schulpsychologen und –psychologinnen sein, diesich regelmäßig gemeinsam im Rahmen schulinterner Fortbildung mitFragen emotionaler und sozialer Entwicklungsprobleme von Kindernund Jugendlichen auseinandersetzen sollten. Auf ihre Hilfe sollen die66
Lehrer und Lehrerinnen sowohl in Teilen des Unterrichts als auch inForm von Beratung zurückgreifen können.• Jede Schule soll mindestens eine Stelle für eine Person zur Verfügungstellen, die im Bereich emotionaler und sozialer Schülerprobleme kompetentund ansprechbar ist.• Jede Schule sollte außerdem in fester Kooperation mit der Jugendhilfe,der Kinder- und Jugendpsychiatrie und den Beratungsstellen für Kinderschutzund Familienhilfe einhergehen. Ansprechpartner und -partnerinnen für die Zusammenarbeit von Schulen und Jugendhilfe solltensowohl auf regionaler als auch auf Landesebene vorhanden sein.Die angeführten Punkte bilden einige der Rahmenbedingungen aus der Formulierungvon Preuss-Lausitz und Textor. Sie weisen darauf hin, dass nicht alleVorschläge zeitgleich umgesetzt werden können. Nach ihnen sind sie vielmehrals „Handlungsorientierung“ (Preuss-Lausitz/ Textor 2005, S. 37) zu verstehen,an denen sich „kurzfristige Entscheidungen“ (ebd.) messen lassen.Im Anlehnung an die Ergebnisse einer Reihe anderer Studien, nennen Klemmund Preuss-Lausitz (vgl. 2008, Internetquelle) weitere günstige Voraussetzungenfür die integrative Beschulung der besagten Schülergruppe, die dem Kataloghinzuzufügen sind.• Es ist ein gewisses Mindestmaß an doppeltbesetzen Unterrichtstundenin den Klassen erforderlich, in denen eine sonderpädagogischeZusatzlehrkraft kontinuierlich dem Unterricht beiwohnt. Dabei warennicht mehr als zwei Kinder mit Verhaltensstörungen in der doppeltbesetzten Lerngruppe.• Es ist wichtig, dass die Lehrkräfte an Weiterqualifikationen teilnehmen,um ihre Kompetenzen hinsichtlich eines Unterrichts unterBedingungen von Heterogenität und im Umgang mit verhaltensauffälligenKindern zu erweitern (vgl. ebd.).2.7.4 Integrative Modelle im Förderschwerpunkt emotionale und sozialeEntwicklungSchon in den siebziger Jahren begannen in Deutschland Schulen damit, Kindermit Verhaltensstörungen und Lernstörungen besonders zu fördern. Die Anfängespielten sich in Grundschulen und <strong>Gesamtschule</strong>n ab. Die Förderung in derGrundschule bestand vornehmlich aus Veränderungen der Unterrichtsweise67
und der Schulstruktur und bezog Modelle der inneren Differenzierung in diePraxis mit ein. Jedoch war bei ihnen noch keine grundsätzliche Veränderungder Grundschularbeit zu beobachten und die ‚additive Lernförderung’ alleinverblieb ohne merkbare Erfolge.Einige der angewendeten Modelle in den Grundschulen konzentrierten sichgezielt auf die Förderung von Verhaltensstörungen. Die zwischen 1970 und1980 entstandenen Modelle wiesen bereits einige wichtige Einzelkomponenteneiner schulintegrierten Förderung bei Verhaltensproblemen auf, konnten jedochnicht in eine geregelte schulorganisatorische Struktur überführt werden.Mittlerweile sind die damaligen Modelle bereits von der Errichtung integrativerKlassen überholt worden.Zeitgleich zu der Erprobung von Modellen im Grundschulbereich fanden auchintegrative Innovationen zur Förderung von Schülern mit abweichendem LernundSozialverhalten in <strong>Gesamtschule</strong>n statt. Hier wurde das Gewicht auf sozialeGruppenarbeit, Spielgruppenarbeit, Projektlernen, Zusammenarbeit der Lehrerund Lehrerinnen und Beratung gelegt. In den 80er Jahren wurden durch dieIntegrationsidee die Modelle von Integrationsklassen, integrativen Regelklassen(Hamburg) und integrativem ‚Gemeinsamen Unterricht’ (Hessen) geschaffen(vgl. Reiser 2007, S. 72f.).Das inzwischen existierende Spektrum an möglichen integrativen Verfahren istvielfältig und vielschichtig und erlaubt keine überschneidungsfreie Gliederung.Es existieren bislang keine Forschungsergebnisse, die die Überlegenheit einesbestimmten Ansatzes gegenüber anderen widerspiegeln. Eher besteht die Vermutung,dass jeder Ansatz seine spezifischen Schwächen und Stärken mit sichträgt (vgl. Reiser 2002, S. 339).Integrative erzieherische Hilfen in Schulen lassen sich organisatorisch grob inschulintegrierte und in ambulante Maßnahmen klassifizieren. In der Praxiszeichnen sich aber durchaus auch Mischformen aus beiden ab (vgl. Reiser2007, S. 71).2.7.5 <strong>Integrierte</strong> schulische ErziehungshilfeUnter integrierter schulischer Erziehungshilfe fallen erzieherische Interventionenin einer Einzelschule, die über die primäre Prävention hinaus gehen. Beispielefür primäre Prävention sind die verhaltensförderliche Gestaltung desUnterrichts, Klassen- und Schulordnung, pädagogische Konferenzen, Elternar-68
eit, Kooperation mit Jugendhilfeeinrichtungen etc., welche ohne spezialisiertesPersonal durchführbar sind.Bei diesen integrierten Einschreitungen handelt es sich hingegen um spezialisierteFunktionen, die durch spezialisiertes Personal eingerichtet worden sindund der Förderung von Schülern des Förderschwerpunktes soziale und emotionaleEntwicklung dienen. Durch die Sonderschullehrkraft, die Qualifikationenin der Verhaltensgestörtenpädagogik besitzt, soll eine Überweisung von verhaltensauffälligenKindern in die Schule für Erziehungshilfe vermieden werden.Unter das spezialisierte Personal können Lehrkräfte fallen, die für eingegrenzteAufgaben wie zum Beispiel für ein Streitschlichter-Programm fortgebildetworden sind oder Beratungslehrer und Honorarkräfte sowie Erzieher, Sozialpädagogenund Sonderpädagogen (vgl. Reiser 2007, S. 71f.). Dabei handelt essich bei allen Personen um Mitglieder des Kollegiums der jeweiligen Regelschule.Innerhalb der Schule haben sie zwar eine besondere Funktion, sonstsind sie in die Klassen-, Jahrgangs-, Stufenteams integriert und ihr Handlungsrahmenvollzieht sich in Abstimmung mit den Kollegen und Kolleginnen. Diespezialisierten Kräfte stehen der Einzelschule dementsprechend kontinuierlichfallunabhängig zur Verfügung (vgl. Reiser 2002, S. 340).Von ausschlaggebender Bedeutung für die Entfaltungsmöglichkeiten der schulintegriertenErziehungshilfe ist die Kooperation mit der Schulleitung. Gewährtdie Schulleitung, den an der Erziehungshilfe beteiligten Sonderpädagogen und-pädagoginnen die nötige Unterstützung und den nötigen Freiraum bei der Ausführungihrer Aufgaben, können diese ihre Kompetenzen besser einsetzen undan andere Lehrer und Lehrerinnen weitergeben. Bei Bedarf können sie dieFunktion der Moderation und/oder der fachlichen Leitung im Lehrerkollegiumübernehmen sowie in der schulinternen Weiterbildung fachliche Anstöße geben.In diesem geschilderten Verhältnis trägt der Arbeitsauftrag der integriertenErziehungshilfe dazu bei, die Einzelschule dem Ziel einer inkludierenden pädagogischenEinrichtung näher zu kommen. Zeigt die Schulleitung hingegenDesinteresse an einer Zusammenarbeit oder herrscht keine Einigkeit im schulischenHandeln, ist die Arbeit des Erziehungshelfers stark beeinträchtigt (vgl.Reiser 2007, S. 80).69
2.7.6 Ambulante schulische ErziehungshilfeDiese Gegebenheit der schulinternen Lokalisation der Unterstützungsform bildetdie Abgrenzung zur ambulanten schulischen Erziehungshilfe. Bei ihr wirddas Personal von Personen gebildet, die zu anderen pädagogischen Einrichtungengehören, wie zum Beispiel Förderzentren oder Förderschulen. Sie werdenfür bestimmte Einzelfälle von der jeweiligen Regelschule als Unterstützung miteinbezogen. Die ambulante erzieherische Erziehungshilfe darf jedoch nur hinzugezogenwerden, wenn die Zuschreibung eines pädagogischen oder sonderpädagogischenFörderbedarfs beim jeweiligen Einzelfall besteht. Im Unterschieddazu kann sich die integrierte schulische Erziehungshilfe, ohne einefallspezifische Zuschreibung oder Kategorisierung in der Einzelschule, mitdem Schüler oder der Schülerin befassen. Der ambulante Dienst erhält teilweiseKritik dahingehend, dass sie die Funktion eines Vermittlungsdienstes für dieUmschulung der Schülerinnen und Schüler von der Regelschule in die Sonderschuledarstelle. Des Weiteren wird ihre fachspezifische Ausrichtung an dersonderpädagogischen Fachrichtung beklagt und stattdessen eine nichtkategorisierendeFörderung in den Bereichen Lernen, Sprache und Verhalten gefordert.Nach Reiser ist bei der Beurteilung der integrativen erzieherischen Maßnahmenvor allem relevant, ob die Anzahl der in den Sonderschulen untergebrachtenSchüler sinkt. Wird die integrative Zielsetzung konsequent verfolgt, dannist gegen eine ambulante schulische Erziehungshilfe und auch gegen einefachspezifische Ausrichtung nichts einzuwenden (vgl. Reiser 2002, S. 345).Mischformen können dann entstehen, wenn beispielsweise ein Sonderschullehreroder eine Sonderschullehrerin von einer Einzelschule angefordert wird unddort so große Aufgabenanteile im Schulalltag übernimmt, dass er/sie als Mitglieddes Kollegiums der Einzelschule angesehen werden kann und auch dortmit Formen der integrierten Erziehungshilfe arbeitet. Das Verhältnis der integrativenund ambulanten Erziehungshilfe ist dabei aber nicht als alternativ anzusehen,sondern vielmehr stehen sie in Ergänzung zueinander. Beide Formenhaben ihre Stärken (vgl. Reiser 2007, S. 71f.).Hinsichtlich der Entwicklung eines inkludierenden Schulsystems scheint dieschulintegrierte Erziehungshilfe einen erfolgversprechenden Weg aufzuzeigen(vgl. ebd., S. 85). Nach Reisers Ermessen eignet sich die integrierte schulischeErziehungshilfe, die von der Sonderschule ausgeht, besser für die präventiveArbeit, während er der Ambulanz bei schwerwiegenden Verhaltensproblemen70
den größten Effekt beimisst (vgl. Reiser 2002, S. 345). Also muss vor der Ü-berzeugung, durch die schulische Erziehungshilfe könnten alle Spezialeinrichtungenfür die Schüler und Schülerinnen des Förderschwerpunkts emotionaleund soziale Entwicklung abgeschafft werden, gewarnt werden.2.8 Blick auf EuropaHeute haben alle Länder der Europäischen Union prinzipiell einen integrativenWeg eingeschlagen. Jedoch erweisen sich die dabei gemachten Erfahrungenund Fortschritte der einzelnen Länder als uneinheitlich (vgl. Markowetz 2008,S. 263).Einigen Nachbarländern und europäischen Mitgliedsstaaten kommt hierbeieine Vorreiterrolle mit Vorbildfunktion zu. Italien und Skandinavien gehörenzu den Ländern, die seit Mitte der 70er Jahre am konsequentesten die schulischeIntegration verfolgt haben (vgl. ebd., S. 264).2.8.1 ItalienIn Italien ist die Integration seit 1977 gesetzlich verankert. Hier gibt es bereitskeine offiziellen Sonderschulen mehr. Daher dürfen allgemeine Schulen behinderteKinder nicht abweisen, sondern müssen sich auf die Förderbedürfnisseder Kinder einstellen. Das Verfahren zur Aufnahme eines behinderten Kindesan einer Schule gestaltet sich wie folgt:Zunächst stellt die Gesundheitsbehörde den sonderpädagogischen Förderbedarffest. Stützlehrer und -lehrerinnen begleiten das Kind während der Schulzeit.Dadurch erhält das Kind den Anspruch auf eine sonderpädagogische Förderungin der wohnortnahen Regelschule. Die Eltern erhalten bei der Schulwahl einuneingeschränktes Wahl-, Mitsprache- und Entscheidungsrecht. Italien verfügtdes Weiteren nicht über ein grundständiges Studium der Sonderpädagogik. Jenach Bedarf muss zur jeweiligen angemessenen Förderung die Kommune zusätzlichesLehr- und Betreuungspersonal finanzieren.Die Pflichtschulzeit von 8 Jahren gestaltet sich nicht selektiv. Sie umfasst einengemeinsamen Rahmenplan, keine Zifferbenotung, geringe Klassenfrequenzen(durchschnittlich 17 Schüler/-innen), die geregelte Ganztagsbetreuung und dieeinheitliche Lehrerbildung. Eine Selektion setzt erst nach der Pflichtschulzeitein (vgl. ebd.).71
2.8.2 DänemarkÜber ähnliche Rahmenbedingungen verfügt auch Dänemark. Dort wird Integrationin einer speziellen Schulgesetzgebung festgehalten und ist Bestandteildes starken sozialen Sicherheitsnetzes. Es liegt in der Entscheidungsmacht derEltern, ob ein behindertes Kind eine Sondergruppe oder den Regelunterrichtbesucht. Seit 1990 hat Dänemark die Kategorisierung nach Behinderungsartenabgeschafft und spricht nun nur noch allgemein von Kindern mit speziellenBedürfnissen. Das dänische Schulsystem beinhaltet eine ungeteilte neunjährigeVolksschule, die alle Kinder besuchen können. Sowohl das Sitzenbleiben alsauch das Aussondern liegt allein bei dem Willen der Eltern. Die Aufgabe derLehrkräfte ist es, für jedes Kind einen individuellen, entwicklungsbezogenenLehrplan im Rahmen der Gesamtlehrpläne zu erstellen und schulpraktisch zuverwirklichen. Schüler und Schülerinnen, die trotz eines eigenen Lehrplansdem Unterricht nicht angemessen folgen können, haben Anspruch auf individuelleHilfen und Spezialunterricht. Die finanziellen Mittel stellt die jeweiligeKommune zur Verfügung (vgl. Markowetz 2008, S. 265).2.8.3 SchwedenIn Schweden wird die Integration behinderter Menschen durch die konsequenteRealisierung der grundgesetzlichen Gleichstellung aller Bürgerinnen und Bürgerbestimmt. Wie Dänemark verfügt auch Schweden über eine neunjährigeobligatorische Einheitsschule, mit einer Unter-, Mittel- und Oberstufe. Bis zumdritten Schuljahr unterrichten grundsätzlich zwei gleichberechtigte Lehrer undLehrerinnen. Diese werden von weiteren Fachkräften, sogenannten Stützlehrer/-innen,begleitet, die schwerpunktmäßig für die integrative Betreuung undFörderung zuständig sind. Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeitenkönnen Spezialunterricht nehmen, dieser kann sich auch auf einige Stundenbeschränken (vgl. ebd.).2.8.4 NorwegenIn Norwegen haben alle Kinder das Recht auf einen gemeinsamen Unterricht.Die meisten staatlichen Sonderschulen wurden bereits geschlossen oder inKompetenzzentren umgewandelt, so dass sie die Kinder mit besonderem Förderbedarfin der Regelschule unterstützen. Die Anzahl der Fachzentren fürSeh-, Hör-, Sprach- und emotionale Störungen beträgt landesweit 13. Sieben72
egionale Zentren haben sich auf geistig- und mehrfachbehinderte spezialisiert(vgl. Markowetz 2008, S. 265).2.8.5 DeutschlandDeutschland verfügt zweifelsfrei über ein ausgebautes und nach Behinderungdifferenziertes Sonderschulwesen. Sonderpädagogische Förderung wird entsprechendder angebotenen Schularten in zehn Kategorien (bzw. aktuell nurnoch in acht sonderpädagogische Schulformen (vgl. Ministerium für Schuleund Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2010f, Internetquelle))aufgeteilt. Die Entwicklung der schulischen Integration ist aufgrund der Kulturhoheitder Länder dabei von Bundesland zu Bundesland verschieden. Es isteine zunehmende Dezentralisierung der Mittelzuweisung im deutschen Bildungswesenzu beobachten. Die Schulen schreiben ihr eigenes Schulprogramm.Viele Schulen binden dabei die Bereiche Integration, Unterricht undErziehung als verpflichtende Bestandteile in das Programm mit ein (vgl. Hausotter2002, S. 481f.).Die Erfahrungen von gemeinsamem Unterricht von behinderten und nichtbehindertenKindern reichen nun schon über 30 Jahre zurück (vgl. Markowetz2008, S. 272).Nicht in allen Bundesländern besteht Einigkeit über das Verständnis und dieDefinition von Integration. Während einige unter gemeinsamem Unterricht diezielgleiche Integration verstehen, setzten andere ihn als zieldifferente Integrationum (vgl. Hausotter 2002, S. 481). Verlässliche Angaben über den Stand derIntegrationsentwicklung der einzelnen Bundesländer gibt es allerdings nurspärlich (vgl. Markowetz 2008, S. 271).Allgemein lässt sich sagen, dass bundesweit der Anteil der behinderten Kinder,die eine Förderschule besuchen, noch immer über 95% liegt. Expertenschätzungengehen davon aus, dass die Zahl der integrativ beschulten Kinder bei 5%liegt. Bei einigen Bundesländern liegt der prozentuale Anteil dieser Schülerund Schülerinnen über dem Bundesdurchschnitt, so kommt Schleswig-Holsteinbeispielsweise auf 25% und Hamburg auf 20%. Es lässt sich insgesamt eineinheitliches langsames Ansteigen der statistischen Integrationsquote erkennen(vgl. ebd., S. 272).Jedoch zeigt sich gleichzeitig, dass die Zahl der in Sonderschulen beschultenstetig zunimmt. Nach der Analyse der KMK-Statistik (2010, Internetquelle) ist73
der Anteil der Schüler und Schülerinnen an Förderschulen zwischen 2000 und2008 von 4,6% auf 4,9% gestiegen.Der Anteil integriert beschulter Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarfhat an allgemeinen Schulen seit 2000 von 12,4% auf 18,4% im Jahr 2008leicht zugenommen. Von diesen besuchten 52.900 (59,5%) die Grundschule,15.100 (17,0%) die Hauptschule und 5.200 (6,0%) die integrative <strong>Gesamtschule</strong>.Von den Integrationsschülern sind 39.800 (44,8%) dem FörderschwerpunktLernen zugeordnet, 19.900 (22,4%) entfallen auf den Bereich emotionale undsoziale Entwicklung und 13.800 (15,6%) auf den Förderschwerpunkt Sprache(siehe Abb. 3) (vgl. KMK 2010, Internetquelle).Das bedeutet, dass die überwiegende Anzahl dieser Schülergruppe in segregierendenMaßnahmen gefördert wird. So folgt dem allmählichen Anstieg integriertbeschulter Kinder und Jugendlicher mit einem sonderpädagogischen Förderbedarfkein Nachlassen der Sonderbeschulung.FörderschwerpunktLernenSehenHörenSpracheKörperliche und motorische EntwicklungGeistige EntwicklungEmotionale und soziale EntwicklungFörderschwerpunkt übergreifend bzw.ohne ZuordnungKrankeInsgesamtFörderschulen Allgemeine Schulen43.51,32,89,56,319,09,06,02,5100,044,82,14,415,67,02,922,40,70,2100,0Abb. 3: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in allgemeinenSchulen nach Förderschwerpunkten 2008 (KMK 2010, S. 15, Internetquelle)Trotzdem ist die rechtliche Ausdehnung der schulischen Integration auch inDeutschland festzustellen. Am weitesten fortgeschritten ist die Gesetzgebungin Schleswig-Holstein, in Hessen, im Saarland und in Brandenburg. In diesenBundesländern sind keine Schulversuche mehr vorgesehen. In Sachsen-Anhalthingegen wird die zieldifferente Integration in Grundschulen erprobt und inBremen, Hamburg und Nordrhein Westfalen werden integrative Konzepte in74
Schulen der Sekundarstufe I noch immer in Schulversuchen untersucht. In Berlinwird der Integration von geistig- und mehrfachbehinderten Kindern einSchulversuch zuteil. Lediglich in Bayern wird die zieldifferente Integrationnoch nicht angenommen bzw. nur in Einzelfällen geduldet.Leider besteht in allen Bundesländern, unabhängig von ihrem Grad der gesetzlichenVerankerung der Integration, ein Haushaltsvorbehalt. Diese Regelunghatte in den letzen Jahren teilweise einen Stillstand der Integration zur Folge.Andererseits wurden dadurch integrative Organisationsformen entwickelt, diemit wenig Kosten gemeinsamen Unterricht gewähren können, wie z.B. dasAußenklassenmodell in Baden-Württemberg, das Konzept der Außenklassen inNordrhein-Westfalen oder das Organisationskonzept der integrativen Regelschulein Hamburg.Das Elternwahlrecht ist in den meisten Bundesländern eingeschränkt. Häufigregeln Förderausschüsse der Schulaufsicht über die Feststellung des sonderpädagogischenFörderbedarfs, welcher Förderort und welche personelle und sächlicheAusstattung sich für ein behindertes Kind am besten eignen, so dass auchdie Tatsache, welches Kind Zugang zur Integration erhält, die Entscheidungder Schulaufsicht ist (vgl. Markowetz 2008, S. 272f.).In den Ländern sind zur Unterstützung der integrativen Praxis Kooperationssystemezwischen der Förder- und Regelschule entstanden. Dabei nehmen dieFörderzentren eine zunehmende bedeutende Rolle ein. Teilweise sind die Förderzentrenein zusätzlicher Arbeitsbereich von Förderschulen geworden, die inihrem Aufgabenbereich Eltern, Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnender Regelschulen beraten und/oder durch Ambulanzlehrer und –lehrerinnen direkt unterstützen (vgl. Hausotter 2002, S. 481).Die Integration in der Sekundarstufe und in den Übergangsphasen von derSchule zum Beruf ist in Deutschland immer noch ein schwieriges Thema (vgl.ebd.).2.8.6 ZusammenfassungAn den Beispielen der europäischen Länder lässt sich erkennen, dass es in denletzten Jahren im integrativen Bereich wesentliche gesetzliche Innovationen imBildungswesen für Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarfgegeben hat. Einige Mitgliedsländer haben die sonderpädagogische75
Förderung als unterstützende Maßnahmen für die Regelschule deutlich formuliert.Welchen Stellenwert die Förderschule gegenüber der Integration einnimmt, istabhängig von der Gestaltung des bestehenden Bildungssystems des jeweiligenLandes. Ist die Existenz der Sonderschulen gering, ist deren Rolle auch strukturellbescheiden. Umgekehrt in Ländern wo ein gut ausgebautes sonderpädagogischesBildungssystem vorherrscht, werden Sonderschulen aktiver in den Integrationsprozesseingebunden Die Kooperation zwischen Sonderschule undRegelschule ist dort besonders anerkannt. Allerdings gibt es auch an diesenOrten Kritiker, die an der Monopolstellung der Sonderschule festhalten und dieKooperation als Bedrohung der sonderschulischen Existenz ansehen.Diese schulischen Machtkämpfe stellen keine guten Rahmenbedingungen fürGemeinsamen Unterricht dar. Die Regelschule ist daran gewöhnt, ihre Problemebzw. Problemfälle an die Sonderschulen zu überweisen und die Verantwortungan sie abzugeben. Zusätzlich verschärft wird die Stellung der Sonderschulendurch die Haltung und Einstellungen vieler Sonderschulkräfte, die sich alsdie Experten und Expertinnen ansehen und sich besondere Kompetenzen zuschreiben(vgl. Hausotter 2002, S. 478).EU-Länder mit getrennten Gesetzen für Sonder- und Regelschule versuchen,eine gemeinsame Gesetzesvorlage für beide Bildungsbereiche zu schaffen unddurchzuführen. Außerdem lässt sich bei vielen Ländern ein verstärkter Akzentauf die Lehreraus- und -fortbildung, die Erweiterung von Kompetenzen für dieintegrative Praxis und die Qualität beobachten. Alle Länder vertreten dabei dieAnsicht, dass Lehrern und Lehrerinnen hinsichtlich der Intervention bei speziellenBehinderungen Angebote zur Qualifikation während ihrer gesamtenberuflichen Tätigkeit zur Verfügung stehen sollten. Jedoch werden die Zugängefür eine Qualifizierung je nach Land anders organisiert. Nicht überall ist dasAngebot der Fortbildungen freiwillig und auch nicht immer kostenlos (vgl.ebd.).Deutliche Unterschiede zwischen den Ländern zeigen sich in der Lehrerausbildung.Länder wie Finnland, Italien oder Schweden haben den Bereich der sonderpädagogischenFörderung in die Grundausbildung für alle Lehrer und Lehrerinnenintegriert. Bei anderen Ländern kann sie als Aufbaustudium oder Aufbaukurserworben werden. So bietet beispielsweise Norwegen ein Aufbaustudiummit dem Schwerpunkt integrative Unterrichtsarbeit an. Das Sonderschul-76
studium mit bestimmten Fachrichtungen wird von den Ländern hinsichtlichseines geringen Integrationsbeitrags abgelehnt (vgl. Hausotter 2002, S. 478).Allein in Deutschland und in Luxemburg stellt die Sonderpädagogenausbildungnoch einen getrennten Zweig dar. Die jeweilige Art der Lehrerausbildungder Länder könnte die unterschiedlichen organisatorischen Zugänge zur Förderungvon Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf erklären (vgl. ebd.,S. 477).Laut Aussagen einiger Länder beeinflusst die jeweilige Qualität der Lehrerausbildungund der vorhandenen Unterstützung sowie weitere Variablen wie Klassengrößeund Arbeitsbelastung der Lehrer und Lehrerinnen die Einstellung vonLehrkräften gegenüber Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Sinddie Rahmenvariablen für Lehrer schlecht, sind sie besonders im Sekundarbereichdes Bildungswesens weniger häufig bereit, Schüler mit sonderpädagogischemFörderbedarf zu integrieren. Generell sind Lehrer und Lehrerinnen voreingenommengegenüber Schülern und Schülerinnen mit schweren emotionalenProblemen (vgl. ebd., S. 478). Der Hintergrund dieser Tatsache ist für unsereArbeit bedeutsam. Mit welchen Einstellungen die Lehrerinnen und Lehrerder integrativen Beschulung von Schülerinnen und Schülern des Förderschwerpunktsemotionale und soziale Entwicklung gegenüberstehen, werdenwir mit dem Fragebogen überprüfen (siehe Kapitel 5).Eine weitere Einstimmigkeit aller Länder zeigt sich beim Umstieg von demBegriff ’Special Education’‚ auf den Begriff ’Special Educational Needs‚(SEN), sonderpädagogischer Förderbedarf. Mit der neuen Begrifflichkeit wirdweniger an der Institution Sonderschule festgehalten. Einige Länder wie beispielsweiseDänemark und Finnland verzichten mittlerweile gänzlich auf eineKategorisierung (vgl. ebd., S. 474).Obwohl in den meisten Ländern die Bildungsminister die Verantwortung fürden sonderpädagogischen Bereich tragen, gibt es des Weiteren einen deutlichenund weit verbreiteten Trend in Richtung Dezentralisierung. Als Beispiele lassensich die Niederlande, Großbritannien und Frankreich nennen. DieserWechsel wirkt sich in einigen Ländern vorteilhaft auf die integrative Praxisaus, da die Kommunikationswege zwischen den Gemeinden und den verantwortlichenPolitikern erleichtert werden und die regionale und lokale Einflussnahmebezüglich der integrativen Rahmenbedingungen und Entwicklungenansteigt (vgl. Hausotter 2002, S. 477). Zudem lässt sich beobachten, dass das77
Elternwahlrecht in manchen Ländern gesetzlich verankert worden ist (vgl.Hausotter 2002, S. 474).Bezüglich der Einstellung der Eltern wurde berichtet, dass die Eltern einer Integrationgenerell positiv gegenüberstehen, die jeweilige Einstellung jedocherheblich von den persönlichen Erfahrungen geprägt wird. Negative Haltungengegenüber Integration entstehen eher in Ländern, in denen die Angebote undEinrichtungen in einem Sonderschulwesen konzentriert sind und nicht in dieRegelschule verlagert werden. Werden sonderpädagogische Leistungen jedochauch in Regelschulen angeboten, fallen die Einstellungen meist positiv aus. Beischweren Behinderungsformen lässt sich beobachten, dass Eltern meist eineseparate Förderung vorziehen, in dem Glauben, dass Sonderschulen bessereFachkenntnisse und Kompetenzen zur Verfügung haben (vgl. ebd., S. 479).2.9 InklusionMit der Behindertenrechtskonvention wird eine Abkehr vom medizinischenModell hin zum sozialen Modell von Behinderung in rechtsverbindlichenNormen festgeschrieben, so dass Menschen mit Behinderungen nicht mehrlänger über Defizite definiert werden (vgl. Beauftragter der Bundesregierungfür die Belange behinderter Menschen 2008, S. 2).Damit verbunden ist ein vielfältiger Perspektivenwechsel:• vom Konzept der Integration zum Konzept der Inklusion;• von der Wohlfahrt und Fürsorge zur Selbstbestimmung.• Menschen mit Behinderungen werden von Objekten zu Subjekten;• von PatientInnnen zu BürgerInnen;• von Problemfällen zu TrägerInnen von Rechten (Rechtssubjekten). (ebd.)Nach der Behindertenkonvention sind die Vertragsstaaten völkerrechtlich verpflichtet„das Recht auf Bildung für Menschen mit Behinderung ohne Diskriminierungauf der Grundlage der Chancengleichheit in einem inklusiven Bildungssystemzu gewährleisten“ (Schuhmann 2009, S. 2).An der Entstehung der Konvention waren zahlreiche Behinderten- und Nichtregierungsorganisationenbeteiligt. Die Grundlegung der Generalversammlungder Vereinigten Staaten fand bereits im Jahr 2001 statt. Seitdem waren insgesamt192 UN-Mitgliedsstaaten am Entstehungsprozess beteiligt. Der Konventionstextwurde in sechs offiziell anerkannten Sprachen verfasst (Arabisch, Chinesisch,Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch).In Artikel 24 (Recht auf Bildung) verpflichten sich die Vertragsstaaten zur Bereitstellungeines „inclusive education system at all levels“ (Wlaschek 2010, S.78
10). In diesem Artikel kommt das Inklusionsprinzip als Menschenrecht zumTragen. Eine deutsche amtliche Arbeitsübersetzung liegt vor, allerdings wird,wie in der Salamanca-Erklärung (s.o.), in der Übersetzung des Inklusionsprinzipsaus Artikel 24, die im Januar 2008 zwischen den Ländern Deutschland,Lichtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmt wurde, „inclusion“ und„inclusive“ durchgängig mit „Integration“ und „integrativ“ übersetzt. Durchdiesen Begriffstausch wird das Menschenrecht auf eine inklusive Bildung nichtersichtlich (vgl. Lindmeier 2008, S. 368). So heißt es im ersten Absatz vonArtikel 24 aus deutschsprachiger Übersetzung:Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung.Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zuverwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem (an inclusiveeducation) 1 auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühldes Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor denMenschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken,b) Menschen mit Behinderung ihre Persönlichkeit, ihre Begabung und ihre Kreativitätsowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassenc) Menschen mit Behinderung zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zubefähigen (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen2008, S. 22).Lindmeier beklagt die falsche begriffliche Übersetzung des englischen Wortesund ist der Meinung, dass eine Übersetzung mit dem Wort „Integration“ nichtbefriedigend die Bedeutung der Inklusion beinhalte. „Inklusion wäre auch gewissnicht das erste und mit Sicherheit auch nicht das letzte Lehnwort, das indie deutsche Bildungspolitik übernommen wird“ (Lindmeier 2008, S. 369). Erist der Auffassung, dass es sich bei dem Ausschluss des Wortes „inclusion“nicht um ein Problem der Übersetzung handelt, sondern dieser vielmehr auszwei unterschiedlichen bildungspolitischen Grundüberzeugungen resultiert(vgl. ebd.).2.9.1 Die frühen EntwicklungenDen erstmaligen Anlauf zu einer stärkeren Wahrnehmung des Menschenrechtsauf Bildung auf internationaler Ebene machten die Weltbildungskonferenz inJomtien/Thailand 1990 und das Weltbildungsforum in Dakar 2000. Aufgrundder großen Zahl von Menschen, denen Bildung immer noch verwehrt wird,wurde auf der Weltbildungskonferenz entschieden, vereint die Initiative zuergreifen, damit allen Menschen Zugang zu einer Grundbildung zuteil wird.1 Ürsprüngliche Formulierung aus dem Orginaltext (vgl. Lindmeier 2008, S. 368)79
Diese Inangriffnahme wurde als Forderung der ‚(Grund-) Bildung für alle’ (Educationfor All, EFA) bezeichnet (vgl. Lindmeier 2008, S. 364).2001 wurde die UNESCO-Initiative ‚Das Recht auf Bildung für Menschen mitBehinderung: Für Inklusion’ gegründet. Ihre Aufmerksamkeit richtete sich vorallem auf behinderte Menschen und ihre Belange und Bedürfnisse. 2005 gabdie UNESCO Initiative eine kleine Schrift heraus, die sogenannten ‚Guidelinesfor Inclusion: Ensuring Access to Education for All’, die Teil des UNESCO-Programms ‚Bildung für alle’ ist. Sie soll den einzelnen Ländern dabei helfen,ihre Bildungspläne mit dem Konzept der Inklusion zu vereinbaren (vgl. ebd.).In den ‚Guidelines für Inclusion’ haben sich bei der Konzeptualisierung vonInklusion folgende Schlüsselmerkmale besonders bewährt (vgl. ebd., S. 367):1. „Inklusion ist ein Prozess“ (ebd.), der nie endet. In ihm muss immerweiter nach besseren Mitteln und Wegen gesucht werden, um auf dieHeterogenität eingehen zu können.2. „Inklusion beschäftigt sich mit der Identifizierung und Beseitigung vonBarrieren“ (ebd.), mit dem Ziel, Verbesserungen in der Politik und Praxishinsichtlich des Abbaus von Teilbarrieren zu erlangen.3. „Inklusion bedeutet die Präsenz, Teilhabe und Erfolg aller Schüler“(ebd.) in der allgemeinen Schule zu bewirken.4. „Inklusion bezieht sich insbesondere auf Gruppen von Lernenden, dievon gesellschaftlicher Marginalisierung, sozialem Ausschluss undSchulversagen bedroht sind“ (ebd.). Für diese Gruppe müssen Schritteeingeleitet werden, die ihre Präsenz und ihre Teilhabe sowie ihren Erfolgam allgemeinen Bildungssystem sicherstellen.2.9.2 Die Formung des Inklusionsbegriffs im internationalen RaumDer Begriff wurde durch die Salamanca-Erklärung der UNESCO von 1994international publik. Die Salamanca-Erklärung, der auch ein Aktionsplan beigefügtwurde, ist von entscheidender Bedeutung für die ‚inclusion’. An derKonferenz in Salamanca nahmen insgesamt 92 Länder und 25 internationaleOrganisationen teil (vgl. Liesen 2004, S. 73). Die damals von über 100 Vertreternunterzeichnete Erklärung sieht die Umsetzung einer ‚inclusive education’,d. h. „einer gemeinsamen Bildung und Erziehung von Kindern“ vor. Mit dieserArt von Bildung soll „den individuellen Bedürfnissen aller Kinder, unabhängigvon Beeinträchtigungen, Rechnung getragen werden“ (Krach 2009, S. 385).80
Im angloamerikanischen Raum wurde der Begriff bereits schon vor der Erklärungverwendet. In Kanada, das häufig als Geburtsland der inklusiven Schulebetitelt wird, ist ‚inclusion' im französischsprachigen Kanada einfach mit ‚intégration'übersetzt worden. Kanadische Protagonisten der Inklusion verwendetendie beiden Wörter teilweise synonym nebeneinander (vgl. Sander 2001,Internet).Auch im deutschsprachigen Raum wurde das englische Wort ‚inclusion’ in derErklärung und in seinem Aktionsrahmen mit dem bereits bestehenden WortIntegration übersetzt. Jedoch fehlen sowohl in der Erklärung als auch im Aktionsrahmenpraktisch-didaktische Methoden zur konkreten Umsetzung derZielvorgabe (vgl. Krach 2009, S. 385).Booth und Ainscow (1998), die eine Untersuchung zu ‚inclusive education’durchführten, erhielten als Befund, dass nicht nur international sondern auchnational sehr unterschiedliche Vorstellungen und Verwendungen der Begriffe‚inclusion’ und ‚exclusion’ existieren (vgl. ebd.).Nichtsdestotrotz hat die Salamanca-Erklärung die sonderpädagogische Debatteaufgewärmt und fortschrittlich beeinflusst. Sie hat dazu beigetragen, dass derBlick über die Grenzen der Behindertenpädagogik hinaus gelenkt wurde (vgl.Sander 2001, Internet). Im Aktionsrahmen zur Salamanca-Erklärung heißt es inArtikel 3:Das Leitprinzip, das diesem Rahmen zugrunde liegt, besagt, dass Schulen alle Kinder,unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichenoder anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen. Das soll behinderte und begabte Kindereinschließen, Kinder von entlegenen oder nomadischen Völkern, von sprachlichen,kulturellen oder ethnischen Minoritäten sowie Kinder von anders benachteiligtenRandgruppen oder –gebieten. (Salamanca-Erklärung 1994, 6) 2Das neue Inklusionskonzept der Salamanca-Erklärung vertritt eine systemischeSichtweise, die auf Heterogenität in Schulklassen setzt, so dass neben den behindertenKindern auch andere Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissenin den Blick genommen werden (vgl. Hinz 2002, Internetquelle).Die Erweiterung des Konzepts geht über Behinderung hinaus. Sie überschreitetden Rahmen der Sonderpädagogik und auch den der bisherigen Integrationspädagogik.Aufgrund ihres Anspruches auf einen hohen Grad an Individualisierungist die inklusive Schule auch eine gute Schule für Kinder mit Migrations-2 "The guiding principle that informs this Framework is that schools accommodate all childrenregardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic, or other conditions. Thisshould include disabled and gifted children, street and working children, children from remoteor nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and childrenfrom other disadvantaged or marginalized areas or groups." (Salamanca Statement, 1994, p. 6)81
hintergrund, Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen, schulschwache Kinder,aber ebenso für unterforderte, schnell lernende Kinder.Diese erweiterte Sichtweise lässt sich bereits schon vor der Salamanca Erklärungin der Pädagogik der Vielfalt, die von verschiedenen Autoren und Autorinnenbeschrieben wird, beobachten (vgl. Sander 2008, S. 350). Auch wennnach Hinz (vgl. 2000, S. 126) keine völlige Übereinstimmung der beiden Ansätzezu verzeichnen ist, sind dennoch wichtige Anstöße von der Pädagogik derVielfalt in der heutigen inklusiven Pädagogik vertreten (vgl. Sander 2008, S.351).2.9.3 Gründe für die Einführung des neuen Inklusions-BegriffsInzwischen sind mehr als 30 Jahre seit den ersten integrativen Schulversuchenvergangen. Mehrere damalige Vertreter der Integration, wie z. B. Hinz undReiser sehen die Integration mittlerweile als gescheitert an. Als Ursache dafürführen sie konzeptuelle sowie strukturelle Gesichtspunkte an, die ihres Erachtensdazu geführt haben, dass zum einen die ursprünglichen Pläne abgeflachtund umgeändert worden seien und zum anderen die Integration außerdemquantitativ stagniert sei (vgl. Reiser 2003, S. 307).Als strukturelle Ursachen für die Stagnation der Integrationspraxis sind einerseitsder selektive Aufbau des deutschen Bildungssystems zu nennen und zumanderen die mangelnde Vermittlung von didaktischen Methoden in der sonderundregelpädagogischen Lehrerausbildung (vgl. Schnell 2003, S. 269).Zum konzeptuellen Aspekt schreibt Hinz (2003, S. 330): „Integration ist imLaufe der Praxisentwicklung vielfältigen Umformungsprozessen ausgesetzt,die zu einer immer weiter gehenden Verwischung dessen geführt haben, wasdamit eigentlich gemeint ist“. Nach Reiser bleibt bei vielen Konzepten in Regelschulenmit integrativem Anspruch weiterhin eine durch äußere Differenzierunghervorgerufene versteckte Selektion bestehen, die er auch als ‚integrierteSelektion’ betitelt (vgl. Reiser 2003, S. 307). In Regelschulen befindet sichsonderpädagogisches Klientel in der Zuständigkeit der Sonderpädagogen, ohnedass die Regelschule selbst für diese Kinder Verantwortung übernimmt oderihr eigenes Kompetenzspektrum erweitert. Der entwickelte Integrationsgedanke,mit der einst angestrebten Verlagerung sonderpädagogischer Ressourcen indie Regelschulen, bewegt sich gegenwärtig in die Richtung der Erweiterungsonderpädagogischer Dienste (vgl. Reiser 2003, S. 307).82
Hinz (vgl. 2003, S. 332f.) macht darauf aufmerksam, dass bei der Integrationsdebattezwei unterschiedliche Perspektiven der Integration vorherrschen. Aufder einen Seite findet sich die sonderpädagogische Orientierung, deren Vertreterihre Aufmerksamkeit auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene richten, diein verschiedenen Bereichen beeinträchtigt sind und demzufolge spezielle Bedürfnissehaben und spezielle Förderung benötigen. Dafür kommen unterschiedlicheFormen der Förderung in Betracht, wie z.B. separierte, teilsepariertebzw. teilintegrierte und voll integrierte Organisationsformen. Diese Orientierungwird auch als ‚differenzierte Integration’ bezeichnet (vgl. ebd., S. 332).Auf der anderen Seite gibt es das integrationspädagogische Verständnis derIntegration. Ihr Blick liegt „nicht mehr exklusiv bei Kindern, Jugendlichen undErwachsenen mit Beeinträchtigungen, sondern ist ausgeweitet auf die Prozesseund Effekte in heterogenen Gruppierungen insgesamt, schließt also alle Menschenmit ein“ (ebd.).Nach diesem Verständnis umfasst das integrative Ziel das gemeinsame Leben,Lernen, Spielen über die gesamte Lebensspanne als Prozess. Daher schränkenjegliche separierende Förderungsansätze die Bürgerrechte dieser Menschen ein.Bei diesem Ansatz von Integration spricht man von einer ‚totalen Integration’(vgl. ebd.).Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass sich in der Debatte umIntegration und Inklusion unterschiedliche Reaktionen zeigen. Während sichfür die Vertreter und Vertreterinnen der differenzierten Integration durch dieInklusion neue, eher illusionistische Perspektiven und Ansprüche auftun, zeigensich die Vertreter der integrationspädagogischen Orientierung eher verwundertund fragen, was das Neue an der Inklusion sei, da sie die Kernpunktedes inklusiven Ansatzes immer schon theoretisch vertreten haben (vgl. ebd., S.332f.).Vertreter der totalen Integration, wie Hinz und Theunissen, möchten verhindern,dass das Potenzial, das die Integration praktisch mit sich bringt, ungenutztbleibt und sich weiterhin auf nur kleinem Raum bewegt. Sie fordern denBegriffswechsel von der Integration hin zur Inklusion, um dem Stillstand derIntegrationsbewegung entgegenzuwirken (vgl. Krach 2009, S. 389). Ihre Motivationzur Einführung des Inklusionsbegriffs begründen sie mit drei grundsätzlichenVorteilen, die sie sich aus dem Wechsel versprechen (vgl. Krach 2009,S. 389). Als ersten vorteilhaften Aspekt der neuen Begrifflichkeit nennen sie83
„die begriffliche Anschlussfähigkeit an die internationale Debatte um inclusion“(ebd.). Damit sehen sie die Möglichkeit eröffnet, die globale Inklusionsbewegungaktiv mitgestalten zu können. Des Weiteren sehen sie die Chance,dass der stagnierte Integrationsprozess einen neuen Impuls erfährt. Drittensbesitzt der Inklusionsbegriff eine erweiterte und vertiefte Bedeutung. Die Erweiterungbzw. Vertiefung wird darin gesehen, dass mit dem neuen Konzeptdie Bedürfnisse des Einzelnen oder der gesamten Gruppe in den Blick genommenwerden und im Sinne eines „systemischen Ansatzes eine Veränderungbzw. eine Weiterentwicklung der gesellschaftlichen Strukturen für alle angestrebt“wird (ebd., S. 390).2.9.4 Kritische Betrachtung der Gründe für die Einführung des InklusionsbegriffsVon den oben dargestellten positiven Wirkungen, die der Begriffswechsel mitsich ziehen solle, sind nicht alle überzeugt. Einige Kritiker widerlegen die aufgeführtenZukunftsperspektiven.Dem erst genannten Vorteilspunkt kann entgegnet werden, dass ‚inclusion’ iminternationalen Raum kein definierter, sondern ein kontrovers gebrauchterFachbegriff ist. Vorreiterländer wie beispielsweise Dänemark, Italien oder dieNiederlande sprechen zudem von Integration (vgl. Sander 2002, S. 151ff.).Auch Liesen und Felder (vgl. 2004, S. 26) bezweifeln, dass der Begriff Inklusionallein hilft, die Anschlussfähigkeit in der internationalen Debatte herzustellen.Den zweiten Aspekt, der besagt, dass es mit dem Begriff Inklusion zu einemneuen Schwung in der Integrationspraxis kommt, zweifelt Reiser (2003, S.308) stark an.Feuser führt als Kritik an: „Die Wirklichkeit der Integration hat sich, seit vonInklusion geschrieben und geredet wird, zumindest nicht sichtbar zum Besserengewendet“ (Feuser 2005, S. 4).Der dritte erhoffte Erfolgspunkt, der mit einer Vertiefung und Erweiterung derIntegration durch den Inklusionsbegriff argumentiert, ist ebenfalls kritisch zubetrachten. Diese These ist davon abhängig, welches Integrationsverständnis(totale vs. differenzierte Integration, s.o.) man welcher Inklusionsauffassunggegenüberstellt. Demzufolge stellt nicht jedes entwickelte Inklusions-Konzepteinen Fortschritt gegenüber den verbreiteten, deutschen Integrationskonzepten84
dar (vgl. Krach 2009, S. 392). Nach Reisers Urteil erfährt die Pädagogik„durch ein Konzept der Inklusion keine wesentliche theoretische Vertiefungoder Erweiterung“ (Reiser 2003, S. 308). Er bemängelt, dass man einen neuentheoretischen Ansatz nicht durch einen Begriffswechsel erwarten kann. Dafürist vielmehr eine „systemtheoretische Neuformulierung“ (ebd., S. 209) derdurch die Integration gestellten Aufgabe erforderlich. Es kann nicht erwartetwerden, dass sich die bis heute abgezeichneten, unerwünschten praktischenEntwicklungsschritte, die sich bereits strukturell verankert haben, unter einemneuen Begriff stoppen lassen (vgl. ebd., S. 309).Inwieweit der Inklusionsbegriff mehr Klarheit in der Integrationsdebatte bringt,ist also fraglich. Allerdings scheint die Tatsache, dass der Begriff eingeführtwurde, dazu geführt zu haben, dass die Diskussion um Integration bzw. Inklusionwieder angetrieben worden ist (vgl. Krach 2009, S. 395).2.9.5 Was unterscheidet Inklusion von Integration?Inklusion bedeutet etymologisch Einschließung, Einschluss (vgl. Duden 1997,S. 362) und leitet sich von dem lateinischen includere (einschließen) ab.In Deutschland wird zurzeit der Begriff der pädagogischen Inklusion mitschwankender Präferenz für verschiedene Bedeutungsschwerpunkte gebraucht(vgl. Kobi 2006, S. 33). Einige benutzen den Begriff als „Synonym zu Integrationbzw. als deren Reanimation und Redesign“ (Kobi 2006, S. 339). Andereals „Weiterentwicklung, Intensivierung und Totalisierung von Integration“(ebd.), oder aber das Konzept wird „als ein, im Unterschied zum nachrangigintegrativen, vorrangiges Konzept“ (ebd., S. 33) verstanden.Der Schrägstrich-Bezeichnung Integration/Inklusion begegnet man vermehrt,wodurch begründbar ist, dass teilweise der Rückschluss gezogen wird, Inklusionsei mehr oder weniger dasselbe wie Integration und richtet sich ausschließlichauf die Belange von Menschen mit Behinderungen (vgl. Schumann 2009,S. 51).Oberflächlich könnte man die Grenze beider Begriffe so formulieren: „Werintegriert werden soll, muss irgendwo irgendwie Aufnahme finden- wer inkludiertist, gehört immer schon dazu“ (Liesen 2004, S. 71).Diese grobe begriffliche Erklärung reicht aber nicht aus, um Inklusion als neuenLeitbegriff in der deutschen Sonderpädagogik einzuführen. Dazu ist es notwendigzu definieren, welche neuen Ebenen der Begriff uns eröffnet und was85
der Wechsel der Integration mit sich zieht. In der deutschsprachigen Debattehat es hierzu bisher noch keine einheitliche befriedigende Antwort gegeben.(vgl. Liesen 2004, S. 71f.).Nach Sanders Verständnis (2002, S. 149) ist Inklusion als „optimiertere underweitertere Integration“ anzusehen: Einerseits optimiert durch den Abbau deröfters noch beobachtbaren Schwächen der Integrationspraxis und anderseitserweitert durch die Einbeziehung aller Kinder und Jugendlicher mit besonderenpädagogischen Bedürfnissen, egal welcher Art (vgl. Sander 2008, S. 350).Andreas Hinz hat versucht, anhand einer Tabelle die Abgrenzung der beidenBegriffe darzustellen, indem er versucht, die Praxis der Integration und diePraxis der Inklusion gegenüberzustellen (vgl. Hinz 2002, S. 359).Praxis der Integration• Eingliederung behinderter Kinder in dieallgemeine Schule• Differenziertes System je nach Schädigung• Zwei-Gruppen-Theorie (behindert /nichtbehindert)• Aufnahme von Kindern mit Behinderung• Individuumszentrierter Ansatz• Fixierung auf die administrative Ebene• Ressourcen für Kinder mit besonderemBedarf• Spezielle Förderung für Kinder mitBehinderungen• Individuelle Curricula für einzelne• Förderpläne für Kinder mit Behinderungen• Anliegen und Auftrag der Sonderpädagogikund SonderpädagogInnen• SonderpädagogInnen als Unterstützungfür Kinder mit Behinderungen• Ausweitung von Sonderpädagogik inPraxis der Inklusion• Leben und Lernen aller Kinder in derallgemeinen Schule• Umfassendes System für alle• Theorie einer pädagogisch ununterteilbarenheterogenen Gruppe• Profilierung des Selbstverständnissesder Schule• Systemischer Ansatz• Beachtung der emotionalen, sozialenund unterrichtlichen Ebenen• Ressourcen für ganze Systeme (Klasse,Schule)• Gemeinsames und individuelles Lernenfür alle• Ein individualisiertes Curriculum füralle• Gemeinsame Reflexion und Planungaller Beteiligter• Anliegen und Auftrag der Schulpädagogikund SchulpädagogInnen• SonderpädagogInnen als Unterstützungfür heterogene Klassen und KollegInnen• Veränderung von Sonder- und Schulpä-86
die Schulpädagogik hinein• Kombination von Schul- und Sonderpädagogik• Kontrolle durch ExpertInnendagogik• Synthese von Schul- und Sonderpädagogik• Kollegiales Problemlösen im TeamAbb. 4: Praxis der schulischen Integration versus Praxis der schulischen Inklusion (nach Hinz2002, S. 359)Beim Vergleich der beiden Praxisbereiche bildet die inklusive Pädagogik einumfassendes System für alle, während die Integration ein differenziertes Systemje nach Schädigung darstellt.Im Unterschied zum terminologischen Verständnis der Integration, die zwischenKindern mit und ohne ‚Sonderpädagogischem Förderbedarf’ unterscheidet(Zwei-Gruppen Theorie), geht die Inklusion von der Besonderheit und denindividuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes aus. Sie erhebt den Anspruch,eine Antwort auf die komplette Vielfalt aller Kinder zu sein (vgl. Schumann2009, S. 51). Ihr Ziel ist es, jedem Schüler und jeder Schülerin das Recht einzuräumen,in einer ‚Schule für alle’ zu lernen. In den Augen der Vertreter undVertreterinnen gibt es keine ‚aussortierten Kinder’, die dem Anforderungsniveauder Schule nicht entsprechen können. Sie vertritt die Theorie einer pädagogischununterteilbaren heterogenen Gruppe. Alle Schüler und Schülerinnensollen unabhängig von ihren Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen und ihrensozialen, ethnischen und kulturellen Bedingungen miteinander und voneinanderlernen. Diese Bedingung erfordert, dass nicht die Kinder den Bedingungender Schule angepasst werden, sondern die Schule sich umgekehrt an den Bedürfnissenund Besonderheiten der Schüler orientiert und bezogen auf dieseausgerichtet wird (vgl. ebd.).Inklusion setzt bewusst bei der ganzen Klasse an und richtet dabei ihren Fokusnicht nur auf das Integrationskind, sondern ebenso auf die speziellen Bedürfnisseund Fähigkeiten der Mitschüler und Mitschülerinnen. Mit Bedürfnissensind dabei andere als behinderungsbedingte gemeint, vielmehr geht die inklusivePädagogik davon aus, dass jedes Kind verschieden ist und somit eine individuelleBeachtung und Herangehensweise erfordert. So ist die Inklusion nichtnur eine Chance für Schüler und Schülerinnen mit Behinderung, vielmehr beziehtsie sich auf alle Kinder (vgl. Sander 2008, S. 35 ff.).Auch wenn keine festen Bestimmungen für eine inklusive Didaktik bestehen(vgl. Rehle 2009, S. 183), so ist in Anbetracht der gewollten Heterogenität derLerngruppe dennoch eine andere Unterrichtgestaltung notwendig als in den87
traditionellen Klassen. Bestimmte Formen der Unterrichtsorganisation und –methodik zeichnen sich besonders für heterogene Gruppen aus, um die Verschiedenheitder Kinder als Gewinn für das individuelle Lernen zu nutzen. DerGrundsatz dieser Didaktik lautet: „dass jedes Kind individuell spezifisch lernfähigist“ (ebd.).Um diese Lernfähigkeit zu unterstützen und zu fördern, muss das gemeinsameRahmencurriculum vielfach individualisiert werden und der Unterricht somitzieldifferent erfolgen. Daher muss kein Kind am Ende des Schuljahres aufgrundschlechter Leistungen die Klasse verlassen. Nicht die Gruppe gilt alsBezugsnorm, sondern die individuellen Leistungen werden an der Person selbergemessen. Die Individualisierung bezieht sich auf Aspekte wie Arbeitsaufgaben,Rückmeldungen und Leistungsbeurteilungen. Bei der Umsetzung desLehrens und Lernens sind auch methodisch keine Grenzen vorgegeben. Diemöglichen Arbeitsformen sind vielfältig und reichen von Einzelarbeit bis hinzur Arbeit im Plenum. Ebenso kann phasenweise auch Frontalunterricht eingesetztwerden (vgl. Sander 2008, S. 35 ff.).Das Hauptcharakteristikum von inklusivem Unterricht ist „eine Abwendungvon dem frustrierenden Versuch, die Klasse im Gleichschritt lernen zu lassen“(ebd., S. 37).2.9.6 Erste Innovationen in Deutschland zur Erreichung eines inklusivenSchulsystemsIn einer Sitzung am 12.06.2008 hat das Präsidium der Kultusministerkonferenzden Beschluss gefasst, eine befristete Arbeitsgruppe zu gründen. Diese Gruppe,die unter dem Namen ‚Sonderpädagogik’ läuft, ist beauftragt, die Empfehlungzur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der BundesrepublikDeutschland (1994)’ fortzuführen (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildungdes Landes Nordrhein-Westfalen 2010f, Internetquelle). Bei der Überarbeitungwerden die schulischen Erfahrungen in den letzten Jahren und vor allemdie Erfahrungen mit dem integrativen Unterricht berücksichtigt (vgl. Ministeriumfür Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalens2010f, Internetquelle).Das übergreifende Ziel der Überarbeitung liegt darin, das individuelle Recht aufgleichberechtigten Zugang zum allgemeinen Bildungssystem für Kinder und Jugendlichemit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sichern und ihnen damit gleichberechtigte,selbstbestimmte und aktive Teilhabe an Bildung, Arbeit und am Leben in derGesellschaft zu ermöglichen. (ebd., S. 7)88
Ein erstes innovatives Arbeitsprodukt der Gruppe ist das Diskussionspapier‚Pädagogische und rechtliche Aspekte der Umsetzung des Übereinkommensder Vereinten Nationen vom 13.12.2006 über die Rechte von Menschen mitBehinderungen (VN-BRK) in der schulischen Bildung’. Dieses Diskussionspapierwurde am 29.04.2010 von der Amtschefkonferenz der KMK einheitlichangenommen. Das Diskussionspapier stellt die Entwicklung des deutschenSchulsystems im Bereich der sonderpädagogischen Förderung und der inklusivenBeschulung in den letzten Jahren dar, die als orientierende Ausgangspunktefür die Ausarbeitung der KMK Empfehlung von 1994 dienen sollen. An derErstellung des Diskussionspapiers waren „neben den sonderpädagogischenFachreferenten sowohl Juristen als auch Fachreferenten der allgemeinen Schulformender Bundesländer“ (ebd.) beteiligt.Das Diskussionspapier beinhaltet zudem Überlegungen, wie sich dem Inklusionskonzeptin Deutschland zukünftig angenähert werden kann.Die Verwirklichung einer inklusiven allgemeinen Schule stellt eine komplexeund kontinuierliche Aufgabe dar. Die inklusiven Schritte sollen an den „bestehendenStrukturen, den gegebenen finanziellen und personellen Ressourcen,den vorhandenen Kompetenzen und den Haltungen der Akteure“ (ebd.) ansetzenund diese weiterentwickeln.Der Weg hin zu einem inklusiven System erfordert eine Öffnung des Schulsystems,um Entwicklungsschritte im Sinne der Behindertenrechtskonvention zuermöglichen. Die Kultusministerkonferenz wird in den Veränderungsprozessdie kommunalen und privaten Schul- bzw. Sachaufwandsträger, die Träger vonSozial- oder Jugendhilfe, die gesetzliche Sozialversicherung, die für die Berufsausbildungmitverantwortlichen Sozialpartner sowie insbesondere die Menschenmit Behinderungen und die sie vertretenden Organisationen, mit einbeziehen.Im Zusammenschluss mit diesen Akteuren werden sowohl die Schlussfolgerungenaus Artikel 24 der Behindertenrechtkonvention als auch die Rahmenbedingungenfür hochwertigen gemeinsamen Unterricht von Kindern und Jugendlichenmit und ohne Behinderungen in den Schulen herausgearbeitet. „Das Zielist ein Schulsystem, das die individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten allerSchülerinnen und Schüler, somit auch derjenigen mit Behinderungen, fördertund damit einen wesentlichen Beitrag zu ihrer weiteren persönlichen und be-89
uflichen Entwicklung leistet“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung desLandes Nordrhein-Westfalens 2010f, Internetquelle).Die Voraussetzungen dieses Ziels, die personelle, sächliche und räumlicheGrundlagen umfassen, sind von den Ländern und den Kommunen herzustellen.Alle Länder sind für den jeweiligen Verantwortungsbereich aufgefordert, eineBestandsaufnahme vorzunehmen, Schritte der Weiterentwicklung festzulegen,entsprechende Maßnahmen zu veranlassen und die ggf. erforderlichen rechtlichenVoraussetzungen zu schaffen. Gemeinsam mit allen Partnern und Partnerinnensind die Rahmenbedingungen und Indikatoren für hochwertigen Unterrichtfür Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in allgemeinen Schulenund sonderpädagogischen Einrichtungen in den Ländern herauszuarbeiten (vgl.ebd.).2.10 ZusammenfassungDie von uns herausgearbeitete und dargestellte Entwicklung der Schulgeschichtevon ihren Anfängen bis hin zur heutigen Zeit spiegelt einen Zeitraumwider, der geprägt ist von zahlreichen Reformen und Bildungsgedanken. Währenddie ersten Separierungsvorgehen von behinderten Kindern dem Schutz derGesellschaft dienen sollten, erfolgte bald die Erkenntnis, dass auch diese Kinder‚förderbar’ sind. Von nun an galten gesellschaftliche Kriterien als Gründefür die Beschulung von behinderten Menschen. Während zunächst der ökonomischeGewinn durch die Eingliederung der behinderten Menschen in die Gesellschafterkannt wurde, veränderte sich unter der verstärkten Entwicklung derMenschenrechte das Ziel der Beschulung hin zum Gedanken der sozialen Integration,also der gesellschaftlichen Teilhabe behinderter Menschen.Die Bandbreite der in der Geschichte entstandenen unterschiedlichen Institutionenund Beschulungsmustern lässt die Unklarheiten und Uneinigkeiten überdie Beschulungsform und –methodik behinderter Menschen erkennen. SeitAnfang der 70er Jahre stehen sich besonders zwei prägnante Einstellungsgruppenin diesem Zusammenhang gegenüber. Die eine Seite bilden Integrationsbefürworter,während auf der anderen Seite Verfechter des Sonderschulwesensstehen.Der integrative Unterricht gilt seit 1973 durch die Empfehlung des DeutschenBildungsrates als eine mögliche Form der Beschulung von Kindern mit Behinderungund wurde in den darauffolgenden Jahren immer weiter gefestigt. Rea-90
lisiert wurden erste schulische Ansätze, die sich in unterschiedlichen Formenausbreiteten. Trotz der verzeichneten positiven Erfahrungen im eigenen Landund denen von anderen europäischen Vorreiterländern, die in ihren integrativenProzessen schon einen erheblichen Vorsprung zeigen, wird auch heute noch amselektierenden Sonderschulwesen festgehalten.In unseren Ausführungen haben wir sowohl in der Geschichte des Bildungssystemsals auch in der aktuellen Debatte Kinder des Förderschwerpunktes emotionaleund soziale Entwicklung eingeordnet. Wir haben die besonderen Charakteristikaabgebildet, die speziell dieser Förderschwerpunkt mit sich bringt unddie sich auf den Unterricht auswirken und daher eine besondere Berücksichtigungfinden sollten. Die konfliktträchtige Gegenwartslage zwischen Selektionund Integration umfasst auch diesen Förderschwerpunkt. Wie die Zahlen darlegen(siehe Kapitel 2.7.1), ist im Förderschwerpunkt emotionale und sozialeEntwicklung in Anbetracht der letzten Jahre die Zahl und der Anteil der Förderschülerund -schülerinnen deutlich erhöht worden. Des Weiteren weisenZahlen darauf hin, dass sich Schüler und Schülerinnen des Förderschwerpunktemotionale und soziale Entwicklung im Vergleich zu anderen Förderschwerpunktenvermehrt in integrativen Beschulungsmustern wiederfinden. Im Gegensatzdazu sind die Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit der Integrationbei verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern begrenzt und weisen meistauf die besondere Problematik der schulischen Integration hin, denn laut empirischenKontrollen weisen diese Kinder die schlechtesten Startbedingungen füreine Integration auf. Auch wenn Schulversuche schon über positive Befundeberichten, gibt es dennoch Kritiker, die eine integrative Beschulung gerade fürdiesen Förderschwerpunkt als ungünstig ansehen.Seit einigen Jahren kommt ein neuer rechtsverbindlicher Beschluss in der BundesrepublikDeutschland, der international zwischen den UN-Ländern beschlossenwurde, zum Tragen. Das neue Konzept heißt Inklusion. Es stellt einumfassenderes Konzept als die Integration dar, indem es nicht mehr den Fokusauf die behinderten Schüler richtet, sondern gegen die Zwei-Gruppen-Theoriewirkt und von individuellen Lernvoraussetzungen und -bedürfnissen bei jedemSchüler ausgeht.Inklusive Schulen sehen sich ihrem Programm zufolge als „Schulen für alleKinder“ (Hinz/ Boban 2003, S. 3, Internetquelle) an. In einer ‚Schule für alle’wird jede mögliche Barriere bezüglich Bildung und Erziehung für alle Kinder91
und Jugendliche so weit wie möglich reduziert (vgl. ebd., S. 11). Ausgehendvon dieser Leitidee ergeben sich folgende Merkmale gelungener Inklusion (vgl.ebd., S. 10):• Heterogenität wird als Chance anstatt als Problem erkannt.• Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Schülerinnen und Schülereiner Schule werden gleich wertgeschätzt.• Es wird eine Gemeinschaft aufgebaut, Werte entwickelt und Leistunggesteigert.• Eine Schule geht mithilfe ihrer Kulturen, Praktiken und Strukturen aufdie Vielfalt der Schülerinnen und Schüler ein, so dass die Teilhabe allerSchülerinnen und Schüler an Unterricht, Kultur und Gemeinschaft derSchule gewährleistet wird.• Verbesserungen einer Schule betreffen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,nicht nur die Schülerinnen und Schüler.• Die Beziehung zwischen Schule und Gemeinde wird nachhaltig aufundausgebaut.Zur Erinnerung die Rahmenbedingungen für optimale integrative Förderungvon Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensstörungen kurz zusammengefasst(siehe Kapitel 2.7.2.1 und 2.7.6):• Doppelbesetzung der Unterrichtsstunden• Differenzierung der Leistungsanforderungen mit kontrollierten Mitentscheidungsmöglichkeiten• Maximal zwei Kinder mit Verhaltensstörungen pro Klasse• Günstiges Klassenmanagement• Konstante Lerngruppen• Für emotionale und soziale Entwicklung qualifiziertes Personal an Förder-und Regelschulen• Strukturen innerhalb der Schule, die bei Krisen im Unterricht entlastendwirken, sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrerinnenund Lehrer• Klassengröße (Primarbereich max. 20, Sekundarbereich max. 25 Schülerinnenund Schüler)• Feste Kooperation mit Jugendhilfe, Psychiatrie und JugendamtDie Merkmale gelungener Inklusion lassen sich mit den optimalen Rahmenbedingungenleicht abgleichen. Da Inklusion jedoch alle Schülerinnen und Schü-92
ler betrifft, und nicht nur die der Integrationsklassen, muss das Prinzip der Integrationausgeweitet werden, um von Inklusion sprechen zu können. DieRahmenbedingungen für Kinder mit Verhaltensstörungen können beibehaltenwerden, der Bereich, in dem sie gelten, muss jedoch ausgedehnt werden, sodass die Ressourcen für das gesamte System zur Verfügung stehen und gemeinsamesund individualisiertes Lernen stattfinden kann (vgl. Abb. 4, Kapitel2.9.6. bzw. Hinz 2002, S. 359). Das bedeutet, dass sich die Strukturen und Gegebenheitender allgemeinen Schule ändern müssen. Es werden mehr Lehrkräftebenötigt (Doppelbesetzung), die Lehrkräfte der allgemeinen Schule brauchensonderpädagogische Qualifikationen, evtl. müssen Klassen verkleinert werdenund die Strukturen der allgemeinen Schule müssen so beschaffen sein, dassSchülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlastendeUnterstützung darin finden und differenzierte Lern- und Leistungsangebotewahrgenommen werden können. Um eine Wertschätzung aller beteiligten Personenzu garantieren, muss die gesamte Schule konsequent inklusiv denkenund handeln.93
3 HypothesenBasierend auf den vorgestellten, bereits empirisch untersuchten Integrationskonzeptenbei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen, den darauserkennbaren Rahmenbedingungen integrativer Beschulung und den Voraussetzungenfür gelungene Inklusion, stellen wir folgende Hypothesen auf:1. Die Lehrkräfte der allgemeinen wie der Förderschule sind, auch aufgrundihrer Ausbildung, noch nicht in der Lage bzw. motiviert, alleKinder zu unterrichten.2. Lehrkräfte haben mehr Schwierigkeiten, Kinder mit Verhaltensauffälligkeitenzu unterrichten als Kinder mit anderer oder keiner Behinderung.3. Die Rahmenbedingungen für eine schulische Inklusion von Kindern mitVerhaltensstörungen sind noch nicht gegeben.In dem folgenden Forschungsteil möchten wir der Frage nachgehen, ob gelingendeInklusion von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensstörungen bereitsmöglich ist. Schulische Inklusion existiert hauptsächlich als theoretischesKonzept und ist aufgrund der Aktualität (z.B. Unterzeichnung der UN-Konvention 2009) in vielen Bereichen noch nicht selbstverständlich. Daherarbeiten wir mit bereits bestehenden Integrativen Konzepten, die dem langfristigenZiel Inklusion näher stehen als separate Beschulung.94
4 Praktische GrundlegungWie bereits in der Einleitung begründet, werden in dieser Arbeit Lehrkräftebefragt, da sie diejenigen sind, die die theoretischen Konzepte in der Praxisumsetzten. Als Erhebungsinstrument haben wir den Fragebogen ausgewählt, daer ein gängiges Mittel zur Datenerhebung darstellt.Ein Fragebogen dient der Erfassung der Rahmenbedingungen der jeweiligenInstitutionen, der zweite soll die Meinung von Lehrkräften bezüglich der Integrationbzw. zukünftiger Inklusion von verhaltensauffälligen Schülerinnen undSchülern erheben.4.1 MethodikDie beiden konstruierten Fragebögen basieren jeweils auf einer Anreihung vonFragen mit gebundenen Antwortmöglichkeiten, sowie auf einigen offenen Fragen,die den Lehrern, Lehrerinnen bzw. Schulleitern und Schulleiterinnen dieGelegenheit bieten, ihre Meinungen, Ansichten und Einstellungen frei ohnefest vorgegebene Kategorien zu beantworten.4.1.1 Der LehrerfragebogenBei dem Lehrerfragebogen folgen die Fragen mit Antwortvorgaben dem Ratingskalaformat.Es stehen jeweils vier Antwortalternativen zu Verfügung, dieuntereinander Abstufungen aufweisen (von 0= ‚trifft zu’ bis 3= ‚trifft nichtzu’). Wir haben die Antwortkategorien bewusst vierstufig untergliedert, umden Erhalt von reinen Mittelwerten, die im Sinne einer Enthaltung gedeutetwerden können, zu vermeiden, und stattdessen klare Tendenzen einer Bejahungoder Verneinung der Frage zu erhalten. Für Personen, die bei bestimmten Fragenunsicher sind oder keine klare Tendenz festmachen können, gibt es eineextra Spalte, die dies erfasst (? = ‚ich bin mir unsicher’). Mit der Einsicht, dassdie Reliabilität und die Validität bei einer größeren Anzahl von Antwortkategoriensteigen, aber zu viele Antwortkategorien wiederum reliabilitäts- und validitätsminderndsein können, halten wir die vierstufigen Antwortkategorien füreine angemessene Anzahl.Die standardisierten Antworten lassen eine quantitative Beurteilung der jeweiligenMerkmalsausprägung, eine ökonomische Auswertung und Vergleiche zu(vgl. Bühner 2006, S. 56).95
Die Items der antwortgebundenen Fragen haben wir als Behauptungen formuliert.Bortz und Döring (vgl. 2006, S. 254) geben an, dass sich diese Formulierungsartbesser zur Erkundung von Positionen, Meinungen und Einstellungeneignet, da „sich die interessierende Position oder Meinung prononcierter unddifferenzierter erfassen“ (ebd.) lässt als mit Fragen, die den gleichen Inhaltumfassen. Nach ihnen sind aufgestellte Behauptungen direkter und könnendurch gekonnte Formulierungen, die ggf. auch provozierend wirken können,die Befragungspersonen zu eindeutigen Stellungnahmen anleiten (vgl. ebd.).Demgegenüber arbeiten qualitative Fragen mit „Verbalisierungen der Erfahrungswirklichkeit,die interpretativ ausgewertet werden“ (ebd., S. 296). Durchdie qualitativen Fragen sollen die beteiligten Lehrer die Möglichkeit erhalten,individuell ihre Einstellungen und Einschätzungen anzubringen und diese zudembegründen zu können. Auch wenn die interpretative Auswertung der qualitativenFragen aufwändiger ist und nicht einen eindeutigen Vergleich der einzelnenBefragten zulässt, liefern sie ein reichhaltigeres und detailreicheres Ergebnisals die quantitativen Frageansätze (vgl. ebd., S. 297).Daher erschien es uns wichtig, qualitative Fragen in den Fragebogen mit aufzunehmen,um einerseits die Befragten mit unseren Vorgaben im Antwortverhaltennicht einzuengen und anderseits Kriterien zu erhalten, die wir nicht voraussagendfestlegen konnten bzw. aufgrund des unterschiedlichen subjektivenEmpfindens nicht mit den von uns aufgestellten Kategorien abgedeckt werdenkonnten.Nach der Erstellung des Fragebogens haben wir die einzelnen Fragen hinsichtlichder von Porst (2000) aufgestellten Kriterien für eine gelungene Fragebogenkonstruktionuntersucht und sie, wenn nötig, entsprechend verändert (vgl.Bortz/ Döring 2006, S. 255).Um die notwendige Motivation und Anstrengungsbereitschaft der Teilnehmerinnenund Teilnehmer bei der Befragung zu erlangen, sind die Fragebögenbewusst sehr knapp gehalten und der Fokus gezielt auf die Aspekte der aufgestelltenHypothesen gerichtet. Eine gewissenhafte Beantwortung der Fragenvon Seiten der Lehrpersonen hatte für uns Vorrang gegenüber einer Vielzahlvon Details.96
Inhaltliche Auswahl der FragenBei der Aufstellung der Fragen des Lehrerfragebogens stellte der Index fürInklusion, der in der englischen Originalfassung von Tony Booth und MelAinscow (2002) entwickelt und später von Boban und Hinz (2003) in die deutscheFassung übersetzt wurde, unsere Bezugsgröße dar.Im Vorwort des Index heißt es:Dieser nun von uns auf Deutsch vorgelegte Index für Inklusion stellt mit seinen ausgearbeitetenMaterialien einen Fundus dar, aus dem Schulen schöpfen können, diesich als "Schule für alle Kinder", integrative oder inklusive Schulen verstehen, wennsie vor der verordneten oder selbst gestellten Aufgaben der Selbstevaluation stehen.So muss nicht jede Schule das Rad der Schulentwicklung wieder völlig neu erfinden.Der Index macht Vorschläge, er ist kein Test für Schulen, die als Ergebnis bescheinigtbekommen, wie sehr - oder auch wie wenig - sie inklusiv sind. Er ist also kein Pflichtkurs,dem sich eine Schule von A bis Z zu unterwerfen hat, um dann vor Überforderungzusammenzubrechen, sondern der Index bietet eine Systematik, die dabei hilft,nächste - und zwar angemessen große oder kleine, verkraftbare, realistische -Schrittein der Entwicklung zu gehen, zum Beispiel im nächsten Schuljahr. Dabei ist wenigermehr, und das übernächste Schuljahr kommt mit ziemlicher Sicherheit! (Boban/ Hinz2003, S. 3, Internetquelle)Der ‚Index for Inclusion‘ wurde in Großbritannien von einer Gruppe von Lehrkräften,Eltern, Schulvorständen, Forschern und einem Vertreter von Behindertenorganisationeninnerhalb von drei Jahren entwickelt und baut auf die bereitsgemachte Praxiserfahrung von Inklusion auf. Eine erste Fassung des Indexwurde bereits in sechs Grund- und Sekundarschulen gestartet und eine modifizierteVariante in siebzehn Schulen in vier Schulbezirken evaluiert. DieseSchulen gaben an, dass der Index für sie eine große Hilfe dabei darstellte, ihrBewusstsein für Inklusion zu stärken und alle Entwicklungsthemen für die Praxisin den Blick zu bekommen, ohne dass Aspekte vernachlässigt wurden (vgl.ebd., S. 7).Aufgrund der Tatsache, dass an der Erschaffung des Index Personen beteiligtwaren, die schon weit reichende praktische Erfahrungen in dem inklusivenSchulfeld gesammelt haben und aufgrund der positiven Rückmeldungen derer,die die Kriterien des Index in ihrer eigenen Praxis berücksichtigt haben, hieltenwird den Index für ein geeignetes Kriterium, um unsere Fragen auf ihn hin auszurichten.Aus dem „Rahmen der Analyse“ (ebd., S. 14), der aus drei miteinanderverbundenen Dimensionen gebildet wird (1. inklusive Kulturen zu schaffen,2. inklusive Strukturen zu etablieren und 3. inklusive Praktiken zu entwickeln)haben wir die allgemein verfassten notwendigen Faktoren für Inklusionherausgegriffen und hinsichtlich unseres Untersuchungsgegenstandes explizit97
auf die Schüler des Förderschwerpunktes emotionale und soziale Entwicklungumformuliert.4.1.2 Fragebogen zur Überprüfung der RahmenbedingungenDieser Fragebogen richtete sich an den Schul- bzw. Institutionsleiter und dientder Erfassung von organisatorischen und strukturellen Fakten der jeweiligenEinrichtung. Er setzt sich aus Ja-Nein-Fragen, Mehrfach-Wahlaufgaben sowieeinigen Fragen mit freiem Antwortverhalten zusammen. Da sich der Fragebogennicht auf persönliche Einstellungen oder Meinungen bezieht, sondern gesicherteDaten prüft, ist das Format der Ja-Nein-Fragen und auch der Mehrfach-Wahlaufgaben besonders günstig, da es einerseits dem Probanden eine schnelleund relativ leichte Beantwortung ermöglicht und auch die Bearbeitungs- undAuswertungszeit kurz und ökonomisch ist (vgl. Bühner 2006, S. 56f.). Wirhaben versucht, die Antwortvarianten möglichst präzise und konkret vorzugeben,damit die Fragen eindeutig beantwortet werden können und keineVerfälschungen der Antworten durch individuelle Wahrnehmungs- oder Verständnisunterschiedeauftreten. So haben wir Häufigkeitsangaben wie ‚teilweise‘und ‚stundenweise‘ zur besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse durchErgänzungsangaben mit der genauen Anzahl ausgeführt. Bei Mehrfach-Wahlaufgaben wurde von uns eine Sparte eingebracht, die die Gelegenheit füreine andere, von uns nicht bedachte Antwortmöglichkeit gibt.Inhaltliche Auswahl der Fragen:Die Inhalte der einzelnen Fragen basieren auf den von uns im Theorieteil erarbeitetenZusammenhängen und Rahmenvoraussetzungen, die für eine integrativebzw. inklusive Beschulung von Schülern des Förderschwerpunktes emotionaleund soziale Entwicklung bedacht sein sollten bzw. ausschlaggebend sind.Der Inhalt dieses Fragebogens steht im Bezug zu den gegebenen Lehrerantworten.Durch ihn kann analysiert werden, ob große Diskrepanzen in den Lehreraussagenauf Varianzen in den Rahmenbedingungen zurückgeführt und erklärtwerden können, und somit auf den Gesamtrahmen bezogen, welche RahmenbedingungenIntegration bzw. Inklusion begünstigen.98
4.2 Die EinrichtungenWir haben uns entschlossen, drei verschiedenen Institutionen in die Befragungaufzunehmen, um unterschiedliche Möglichkeiten der Integration darstellen zukönnen.Die Informationen der Darstellungen ergeben sich aus unseren Fragebögen zurFeststellung der Rahmenbedingungen, aus Internetauftritten der drei Institutionen,des Schulministeriums NRW und der Bezirksregierung Köln sowie ausBesuchen und Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.4.2.1 Die Burgschule in FrechenDie Burgschule ist eine der sieben Frechener Grundschulen, liegt im Süden derFrechener Innenstadt und bietet seit 17 Jahren Gemeinsamen Unterricht (GU)an. Im Schuljahr 2010/2011 besuchen etwa 230 Kinder die Schule und werdenin 10 Klassen unterrichtet. Nachmittagsbetreuung findet in Form der OffenenGanztagsschule statt. Es gibt 20 Lehrerinnen, davon sind drei Sonderpädagoginnenund zwei Lehramtsanwärterinnen. Das Kollegium wird durch eine Sozialpädagoginergänzt. Regelmäßige außerschulische Zusammenarbeit findetmit dem schulpsychologischen Dienst, therapeutischen Einrichtungen, einemSozialpädriatischen Zentrum, zwei Kindergärten, Kirchen, der Bücherei, Polizei,der Musikschule Frechen, dem Kinderschutzbund, dem Rotary Club, demWDR sowie mit weiterführenden Frechener Schulen statt. Zusätzlich wird versucht,gemeinsam mit dem Hochbegabtenzentrum Brühl, hochbegabte Kinderan externen Lernorten zusammen mit hochbegabten Kindern anderer FrechenerGrundschulen zu fördern.Räumliche Lernangebote bestehen durch die Schulbücherei, ein Lernforum indem alle zwei Wochen jede Klasse einmal ist, einen Computerraum und einenPsychomotorik-Raum sowie durch die Gruppenräume der offenen Ganztagsschule.4.2.1.1 Integration an der BurgschuleIm Leitbild der Schule wird Heterogenität angesprochen: „Unsere Schule istein Lebens- und Erfahrungsraum, in dem vielfältiges Lernen stattfindet.“ Genauerwerden die Kinderrechte, eine umfassende Förderung, Hilfsbereitschaft99
und Rücksichtnahme, Weltoffenheit und ein positives Schulklima als wertvolleZielsetzungen der Schule formuliert.Bis auf Kinder mit einem Förderbedarf in der geistigen Entwicklung werdenalle Kinder an der Schule aufgenommen. Für die Aufnahme von körperbehindertenKindern ergibt sich die Einschränkung, dass lediglich zwei Klassenräumebarrierefrei zugänglich sind. Im Moment werden drei Schülerinnen undSchüler mit Verhaltensauffälligkeiten im GU der Burgschule unterrichtet. Injedem Jahrgang gibt es eine GU-Klasse, die das ganze Schuljahr von einemfesten Lehrerinnen-Team unterrichtet wird. Pro Woche sind die GU-Klassen 14Stunden doppelt besetzt. Die GU-Klassen werden mit durchschnittlich 21 Kindernkleiner gehalten als die Klassen ohne Kinder mit Förderbedarf, in welchenetwa fünf Kinder mehr unterrichtet werden. Für die Genehmigung einer GU-Klasse müssen mindestens drei Kinder mit offiziellem Förderbedarf vorhandensein. An der Burgschule sind drei Sonderpädagoginnen angestellt, so dass insgesamt70 Sonderpädagogik-Stunden für 18 Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarfzur Verfügung stehen.Im letzten Jahr konnten zwei Kindern mit Förderbedarf im emotionalen undsozialen Bereich die Empfehlung für die Realschule als weiterführende Schuleausgesprochen werden. Die beiden Kinder werden dort weiterhin beschult. DerGU hat hier also eine erfolgreiche Rückschulung ermöglicht.4.2.2 Förderschule und Kompetenzzentrum Berliner StraßeDie städtische Förderschule Berliner Straße befindet sich in Dünnwald im KölnerNorden. Mit ca. 130 Schülerinnen und Schülern, die in 13 Klassen unterrichtetund erzogen werden, befinden sich im Durchschnitt zehn Schüler ineiner Lerngruppe. Neben 24 Lehrkräften gibt es zwei, die sich in der Ausbildungbefinden, eine Schulsozialpädagogin, drei Sozialarbeiter für die OffeneGanztagsschule (OGS), eine Lehrerin mit Zusatzausbildung HeilpädagogischesVoltigieren, eine Ergotherapeutin, eine Sprachtherapeutin, eine Schulärztin mitSprechstundenhilfe sowie einen Bezirkspolizist der eine regelmäßige Sprechstundeanbietet.Neben den Klassenräumen, einer Aula und Turnhalle kann die Schule einenMädchenraum, einen Ergotherapieraum, einen Sprachtherapieraum, einenComputerraum, einen Werkraum sowie eine Küche als Lernorte gestalten. DenSozialarbeitern der OGS stehen vier Räume zur Verfügung.100
Durch die Teilnahme am ‚netzwerk E‘ besteht ein regelmäßiger Austausch mit24 anderen Schulen für den Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklungdes Regierungsbezirks Köln.4.2.2.1 Das KompetenzzentrumAngeschlossen an die Förderschule ist ein Kompetenzzentrum. Das Pilotprojektder ‚Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung im Bereich derLern- und Entwicklungsstörungen‘ läuft seit dem Schuljahr 2008/09 in mittlerweilemehr als 30 Regionen und hat das Ziel, aus möglichst vielen KonstellationenErfahrungen zu sammeln. Angestrebt wird eine Rechtsverordnungzum Ende der dreijährigen Pilotphase, in der Voraussetzungen und Aufgabeneines Kompetenzzentrums festgehalten werden. Diese Rechtsverordnung solldie Grundlage für den Ausbau weiterer Förderschulen zu Kompetenzzentrendarstellen. Auch wenn die Idee aus der sonderpädagogischen Diskussion herausentstand, betrifft sie entscheidend die allgemeinen Schulen, da diese zurwohnortnahen Förderung unverzichtbar sind.Mehr Kinder präventiv wohnortnah bei gleichbleibender Qualität der Unterstützungzu fördern um der Festigung von Lern- und Entwicklungsstörungenvorzubeugen, ist ein Ziel der Kompetenzzentren, deren Konzept sich an denLeitideen der von der Bundesrepublik 2009 ratifizierten UN-Charta orientiert.Praktisch sollen die allgemeinen Schulen, meist Grundschulen, durch die sonderpädagogischenLehrkräfte in vielfältiger Form unterstützt werden, so dasseine fruchtbare Zusammenarbeit entsteht. Hierbei sind Lehrkräfte aller beteiligterSchulformen für eine qualitativ hochwertige Förderung verantwortlich. Essoll erprobt werden, ob die Unterstützung vor Ort durch Flexibilität und Vernetzungschulischer und außerschulischer Konstanten verbessert werden kann,und wenn ja, wie dies konkret geschehen kann. Bestehende und sich entwickelndeUnterstützungsstrukturen sollen sowohl untereinander als auch mitdem Kompetenzzentrum vernetzt und systematisch in Prävention, Beratungund Diagnose eingebunden werden.Da die Pilotphase unter realistischen Bedingungen stattfinden soll um eine gescheiterteUmsetzung zu vermeiden, werden keine zusätzlichen Lehrerstellenzur Verfügung gestellt. Eine Verbesserung soll sich durch die geänderte Verteilungder Ressourcen ergeben. Wie die beteiligten Lehrkräfte eingesetzt werden,101
obliegt der Leitung des jeweiligen Kompetenzzentrums, die zusammen mit denbeteiligten Schulen ein Personaleinsatzkonzept erstellt. Organisatorischverbleiben die Lehrkräfte an der Schule, wo sie auch vor Beginn der Pilotphaseangestellt waren. Lediglich eine halbe Stelle zusätzlich pro Pilotregion dientdem Aufbau präventiver Maßnahmen. Eine entscheidende Veränderung ergibtsich dadurch, dass sich die Stellen für sonderpädagogische Lehrkräfte im Einzugsgebietder Kompetenzzentren nicht mehr an den AO-SF Verfahren orientieren.In den Pilotregionen wurde die Anzahl der sonderpädagogischen Lehrstellenkonstant gehalten. Durch diese Veränderung ist es nicht mehr nötig, einAO-SF Verfahren durchzuführen um sonderpädagogische Förderung in Anspruchnehmen zu können. Auch die Aufhebung des sonderpädagogischenFörderbedarfs wird dadurch erleichtert und ist nicht mehr mit Lehrerstellenabbauverbunden. Bürokratische Wege werden somit verkürzt oder abgeschafft.Für rechtliche Grundlagen bleibt das Verfahren aber weiterhin theoretisch bestehen.Auch der diagnostische Aspekt des AO-SF Verfahrens soll aufrechterhalten werden, um die Professionalität der sonderpädagogischen Förderungzu gewährleisten.Grundsätzlich verfolgt das Konzept der Kompetenzzentren eine Grundidee derInklusion: Nicht die Kinder geht zu einer passenden Schule, sondern die Lehrkräftegehen dorthin, wo das Kind ist (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildungdes Landes Nordrhein-Westfalen 2009, Grundsatzpapier, Internetquelle).Die Kompetenzregion Mülheim-OstDie Umsetzung des Konzeptes des Kompetenzzentrums für sonderpädagogischeFörderung hat seit Beginn der Pilotphase schrittweise stattgefunden. Imersten Jahr fanden überwiegend Hospitationen statt, um sich gegenseitig kennenzulernenund mit der neuen Situation vertraut zu machen. Im zweiten Jahrkonnten die sonderpädagogischen Lehrkräfte auch beratend aktiv werden. Mittlerweileläuft das letzte Jahr der Pilotphase und es findet neben Hospitation,Beratung, regelmäßigem Austausch auch Unterricht im Team statt.Lehrkräfte der Schule Berliner Straße koordinieren die Arbeit des KompetenzteamsMülheim-Ost, welches aus insgesamt neun Lehrkräften verschiedenerSchulen der Umgebung besteht. Das gesamte Team unterteilt sich in ein Koordinationsteamsowie fünf Stadtteilteams, die jeweils mit bis zu zwei Lehrkräf-102
ten die Stadtteile Dünnwald, Dellbrück, Holweide, Buchheim und Höhenhausbetreuen. Dazu gehören etwa 81.000 Einwohner, von denen rund 20% unter 18Jahre alt sind, etwa 40 Kindergärten und –tagesstätten sowie 25 Schulen. DieBetreuung umfasst Hospitationen, Unterstützung durch Testdiagnostik undBeratungsgespräche sowie Beratung zu Lern- und Entwicklungsprozessbegleitung,Unterstützung zur Entwicklung von Maßnahmen für erfolgreiche LernundEntwicklungsprozesse der Schülerinnen und Schüler sowie die Durchführungvon Fortbildungen mit Kolleginnen und Kollegen der allgemeinen Schulen.4.2.3 Die <strong>Gesamtschule</strong> <strong>Bonn</strong> <strong>Beuel</strong> (IGS)Die integrierte <strong>Gesamtschule</strong> (IGS) im rechtsrheinischen Stadtteil <strong>Beuel</strong> wurde1978 als erste <strong>Bonn</strong>er <strong>Gesamtschule</strong> gegründet. Sie liegt im städtischen Raumund steht bezüglich der Anmeldungen in Konkurrenz zu anderen Schulen derUmgebung. Etwa 1300 Kinder und Jugendliche (der Anteil Mädchen-Jungenist beinah ausgeglichen) besuchen die Schule, davon etwa 30% mit Migrationshintergrund,und werden von ca. 130 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet,darunter 17 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter für Förder- sowieRegelschule. Das Lehrkräfte-Team, zu dem 13 sonderpädagogische bzw. sozialpädagogischeFachkräfte zählen, wird durch eine Schulpsychologin sowienicht-lehrendes Personal ergänzt. Drei der sonderpädagogischen Fachkräftesind im Bereich der Förderung sozialer und emotionaler Entwicklung ausgebildet.Die Förderschullehrkräfte gehören organisatorisch zu umliegenden Förderschulen,nicht zur IGS. Aufgrund der Ganztagsbetreuung haben die Schülerinnenund Schüler die Möglichkeit, mittags in der schuleigenen Mensa zu speisen,bevor sie an weiterem Unterricht, AGs oder Tutorenstunden teilnehmen.Bei der ‚Qualitätsanalyse NRW’ im November 2007 durch die BezirksregierungKöln wurden sechs Qualitätsbereiche (Ergebnisse/Schulabschlüsse, Lernenund Lehren - Unterricht, Schulkultur, Führung und Schulmanagement,Professionalität der Lehrkräfte, Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung)der Schule evaluiert. Insgesamt erhielt die Schule die Note 3,9 bei einer möglichenBestnote von 4,0. Zusätzlich hat die Schule mehrere Preise und Auszeichnungenerhalten, z.B. den Schulentwicklungspreis 2008 oder das Gütesiegelfür individuelle Förderung 2007. Auch die Schülerfirma der IGS <strong>Bonn</strong>103
<strong>Beuel</strong> arbeitet erfolgreich: Beim Deutschen Gründerpreis 2007 schaffte sie esim Regierungsbezirk Köln auf Platz drei.Die Gebäudesituation wird als gut bis sehr gut angesehen, was auch dadurchbestätigt wird, dass die Räume für Fortbildungsveranstaltungen, allgemeineTagungen und Kongresse genutzt werden.4.2.3.1 Integration an der IGS <strong>Bonn</strong>Im Schulprogramm der IGS sind Integration als Prinzip sowie Chancen derHeterogenität festgehalten.Leben und Lernen an der <strong>Integrierte</strong>n <strong>Gesamtschule</strong> <strong>Bonn</strong>-<strong>Beuel</strong> heißt, die unterschiedlichstenMenschen zu integrieren, ihre individuellen Fähigkeiten zu fördern undLeistung zu fordern. Durch Toleranz, verantwortungsvollen Umgang miteinander, sozialesEngagement und Freude am Lernen sollen sich selbstständige, teamfähige undkonfliktfähige Persönlichkeiten entwickeln können. (Schulprogramm der IGS)Konkret bietet die Schule viele verschiedene Möglichkeiten der Differenzierungan. Wahlpflichtfächer ab der der sechsten Klasse und die ‚individuelleBegabungsförderung’ ermöglichen eine Schwerpunktsetzung in verschiedenenBereichen (Französisch, Latein, Spanisch, Chinesisch, Naturwissenschaften,Arbeitslehre, Psychologie, Informatik, Sport, kreativ-künstlerische Fächer). Abder siebten Klasse gibt es für die Hauptfächer Mathematik und Englisch sowieab der neunten Klasse für Deutsch und Chemie oder Physik unterschiedlicheKurse. Die anderen Fächer werden überwiegen im Klassenverband erteilt, derin der IGS während der Sekundarstufe I konstant gehalten wird. Eine Klassewird dafür über sechs Jahre von einem Team (Lehrerin und Lehrer) unterrichtet,mit möglichst wenig anderen Lehrkräften, um die Bildung von Bezugsgruppenzu ermöglichen und übersichtliche Strukturen zu schaffen. In denJahrgängen fünf und sechs sind alle Stunden doppelt besetzt, danach erfolgt proSchuljahr der stundenweise Abbau der Doppelbesetzung. Die individuelleSchülerlaufbahn kann mit dem jeweils passenden Abschluss beendet werden:Hauptschulabschluss, Mittlerer Abschluss mit oder ohne Qualifikation, Fachhochschulreifeoder Abitur. Soziales Lernen wird von Beginn der SekundarstufeI, unter anderem im fachunabhängigen Ausgleichsunterricht, der bis zursiebten Klassenstufe im Stundenplan vorgesehen ist, in zwei oder drei Unterrichtsstundenpro Woche realisiert. Auch Praktisches Lernen, Medienerziehung,Gesundheits- und Umwelterziehung, kulturelles und interkulturelles Lernennehmen an der <strong>Gesamtschule</strong> einen hohen Stellenwert ein.104
Das Prinzip des Gemeinsamen Unterrichts (GU) wird an der Schule seit 25Jahren umgesetzt. Aktive Eltern gaben den Ausschlag zur Umsetzung der Integrationsform.Zurzeit werden 88 Schülerinnen und Schüler, etwa 5% der gesamtenSchülerschaft, mit verschiedenen Förderschwerpunkten im GU der SekundarstufeI und II unterrichtet. Lediglich Schülerinnen und Schüler, die einenhohen Pflegebedarf haben, können aufgrund mangelnder Pflegemöglichkeitennicht beschult werden. Es gibt zwei Krankenschwestern an der IGS, die kleinepflegerische Eingriffe vornehmen können (z.B. Katheter legen). Pro Jahrgangwerden zwei der sechs Jahrgangsklassen der Sekundarstufe I als GU-Klassengeführt, so dass pro Schuljahr 12 GU-Plätze angeboten werden können. Bei derZusammensetzung achten die Lehrkräfte darauf, dass in den Klassen ein breitesLeistungsspektrum zusammenkommt. Weiterhin gibt es in der Regel nichtmehr als ein oder zwei Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten pro Klasse. Durchdas differenzierende Kurssystem in einigen Fächern, sind Schülerinnen undSchüler über die GU-Klassen hinaus an der Integration beteiligt. Im Hinblickauf die Erfahrung mit GU gilt die IGS als bundesweit führend. Trotzdem wirdim Kollegium jedes Schuljahr neu verhandelt, inwiefern der GU weiter bestehenbleibt.4.3 DurchführungUm eine erfolgreiche Durchführung zu ermöglichen, haben wir bei dem Anschreibenan die Institutionen die Fragebögen bereits mitgeschickt. Anschließendsind wir zu vereinbarten Treffen gefahren, um die Arbeit vorzustellen unddie Fragebögen auszuteilen. Bei einer Schule wurde die Befragung wie geplantdurchgeführt, teilweise hatten die Lehrkräfte auch schon ausgefüllte Bögendabei. Bei den anderen Schulen wurden wir durch engagierte Personen sehrunterstützt, welche uns einen langen Zeitraum über für Fragen zur Verfügungstanden und die Bögen zu dem Treffen für uns bereits eingesammelt hattenoder uns die Bögen zugeschickt haben.4.4 AuswertungUm anschauliche Ergebnisse präsentieren zu können, stellen wir die Ergebnissein Grafiken dar. Dabei werden wir zum besseren Vergleich die Daten allerSchulen in einer Grafik gegenüberstellen. In die Prozentangaben sind alle Informationender zurückerhaltenen Fragebögen mit eingeflossen. Sie ergeben105
sich aus dem Verhältnis der erhaltenen Fragebögen (Teilnehmerinnen undTeilnehmer der Befragung) zur Stichprobe (Anzahl der gesamten Lehrkräfteder Institution/en) der Population (alle Lehrkräfte im Raum Köln/<strong>Bonn</strong>).106
5 Ergebnisse und InterpretationenTrotz den kurz gehaltenen Fragebögen und der engagierten Unterstützungdurch einzelne Personen an den Schulen fallen die Rücklaufquoten nicht sehrhoch aus (Abb. 5). Dadurch ist die Stichprobe kleiner ausgefallen als erhofft.Vom Kompetenzzentrum Berliner Straße wurden Fragebögen von Lehrkräftender Förderschule, des Teams sowie der betreuten Schulen der Kompetenzregionausgefüllt. Da eine genaue Zuordnung zu den jeweiligen Schulen nichtmöglich war, kann keine Rücklaufquote errechnet werden. Zum Vergleich: wirhaben sieben Bögen von der Berliner Straße bekommen, von der Burgschulekamen drei, von der IGS elf zurück.Abb. 5: Rücklaufquoten der Lehrerfragebögen ohne Schule Berliner StraßeAnzuführende Gründe sind rein spekulativer Natur. Erklärungen können sein,dass zu wenig Zeit zum Ausfüllen und zu viel Arbeit der Lehrkräfte zu der geringenAnzahl zurückgegebener Fragebögen geführt hat. Trotzdem sind dieErgebnisse interessant.5.1 Darstellung der ErgebnisseZunächst werden die Ergebnisse in Grafiken unkommentiert abgebildet, bevorwir die Überprüfung der Hypothesen vornehmen.107
5.1.1 A: Integration/Inklusion von verhaltensauffälligen SchülerInnenan der SchuleAbb. 6: Auswertung Item A1 des LehrerfragebogensAbb. 7: Auswertung Item A2 des LehrerfragebogensAbb. 8: Auswertung Item A3 des Lehrerfragebogens108
Abb. 9: Auswertung Item A4 des Lehrerfragebogens5.1.2 B: Integration/Inklusion von verhaltensauffälligen SchülerInnenim UnterrichtAbb. 10: Auswertung Item B1 des LehrerfragebogensAbb. 11: Auswertung Item B2 des Lehrerfragebogens109
Abb. 12: Auswertung Item B3 des LehrerfragebogensAbb. 13: Auswertung Item B4 des LehrerfragebogensAbb. 14: Auswertung Item B5 des Lehrerfragebogens110
5.1.3 C: Persönliche ZufriedenheitAbb. 15: Auswertung Item C1 des LehrerfragebogensAbb. 16: Auswertung Item C2 des LehrerfragebogensAbb. 17: Auswertung Item C3 des Lehrerfragebogens111
Abb. 18: Auswertung Item C4 des Lehrerfragebogens5.1.4 Offene Frage: Würden Sie die Integration/ Inklusion an ihrerSchule als erfolgreich ansehen?Abb. 19: Auswertung offene Frage des LehrerfragebogensAls Begründungen wurden genannt:IGS Burgschule Berliner Straßeo die SuS sind sehr sozialkompetento Verbesserungen sind o das Schulklima trägt dieimmer möglichKindero Doppelbesetzung (mehrfach o Die Zusammenarbeit o aufgrund der wenigengenannt)mit Eltern ist eine wichtigeErfahrung noch nichto Heterogenität (mehrfachVoraussetzung für beurteilbar (mehrfachgenannt)erfolgreiche Arbeit genannt), trotzdem mito max. ein ES-Schüler pro o zu wenig Erfahrung positiven Aussichten;Lerngruppe(daher keine Angabe) man geht von langem112
o Kinder werden zu gutenAbschlüssen geführto langjährige Erfahrung(mehrfach genannt)o Beteiligung vieler Kolleginnenund Kollegeno hohe Nachfrage nach Integrationsplätzeno GemeinschaftProzess aus mit vielAufklärungsarbeitAbb. 20: Begründungen zur offenen Frage „Würde Sie Integration/Inklusion an IhrerSchule als erfolgreich ansehen?“5.1.5 Offene Frage: Rahmenbedingungen, die Sie noch als hilfreichempfinden würdenGenannte Rahmenbedingungen:IGS Burgschule Berliner Straßeo Ausbau der Integration undKooperation mit außerschulischenPartnerno Beibehaltung einer konsequentenDoppelbesetzung auch ino mehr Differenzierungsmöglichkeiteno Raum und Platzangeboteden Jahrgängen 7-10.o Wunsch nacho bessere räumliche und personellemehr sonderpädagogischenAusstattungo Differenzierungsstunden nur fürES-Schülero Fest an Schulen angestellteAn-geboteno Räume für AuszeitenSchulbegleiter, die auch anteiligauf mehrere Schüler gesplittetwerden können. Fortbildungenauf hohem Niveau zur InklusionVerhaltensauffälligero Mehr Integrationsklassen,Kleingruppenräumeo Mehr Zeit für Abspracheno Multiprofessionalität an Regelschulen,Integrationshelfer imSystem und nicht nur für einzelneSchüler. VeränderteRaumkonzepte für Regelschuleno mehr Inklusion in derGesellschafto Veränderung von Haltungin der Gesellschafto mehr Geld/Personal fürBildung und Erziehung(mehrfach genannt)o kleinere Klasseno Doppelbesetzung (mehrfachgenannt)o Mehr Zeit für Austausch,Besprechungen,Förderplanung, Elterngespräche(mehrfach genannt)o Differenzierungsräumeo mehr Bewegungsangeboteo Raum für Auszeit (keinenTrainingsraum!)Abb. 21: Gewünschte Rahmenbedingungen für erfolgreiche Inklusion113
5.1.6 Offene Frage: Denken Sie, dass man verhaltensauffällige Schülerinnenund Schüler inkludieren kann bzw. halten Sie es fürsinnvoll?Abb. 22: Auswertung offene Frage des Lehrerfragebogensgenannte Begründungen und Bedingungen:IGS Burgschule Berliner Straßeo sinnvoll, da sie nur so aufgefangenwerden können / notwendigo gute Zusammenarbeitmit Eltern undaußerschulischeno professionelle Hilfe durch Institutionen vonSchulpsychologen, SozialarbeiterVorteildu Jugendamt würde o je nach Auffällig-Lehrer entlastenkeit (mehrfach),o Lernen am Modell (mehrfach) manchen Kinderno mit Doppelbesetzung undmax. einem verhaltensauffälligenKind pro Lerngruppe /tut vielleicht eineintensivere FörderunggutRahmenbedingungen müssenstimmen (mehrfach)o äußerst sinnvoll, da nur danneine Normalisierung entstehenkann, Mitschüler lernen denUmgang mit Verhalten underziehen mit, soziale Integrationfunktioniert nur wohnortnaho nur mit entsprechendgutem Konzept und notwendigenfinanziellenund gesellschaftlichenVoraussetzungeno unter bestimmten Rahmenbedingungeno es gibt auch ein Rechtauf Schonraum Kleingruppeo je nach Schweregrado Die Regelschulen sindnicht personell so ausgestattet,um die SuSausreichend zu fördern.o es gibt immer individuelleUnterschiede, wo eineBeschulung an einerFörderschule ES mehrSinn machtAbb. 23: Begründungen und Ergänzungen zu den Antworten der Frage „Denken Sie, dassman verhaltensauffällige SchülerInnen inkludieren kann bzw. halten Sie es für sinnvoll?“114
5.2 Überprüfung der ersten HypotheseDie Lehrkräfte der allgemeinen wie der Förderschule sind, auch aufgrund ihrerAusbildung, noch nicht in der Lage bzw. motiviert, alle Kinder zu unterrichten.Abbildung 15 (C1, Ich fühle mich für integrative/inklusive Arbeit ausreichendausgebildet) zeigt, dass die Empfindungen der Lehrkräfte bei der Aussage, sichausreichend ausgebildet zu fühlen, weit auseinandergehen. Alle Antwortmöglichkeitenwurden genutzt. Die Antworten ‚trifft weniger zu‘ und ‚trifft eherzu‘ wurden mit je rund 33% gleich oft genannt. Ein Vergleich zwischen Förderschul-und Regelschullehrkräften (Abb. 24) zeigt, dass die Ausbildung keinenEinfluss zu haben scheint, da die Lehrkräfte beider Schulformen ähnlichsicher bzw. unsicher sind.Abb. 24: Vergleich zwischen Förderschul- und Regelschullehrkräften bei Item C1Auch die Aussagen zu C4 (Abb. 18, Ich erhalte angemessene Unterstützungund Weiterbildungsangebote) verteilen sich über alle Antwortmöglichkeiten.Rund 47% der Stichprobe findet die Aussage als eher zutreffend, rund 10%stufen sie als nicht zutreffend ein und rund 19% empfinden UnterstützungsundWeiterbildungsangebote als angemessen. Damit lässt sich eine Tendenzhin zu den positiven Antworten feststellen.B3 (Abb. 12, Ich fühle mich für die Förderung aller SchülerInnen gleichermaßenverantwortlich) kann ebenfalls für die Überprüfung der ersten Hypothesehinzugezogen werden. Auf über 85% der Befragten trifft diese Aussage zu,knapp 15% empfinden sie als weniger zutreffend.115
Fazit:Die Ergebnisse zeigen, dass die Lehrkräfte bezüglich der inklusiven ArbeitUnsicherheiten zeigen. Dabei spielt keine Rolle, für welche Schulform manausgebildet wurde. Unterschiedlich sind auch die Empfindungen einer angemessenenUnterstützung (C4). Was gegen die Hypothese spricht, ist, dass sichüber 85% der Befragten für die Förderung aller Schülerinnen und Schüler verantwortlichsehen. Diese Hypothese kann also nicht voll bestätigt werden.5.3 Überprüfung der zweiten HypotheseLehrkräfte haben mehr Schwierigkeiten, Kinder mit Verhaltensauffälligkeitenzu unterrichten als Kinder mit anderer oder keiner Behinderung.Die Auswertungen der Items B1 (Abb. 10, Ich integriere verhaltensauffälligeSchülerInnen durch Differenzierung in meinem Unterricht) und B2 (Abb. 11,Die verhaltensauffälligen SchülerInnen haben keinen Sonderstatus unter denMitschülerInnen) zeigen, dass Kinder mit Verhaltensstörungen bereits im Unterrichtintegriert werden und das offensichtlich mit Erfolg (B2). Über 80% derLehrkräfte differenzieren in ihrem Unterricht so, dass eine Integration möglichist. Nur etwas weniger, 76,2% sind der Meinung, dass es eher zutrifft, ihre verhaltensauffälligenSchülerinnen und Schüler haben keinen Sonderstatus in derKlasse. Somit wären Ausschlusserfahrungen durch erfolgreiche Integrationvorgebeugt. Wichtige Erkenntnis ist zudem, dass ein Großteil der Lehrkräftedie Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit emotional-sozialen Problemenfür möglich hält. Einige gehen sogar so weit zu sagen, dass sie notwendigist (Abb. 22).B5 (Abb. 14, Die Integration von verhaltensauffälligen SchülerInnen empfindeich als Belastung) macht jedoch auch deutlich, dass diese Integration für dieLehrkräfte mit erhöhter Belastung einhergeht. Rund 38% der Befragten empfindendie Aussage als eher zutreffend, knapp 29% sehen in der Integration vonSchülern mit Verhaltensproblemen keinerlei Belastung.Fazit:Geht man nach der Belastung, die die oben genannten 38% der Befragten empfinden,kann diese Hypothese als bestätigt angesehen werden. Trotzdemscheint es den Lehrkräften zu gelingen, die Schüler ohne große Probleme in dieKlasse zu integrieren. Dies wird vielleicht auch durch die Einstellung der116
Lehrkräfte möglich, dass Integration grundsätzlich auch für verhaltensauffälligeKinder möglich ist.5.4 Überprüfung der dritten HypotheseDie Rahmenbedingungen für eine schulische Inklusion von Kindern mit Verhaltensstörungensind noch nicht gegeben.Die bisher praktizierte Integration scheint weitgehend zu funktionieren (vgl.Abb. 19, Würden Sie die Integration/Inklusion an Ihrer Schule als erfolgreichansehen?). Die Tendenzen der Auswertungen der Items A2 (Unsere Schule istpersonell ausreichend ausgestattet), A3 (MitarbeiterInnen und schulischeGremien arbeiten gut zusammen), A4 (Ich arbeite mit lokalen außerschulischenPartnern zusammen), B3 (Ich fühle mich für die Förderung aller SchülerInnengleichermaßen verantwortlich), B4 (Ich sehe Heterogenität als Chancefür Lehren und Lernen), C2 (Ich empfinde die Arbeit mit den KollegInnen alsgut strukturiert und koordiniert), C3 (Meine Kompetenzen werden vom Kollegiumund der Schulleitung anerkannt und genutzt) unterstützen diese Wahrnehmung.Die Ergebnisse der Items von Block C können darauf zurückzuführensein, dass ein Merkmal gelungener Inklusion, die Wertschätzung aller Beteiligten,zumindest innerhalb der Kollegien, vorhanden ist. Auch Schülerinnenund Schüler mit Verhaltensstörungen können mit wenig Ausgrenzungserfahrungenintegriert werden (siehe Fazit zweite Hypothese). Wesentliches ist zudemin der Anerkennung von Heterogenität als Chance gegeben (B4).Allerdings zeigen die Antworten der offenen Fragen, dass die Integration unterbestimmten Bedingungen funktioniert (Abb. 19, Abb. 20) und dementsprechendzahlreiche ähnliche Forderungen (Abb. 21) existieren. Die genanntenRahmenbedingungen decken sich zum Großteil mit denen von uns zusammengefasstenRahmenbedingungen für erfolgreiche Integration (siehe Kapitel2.10).Fazit:Integration funktioniert bereits in den in die Untersuchung einbezogenen Institutionen.In Ansätzen sind auch wesentliche Bedingungen vorhanden, um Inklusiongelingen zu lassen. Resultierend aus den Begründungen und Forderungender Lehrkräfte und daraus, dass viele Schulen noch am Anfang der Integrationsind, ergibt sich jedoch eindeutig, dass für die erfolgreiche Inklusion von117
Kinder mit Verhaltensstörungen noch viele Rahmenbedingungen fehlen. DieHypothese kann somit bestätigt werden.118
6 Ausblick – Inklusion: Realität oder Utopie?Die Hypothese, die Rahmenbedingungen für erfolgreiche Inklusion seien nochnicht vorhanden, hat sich bestätigt. Vor allem die Antworten der offenen Fragenlassen erkennen, dass der Wunsch nach veränderten Rahmenbedingungenan der Regelschule im Vordergrund steht. Vermehrt wurden räumliche undpersonelle Erweiterungen genannt, darunter z. B. Doppelbesetzung, kleinereKlassen und Unterstützung durch Fachpersonal anderer Disziplinen, so dass dieLehrkräfte mehr Zeit für den fachlichen Austausch mit Kollegen oder Elternarbeiterhalten und generell entlastet werden. Auf externer Ebene besteht dieNachfrage nach einer engeren Zusammenarbeit mit außerschulischen Angeboten.Im Pilotprojekt der Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderungwird bereits versucht, sonderpädagogisches Wissen an die Regelschulen zubringen und lokale Unterstützungsnetzwerke für eine wohnortnahe Förderungzu stärken. Das Modell der Kompetenzzentren sieht vor, den sonderpädagogischenFörderort neben der allgemeinen Schule bestehen zu lassen. Auch Befragtesind der Ansicht, dass Integration nicht bei allen Schülerinnen und Schülernmit Verhaltensstörungen sinnvoll ist und ihr somit Grenzen setzen. DerGroßteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Befragung hält die Beschulungin der Regelschule aufgrund von positiven Verhaltensmodellen jedoch fürnotwendig und somit sinnvoll, um gelungene soziale Integration zu gewährleisten.Hingegen der Befürchtungen, Kinder und Jugendliche geraten auch in Integrationsklassenin eine Außenseiterrolle, konnten Studien belegen, dass dieSozialkompetenzen aller Schülerinnen und Schüler der Integrationsklassenpositiv beeinflusst werden. Auch unsere Befragung konnte die Besorgnissenicht bestätigen. Günstiger als die Beschulung an der Förderschule scheint sichIntegration auch auf das Leistungsverhalten der Schülerinnen und Schüler mitFörderbedarf aus. Lehrkräfte der IGS bestätigten diese These mit ihren Begründungenzu der Frage, ob sie Integration der Schule als erfolgreich ansehen.Die Zunahme der Sozialkompetenzen, sozialen Integration und die Erreichungbesserer Abschlüsse sind ausschlaggebende und notwendige Faktoren, die sichauf die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensstörungenpositiv Auswirken, so dass eine integrative Beschulung, mit demZiel Inklusion, betroffener Schülerinnen und Schüler befürwortet werden sollte.119
Dass die Rahmenbedingungen dabei eine erhebliche Rolle spielen, wird aus derBefragung ersichtlich. Sie sind Begründungen für erfolgreiche Integration underfüllen erste Schritte hin zur Inklusion. Zur Umsetzung von vollständiger,erfolgreicher Inklusion sind jedoch komplexere Veränderungen notwendig. DiePolitik muss Inklusion unabhängig von Integration als eigenständiges Konzeptanerkennen und günstige Ausgangslagen zur Umsetzung schaffen. Zu den notwendigenVoraussetzungen, die die Politik zur Verfügung stellen muss, gehörenvor allem die Bereitstellung von finanziellen Mitteln um personelle undräumliche Ausstattungen quantitativ und qualitativ zu verbessern, so dass sieden Wünschen der Lehrkräfte nachkommen und den inklusiven Bedingungenentsprechen. Einem inklusiven Schulsystem geht die Abschaffung der Förderschuleund anderen selektierenden Schulformen voraus. Dementsprechendmuss die Ausbildung an den Hochschulen für Lehrerberufe vereinheitlichtwerden, um auf die heterogene Schülerschaft vorzubereiten. Heterogenitätmuss als Normalität angesehen werden, vor allem innerhalb der Gesellschaft,denn Inklusion muss gewollt sein und kann erzwungen nicht funktionieren.Dazu gehört auch die Umwandlung der gegenwärtig noch vorherrschendenZwei-Gruppen-Theorie, die lediglich eine Unterscheidung von Kindern mitund ohne Behinderung vorsieht, hin zu einem Verständnis, das die individuellenBedürfnisse eines jeden Kindes anerkennt. Das Pilotprojekt des Kompetenzzentrumsgeht diesem Gedanken bereits nach, indem es eine sonderpädagogischeFörderung Kindern auch ohne AO-SF Verfahren zugänglich macht.In der Praxis ist Inklusion zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Realität.Aufgrund erfolgreicher Integration zeigt sich aber, dass es bei verhaltensaufälligenSchülern und Schülerinnen möglich und nötig ist, diese in heterogenenLerngruppen zu beschulen. Auf kurze Sicht ist eine inklusive Beschulung utopisch,da die notwendigen Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. Selbstwenn die finanziellen Mittel vorhanden wären, kann der Wechsel nicht radikalumgesetzt werden. Da die Gesellschaft Selektion Jahrhunderte lang als normalerlebt hat, müssen die Menschen in kleinen Schritten mit dem Konzept Inklusionvertraut gemacht werden.Auf lange Sicht sollte Inklusion aber als Ziel gesetzt sein und stetig angestrebtwerden, so dass sich die Inklusion verhaltenausfälliger Schüler und Schülerinnenvon der Utopie zur Realität entwickelt. Abgesehen davon, dass sichDeutschland durch die Ratifizierung der UN-Konvention verpflichtet hat, ein120
inklusives Schulsystem zu etablieren, ist die Inklusion auch aus entwicklungspsychopathologischerund ökonomischer Sicht wertvoll.121
7 ReflexionDie vorliegenden Ergebnisse sind aufgrund der kleinen Stichprobe nicht repräsentativund besitzen somit keine Allgemeingültigkeit. Dennoch gehen wirdavon aus, dass die Befunde ernst zu nehmende Meinungen sind. Aufgrund derVielzahl und Relevanz der Daten, haben nicht alle Items des Fragebogens fürdie Rahmenbedingungen in unserer Auswertung Berücksichtigung gefunden.Rückblickend sind wir der Meinung, dass der Theorieteil im Vergleich zumPraxisteil etwas zu stark gewichtet worden ist. Das hängt mit der Komplexitätder zusammengefügten Themenbereiche zusammen.Durch die detaillierte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Inhaltenkonnten wir im Hinblick auf unsere bevorstehende eigene Tätigkeit als Lehrkräfteklare Stellungnahmen entwickeln. Wir halten Inklusion für verhaltensauffälligeSchülerinnen und Schüler unter den gegebenen Rahmenbedingungenfür unbedingt notwendig.122
LiteraturverzeichnisBach, Heinz (1993): Verhaltensstörungen und ihr Umfeld. In: Goetze, Herbert/Neukäter, Heinz (Hrsg.): Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Band 6.Handbuch der Sonderpädagogik. 2. Auflage. Berlin: Edition Marhold, S.3-35.Becker, Katja/ Schmidt, Martin (2008): Kategoriale Klassifikationssysteme.In: Gasteiger-Klicpera, Barbara/ Julius, Henri/ Klicpera, Christian(Hrsg.): Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung.Band 3. Handbuch der Sonderpädagogik. Göttingen: Hogrefe, S. 34-48.Bittner, Günther/ Ertle, Christoph/ Schmid, Volker (1974): Schule und Unterrichtbei verhaltensgestörten Kindern. In: Deutscher Bildungsrat(Hrsg.): Gutachten und Studien der Bildungskommission. Sonderpädagogik4. Stuttgart: Klett. S. 13-102.Booth, Tony/ Ainscow, Mel (2002): Vaughan, Marc (Hrsg.): The Index forInclusion - Developing learning and participation in schools. (o. A.): Centrefor Studies on Inclusive Education (UK).Borchert, Johann/ Schuck, Karl Dieter (1992): Integration: Ja! Aber wie?Ergebnisse aus Modellversuchen zur Förderung behinderter Kinder undJugendlicher. Hamburg: Hamburger Buchwerkstatt.Bortz, Jürgen/ Döring, Nicola (2006): Forschungsmethoden und Evaluationfür Human- und Sozialwissenschaftler. 4. Auflage. Heidelberg: Springer.Bruchmann, Sebastian (2008): Geschichte der Pädagogik: Die Epoche derAufklärung. In: Pflüger, Niels (Hrsg.): Basiskurs Pädagogik. Überblicküber die Grundbegriffe, Geschichte und Paradigmen der Erziehungswissenschaft.Norderstedt: Books on Demand GmbH, S. 128-136.Bühner, Markus (2006): Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion.2. aktualisierte und erweiterte Auflage. München: Pearson EducationDeutschland GmbH.Bürli, Alois (1997): Sonderpädagogik international. Vergleiche, Tendenzen,Perspektiven. Luzern: Edition SZH/SPC.Cloerkes, Günther (2003): Zahlen zum Staunen. Die deutsche Schulstatistik.In: Cloerkes, Günther (Hrsg.): Wie man behindert wird. Texte zur Konstruktioneiner sozialen Rolle und zur Lebenssituation betroffener Menschen.Heidelberg: Winter, S. 11-23.Deppe-Wolfinger, Helga (2004): Integrationskultur- am Anfang oder Ende?In: Schnell, Irmtraud/ Sander, Alfred (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. BadHeilbrunn: Klinkhardt. S. 23-40.Deutscher Bildungsrat Empfehlung der Bildungskommission(1973): Zurpädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohterKinder und Jugendlicher. Stuttgart: Klett.Duden (1997): Fremdwörterbuch. Band 5. Mannheim: Brockhaus.Dumke, Dieter/ Eberl, Doris (2002): Bereitschaft von Grundschullehrern zumgemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Schülern.In: Psychologie in Erziehung und Unterricht, Jg. 49, 1, S. 71-83.123
Eberwein, Hans (1990): Integrationspädagogik als Weiterentwicklung (sonder-)pädagogischen Denkens und Handelns. In: Eberwein, Hans (Hrsg.):Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik.Weinheim: Beltz, S. 45-53.Eberwein, Hans/ Knauer, Sabine (2002): Integrationspädagogik als Ansatzzur Überwindung pädagogischer Kategorisierungen und schulischer Systeme.In: Eberwein, Hans/ Knauer, Sabine (Hrsg.): Integrationspädagogik.Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam. 6. Auflage.Weinheim: Beltz, S. 17-35.Eberwein, Hans/ Mand, Johannes (2008): Integration konkret. Begründung,didaktische Konzepte, inklusive Praxis. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.Ellger-Rüttgardt, Sieglind (2006): Geschichte der sonderpädagogischen Institutionen.In: Harney, Klaus/ Krüger, Heinz-Hermann (Hrsg.): Einführungin die Geschichte der Erziehungswissenschaft und Erziehungswirklichkeit.Opladen: Barbara Budrich, S. 269-290.Feuser, Georg (2005): Was bring uns der Inklusionsbegriff? Perspektiven einerinklusiven Pädagogik: Vortrag vom 29.09.2005 bei der 42. Arbeitstagungder Dozentinnen und Dozenten der Sonderpädagogik in deutschsprachigenLändern an der Hochschule Zittau/Görlitz (FH) vom 29.09 bis1.10.2005.Feuser, Georg (1995): Behinderte Kinder und Jugendliche. Zwischen Integrationund Aussonderung. Darmstadt :Wissenschaftliche BuchgesellschaftGoetze, Herbert (1990): Verhaltensgestörte in Integrationsklassen - Fiktionenund Fakten. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 41, 12, S. 832-840.Goetze, Herbert/ Neukäter, Heinz (1994): Unterricht bei Schülern mit Verhaltensstörungen.Potsdam: Universität, Institut für Sonderpädagogik. Serie:Potsdamer Studientexte: Sonderpädagogik 3.Groppe, Carola (2006): Pädagogik im 19. Jahrhundert. Pädagogische Denkformen,Erziehungswirklichkeit und Bildungssystementwicklung um1800 und 1900. In: Harney, Klaus/ Krüger, Heinz-Hermann (Hrsg.): Einführungin die Geschichte der Erziehungswissenschaft und Erziehungswirklichkeit.Opladen: Barbara Budrich, S. 37-70.Häberlein-Klumpner, Ramona (2009): Separation – Integration – Inklusionunter problemgeschichtlicher Perspektive. In: Thoma, Pius/ Rehel, Cornelia:Inklusive Schule. Leben und Lernen mittendrin. Bad Heilbrunn:Klinkhardt, S. 35-46.Haupt, Ursula (1985): Die schulische Integration von Behinderten. In : Bleidick,Ulrich: Handbuch der Sonderpädagogik. Theorie der Behindertenpädagogik.Berlin: Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, S. 152- 197.Hausotter, Anette (2002). Entwicklungen und Trends integrativer Erziehungin Europa. In: Eberwein, Hans/ Knauer, Sabine (Hrsg.): Integrationspädagogik.6. Auflage. Weinheim: Beltz . S. 471-484.Hergenröder, Martina (2008): Geschichte der Pädagogik: Renaissance, Reformationund Barock. In: Pflüger, Niels (Hrsg.): Basiskurs Pädagogik.Überblick über die Grundbegriffe, Geschichte und Paradigmen der Erziehungswissenschaft.Norderstedt: Books on Demand GmbH, S. 91-99.124
Hillenbrand, Clemens (2003): Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen.2. Auflage. München: Ernst Reinhardt.Hillenbrand, Clemens (2006): Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen.3. überarbeitete Auflage. München: Reinhardt.Hillenbrand, Clemens (2008): Begriffe und Theorien im Förderschwerpunktsoziale und emotionale Entwicklung – Versuch einer Standortbestimmung.In: Gasteiger-Klicpera, Barbara/ Julius, Henri/ Klicpera, Christian(Hrsg.): Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung.Band 3. Handbuch der Sonderpädagogik. Göttingen: Hogrefe, S. 5-24.Hillenbrand, Clemens/ Hennemann, Thomas (2005): Prävention von Verhaltensstörungenim Vorschulalter. Überblick und theoretische Grundlegung.In: Vierteljahreszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete,2, 2005, S.129-144.Hillenbrand, Clemens/ Hennemann, Thomas (2006): Präventive Erziehungshilfein der Grundschulstufe. Zeitschrift für Heilpädagogik, 2,2006, S. 42-51.Hinz, Andreas (2000): Sonderpädagogik im Rahmen von Pädagogik der Vielfaltund Inclusive Education. Überlegungen zu neuen paradigmatischenOrientierungen. In: Albrecht, Friedrich/ Hinz, Andreas/ Moser, Vera(Hrsg.): Perspektiven der Sonderpädagogik. Neuwied: Luchterhand, S.124-140.Hinz, Andreas (2003): Die Debatte um Integration und Inklusion – Grundlagefür aktuelle Kontroversen in Behindertenpolitik und Sonderpädagogik?In: Sonderpädagogische Förderung 4, S. 330-347.Holtmann, Martin/ Schmidt, Martin (2008): Dimensionale Klassifikationssysteme.In: Gasteiger-Klicpera, Barbara/ Julius, Henri/ Klicpera, Christian(Hrsg.): Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung.Band 3. Handbuch der Sonderpädagogik. Göttingen: Hogrefe, S.25-34.Ihle, Wolfgang/ Esser, Günter (2008): Epidemiologie psychischer Störungendes Kindes- und Jugendalters. In: Gasteiger-Klicpera, Barbara/ Julius,Henri/ Klicpera, Christian (Hrsg.): Sonderpädagogik der sozialen undemotionalen Entwicklung. Band 3. Handbuch der Sonderpädagogik. Göttingen:Hogrefe, S. 49-62.Inckemann, Elke (1997): Die Rolle der Schule im sozialen Wandel. Bestimmungin Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft am Beispiel der Grundschule.Bad Heilbrunn: Klinkhardt.Knauer, Sabine (2002): Integrationspädagogik im gesellschaftlichen Umbruch.Eberwein, Hans; Knauer, Sabine (Hrsg.): Integrationspädago-gik.Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam. 6. Auflage. Basel:Beltz Verlag. Basel, S. 53- 68.Kobi, Emil E. (1993): Veränderte Begriffsbildung und Begründung eines integrationspädagogischenVerständnisses. Was bedeutet Integration? -Analyse eines Begriffes. In: Eberwein, Hans (Hrsg.): Behinderte undNichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik.2. Auflage. Weinheim: Beltz, S. 54-62.125
Kobi, Emil E. (2006): Inklusion: ein pädagogischer Mythos. In: Dederich,Markus (Hrsg.): Inklusion statt Integration. Heilpädagogik als Kulturtechnik.Gießen: Psychosozial-Verlag, S. 28-42.Kocyigit-Baumgartner, Hüseyin (2008): Geschichte der Pädagogik: Antike,Christentum und Mittelalter. In: Pflüger, Niels (Hrsg.): Basiskurs Pädagogik.Überblick über die Grundbegriffe, Geschichte und Paradigmen derErziehungswissenschaft. Norderstedt: Books on Demand GmbH, S. 71-78.Krach, Stafanie (2009): Zur Herleitung und Begründung des Begriffs Inklusion.In: Behindertenpädagogik, 4, S.382-397.Lauer, Brigitte (2008): Geschichte der Pädagogik: Aristoteles – ein „Pädagoge“der Antike. In: Pflüger, Niels (Hrsg.): Basiskurs Pädagogik. Überblicküber die Grundbegriffe, Geschichte und Paradigmen der Erziehungswissenschaft.Norderstedt: Books on Demand GmbH, S. 63-70.Liesen, Christian (2004): Was unterscheidet Inklusion und Integration? In:Kummer Wyss, Annemarie/ Walther-Müller, Peter (Hrsg.): Integration:Anspruch und Wirklichkeit. Luzern: Edition SZH/CSPS, S. 67-86.Lindmeier, Christian (2008): Inklusive Bildung als Menschenrecht. In: SonderpädagogischeFörderung heute, 53, S. 354- 398.Markowetz, Reinhard (2007): Soziale Integration, Identität, und Entstigmatisierung.Behindertensoziologische Aspekte und Beiträge zur Theorieentwicklungin der Integrationspädagogik. (o. O): (o. V.).Möckel, Andreas (2002): Die Funktion der Sonderschule und die Forderungder Integration. In: Eberwein, Hans/ Knauer, Sabine (Hrsg.): Integrationspädagogik.Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam. 6.Auflage. Weinheim: Beltz, S. 80-98.Möckel, Andreas (2007): Geschichte der Heilpädagogik. Stuttgart: Klett-Cotta.Muth, Jakob (1991): Zehn Thesen zur Integration von behinderten Kindern.Vierteljahreszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, 60,S. 1-5.Myschker, Norbert (2005): Verhaltensstörungen bei Kinder und Jugendlichen.Erscheinungsformen – Ursachen – hilfreiche Maßnahmen. 5. Auflage.Stuttgart: Kohlhammer.Opp, Günther (2009): Gefühls- und Verhaltensstörung. Begriffsdiskussion,Erscheinungsformen, Prävalenz. In: Opp, Günther/ Theunissen, Georg(Hrsg.): Handbuch schulische Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt,S. 227-231.Opp, Günther/ Unger, Nicola (2003): Begriffliche Grundlagen. In: Opp, Günther(Hrsg.): Arbeitsbuch schulische Erziehungshilfe. Bad Heilbrunn:Klinkhard, S. 43-64.Preuss-Lausitz, Ulf (2002): Integrationsforschung. Ansätze, Ergebnisse undPerspektiven. In: Erberwein, Hans/ Knauer, Sabine (Hrsg.): Integrationspädagogik.6. Auflage. Weinheim: Beltz, S. 458-470.Preuss-Lausitz, Ulf (2005): Verhaltensauffällige Kinder integrieren. Zur Förderungder emotionalen und sozialen Entwicklung. Weinheim: Beltz.126
Preuss-Lausitz, Ulf/ Textor, Annette (2005): Schulpolitische und pädagogischeRahmenbedingungen integrativer Förderung schwieriger Schüler.Das Beispiel Berlin. In: Preuss-Lausitz, Ulf (Hrsg.): VerhaltensauffälligeKinder integrieren. Zur Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung.Weinheim: Beltz, S. 27- 38.Purr, Mathias (2008): Geschichte der Pädagogik: Das Zeitalter der Industrialisierungund das 20. Jahrhundert. In: Pflüger, Niels (Hrsg.): BasiskursPädagogik. Überblick über die Grundbegriffe, Geschichte und Paradigmender Erziehungswissenschaft. Norderstedt: Books on Demand GmbH,S. 190-196.Rehle, Cornelia (2009): Grundlinien einer inklusiven, entwicklungsorientiertenDidaktik. In: Pius, Thomas/ Rehle, Cornelia: Inklusive Schule. Lebenund Lernen mittendrin. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 183- 194.Reiser, Helmut (1997): Lern- und Verhaltensstörungen als gemeinsame Aufgabevon Grundschul- und Sonderpädagogik unter dem Aspekt der pädagogischenSelektion. In : Zeitschrift für Heilpädagogik, 48 (7), S. 266-275.Reiser, Helmut (2002): Sonderpädagogische Unterstützung zur Nichtaussonderungbei Verhaltensproblemen in der Schule. In: Eberwein,Hans/ Knauer, Sabine (Hrsg.): Integrationspädagogik. Kinder mit undohne Behinderung lernen gemeinsam. 6. Auflage. Weinheim: Beltz, S.338-359.Reiser, Helmut (2003): Vom Begriff Integration zum Begriff Inklusion. Waskann mit dem Begriffswechsel angestoßen werden. In: SonderpädagogischeFörderung 4, S. 305-312.Reiser, Helmut (2007): <strong>Integrierte</strong> schulische Erziehungshilfe. In: Reiser,Helmut/ Willmann, Marc/ Urban, Michael (Hrsg.): SonderpädagogischeUnterstützungssysteme bei Verhaltensproblemen in der Schule. Innovationenim Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung. BadHeilbrunn: Klinkhardt, S. 71-90.Reiser, Helmut/ Willmann, Marc/ Urban, Michael (2007): SonderpädagogischeUnterstützungssysteme bei Verhaltensproblemen in der Schule. Innovationenim Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung.Bad Heilbrunn: Klinkhardt.Ricking, Heinrich/ Hennemann, Thomas (2008): Stillstand oder Innovation?Tendenzen in der Didaktik und Methodik im Förderschwerpunkt emotionaleund soziale Entwicklung. In: Biewer, Gottfried/ Luciak, Mikael/Schwinge, Mirella (Hrsg.): Begegnung und Differenz: Menschen-Länder-Kulturen. Beiträge zur Heil- und Sonderpädagogik. BadHeilbrunn: Klinkhardt, S. 361-370.Rosenberger, Manfred (1998): Zur Entwicklung der Idee einer ‚Schule ohneAussonderung’. In: Rosenberger, Manfred (Hrsg.): Schule ohne Aussonderung- Idee, Konzepte, Zukunftschancen. Pädagogische Förderung behinderterund von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher.Neuwied: Luchterhand, S. 12-39.127
Rosenberger, Manfred (1998a): Schule ohne Aussonderung- Idee, Konzepte,Zukunftschancen .Pädagogische Förderung behinderter und von Behinderungbedrohter Kinder und Jugendlicher. Neuwied: Luchterhand.Sander, Alfred (1998): Schulorganisatorische Formen und Aspekte. In: Rosenberger,Manfred (Hrsg.): Schule ohne Aussonderung- Idee, Konzepte,Zukunftschancen . Pädagogische Förderung behinderter und von Behinderungbedrohter Kinder und Jugendlicher. Neuwied: Luchterhand, S.54-65.Sander, Alfred (2001): Internationaler Stand und Konsequenzen für die sonderpädagogischeFörderung in Deutschland. In: Hausotter, A./ Boppel,W./ Meschenmoser, H. (Hrsg.): Perspektiven Sonderpädagogischer Förderungin Deutschland. Dokumentation der Nationalen Fachtagung vom14-16. November 2001 in Schwerin. Middelfahrt (European Agency), S.143-146.Sander, Alfred (2008). Inklusion macht Schule: Ein langer Weg zu einemhumaneren Bildungswesen. In: Sonderpädagogische Förderung heute, 4,S. 342-353.Sander, Alfred (2008a): Etappen auf dem Weg zu integrativer Erziehung undBildung. In: Eberwein, Hans/ Mand, Johannes (Hrsg.): Integration konkret.Begründung, didaktische Konzepte, inklusive Praxis. BadHeilbrunn: Klinkhardt, S. 27-40.Schär, Adelheit/ Parmentier, Ursula (1996): Integration- keine Frage! Behinderteund nichtbehinderte Kinder gemeinsam schulen. Vom 1. April1995 in Zürich/ Luzern: Ed 257 H/ SPC.Schlee, Jörg (1993): Zur Problematik der Terminologie in der Verhaltensgestörtenpädagogik.In: Goetze, Herbert/ Neukäter, Heinz (Hrsg.): Pädagogikbei Verhaltensstörungen. Band 6. Handbuch der Sonderpädagogik. 2.Aufl. Berlin: Edition Marhold, S. 36-49.Schmid, Pia (2006): Pädagogik im Zeitalter der Aufklärung. In: Harney,Klaus/ Krüger, Heinz-Hermann (Hrsg.): Einführung in die Geschichteder Erziehungswissenschaft und Erziehungswirklichkeit. Opladen: BarbaraBudrich, S.15-36.Schnell, Irmtraud (2003): Geschichte schulischer Integration. GemeinsamesLernen von SchülerInnen mit und ohne Behinderung in der BRD seit1970. Weinheim und München. Juventa.Schumann, Brigitte (2009): Inklusion: Eine Verpflichtung zum Systemwechsel.Deutsche Schulverhältnisse auf dem Prüfstand des Völkerrechts. In:Zeitschrift Pädagogik, Heft 2/2009, S. 51-53.Specht, Nadine (2008): Geschichte der Pädagogik: Renaissance – Reformation– Barock. Die Entwicklung der Klosterschule bis hin zur Universität. In:Pflüger, Niels (Hrsg.): Basiskurs Pädagogik. Überblick über die Grundbegriffe,Geschichte und Paradigmen der Erziehungswissenschaft. Norderstedt:Books on Demand GmbH, S. 80-90.Speck, Otto (1993): Sonderpädagogische Organisationsformen. In: Goetze,Herbert/ Neukäter, Heinz (Hrsg.): Pädagogik bei Verhaltensstörungen.128
Band 6. Handbuch der Sonderpädagogik. 2. Aufl. Berlin: Edition Marhold,S. 191-228.Stein, Roland/ Stein, Alexandra (2006): Unterricht bei Verhaltensstörungen.Ein integratives didaktisches Modell. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.Textor, Annette (2007). Analyse des Unterrichts mit „schwierigen“ Kindern.Hintergründe, Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen. Bad Heilbrunn:Klinkhardt.Textor, Annette (2009): Nötig und möglich - Gemeinsamer Unterricht mitSchülern mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.In: Börner, Simone/ Glink, Andreas/ Jäpelt, Birgit/ Saners, Dietke/Sasse, Ada (Hrsg.): Integration im vierten Jahrzehnt. Bilanz und Perspektiven.Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S.113-122.Van Ackeren, Isabell/ Klemm, Klaus (2009): Entstehung, Struktur und Steuerungdes deutschen Schulsystems. Eine Einführung. Wiesbaden: VSVerlag für Sozialwissenschaften.Vernooij, Monika (1994): Das Sonderpädagogische Förderzentrum – eineneue Möglichkeit der institutionalisierten Hilfe für Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten?In: Goetze, Herbert (Hrsg.): Pädagogik bei Verhaltensstörungen– Innovationen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 41-57.Vojtová, Vera/ Bloemers, Wolf/ Johnstone, David (2006): PädagogischeWurzeln der Inklusion. Berlin: Frank & Timme.Willmann, Marc (2007): Die Schule für Erziehungshilfe/Schule mit dem FörderschwerpunktEmotionale und Soziale Entwicklung: Organisationsformen,Prinzipien, Konzeptionen. In: Reiser, Helmut/ Willmann, Marc/Urban, Michael: Sonderpädagogische Unterstützungssysteme bei Verhaltensproblemenin der Schule. Innovationen im Förderschwerpunkt Emotionaleund Soziale Entwicklung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 13-70.Wlaschek, Michael (2010): Inklusion (k)eine neue Form der Sonderpädagogik?In: Schule Heute. Zeitschrift des Verbandes Bildung und Erziehung2/2010, S. 4-6.Wocken, Hans (1993): Bewältigung von Andersartigkeit, Untersuchungen zursozialen Distanz in verschiedenen Schulen. In: Gehrmann, Petra/ Hüwe,Birgit (Hrsg.): Forschungsprofile der Integration von Behinderten: BochumerSymposion 1992. Essen: Neue Deutsche Schule-Verlagsgesellschaft, S. 86-106.Wocken, Hans (1998): Integrative Prozesse. In: Rosenberger, Manfred(Hrsg.): Ratgeber gegen Aussonderung. 2. Auflage. Heidelberg: UniversitätsverlagC. Winter, S.174- 181.Wocken, Hans (1987): Integrationsklassen in Hamburg. Erfahrungen, Unersuchungen,Anregungen. Solms: Oberbiel.129
Internetquellen:Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen(2009a): Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.Zwischen Deutschland, Lichtenstein, Österreich, und derSchweiz abgestimmte Version. Online im Internet:http://www.behindertenbeauftragter.de/nn_1040358/SharedDocs/Publikationenen/DE/Broschuere__UNKonvention__KK,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Broschuere_UNKonvention_KK.pdf (Stand:07.08.2010).Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen(2009b): Die Behindertenrechtskonvention – BRK. Online im Internet:http://www.behindertenbeauftragter.de/cln_115/nn_1369658/AI/Konvention/WasistdieUNKonvention__node.html?__nnn=true (Stand:06.08.2010).Berlinerstraße, Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung:www.schule-berlinerstrasse.de (Stand: 02.11.2010)Bezirksregierung Köln (2010): Sonderpädagogisches Kompetenzzentrum.Online im Internet: http://www.bezregkoeln.nrw.de/brk_internet/organisation/abteilung04/dezernat_41/kompetenzzentrum/index.html (Stand: 23.09.10).Boban, Ines/ Hinz, Andreas (2004): Qualität des Gemeinsamen Unterrichts(weiter-) entwickeln – Inklusion. In: Leben mit Down-Syndrom, 45, S.10 – 14. Online im Internet:http://www.trisomie21.de/inklusion_boban_hinz.pdf(Stand:06.09.2010).Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2009): Übereinkommen derVereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.Online im Internet:http://www.bmas.de/portal/25970/2008__04__30__rechte__von__menschen__mit__behinderungen.html (Stand: 27.07.2010).Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW): Erklärung der GEWvom 14.01.2009 zur Überarbeitung der KMK-Empfehlungen zur sonderpädagogischenFörderung. Online im Internet:http://www.gew.de/Binaries/Binary40744/GEW-Beschluss_KMK_%C3%9Cberarb_sondp%C3%A4d.pdf (Stand:05.11.2010).GGS Burgschule Frechen (o. A.): www.burgschule-frechen.de (Stand:02.11.2010)Hinz, Andreas (2002): Von der Integration zur Inklusion - terminologischesSpiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung. Online im Internet:http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-inklusion.html (Stand 10.06.2010)Hinz, Andreas/ Boban, Ines (2003): Index für Inklusion. Lernen und Teilhabein der Schule der Vielfalt entwickeln. Online im Internet:130
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20German.pdf (Stand:09.06.2010)Integration / Inklusion Köln (o. A.): Die UN-Konvention - Einführung. Onlineim Internet:http://www.inkoe.de/information/information_detail.php?thema_id=5&eintrag_id=25#information_inhalt (Stand: 05.11.2010)<strong>Integrierte</strong> <strong>Gesamtschule</strong> <strong>Bonn</strong>-<strong>Beuel</strong> (o. A.): http://www.gebonn.de (Stand:02.11.2010)<strong>Integrierte</strong> <strong>Gesamtschule</strong> <strong>Bonn</strong>-<strong>Beuel</strong> (2008): Qualitätsanalyse Nordrhein-Westfalen. Impulse für die Weiterentwicklung von Schule. Qualitätsbericht.<strong>Gesamtschule</strong> <strong>Bonn</strong>-<strong>Beuel</strong>. 09.05.2008. Online im Internet:http://www.gebonn.de/schule/evaluation/Bericht_QuB_GE_BN-<strong>Beuel</strong>.pdf (Stand: 02.11.2010)Klemm, Klaus/ Preuss-Lausitz (2008): Gutachten zum Stand zum Stand undzu den Perspektiven der sonderpädagogischen Förderung in den Schulender Stadtgemeinde Bremen. Online im Internet: 05.11.2010Kultusministerkonferenz: Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusministerder Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.)(1994): Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulenin der Bundesrepublik Deutschland. Online im Internet:http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1994/1994_05_06-Empfehl-Sonderpaedagogische-Foerderung.pdf (Stand:01.07.2010)Kultusministerkonferenz: Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusministerder Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.)(2000): Empfehlungen zum Förderschwerpunkt emotionale und sozialeEntwicklung. Online im Internet:http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2000/2000_03_10-FS-Emotionale-soziale-Entw.pdf (Stand: 28.08.2010)Kultusministerkonferenz: Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusministerder Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.)(2005): Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz.Dokumentation Nr. 177 – November 2005. Sonderpädagogische Förderungin Schulen 1994 bis 2003. Online im Internet:http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/Dokumentation177.pdf (Stand: 18.08.2010)Kultusministerkonferenz: Sekretariat der ständigen Konferenz der Kultusministerder Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.)(2010): Statistische Veröffentlichungen der Kultusministerkonferenz.Dokumentation Nr. 189 – März 2010. Sonderpädagogische Förderung inSchulen 1999 bis 2008. Online im Internet:http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Statistik/Dok_189_SoPaeFoe_2008.pdf (Stand: 20.08.2010)Liesen, Christian/ Felder, Franziska (2004): Bemerkungen zur Inklusionsdebatte.Online im Internet: http://www.heilpaedagogikonline.com/2004/heilpaedagogik_online_0304.pdf(Stand: 01.07.2010).131
Meyer, Kerstin (2009): Im Paradies für Pädagogen. Zeitungsartikel im KölnerStadt Anzeiger. Online im Internet:http://www.ksta.de/html/artikel/1260194919792.shtml (Stand:02.11.2010).Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2009): Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderungim Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen- Unterricht und individuelleFörderung in den Pilotregionen. Grundsatzpapier. Online im Internet:http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Projekte/Kompetenzzentren_sonderpaedagogische_Foerderung/Grundsatzpapier.pdf(Stand: 01.11.2010)Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2010):a) Das Schulsystem in NRW. Online im Internet:http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem (Stand:22.09.10).b) Das Schulwesen in Nordrhein-Westfalen aus quantitativer Sicht2009/10. 3. Auflage. Online im Internet:http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Statistik/2009_10/StatUebers.pdf (Stand: 23.09.10).c) Förderschulen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung.Online im Internet:http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Schulformen/Foerderschulen/EmotionaleUndSozialeEntwicklung.html (Stand:05.10.2010).d) Grundlegende Gesetze. Online im Internet:http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Gesetze/index.html(Stand: 23.09.10).e) Pädagogische und rechtliche Aspekte der Umsetzung des Übereinkommensder Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschenmit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention - VN-BRK) in derschulischen Bildung. Online im Internet:http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Behindertenrechtskonvention/Diskussionspapier-Stand-29-04-2010.pdf (Stand:03.10.2010).f) Die Förderschulen. Online im Internet:http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulsystem/Schulformen/Foerderschulen/index.html (Stand 24.09.10)Modellkolleg Bildungswissenschaften (o. A.): Antrag für das Sonderprogramm‚Innovation in Lehre und Studium’ für ein Modellkolleg Bildungswissenschaften(School of Education). Online im Internet:http://www.hf.unikoeln.de/data/modellkolleg/File/School%20of%20Education.pdf(Stand:05.11.2010).132
Salamanca-Statement (1994): The Salamanca Statement and Framework forAction on Special Needs Education. Adopted by the World Conferenceon Special Needs Education: Access and Quality. Online im Internet:http://www.european-agency.org/about-us/european-keydocuments/salamanca-statement-and-framework.pdf(Stand: 05.11.2010).Sander, Alfred (2002). Von der integrativen zur inklusiven Bildung. InternationalerStand und Konsequenzen für die sonderpädagogische Förderungin Deutschland. Online im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/sanderinklusion.html(Stand: 24.06.2010)Schuhmann, Brigitte (2009): Inklusion statt Integration: eine Verpflichtungzum Systemwechsel. Deutsche Schulverhältnisse auf dem Prüfstand desVölkerrechts. Online im Internet:http://www.gew.de/Binaries/Binary43645/SonderdruckManifest.pdf(Stand: 05.11.2010)Schumann, Monika (2009): Die „Behindertenrechtskonvention“ in Kraft! –Ein Meilenstein auf dem Weg zur inklusiven Bildung in Deutschland.Online im Internet: http://www.inklusiononline.net/index.php/inklusion/article/view/35/42(Stand: 16.08.2010)United Nations (2006): Convention on the Rights of Persons with Disabilities.Online im Internet:http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml (Stand:05.11.2010).133
Anhang134