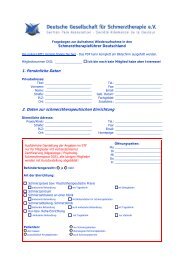Schmerztherapie 1/2010 - Schmerz Therapie Deutsche Gesellschaft ...
Schmerztherapie 1/2010 - Schmerz Therapie Deutsche Gesellschaft ...
Schmerztherapie 1/2010 - Schmerz Therapie Deutsche Gesellschaft ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
und Interpretationen der Ärzte gegenüber ihren<br />
Patienten. Diese vier Dimensionen wirken auf<br />
den Interaktionsverlauf und das Verständnis des<br />
Gesprächs ein und beeinflussen sowohl die Diagnosestellung<br />
als auch den <strong>Therapie</strong>erfolg.<br />
1. Machtasymmetrie: Interkulturelle Beziehungen<br />
sind in der Regel durch Machtasymmetrien<br />
wie Status- und Rechtsungleichheit<br />
gekennzeichnet. Daraus resultiert eine Überlegenheit<br />
an Handlungsmöglichkeiten wie z.B.<br />
Zugang zu Informationen, Sprachkenntnisse,<br />
materielle Ressourcen, aber auch eine Überlegenheit<br />
im institutionell vorgegebenen Beziehungsgefüge<br />
im Verhältnis zwischen Arzt und<br />
Patient.<br />
2. Kollektiverfahrungen: Im Hintergrund der<br />
Kommunikation wirken außer historischen Kollektiverfahrungen<br />
(z.B. die koloniale Vergangenheit<br />
einiger Zuwanderergruppen) auch Diskriminierungserfahrungen<br />
des Einzelnen oder der<br />
Gruppe auf die Beziehungsebene der Kommunikationspartner.<br />
Angehörige diskriminierter<br />
Gruppen bringen möglicherweise ein generalisiertes<br />
Misstrauen mit in die Sprechstunde, das<br />
die Entwicklung eines Vertrauensverhältnisses<br />
erschwert. Sie können mit Rückzugsverhalten,<br />
aber auch mit hohen Erwartungen an die Dominanzkultur<br />
einhergehen. Angehörige der Mehrheitskultur<br />
reagieren darauf häufig paternalistisch<br />
durch kontrollierendes, überfürsorgliches<br />
Verhalten. Die Migranten werden nach stereotypen<br />
Bildern ethnisiert oder auch idealisiert.<br />
Meist wird jedoch die Problemursache der Minderheit<br />
zugeschoben und deren „mangelnder<br />
Anpassungsbereitschaft“ zugeschrieben.<br />
3. Fremdbilder: Fremdbilder basieren auf Kollektiverfahrungen<br />
sowie gesellschaftlich, politisch<br />
oder medial geprägten Bildern, so wie es<br />
im Ausland auch das Bild „des <strong>Deutsche</strong>n“ gibt.<br />
Verschiedene Studien stellen fest, dass Fremdbilder<br />
aus Anlass von Konflikten mit medialer<br />
Unterstützung sehr rasch zu Feindbildern gemacht<br />
werden können. Die gegenseitige Erwartungshaltung<br />
kann die individuelle Beziehung<br />
von vornherein belasten. Im günstigen Fall, das<br />
heißt in nicht allzu asymmetrischen Konstellationen,<br />
wird „kulturelle Identität ausgehandelt“. Von<br />
beiden Seiten werden in diesem Fall kulturelle<br />
Merkmale zur Disposition gestellt, die Fremdbilder<br />
können korrigiert werden.<br />
4. Kulturdifferenzen: Differente Kulturmuster<br />
beschreiben die kulturellen Codes, nach denen<br />
unser Alltagsleben organisiert ist. Gerade die<br />
Unreflektiertheit dieser Alltagsmuster kann bei<br />
interkulturellen Kontakten zu Irritationen und<br />
Konflikten führen. Dies gilt auch für nonverbale<br />
Ausdrucksformen wie Mimik und Gestik, Körperhaltung<br />
und die räumliche Distanz zwischen<br />
den Kommunikationspartnern. Viele Kommunikationsregeln<br />
erschließen sich dem Kulturneu-<br />
SCHMERZTHERAPIE 1/<strong>2010</strong> (26. Jg.)<br />
Nach Auernheimer 00<br />
ling nicht von alleine, wenn sie nicht explizit<br />
gehandhabt werden (Auernheimer, 2008).<br />
Zugangsbarrieren zum<br />
Gesundheitswesen<br />
Aufseiten der Migranten tragen fehlende Kontakte<br />
zu <strong>Deutsche</strong>n, Sprachprobleme und<br />
mangelnde Kenntnisse des Gesundheitssystems<br />
dazu bei, dass die Dienste der Gesundheitsversorgung<br />
nur wenig in Anspruch genommen<br />
werden. Es bestehen hohe Defizite im<br />
Wissensstand bezüglich der Behandlungsmöglichkeiten<br />
und präventiven Angebote.<br />
In Bezug auf die versorgungsspezifischen<br />
Faktoren existieren Zugangsbarrieren für die<br />
Migranten, da sich die Angebote des Gesundheitswesens<br />
aufgrund mangelnder interkultureller<br />
Kompetenz der Fachkräfte in der Regel<br />
an den Bedürfnissen der Mehrheitsgesellschaft<br />
orientieren. So erreichen die Informationen über<br />
die zahlreichen vorhandenen Angebote die Migranten<br />
häufig nicht. Sie kennen die Versorgungsstrukturen<br />
nicht oder nur in Ansätzen, was dazu<br />
führt, dass eine medizinische Behandlung nicht<br />
rechtzeitig oder nur unvollständig in Anspruch<br />
genommen wird. Dies führt zu einem erhöhten<br />
zeitlichen, finanziellen und personellen Ressourcenaufwand<br />
in Form von Fehl- und Endlosdiagnosen,<br />
Chronifizierungen, verstärktem Einsatz<br />
invasiver <strong>Therapie</strong>maßnahmen oder häufigeren<br />
stationären Einweisungen (vgl. Lauderdale,<br />
2006, nach Bermejo et al., 2009).<br />
Häufiger Umgang mit Kommunikationsproblemen<br />
Die derzeitigen kommunikativen Lösungsansätze<br />
basieren häufig auf Zufälligkeiten. Mitgebrachte<br />
Kinder – teilweise sogar Grundschulkinder<br />
–, Verwandte oder Nachbarn werden<br />
Interkulturelle Kommunikation und PTBS<br />
zum Übersetzen hinzugezogen. Die Patienten<br />
haben jedoch eine hohe Hemmschwelle, sich<br />
bei der Anamnese den Angehörigen oder Bekannten<br />
gegenüber ehrlich zu offenbaren. Die<br />
Erfahrung zeigt, dass auch gut Deutsch sprechende<br />
Gefälligkeitsdolmetscher überfordert<br />
sind, medizinische Fachausdrücke und -inhalte<br />
zu übersetzen. „Schlechte“ Diagnosen werden<br />
aus Höflichkeit nur mangelhaft vermittelt.<br />
Manche Kliniken behelfen sich mit Listen von<br />
Sprachkenntnissen der Mitarbeitenden vom medizinischen<br />
Fachpersonal bis zur Reinigungskraft,<br />
die im Bedarfsfall zum Übersetzen herangezogen<br />
werden. Es hängt vom Zufall ab, ob die Personen<br />
in der Lage sind, die jeweiligen Inhalte fachgerecht<br />
zu vermitteln. Der Einsatz professioneller<br />
Dolmetscher scheitert oft aus Kostengründen,<br />
zudem erfüllen nur wenige von ihnen die besonderen<br />
Anforderungen im medizinischen Bereich<br />
oder verfügen über hinreichende soziokulturelle<br />
Vermittlungskompetenzen.<br />
Diese für alle Parteien unbefriedigende Situation<br />
führt zu erheblichen Mehrkosten, da aufgrund<br />
des Nichtverstehens Ärzte immer wieder<br />
gewechselt werden und die Behandlung wiederholt<br />
wird. Es kommt zu Mehrfachuntersuchungen,<br />
aber auch zu verspäteten und unangemessenen<br />
<strong>Therapie</strong>n. Im Ergebnis wird das Gesundheitswesen<br />
durch kosten- und zeitintensiven Mehraufwand<br />
zusätzlich belastet, ohne jedoch eine<br />
Verbesserung bei der Versorgung zu erzielen.<br />
Studie aus Schleswig-Holstein<br />
400 leitende Krankenhausärzt(e)/-innen, 400<br />
niedergelassene Ärzt(e)/-innen sowie circa 100<br />
Teilnehmer/-innen einer Fachtagung, die die Ärztekammer<br />
im Sommer 2001 durchgeführt hat,<br />
wurden gebeten, zu den Problemen bei der Versorgung<br />
ihrer ausländischen Patient(en)/-innen<br />
Abb. 1: Vier Dimensionen prägen den interkulturellen Interaktionsverlauf<br />
Machtasymmetrien Kulturdifferenzen<br />
Kollektiverfahrungen Fremdbilder<br />
Situationsdefinition<br />
Erwartungen und Deutungen<br />
Interaktionsverlauf