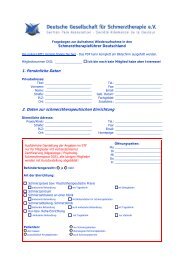Schmerztherapie 1/2010 - Schmerz Therapie Deutsche Gesellschaft ...
Schmerztherapie 1/2010 - Schmerz Therapie Deutsche Gesellschaft ...
Schmerztherapie 1/2010 - Schmerz Therapie Deutsche Gesellschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Spezialisierte ambulante Palliativ-<br />
versorgung ergänzt den Hospizdienst<br />
Die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) ist die hoch qualifizierte Ergänzung zum ehrenamtlich<br />
getragenen Hospizdienst. Das SAPV bedeutet aber keineswegs den Tod des Ehrenamtes, erläutert<br />
Thomas Sitte, DGS-Leiter und Palliativmediziner aus Fulda.<br />
Auf Grundlagen besinnen<br />
In der Jesuitenzeitschrift „Stimmen der<br />
Zeit“ 6/2009 schreibt Prof. Lob-Hüdepohl<br />
im Artikel „Bedrohtes Sterben“ von<br />
der „maximaltherapeutischen Versorgung<br />
einer Höchstleistungsapparatemedizin,<br />
die den Körper des Sterbenden<br />
zum bloßen Reaktor technischer Artefakte<br />
degradiert“. Mit der SAPV haben wir<br />
die Chance, uns wieder auf die Grundlagen<br />
medizinischer Arbeit als Leib- und<br />
Seelsorger zu besinnen. Ich wünsche uns<br />
allen, dass wir nicht die Freude an der<br />
menschlichsten und vielleicht auch ärztlichsten<br />
aller Arbeiten verlieren, sondern<br />
dass es gelingt, die Palliativversorgung –<br />
sei es ambulant oder stationär, allgemein<br />
oder spezialisiert – als einen Beitrag<br />
zur „ars diminuendi, also Kunst der<br />
allmählichen Zurücknahme aus dem<br />
aktiven Leben“ (gleiche Quelle) für die<br />
Patienten zu praktizieren.<br />
Ü ber<br />
Jahrhunderte hinweg war es ärztliches<br />
Denken, sich von Patient und Angehörigen<br />
zurückzuziehen, wenn der Arzt glaubte,<br />
dass Heilung nicht mehr möglich, der Tod nahe<br />
sein könnte. Das heißt, die „Professionellen“<br />
überließen die Patienten – auch mit allen ihren<br />
körperlichen Beschwerden – der Nächstenliebe<br />
von Klöstern, Hospizen, Sterbehäusern.<br />
Diese Laienbewegung war entfernt vergleichbar<br />
mit der ehrenamtlichen Hospizbewegung<br />
von heute. Ein bekanntes Beispiel eines solchen<br />
tätigen „bürgerschaftlichen“ Engagements<br />
war zum Beispiel die später heilig gesprochene<br />
Elisabeth von Thüringen (*1207, † 1231), die in<br />
Erfurt und später in Marburg Ausgegrenzte und<br />
Schwerstkranke versorgte.<br />
Das änderte sich eingangs des 19. Jahrhunderts.<br />
Hufeland veröffentlichte damals<br />
seine breite Abhandlung über „Die Verhältnisse<br />
des Arztes“ 1806 im „Neuen Journal der<br />
Practischen Arzneikunde und Wundarzneiwis-<br />
SCHMERZTHERAPIE 1/<strong>2010</strong> (26. Jg.)<br />
© Bildarchiv Urban & Vogel<br />
senschaft“: „Selbst im Tode soll der Arzt den<br />
Kranken nicht verlassen, noch da kann er sein<br />
großer Wohlthäter werden, und, wenn er ihn<br />
nicht retten kann, wenigstens sein Sterben erleichtern.“<br />
Ein lesenswertes Plädoyer für eine<br />
Medizin der Menschlichkeit, jenseits profitorientierter<br />
Technisierung, so könnte man heute<br />
sagen.<br />
Palliativmedizin<br />
Thomas Sitte,<br />
Fulda<br />
Ehrenamtliches Hospiz<br />
In den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts<br />
entstand neben dieser kleinen Zahl von Ärzten<br />
eine breiter werdende Bewegung mit engagierten<br />
Laien im Hospizdienst. Über Jahrzehnte<br />
haben sich Hausärzte und auch schmerztherapeutisch<br />
tätige Ärzte mehr neben als mit den<br />
ambulanten Hospizdiensten um die Versorgung<br />
Integrierung der SAPV in die Hospizarbeit<br />
Schritt 1: Informelles Gespräch der verschiedenen Leistungserbringer zum Kennenlernen und<br />
zum Austausch von Wünschen, Zielen usw.<br />
Schritt 2: Verbindliche Qualitätszirkel: Interdisziplinär angelegt sind sie die Grundlage der<br />
beginnenden Teamarbeit. Dort werden Haltungen besprochen, Sachfragen diskutiert, Patienten<br />
vorgestellt.<br />
Schritt 3: Informelle Kooperation am Patienten: In kleiner Anzahl können Patienten auch<br />
ohne (SAPV-)Verträge und Honorar auf hohem Niveau palliativ begleitet werden. Beide Seiten<br />
haben ohnehin Patienten in Betreuung. Wenn man sich kennt und schätzt, wird man sich<br />
auch einbinden.<br />
Schritt 4: Verbindliche, langfristige Kooperation und SAPV-Verträge: Wenn Leistungserbringer<br />
SAPV-Verträge abgeschlossen haben, müssen sie Hospizdienste verbindlich in die Versorgung<br />
integrieren. Allen Beteiligten erleichtert es die Arbeit, oft wird sie überhaupt erst dadurch<br />
stabil möglich.