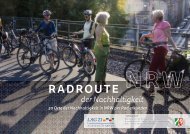Besser verkehren
16041214-VZ-09-96dpi
16041214-VZ-09-96dpi
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
könnte sich ähnlich wie die österreichische ASFINAG<br />
eines ausgeweiteten Einsatzes von ÖPP enthalten. Die<br />
Bundesregierung hat den ganzen Prozess mit dem Ziel<br />
angestoßen, privates Kapital einzubinden. Die bundeseigenen<br />
Gesellschaften, die den Prozess begleiten und<br />
institutionell umsetzen sollen sind vor allem die VIFG,<br />
die DEGES und die ÖPP Deutschland AG. Aller drei<br />
Gesellschaften sind extrem ÖPP-bejahend, ja teilweise<br />
wachsen ihnen Bedeutung und Aufgaben zu, wenn sich<br />
der Einsatz von ÖPP ausweitet.<br />
Keine Bundesfernstraßengesellschaft – aber<br />
»Umsetzungsstrategien«, die Vergleichbares<br />
bewirken<br />
Die Länder stellen sich in ihrer Schlussbetrachtung<br />
im Prozess in zentralen Fragen gegen die Pläne des<br />
Bundes:<br />
»Die Länder stellen die politische Frage, ob die Reformziele<br />
des Bundes überhaupt zentral erreichbar sind,<br />
wenn man sich ausschließlich auf eine organisatorische<br />
Konzentration der Prozesse fokussiert. Dies ist – auch<br />
angesichts anzunehmender umfänglicher Transaktionskosten<br />
und einer langen zeitlichen Umsetzungsphase<br />
– zweifelhaft. Ein Zeitfenster von deutlich mehr als einer<br />
Dekade ist im Falle der Gründung einer eigenen Bundesgesellschaft<br />
(inklusive Grundgesetzänderung und<br />
Integration) anzunehmen. Dagegen sind die im vorliegenden<br />
Bericht beschriebenen Umsetzungsstrategien<br />
ohne Friktionen in einem Zeitraum von ca. zwei Jahren<br />
durchführbar.« (Bodewig-Abschlussbericht 2016)<br />
Der angedeutete Konflikt bezieht sich allerdings nicht<br />
auf die Einbindung privaten Kapitals. Der ursprüngliche<br />
Vorschlag der Fratzscher-Kommission, privatem Kapital<br />
(zentralisierten und strukturierten) Zugang zum Bau,<br />
Unterhalt und Betrieb öffentlichen Infrastrukturen zu<br />
verschaffen, wird erfüllt. Die Fratzscher-Kommission<br />
hatte gefordert:<br />
»[Es] müsste ein Mechanismus gefunden werden, um die<br />
[…] Risiken mindestens teilweise auf private Investoren<br />
zu übertragen. Dafür kämen […] in Frage: Koinvestitionen<br />
auf Projektebene mit Infrastruktur- fonds oder anderen<br />
institutionellen Investoren, die ihrerseits Kapitalsammelstellen<br />
sind und auf diese Weise Risiko gebündelt<br />
weitergeben.«( Fratzscher-Kommission 2015)<br />
Das Modell deckt sich mit den Forderungen von Bauindustrie<br />
und Versicherungswirtschaft:<br />
»Eine solche Gesellschaft böte […] auf Projektebene<br />
viele Möglichkeiten, privates Kapital zu beteiligen.<br />
›Öffentlich-private Partnerschaften haben sich bewährt.<br />
Alle bisherigen Projekte waren im Kosten- und Zeitrahmen,<br />
Mehrkosten gab es nicht‹, betont Knipper. Investoren<br />
könnten mit der Übernahme von Projektrisiken<br />
höhere Renditen erzielen als etwa mit Bundesanleihen.<br />
Im Gegenzug werde der Staat von Risiken entlastet. ›Bei<br />
ÖPP gilt, Rendite gegen die Übernahme von Risiken.<br />
Das ist ein fairer Deal‹, so Knipper« (Hauptverband der<br />
Deutschen Bauindustrie 2015)<br />
Eine »Kapitalsammelstelle« oder vergleichbare zentrale<br />
Einrichtung kann der Bund ohne explizite Zustimmung<br />
der Länder einrichten, es sind auch keine Grundgesetzänderungen<br />
mehr erforderlich. Der Vorteil für die<br />
Länder dabei ist: Sie können damit werben, dass die<br />
Auftragsverwaltungen erhalten bleiben und sogar ausgebaut<br />
werden. Die langfristigen Folgen des Einbezugs<br />
von privatem Kapital bleiben ausgeblendet.<br />
Die Ergebnisse der Bodewig-II-Kommission könnten<br />
allerdings ein Pyrrhussieg für die Länder werden. Ein<br />
wichtiges Ergebnis sind die Vorschläge, wie Prozesse so<br />
optimiert werden könnten, dass Länder für schnelleres<br />
bauen belohnt werden. Schneller zu bauen heißt allerdings<br />
oft auch schlechter bauen und somit auf lange<br />
Sicht teurer bauen – dieses Geld wird den Ländern<br />
fehlen.<br />
Folgen von Einbezug von privatem Kapital ohne<br />
Bundesfernstraßengesellschaft<br />
Wenn die Länder sich jetzt als konfliktbereit feiern<br />
lassen (»Länder suchen den Konflikt mit Dobrindt«,<br />
Tagesspiegel vom 18.2.2016), verdecken sie, dass ihnen<br />
mit ihrer eigenen Position mittelfristig Nachteile entstehen<br />
könnten. Insbesondere droht die Aushöhlung der<br />
Auftragsverwaltungen:<br />
• Die Schaffung von Doppelstrukturen beim Bund<br />
könnte die Auftragsverwaltungen in den Ländern personell<br />
unter Druck setzten und mittelfristig dort den<br />
Abbau der betreffenden Stellen bewirken.<br />
• Der Bund wird für seine »Kapitalsammelstelle« zudem<br />
die hochqualifizierten Fachkräfte anwerben – vor<br />
allem von den Ländern, denen sie dann fehlen. Schon<br />
heute zahlt z.B. die DEGES deutlich über den TVÖD-<br />
Tarifen. In der Folge bekommen wenige Fachkräfte<br />
mehr Geld, die Struktur der Fachkompetenz in den<br />
Ländern wird jedoch geschwächt, womit das Wissen<br />
der verbleibenden Fachkräfte entwertet und mittelfristig<br />
vom Stellenabbau bedroht wird.<br />
• Gesteuert über die Mittelvergabe und zentral vorgegebene<br />
technische Systeme erfolgt sukzessive eine<br />
Verlagerung von Kompetenzen von den Ländern in<br />
Richtung Bund. Dieser Prozess erodiert die Auftragsverwaltungen.<br />
Einmal angelegt, kann er später<br />
einfacher grundgesetzlich oder gesetzlich verstärkt<br />
werden.<br />
• Am gravierendsten kommt aber die Auftragsverwaltungen<br />
die erhebliche Verteuerung der Finanzierung<br />
zu stehen, wodurch dem Sektor insgesamt deutlich<br />
weniger produktiv einsetzbares Geld zur Verfügung<br />
steht. Der Anteil der Zinszahlungen am Gesamtvolumen<br />
steigt, in der Folge muss der Anteil der Mittel für<br />
Personal- und Sachkosten sinken. Folge ist die der<br />
Abbau von Stellen infolge des Rückgangs an verfügbaren<br />
Mitteln für Personalkosten.<br />
12