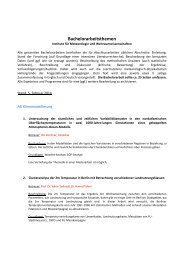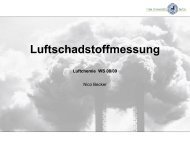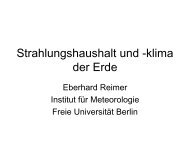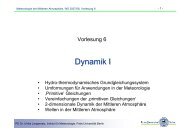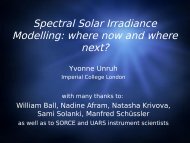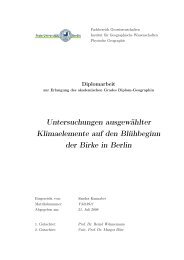ME TA R - Freie Universität Berlin
ME TA R - Freie Universität Berlin
ME TA R - Freie Universität Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>ME</strong><strong>TA</strong>R 44c/2004 Sportarenen als Kunstwelten im städtischen Restrukturierungsprozess 13<br />
Verflechtung im ökonomischen Sinne zu profitieren. Als Beispiele lassen sich Projekte in<br />
Baltimore, Cleveland und Denver anführen. (vgl. VLASSENROOD 2000). 2 Ein zentraler<br />
Aspekt bei den innerstädtischen Projekten, auf den noch näher eingegangen wird, heißt<br />
"Synergie". Kritiker merken jedoch an, dass die Schaffung von Synergien nur innerhalb<br />
eines bestimmten Radius´ geschieht, meist innerhalb eines Stadtquartiers. Die geschaffenen<br />
Großstrukturen, von denen Sportarenen nur ein Teil sind, haben die Eigenschaft, ein<br />
Gebiet um sich herum einzuschließen und gegen die weitere Umgebung abzugrenzen<br />
(vgl. u.a. BACH 2000: 108; HENNINGS 2000c: 41; HATZFELD 1997: 302; ILS 1994: 32).<br />
Auch in Europa lässt sich diese Trendwende beobachten. Die Stadionbauten in Barcelona,<br />
Amsterdam und Paris zeigen, dass seit den 1980er Jahren "die von einem<br />
Asphaltmeer aus Parkplätzen umschlossenen, autonom an der Peripherie errichteten<br />
Stadien zunehmend von Freizeitkomplexen abgelöst [wurden], deren Errichtung zugleich<br />
als kommunale Revitalisierungsprojekte eingesetzt wurden" (BECKER 2001b: 131).<br />
Die US-amerikanische Erfahrung zeigt weiterhin, dass die großen Unterhaltungskonzerne,<br />
wie etwa Disney oder Sony, bei der Revitalisierung eine besondere Rolle haben. Gerade<br />
die Produkte dieser Konzerne, ihre Verknüpfung der Sparten Film, Fernsehen, Musik,<br />
Themenparks und Einzelhandel sowie die Kombination von prominenten Charakteren und<br />
Figuren mit bestimmten Markennamen bewähren sich in der Wiederentdeckung der USamerikanischen<br />
Städte als wirtschaftliche Standorte (vgl. BLU<strong>ME</strong> 1998: 7). Prominentestes<br />
Beispiel ist die Aufwertung des Times Square durch das Engagement des Disney-<br />
Konzerns (siehe auch ROOST 2000a). Die Kommunen selbst begrüßen die Projekte der<br />
Unterhaltungsökonomie, da sie sie als Möglichkeit der städtischen Revitalisierung von<br />
zentralen Bereichen sehen (vgl. HANNIGAN 2002: 183).<br />
Die Realisierung großer Freizeiteinrichtungen wie Sportarenen löst positive und negative<br />
Erwartungen aus. Befürworter von Freizeitgroßanlagen verbinden mit der Realisierung<br />
solcher Projekte die Hoffnungen auf positive Arbeitsmarkteffekte, auf eine Impulswirkung<br />
für die städtische Wirtschaft, Kaufkraftzuflüsse und eine Erhöhung des Steueraufkommen<br />
sowie eine Verbesserung des Image einer Stadt (u.a. BÉLANGER 2000: 382; BACH<br />
2000: 19; RONNEBERGER 2001: 32; TURNER/ROSENTRAUB 2002; SCHE<strong>ME</strong>L 2002;<br />
DEGI 2003: 46). Außerdem erhöhen sie die Freizeitattraktivität und das touristische<br />
Angebot und stärken die weichen Standortfaktoren (vgl. BACH 2000: 19; DEGI 2003: 46;<br />
BLU<strong>ME</strong> 1998: 7; JUDD 1999; RÖCK 1996). Solche groß angelegten Projekte werden als<br />
"städtisches Eigendoping" (HATZFELD 2000: 63) verstanden, die die Aufmerksamkeit<br />
und Medienpräsenz erhöhen sowie eine verbesserte Position im nationalen und internationalen<br />
Städtewettbewerb verschaffen. Sportarenen gelten im Städtewettbewerb als<br />
Symbole urbaner Bedeutsamkeit und des Erfolgs (vgl. BECKER 2001b: 131; McCARTHY<br />
2002: 106). Kommerzielle Freizeitgroßanlagen wie Sportarenen, Urban Entertainment<br />
Center oder Musicals können demnach als Katalysatoren, als "Kristallisationskerne" des<br />
Strukturwandels fungieren (vgl. HATZFELD 2000: 63).<br />
2 In den USA besteht hinsichtlich der in den Arenen spielenden Profimannschaften eine Besonderheit: Die vier großen<br />
Profiligen (American Football, Baseball, Basketball und Eishockey) sind als Unternehmen organisiert. Spielberechtigt<br />
für die Profiligen sind nur Mannschaften, die von den Ligen entsprechende Lizenzen erhalten haben. Dieses<br />
Franchisesystem hat eine z.T. erbitterte Konkurrenz der Städte um die rund 100 Profimannschaften zur Folge, gelten<br />
sie doch als besondere Prestigeobjekte (vgl. BACH 2000; TURNER/ROSENTRAUB 2002; JUDD 1999;<br />
SCHLOSSBERG 1996).<br />
————————————————— 13