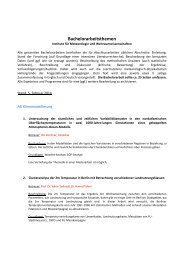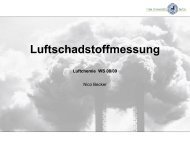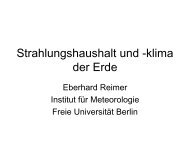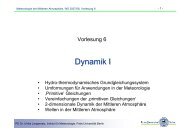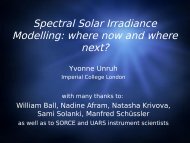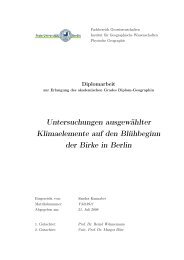ME TA R - Freie Universität Berlin
ME TA R - Freie Universität Berlin
ME TA R - Freie Universität Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>ME</strong><strong>TA</strong>R 44c/2004 Sportarenen als Kunstwelten im städtischen Restrukturierungsprozess 15<br />
Einrichtungen profitieren ("a rising tide does not lift all ships")(HANNIGAN 1998: 143;<br />
2002: 191). Sportarenen können sich zwar als Attraktion einer Stadt etablieren. Insgesamt<br />
aber dürften sie als weiche Standortfaktoren nur eine untergeordnete Rolle bei der<br />
Standortentscheidung von Unternehmen einnehmen. Hinsichtlich des Image einer Stadt<br />
entwickeln Sportarenen nur eine mittelbare Wirkung, da sie die infrastrukturelle Voraussetzung<br />
für den Erfolg von Sportvereinen oder erfolgreichen Veranstaltungen sind (vgl.<br />
BACH 2000: 130 ff.; AUSTRIAN/ROSENTRAUB 2002; SCHLOSSBERG 1996). Denn<br />
eher als Sportarenen entfalten Sportvereine eine identitätsstiftende und das Image<br />
fördernde Funktion: "Above all else though, the one thing that spurs development and<br />
economic trickledown is a winning team, which puts fans in the seats and brings their<br />
money to the neighborhood. No amount of steel and concrete can guarantee that"<br />
(SCHLOSSBERG 1996: 175).<br />
2.1 SPOR<strong>TA</strong>RENA: FREIZEITIMMOBILIE UND KUNSTWELT<br />
Raumplanerisch sind Sportarenen als Freizeitgroßanlagen vor allem wegen ihres Einzugsgebiets,<br />
Flächenanspruchs, Verkehrsaufkommens und ihrer Nutzungsmischung<br />
relevant. In den letzten Jahren erlangten sie auch Bedeutung im Zuge der Revitalisierung<br />
von Brachflächen, besonders in Innenstadtnähe. Für Sportarenen kann man auf Grund<br />
der Komplementärnutzungen, den so genannten Mantelnutzungen, wie etwa Einzelhandel,<br />
Gastronomie und Hotellerie, von etwa 3,5 bis 15 ha Gesamtfläche ausgehen. Dabei<br />
fallen Stellplätze für Pkw besonders ins Gewicht. (vgl. FOCKENBERG et al. 1998: 12;<br />
HATZFELD 1997: 292) Freizeitgroßanlagen bedingen meist auch ein hohes Verkehrsaufkommen,<br />
so dass es vor und nach Veranstaltungen teilweise zu erheblichen An- und<br />
Abfahrtsbewegungen kommt. Bei Sportarenen geht man von einer Spitzenbelastung von<br />
bis zu 15.000 Pkw je Veranstaltung aus (vgl. FOCKENBERG et al. 1998: 23). Insgesamt<br />
rechnet man je nach Kapazität der jeweiligen Arena mit mindestens 500.000 Besuchern<br />
jährlich. Bei einer Zuschauerkapazität von bis zu 20.000 und etwa 200 Veranstaltungen<br />
im Jahr können dies aber auch mehr als 2 Mio. Besucher sein.<br />
Für den Makrostandort der Sportarenen erweisen sich demnach folgende Standortfaktoren<br />
als ausschlaggebend:<br />
• ein hohes Bevölkerungspotenzial im Umkreis von etwa 50 km und damit ein hohes<br />
Nachfragepotenzial,<br />
• die Konkurrenzsituation zu anderen Veranstaltungsstätten sowie<br />
• eine überregionale, leistungsfähige Verkehrsanbindung (vgl. FALK 2004: 329;<br />
VORNHOLZ 2000: 13 f.; BACH 2000: 36; NEUMANN 1998: 85; ILS 1994: 30).<br />
Entscheidend für den Mikrostandort sind<br />
• ein ausreichendes Flächenpotenzial für die Erstansiedlung und spätere Erweiterungen<br />
sowie für Stellplätze,<br />
• eine leistungsfähige Verkehrsanbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und<br />
das Individualverkehrsnetz,<br />
• die Eigenschaften der Liegenschaft (Zuschnitt, Kosten des Erwerbs, Verfügbarkeit,<br />
Bebaubarkeit, Nutzungseinschränkungen, Bodenbeschaffenheit usw.)<br />
sowie<br />
————————————————— 15