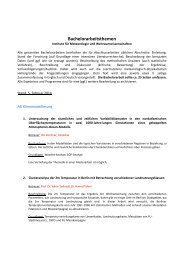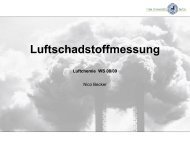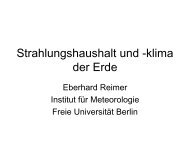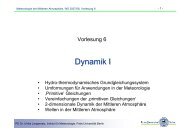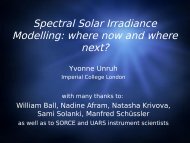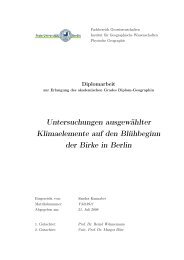ME TA R - Freie Universität Berlin
ME TA R - Freie Universität Berlin
ME TA R - Freie Universität Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>ME</strong><strong>TA</strong>R 44c/2004 Sportarenen als Kunstwelten im städtischen Restrukturierungsprozess 39<br />
Für global agierende Unternehmen bedeutet dies, möglichst auf vielen Märkten,<br />
insbesondere der Triade (USA, EU, Japan), präsent zu sein und gleichzeitig regionale und<br />
kulturelle Besonderheiten zu berücksichtigen. Zwei Beispiele aus dem Konsum- und<br />
Kulturbereich verdeutlichen dies: Handelsunternehmen nehmen auf die regionalen<br />
Besonderheiten bei der Zusammenstellung und Präsentation der Produktpalette Rücksicht.<br />
Ähnlich ist es im Kultur- und Medienbereich: MTV sowie CNN haben eine regional<br />
und national unterschiedliche Zusammenstellung des Programms und Formen der<br />
Präsentation desselben. Hinsichtlich der Standortwahl spielt auch die Branche eine<br />
wichtige Rolle: Während sich global agierende Unternehmen aus dem Konsum- und<br />
Kulturbereich auf die Märkte der Triade konzentrieren, wählen Unternehmen des produzierenden<br />
Sektors weltweit Standorte. (vgl. REHFELD 1999: 233 f.)<br />
Neben den strategischen Fokussen Markterschließung, Effizienzsteigerung und Produktionskosten<br />
verfolgen Unternehmen die Strategie, sich Zugang zu lokalisierten Ressourcen<br />
und Innovationen zu verschaffen. Ziel dieser innovationsorientierten Strategie ist die<br />
Sicherung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Beispielhaft<br />
lässt sich die Ansiedlung ausländischer Unternehmen im Silicon Valley anführen. (vgl.<br />
REHFELD 1999: 235; BATHELT/GLÜCKLER 2002: 274)<br />
Daneben gibt es die Strategie, spezifische Standort- und Wettbewerbsvorteile zu sichern<br />
und vor der Konkurrenz zu verteidigen. Erklärtes Ziel ist die strategische Wettbewerbssicherung<br />
gegenüber Konkurrenten. Dabei treten Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung<br />
oder Erschließung neuer Ressourcen in den Hintergrund. (vgl. BATHELT/GLÜCKLER<br />
2002: 275)<br />
Schließlich gibt es noch eine weitere Strategie: die dauerhafte Kundennähe. Unternehmen<br />
mit dieser Strategie verfügen über Produkte, die auf regionale Märkte ausgerichtet<br />
sind und eine ausgeprägte regionale Einbindung und Kundenorientierung aufweisen (vgl.<br />
REHFELD 1999: 239). Unternehmen mit solchen Produkten müssen "dicht" am Kunden<br />
und seinen Problemen sein, da die Eigenheiten des Produktes keine hohe Standardisierung<br />
ermöglichen. REHFELD (1999) führt das Beispiel eines globalen<br />
Entsorgungsunternehmen auf, das nur auf die jeweiligen lokalen Besonderheiten abgestimmte<br />
Produkte, hier Abwassersysteme, anbieten kann (ebd.). Weitere Beispiele finden<br />
sich im Dienstleistungssektor, so etwa global agierende Unternehmensberatungen.<br />
In der Realität sind diese Idealformen selten anzutreffen. Die erwähnten Strategien<br />
weisen sektorale, funktionale und räumliche Unterschiede auf und werden oft miteinander<br />
kombiniert. Es stellt sich nun die Frage, welche Strategien Unternehmen der Freizeit- und<br />
Unterhaltungsbranche verfolgen? Dieser Frage widmet sich das folgende Kapitel.<br />
3.2 STRATEGIEN GLOBALER KONZERNE DER FREIZEIT- UND UNTERHALTUNGS-<br />
INDUSTRIE<br />
————————————————— 39