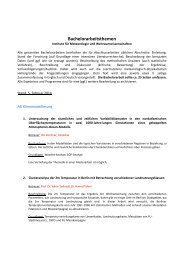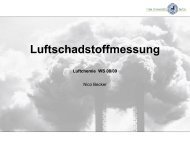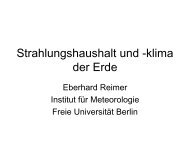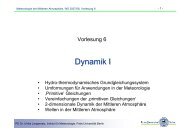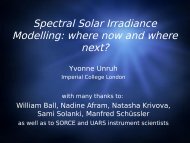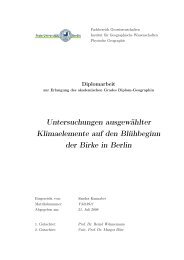ME TA R - Freie Universität Berlin
ME TA R - Freie Universität Berlin
ME TA R - Freie Universität Berlin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>ME</strong><strong>TA</strong>R 44c/2004 Sportarenen als Kunstwelten im städtischen Restrukturierungsprozess 43<br />
transnationalen Immobilienunternehmen finanziert und errichtet" (HÄUßERMANN/ROOST<br />
2000: 85). Vielen Städten erscheint es als notwendig, im Wettbewerb mit anderen Städten<br />
"die Produktion und Vermarktung eines global-abstrakten (d.h. nicht ortstypischen,<br />
traditionell-lokalen) Raumes zu fördern" (STRATMANN 1999: 130). Dies macht sich in der<br />
relativen Homogenität und Standardisierung der Bauten und Stadtlandschaft bemerkbar<br />
(ebd.; BERKING 2001: 52; HÄUßERMANN/ROOST 2000: 85). Meist stünden hinter den<br />
entstehenden Großprojekten und den großen privaten Investitionen internationale Kapital-<br />
und Immobiliengesellschaften, die den Raum nur noch nach seiner Verwertbarkeit und<br />
unter der Perspektive der optimalen Rendite erfassten. Gerade bei Freizeitimmobilien, wie<br />
etwa Urban Entertainment Center, wird angenommen, dass sie relativ standortunabhängig<br />
realisiert werden, wenn die verkehrliche Zentralität, die Größe des damit<br />
erschließbaren Einzugsbereichs und die Kaufkraft stimmten (vgl. RO<strong>ME</strong>Iß-STRACKE<br />
2000: 80; HÄUßERMANN/ROOST 2000: 85; HEL<strong>ME</strong>R-DENZEL 2002: 242, 264;<br />
HENNINGS/MÜLLER 1999: 110). Es entschieden dann auch das Tempo von Genehmigungsverfahren<br />
und die Höhe der öffentlichen Infrastrukturleistungen über die Investition<br />
in diese Verwertungsräume. Für das globale Kapital mit seiner relativen Standortunabhängigkeit<br />
seien "lokale Eigenheiten des Raumes nur wichtig, wenn sie sich<br />
gewinnbringend als 'inszenierte Originalität' einbauen lassen: Schwarzwaldmädel,<br />
Fachwerk, Brezeln und Bier" (RO<strong>ME</strong>Iß-STRACKE 2000: 80, Hervorhebung im Original).<br />
Demnach seien zahlreiche Freizeitimmobilien "Filialen in einem weltweit standardisierten<br />
Konzept, die sich selbst genügen" (HÄUßERMANN/ROOST 2000: 85). Ähnlich argumentieren<br />
HENNINGS und MÜLLER (1999), die die heutigen Kunstwelten mit ihren globalen<br />
Inhalten und (i.d.R.) nicht regionalspezifischen Architektur als Formen eines weltweit<br />
ähnlichen Prozesses des Vergnügens sehen.<br />
Andererseits vernachlässigt die Überbetonung des Globalen, verstanden als freier,<br />
ungebundener und entterritorialisierter Raum, die Bedeutung des Lokalen, obwohl das<br />
Globale stets auf unterschiedlich geprägte lokale Kontexte trifft. Dabei werden die<br />
Globalisierungstendenzen in vielfältiger Weise durch ein komplexes Wirkungsgefüge<br />
politischer und sozialer Regulationsformen und gesellschaftlicher Arrangements, durch<br />
kulturelle Institutionen und soziale Institutionen gebrochen, gedämpft und gefiltert, so<br />
dass keine Stadt unmittelbar den Kräften der Globalisierung ausgesetzt ist (vgl. LÄPPLE<br />
1996: 131; HÄUßERMANN/ROOST 2000: 89; STRATMANN 1999: 126). Beispielhaft<br />
kann hier RONNEBERGER (2000) angeführt werden. Dieser kommt im Zusammenhang<br />
mit der in Frankfurt am Main geplanten "Messestadt" bzw. dem "Europaviertel", mit<br />
dessen Realisierung sich die Befürworter nationales und internationales Ansehen erhoffen,<br />
zu folgender Einschätzung. Die bauliche Umwelt sowie der lokale soziale Raum<br />
unterliegen einer gewissen Trägheit, so dass sie sich den Verwertungserfordernissen<br />
nicht beliebig anpassen lassen: "Die metropolitanen Zentren mögen zwar im hohen Maße<br />
von dem globalisierten Kapital geprägt sein, dennoch müssen die Aktivitäten von Banken<br />
und internationalen Konzernen auch mit den jeweiligen lokalen Bedingungen vereinbar<br />
sein" (RONNEBERGER 2000: 57). BECK (1997) merkt dazu an, dass niemand global<br />
produzieren könne und gerade global produzierende und ihre Produkte vermarktenden<br />
Unternehmen lokale Bindungen haben müssten "[...] – und zwar, indem erstens ihre<br />
Produktion auf lokalen Beinen entsteht und zweitens auch global vermarktbare Symbole<br />
aus den Rohstoffen lokaler Kulturen, die deswegen lebendig, eruptiv und disparat bleiben<br />
und gedeihen, 'abgeschöpft' werden müssen" (BECK 1997: 86). Globalisierung erweist<br />
sich somit als ein gestaltbarer Prozess. Gerade für die Freizeit- und Unterhaltungsindu-<br />
————————————————— 43