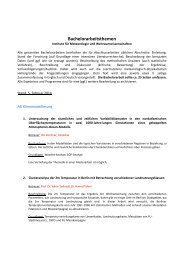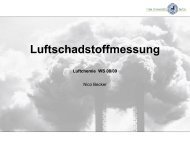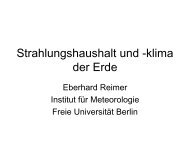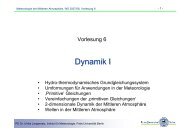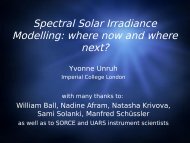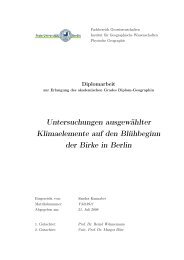ME TA R - Freie Universität Berlin
ME TA R - Freie Universität Berlin
ME TA R - Freie Universität Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>ME</strong><strong>TA</strong>R 44c/2004 Sportarenen als Kunstwelten im städtischen Restrukturierungsprozess 23<br />
Nachfrage. Zum anderen konkurrieren die Anbieter, wie oben dargelegt, um eine nicht<br />
erweiterbare Zeitspanne. Ferner lastet auf den Angeboten ein "Innovationsdruck". Viele<br />
Freizeitangebote nutzen sich schnell ab und haben deshalb kurze Lebenszyklen. Dies<br />
macht eine zielgruppen- und zeitgerechte Fortentwicklung der Angebote notwendig. (vgl.<br />
AGRICOLA 2001: 249 f.; 2002: 182)<br />
Besonderheiten weisen aber auch die Freizeitimmobilien auf. Im Gegensatz zu klassischen<br />
Immobilien, etwa Büro- und Gewerbeimmobilien, wird die (Miet-) Preisbildung nicht<br />
durch die Lage und den Standort bestimmt und ist auch nicht so stark an den lokalen<br />
Immobilienmarkt gekoppelt. Vielmehr bleibt sie vom lokalen Immobilienmarkt abgekoppelt<br />
und wird überregional vom spezifischen Angebot und der Nachfrage gesteuert (vgl.<br />
BEYERLE 2003; DZIOMBA/BEYERLE 2003: 112).<br />
Während klassische Immobilien langlebig sind, unterliegen Freizeitimmobilien einer<br />
starken Trend- und Modeabhängigkeit (MÖSEL 2002: 89). Um die Attraktivität realisierter<br />
Freizeitimmobilien aufrechtzuerhalten, bedarf es (z.T. hoher) Reinvestitionen sowie<br />
regelmäßiger Konzepterneuerungen bzw. -änderungen (vgl. BEYERLE 2003; HATZFELD<br />
2000: 67).<br />
Weiterhin können Freizeitimmobilien nur bedingt bzw. mit erheblichem Aufwand einer<br />
Zweitverwertung zugeführt werden – anders als bei Gewerbeimmobilien oder Einzelhandelsflächen<br />
–, da die Anlagen meist exakt auf das jeweilige Freizeitkonzept zugeschnitten<br />
sind (vgl. DZIOMBA/BEYERLE 2003: 113; VORNHOLZ 2001: 176). Auch bei Sportarenen<br />
stößt man auf das Problem, dass sie sich auf Grund der baulichen Gestaltung und der<br />
Dimensionierung kaum alternativ nutzen lassen (vgl. ILS 1994: 32).<br />
Auf Grund der aufgezählten Risiken werden Freizeitimmobilien auch als Risikoimmobilien<br />
bezeichnet, mit denen sich aber in den letzten Jahren hohe Renditen realisieren ließen<br />
(vgl. FRANCK/WENZEL 2001: 187). Der wirtschaftliche Erfolg von Freizeitimmobilien<br />
hängt wesentlich von den Managementqualitäten des Betreibers ab (vgl.<br />
FRANCK/WENZEL 2001: 188; AGRICOLA 2002: 165; MÜLLER/HENNINGS 1998: 23).<br />
Die Belegungsdichte und die Vermarktungsfähigkeit einer Sportarena etwa werden<br />
wesentlich vom Management beeinflusst. Arenen gelten deshalb als so genannte Managementimmobilien:<br />
"Freizeitimmobilien sind folglich ohne Programmm und Betrieb 'nichts<br />
wert', d.h. nicht die Immobilie selber gibt den Investoren die Sicherheit, sondern die<br />
richtige Auswahl des Betreibers [bzw. des Managements]" (BACH 2000: 45, Hervorhebung<br />
im Original). Freizeitimmobilien gelten deshalb auch als "sensible" Immobilien, die in<br />
besonderem Maße qualifiziertes Management erfordern (vgl. FALK 2004: 330). Die<br />
wesentlichen Aufgabe sind der Aufbau eines positiven Image und eine fortwährende,<br />
gezielte Profilierungspolitik. Gefordert sind u.a. eine absolute Marktnähe und ein Gespür<br />
für neue Entwicklungen und Trends (ebd.). Für einige sind Freizeitimmobilien eher<br />
Unternehmen als Immobilien, da sie kompetent geführt werden müssen und der wirtschaftliche<br />
Erfolg stark von den Marketingkonzepten abhängt. Dies gilt insbesondere für<br />
Sportarenen (NEUMANN 1998: 74). 3<br />
3 Nach Meinung einiger Autoren ähneln Sportarenen und Stadien sogar Maschinen – auf Grund der Notwendigkeit, die<br />
Besucherströme leiten und lenken zu müssen. Auch das Innenleben von Sportarenen und Stadien mit austauschbarem<br />
Spielfeld, ausfahrbarem Dach, mobilen Bühnen und Tribünen lässt den Vergleich mit Maschinen als treffend<br />
erscheinen. (vgl. BECKER 2001b: 129-130)<br />
————————————————— 23