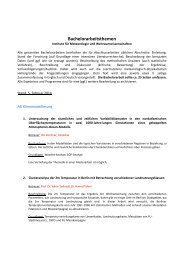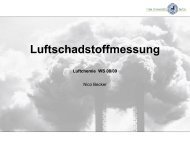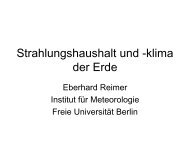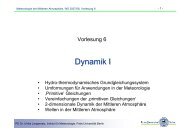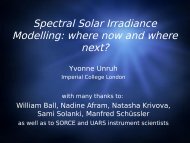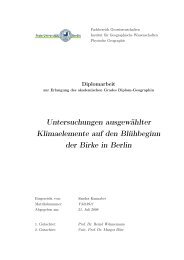ME TA R - Freie Universität Berlin
ME TA R - Freie Universität Berlin
ME TA R - Freie Universität Berlin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>ME</strong><strong>TA</strong>R 44c/2004 Sportarenen als Kunstwelten im städtischen Restrukturierungsprozess 17<br />
Konsumeinrichtungen, die i.d.R. nur eine Aktivitätsoption bieten (vgl. QUACK 2001: 30).<br />
Die Multifunktionalität der neuen Freizeitimmobilien bedingt die so genannte Multioptionalität.<br />
Die Freizeitimmobilien werden zu "komplexe[n], multifunktionale[n] Einrichtungen mit<br />
vielfältigen Einzelangeboten, aus denen sich die Konsumenten – wie bei einem Büfett –<br />
eine individuelle Mischung nach ihrem aktuellen Bedürfnis selbst zusammenstellen<br />
können (Prinzip der Multioptionalität)" (STEINECKE 2002: 2, Klammern im Original;<br />
ähnlich QUACK 2002: 110). Das spezifische Profil eines "Mixed Use Centers" ergibt sich<br />
aus der Schwerpunktsetzung in einem Angebotsbereich, etwa Einzelhandel, Unterhaltung,<br />
Freizeit und Sport, und der Verknüpfung mit anderen Bereichen. "Wie in einem<br />
Baukastensystem werden dabei zumeist standardisierte Angebote zu einem neuen,<br />
komplexen Gesamtangebot montiert, das häufig unter einem Dachthema oder in Form<br />
thematisierter 'Welten' auf dem Markt positioniert wird" (STEINECKE 2002: 2, Hervorhebung<br />
im Original).<br />
Was macht Sportarenen zu Kunstwelten? Um diese Frage beantworten zu können, muss<br />
noch einmal auf den Begriff Kunstwelt eingegangen werden. Kunstwelten sind räumliche<br />
Gebilde, die auf Simulation und künstlichen Inszenierungen basieren, als Gegenwelten<br />
zum Alltag konzipiert sind und auf den Kontrast zu ihrer Umwelt setzen. Sie sind den<br />
jeweils zeitgenössischen politischen Paradigmen, sozio-ökonomischen Verhältnissen und<br />
gesellschaftlichen Wertvorstellungen angepasst. Darüber hinaus weisen sie übergeordnete<br />
Leitbilder und Konstruktionsprinzipien auf: Kunstwelten basieren u.a. auf den<br />
Gedanken der perfekten Beherrschung der Natur, gelten als entworfene Traumwelten und<br />
Gegenwelten zum Alltag, erzählen auf Grund ihrer thematischen Ausrichtung bestimmte<br />
"Geschichten" und leben von den Mythen, die in ihnen inszeniert werden. Weiterhin<br />
greifen sie in ihrer Außendarstellung häufig auf Symbole zurück, wie etwa die Comic-<br />
Figuren bei Disneys Freizeitparks oder die Architektur von Gebäuden. Kunstwelten<br />
basieren darüber hinaus jeweils auf einem politischen, ästhetischen oder ökonomischen<br />
Kalkül, das in der planmäßigen Anlage der Einrichtungen zum Ausdruck kommt. Die dabei<br />
verfolgten Ziele können sehr unterschiedlicher Natur sein: die Demonstration von Macht –<br />
besonders augenfällig bei den Landschaftsgärten des 18. und 19. Jahrhunderts – , die<br />
Inszenierung der Natur oder die Schaffung eines angenehmen Umfeldes für Konsumaktivitäten.<br />
In jedem Fall geht es um den Versuch der Steuerung des Verhaltens und der<br />
Wahrnehmung der Besucher von Kunstwelten. Dazu bedarf es auch des Einsatzes<br />
innovativer und aufwendiger Technik. (vgl. STEINECKE 2002: f.)<br />
"Im Unterschied zu ihren Vorläufern ist die Wirkungsästhetik moderner Themenparks und<br />
Shoppingmalls [sowie anderer Freizeitimmobilien] [...] in eine kapitalistische Konsumkultur<br />
eingebettet, in der das 'Erlebnis' von einer Entertainment-Industrie als Ware angeboten<br />
und verkauft wird" (RONNEBERGER 2001a: 91, Hervorhebung im Original). Frühere<br />
Kunstwelten beschränkten sich auf die Abgrenzung zur Außenwelt durch die Architektur.<br />
Auch heute sind viele Kunstwelten sich selbst genügende, nach innen orientierte Welten,<br />
die in vielen Fällen keine Verbindung zur Umgebung haben (vgl. HÄUßERMANN/ROOST<br />
2000: 85; ähnlich HENNINGS 2000c: 40). Freizeitanlagen hätten nach HATZFELD (1997)<br />
häufig den Charakter eines Raumschiffs, "also einer in sich autarken Maschine, die sich<br />
nach ihrer Landung in einer potentiell feindlichen Umgebung behaupten muß"<br />
(HATZFELD 1997: 299; ähnlich STEINECKE 2002: 2). BREUER (1998: 218) bezeichnet<br />
die neuen Freizeitgroßanlagen und Kunstwelten wegen ihres im Gegensatz zu ihrem<br />
————————————————— 17