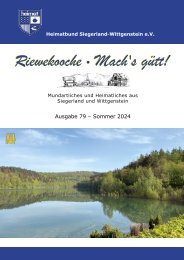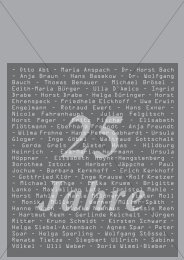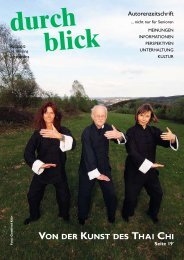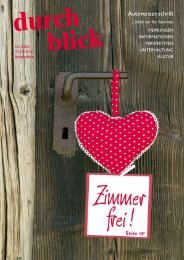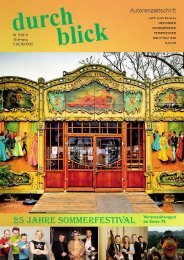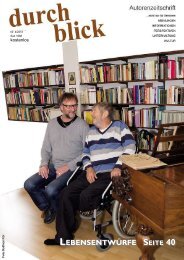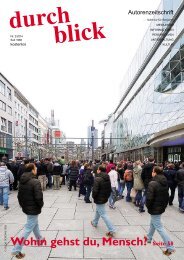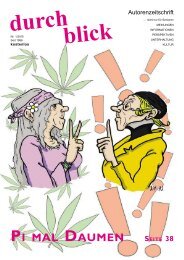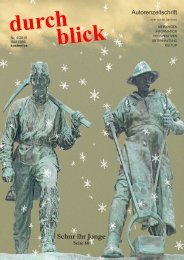2010-04
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gesellschaft<br />
Rechtssicherheit bei Behandlungsabruch<br />
RA Kringe zum BGH-Urteil zur Sterbehilfe<br />
§<br />
Schon in seiner letzten Ausgabe<br />
hat der durchblick auf das wegweisende<br />
Urteil des Bundesgerichtshofs<br />
(BGH ) vom 25.6.<strong>2010</strong><br />
zur Sterbehilfe hingewiesen. Der<br />
Wilnsdorfer Rechtsanwalt und<br />
Notar, Michael Kringe, Fachanwalt<br />
für Familienrecht, schreibt<br />
für den durchblick dazu:<br />
Erkrankung. Der Behandlungsabbruch muss notwendig<br />
auf die Verhinderung oder Rückgängigmachung einer medizinischen<br />
Maßnahme gerichtet sein. Erfasst werden von<br />
erlaubten Behandlungsabbrüchen daher das Unterlassen<br />
einer lebenserhaltenden medizinischen Maßnahme, der<br />
Abbruch einer begonnenen Behandlung und die Inkaufnahme<br />
eines vorzeitigen Todes, wenn er als Nebenfolge einer<br />
palliativmedizinischen Behandlung, wie etwa der Schmerzlinderung,<br />
eintritt.<br />
Das Gericht musste über die Strafbarkeit eines Anwalts<br />
urteilen, der einer Mandantin empfohlen hatte,<br />
den Schlauch der Magensonde durchzutrennen,<br />
mit welcher deren Mutter, die sich in einem nicht mehr<br />
rückgängig zu machenden Wachkoma befand, ernährt wurde.<br />
Die Vorinstanzen hatten den Rechtsanwalt wegen versuchten<br />
Totschlags verurteilt.<br />
In der Entscheidung, mit der der BGH diese Urteile<br />
aufgehoben und den Anwalt freigesprochen hat, ergriff er<br />
die Gelegenheit, um die Grenzen zwischen erlaubter und<br />
unerlaubter Sterbehilfe neu zu definieren.<br />
Das Gericht diskutiert die Problematik im Spannungsverhältnis<br />
zwischen dem Selbstbestimmungsrecht des<br />
Patienten und dem Gebot des Schutzes menschlichen Lebens.<br />
Es berücksichtigt außerdem das seit 2009 geltende<br />
sog. Patientenverfügungsgesetz. Dieses Gesetz ordnet<br />
eine am Patientenwillen orientierte Begrenzung der Behandlung<br />
bei zum Tode führenden Erkrankungen an. Der<br />
tatsächliche oder mutmaßliche Wille des Patienten ist unabhängig<br />
von Art und Stadium der Erkrankung Ausgangspunkt<br />
und Maß aller Behandlungsmaßnahmen.<br />
Der BGH stellt fest, dass die bisherige Unterscheidung<br />
zwischen bloßem Unterlassen, also passiver Sterbehilfe,<br />
die straffrei möglich ist, einerseits und aktivem Tun, also<br />
strafbarer aktiver Sterbehilfe, untauglich sei. Diese Unterscheidung<br />
habe in der Vergangenheit zu juristischen Kunstgriffen<br />
geführt, die zu Recht kritisiert worden seien.<br />
So hätten Gerichte beispielsweise das Abschalten<br />
eines Beatmungsgerätes als Unterlassen im juristischen<br />
Sinne interpretiert und seien so zur gewünschten Straffreiheit<br />
gekommen.<br />
Nun ersetzt das Gericht diese Unterscheidung durch<br />
den Begriff des „Behandlungsabbruchs“, der regelmäßig<br />
aus Elementen aktiven Handelns und passiven Unterlassens<br />
bestehe.<br />
Handlungen, die das Leben unabhängig von<br />
einem schweren Krankheitsprozess beenden,<br />
sind weiterhin strafbar.<br />
Ausführlich setzt das Gericht sich mit der Problematik<br />
des mutmaßlichen Patientenwillens auseinander. Es<br />
verweist für den Fall, dass der Patient seinen Willen nicht<br />
mehr äußern kann und ihn auch in der Vergangenheit nicht<br />
schriftlich geäußert hat auf die Regeln des Patientenverfügungsgesetzes,<br />
die Anhaltspunkte zur Ermittlung eines<br />
solchen Willens geben.<br />
Lob haben die Richter erhalten für die Deutlichkeit, mit<br />
der sie die Grenze zwischen strafbarer Tötung und strafloser<br />
Sterbehilfe, neu definiert haben. Sie erlaubt dem juristischen<br />
Laien, also Ärzten, Pflegekräften, Betreuern und<br />
Angehörigen eindeutig zu bestimmen, wie weit Eingriffe,<br />
die das Leben beenden, gehen dürfen bzw. wo die Strafbarkeit<br />
anfängt.<br />
Ein Behandlungsabbruch liegt nur dann vor, wenn er im<br />
Zusammenhang mit Sterbehilfe steht. Er setzt die Einwilligung<br />
des Betroffenen voraus sowie eine lebensbedrohliche<br />
durchblick 4/<strong>2010</strong> 55