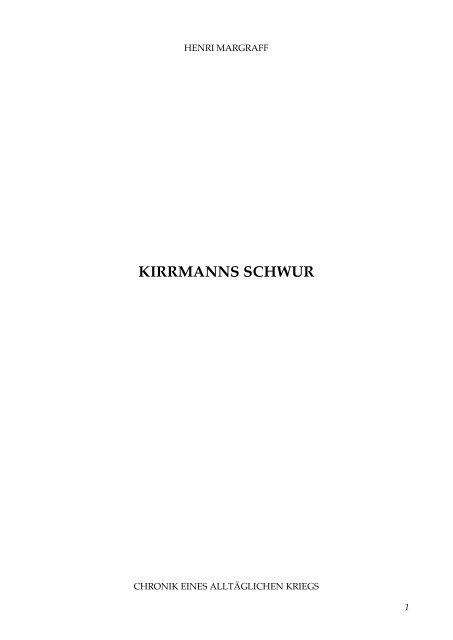KIRRMANNS SCHWUR
KIRRMANNS SCHWUR
KIRRMANNS SCHWUR
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
HENRI MARGRAFF<br />
<strong>KIRRMANNS</strong> <strong>SCHWUR</strong><br />
CHRONIK EINES ALLTÄGLICHEN KRIEGS<br />
1
Ich widme diese Chronik zum Gedenken an den<br />
seligen Marcel Callo,<br />
jozistischen Militanten,<br />
der das Martyrium des Lagers FLOSSENBÜRG<br />
lebte und überlebte,<br />
am 19. März 1945 in MAUTHAUSEN<br />
die letzte Reise antratt.<br />
Am 4. Oktober 1987<br />
vom Papst Johannes-Paulus II<br />
selig gesprochen.<br />
“O Crux, ave, spes unica !“<br />
HENRI MARGRAFF wurde 1920 zu Zabern (Savernes, Departement Bas-Rhin) in einer<br />
fest mit der Heimat verbundenen elsässischen Familie geboren: sein Urgroßvater,<br />
Jahrgang 1802, war Landwirt, sein Großvater und Vater, im französischen Boden<br />
wurzelnd, waren beide Bäcker.<br />
Henri Margraff berichtet über sein Erfahren und Widerfahren während der Kriegsjahre<br />
von 1939 bis 1945, seine Flucht aus dem annektierten Elsaß unter der Besatzung der Nazis,<br />
sein Studentenleben in Clermont-Ferrand, wo die Universität Straßburg sich nach dem<br />
Anschluss niedergelassen hatte, sein Engagement in der Résistance, der<br />
Widerstandsbewegung, seine Verhaftungen, seine Deportation zu den Lagern Auschwitz<br />
(obwohl er kein Jude war), Buchenwald und Flossenbürg.<br />
Diese Odyssee brachte ihm, am Rande des Tods, die Offenbarung des Heiligen Geistes<br />
und war für ihn die Gelegenheit zu vielerlei Begegnungen und Bekanntschaften, unter<br />
denen auch die Begegnung mit Albert Kirrmann, die für den Titel dieses Berichts<br />
entscheidend war.<br />
Es ist die wahre und gelebte Geschichte eines humanistischen Katholiken, eines<br />
deportierten Widerstandskämpfers, Befürworters der deutsch-französischen Versöhnung.<br />
Es ist auch ein Teil der Geschichte des Elsasses aus einem persönlichen und positiv<br />
humanen Blickwinkel, ohne Nachsicht.<br />
2
Kapitel I<br />
ZABERN<br />
Heim und Heimat<br />
Zabern, Zawère, Saverne. Meine Heimat. Dort wurde ich 1920 geboren, inmitten einer<br />
Gesellschaft, die geprägt war von der Rückkehr des Elsasses zu Frankreich im Jahre 1918.<br />
Dort verbrachte ich eine von Lebensfreude erfüllte Kindheit. Eltern und Lehrer waren streng, wir<br />
waren glücklich. Der Zeitvertreib, der uns die größte Zufriedenheit verschaffte, mag vielleicht<br />
anspruchslos erscheinen: Winters und Sommers zogen wir durch die Wälder auf den Hügeln in<br />
der Nähe, in demselben Wald, in dem damals, unter Obhut seines Großvaters, auch Charles de<br />
Foucauld spazieren ging.<br />
Die schicke, elegante Stadt, mit damals 6000 bis 7000 Einwohnern, am Nordrand der Vogesen, an<br />
der Zaberner Steige (Col de Saverne), fast versteckt und überragt von den Ruinen des Haut-Barr,<br />
dem Auge des Elsasses (l’Œil de l’Alsace), am Übergang zur großen grünen Ebene («le beau<br />
jardin», dem schönen Garten, wie Ludwig XIV sie zu nennen pflegte), wurde 1913, kurz vor dem<br />
Ersten Weltkrieg, schlagartig und grenzüberschreitend bekannt: die Zabernaffäre - in den<br />
französischen Schulbüchern «L’Affaire du Lieutenant de Saverne» - sorgte für Aufruhr im<br />
deutschen Kaiserreich.<br />
Eine nicht unwichtige deutsche Garnison (11 Kompanien des 99. Infanterieregiments) war im<br />
Schloss Rohan, dem Prunkstück der Stadt, einquartiert. Laut in Umlauf befindlicher Gerüchte,<br />
verbreitet vom anderen Geschlecht (Sie verstehen, was ich sagen will), hatte ein feuriger<br />
Unterleutnant preussisch-adliger Herkunft in der horizontalen Lage ein Problemchen mit der<br />
Harnblase (Sie verstehen immer noch, was ich sagen will). Das war ein gefundenes Fressen für die<br />
Stadtbengel, die ihm eines Tages nachliefen und laut zuschrien: «pisse en lit! - Bettnässer!», um<br />
sich dann in Windeseile aus dem Staub zu machen.<br />
Es wäre dabei geblieben, wenn nicht der kleine Leutnant ein intimer Freund des deutschen<br />
Kronprinzen gewesen wäre und er letzteren nicht gebeten hätte, zu intervenieren. Und siehe da!<br />
Der Kronprinz, vor den Augen der übergangenen Zivilbehörde, befahl dem<br />
Garnisonskommandant, den Belagerungszustand in der Stadt auszurufen und jede<br />
Zusammenrottung von mehr als 3 Personen zu unterbinden. Der Befehl wurde befolgt, ohne<br />
Bedenken und ohne Scham, und so wurden - nebst anderen - die Gerichtsbediensteten beim<br />
Verlassen des Gerichtsgebäudes nach geschlossener Sitzung alle zusammen verhaftet und zum<br />
Garnisonsschloss befördert. Überdies mussten die vor Ort eingezogenen, jungen wehrpflichtigen<br />
Rekruten des Bezirks - mit damals 200 Einwohnern pro Quadratkilometer - etliche Scherereien<br />
erdulden, was zu großem Entsetzen in der Stadt und auf dem Land führte.<br />
Wochenlang berichtete die Tageszeitung «Zaberner Tagblatt» nicht nur über die Zwischenfälle vor<br />
Ort, sondern ebenfalls über die deutsch-französischen Spannungen auf diplomatischer Ebene. Es<br />
kam zu einer Kriegsatmosphäre, bis zur höchsten Instanz, sodass die Berliner Regierung den<br />
Rückzug der Garnison «über den Rhein» anordnete.<br />
Letztendlich, um ganz ehrlich zu sein, war der Ausgang der Affäre weniger glorios, denn nach<br />
dem Rückzug der etwa 3000 Männer - bei einer Zivilbevölkerung von etwa 7000 Einwohnern -<br />
kam die städtische Wirtschaft ins Stolpern, umso mehr als den deutschen Wehrpflichtigen ein<br />
überdurchschnittlicher Sold sicher war,… sodass die örtlichen Händler um die Rückkehr der<br />
Garnison baten. Die Rückkehr, in aller Ruhe, fand wenige Monate vor dem Ausbruch des Ersten<br />
Weltkrieges im August 1914 statt.<br />
Nach der Wiedereingliederung des Elsass in die République Française, wie vom Versailler Vertrag<br />
bestimmt, erzählten die Bengel von damals, die den Konflikt überlebt hatten, uns<br />
Nachkriegsbuben, die ganze Geschichte so ausgeschmückt und aufgeputscht, dass wir hätten<br />
glauben können, der Anlass zum Ersten Weltkrieg wäre der Zwischenfall von 1913 gewesen.<br />
3
Was mich betraf, so war ich bereits seit meiner Kindheit sehr früh aufgeklärt. Mein Großvater<br />
Alois, 1854 geboren und 1928, als ich gerade acht war, verstorben, erzählte mir die wahre<br />
Geschichte. Beim ihm verweilte ich jeden Abend, nach Heimkehr aus der Grundschule, jeden<br />
Samstag und Sonntag. Von seinen Enkeln stand ich ihm am nächsten. Er brachte mir alle seinen<br />
Lebenserfahrungen und -erlebnisse bei und dies mit einem pädagogischen Geschick, dessen er<br />
sich gar nicht bewusst war.<br />
Großvater war der Benjamin der zehn Kinder meines Urgroßvaters (1802-1893), Eigentümer<br />
ausgedehnter Güter im Nordelsass. Er war auch der klügste von den Zehn, was den ältesten,<br />
sechzehn Jahre vor Alois Geborenen, zur Verzweiflung brachte. Die Jahre gingen vorbei und der<br />
Junge wuchs auf, brav und klug, bis er dem alten Dorfpfarrer, einem Gelehrten im Ruhestand des<br />
Bistums Straßburg, auffiel. Der Pastor brachte ihm Französisch, Grundkenntnisse im Latein und<br />
Allgemeinbildung bei und dies zu einer Zeit, in der es noch keine Grundschule im “Alten<br />
Frankreich“ gab. Vielleicht wollte er aus Alois einen Pfarrer machen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls,<br />
um die Jahre 1860, befolgte mein Urgroßvater die Ratschläge des Adoleszenten Alois in Bezug auf<br />
die Planung der Arbeit auf dem Bauernhof, was den Ältesten, der seinen Bruder als “Professor“<br />
beschimpfte und ihn dabei mit Schlägen traktierte, zu weiterer Verzweiflung brachte. Mit siebzehn<br />
war Alois, trotz fehlenden Schulunterrichts, ein gebildeter Bursche, überzeugt von den<br />
republikanischen Prinzipien der Französischen Revolution von 1789, die ihm vom Pfarrer<br />
beigebracht worden waren. Er wusste, dass unter dem Premier Empire des Napoleon Bonaparte,<br />
die Elsässer Generäle die besten des Heeres waren: Kléber, Desaix, Kellermann, Leclerc, u.a.<br />
Nachdem Elsass-Lothringen - dem Frankfurter Vertrag von 1871 zufolge - zurück ins Deutsche<br />
Reich gingen, traf Alois den schwerwiegenden Beschluss, ins alte Frankreich umzusiedeln. Er<br />
verbracht nur einige Wochen beim Bäcker des Kantons (Wasselonne), um die Grundkenntnisse<br />
der Backstube zu erlernen. Dann zog er, den Wanderstab in der Hand und den Reisesack auf der<br />
Schulter, auf die Lothringer Hochebene, marschierte stracks gerade aus, bis er merkte, dass er im<br />
Alten Frankreich angekommen war, als er auf seine in Elsasser Mundart gestellte Frage, von den<br />
Bauern den Weg auf Französisch gezeigt bekam. Fröhlich bedankte er sich in ihrer Sprache. Er<br />
fühlte sich zu Hause.<br />
Zu jener Zeit war Frankreich von Lothringen bis zum Île-de-France, den Bestimmungen des<br />
Frankfurter Vertrags zufolge, während mehrerer Jahre von den Deutschen besetzt. Eine<br />
Arbeitsgenehmigung in der Besatzungszone erhielt Alois erst nach Ausstellung eines Reisebuchs,<br />
in dem die verschiedenen Reisen und Aufenthaltsorte eingetragen wurden. Aus juridischer Sicht<br />
hatte er die Deutsche Nationalität, und 1874, als er zwanzig wurde, war er gezwungen, wieder ins<br />
Elsass zu ziehen und wurde dort zur deutschen Armee eingezogen. Zum Wehrdienst wurde er zu<br />
Wartha, in Mecklenburg, bei einem preußischen Prinzen einquartiert. Die Dauer des Wehrdienstes<br />
war damals auf zwei Jahre festgelegt, jedoch war vorgesehen, dass der Soldat, nach zwölf äußerst<br />
anstrengenden Monaten, nach Ermessen seiner Vorgesetzten freigestellt werden konnte, wenn er<br />
die Dienstpflichten erfüllt und die Prüfungen korrekt bestanden hatte. Das galt für Alois.<br />
Nach seiner Heimkehr ins Elsass fand er Arbeit in einer Zaberner Bäckerei und heiratete die<br />
Tochter des Hauses. Seine Ehefrau starb fünf Jahre später infolge einer Tuberkulose, eine nicht<br />
seltene Todesursache zu jener Zeit. Die Ehe blieb kinderlos, und so arbeitete Alois allein im<br />
Bäckereigeschäft. Kurze Zeit danach ging er eine neue Ehe ein. Seine zweite Ehefrau, Maria<br />
Ruhart, war ein kräftiges Fräulein aus einem Nachbardorf. Ihre Eltern, wohlhabende Bauern,<br />
hatten Maria nach Lothringen, in ein von Nonnen geführtes Pensionat schicken können und nach<br />
Abschluss ihrer Ausbildung sprach auch Maria fließend Französisch. Ich habe diese, meine<br />
Großmutter (1863-1936), die ihrem Ehemann sechs Kinder schenkte, gut gekannt. Das dritte Kind -<br />
und auch der erste Sohn - sollte 1889 mein Vater werden. Neben meinem Großvater Alois,<br />
kleinwüchsig aber breitschultrig, erschien Maria wie ein Riese, eine wahre Gargamelle, ein Kopf<br />
größer als ihr Ehemann.<br />
Mein Vater, Joseph, hatte die Körpergröße von seiner Mutter geerbt. Im Alter von vierzehn Jahren<br />
half er, als ältester der drei Söhne, seinem Vater in der Bäckerei, denn mein Großvater war nicht in<br />
der Lage, einen Gesellen zu entlohnen. Die Kundschaft in seinem Zaberner Viertel am Stadtrand<br />
war arm und stand andauernd in der Kreide, sodass auch mein Großvater erhebliche Schulden<br />
hatte. Er war sogar gezwungen, ein Pferd und ein Teil der großmütterlichen Landgüter zu<br />
4
verkaufen, um, im Hinblick auf den Ruhestand, in der Nähe von Zabern einen Bauernhof zu<br />
erwerben. Trotz seiner physischen Kräfte, litt mein Vater Joseph unter ernsthafte Beschwerden mit<br />
dem venösen Kreislauf in den Beinen, sodass er 1909 im Alter von zwanzig Jahren von der<br />
damaligen deutschen Militärbehörde endgültig wehrdienstunfähig gestellt wurde. Diese<br />
Behinderung verstärkte noch seine Bindung zur Heimat. Er leistete weiter harte Arbeit, was<br />
vielleicht erklärt, dass er seine Kinder so erzog, wie er selbst erzogen worden war.<br />
Das Leben der beiden anderen Söhne meines Großvaters war ganz anders. Albert, Jahrgang 1911,<br />
hatte nicht nur seine zwei Jahre Wehrdienst bei der Kaiserlichen Garde in Berlin abzuleisten,<br />
sondern noch drei zusätzliche Monate wegen Disziplinarvergehens. Mein Großvater war wütend,<br />
und nach seiner Heimkehr im Jahre 1913 verließ Albert heimlich das Elternhaus, jedoch nicht<br />
allein. Er nahm sein Bruder Charles, Jahrgang 1915, mit sich. Charles war erst achtzehn, aber<br />
außergewöhnlich kräftig für sein Alter.<br />
Der älteste Bruder meiner Mutter, Henri Wild, vom Wehrdienst zurückgestellt, war bereits 1912,<br />
nach Beenden seines Ingenieursstudiums, im Alter von fünfundzwanzig Jahren nach Paris<br />
geflohen. Das war nur deshalb möglich, weil in Zabern eine Organisation für heimliche<br />
Auswanderer nach Frankreich aktiv war. Ein gewisser Baumgartner Zaberner Herkunft, eröffnete<br />
auf dem Pariser Montmartre ein Bistro mit renommierter Küche und zwielichter Kundschaft, in<br />
dem sich ein chiques Klientel traf, um starke Gefühle zu erleben. Dieser Chefkoch brachte dem<br />
kleinen Charles das Handwerk bei. Albert bekam eine Stelle bei einer Bank und Henri, als<br />
Ingenieur, fand problemlos eine Beschäftigung bei einem Unternehmen der feinmechanischen<br />
Industrie, wo er nach 1918 Direktor wurde.<br />
Meine beiden Onkel meldeten sich freiwillig bei der französischen Armee, und es war Charles, der<br />
beim Aufmarsch zum Parlament die Trikolore der Pariser Elsässer trug. Henri wurde nach Paris<br />
zurückberufen und ab den ersten Wochen des Konflikts als Direktor bei einem Hersteller von<br />
Kriegswaffen eingestellt. Nach dem Ersten Weltkrieg, im Jahre 1919, wurde er Direktor des<br />
Ateliers Vaucanson. Er verunglückte 1924, zusammen mit seinem Mechaniker, auf der Straße nach<br />
Melun, als er seinen neuen Ford ausprobierte.<br />
Alle 9000 Elsässer und Vogesener, die 1914 in der Französischen Armee aufrückten, waren<br />
Freiwillige. Nicht erst 1919, aufgrund des Versailler Vertrags, erhielten sie die französische<br />
Nationalität, denn die war ihnen bereits 1917 zugesichert worden, und zwar aufgrund eines<br />
Sondergesetzes, das ihnen diese Nationalität, ohne jeden Vorbehalt verlieh. Diese Freiwilligen der<br />
französischen Armee waren jedoch einer nicht zu unterschätzenden Gefahr ausgesetzt. Die<br />
meisten von ihnen sprachen nur den Elsässer Dialekt und liefen Gefahr , bei einer<br />
Gefangenennahme vom Feind nicht als Kriegsgefangene, sondern als Deserteure behandelt und<br />
verurteilt zu werden. Um sie vor diesem Los zu bewahren, fiel der französischen Regierung nichts<br />
Besseres ein, als sie 1916 alle nach Marokko zu versetzen, und so waren die zwei Brüder Margraff,<br />
nachdem Charles bereits 1915 bei Reims durch eine Kugel am Oberschenkel verletzt worden war,<br />
an der Befriedung Marokkos beteiligt. Mein Großvater Alois dachte oft und sehr gerührt an seine<br />
beiden eingezogenen Söhne. So erzählte mein Vater Josef später, nach dem Großen Krieg - la<br />
Grande Guerre -, wie Alois ab 1916, während der großen Schlacht bei Verdun – von der die<br />
Deutschen behaupteten, die Sieger zu sein - immer wieder, nachts, zu Fuß, auf die Spitze des Haut<br />
Barr stieg, um von dort aus das Aufleuchten der Geschütze zu beobachten, um danach wieder zu<br />
seiner Nachtarbeit als Bäcker zurückzukehren.<br />
Albert, obwohl ganz sportlich, vertrug das trockene Klima in Süd-Marokko nicht. Er wurde<br />
wieder ins Mutterland versetzt und in ein Bataillon der dritten Zuavenarmee in Frankreich<br />
eingegliedert. Am 16. Juli 1918, in Villers-Cotterêts, Departement Aisne, rückte er in der<br />
Angriffslinie auf und, trotz der guten Vorbereitung seitens der Artillerie, wurde er von einer<br />
Kugel in den Bauch getroffen. Die Kugel wurde von einem MG-Nest aus gefeuert, von feindlichen<br />
Soldaten, die an das Maschinengewehr festgekettet waren. Nur selten überlebte ein Verletzter<br />
solche Verwundungen und die daraus entstehende Blutvergiftung, denn weder Antibiotika noch<br />
Sulfonamide waren damals bekannt. Albert schaffte es. In der Folge hatte er mit schweren<br />
irreversiblen Nahrungsproblemen zu kämpfen, bis zu seinem Ableben im Alter von 86 Jahren im<br />
Jahre 1977.<br />
5
Das Schicksal des zweiten Bruders, Charles, weiter im verbleibenden dritten Zuave eingebunden,<br />
war dramatischer. Am 31. August 1918 ging seine Patrouille, auf Befehl des Scharführers, auf die<br />
Suche nach Wasser. In der Nähe von Sidi Minoun, im Tazastreifen, wurden sie von einer<br />
Rebellenreitertruppe überfallen und, nach einem kurzen Scharmützel fielen Charles und seine<br />
Mitstreiter. Die Leichen wurden nicht repatriiert und vor Ort begraben. Später wurden die Gräber<br />
geschändet. Anfangs war Charles nach Frankreich übergesiedelt, um Elsass-Lothringen<br />
zurückzuerobern. Letztendlich starb er im fremden Ausland, für eine Sache, die nicht die seine<br />
war.<br />
Als am 19. November 1918 die Siegertruppen Zabern erreichten, hatte die Militärbehörde als<br />
ersten Auftrag, sich nach der Familie Margraff zu erkundigen, um ihr die Nachricht zu<br />
übermitteln, dass Onkel Albert sich in Paris allmählich von seinen Kriegsverwundungen erholte<br />
und sein Bruder Charles irgendwo in Marokko einquartiert war. Als Albert einige Wochen später<br />
in Zabern eintraf, musste er seinen Eltern leider mitteilen, dass Charles nie wiederkommen würde.<br />
Es ist nicht die autobiografische Besorgnis, die mich dazu bringt, über das Schicksal meiner<br />
Familie zu berichten, sondern vielmehr die Absicht, die Wesensart und Einstellung des Elsass-<br />
Lothringen jener Epoche darzustellen und herauszuarbeiten. Großväter wie mein Großvater Alois<br />
gab es Tausende in dem siebenundvierzigjährigen Zeitraum von 1871 bis 1918, woraus zu<br />
schließen ist, dass nicht die Muttersprache als Kriterium und Nachweis für die Nationalität des<br />
Betroffenen angewandt werden kann.<br />
Kapitel II<br />
ADOLESZENZ<br />
Der Tod meines Großvaters im Jahr 1928 war für mich grausam. Viel Trost fand ich bei meiner<br />
Großmutter. Meine Eltern, zu sehr in der Bäckerei beschäftigt, hatten mich Bauerntöchtern<br />
anvertraut. Diese waren zwar sehr nett und freundlich, jedoch weit von jeder kulturellen Bildung<br />
entfernt und ohne Erfahrung im Bereich der Nahrungs- und Körperhygiene, sodass ich über<br />
längere Zeit ein schmächtiger Bursche blieb. Dazu kam noch, dass mein Vater, ein<br />
schwerarbeitender, rauer Kerl, mit dem ich mich nie auf Französisch unterhalten habe, mich - statt<br />
in die unteren Klassen des Gymnasiums zu schicken - für drei Jahre der Gemeindeschule<br />
anvertraute. Dort teilte ich den Unterricht mit Kindern bescheidener Herkunft und hörte als<br />
einzige Sprache nur die Elsasser Mundart. Mein Vater hatte jedoch die Anweisungen des<br />
Großvaters Alois nicht vergessen. Alois war der Meinung, dass ich, mit meinem wachen Geist,<br />
unbedingt und so früh wie möglich sowohl ins Alte Frankreich als auch nach Deutschland<br />
geschickt werden sollte, um mir auf der einen Seite ein korrektes Französisch anzueignen, auf der<br />
anderen Seite ein korrektes Deutsch zu lernen, ohne Mundartbeimischungen mit überwiegend<br />
germanischen Wurzeln.<br />
Die zwei Monaten, die ich während des Sommers 1930 in Villers-la-Faille, Kanton Gorgoloin, in<br />
Burgund verbrachte, hinterließen eine sehr angenehme Prägung. Für alle, vom Bäcker bis zum<br />
letzten Schulbuben, war ich der «kleine Boche». Noch lange Zeit danach trug ich an den Beinen die<br />
Verletzungen durch die Steine, mit denen ich von den Lausbuben traktiert wurde. Erst nach<br />
Eingreifen, sowohl des Bürgermeisters als auch des Schullehrers, der gleichzeitig auch<br />
Gemeindesekretär war, hörte dieser Kleinkrieg auf. Überragend waren jedoch die Schönheit und<br />
der Reichtum dieser Landschaft der Weinberge, die Entdeckung einer fürstlichen Küche inmitten<br />
dieser Menschen. Ich kehrte heim, ohne Groll und ohne Akzent.<br />
Später, 1936, gelang es meinem Vater, mich bei einer deutschen Gastfamilie unterzubringen. Der<br />
Vater, ehemaliger Offizier der deutschen Marine, unterrichtete Geschichte und Erdkunde an<br />
einem «Pädagogium», einer Vorbereitungsschule für das Studium an einer pädagogischen<br />
Hochschule, in Bad-Godesberg am Rhein, nahe Bonn. Regelmäßig während der Ferien empfing er<br />
junge Ausländer, auch Franzosen. Das war für mich eine neue Erfahrung. Der Nazismus hatte die<br />
Macht übernommen. Hitler hatte das Rheinland besetzt, den Vertrag von Locarno von 1925<br />
gebrochen, was ihn nicht weiter störte, um die Berliner Olympiade 1936 zu veranstalten. Während<br />
6
dieser Olympiade verließ der enttäuschte «Führer» das Stadion, damit er einem farbigen Athleten,<br />
Jesse Owens, nicht die Hand reichen musste. Jesse Owens hatte mehrere Weltrekorde gebrochen<br />
und den Vereinigten Staaten vier Goldmedaillen eingebracht.<br />
Paradoxerweise spürte ich in dieser katholischen Familie - ich war Protestant - die Furcht vor<br />
einem neuen Krieg. Eines Tages hörte ich ungewollt ein Gespräch zwischen Professor Schramm<br />
und einem Industriellen aus dem Rheinland, der seinen Sohn auch in dieser Pension<br />
untergebracht hatte. Aus diesem Dialog ging deutlich ihre Überzeugung hervor, dass Hitler die<br />
Revanche wollte und den Krieg vorbereitete, indem er die allgemeine Wehrpflicht wieder<br />
einführte. So hatte er die Jahrgänge 1914, 1915 und 1916 sofort mobilisiert, um die Reichswehr, mit<br />
40 000 Mann zur Zeit der Weimarer Republik, auf eine Stärke von 500 000 Mann, d.h. auf die Basis<br />
der feindlichen Truppen in 1939, zu erhöhen.<br />
In den Vorkriegsjahren häuften sich in Frankreich Fehler und Pannen. Am Zaberner Kolleg gab es<br />
leidenschaftliche Diskussionen, sowohl unter den Schülern als auch unter den Lehrern, über die<br />
Besetzung des Rheinlands durch die Deutschen Wehrmacht im März 1936. Die allgemein<br />
herrschende Meinung war: zurückschlagen und - der Erklärung des Albert Sarraut zustimmend -<br />
verhindern, dass Straßburg unter das Feuer der feindlichen Kanonen gerät. Eine Minderheit, etwas<br />
feinsinniger und nuanzierter, war der Meinung, dass eine wirtschaftliche Blockade Deutschlands -<br />
1918 zwar mit den Waffen besiegt, aber weiter über eine intakte Industrie verfügend - die<br />
Reparationen unmöglich machen würde und dass die 1931 von Poincaré getroffene Sanktion,<br />
nämlich die Wiederbesetzung des Ruhrgebiets wegen Nicht-Einhaltung des Abkommens, sehr<br />
ungeschickt war. Innerhalb der französischen Bevölkerung war bereits das Vorgefühl eines<br />
bevorstehenden neuen deutsch-französischen Konflikts zu erahnen.<br />
Auf Initiative des Garnisonskommandanten und im Einverständnis mit dem Direktor des Kollegs<br />
wurde in jeder oberen Klasse eine Gruppe Freiwilliger gebildet, die am Schießstand der Kaserne<br />
und an dem des Fasanerie-Waldes den Umgang mit Gewehren und Maschinengewehren übten.<br />
Am 13. März 1938, nach einer von Goebbels geführten Hetzkampagne in Rundfunk und Presse,<br />
ließ Hitler seine Truppen in Österreich einrücken, wo sie von der Bevölkerung, tief vom Verlust<br />
des Kaiserreichs in 1918 frustriert, mit Jubel und Applaus begrüßt wurden.<br />
München 1938, 29. - 30. September. Unsere Presse erweckte nicht den Eindruck, sich über das<br />
Münchener Abkommen zwischen Frankreich, England, Italien und Deutschland - unter<br />
Ausschluss der UdSSR - einig zu sein. Nur Anthony Eden bestand auf einem harten Vorgehen.<br />
Neville Chamberlain und Lord Halifax blieben unnachgiebig und wollten weiter verhandeln.<br />
Viele unserer Mitbürger waren der Meinung, dass das Münchener Abkommen das Ende der<br />
Spannungen bedeutete, obwohl es offensichtlich war, dass Hitler vorerst einmal das bekommen<br />
hatte, was er wollte. Edward Daladier hingegen ließ sich nicht in die Irre führen und bei seiner<br />
Rückkehr aus München gab er es auch deutlich zu verstehen. Erst in April 1939, nachdem Hitler<br />
unter dem Vorwand der Unzufriedenheit der sudetischen Minderheiten die gesamte Tschechische<br />
Republik überfallen und besetzt hatte, wurde den Briten klar, dass es zu keiner Einigung keiner<br />
Entente mit der Clique kommen konnte, die 1933 in Deutschland die Macht ergriffen hatte.<br />
Spätes Erwachen! Zu spät! Bereits ab dem Herbst 1938 hatte unsere Regierung eine allgemeine<br />
Mobilmachung eingeleitet und spätestens dann mussten wir alle feststellen, dass wir überhaupt<br />
nicht vorbereitet waren, denn diese Mobilmachung hatte solche Mängel und Lücken in deren<br />
Organisation ans Licht gebracht, dass es fast wie eine Farce aussah. Wieder eine Erfahrung mehr.<br />
Es wurde deutlich, dass der Krieg zum Anlass nur noch einer neuen Aggression seitens des<br />
“Führers“ bedurfte. Der Schock kam am 23. August 1939: Es gelang Nazi-Deutschland, mit der<br />
UdSSR ein Nichtangriffspakt zu unterzeichnen. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten:<br />
Neun Tage später, am 1. September 1939, unter dem falschen Vorwand und der Behauptung eines<br />
polnischen Angriffs auf Deutschland, rückten die deutschen Truppen aus dem Westen, die<br />
russischen aus dem Osten in Polen ein. Zehn Tage nach dem Hitler-Stalin-Pakt, am 2. September<br />
1939 erklärten Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg. Unsere angeblich<br />
unüberwindbare Front, die «Ligne Maginot», machte keine Fortschritte.<br />
7
Am Tag der großen Offensive, dem 10. Mai 1940, war mein Jahrgang immer noch nicht<br />
mobilisiert. Erst am 6. Juni, kurz vor dem Zusammenbruch, wurde dieses 3. Kontingent 1939<br />
aufgerufen. Vorher hatte ich die Gelegenheit, von der Universität Nancy aus, das erste Jahr der<br />
höheren Militärausbildung zu absolvieren. Zur Zeit der Einberufung hatte ich um Eingliederung<br />
bei der damaligen «Infanterie Coloniale» - später «Infanterie de Marine» genannt - gebeten. Das<br />
wurde mir genehmigt und am 8. Juni 1940 kam ich ins Waffenlager des 23. RIC Regiment der<br />
«Infanterie Coloniale» in Dreux, Departement Eure-et-Loir. Am 9. Juni wurde die Stadt<br />
bombardiert: bis zum 14. Juni nahm ich an der Ausbildung “Gewehrgriffe“ teil, bis wir, zu Fuß, in<br />
der Abenddämmerung das Lager räumten.<br />
Am Morgen des 15. Juni, nach einem Nachtmarsch, näherten wir uns einem Dorf, irgendwo in<br />
Eure-et-Loir. Am Eingang des Orts, an einer Hausmauer, bemerkte ich ein Plakat mit der<br />
Tricolore, der französische Nationalfahne, in den Ecken. Ich hielt an, ging beiseite. Das Plakat war<br />
auf den 10. Juni datiert und ich konnte lesen, dass im Gegensatz zu dem, was von den<br />
Panikmachern behauptet und verbreitet wurde, Évreux - etwa hundert Kilometer östlich von Paris<br />
- nicht evakuiert wurde. Der Text endete mit «Nous vaincrons!» (Wir werden siegen!) und war<br />
unterzeichnet: «Jean Moulin, Präfekt zu Chartres». Ich fühlte, zwar noch ziemlich konfus, dass zu<br />
einer Zeit, in der die Front zusammenbrach, dieser mir bis danhin unbekannte Mann bereits vom<br />
unbeugsamen Willen zum Weiterkämpfen und zum Widerstand ergriffen war. Erst viel später,<br />
1972, vernahm ich mehr über ihn, als während eines Vortrags Christian Pineau, Überlebender der<br />
Deportation, den Verdienst Jean Moulins würdigte. Jean Moulin war von der Gestapo gefoltert<br />
worden und Christian Pineau war der letzte der ihn danach, kurz vor seinem Tod gesehen hatte.<br />
Ich erzählte ihm wie ich, wahrscheinlich ein der ersten, Zeugen seiner Initiative zum Widerstand<br />
gewesen war, noch vor dem 18. Juni 1940, als Charles de Gaulle aus London dazu aufrief (L’Appel<br />
du 18 juin 1940).<br />
Wie jeder weiß, folgte der Exodus. Ich möchte jedoch die Gefühle der Machtlosigkeit, der<br />
Frustration und der Scham der Männer dieses Eliteregiments, das während seines Marsches vom<br />
Freikorps des 1. Bataillons begleitet und geschützt wurde, betonen. Es kam dennoch zum<br />
Feuergefecht mit dem, was wir in die Hände bekamen, als die Heinkel 111, beim Überqueren der<br />
Loire in Beaugency, Bomben auf die Brücke und auf uns abwarfen. Ein junger Soldat und ein<br />
Kapitän wurden zerfetzt, ein Leutnant von Bombensplittern verletzt. Sofort bin ich zu einem von<br />
den Schützen verlassenen Maschinengewehr geeilt und feuerte von der Ladefläche des<br />
Lastwagens aus. Dafür gab es das Lob des Hauptmannes.<br />
Es ging weiter. Der Rückzug endete in der Sologne, in der Nähe von Selles-sur-Cher. Fast die<br />
gesamte Mannschaft aus dem Lager von Dreux gelang über die Cher-Brücke.<br />
Erst in Mai 1941, auf meiner Flucht aus dem Elsass, wurde mir klar, dass Selles-sur-Cher zu einem<br />
Punkt auf der Demarkationslinie geworden war. Am Morgen des 19. Juni befand sich das<br />
Freikorps, in dem ich eingebunden war, eingeschlossen zwischen La Ferté Saint-Aubin und Selles.<br />
Wir vernichteten unsere Waffen und ergaben uns der deutschen Motorradeinheit, die uns<br />
rücksichtslos zusammentrieb und uns bis Romorantin, immer noch in der Sologne, marschieren<br />
ließ. Während des Marsches schlossen sich uns mehrere andere Gefangenentruppen an.<br />
Es ist mir unmöglich, die von mir damals durchlittene und mich niederwerfende Erschöpfung zu<br />
beschreiben. Der schlimmste Augenblick, so glaube ich, war die Begegnung mit einem alten<br />
Pfarrer in einem der Dörfer, durch die wir zogen. In seiner Soutane stand er am Wegrand und, als<br />
wir an ihm vorbeimarschierten, zog er den Hut, um uns schweigend sein Mitleid zu bekunden.<br />
Heute frage ich mich noch, wie ich damals meine Verzweiflung überwinden konnte, wie es nicht<br />
zum Nervenzusammenbruch kam.<br />
Nach einer ersten Nacht im Wiesengras wurden wir am frühen Morgen zusammengeführt und in<br />
Richtung Salbris im Departement Loir-et-Cher weitergeschickt, wo wir auf einer anderen Wiese<br />
Halt machten. In der riesigen Menge der Kriegsgefangenen, auf dieser Wiese zusammengetrieben,<br />
sah ich nur Niedergeschlagenheit. Die stärksten unter den Männern waren dennoch überzeugt,<br />
vielleicht nach einigen Wochen wieder heimkehren zu können. Es gab unglaubliche<br />
Zwischenfälle: auf unserem Marsch zum Zusammenschluss sah ich, wie Kriegsgefangene sich eilig<br />
unserer Truppe anschlossen, obwohl sie in der Gegend zu Hause waren, und als deutsche<br />
8
Offiziere zu uns stießen und uns auf Französisch zuriefen «la guerre finie» (Aus der Krieg!), gab es<br />
sogar Applaus seitens einiger Gefangenen, die auf dem Boden zusammengesunken waren. Als ich<br />
einer der deutschen Offiziere zu seinen Kollegen auf Deutsch sagen hörte, dass die Elsässer und<br />
Lothringer freigelassen werden sollten, war mir sofort klar, dass den drei Departements Moselle,<br />
Bas-Rhin, Haut-Rhin (Mosel, Ober- und Niederrhein) der gewaltsame Anschluss, die Annexion in<br />
das Dritte Reich bevorstand.<br />
Ich überlegte und suchte einen Weg, mich aus dieser Situation zu befreien, um nicht wie ein<br />
Deutscher behandelt zu werden. Ich vertraute mich einem Landsmann aus Mülhausen an, einem<br />
Arbeiter, der meine Meinung teilte. Er hatte eine Verbindung zu einem anderen Artilleristen, der<br />
die Schlacht an der Somme überlebt hatte. Ich selbst wurde von einem jungen Einberufenen aus<br />
dem Jura aufgesucht. Der Mülhausener und ich konnten die beiden anderen davon überzeugen,<br />
dass je länger wir warten würden, desto mehr Schwierigkeiten wir bekämen, uns davon zu<br />
machen. Sie sollten entweder mit uns kommen oder uns allein fliehen lassen. Sie ließen sich<br />
überreden, nicht nur aus Kameradschaft, sondern auch weil die «boîtes de singe», die<br />
Fleischkonserven, ausgegangen waren und unsere Wächter gar nicht daran dachten, uns wieder<br />
zu beliefern. Mitten in der Nacht konnten wir die unaufmerksamen, zerstreuten und<br />
halbschlafenden Wächter überlisten. Von der Wiese flohen wir auf den Acker und bis zum frühen<br />
Morgen zogen wir durch die Felder. In der Morgendämmerung war Zufriedenheit auf allen<br />
Gesichtern zu lesen und das Lächeln, das wir austauschten, sagte alles.<br />
Für mich begann ein neues Leben, so empfand ich es. Juni 1940 wurde ich, im Alter von 20 Jahren,<br />
neu geboren.<br />
Dörfer wurden gemieden, umgangen, Straßen genauestens überschaut, dann in Windeseile, mit<br />
einem Satz überquert. Mittags erreichten wir einen Bach, unweit einer Bauernkate, geführt von<br />
zwei jungen Bäuerinnen. Ruck zuck aus den Kleidern sprangen wir ins Wasser, um uns - bei der<br />
herrschenden brühenden Hitze - zu erfrischen. Die beiden Mädels servierten uns ein Omelette und<br />
zeigten uns den größeren Bauernhof, zu dem sie gehörten. Das ältere Bauernehepaar - mir<br />
schienen die beiden alt, obwohl sie vielleicht erst fünfzig waren - stellte keine Fragen, verlangte<br />
keine Erklärungen und wir wurden in die große Küche geführt. Erst wird gegessen und<br />
getrunken, das “Plaudern“ hat Zeit.<br />
So ist nun mal die Bauernschaft in Frankreich. Selbst hatten sie drei Söhne, die zum Militär<br />
eingezogen waren und von denen sie noch keine Nachricht erhalten hatten. Die Arbeit auf den<br />
Feldern konnte nicht aufgeschoben werden. Die zwei Artilleristen zeigten sich sofort bereit, ihnen<br />
zu helfen, aber nachdem die Tiere in den Stall getrieben waren, wurden wir ins Bett gebracht.<br />
Morgen ist ein anderer Tag. Ich ließ mich fallen wie ein Sack, schlief wie ein Holzklotz und wachte<br />
vor Tagesanbruch auf. Ich brauchte einen Plan für die kommenden Tage. Die «Artilleristen» waren<br />
sich einig, den Bauer um Arbeit auf dem Hof zu fragen. Der Kleine aus dem Jura war sich wohl<br />
bewusst, dass er nicht auf eigene Faust zurück zu seiner Familie in Orchamps, Franche-Comté,<br />
konnte und wollte nach Paris, in Zivil, um dort Onkel und Tante aufzusuchen. Das passte auch zu<br />
meinem Plan, vorausgesetzt ich konnte mir Zivilkleidung verschaffen. Seit September 1939 war<br />
eine meiner älteren Schwestern bei einer Freundin aus dem Pensionat untergebracht und deren<br />
Vater war Direktor der zentralen Molkerei in Dijon und Eigentümer eines großen Bauernhofs in<br />
der Nähe. Also, los! Die Idee, mit dem Strom der heimkehrenden Flüchtlinge nach Paris zu ziehen,<br />
gefiel mir. Ich konnte mich dort beim Onkel meines Reisegefährten etwas ausruhen, danach weiter<br />
nach Dijon ziehen, abhängig von den dortigen Berichten über die Lage der Nation, denn<br />
Rundfunk und Zeitung gab es nicht. In der damaligen Situation ging es mir darum, - ich war von<br />
dem Gedanken wie besessen -, nicht als Elsässer aus der Gefangenschaft befreit und<br />
dementsprechend vom Feind als Deutscher behandelt zu werden.<br />
Am übernächsten Tag, von meinen Gastgebern mit Zivilweste und -hose ausgestattet, mit einer<br />
Decke am Schulterriemen, den Militärschuhen an den Füßen und dem Brotbeutel an der Seite,<br />
brach ich zusammen mit Albert, dem Jurassier, nach Orléans auf. Das Feuer in Orleans war noch<br />
nicht ganz gelöscht, denn eine dichte Rauchwolke stieg über der Stadt auf. Die Statue der Jeanne<br />
d’Arc stand mitten in den Trümmern. Nur die Eisenbahnbrücke mit ausgerissenen Schienen war<br />
unversehrt. Angeblich war es verboten, sie zu überqueren, aber wir erreichten die andere Seite<br />
ohne Schwierigkeiten. Noch weitere zwei Nächte verbrachten wir auf einem Bauernhof und trafen<br />
9
dann im Bahnhof von Étampes, fünfzig Kilometer südlich von Paris, ein. Auf gut Glück warteten<br />
wir in der dichten Menschenmenge auf den Zug, der die Flüchtlinge nach Paris bringen sollte.<br />
Und siehe da! Ein Güterwagenzug mit einem einzigen und freiwilligen Lockführer wurde<br />
zusammengestellt. Die Waggons füllten sich, als eine deutsche Einheit anrückte und jeden<br />
Waggon nach versteckten Gefangenen kontrollierte. Einige Männer wurden herausgeholt und<br />
abgeführt. Mein Kumpel wurde in Ruhe gelassen, gar nicht kontrolliert, und ich antwortete auf<br />
Deutsch, dass ich erst neunzehn war und dass die Franzosen in dem Alter nicht eingezogen<br />
wurden. Dabei hatte ich nicht weniger Angst als bei der Flucht aus Salbris, einige Tage zuvor.<br />
Nachts hielt der Zug im Pariser Bahnhof Austerlitz: Sperrstunde. Es blieb uns nichts anderes<br />
übrig, als auf dem Beton zu übernachten. Am nächsten Morgen zogen wir zur Rue Jarente, im<br />
Marais-Viertel, und als wir zum vierten Stock hinaufstiegen und das alte Arbeiterpaar den Neffen<br />
erblickte, flossen die Tränen. Die einfache Wohnung, in der ich mich zwei Tage ausruhen konnte,<br />
sollte ich später nicht wiedererkennen, denn wie das ganze Viertel sollte sie dem<br />
Restaurationsboom ausgeliefert und zu einer eleganten Zwei-Zimmer-Wohnung zu horrenden<br />
Mietpreisen renoviert werden.<br />
2. Juli 1940. Die Geschäfte und Läden machten allmählich wieder auf und meinem Plan<br />
entsprechend wurde der Knappsack mit Wurst, Pastete- und Sardinenkonserven aufgefüllt. Die<br />
Pariser U-Bahn, die Metro, war streckenweise wieder in Betrieb. Ich fuhr bis zur Porte d’Italie und<br />
begab mich auf die Nationale 5 bis zum Senart-Wald, wo ich die Nacht verbrachte.<br />
7. Juli 1940. Nach fünf Tage Marsch über 323 Kilometer erreichte ich Dijon, Departement Côte<br />
d’Or. Die Flüchtlinge zogen allmählich nordwärts. Ohne Schwierigkeiten wurde mir auf dem<br />
Land Übernachtung in den Scheunen gestattet, nur nicht in der Stadt Montereau, wo ich nachts<br />
auf dem zerstörten Eisenbahndepot in einem Reisewaggon erster Klasse pennte. Immer wieder<br />
begegneten mir Militär- und Gefangenenkolonnen. Einmal wurde ich von einem jungen deutschen<br />
Offizier angehalten, der mich fragte, ob ich Soldat sei.<br />
Ich rechnete zusammen: in den neunzehn Tagen war ich etwa 920 Kilometer gelaufen, also einen<br />
Durchschnitt von 60 pro Tag. Socken hatte ich schon lange nicht mehr, aber keine Blasen an den<br />
Füßen. Das Französische Militär hatte gute Schuhe!<br />
Die Gastfamilie meiner Schwester hatte wie alle gehandelt: sie waren geflüchtet und noch nicht zu<br />
Hause zurück. Der Werkmeister der Molkerei, mit der Aufsicht beauftragt, ließ mich mit dem<br />
Lieferwagen zu dem Kuhhirten auf dem Hof in Changey, einige Kilometer entfernt, bringen. Sein<br />
Häuschen stand unweit vom Herrenhaus, in deren Nebengebäuden bis vor der Evakuierung der<br />
Veterinärdienst der Französischen Armee untergebracht war. Alles war vernichtet und überall<br />
herrschte Unordnung. Ich fand ein Bettgestell, eine Matratze und haufenweise Bücher im<br />
Durcheinander, der in der Eile zurückgelassen worden war. Die Mahlzeiten nahm ich zusammen<br />
mit dem Ehepaar ein. Auch er - ein Veteran von 1914, mit der Medaille «mirlitaire» geehrt -, seine<br />
Frau und ihr taubstummes Töchterchen warteten auf die Rückkehr des Herrn.<br />
Einige Tage gingen vorbei. Die aufrückenden deutschen Truppen machten immer wieder halt,<br />
nahmen mit, was noch mitzunehmen war, oder wurden in Einheiten einquartiert. Für die<br />
euphorischen Sieger war ich der Verwandte aus der Stadt, in Ferien auf dem Bauernhof. Sie gaben<br />
mir ihre Propagandameldungen zu lesen. So vernahm ich, dass die Maginotlinie gefallen war.<br />
Auch las ich die Veröffentlichung der wichtigsten Klauseln des Waffenstillstands: mit Ausnahmen<br />
von den Elsässern und den Lothringern, blieben die Kriegsgefangenen in Gefangenschaft «bis zum<br />
Ende der Kampfhandlungen»; diejenigen, die noch weiter kämpfen sollten, wurden als<br />
Freischärler betrachtet und behandelt, mit anderen Worten: sofort erschossen. Der Verlauf der<br />
Demarkationslinie, infolge deren drei Fünftel von Frankreich als Besatzungszone galt, war<br />
ebenfalls in diesen Bulletins wiedergegeben. Ratlos strengte ich mich an, nicht mehr zu überlegen,<br />
nahm die Unterkunft und Versorgung weiter in Anspruch und wartete auf die kommenden<br />
Nachrichten, auch wenn ich nicht wusste, was für Nachrichten wann kommen würden.<br />
Plötzlich ging alles sehr schnell: am 9. Juli trafen meine Eltern in Dijon ein. Es war ihnen<br />
gelungen, mit dem Wagen von Saverne nach Dijon zu kommen, um meine Schwester abzuholen.<br />
Sie war zwei Tage vorher, begleitet von ihren Gastgebern, aus dem Cantal zurückgekommen.<br />
Große Erleichterung für meine Eltern, die beiden Kinder wiederzusehen. Immer noch gab es<br />
10
keinen Rundfunk, keine Zeitungen, keine Eisenbahnverbindungen und keine Banken waren<br />
geöffnet. Die Präfektur konnte keine Auskünfte hinsichtlich des Übergangs der Demarkationslinie<br />
erteilen. Ich wusste nicht wie ich zur Universität Straßburg, die nach Clermont-Ferrand im Massif<br />
Central gezogen war, zurückfinden konnte. Bei unseren Gastgebern spürte ich bereits eine<br />
Einstellung des Sich-Abfindens mit der neuen Situation, Prämisse zum «Pétainismus», der die<br />
Mehrheit der Franzosen, insbesondre die Bourgeoisie, gewinnen sollte.<br />
Mein Vater hatte keine Mühe, um als Elsässer auf dem Rückweg in die Heimat bei der<br />
Kommandatur das für die Rückfahrt erforderliche Kontigent Benzin zu erhalten. Kriegsmüde ließ<br />
ich mich überreden und fuhr mit Vater, Mutter und Schwester über Nancy, wo ich meine Sachen<br />
bei der Mobilmachung hinterlassen hatte, zurück nach Zabern, wo wir am 12. Juli 1940 ankamen.<br />
14. Juli 1940 - Nationalfeiertag. Wir, etwa ein Dutzend Kumpel, hatten uns auf dem Col de<br />
Saverne, der Zaberner Steige, getroffen und von dort zogen wir, französische Militärmärsche<br />
pfeifend, in die Stadt, wo, bei den ersten Häusern angekommen, die Einwohner uns mit Applaus<br />
begrüßten und gratulierten. Sofort danach, wie verabredet, machten wir uns aus dem Staub.<br />
“Man“ wusste davon, aber wir wurden nie identifiziert.<br />
Ich hatte zwölf Kilo weniger als bei der Mobilmachung, 35 Tage vorher. In dem allgemeinen<br />
Kuddelmuddel stellte mir keiner Fragen. Die Angst meines Vaters, aus seiner Heimat deportiert<br />
zu werden, erreichte einen Höhepunkt am 16. Juli 1940, als an jenem Morgen mehrere<br />
Unteroffiziere der Wehrmacht ins Haus eindrangen und meinen Vater mitnahmen. Er war als<br />
Mitglied der Sûreté Générale Française (Allgemeiner Staatssicherheitsdienst Frankreichs)<br />
angezeigt worden. Außerdem hatten die Wehrmachtsoffiziere wissen lassen, dass sie alle<br />
Deserteure der Deutschen Armee vom vorigen Krieg 1914-18 suchten, in unserem Fall die beiden<br />
jüngeren Brüder meines Vaters und der ältere Bruder meiner Mutter, Charles Wild. Es fiel meinem<br />
Vater nicht allzu schwer, diese absurde Anzeige seiner Angehörigkeit zu der Staatssicherheit oder<br />
irgendeines Geheimdiensts zurückzuweisen und zu beweisen, dass einer seiner Brüder und sein<br />
Schwager verstorben waren. Sein anderer Bruder, so konnte er verdeutlichen, hatte sich bei der<br />
Evakuierung von Straßburg in September 1939 zurückgezogen. Es war also nicht die Gestapo, die<br />
Geheime Staatspolizei, sondern die Abwehr der deutschen Wehrmacht, die alle Archive von<br />
damals, von der «Grande Guerre» 1914-18, aufbewahrt hatte. So fassten sie, zur selben Zeit, in<br />
Zabern drei Deserteure, die sich 1914 freiwillig bei der Französischen Armee gemeldet hatten.<br />
Das Militär brachte die Festgenommenen nach Straßburg, wo sie vernommen wurden, hart aber<br />
korrekt. Einer der Vernehmenden vertraute meinem Vater an, dass er evangelischer Pfarrer war,<br />
und flüsterte ihm den Namen des Denunzianten zu. Alle vier, mein Vater und die drei<br />
mutmaßlichen Deserteure, wurden am späten Abend wieder freigelassen. Erst viel später erfuhr<br />
ich, dass nicht nur in Elsass-Lothringen, sondern im ganzen besetzten Frankreich gleichartige<br />
Ermittlungen stattfanden, dort von der Gestapo geführt. Einer unserer Freunde, Leiter des<br />
Postamtes in Nancy im besetzten Gebiet, wurde von der Gestapo hart vernommen, aber die ihm<br />
vorgeworfenen Tatsachen waren längst verjährt, sodass er davon kam. Er wusste, dass er weiter<br />
beobachtet wurde und es gelang ihm, eine Anstellung beim Postamt in Saint-Flour - in der nichtbesetzten<br />
Zone - zu bewirken.<br />
In diesem Sommer 1940 ging es noch ausschließlich um einfache Routinemaßnahmen, ziemlich<br />
milde, denn die Nazis befanden sich noch im Rausch des Sieges. Jedoch fühlten wir uns<br />
beobachtet, überwacht. Alle Behörden, d.h. die gesamte Verwaltung, wurde “nazifiziert“ und in<br />
einen immer enger werdenden Rahmen gezwungen. Es brauchte nicht mehr als zwei Prozent<br />
hundsgemeiner Dreckskerle, um zu erfahren, wer nicht an den Propagandaversammlungen<br />
teilnahm, wer nicht auf der Arbeitsstelle erschien, wer unter der neuen Konstellation das Studium<br />
nicht wieder aufnahm.<br />
Am 17. oder am 18. Juli 1940 traf ich meine Freunde, Paul Durrenberger und François Loth, auf<br />
dem Bürgersteig in der Grand’ Rue. Eine Kompanie der Wehrmacht zog in Gleichschritt singend<br />
durch die Straße. Gerade als sie sich auf unserer Höhe befanden, sangen sie aus voller Brust:<br />
11
«Wir werden weiter marschieren,<br />
Wenn alles in Scherben fällt,<br />
Denn heute da hört uns Deutschland<br />
Und morgen die ganze Welt.»<br />
Wir warfen einander schockierte Blicke zu: jeder hatte ganz eindeutig begriffen, dass das Leben<br />
mit solchen Leuten nicht möglich war.<br />
Einige Tage später verschlimmerte sich die Lage. Alle Juden, die sich noch in Zabern aufhielten -<br />
unter ihnen auch Fernand Loth und seine Familie -, wurden zusammengetrieben und in die Freie<br />
Zone abgeführt. Dort wurden sie als Flüchtlinge aus Elsass-Lothringen, ohne jede rassistische<br />
Diskriminierung aufgefangen. Dazu ist zu bemerken, dass die antisemitischen Verfügungen auf<br />
Eigeninitiative des Vichy-Regimes erst in Dezember 1940 veröffentlicht wurden. Paul<br />
Durrenberger teilte mir mit, dass sein Vater, Beamter bei der Nationalen Französischen Eisenbahn<br />
S.N.C.F., mit seiner Familie nach Paris wollte und, falls es zur Flucht kommen sollte, ich seine<br />
Adresse in Paris an der philologischen Fakultät erfahren konnte. Fernand Loth und seine Familie<br />
überlebten den Krieg und kehrten nach Zabern zurück.<br />
Von den 625 Juden in Zabern waren bei Kriegsende nur 126 spurlos verschwunden. Die 500<br />
Überlebenden müssten dann wohl irgendwo und irgendwie Schutz bei und von der “normalen“<br />
Bevölkerung gefunden haben. Dies erklärt auch, weshalb auf nationaler Ebene die Prozentzahl der<br />
in den Osten deportierten Juden weit unter dem Durchschnitt der von den Nazis besetzten Länder<br />
West-Europas lag. In diesem Herbst 1940 fürchteten sich alle vor weiteren Vertreibungen. Es war<br />
allgemein bekannt, dass jedem, der der Francophilie verdächtigt wurde, die Vertreibung aus dem<br />
annektierten und germanisierten Elsass drohte.<br />
Es gab in Zabern nur ganz wenige elsässische Verräter. Einer von denen, der den Posten des<br />
Kreisleiters innehatte, heuchelte meinem Vater sein Erstaunen vor, nämlich darüber, dass ich - in<br />
Abwartung der Neubildung einer neuen deutschen Universität in Straßburg - mein Studium nicht<br />
an der Uni Heidelberg fortsetzen wollte, denn das Elsass war Teil des Gaus Elsass-Baden im<br />
Dritten Reich. Es war uns bekannt, dass dieser Kreisleiter das Vertrauen der Nazis genoss, wenn<br />
es darum ging, die Unerwünschten zur Vertreibung anzuzeigen. Der genannte Ganther wurde<br />
nach der Befreiung der Justiz in Zabern gestellt, zum Tode verurteilt und 1947 standrechtlich<br />
erschossen.<br />
Nach dieser Verwarnung ging die Angst meines Vaters in Panik über. Er bedrängte mich, mit<br />
inständiger Bitte, «vorübergehend», um in die Irre zu führen, nach Heidelberg zu ziehen. In den<br />
ersten Oktobertagen reiste ich ab und blieb bis Ende März 1941. Kurz nach meiner Ankunft, am 22.<br />
Oktober 1940, war ich Zeuge der Vertreibung der bedeutenden jüdischen Gemeinschaft von<br />
Heidelberg und Umgebung. Im Vergleich mit der Behandlung, die die Elsässer Juden in Juli 1940<br />
erfuhren, endete die Deportation für die 282 Heidelberger Juden viel tragischer, meistens mit dem<br />
Tod. Sie wurden von der Polizei unter den gleichgültigen Blicken der Heidelberger Bevölkerung<br />
in Lastwagen zusammengedrängt. Ihr Schicksal entnahm ich in einer Schrift, 1965 von einem<br />
heute verstorbenen Heidelberger Verleger publiziert. Sie wurden in Tierwaggons nach Lyon<br />
gebracht, dürften nicht mehr als 300 Mark und 30 Kilo Gepäck mitnehmen. Bei der<br />
Demarkationslinie wurde ihnen einen Teil des Geldes abgenommen. Von dort ging es zum Lager<br />
von Gurs, in den Pyrénées-Atlantiques. Das Gepäck, systematisch beraubt, folgte später. Viele von<br />
ihnen kamen durch Hunger und Erschöpfung um. Nach einer Reihe Verhandlungen zwischen<br />
dem SS-Offizier Dannecker und dem Vertreter der französischen Polizei, Jean Leguay, wurden die<br />
Inhaftierten von Gurs nach Drancy, später - in verschiedenen Konvois - nach Auschwitz<br />
transportiert. Es ist größtenteils dem wiedergefundenen Tagebuch des Hans Oppenheimer zu<br />
verdanken, dass das Los der Heidelberger Juden nachverfolgt werden konnte. Es stellte sich<br />
heraus, dass in November 1942 etwa 6000 Juden aus dem Saargebiet und dem Badener Land in die<br />
französische besetzte und freie Zone abgeführt wurden.<br />
Von den Elsässern und Lothringern, die sich in Heidelberg befanden, waren 95% bemüht, ihren<br />
Eltern die Vertreibung zu ersparen. Die brutal verlaufende Verbannung erfolgte im Dezember, in<br />
aller Frühe morgens. Beim Einstieg in die Tierwaggons wurde erlaubt, 30 Kilo Gepäck und 2000<br />
Francs mitzunehmen. Die Auswahl erfolgte völlig willkürlich. Einigen Familien, die fest glaubten,<br />
12
abgeführt zu werden, blieb es erspart. So ging es meiner Familie. Andere, als sie aufgerufen<br />
wurden, waren verblüfft und erschüttert. Die Nachricht, dass meine Familie nicht zum Konvoi<br />
gehörte, traf kurz danach in Heidelberg ein.<br />
An der Universität Heidelberg führte das Rektorat eine geschickte Politik zwischen Studium und<br />
nationalsozialistischem System. Wir waren individuell oder in kleineren Gruppen untergebracht<br />
und bekamen billige Kost in der Uni-Mensa. Die Mitgliedschaft in der offiziellen Studentenpartei<br />
war Pflicht, auch die regelmäßige und eifrige Teilnahme an den Körperschaftstreffen, Überreste<br />
der alten Gilden. Jeder von uns wurde in eine solche Studentenschaft eingegliedert. Das Rektorat<br />
ernannte einen Führer für jede Kameradschaft, wo sich die Vorträge über «politische Bildung»<br />
aneinanderreihten.<br />
Häberle, einem Koloss von ein Meter neunzig mit einer Trepannarbe an der Stirn und einem<br />
gläsernen Auge infolge eines Unfalls, war die Mobilisierung erspart geblieben und er wurde<br />
Führer der Studentenschaftsabteilung, der ich zugewiesen wurde. Er war Jurist und höflich. Bei<br />
der Ausübung seiner Aufgaben ließ er überhaupt keinen Fanatismus einfließen und ich merkte<br />
sogar einige Annäherungsversuche zu uns und Verständnis für die Lage der Elsässer und<br />
Moselaner. Aber wem konnte man noch trauen? Wem konnte man sich anvertrauen? Das Regime<br />
hatte die Denunziation zu einer Staatsangelegenheit erhoben. Die Gesamtheit der eingesessenen<br />
Studenten, noch vom Sieg berauscht und seit August 1940, nach der Frankreichkampagne<br />
vorläufig demobilisiert, war von der Tatsache, dass im Winter 1940-41 nach dem Zusammenbruch<br />
der Frankreichfront nicht sofort die Invasion Großbritaniens erfolgte, überhaupt nicht beunruhigt<br />
und glaubte fest an den Endsieg des Dritten Reichs. Einer von ihnen hielt sogar einen auf<br />
allgemeine Zustimmung stoßenden Vortrag über die neutrale Position der UdSSR im Rahmen des<br />
Abkommens Berlin-Rom-Tokyo, wodurch Deutschland die Gelegenheit und Möglichkeit bekam,<br />
die Endoffensive gegen England für das Frühjahr 1941 vorzubereiten! Was uns auffiel und<br />
interessierte, war der verachtende Spott über Frankreich und die Franzosen, die wohl glauben<br />
würden, dass die Zusammenarbeit, die Kollaboration zwischen Besetzern und Besetzten im<br />
Rahmen einer neuen politischen Ordnung möglich wäre. Für sie bedeutete Kollaboration die<br />
Ausbeutung der Ressourcen Frankreichs mit dem Ziel, den Krieg weiterführen zu können. In<br />
seinen Schriften über die “Geheimen Akten des Gegenwärtigen Frankreichs“ wirft Claude Paillat<br />
ein Licht auf dieses geplante “Abholzen“ des Landes im Zeitraum vom Sommer 1940 bis<br />
November 1942.<br />
Wir bemühten uns an, nach außen den Eindruck zu vermitteln, dass wir das Spielchen<br />
mitspielten. Dabei blieben wir wachsam und nur an bestimmten Abenden, unter Landesgenossen<br />
in einem unserer Zimmer oder im Hintersaal einer Kneipe (und davon gab es viele in der<br />
Studentenstadt Heidelberg) besprachen wir die Ereignisse und nahmen wieder das ewige<br />
Leitmotiv auf, nämlich wie und wann - die Vertreibungen aus dem Gebiet Elsass-Mosel wurden<br />
eingestellt - wir in die Freie Zone flüchten sollten. Einige unter uns meinten, in der Heimat bleiben<br />
zu müssen und dort die Mission, wie von Maurice Barrès in seinem Roman «Colette Baudoche»<br />
geschildert, aufzunehmen und zu verwirklichen. Völlig utopisch, denn der Krieg ging weiter und<br />
es gab keinerlei Aussicht auf einen Friedensvertrag zwischen Deutschland und Frankreich. Die<br />
vorherrschende Tendenz ging dahin, die Entwicklung in den Vereinigten Staaten abzuwarten und<br />
damit die Abwartehaltung über den Winter, bis zum Frühjahr zu rechtfertigen.<br />
Dann kam es, im Februar 1941, in Heidelberg zu einem Zwischenfall, der von uns, einigen<br />
Hunderten, als sehr bedeutend empfunden wurde und die Stimmung des «drôle de guerre», des<br />
Sitzkrieges ohne entscheidendes Militäreingreifen - abgesehen von den vernichtenden und<br />
erfolglosen Bombardements Großbritaniens - gut wiedergab. Wir wurden ins Amphitheater<br />
gerufen, wo zwei unserer Landesgenossen - ausgewählt unter den fünf oder sechs, die aufgrund<br />
ihrer Deutschfreundlichkeit das Vertrauen der Behörde genossen - das Wort ergriffen, um sich -<br />
jeder der Reihe nach - darüber zu wundern, dass sich bis dahin noch kein elsässer oder<br />
lothringischer Student der Universität Heidelberg freiwillig zur Wehrmacht gemeldet hatte!<br />
Ein Engel ging durchs Zimmer… Andre Ring (4. Jahr Medizin) beugte sich zu mir hinüber und<br />
flüsterte: «Heute Abend, Fünfertreffen». Mangels einer Gesamtorganisation beschlossen wir, dass<br />
jeder individuell die Vorbereitungen treffen würde, um sich so schnell wie möglich abzusetzen,<br />
13
entweder über die Schweiz, oder unmittelbar über die Grenze zwischen der annektierten und der<br />
verbotenen Zone, um zur Universität Straßburg in der freien Zone zu finden.<br />
Ich schwänzte die Vorlesungen und im März kehrte ich nach Zabern zurück. Etwas später traf<br />
auch Ring bei uns ein. Mein Vater hatte seine Einstellung und Ansichten geändert. Er war zwar<br />
noch vom Gedanke der Vertreibung betroffen, aber er war sich sicher, dass die Vertreibung zu<br />
Ende war, umso mehr da es den Deutschen nicht gelungen war, im Lauf des zweiten Halbjahrs<br />
1940 in England Fuß zu fassen. Unter der Bevölkerung herrschte die allgemeine Meinung, dass<br />
«sie» - auch wenn keiner etwas genaues wusste - den Krieg verlieren würden; «sie» hätten keine<br />
Chancen mehr, ihn noch zu gewinnen. Ring reiste nach Straßburg ab und wir vereinbarten, uns<br />
gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. So vernahm ich von ihm, dass er über die Schweiz in<br />
der freien Zone angekommen war. Einige Wochen später, im Mai 1941, würde ich ihn in<br />
Clermont-Ferrand wiederfinden.<br />
In Zabern setzte mein Vater alle Hebel in Bewegung, um meine Flucht vorzubereiten. Er fand<br />
einen Fluchtweg, der uns überraschend und unglaublich erschien. Einer seiner Freunde war<br />
Käsegroßhändler und war von der Militärbehörde aufgefordert, wöchentlich die bei Nancy<br />
einquartierte deutsche Division mit der erforderlichen Menge Käse zu versorgen. Die Lieferung<br />
wurde von einem Konvoi begleitet, ein Militärlieferwagen mit zwei österreichischen Offizieren,<br />
die als Landsleute nach der Reichsgebietserweiterung in die Wehrmacht eingebunden worden<br />
waren. Ich erinnere mich ihrer Namen nicht mehr. Sie waren im Hause Bohn untergebracht und<br />
hatten in vollem Vertrauen zum Ehepaar Bohn ihre Abneigung und Opposition zum Hitlerregime<br />
geäußert. Sie waren einverstanden, mich in ihrem Lieferwagen zu verstecken, jedoch unter der<br />
Bedingung, dass einer von den beiden sich vorher mit mir unterhalten könnte. So begab ich mich<br />
dann am späten Abend zu der Familie Bohn und hörte zu, als einer dieser Österreicher mir kurz<br />
und klar seine Überzeugung über die Sinnlosigkeit des Krieges kundgab. Die Aktion wurde<br />
geplant und vorbereitet. Er versicherte mir, dass er in der Zukunft auch noch andere mitnehmen<br />
würde, wenn die Kontrolle der Lieferfahrten nach Nancy so bleiben würde wie bisher. Ring war<br />
schon fort und ich verging fast vor Ungeduld. Die Apriltage gingen vorüber. Eines Tages wurde<br />
ich auf der Straße vom Untersuchungsrichter Mischlich angesprochen. Was die Verschwiegenheit<br />
betraf, war ich sofort beruhigt, als er mir seine Absicht, auch zu flüchten, anvertraute. Obwohl er<br />
der jüngste Untersuchungsrichter Frankreichs war, hatte er bereits eine brillante Karriere hinter<br />
sich und sollte diese in den Nachkriegsjahren als Erster Vorsitzende des Berufungsgerichts zu<br />
Colmar abschließen. Aber damals, auf der Straße in Zabern, war er ratlos, denn er hatte keine<br />
zuverlässigen Verbindungen. Er fragte mich, ob ich für ihn einen Fluchtweg in die freie Zone<br />
finden könnte. Dass wusste ich schon, aber ich konnte ihm nicht ohne weiteres meinen Plan<br />
offenlegen. Ich empfahl ihm, nach meiner Abfahrt meinen Vater aufzusuchen. Ich merkte wie er<br />
sich doch etwas wunderte, nicht sofort Auskunft zu erhalten, denn sein Beruf war für ihn wie zu<br />
einer zweiten Natur geworden. Erst im Oktober 1941 ergriff er selbst die Initiative, landete in<br />
einem Militärbüro in Paris, wo er versuchte, sich einen Ausweis ausstellen zu lassen, um eine<br />
angebliche Freundin in der freien Zone besuchen zu können. Dann zog er in die Landes südlich<br />
von Bordeaux und von dort, unter riskanten und gewagten Bedingungen, über die<br />
Demarkationslinie in die nicht besetzte Zone. In Cusset nahe Vichy wurde er in das Amt des<br />
Staatsanwalts berufen. Später suchte er mich in Clermont auf und erzählte mir seine Geschichte.<br />
In Zabern fiel mir das Warten schwer. Seit drei Wochen stand mein Reisesack parat. Ich machte<br />
mir Sorgen. Vielleicht war der gesamte Plan, der Fluchtweg aufgedeckt worden. Am 28. April kam<br />
endlich die Nachricht: Morgen früh geht es los. Spät in der Nacht überbrachte ich den Reisesack,<br />
wie vereinbart. Ich hatte einen unruhigen Schlaf. Ich hatte darum gebeten, morgens früh mit<br />
meiner Mutter allein sein zu können. Ich erklärte ihr, dass ich davon überzeugt war, dass überall<br />
im alten Frankreich Widerstandsbewegungen aufgebaut und organisiert wurden. Sie konnte ihre<br />
Tränen nicht zurückhalten, als ich aus dem Haus ging und mich zu Fuß auf den Weg begab, die<br />
Hände in den Hosentaschen, mit einer ruhigen Miene, obwohl ich ganz genau das grausame<br />
Gefühl spürte, mir selbst entrückt zu sein. Alleine die Idee, vielleicht niemals mehr<br />
zurückzukommen, war für mich eine Folter. Es musste aber sein. Das Marschieren tat mir wohl<br />
und nach einer halben Stunde hatte ich die zweite Kurve auf dem Weg zum Col erreicht. Kurz<br />
darauf hielt der «österreichische» Lieferwagen an und sobald ich in das vorgerichtete Versteck<br />
geschlüpft war, fuhr er ab. Auf der Strecke wurde einmal angehalten, wie vorgesehen, nämlich bei<br />
der «Grenzkontrolle» zum Departement Meurthe-et-Moselle. Etwas weiter stieg ich im Innenhof<br />
14
eines Hauses in Lunéville aus. Die Begleitmannschaft fuhr sofort weiter, Richtung Nancy,<br />
nachdem sie mir erklärten, dass vor Nancy mit einer neuen Kontrolle zu rechnen wäre. Im<br />
Innenhof erschien eine junge Frau, die mich bat, keine Fragen zu stellen. Ihr Mann war im Mai<br />
1940 in Dünkirchen gefallen. Sie zeigte mir das Haus, wo ich die Nacht verbringen konnte. Sie<br />
brachte mir das Abendessen und morgens nahm ich das Frühstück. Frau Cornat zögerte, Geld zu<br />
nehmen. In Lunéville stieg ich in den Omnibus nach Nancy, wo ich Unterkunft bei alten Freunden<br />
unserer Familie finden sollte. Die Müllers stammten ebenfalls aus Zabern, wohnten aber seit<br />
langem in Nancy. Im Winter und Frühjahr 1940, nach der Evakuierung von Straßburg, als ich mich<br />
für die Juraprüfungen an der Universität Nancy vorbereitete, besuchte ich sie sehr oft. Sehr früh<br />
hatten sie die Seite von De Gaulle gewählt. Über ein Verbindungsnetz unter Freunden knüpften<br />
sie Kontakte mit dem Stadtamt in Nancy, mit mehreren Beamten, die bereit waren, sich um mich<br />
zu kümmern und mich über den Jura in die freie Zone führen zu lassen, es sei denn, ich wollte<br />
nach Paris, um von dort aus auf eigene Faust weiterzukommen.<br />
Dank Müller war ich also auf ein echtes, organisiertes Fluchtnetz gestoßen! Ich war mehr als<br />
zufrieden, denn meine Reiseroute war bereits festgelegt und - mehr noch - ich fand einen Halt und<br />
bekam die Möglichkeit, mich einer Widerstandsorganisation anzuschließen. Dem Agenten, der<br />
mir die «echten falschen» Lebensmittelscheine zuspielte, schlug ich vor, mit Müller in Verbindung<br />
zu bleiben, sodass ich Letzterem in seiner Zone später, nach meiner Ankunft in Clermont, zur<br />
Verfügung stehen könnte, nämlich als Glied in der Fluchtwegkette über die Lothringer Grenze.<br />
Für den Fall, dass ich mich entscheiden sollte, wieder “herüberzuziehen“, um Frau Müller oder<br />
ihre Tochter aufzusuchen, stimmte er einer späteren Kontaktaufnahme zu, aber nur wenn die<br />
Umstände es zuließen. Zu der Zeit konnte ich nicht mehr tun, als ihm für das Angebot zum<br />
Übergang durch den Jura zu danken. Ich erklärte ihm, dass ich von Nancy nach Paris wollte, wo<br />
ich von weiteren Freunden aus Zabern erwartet wurde. Für die Reise nach Paris gab er mir<br />
zahlreiche, nützliche Anleitungen mit Bezug auf die Kontrollen der Züge in Revigny,<br />
Übergangspunkt zur verbotenen Zone. Mit herzlichen Dankesworten verabschiedete ich mich von<br />
diesem Freiwilligen. Erst im Sommer 1942 suchte ich Frau Müller und die Organisation wieder<br />
auf.<br />
In Paris erwartete mich Paul Durrenberger. In dieser meiner Geschichte über die Kriegsjahre ist es<br />
mir wichtig, etwas mehr über das Los dieses Schulkameraden zu erwähnen. Seine beispielhafte<br />
Haltung dem Feind gegenüber, sollte er mit seinem Leben bezahlen. Ab dem Sommer 1939, als<br />
auch er in Nancy - jedoch an der philologischen Fakultät der - studierte, hatte er die Absicht, sich<br />
für die Dauer des Krieges zu engagieren. Wegen nur einiger Monate Altersunterschied, wurde er<br />
nicht zusammen mit mir ins Kontingent des Sommers 1940 eingezogen und so blieb er bei seiner<br />
Familie in Zabern, wo ich ihn nach meiner Flucht aus der Gefangenschaft in Salbris und der<br />
kurzen Kampagne durchs besetzten Gebiet wiedersah.<br />
Problemlos erreichte ich die Gare de l’Est, den Ostbahnhof von Paris, und stieg dort aus. Es war<br />
Anfang Mai 1941. Hotelzimmer ohne weitere Kontrolle, Restaurants von dem Schwarzmarkt<br />
beliefert… all das war möglich mit Tickets und Geld. So sollte ich zwei Wochen durchhalten. Am<br />
Tag nach meiner Ankunft begab ich mich sofort zum Sekretariat der Fakultät, wo mir mitgeteilt<br />
wurde, dass es untersagt war, Adressen zu nennen, aber eine hinterlassene schriftliche Nachricht<br />
vertraulich zugestellt werden könnte. Also lief ich, ein wenig entsetzt, in der strahlenden<br />
Morgensonne die rue Monge hinauf, auf der Suche nach einem Schreibwarenladen, und stand<br />
plötzlich Auge in Auge mit Paul, der auf dem Weg zur Fakultät war. Seit zehn Monaten hatten wir<br />
uns nicht mehr gesehen. Er war, so wie ich ihn in Erinnerung behalten habe, ein prächtiger Kerl,<br />
obwohl er mir damals etwas abgemagert erschien. Er erzählte mir, wie er - um über die<br />
Demarkationslinie zu flüchten - sich mit einem Zaberner zusammengetan hatte. Dieser Zaberner<br />
Freund, Fernand Heitz, war der Sohn eines Metzgers in Saverne (der Metzger Heitz sollte später,<br />
nach der Befreiung von 1944/45, Bürgermeister der Stadt werden) und stand in Verbindung mit<br />
seinem Vetter Victor Daum, Professor am Lyzeum in Bourges, der bereits in einer<br />
Fluchtorganisation in seiner unmittelbaren Nähe aktiv war.<br />
Und es klappte! In einem Brief aus Bourges gab Fernand an, an welchem Tag und welcher Uhrzeit<br />
Paul sich mit Victor Daum im Hintersaal einer Kneipe treffen sollte. Als Erkennungszeichen sollte<br />
Victor Daum, in marineblau gekleidet und einen Gehstock aus Bambus in der Hand, ein Vichy-<br />
Fraise (Vichy-Mineralwasser mit Erdbeersaft) konsumieren. Paul erschien zur genannten Zeit und<br />
15
stellte mich bei Victor vor. Es brauchte noch einige Zeit, um einen Passeur, einen Fluchthelfer, zu<br />
finden, und am vorgesehenen Tag nahm ich den Zug nach Bourges, wo ich beim Ehepaar Daum<br />
und deren drei jungen Söhnen untergebracht wurde. Ich schlief im Bett des jüngsten, der wie sein<br />
Vater und seine Mutter redselig, lustig und rothaarig war. Die Stimmung war bestens. Am<br />
gleichen Abend vernahmen wir über den BBC-Rundfunk, dass Rudolf Heß, der sich eingebildet<br />
hatte, einen imaginären, separaten Frieden mit England schließen zu können, mit dem Fallschirm<br />
über Schottland abgesprungen war. Wir wissen, wie es weiterging.<br />
Eine junge Grundschullehrerin, die in direkter Verbindung mit dem Fluchthelfer stand, kam zu<br />
uns. In der Nacht sollte es los gehen. Genau beschrieb sie uns den Weg, um zum Treffpunkt,<br />
einem Haus am Dorfrand in Trouy, zu gelangen. Daum begleitete mich bis zum Ortseingang. Als<br />
ich ein letztes Mal zurückblickte, sah ich wie er, auf seinen Gehstock aus Bambus gestützt,<br />
wartend zuschaute bis ich von der Dunkelheit umgeben war. Erst 1946 sollte ich ihn wiedersehen,<br />
denn auch er wurde deportiert. Nach meiner Flucht wurde er mehr und mehr aktiv in der<br />
Widerstandsbewegung und eines Tages wurde er gefasst. Er überlebte die Deportation und die<br />
Gefangenschaft im KZ und nach der Befreiung wurde er zum Staatskommissar in Nîmes ernannt.<br />
Er schließ seine Karriere als Generalinspektor des Öffentlichen Bildungswesens ab. In seiner<br />
Geschichte, die in der Sammlung der Straßburger Augenzeugenberichte aufgenommen und nach<br />
dem Krieg von der Universität herausgegeben wurde, beschreibt er auf besonders pikante Art und<br />
Weise den Vorgang des Latrinendienstes im KZ.<br />
Frau Daum hatte mir ein Säckchen Pfeffer mitgegeben, denn die Grundschullehrerin hatte mich<br />
gewarnt: Die einzige unvorhersehbare Gefahr könnte von einer Sonderpatrouille mit Hunden<br />
ausgehen. Ohne Zwischenfälle fand ich das Haus des Fluchthelfers, der über meine<br />
Personenbeschreibung Bescheid wusste.<br />
Bei Nacht gingen wir fort. Nach einigen Minuten Marsch gab er mir die genaue Richtung an und<br />
zeigte mir, etwa dreihundert Meter entfernt, die Stromkabine, an der ich rechts vorbeigehen sollte.<br />
Dahinter war die freie Zone. Den weiteren Weg ging ich allein, den Rest des Pfeffers hinter mir<br />
ausstreuend. Plötzlich, auf gut hundert Metern hinter der Elektrizitätskabine stand ich Auge in<br />
Auge mit einem Wachposten mit Bajonett… der Französischen Vichy-Armee. Das gab mir die<br />
Sicherheit, dass ich mich in der freien Zone befand. Anscheinend fand der brave Mann es als<br />
selbstverständlich, mich dort zu treffen. Er zeigte mir den Bauernhof, wo ich in der Scheune<br />
pennen konnte, was ich dann auch tat.<br />
Morgens, nach dem Aufwachen, ging ich mich bei den Eigentümern vorstellen. Sie hatten mich<br />
kommen gehört und wussten, dass ich in der Scheune geschlafen hatte. Bevor ich weiterzog, sollte<br />
ich doch etwas zu mir nehmen, das waren sie so gewohnt. Ich hatte schon Mühe gehabt, dem<br />
Passeur einen 100-Francs-Schein in die Hände zu drücken (der damalige Monatsgehalt betrug<br />
etwa 1200 FF), aber diese Landwirte lehnten jede Form von Entgeld, sowohl für die Übernachtung<br />
als auch für das Chicorée-Milch-Brot-Butter-Frühstück, entschieden ab. Sie zeigten mir die Route<br />
nach Issoudun, Departement Indre. Unterwegs dachte ich an den Untersuchungsrichter Mischlich<br />
und kam zu der Meinung, er hätte sich mir, auf diesem Fluchtweg anschließen sollen. Dann hielt<br />
ein Citroën Traction Avant, auf meiner Höhe an. Ein junges Paar bot an, mich nach Issoudun<br />
mitzunehmen. Im Verlauf des Gesprächs merkte ich, dass sie verstanden hatten. Auf halber<br />
Strecke hielt der Fahrer bei einem Werk an, zeigte auf ein Büro und bat mich, dort die<br />
«Aktentasche des Monsieur Bureau» abzuholen. Dann fuhr er weiter und beim Ortseingang von<br />
Issoudun erklärte er mir den Weg zum Kolleg. Drei Jahren später traf ich André Bureau wieder,<br />
nämlich im Konvoi der Deportierten vom 29. April 1944, von Compiègne aus erst nach Auschwitz,<br />
dann weiter, über Buchenwald, nach Flossenbürg, wo wir am 25. Mai 1944 landeten. Im Herbst<br />
1944 starb André völlig erschöpft im KZ Flossenbürg.<br />
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich davon wusste, aber der Vorsteher des Zaberner<br />
Kollegs, unser damaliger Französischlehrer in der Abschlussklasse, war nach Issoudun berufen<br />
worden. Auf meinem Weg nach Clermont machte ich Halt im Kolleg, aber er war abwesend. Seine<br />
Frau, Madame Drion, die mich sehr freundlich empfing, sorgte für die erste Enttäuschung. Seit<br />
Lunéville waren mir nur Leute begegnet, die ernsthaft darüber nachdachten, wie sie - in<br />
Erwartung des Kriegsendes - solidarisch gegen den Feind kämpfen könnten. Das war eine<br />
stillschweigende Bejahung der Politik des De Gaulles, des Gaullismus. Aber Frau Drion erzählte<br />
von ihrem Ehegatten und dass dieser der Politik des Marschalls Philippe Pétain voll vertraute und<br />
16
ihr zustimmte, denn Letzterer würde uns helfen, das Unheil zu überstehen. Mein Erstaunen sollte<br />
bald aufhören, denn, einmal in Clermont eingelebt, musste ich feststellen, dass die übergroße<br />
Mehrheit im sogenannten Freien Frankreich auf der Seite von Pétain stand, nicht Gaullist sondern<br />
Pétainist war.<br />
Der Schulvorsteher, zwei Meter groß mit Vollbart, ein «Alter Kamerad» von 1914-18 - übrigens<br />
ein hervorragender Lehrer und nebenbei auch Schriftsteller - war von Zabern nach Issoudun<br />
ausgewichen. Bei einem Treffen in Clermont mit einigen seiner ehemaligen Schüler - unter denen<br />
auch ich anwesend war - im darauffolgenden Jahr 1942 hielt er, das Abzeichen der Vichy-Legion<br />
zur Schau tragend, eine regelrechte Predigt über die Glückseligkeit unter der Führung des<br />
Marschalls. Ich hatte mich bereits daran gewöhnt, denn wie viele andere Geflüchtete wurde ich<br />
von sonst hervorragenden Leuten eingeladen und empfangen, um dann zu erfahren, dass für<br />
diese Leute das Elsass-Lothringen nur ein Klischee war, geehrt und geachtet… unter der<br />
Bedingung, keinen Kritik an dem Vichy-Regime zu äußern. Bei mehreren dieser Begegnungen<br />
hätte ich Anlass zu meiner Festnahme geben können. Es war nicht der Sieg der Deutschen, den sie<br />
sich wünschten. In einer Stimmung der Resignation, mit einem Schuldgefühl nach den Fehlern,<br />
die die Niederlage herbeigeführt hatten, bei manchen dazu noch ein alter hartnäckiger und<br />
überholter Groll gegenüber Großbritannien, das uns diese Misere bereitet hatte, betrachteten sie<br />
den Aufruf des De Gaulles als unnütz, sogar schädlich.<br />
Ein Beispiel: Madame Mounier. Frau Mounier, Witwe eines 1922, infolge seiner<br />
Kriegsverletzungen verstorbenen Arztes,deren Tochter zusammen mit mir an der Jurafakultät<br />
studierte, stellte mir ihr Wochenendhaus zur Verfügung, sodass ich mich dort, unter anderem, mit<br />
Lebensmitteln versorgen konnte. Noch im November 1942 betrachtete sie das Versenken der<br />
Kriegsflotte im Hafen von Toulon als eine hervorragende Kriegshandlung.<br />
Aber zurück nach Clermont in 1941, wo ich an der Jurafakultät eingeschrieben wurde. Mit einer<br />
ironischen Miene schob der Sekretär mir ein “überraschendes“ Dokument zu, mit der Bitte den<br />
“Papierkram“ zu unterschreiben. Es war eine eidesstattliche Erklärung, mit der ich versicherte,<br />
weder Mitglied des Großostens noch der Freimaurergroßloge Frankreichs zu sein. Im Freien<br />
Frankreich nahm das Vichy-Regime seinen Lauf.<br />
Ich sollte mich ebenfalls bei der Demobilisierungsbehörde melden, um dort meine Situation und<br />
die Angaben in meinem Wehrpass, den ich seit meinem Abschied vom Elsass bei mir trug und bis<br />
heute aufbewahrt habe, regularisieren zu lassen. Es wurde vermerkt, dass meine Mobilmachung<br />
am 14 Juni 1940 stattgefunden hatte und dass ich mich am 19. Juni immer noch in Gefangenschaft<br />
befand! Na ja! Paradoxerweise sollte ich, in meiner Eigenschaft als geflohener Kriegsgefangener,<br />
auch bei der einzigen Zentralbehörde des Hoheitsgebiets (C.A.T. Centre d’Administration<br />
Territoriale) in Lyon vorstellig werden. So nahm ich den Zug Vichy-Clermont-Lyon, um eine<br />
durchaus banale Reise anzutreten, wenn ich bei der Abfahrt im Bahnhof zu Clermont nicht eine<br />
unerwartete Begegnung gehabt hätte. Ich war frühzeitig angekommen und hatte mich in einem<br />
Abteil erster Klasse installiert. Im gleichen Abteil unterhielten sich zwei Personen, ein Mann in<br />
Zivilkleidung, der den anderen, in Soutane, mit “Monseigneur“ anredete. Den Zivilisten erkannte<br />
ich als Generalinspektor Schlienger, den ich in den Vorkriegsjahren, während meiner Schulzeit im<br />
Zaberner Kolleg öfters bei seinen Inspektionsbesuchen in unserer Einrichtung erlebt hatte.<br />
Ich stellte mich vor als einen von ihm inspizierten aber nicht immer besten Schüler! Darauf folgte<br />
ein herzliches, fast amüsantes Gespräch, dem Monseigneur mit offensichtlicher Sympathie<br />
zuhörte. Als sie das Abteil verließen, sagte mir der Kirchenvater: «Junger Freund, ich bin Abt<br />
Vincent, Professor der Religionsgeschichte an der Fakultät für Theologie. Ich wohne im “Château<br />
Rouge“, Avenue Charasse, und ich würde mich freuen, wenn Sie mich, während ihres Studiums in<br />
Clermont, aufsuchen würden.». Daraus entstand eine Freundschaft, anfangs nur schüchtern, dann<br />
allmählich vertraulicher und, ab 1943, ausschlaggebend für meinen Eintritt in die<br />
Widerstandsbewegung. Aber so weit sind wir noch nicht.<br />
Abt Vincent hatte den Rang des Prälats, war zweifellos reich, jedenfalls konnte er sich eine<br />
Haushälterin leisten. Seine Aufgabe des Feldgeistlichen unter Marschall Lyautey in Marokko<br />
hatte ihm eine gewisse Haltung und viele Beziehungen eingebracht. Die Tochter und der<br />
Schwager des Generals Georges dinierten des Öftern bei ihm. Jedoch war er, wie fast die gesamte<br />
Bourgeoisie von damals, klar und offen Pétainist bis an dem Tag in November 1942, an dem die<br />
17
Amerikaner in Marokko landeten. Ich kann mich noch an eins unserer wöchentlichen Diners bei<br />
ihm erinnern, ein Essen im Mai 1942, bei dem eine Diskussion mit dem Sohn des Straßburger<br />
Bankiers Asch und dessen (katholischer) Frau lief. Der Abt war fest davon überzeugt, dass die<br />
Engländer uns Madagaskar, das sie gerade mit Gewalt eingenommen hatten, nie zurückgeben<br />
würden, während Asch und ich ihm erklärten, dass die Briten die Bucht Diego Suarez unbedingt<br />
brauchten, um ihre Präsenz im Indischen Ozean zu stützen, denn die Japaner hatten ihnen dort<br />
schwere Niederlagen zugefügt.<br />
Kurz gesagt: der Krieg machte keine Fortschritte. Großbritannien kämpfte immer noch allein<br />
gegen die Deutsch-Italienische Allianz. An der Universität, unter dürftigen materiellen<br />
Bedingungen und in einer dürftigen Atmosphäre, arbeitete ich weiter an den Vorbereitungen<br />
meiner Licence der Rechtswissenschaften. Ich hätte zwar ein gutes Mietzimmer in einem Neubau<br />
am Stadtrand beziehen können, aber in den Stunden vor und nach den Vorlesungen war ich nicht<br />
oft dort, denn die Versorgung mit Lebensmitteln nahm den größten Teil meiner Freizeit in<br />
Anspruch, auch wenn ich der glückliche Besitzer eines Fahrrads war, das meine Eltern über die<br />
Binnengewässer hatten herüberschmuggeln lassen. Trotz des guten Willens der Sozialeinrichtung<br />
der Universität erhielt man mit den in der Mensa ausgehändigten Lebensmittelscheinen nur die<br />
fürs Überleben strikt notwendige Nahrung. Wie viele andere Alleinstehende hatte auch ich<br />
ständig ein Hungergefühl im Bauch. Überdies - ich möchte es hier einmal für immer sagen, in aller<br />
Bescheiden- und Offenheit - interessierten mich das Studium und die berufliche Zukunft nur an<br />
zweiter Stelle, jedenfalls solange wir unter der Gewaltherrschaft der Angreifer leben mussten. Die<br />
Mehrheit meiner Kameraden, Jungen und Mädchen, ob nun aus dem Elsass oder aus der<br />
Auvergne, reagierten nach außen hin völlig anders, büffelten verbissen weiter und, wenn das<br />
Thema zur Sprache kam, schienen sie sich gar nicht um das Los unseres Staates zu sorgen.<br />
Dritter Sonntag im Juni 1941. Ich weiß nicht mehr, ob es nun am 20. oder am 22. Juni war, aber<br />
das ist nicht so wichtig. Der Morgen der Sommersonnenwende war strahlend. Ich lag im Bett,<br />
wach seit fünf Uhr morgens, spürte das fast ständige Hungergefühl im Bauch und überlegte, ob<br />
ich meine zwei Zweibackstücke jetzt oder erst später essen sollte. Einen Rundfunkempfänger hatte<br />
ich noch nicht, brauchte ich auch nicht immer, denn das Gerät der Nachbarn im Stockwerk über<br />
mir brüllte mir regelmäßig die Nachrichten herunter. In den Sechs-Uhr-Nachrichten von Radio<br />
Vichy kam die Meldung: «Seit heute Morgen um drei Uhr ist Deutschland in den Krieg gegen<br />
Sowjetrussland eingetreten»!<br />
Mit einem Satz, einem Freudensprung, war ich aus dem Bett. Der Konflikt nahm eine neue<br />
Wendung und der Hunger war mir vergangen! Seit Herbst 1940, Ende Oktober, als ich mich noch<br />
in Heidelberg aufhielt, hatte ich keine Aussichten mehr auf ein mögliches Kriegsende, sah nicht<br />
wie Deutschland den Krieg noch gewinnen könnte. Nazi-Deutschland hatte England nicht erobern<br />
können, trotz der “Vorinvasion“ in Norwegen am 9. April 1940, wodurch die Neutralität des<br />
Landes zunichte ging. Auf der anderen Seite wusste ich noch weniger, wie Deutschland den Krieg<br />
verlieren sollte, denn - jedenfalls vor dem 22. Juni 1942 - war Nazi-Deutschland auf der Ostflanke<br />
durch das Schild des Hitler-Stalin-Pakts vom 23. August 1939 geschützt. Jetzt nahm die Situation<br />
eine, nach meiner Ansicht entscheidende Wende, denn sofort nach dieser Meldung in den<br />
Nachrichten hatte ich die Vorahnung, die Sicherheit, dass der Russlandfeldzug als<br />
Abnutzungskrieg verheerende (ver - Heer - Ende, wie das Wort es sagt) Folgen haben würde. Die<br />
späteren Ereignisse sollten dies bestätigen.<br />
So verging die Zeit, aufgeteilt zwischen der Universität und der Versorgung mit Lebensmitteln,<br />
zwischen dem heimlichen Radiohören (ich hatte einen Empfänger gefunden) und den Gesprächen<br />
mit den Flüchtlingen aus Elsass-Lothringen in der «Académie de Billards», Place Chapelle de<br />
Jaude («Académie des Bobards», Akademie der Lügenmärchen - dixit Prof. Vincent). Im Lauf des<br />
zweiten Halbjahrs 1941, umgeben von einer betrügerischen Atmosphäre des rein intellektuellen<br />
Widerstands, kam ich allmählich zu der Überzeugung, dass ich später, nach dem Krieg, noch für<br />
den Rest meines Lebens ausreichend Elsässern begegnen würde und es in jenem Augenblick<br />
sinnvoller wäre, die Gelegenheit zu nützen, um weitere und tiefere Kontakte mit anderen<br />
Landsleuten zu knüpfen, mit Franzosen, die sich sowohl sich aus der Auvergne als auch aus den<br />
anderen Teilen Frankreichs in Clermont zahlreich zusammengefunden hatten.<br />
18
Der Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg nach dem Japanischen Überraschungsangriff auf<br />
Pearl Harbour am 7. Dezember 1941 gab allen, sowohl den Gaullisten als auch den Pétainisten,<br />
neuen Mut, für einige endgültig, für andere zum ersten Mal. Man wurde sich bewusst, dass der<br />
Krieg, nun Weltkrieg, nur noch mit der endgültigen Niederlage des Dritten Reichs ausgehen<br />
konnte. Wir waren jedoch noch weit vom Ziel und in Europa tat sich für uns nichts Erfreuliches.<br />
Das erste Halbjahr 1942 war diesbezüglich wohl eine der trübseligsten und moralisch<br />
schwierigsten Perioden unter der feindlichen Besatzung. An der Westfront hatten die deutschen<br />
Panzerschiffe «Scharnhorst» und «Gneisenau» den Hafen von Cherbourg in der Spitze der<br />
Normandie verlassen, den Ärmelkanal vor den Augen der Engländer durchquert und in Narvik,<br />
im Norden Norwegens, angelegt. Das Panzerschiff «Hume» der Home Fleet war mit Hab und Gut<br />
von der «Bismarck» versenkt und Letzterer später, am 27. Mai 1941, von der britischen<br />
Kriegsmarine torpediert worden. In Fernost hatten die Briten die 42 000 Tonnen schwere<br />
«Repulse» sowie die neue 35000 Tonnen schwere «Prince of Wales» unter japanischem Feuer<br />
verloren. Die Japaner hatten die gesamte Flotte der holländischen Torpedoabwehrboote<br />
vernichtet, sodass den Japanern der Weg zum Malaiischen Archipel, der Insulinde, geöffnet war<br />
und diese dann auch sofort besetzt wurde. An der Ostfront war die Wehrmacht weiter in Russland<br />
eingerückt, kurz vor Moskau und Leningrad knapp gestoppt und fast umzingelt worden. Der<br />
Stalingrader Zusammenbruch sollte erst im Winter 1943 die Entscheidung im Russlandfeldzug<br />
herbeiführen.<br />
Ich verging fast vor Ungeduld, denn ich hatte noch keinerlei Verbindung zum aktiven<br />
Widerstand. Die langen Sommerferien an der Universität, von Juni bis November, standen bevor.<br />
In den Monaten Juli und August fand ich einen Ferienjob bei der Ernte in der Nähe von Rochefort-<br />
Montagne, westlich von Clermont-Ferrand, und konnte ausspannen. Es wurde von fünf Uhr<br />
morgens bis sieben Uhr abends geschafft, dafür dann auch fünf mal gegessen! Ende August 1942<br />
kehrte ich nach Nancy zurück. Das ging eigentlich ziemlich einfach, denn seit Laval, unter Druck<br />
der Nazis, im April 1942 wieder an die Macht gekommen war und seine Hoffnung auf den Sieg<br />
des Dritten Reichs geäußert hatte, war der Übergang über die Demarkationslinie gelockert<br />
worden. Es wurde sogar ein Ferienkonvoi von Clermont und Moulins nach Nancy eingerichtet,<br />
obwohl Nancy für die in den Süden geflüchteten Studenten eigentlich verbotene Zone war. Im<br />
Sekretariat der Fakultät füllte ich den Papierkram aus und trug ein, dass meine Mutter in Nancy<br />
wohnte. Ich wurde für einen Konvoi, der voraussichtlich im September wiederkehren sollte,<br />
eingetragen. Die Familie war über meine Anreise benachrichtigt worden. Inzwischen war der<br />
Fluchtweg zwischen dem Departement Meurthe-et-Moselle und Lothringen besser organisiert als<br />
im Frühjahr 1941.<br />
Zweimal überquerte ich mit dem Passeur diese Grenze, im Sektor Dieuze, an einer ganz genau<br />
bestimmten Stelle zu einer ganz genau bestimmten Zeit, nämlich zwischen zwei Kontrollgängen<br />
der Patrouillen. Beim Übergang begleiteten wir zwei oder drei Gefangene, die von einem vorigen<br />
Fluchthelfer auf einem Bauernhof versteckt und von uns, zwischen zwei Patrouillen, zu einem<br />
Haus in einem «französischen» Dorf in Meurthe-et-Moselle geführt wurden. Dort stiegen sie<br />
anderntags ganz einfach in den Bus und fuhren nach Nancy, wo sie von der Organisation über<br />
den Fluchtweg durch den Jura geleitet wurden.<br />
Ich sollte am 27. August zum dritten Übergang wieder erscheinen. Ich kannte die Strecke und<br />
Uhrzeiten, konnte also allein handeln. Es gab nur noch einen Flüchtling abzuholen. In Nancy<br />
nahm ich den Bus bis zum letzten Dorf vor der Grenze. Wie vereinbart war Diedenhofer, so hieß<br />
mein Passeur, bereits auf der anderen Seite. Zwischen zwei und drei Uhr nachts stieg ich, genau<br />
an der üblichen Stelle, über den Stacheldrahtzaun. «Halt!» Vor mir, auf dem Weg, stand ein<br />
Wachposten, der sich dort eigentlich nicht zu befinden hatte, das Gewehr auf mich gerichtet.<br />
Seinem Begleiter gab er den Auftrag, mich - bei gehobenen Händen - zu durchsuchen, dann - die<br />
Waffen immer noch auf mich gerichtet - begleiteten sie mich zum Militärposten im Dorf. Ein<br />
bewaffneter Unteroffizier bewachte mich für den Rest der Nacht, ohne Brutalitäten, ohne Fragen.<br />
Ich hätte sogar schlafen können, so gab er mir zu verstehen, aber dazu war ich aufgrund meines<br />
Schreckens nicht in der Lage. Am frühen Morgen, in meiner Gegenwart, nahm er telefonisch<br />
Kontakt mit der Gendarmerie in Drieuze auf, um mitzuteilen, dass ein junger Elsässer auf dem<br />
Weg von Frankreich nach Deutschland festgenommen worden war. Ich sollte zur Gendarmerie<br />
gebracht werden. Zwei Feldgendarmen holten mich mit dem Wagen ab und fuhren mich zu ihrer<br />
19
Dienststelle. Während der schlaflosen Stunden der vergangenen Nacht hatte ich die Zeit, mir<br />
einen Erklärungsversuch zusammenzureimen. Vielleicht gab es doch eine Möglichkeit,<br />
davonzukommen, denn bei meiner Festnahme hatte ich keinen Flüchtling bei mir. Ich konnte<br />
ihnen also meine Geschichte erzählen und diese Geschichte hatte ich bereits - für alle Fälle -<br />
vorbereitet: der Trick mit dem Mädel. Anfang des Krieges hatte ich in Zabern ein Mädchen<br />
kennengelernt und sie später in das Geheimnis meiner Flucht im April 1941 eingeweiht. Im Juli 42<br />
war es mir gelungen, ihr eine Nachricht zukommen zu lassen, sie über meinen Fluchtversuch und<br />
einen Besuch bei ihr zu informieren. Die Botschaft wurde weitergeleitet, denn ich erhielt sofort<br />
eine Antwort von ihr, indem sie an geflüchtete Freunde in der besetzten Zone schrieb, sich über<br />
meinen Fluchtversuch wunderte und mir davon abriet. Als die Gendarmen mich an dem Morgen<br />
in Drieuze vernahmen, nannte ich also meinen richtigen Namen und erklärte ihnen, dass ich die<br />
Gelegenheit, die die Ferien mir boten, wahrnehmen wollte, um meine «Braut» in Zabern<br />
aufzusuchen; seit der Mobilmachung in Juni 1940 war ich ohne Nachricht von ihr. Das war<br />
ziemlich gewagt, denn logischerweise würden sie meine Aussagen überprüfen und konnten dabei<br />
meine Flucht im April 1941 aufdecken, was für mich die Internierung bedeuten würde. Für mich<br />
war ein solches Risiko viel weniger schwerwiegend als die Entlarvung als Glied in einer<br />
Fluchtorganisation. Die Feldgendarmen tippten ihren Bericht in diesem Sinn und riefen in meinem<br />
Beisein die Gestapo in Metz an, um nähere Befehle zu meiner Überführung einzuholen.<br />
Ich hatte noch nicht begriffen, was nun eigentlich passiert, was wohl schiefgelaufen war. Erst ein<br />
Monat später, als ich wieder in Nancy eingetroffen war - wie ich dahin kam, erzähle ich später -,<br />
erfuhr ich, dass Diedenhofer wohl gemerkt hatte, dass die Wachmannschaften und die<br />
Patrouillezeiten geändert worden waren. In aller Eile hatte er Alarm geschlagen, um mich<br />
zurückzuhalten. Zu spät, denn ich war bereits seit mehreren Stunden unterwegs und man konnte<br />
mich nicht mehr vor der Grenze einholen. Dazu muss man wissen, dass zu der Zeit keine Autos<br />
und nur wenige Busse mit Holzvergaser zur Verfügung standen und die Fahrräder mit<br />
abgefahrenen Reifen konnten kaum zur Beschleunigung der Informationsvermittlung beitragen.<br />
Von einem Gendarmen wurde ich in einen Schuppen geführt, den er sorgfältig abschloss. Ich<br />
hatte noch nichts gegessen, nichts getrunken bei drückender Hitze. Als ich den Deckel hochhob,<br />
stieg aus der Latrine ein scheußlicher Geruch auf. Der Gendarm, ein Lothringer Zwangssoldat,<br />
hatte mir, bevor er mich einsperrte, eine Zigarette gegeben und angezündet. Das gab mir auch<br />
Mut, ihn um Wasser zu bitten. Er stimmte zu, kam aber erst abends spät und reichte mir eine<br />
Flasche durch die Gitterstäbe. Ich trank nur schluckweise, bevor ich mich auf die einfache Liege,<br />
unter eine beschmutzte Decke legte.<br />
Ich weiß nicht mehr, wann man mich anderntags wecken kam, um mich zur Gendarmerie zu<br />
führen. Angeblich hatte ich Recht auf ein komplettes Frühstück - Kaffee, Milch, Butterbrote -, das<br />
mir unwillig und gehässig von der Ehefrau des Gendarmerieobersten aufgedeckt wurde und ich<br />
im Stehen verspeisen dürfte. Darauf befahl der wachhabende Gendarm mir, die Hosenträger<br />
abzulegen, und erklärte mir, dass diese Maßnahme mich daran hindern sollte, fortzulaufen und<br />
die Flucht zu ergreifen. Großzügig versprach er, mir keine Handschellen anzulegen, aber mich<br />
beim ersten Anzeige eines Fluchtversuchs sofort zu erschießen. Wir fuhren im Auto zum Bahnhof<br />
von Drieuze, wo wir den Bus nach Metz nahmen. Dort, nachdem ich wieder in den Besitz meiner<br />
Hosenträger gekommen war, begleitete der Gendarm mich zur Gestapo, die in einem großen<br />
Polizeikommissariat, auch Polizeigefängnis genannt, untergebracht war. Während der Stunden<br />
Wartezeit vor meiner Vernehmung, konnte ich mir ein Bild machen von dem, was sich im<br />
Vernehmungsraum abspielte. Lärm von Schlägen, Schreien, Stöhnen… Dann und wann wurde ein<br />
blutender Verhafteter mit blauen Flecken und Blutergüssen abgeführt. Ein neuer wurde<br />
hineingebracht. Es handelte sich um Fälle für die sogenannte “politische“ Polizei, also die S.D.<br />
Sonderdienst, anderer Name der Gestapo: Dienstverweigerer, Saboteure, Flüchtlinge… . aber<br />
keine Verbrecher des gemeinen Rechts, denn die wurden vor dem ordentlichen Gericht<br />
vernommen und verurteilt und ins Gefängnis eingesperrt. Was mir auffiel war die Nationalität:<br />
sehr viele Polen. In Lothringen, vor dem Zusammenbruch in 1940 eine Gegend mit vielen<br />
Bergwerken und Stahlindustrie, gab es in der Tat eine große polnische Gemeinschaft. Bei der<br />
Annektierung aufgegriffen wurden diese Polen nicht in die Freie Zone abgesetzt, wie es für viele<br />
ansässige Moselaner der Fall war, sondern fielen den systematischen Verfolgungen vor Ort zum<br />
Opfer, nur weil sie als Polen geboren waren. Mehrere von ihnen waren im Nebenraum eingesperrt<br />
20
und als die Tür dann und wann geöffnet wurde, sah ich sie, wie Skelette, völlig gebrochen nach<br />
einer monatelangen Haft. Ich hörte Gesprächsfetzen der Polizisten und erfuhr, dass sie nur jeden<br />
zweiten Tag zu essen bekamen, dass sie donnerstags überhaupt nicht zu essen bekamen. Sie<br />
waren der Willkür der Gestapo völlig ausgeliefert.<br />
Zu der Zeit funktionierte die Justizbehörde mehr oder weniger normal. Die Verwaltungsbeamten,<br />
Richter und Staatsanwälte, erfüllten ihr Mandat unter Anwendung der deutschen<br />
Justizorganisation. Die Mehrzahl der Magistrate waren dieselben - und gerade diejenigen - die<br />
bereits 1939 unter der französischen Gesetzgebung im Amt waren. Abgesehen von seltenen<br />
Ausnahmen, wie Mischlich, waren sie nach der Niederlage im Juni 1940 im Amt geblieben oder<br />
hatten, nach ihrer Befreiung als Elsässer oder Lothringer, ihr Amt wieder angetreten.<br />
Ich wurde aufgerufen. Der Polizist las den Bericht der Gendarmerie vor und sagte mir, dass ich<br />
demzufolge verhaftet und eingesperrt würde. Drei Minuten später, nachdem ich wegen des Lärms<br />
beim Durchqueren des Raums angeschnauzt wurde, fiel die Tür der Zelle hinter mir ins Schloss<br />
und ich befand mich inmitten eines Dutzends von Gefangenen, alle wegen Verstoßes gegen die<br />
Aufenthalts-, Arbeits- oder Reisevorschriften eingelocht.<br />
In den fünfzehn darauffolgenden Tagen wurde ich vom Hunger zernagt und von Läusen befallen.<br />
Dieser Aufenthalt erlaubte es mir jedoch, mir im Nachhinein ein genaueres Bild vom Los eines<br />
anderen, nahen Kameraden zu machen: André Royer wurde dort, 1943, wochenlang eingesperrt,<br />
nachdem er vom Eisenbahnkonvoi abgesprungen war, danach im besetzten Gebiet der Mosel<br />
gefasst und später nach Buchenwald abgeführt wurde.<br />
So etwa am zehnten Tag wurde ich aus der Zelle geholt und zur Vernehmung - ohne Gewalt - in<br />
einen Büroraum geführt. Es war mir bewusst, dass dort mein Schicksal bestimmt werden sollte.<br />
Ich erklärte, dass ich anlässlich der Kampagne Mai-Juni 1940 in die Französischen Armee<br />
einbezogen wurde, dass ich bei den Gefechten auf dem Rückzug dabei war, dass ich zusammen<br />
mit meiner Einheit bis in die nicht-besetzte Zone geraten war, dass ich nach der Niederlage nicht<br />
nach Zabern zurückgekehrt, sondern nach Clermont geflüchtet war und während der Ferien<br />
meine Braut in Zabern aufsuchen wollte. Nachdem dies mit der Schreibmaschine zu Protokoll<br />
genommen war, rechnete ich damit, in Hinblick auf weitere Ermittlungen, über die sogenannte<br />
“Braut“ befragt zu werden. Nichts davon. Der Gestapomann erklärte mir ganz einfach, dass, wenn<br />
ich unter solchen Bedingungen meine Braut sehen wollte, ich sie nicht sehen sollte und statt<br />
dessen vor das Gericht geführt würde, nämlich wegen… Grenzverletzung. Eigentlich konnte ich<br />
mir nichts Besseres wünschen, wenn das ja stimmen würde.<br />
Tatsächlich konnte ich mir in dem Fall - nach Urteil - sicher sein, über die Grenze nach Meurtheet-Moselle<br />
abgeschoben zu werden. Es blieb noch die willkürliche und in der Zeit unbestimmte<br />
Haft zu befürchten. Das Schlimmste, die Verurteilung vor einem Sondergericht wegen Hilfe zur<br />
Flucht eines Verhafteten, blieb mir erspart. Zurück in meiner Zelle war ich allein, meiner<br />
Verzweiflung überlassen, ohne Landesgenossen, denen ich mich anvertrauen konnte. Obwohl…<br />
es gab in Nancy noch Jacques Dubach, einen Uhrmacher aus Forbach. Vor dem Krieg war er am<br />
Kolleg in Forbach, Departement Mosel, Schüler eines jüngeren Vetters meines Vaters, des Lehrers<br />
Camille Wollbrett. Das konnte nicht erfunden sein. Auch ihm wurde Grenzverletzung<br />
vorgeworfen und auch er rechnete damit, abgeschoben zu werden. Er gab mir seine Adresse in<br />
Nancy, wo ich ihn aufsuchen sollte, falls wir beide davon kämen.<br />
Eines Nachmittags gab es einen Appell und ich wurde vom Polizisten aus meiner Zelle geholt.<br />
Zusammen mit anderen Gefangenen wurde ich, zu Fuß und ohne Handschellen, von einem<br />
einzigen, mit einem kleinen armseligen 6,35 bewaffneten Polizisten zum Gericht geführt.<br />
Allmählich, nach zwei Wochen inmitten von Leid und Verzweiflung, bekam ich ein Gefühl der<br />
Sicherheit. Nach zwei Stunden Wartezeit in einem mit Vorhängeschloss abgesperrten Raum, über<br />
einen endlosen Flur in einen Gerichtssaal, vor zwei deutsche Magistrate, einen Mann und eine<br />
Frau, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, geführt, wurde mir das Urteil gesprochen: aufgrund der<br />
Grenzverletzung und gemäß eines Artikels des deutschen Strafgesetzes wurde ich zu zwei<br />
Wochen Haft verurteilt, in der Folge unter Aufsicht der Sicherheitspolizei - der Gestapo - gestellt.<br />
Ich traute mich nicht, mir die Bedeutung des letzteren Satzes mit Bezug auf die “Aufsicht“<br />
21
genauer erklären zu lassen, befragte jedoch die Richter bezüglich der Anwendung der deutschen<br />
Gesetzgebung in Elsass-Lothringen. Die Antwort war, dass gerade vor zwei Wochen der<br />
rechtmäßige Transfer der Gerichtsbarkeit stattgefunden hatte!<br />
Ab in den Gefangenenwagen, zusammen mit den vor dem Sondergericht erschienenen<br />
Angeklagten. Es gab sogar einen, der freigesprochen wurde, und beim Eintreffen im Gefängnis<br />
wurde er in der Tat von seinen Fesseln befreit. Also saß ich meine zwei Wochen ab, denn die<br />
Untersuchungshaft bei der Gestapo wurde nicht berücksichtigt. Dreierzelle, Kälte, Hunger,<br />
Gefängnistratsch… Nur die Verbrecher des gemeinen Rechts hatten Ausgang… für Arbeiten<br />
außerhalb des Gefängnisses. Wir wurden für die internen Angelegenheiten aus der Zelle geholt,<br />
d.h. hauptsächlich, gemeinsam mit anderen Häftlingen an einen großen Tisch, zum Auslesen des<br />
trockenen Gemüses und der Abfälle für die Gefängnisküche. Dabei fielen mir aus zwei<br />
verschiedenen Gründen zwei Mithäftlinge und -sortierer auf. Der erste, Nicolaï, ein Lothringer<br />
trug die Uniform der Reichsbahn. Die Organisation der Eisenbahnen des Dritten Reichs stand der<br />
Militärmacht in ihrer Gesamtheit zur Verfügung und die Wehrmacht hatte das Eisenbahnpersonal<br />
bis an die Russlandfront mobilisiert. Nicolaï war von den Horrortaten, deren Augenzeuge er dort<br />
wurde, schockiert und als er in den Urlaub zurück nach Lothringen geschickt wurde, hatte er<br />
versucht, in Uniform, «in den falschen Zug zu steigen» und nach Metz zu fliehen. Es war ihm<br />
nicht gelungen. Er erzählte mir, dass in der Ukraine, in mehreren Orten, die Wehrmacht die<br />
jüdische Bevölkerung auf ein Gelände außerhalb zusammengetrieben hatte. Auf dem Gelände<br />
waren ringsum Maschinengewehre aufgestellt. Die Soldaten hatten auf die Menschenmenge<br />
geschossen, bis sich nichts mehr bewegte. Es war das erste Mal - und leider nicht das letzte Mal -,<br />
dass ein unmittelbarer Zeuge mir über die systematische Vernichtung der jüdischen Bevölkerung<br />
vor Ort, im russischen Gebiet berichtete. Das war auch die Erklärung dafür, dass ich im KZ<br />
Auschwitz, das ich im Frühjahr 1944 kennenlernen sollte, keine Juden russischer Herkunft traf: sie<br />
wurden systematisch in den eroberten Gebieten ermordet.<br />
Der zweite fiel mir durch seine Diskretion auf. Auf jede Frage antwortete er, dass er nach seiner<br />
Arbeit in Nancy übers Maß getrunken hatte und völlig betrunken in den falschen Zug nach Metz<br />
gestiegen war. Ich ahnte sofort, dass er ein Gefangener auf der Flucht war und er versuchte, die<br />
Spur zu verwischen. Mit Spannung wartete ich das weitere Geschehen ab.<br />
Am Nachmittag des fünfzehnten Tags erschienen mehrere Polizisten, einige in Gestapouniform.<br />
Sie lasen die Namen auf der Liste, die sie mitführten, und wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt.<br />
Ich geriet in die Gruppe mit André Perrier, mit demjenige, der in den falschen Zug eingestiegen<br />
war. Dann verlief alles sehr schnell: Entlassung aus der Haft, Rückgabe der bei der Inhaftierung<br />
beschlagnahmten persönlichen Gegenstände, Einstieg in einen Lkw, Abfahrt über die Straße nach<br />
Nancy. Bei einbrechender Nacht erreichten wir die Demarkationslinie. Neue Kontrolle der Listen<br />
und… Befehlszeichen, nach Frankreich zu flüchten. Wir - Perrier, ich und noch einige - wurden<br />
aus dem Großen Reich ausgewiesen. Perrier gesellte sich zu mir, legte mir den Arm auf den<br />
Schulter und sagte: «Henri, ich bin Bäcker in Aigueperse nah Clermont und befinde mich jetzt,<br />
nach siebenundzwanzig Monaten Haft, wieder auf französischem Boden. Wir waren in der<br />
“richtigen“ Gruppe, denn die anderen, die von den Polizisten in Uniform abgeführt wurden,<br />
waren zweifellos zum Lager in Natzweiler, Departement Bas-Rhin, im Brüchetal mitten in den<br />
Vogesen deportiert worden. Pierre hatte die Idee, beim Bürgermeister der Gemeinde vorstellig zu<br />
werden, um um Hilfe zu bitten (falls ich mich richtig erinnere, war es die Gemeinde Homécourt,<br />
nordwestlich von Metz). Nachdem der gute Mann sich vergewissert hatte, dass wir keine<br />
geflüchteten Kriegsgefangenen waren, ließ er uns nebst einem Stück Brot das nötige Geld für den<br />
Zug nach Nancy geben. Wir schliefen in einem Personenwaggon im Rangierbahnhof und nahmen<br />
morgens den ersten Zug zur Stadt. In Nancy herrschte die Desorganisation: keine Kontrolle beim<br />
Verlassen des Bahnhofs, kein einziger Fahrplan stimmte. Kurz vorher hatten die Briten wichtige<br />
Eisenbahnanlagen bombardiert. Auf der Strecke nach Toul wurde eine schwere, nicht explodierte<br />
Bombe entschärft. Ich nahm meinen Kumpel mit zu den Müllers, die beim Wiedersehen sichtbar<br />
erleichtert waren. Nach einigen kurzen Erklärungen meinerseits bestätigten sie mir, dass der<br />
Fluchtweg auf der lothringer Seite abgeschnitten, zum Süden intakt, aber «ohne Kundschaft» war.<br />
Das war am 28. September 1942. Am gleichen Morgen war der Studentenkonvoi zurück nach<br />
Clermont und Vichy abgefahren. Nun hing ich fest, fast total erschöpft. Ich wog etwa 10 Kilo<br />
weniger als nach den Erntearbeiten von Juli und August in der Auvergne. Und - als ob das alles<br />
22
noch nicht genug wäre - ich war befallen mit Läusen, während sich am Pobacken eine Eiterbeule<br />
bildete. Die Müllers bestanden darauf, mich bei sich zu pflegen, sodass ich mich erholen konnte.<br />
Ich stimmte allem zu, was mir die Gelegenheit gab, André Perrier zum Ende seiner Reise<br />
weiterzuhelfen. André war ein forscher Kerl von fünfunddreißig und hätte, falls es Probleme<br />
geben sollte bei der Passage der Demarkationslinie, ohne weiteres einen Gegner mit einem<br />
Nackenschlag niederschmettern können. Zwei Tage wartete er in einem Appartement auf seine<br />
Verbindung und gelangte dann ohne Zwischenfälle über die Demarkationslinie. Anderntags<br />
suchte ich Jacques Daubach in seinem Uhrengeschäft auf und erzählte ihm die ganze Geschichte.<br />
Wie ich, wie Perrier und andere in der gleichen Situation hatte auch er den Mangel an<br />
Koordination innerhalb der deutschen Dienste nutzen können, denn sonst wären wir, genau so<br />
wenig wie viele andere, nie ins “Alte Frankreich“ ausgewiesen worden. Seit langem in Nancy zu<br />
Hause kannte er alle Kniffe, Lücken und Tücken der Besatzungsmacht und war in einem<br />
kohärenten Netz gegenseitiger Hilfe eingebunden. Wie ich war er der Meinung, dass ich nicht viel<br />
riskieren würde, wenn ich mich bei der Kommandatur als Student-in-Ferien melden würden, um<br />
ihnen zu erklären, dass ich bei meiner Rückkehr aus Toul, nach einem Besuch bei meiner Mutter,<br />
wegen der noch zu entschärfenden britischen Bombe auf der Eisenbahnstrecke nach Nancy den<br />
bereits in die Freie Zone abgefahrenen Studentenkonvoi verpasst hatte.<br />
Ich beschloss dann auch, diesen Versuch zu wagen. Vorerst wurde frische Wäsche besorgt, dann<br />
tauchte ich ins vorgeschriebene Schwefelbad, um die Tierchen zu vernichten (es tauchten sogar<br />
Exemplare von drei Millimetern an der Wasseroberfläche auf). Nachmittags, korrekt gekleidet,<br />
wurde ich vorstellig und achtete darauf, bei der Beschreibung meiner Verwirrung nur französisch<br />
zu reden. Der Unteroffizier von Dienst, strack betrunken, aber korrekt, erwiderte mir, ebenfalls auf<br />
Französisch, dass, wollte ich den Ausweis für die Freie Zone erhalten, ich einen schriftlichen<br />
Antrag, in deutscher Sprache und mit der Schreibmaschine geschrieben, einreichen sollte und<br />
forderte mich auf, in zwei Tagen wiederzukommen. Ohne Schwierigkeiten fand Daubauch sofort<br />
einen Kameraden, der den von mir verfassten Bericht in einer Kürze, wie der deutsche<br />
Militarismus es liebte und schätzte, mit der Maschine schrieb.<br />
Ich brachte meinen Bericht, in vier Exemplaren wie vorgeschrieben, zu demselben Unteroffizier,<br />
der mir befahl, in zwei Tagen zur vorgegebenen Uhrzeit wieder zu erscheinen. Also erschien ich,<br />
nicht ganz beruhigt, nach zwei Tagen eine drittes Mal wieder. Er übergab mir den einmaligen, nur<br />
für kurze Dauer gültigen Passierschein, während draußen eine Menge Leute, von denen ich<br />
bereits mehrere kannte, endlos warteten. So konnte ich im Sitzen - zwar auf einer Eiterbeule -, mit<br />
belegten Brötchen versorgt, keinerlei Risiko ausgesetzt, ohne das Abteil zu verlassen, im Zug nach<br />
Lyon den Passierschein abreißen lassen und im Lyoner Bahnhof in den Zug nach Clermont<br />
einsteigen. Das war am 2. oder 3. Oktober 1942, ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber das Leben<br />
konnte wieder “normal“ weitergehen und zwar einfacher und leichter als während meines ersten<br />
Aufenthalts in Clermont. Die Verbindungen und Kontakte waren gelegt, die Versorgung mit<br />
Lebensmitteln war immer noch knapp, aber besser organisiert, und, nicht zuletzt, hatte die<br />
gesamte Bevölkerung sich eine gewisse Routine angewöhnt. Ich erinnere mich noch, dass für die<br />
Bourgeoisie, die ich frequentierte, das große Ereignis im September 1942 die Wiedereröffnung der<br />
Jagdsaison war.<br />
Im November 1942 befand ich mich in Rochefort-Montagne, südwestlich von Clermont-Ferrand,<br />
im Ferienhaus der Madame Mounier, unweit entfernt von den Bauern, denen ich bei der Ernte<br />
geholfen hatte. Ich erholte mich von meiner mittlerweile vernarbten Eiterbeule und von der<br />
gewaltigen Nesselsuchtkrise, infolge des für meinen entwöhnten Körper zu reichen<br />
Wiedersehensessens. Am Sonntag, dem 8. November, kam der Inhaber des Dorfladens<br />
hereingestürmt: Die Alliierten waren in Marokko und Algerien gelandet! Operation Torch. Er war<br />
entsetzt, denn er wusste schon, dass dieses Ereignis sein nunmehr gewohntes Leben völlig<br />
verändern würde. Ich jubelte! Viele meiner begeisterten Kameraden machten sich etwas vor, als<br />
sie glaubten, der Krieg würde spätestens im nächsten Frühjahr beendet sein! Es dauerte nicht lang<br />
bis, infolge der raschen Ereignisse, die Stimmung der Bevölkerung eine grundsätzliche Wendung<br />
nahm. Zwei Wochen nach der Einnahme von Algier fielen die deutschen Truppen in die Freie<br />
Zone ein. Pétain kam gerade noch dazu, im Rundfunk eine zitterige Protestaktion gegen die<br />
Schändung des Waffenstillstandsabkommens abzugeben. Am 26. November wurden von den<br />
französischen Truppen, in Erwiderung des deutschen Angriffs, Operation Lila, im Hafen von<br />
Toulon zweiundfünfzig Kriegsschiffe versenkt. Von denjenigen, die in den zweieinhalb Jahren<br />
23
immer noch nicht begriffen hatten, dass Deutschland unser Land systematisch ausplünderte,<br />
wurden einigen die Augen geöffnet, während andere hartnäckig weiter glaubten, dass die<br />
Reaktion der Admiralität zu Toulon eine patriotische Handlung darstellte, und sich nur Sorge<br />
über weitere Einschränkungen auf dem Lebensmittelmarkt machten, denn in der Folge fiel die<br />
Belieferung mit algerischen Frühgemüsen aus. Das traf aber auch für die Deutschen zu, die in der<br />
Vergangenheit nicht darauf verzichtet hatten, ihren Teil nach eigenem Gutdünken einzubehalten.<br />
Kaum einer kam auf die Idee, dass diese zweiundfünfzig Marineeinheiten, auf der anderen Seite<br />
eingesetzt, erheblich zum Beschleunigen der späteren Landung und somit zu einem raschen<br />
Kriegsablauf beigetragen hätten.<br />
Beim Abt Vincent war die Stimmung zum Glück umgeschlagen. Seit die Amerikaner in<br />
Nordafrika gelandet waren, war der Abt zum Gaullisten geworden. Endlich konnte ich ihm die<br />
wahren Gründe meiner langen Abwesenheit während des vergangenen Sommers enthüllen. Aus<br />
den bis dann freundschaftlichen Verhältnissen wurden solidarische Bande. In Gegenwart der<br />
Besucher schob er alle Distanz zu mir beiseite. Im Lauf des Winters stellte er mich bei einem<br />
jungen Polizeikommissar vor. Henri Weilbacher war auch Elsässer und kaum etwas jünger als ich.<br />
Er erschien oft, meist nur sehr kurz beim Abt. Wir unterhielten uns in vollem Vertrauen über die<br />
Situation. Insofern er über solche verfügte, gab er uns Auskünfte und Nachrichten über die<br />
Umtriebe des Feinds und interessierte sich für das Geschehen an der Universität und die<br />
Stimmung unter den Studenten. Der Winter 42/43 ging zu Ende. Seit Januar war Stalingrad<br />
Geschichte. Der Druck seitens Nazi-Deutschland, junge Leute zur Zwangsarbeit (S.T.O. Service du<br />
Travail Obligatoire) nach Deutschland zu schicken, wurde allmählich größer.<br />
Abt Vincent hatte Weilbacher darüber informiert, dass es mir gelungen war, aus Nancy einen<br />
geflüchteten Gefangenen, einen Bäcker aus Aigueperse, in die Freie Zone zu bringen. Es fiel dem<br />
Kommissar nicht schwer, sich zu informieren und sich dieses Ereignis bestätigen zu lassen. An<br />
einem Abend bei Vincent im März 43 nahm Weilbacher mich beiseite und gestand mir - unter dem<br />
Siegel der Verschwiegenheit - selbst, innerhalb der Vichy-Polizei, in einer<br />
Widerstandsorganisation eingebunden zu sein. Selbstverständlich nannte er mir weder den<br />
Namen seiner Gruppe, noch deren Aktivitäten. Er gab mir den Rat, mich von jeglichem nur<br />
intellektuellen Widerstand an der Uni fernzuhalten und eher zu versuchen, eine eigene Gruppe<br />
zusammenzufügen; nur fünf bis sechs entschlossene Personen würden genügen, um einen<br />
bewaffneten Kern zu bilden; sie sollten sich bereit halten, um zur bewaffneten Aktion<br />
überzugehen, wenn die für dasselbe Jahr vorgesehene Landung der Alliierten in Frankreich<br />
eintreffen sollte. Dazu brauchten wir zuverlässige und fest entschlossene Leute mit einer<br />
Militärausbildung, die in der Lage wären, sich in der Stadt vor der Requisition des S.T.O. zu<br />
verstecken. Ich sollte die Identitäten für mich behalten, sogar ihm nicht preisgeben. Endlich, lange<br />
nach meiner Rückkehr aus Lothringen im Herbst 1942, hatte ich das feste Bindeglied gefunden.<br />
Als er mich fragte, ob ich mich zu einer solchen undankbaren Aufgabe bereit fühlte, bestätigte ich<br />
ihm, dass ich mich bereit und fähig fühlte, eine solche Zelle aufzubauen. Es wurde vereinbart, dass<br />
Abt Vincent als “Briefkasten“ eingeschaltet werden sollte. Im Lauf des Winters hatte ich unter der<br />
Stundentenbevölkerung aller Fakultäten bereits einige zuverlässige, besonnene Elemente entdeckt,<br />
von denen ich meinte, sie wären zur Aktion bereit und die sich bewusst waren, dass die<br />
Desorganisation des feindlichen Hinterlands mittels Waffen und anderer geeigneter Mittel für die<br />
Landung und den Einmarsch der Alliierten entscheidend sein würde.<br />
Es verlief leider ganz anders. Der gesamte Widerstand schaute auf eine Landung in 1943 aus.<br />
Großbritannien drängte auf ein Maximum an Nachrichten und Auskünften und hatte bereits in<br />
April und August 1942 Aufklärungsgruppen nach Saint-Nazaire und Dieppe befördert. Das gab<br />
uns den Mut, Risiken einzugehen, umso mehr diese uns begründet und verantwortet schienen,<br />
alleine schon durch die Tatsache, dass die deutschen Streitkräfte an der Westfront stark<br />
ausgedünnt wurden. Der große Einsatz fand an der Ostfront statt, wo die Wehrmacht nunmehr in<br />
die Defensive geraten war und die Niederlagen sich trotz brutaler Gegenangriffe häuften. Das<br />
reichte noch lange nicht, um zu einer Landung anzusetzen. Erst viel später, nach dem Krieg,<br />
begriffen wir, dass erst ab Juli 1943 die Tonnage des über den Atlantik nach Großbritannien<br />
verschifften Rüstungsmaterials die Tonnage der von der deutschen Kriegsmarine bis dahin<br />
versenkten Schiffe überstieg. Unter diesen Bedingungen war es den Alliierten in 1943 noch nicht<br />
möglich, erfolgreich eine Landung zu unternehmen. Erst sollte die Atlantik frei gemacht werden,<br />
sodass die Quasi-Gesamtheit der Konvois unversehrt zum Einsatz gebracht werden könnte. Die<br />
24
Kriegsmarine und die Luftwaffe sollten erst im Frühjahr des darauffolgenden Jahres - in 1944! -<br />
endgültig unschädlich gemacht werden.<br />
In Abwartung besserer Zeiten, sollte ich meine Gruppe aufbauen, zusammenhalten und darüber<br />
berichten.<br />
Anfang April war es dann so weit. Ich bedauerte, dass Paul Durrenberger 1941 in Paris geblieben<br />
war, zweifelte jedoch nicht daran, dass auch er fest entschlossen in dem Widerstand aktiv<br />
engagiert war.<br />
Ich bat Abt Vincent, mich wieder mit Henri Weilbacher (H.W.) in Verbindung zu bringen. Am<br />
nächsten Tag traf ich ihn beim Abt und konnte ihm über den Erfolg meiner Mission berichten. Er<br />
legte mir nochmals ans Herz, die Gruppe unbedingt zusammenzuhalten, egal was geschehen<br />
würde, in aller Ruhe seine Instruktionen abzuwarten und ihn nur dann, von mir aus zu<br />
kontaktieren, wenn die Landung losgehen würde. Ich versprach es ihm. Des Weiteren erzählte er<br />
mir, dass er sich anstrengte, um es innerhalb der Polizeibehörde von Clermont zum Posten des<br />
stellvertretenden Polizeiintendanten zu bringen. Die französische Polizei von Vichy kollaborierte<br />
ganz offen mit den Nazis und eine solche Infiltration, zwar äußerst gefährlich, konnte ihn aber vor<br />
dem Verdacht einer anti-deutschen Aktivität schützen. Das war genial, sogar dreist… meinte ich<br />
jedenfalls.<br />
Der Winter 1942-43 war hart. Trotz meiner körperlichen Widerstandsfähigkeit war ich müde, vor<br />
allem weil mir die richtige Nahrung gefehlt hatte. Von meiner Gruppe war ich der Einzige, der<br />
noch keinen Arbeitsschein hatte, eine ernsthafte Lücke in der Organisation, und somit<br />
ungeschützt vor den Razzien des S.T.O. Aber auch innerhalb der “normalen“ Bevölkerung,<br />
innerhalb der Bourgeoisie von Clermont-Ferrand hatte ich während meines zweijährigen<br />
Aufenthalts gute Beziehungen knüpfen können. An der Fakultät für Philologie hatte ich den<br />
jungen Seailles kennengelernt. Sein Vater war Generaldirektor der “Ateliers de Construction du<br />
Centre- A.C.C.“ in Montferrand, Hersteller von schwerem Eisenbahnmaterial für die Nationale<br />
Französische Eisenbahn, die S.N.C.F. (Société Nationale des Chemin de Fer Français), die einen<br />
Prioritätsstatus genoss und deren Arbeiter über Requisitionsausweise vor Ort verfügten.<br />
Ich zog ihn ins Vertrauen und schlug vor, dass sein Vater mich einstellen sollte. Er kontaktierte<br />
seinen Vater, der mich persönlich sprechen wollte, die Begegnung jedoch um mehrere Wochen<br />
verschob. Bis zum Anfang des akademischen Jahres in November verließ ich Clermont-Ferrand,<br />
ohne Schwierigkeiten, denn eine Demarkationslinie gab es nicht mehr, einziger Vorteil der<br />
Besetzung der Vichy-Zone. Die Post funktionierte wieder normal in ganz Frankreich. Eine<br />
Einladung meines Vetters, Camille Wollbrett, Geschichts- und Deutschlehrer am Lyzeum Henri IV<br />
in Vendôme, traf ein. Er schlug mir vor, einige Wochen zur Erholung bei ihm zu verbringen, was<br />
ich nicht ablehnte. Die Reise nach Vendôme, etwa 300 Kilometer nordwestlich von Clermont im<br />
Departement Loir-et-Cher, war anstrengend, der Empfang herzlich. Völlig entspannt und in aller<br />
Ruhe hatten wir es über die alte, gute Zeit vor dem Krieg. Camille konnte sich noch gut an seinen<br />
Schüler Daubach in Forbach erinnern. Beim Ehepaar Wollbrett nahm ich um etliche wohltuende<br />
Kilo zu, nicht zuletzt dank der Lebensmittelversorgung per Fahrrad in jener reichen und schönen<br />
Ebene der Touraine, auch «der Garten Frankreichs» genannt.<br />
Im Westen nichts Neues. Allmählich gewannen im Pazifik die Amerikaner, in Fernost die Briten<br />
die Überhand auf die Japaner. Nach der Katastrophe von Stalingrad sah die deutsche Wehrmacht<br />
sich gezwungen, die Front zusammenzuziehen, und verlor die Schlacht bei Orel an der Oka. Die<br />
Landung in Frankreich ließ weiter auf sich warten.<br />
Abwartend hielt ich den Kontakt zu Vincent und meinen Kameraden. Sechs Wochen konnte ich<br />
für ein Examen um den 15. Juni büffeln. Danach verbrachte ich einige Tage in Rochefort-Montagne<br />
mit Dauerverbindung nach Clermont. Die langen, eintönigen Universitätsferien standen bevor, bis<br />
November. Ich hatte einige sehr gute Freunde in Saint-Flour, südlich von Clermont-Ferrand im<br />
Departement Cantal: die Eltern meines Kameraden, Jean Delort, dessen Vater dort als Notar<br />
niedergelassen war, sowie der Leiter des Postamts, ebenfalls aus Zabern, Freund unserer Familie<br />
und, wie meine beiden Onkel, auch Freiwilliger im Ersten Weltkrieg. Er war gut bekannt mit dem<br />
25
Müller, Herrn Grèze, der nebst der Mühle noch ein Transportunternehmen führte. Ich suchte den<br />
Leiter des Postamts, Herrn Ramsacher, und die Eltern von Delort auf. Herr Grèze nahm uns,<br />
Ramsacher und mich, im Lkw von Saint-Flour zum Puy mit. Dort wohnte, seit seiner Ausweisung<br />
im Dezember 1940, der Zaberner Finanzamtleiter, Paulus, mit dessen Sohn, Marineoffizier zu der<br />
Zeit, als ich das Kolleg besuchte. Von Vater Paulus - einer seiner Schwiegersöhne war Industrieller<br />
- wurde behauptet, dass er über eine Reihe von Auskünften mit Bezug auf die Zaberner<br />
Ausgewiesenen von 1940 verfügte. Es war also die Gelegenheit, um Neues über die Heimat zu<br />
erfahren und die Atmosphäre der alten Freundschaften herbeizureden. Im Lauf des Gesprächs<br />
zeigte Paulus sich als überzeugter Gaullist. Auf eine seiner Auskünfte wird hier, aufgrund des<br />
Außergewöhnlichen, näher eingegangen.<br />
Der Kommandant, de Gouvello, Absolvent «Croix du Drapeau 1914» des Militärkollegs Saint-Cyr,<br />
Kommandeur der Ehrenlegion «Légion d’Honneur» 14-18, war von 1937 bis 1939 Führer des 10.<br />
Jägerbataillons in Zabern. Die Garnison lebte in vollkommnerer Symbiose mit der Bevölkerung.<br />
Im Einverständnis mit dem Kollegdirektor hatte er das bereits genannte Zentrum zur militärischen<br />
Vorausbildung organisiert und wurde zum Ehrenbürger der Stadt Zabern ernannt. In der Schrift<br />
des Claude Paillat über den Kampf von Juni 1940 wird er in der Eigenschaft als Generalstabsführer<br />
einer Division zitiert. Beim Rückzug in Dünkirchen wurde er ein weiteres Mal ernsthaft verletzt.<br />
Im Sommer 1941 hatte ich ihn in Clermont aufgesucht, wohin er, immer noch hinkend, im Rahmen<br />
der Vichy-Armee, zur Generaldirektion der Infanterie berufen wurde. Als er mich empfing, kamen<br />
sein Revanchegeist und sein Vertrauen an die endgültige deutsche Niederlage deutlich zum<br />
Ausdruck. Also war ich gespannt, Näheres über ihn zu erfahren. Vater Paulus wusste, dass im<br />
Monat davor, im Mai 1943, de Gouvello das Kommando über die mobile Garde der Region<br />
Marseille übernommen hatte. Diese Garde wurde immer mehr von den Nazis zum Einsatz<br />
befohlen und sollte, in der Folge, den Kampf gegen die Maquisards aufnehmen und diese<br />
verhaften. Ich konnte es nicht fassen… Aber nach dem Krieg, zurück in Zabern, traf ich zwei<br />
Kameraden, die heil aus dem Maquis davongekommen waren und anschließend, auf<br />
Entscheidung von Edmond Michelet, in die 2. Panzerdivision unter Philippe Leclerc eingebunden<br />
wurden. Diese Kameraden erzählten mir, unabhängig voneinander, wie sie eines Tages in der<br />
eroberten Zone in Deutschland einen Zwischenfall mit de Gouvelle erlebt hatten und dieses<br />
Geschehen stimmte genau mit den Angaben des Finanzamtleiters Paulus überein. Ein anderer<br />
ehemaliger Maquisard hatte de Gouvelle als Befehlshaber einer bewaffneter Aktion der mobilen<br />
Vichy-Garde gegen seine Maquisardgruppe identifiziert. Aus diesen Unterredungen wurde fast<br />
ein Drama. General Leclerc, der die Karriere von de Gouvello, Held des Ersten Weltkriegs, kannte,<br />
wurde sofort alarmiert und forderte de Gouvello - nach vorläufiger Festnahme und Ermittlungen -<br />
auf, sein Amt sofort niederzulegen. Mehr weiß ich über diese Angelegenheit nicht, aber es<br />
schockiert mich, dass heutzutage eine Straße in Zabern den Namen “Général de Gouvello“ trägt,<br />
ohne dass irgendwo die Namen des Paul Durrenberger oder anderer Märtyrer erscheinen. Die<br />
Gemeinde der 650 Zaberner Juden, von denen mehr als 120 in Auschwitz vergast worden sind,<br />
wurde ganz vergessen.<br />
Ende Juni reiste ich von Saint-Flour nach Clermont zurück und bei meiner Ankunft suchte ich<br />
sofort den Abt auf, nur einige Schritte vom Bahnhof entfernt. Bereits bei der Begrüßung spürte ich<br />
bei ihm eine große Besorgnis. Er bat mich, sofort mit Henri Weilbacher Kontakt aufzunehmen und<br />
ihm mitzuteilen, dass die “Große Gestapo“ (kurz davor in Lyon zugange) seit dem Morgen in<br />
Clermont war.<br />
Keine Zeit, nach der Herkunft dieser Information zu fragen. Sofort eilte ich mit der Straßenbahn<br />
zur Rue Montlosier, zur Polizeiverwaltung. In der streng bewachten Eingangsschleuse wartete ich<br />
eine Weile auf den Befehl von Henri an den wachhabenden Polizisten, mir den Durchgang zu<br />
gestatten und mich zu ihm zu führen. Ich sagte ihm Bescheid. H.W. rief einen seiner Gehilfen, der<br />
bestätigte, diese Information vor zwei Stunden erhalten zu haben. Als ich mit ihm allein war, bat<br />
er mich, in Zukunft, falls er abwesend sein sollte, nach Chabrier, seinem Assistenten, zu fragen,<br />
aber nur bei höchster Dringlichkeit und wenn unbedingt erforderlich (Landung). Er gab mir den<br />
Auftrag, Abt Vincent zu warnen, dass er sich auf keinen Fall beim Banker Asch verstecken sollte,<br />
denn Letzterer befand sich als Jude in einer zu gefährlichen Lage. Solange keine<br />
“unvorhersehbaren Ereignisse“ eintraten, sollte ich ihn vor Oktober nicht wieder aufsuchen. Ich<br />
ahnte Schlimmes. Vincent nahm alles zur Kenntnis und gab mir eine Verbindungsadresse. Zwei<br />
Tage später erlebten wir die zweite Katastrophe: in der Stadt wurden zwei Gestapomänner<br />
26
erschossen. Einer konnte sich noch aus der Wohnung bis auf den Bürgersteig schleppen, wo er<br />
tödlich verwundet liegen blieb. In der Wohnung, in einem Anzug im Kleiderschrank wurde ein<br />
Zettel mit der Adresse des Vereinshauses «La Gallia», Treffpunkt von Studenten aus Elsass-<br />
Lothringen, Rue Rabanesse, gefunden. In der darauffolgenden Nacht wurde das Vereinshaus<br />
umzingelt und achtunddreißig Studenten wurden brutal abgeführt, unter denen auch meine<br />
Kumpel aus der sechsten Klasse, André Royer und Georges Peter. In den frühen Morgenstunden,<br />
um nicht auch bei einer Razzia gefasst zu werden, fuhr ich mit dem Rad nach Rochefort-<br />
Montagne, meinem Rückzugsgebiet in den Bergen, bei den Bauern, die mich seit den<br />
Erntearbeiten im Sommer 42 adoptiert hatten und somit die Anweisung der Gruppe für solche<br />
Fälle befolgten. Ich wusste, dass die anderen das Gleiche taten, jeder auf seiner Seite, und dass es<br />
in Clermont nur noch einen Briefkasten gab, in einer Kneipe, Place Chapelle de Jaude.<br />
Juli und August, zwei lange Monate, voller Verzweiflung. Die Mitglieder der «Gallia» waren<br />
gefasst und saßen im Gefängnis in Moulins, nördlich von Clermont im Departement Allier,<br />
eingesperrt. Später wurden sie nach Compiègne (Frontstammlager 112, Sammelpunkt vor der<br />
Deportation zu den KZ) gebracht. Um meine Ungeduld zu überwinden, strengte ich mich bei der<br />
Arbeit als Bauernknecht an: Ernten, Melken, Ausmisten… sodass ich abends, nachdem die letzte<br />
Karre hereingeholt worden war, todmüde ins Bett fiel. Ich wollte keinen Lohn (die Knechte<br />
wurden damals gut bezahlt), ich konnte in das Zimmer des gefangenen Sohns einziehen, hatte<br />
ausreichend zu Essen und, nicht zuletzt, ich verfügte über ein Überwachungsglied, sodass ich bei<br />
Alarm rechtzeitig fliehen konnte, bevor die Deutschen oder die Mobilen Reservegruppen GMR<br />
(Groupes Mobiles de Réserve) der französischen Polizei, im Sold der deutschen Polizei anrückten.<br />
Dieser Verbindungsmann übermittelte mir auch die Nachrichten und Neuigkeiten aus Clermont -<br />
via Rochefort oder Perpezat - und dieser Nachrichtendienst funktionierte, wie die Buschtrommel,<br />
dank der Hilfe von Bäuerinnen, Postbeamten und Autobusfahrern.<br />
Der September rückte näher. Mit einer Landung der Alliierten in diesem Jahr 1943 war nicht mehr<br />
zu rechnen. Ich schrieb meinem Vetter Camille in Vendôme einen banalen Brief, auch an Paul<br />
Durrenberger in Paris, denn ich hatte die Absicht, einige Tage bei ihnen zu verbringen. Seit 1941<br />
hatte ich in Clermont Pauls Vater, Inspektor der Eisenbahn, regelmäßig getroffen. Als Bediensteter<br />
der Eisenbahn konnte er ohne Probleme, amtshalber, durchs Land reisen und so hatte er öfters<br />
meinen heimlichen Briefwechsel bis ins Elsass zu meiner Familie befördert.<br />
Obwohl mir alles ruhig schien, ließ ich nicht nach, die genauesten Vorsichtsmaßnahmen zu<br />
beachten, immer wenn ich zum “Briefkasten“ nach Clermont fuhr. Überraschungsrazzien waren<br />
nicht ausgeschlossen und ich hatte noch keinen Arbeitsschein. Im Briefkasten fand ich eine<br />
Nachricht von meinen drei Kameraden, die mir in Andeutungen den Hinweis gaben, das große<br />
Geschehen, wie vereinbart, weiter abzuwarten. Ich vernichtete die Korrespondenz und hinterließ<br />
die banale Nachricht, dass ich im Oktober, nach den Ferien und vor Beginn des akademischen<br />
Jahres in November, wieder in Clermont sein wollte. Ich hatte der jüngeren Schwester eines<br />
Kommilitonen an der Fakultät - der Vater, Offizier, war bis November 1947 der 2. Befehlshaber<br />
des 4. Artillerieregiments zu Clermont -, während zwei Jahren Deutschunterricht gegeben und das<br />
Mädel war bereit, während ich in der Wohnung ihrer Eltern wartete, am Bahnhof nach<br />
Polizeikontrollen Ausschau zu halten und mir einen Fahrschein für Paris zu besorgen.<br />
Ich hatte immer den Wunsch gehegt, dass Paul Durrenberger zu mir nach Clermont ziehen sollte,<br />
um dort gemeinsam die Kriegs- und Studentenjahre zu erleben. In Paris - ich glaube, es war am 1.<br />
oder 2. September - fand er für mich ein Hotelzimmer im Wohnviertel seiner Eltern, Rue de<br />
l’Entrepôt (heute Rue Yves Toudie, ein füsilierter Widerstandskämpfer). Er hatte es fertig<br />
gebracht, als Attaché im Kabinett des Polizeipräfekten angestellt zu werden! Seine<br />
Vorgehensweise, so fiel mir auf, war der des Henri Weilbacher in Clermont sehr ähnlich, aber das<br />
sagte ich ihm wohl nicht. Er gestand mir, ohne Umschweife, aber auch ohne weitere Angaben -<br />
selbstverständlich -, in einer Widerstandsbewegung eingegliedert zu sein. Abends, im<br />
Hotelzimmer, nannte er mir den Ort, wo ich ihn anderntags nach der Arbeit treffen sollte. Dort<br />
gab er mir einen Termin im Hotelzimmer, das er in der Rue Monsieur le Prince gemietet hatte, wo<br />
er letztendlich ein Treffen für den Nachmittag, auf einer Caféterrasse, Place de la République,<br />
ankündigte. Ich traf ihn auch dort, begleitet von drei seiner Kameraden. Ich glaubte meinen<br />
Augen und Ohren nicht! Ganz ruhig und gelassen, in meiner Gegenwart, unterhielten sie sich über<br />
den Plan, anderntags das Gestapoauto zu stoppen, in dem ein verhafteter Kamerad von einem<br />
27
Gefängnis zum anderen gebracht werden sollte. Ich war entsetzt: so viel Unvorsichtigkeit und so<br />
wenig Mittel, die zur Verfügung standen!<br />
Wieder allein mit Paul, erzählte er mir, dass er in einem Stoßtrupp aktiv war. Das Ziel war, wenn<br />
nötig auch durch Tötung, deutsche Uniformen und Handfeuerwaffen zu beschaffen, um damit<br />
ihre Kameraden befreien zu können oder um wieder zu neuen Waffen zu gelangen. Es war mir<br />
klar, dass es sich um eine spontane, autonome Gruppe handelte und diese nicht in eine<br />
Gesamtorganisation eingebunden war. Das war reiner Selbstmord! Mehr als zwei Aktionen hätten<br />
sie nie zu Stande gebracht. Spätestens beim dritten Versuch wären sie geschnappt worden, ohne je<br />
einen Erfolg auf Dauer zu erreichen. Ich rückte mit der Sprache heraus: ich erklärte Paul, dass ich<br />
einer strukturierten Organisation in Clermont angehörte, und versuchte ihn davon zu überzeugen,<br />
mir in die Auvergne zu folgen, wo ich mich um ihn kümmern würde. Ich verfügte nämlich über<br />
zwei getrennte Unterkünfte, in einem versteckten Winkel in den Bergen und in einem<br />
Verbindungspunkt des Widerstands. Er versprach mir, darüber nachzudenken und wir sollten am<br />
übernächsten Tag noch einmal darüber reden. Als Treffpunkt wurde die Kneipe in direkter Nähe<br />
zu seinen Eltern - sie wohnten Rue de l’Entrepôt - vereinbart. Ich sollte ihn nie wiedersehen.<br />
Es war am 6. oder 7. September. Etwas vor der vereinbarten Uhrzeit hatte ich mich etwas entfernt<br />
von der Kneipe postiert, um Ausschau zu halten. Paul war nicht dort und er kam auch nicht. Als<br />
ich in die Rue de l’Entrepôt abbog, sah ich, dass auf der anderen Straßenseite, vor dem<br />
Wohnungsgebäude seiner Eltern ein Citroën Traction Avant geparkt stand. Ohne den Schritt zu<br />
beschleunigen, ging ich weiter und achtete darauf, nicht zurückzublicken. Am Ende der Straße<br />
nahm ich die andere Richtung und sah, wie drei Zivilisten aus dem Gebäude kamen, in den<br />
Wagen einstiegen und davon fuhren. Ich wartete noch eine Weile, ging dann hinein zur Loge der<br />
Concierge, die mich warnte: «Gehen Sie nicht hinauf! Es gab eine Hausdurchsuchung.” Sie gingen<br />
nur zu dritt hinauf, präzisierte sie noch. Also waren sie alle fort, ohne eine Falle zu stellen. Auf der<br />
Etage angekommen, traf ich auf Frau Durrenberger in Tränen und den jüngeren Brüder unter<br />
Schock. Es waren Beamten der Polizeipräfektur, im Sold der deutschen Polizei, die alles<br />
durchsucht hatten, nachdem sie erfolglos in seinem Zimmer im Quartier Latin nach Waffen und<br />
Dokumenten gefahndet hatten. Sie hatten das Kommissariat, zu dem Paul nach seiner Festnahme<br />
in der Polizeipräfektur gebracht wurde, genannt. Er durfte ein Paket in Empfang nehmen. Sein<br />
Bruder brachte es ihm noch am gleichen Abend, ohne ihn sehen oder mit ihm reden zu können.<br />
Mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen.<br />
Am übernächsten Tag, in aller Frühe, nahm ich im Bahnhof Austerlitz den Zug nach Vendôme,<br />
wo ich ausstieg im Bahnhof, der mir so ruhig wie im vergangenen April vorkam. Ohne mich zu<br />
beeilen begab ich mich zu meinen Vettern Wollbrett. Unterwegs begegneten mir einige Panzer des<br />
Sonderkommandos, das in diesem Sektor einquartiert war. Abgesehen vom Erscheinen eines<br />
jungen Leutnants aus Karlsbad am späten Abend, dessen Einheit ein Zimmer im großen Haus<br />
meiner Vettern in Beschlag genommen hatten, verlief alles gut während der drei folgenden<br />
Wochen, in denen ich mich, wie im vergangenen Frühjahr, erholte. Ich erzählte ihnen nichts,<br />
weder über meine Aktivitäten noch über die Gefahr, der ich in Paris gerade noch entwischt war.<br />
Die Frau meines Vetters erwartete ihr drittes Kind. Wir waren alle mit den Ereignisse in Italien<br />
beschäftigt: Abdankung des Königs Viktor-Emmanuel nach der Landung der Alliierten auf der<br />
Halbinsel, die Festnahme und die Befreiung Mussolinis durch die Fallschirmjäger unter Otto<br />
Skorzeny.<br />
Die Durrenbergers hatten mir versprochen, mich über alles, was der Vater auf seinen Dienstreisen<br />
durchs ganze Land über Paul erfahren sollte, zu informieren. So fügten sich die Puzzleteilchen<br />
allmählich zusammen. Die Männer wurden von einer Sekretärin im Kabinett des Polizeipräfekten<br />
angezeigt. Paul und seine Verbündeten wurden der Gestapo ausgeliefert. Sie wurden beschuldigt,<br />
einen deutschen Soldat bewusstlos geschlagen und seiner Waffen beraubt zu haben Sie wurden im<br />
Lager zu Fresnes unter strengster Bewachung eingesperrt. Sie sollten einem Kriegsgericht<br />
überstellt werden…<br />
Erst als ich 1945 aus der Deportation heimkehrte, vernahm ich, dass Paul grausam gefoltert, dann<br />
zum Tode durch Erschießen verurteilt worden war. Vor Gericht hatte er noch den Mut gehabt,<br />
seinen Richtern zuzuschreien, dass er nicht mehr oder weniger Terrorist war als die preußischen<br />
Studenten, die gegen die Besatzung unter den Truppen Napoleons agiert hatten und, dass er, wie<br />
28
sie, seinen patriotischen Pflichten nachgekommen sei. Es wurde mir auch erzählt, dass er -<br />
möglicherweise aufgrund vieler unternommener Schritte, möglicherweise aufgrund seiner<br />
mutigen patriotischen Haltung - begnadigt und deportiert wurde. Kurz darauf, um den 15. Mai<br />
1945, erhielt seine Familie, die inzwischen auch nach Zabern zurückgekehrt war, die Nachricht,<br />
dass Paul in der Tschechei wiedergefunden worden war. Er war am Leben, aber sterbend, wie<br />
seine Familie später erfahren sollte. Zu der Zeit musste ich zurück nach Clermont, wo ich drei<br />
Jahren meines Lebens verbracht hatte und verhaftet wurde. Ich fuhr Anfang Juni 1945 ab, ein<br />
wenig erholt, und kam zwei Wochen später über Paris zurück nach Zabern. Auf dem Rückweg<br />
von Paris ins Elsass, stehend in einem völlig überfüllten Zug, sah ich Pauls Vater auf dem<br />
Bahngleis. “Ist er zurück?“ - “Er ist tot!“, und er fügte hinzu, dass er zur Zeit seiner Befreiung<br />
noch am Leben war, dass er durch die Evakuierung des Lagers total erschöpft war und kurz<br />
danach starb. Deshalb wurde im ersten Brief vermeldet, dass er noch am Leben sei. Erst viel<br />
später, im November 1945, nach einer langen Rekonvaleszenz, kam ich dazu, Frau Durrenberger<br />
in Paris, Rue de l’Entrepôt, aufzusuchen. Zuletzt wurde Paul in Theresienstadt, Böhmen,<br />
interniert, völlig erschöpft. Von dort aus wurde er, am Ende seiner Kräfte, evakuiert. Er bat sogar<br />
seine Wärter, ihn zu erschießen, um seiner Agonie ein Ende zu machen. Sie taten es nicht und am<br />
8. Mai 1945 wurde er von seinen Befreiern der Roten Armee sterbend aufgefunden. Eine<br />
tschechische Familie stand ihm in den letzten Stunden zur Seite und konnte der Familie die Details<br />
übermitteln. Wahrscheinlich war Paul, auf dem Weg nach Theresienstadt, auch im Lager<br />
Flossenbürg in Nord-Bayern gelandet, wo ich von 1944 bis 1945 elf Monate Haft überleben sollte,<br />
ohne je von ihm zu erfahren. Er war ein prächtiger Athlet, der sein unheimliches Potential an<br />
Energie für seine Sache einsetzte. Das erklärt, wie er, solchen extremen Bedingungen ausgesetzt,<br />
so lange überleben konnte.<br />
Es war mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle in meiner Geschichte, über Pauls Leidensweg zu<br />
berichten, damit sein Vorbild nicht in Vergessenheit gerät.<br />
Seit dem 7. oder 8. September 1943 war ich also in Vendôme. Über die Ereignisse in Paris blieb ich<br />
verschwiegen, damit nichts über das Versteck bekannt wurde. Durrenberger hatte ich bei meiner<br />
Abfahrt keinerlei Hinweise auf meine Bestimmung gegeben. Nach den drei aufeinanderfolgenden<br />
Schocks in September 42, Juni und September 43, neigte ich dazu, schön ruhig bei meinen Vettern<br />
in Vendôme unterzutauchen und dort vorerst mal die Landung der Allierten abzuwarten, um<br />
mich dann vor Ort nützlich zu machen. Aber Henri Weilbacher hatte mich beauftragt, Anfang<br />
Oktober mit ihm Kontakt aufzunehmen und wie versprochen, sollte ich mich danach bei meinen<br />
Kameraden melden. Also… Die Rückfahrt nach Clermont verlief ohne Zwischenfälle.<br />
Es war am 4. oder 5. Oktober. Die treue Hausangestellte des Abbé Vincent, eine Elsässerin, war<br />
alleine im Château Rouge. Sie sagte mir, der Abt und “Mademoiselle“ waren in aller Eile<br />
abgefahren, sofort als sie vernommen hatten, dass Henri Weilbacher am 1. Oktober von der<br />
Gestapo gefasst worden war. Die Nachricht war rundgegangen und somit erfuhr ich, dass er nicht<br />
allein, sondern zusammen mit anderen verhaftet worden war. Das Netz war gerissen. Ich war von<br />
Allen und Allem abgeschnitten. Meinen drei Freunden teilte ich mit, dass wir uns erst am Anfang<br />
des akademischen Jahres im November treffen würden.<br />
Ich sollte mit Seailles Junior Verbindung aufnehmen, denn eine Einstellung im Unternehmen<br />
seines Vaters, Atelier de Constructions du Centre - A.C.C., würde mich vor den “normalen“<br />
Razzien, von denen es in der Stadt immer mehr gab, schützen. Um den 15. Oktober empfing Vater<br />
Seailles mich in seinem privaten Wohnsitz in Chamalières, ein Vorort von Clermont-Ferrand. Das<br />
Gespräch verlief ganz offen und Herr Seailles erläuterte sein Bedenken bezüglich einer<br />
tatsächlichen Einstellung in sein als prioritär eingestuftes Unternehmen, sodass ich sowohl eine<br />
Arbeit würden nachweisen können und gleichzeitig vor allen Arten von Requisition sicher wäre.<br />
Es brauchte eine Menge Formalitäten und Papieren bei den verschiedenen Arbeitsbehörden,<br />
zusätzlich der Überprüfung aller Dokumente seitens der Polizeiverwaltung, bis ich meine<br />
Arbeitskarte ausgestellt bekam.<br />
Die Wiederaufnahme der Vorlesungen an der Jura-Fakultät war für Anfang November. Ich war<br />
anwesend bei der Eröffnung und in den ersten darauffolgenden Tagen. Es verbreiteten sich<br />
Gerüchte über den Leichtsinn des Rektors, die Universität wieder eröffnet zu haben, und wie fast<br />
29
immer waren diese Gerüchte nicht nachprüfbar. Eine Delegation schlug vor, den Unterricht per<br />
Korrespondenz zu organisieren. Der Rektor betrachtete diesen Vorschlag als nicht realisierbar.<br />
An einem Morgen - ich glaube, es war der 8. oder 9. November - klopfte es an meiner Tür: es war<br />
die junge Schülerin, der ich längere Zeit Deutschstunden erteilt hatte. Ihr Vater, Kolonel Fallotin,<br />
war in September von der Vichy-Polizei verhaftet und eingesperrt worden. Er wurde verdächtigt,<br />
einer Gruppe Offiziere der aufgelösten Vichy-Armee anzugehören, Waffen und Kriegsmaterial<br />
erbeutet und versteckt zu haben. Ihre Mutter war noch in Kontakt mit untergetauchten Offizieren,<br />
die ihr wissen ließen, die Deutschen hätten die Absicht, die Universität zu schließen. Ich glaubte<br />
ihr und beschloss, mich aus den Vorlesungen fernzuhalten und mich weitgehend zurückzuziehen.<br />
Mehrere Studentinnen hatten sich bereit erklärt, Notizen von den Vorlesungen zu machen und<br />
diese an einige der unseren weiterzugeben.<br />
Nach einem Tag Beschäftigung mit im Grunde genommen unwichtigem Papierkram war die<br />
beste Art und Weise, die Zeit sinnvoll zu nutzen, abends im Zimmer diese Notizen der<br />
Vorlesungen durchzuackern, jedenfalls besser als herumzurennen und zu überlegen, wann, mit<br />
wem und wie Kontakt aufzunehmen sei, entweder durch Nachricht über Abt Vincent, oder<br />
vielleicht unmittelbar mit einem der Offiziere und Unteroffiziere, mit denen die Ehefrau des<br />
Kolonels Fallotin noch in Verbindung stand.<br />
Eine überraschende Nachricht baute meine Stimmung wieder auf. Es war am 20., möglicherweise<br />
am 21. November 1943. Mein alter Schulkamerad am Zaberner Kolleg, Robert Dahlet, der sich<br />
innerhalb der “Chantiers de la Jeunesse“ in Sicherheit gebracht hatte, hatte zusammen mit<br />
Georges Peter die Schulzeit mit dem Abitur abgeschlossen; sie bewahrten eine enge Freundschaft<br />
während der Rückzugsjahre in Clermont-Ferrand. Am Anfang des neuen Studienjahrs hatte ich es<br />
vermieden, Kontakt mit “Robby“ aufzunehmen, um ihn für meine Gruppe zu gewinnen, denn er<br />
war mit der Tochter eines Philologieprofessors verlobt und sollte sie in Kürze heiraten; der<br />
Nachwuchs, das erste von vier Kindern, war unterwegs. Er wusste nichts von meinem<br />
Engagement. Von ihm erfuhr ich, dass die gefassten Mitglieder der “Gallia“ nach Compiègne<br />
deportiert worden waren und, am 30. Oktober 1943, von dort weiter nach Deutschland; dass es<br />
Peter gelungen war, vom Zug zu springen und er sich irgendwo in der Nähe von Clermont<br />
befand. Ein starkes Stück! Ich achtete darauf, nicht nach seinem Versteck zu fragen, und ließ ihm<br />
die Nachricht übermitteln, dass ich ihn über Ginette, seine Braut, mit Lebensmitteln versorgen<br />
würde. Peter schaffte es, tauchte später im Maquis unter, wurde Offizier - mit den<br />
dazugehörenden und -passenden Auszeichnungen - und beendete anschließend sein<br />
Medizinstudium. Nach diesem Studium arbeitete er bis 1966 in Tunesien. Als Witwer mit zwei<br />
Kindern heiratete er ein zweites Mal und bekam noch zwei weitere Kinder. Er beendete seine<br />
Karriere als Krankenhausarzt in der Pariser Gegend und, kaum im Ruhestand, starb er in<br />
November 1988 an Krebs. Ich stand ihm bis in die letzten Tage bei.<br />
Erst viel später erfuhr ich, dass auch André Royer, im gleichen Konvoi nach Deutschland, im<br />
annektierten Lothringen einige Stunden nach Peter vom Zug gesprungen war. Er war wieder<br />
festgenommen und nach Buchenwald deportiert worden. Aber darüber später mehr…<br />
Am Mittwoch, dem 24., und am Donnerstag, dem 25. November sollte ich zusammen mit anderen<br />
Studenten zur Universität, um uns dort am späten Vormittag mit dem Fakultätsdekan und den<br />
Professoren zu treffen, um die Einschreibungen zu überprüfen und den Fernunterricht besser zu<br />
gestalten. Es war am Donnerstag, dem 25., kurz vor elf Uhr vormittags. Die Hörsäle waren noch<br />
nie so voll. Es verlief fast lautlos. Im kleinen Raum auf dem Dachboden der Notariatschule, wo die<br />
Vorlesungen, an denen auch ich teilnahm, abgehalten wurden, hatte nur einer der Kommilitonen<br />
das dumpfe Geräusch gehört: «Die Deutschen!». Fast im gleichen Augenblick wurde die Tür<br />
geöffnet. Die Soldaten der Luftwaffe schienen erstaunt, noch einen vollen Saal anzutreffen. Ein<br />
Unteroffizier schnappte sich einen der Studenten, befahl ihm die Hände in den Nacken zu legen<br />
und die anderen folgten willig die drei Stockwerke hinunter bis in den Hof, wo die Gesamtheit der<br />
Fakultät zusammengetrieben wurde. Zwei Stunden Warten, zusammengedrängt, die Waffen auf<br />
uns gerichtet, Redeverbot. Nach einiger Zeit - es kam mir sehr lang vor und ich versuchte, mich zu<br />
entspannen - holte ich eine Zigarette heraus. In dem Augenblick, als mein Nachbar mir sein<br />
Feuerzeug reichte, sagte einer der Wärter zu einem anderen: «Hol dem mal die Zigarette aus der<br />
Fresse!», doch bevor er seinen Satz beenden konnte, war die Zigarette verschwunden. Der<br />
betroffene Soldat kam nicht dazu, mich zu identifizieren, und es blieb dabei.<br />
30
Wir wurden gezwungen, in einen Lkw einzusteigen und dreihundert Meter weiter, am<br />
Universitätshauptgebäude wieder auszusteigen. Der große Einsatz von Wärtern und Kontrollen in<br />
der Eingangshalle, die Uniformen der Wehrmacht ließen sich dadurch erklären, dass die Gestapo<br />
ein komplettes Bataillon der Luftwaffe am Flughafen von Aulnat, nördlich von Clermont-Ferrand,<br />
mobilisiert hatte, um alle acht, über die Stadt verstreuten Fakultäten zu umzingeln und deren<br />
gefasste Bevölkerung ins Hauptgebäude zusammenzubringen. Zweitausend Studenten standen<br />
versammelt auf dem Rasen. Im Nachhinein erklärten uns die Soldaten, die uns auch im Gefängnis<br />
weiter bewachten, dass sie den Befehl bekommen hatten, besonders gewaltsam vorzugehen.<br />
Tatsächlich verlief es an anderen Fakultäten viel schlimmer als an der juristischen Fakultät.<br />
Professor Collomb wurde sinnlos erschossen und mein Freund Ettel, Professor für Evangelische<br />
Theologie, den ich seit 1941 kannte, bekam von einem Gestapomann (später sollten wir seinen<br />
Namen - Kalteiss - und seine Grausamkeit erfahren) ein halbes Revolvermagazin - bis zur<br />
Ladehemmung - in den Bauch gefeuert.<br />
Immer wieder mit der Bajonettspitze gehetzt wurden wir gezwungen, in kleinen Gruppen hoch<br />
zur Eingangshalle zu laufen, wo wir, einer nach dem anderen, kontrolliert wurden. Es nahm kein<br />
Ende. Ein anderer Student, der das Warten satt hatte, zündete sich eine Zigarette an. Ein Koloss<br />
der Gestapo, Blumenkamp, sah es und verpasste ihm eine ordentliche Tracht Prügel. Unter dem<br />
Gemurmel der entsetzten Mädchen schleppte er ihn in die Halle und schrie: «Hat Widerstand<br />
geleitet! Abführen und erschießen!» Zwei Tage später wurde er von dem “witzigen“<br />
Gestapomann freigelassen.<br />
Dann kam ich an die Reihe und wurde zur Sortierstelle hinaufgeführt. Als ich die letzten Stufen<br />
hinaufging, erkannte ich ihn: Georges Mathieu. Er entschied über Verhaftung und Freilassung,<br />
eine Liste mit etwa zwanzig Namen in der Hand. Nachdem er sich auf die Militärschule Saint-Cyr<br />
vorbereitet hatte, kam Mathieu, Sohn eines höheren Offiziers im Ruhestand und brillanter<br />
Student, zur Fakultät der Philologie. Im Winter 42/43 hatte ich ihn oft, zusammen mit seinen<br />
Kumpeln, in der «Académie de Billard» gesehen. Juni 1943 hatte wir uns bei der gleichen<br />
Juraprüfung getroffen; nur einmal, bei der mündlichen Prüfung, hatte ich mit ihm gesprochen.<br />
Danach hatte ihn keiner mehr gesehen. Später erfuhren wir, links und rechts, dass er, zusammen<br />
mit seiner schwangeren Lebensgefährtin, im Sommer von der Gestapo verhaftet wurde. Die<br />
Gestapo soll seine Lebensgefährtin als Geisel benutzt haben, um ihn zum Reden zu bringen, und<br />
dabei auf geschickte Weise das klassische Argument des großen Kampfs gegen den<br />
Bolschewismus eingesetzt haben, um ihn “für sich einzunehmen“. Er war kein Einzelfall. Die<br />
Gestapo trug ihm auf, die mutmaßlichen “Gaullo-Terroristen“ an der Universität herauszufinden.<br />
In den darauffolgenden Monaten wurde allen, die wie ich im Gefängnis eingesperrt waren,<br />
deutlich, dass aus ihm ein treuer Agent der Gestapo geworden war: Beteiligung an Razzien und<br />
Verhaftungen, an Verhören unter Folter, an Operationen gegen die Maquisards…<br />
Es ist nicht meine Absicht, hier den Fall «Mathieu» zu erläutern. Jedoch möchte ich noch<br />
hinzufügen, dass er in Oktober 1944, vor Kriegsende, verhaftet wurde. Nach kurzer Ermittlung<br />
wurde er dem Gericht zu Clermont überstellt, zum Tode verurteilt und in Dezember 1944, lange<br />
vor unserer Befreiung und Rückkehr aus den Lagern, exekutiert. Während des Gerichtsverfahrens<br />
wurde der Fall an der Universität nicht weiter vertieft, die anderen Anklagepunkte waren<br />
bedeutend schwerwiegender. Seine Lebensgefährtin wurde zu lebenslanger Zwangsarbeit<br />
verurteilt. Ihr gemeinsames, erst nach dem Verfahren geborenes Kind, wurde dem Roten Kreuz<br />
übergeben und bekam durch Adoption eine neue Identität. Wie viele andere, die die<br />
Konzentrationslager gerade noch überlebten, bedauere ich, dass das Verfahren nicht bis zu<br />
unserer Rückkehr in Mai 1945 vertagt wurde. Ich war frustriert, die Gegenüberstellung bei den<br />
Verhören nicht erlebt zu haben, um zu erfahren, was Mathieu über meinen Kontakt zu Henri<br />
Weilbacher gewusst hatte.<br />
Ich war dran. Noch bevor ich mich auf seiner Höhe befand, hörte ich Mathieu, nach jeder<br />
Überprüfung, «links» oder «rechts!» schreien und merkte, dass die “Linken“ verhaftet und die<br />
“Rechten“ freigelassen wurden. Direkt vor mir stand ein siebzehnjähriger Junge, erstes Jahr<br />
Lizenz, und als Mathieu seinen Personalausweis sah, befahl er: «Amoudruez, sofort ins<br />
Gefängnis!». So machte ich die Bekanntschaft des François Amoudruez, der zwar nicht aktiv im<br />
Widerstand war, aber dessen Schwager, der Bibliothekar Fischer, von Mathieu hartnäckig gesucht<br />
31
wurde, ohne dass Letzterer wusste, dass Fischer der Verantwortliche für die gesamte Zone Süd<br />
war. Ich sollte François erst nach der Befreiung der Lager wiedersehen. Auch er war im Lager<br />
Flossenbürg im Transit, bevor auch ich dort landete. Noch heute halten wir eine echte und<br />
brüderliche Freundschaft aufrecht.<br />
Als François abgeführt wurde, warf Mathieu einen Blick auf meine Karte und auf die Liste, die er<br />
in der Hand hielt: «Links!». Das Wort fiel wie ein Fallbeil. Während ich zusammen mit anderen<br />
Linken zum Lkw geführt wurde, fragte ich mich völlig verängstigt, was dieser Dreckskerl noch<br />
alles wusste und was diese Liste genau zu bedeuten hatte.<br />
Die Planen wurden hermetisch abgeschlossen. Zusammengedrängt im Dunkeln war es<br />
unmöglich, herauszufinden, wohin wir verfrachtet wurden. Nach einigen Minuten hielt der Lkw<br />
an und die hintere Plane wurde hochgehoben. Wir wurden gezwungen, herunter zu springen, und<br />
unter lautem Schreien und Rufen durch einen weit geöffneten Torbau getrieben. Wir befanden uns<br />
auf dem Innenhof des Gefängnisses “92“, neben der Kaserne. Bis abends wurden weitere Linke,<br />
verhaftete Kameraden, per Lkw angefahren. Bei einbrechender Nacht wurden die etwa<br />
vierhundert Männer und Frauen in die Kasernengebäude geführt. Eine Nacht, ein Tag… Ein<br />
neues Aussortieren während der darauffolgenden Nacht. Die Vichy-Polizei notierte die<br />
Personalien der Verhafteten. Keiner konnte nachvollziehen, nach welchen Kriterien eine<br />
übergroße Mehrheit in derselben Nacht und anderntags wieder freigelassen wurde. Nur eins<br />
stand fest: alle auf der Liste von Mathieu und alle Juden wurden endgültig festgenommen. Zum<br />
Ausgleich kamen noch etwa hundert andere dazu, sodass wir am vierten Tag, Männer und Frauen<br />
getrennt, ungefähr hundertzwanzig waren. Die Frauen in einer, die Männer in drei Stuben, weiter<br />
von denselben Soldaten der Luftwaffe bewacht, bekamen endlich von den Gefängniswärtern<br />
Essen zugeteilt.<br />
Wir verbrachten mehrere Tage im Gefängnis und machten gegenseitige Bekanntschaft. Dann und<br />
wann erschien die Gestapo und führte den einen oder den anderen zum Verhör ab. Einer wurde<br />
vernommen, um sicherzugehen, dass er Jude war: Dreyfus, ein charmanter Student im ersten Jahr<br />
Medizin. Er sollte an Erschöpfung in Auschwitz sterben. Ein Professor der Fakultät der Medizin,<br />
Dr. Kayser, wurde vom deutschen Militärarzt untersucht, um die von ihm erwähnte Tuberkulose<br />
zu überprüfen. Er wurde freigelassen. Wir ahnten, dass draußen weitere Ermittlungen und<br />
Maßnahmen durchgeführt wurden. Eines Tages, während wir mit den Wächtern plauderten,<br />
stürmte die Gestapo herein, täuschte Erstaunen vor, als sie uns eine Zigarette rauchend auffanden,<br />
und forderten uns auf, alle Zigaretten und Tabak herauszugeben, unter der Drohung einer<br />
späteren Durchsuchung. Die Vorräte tauchten aus den Taschen und den Kartons auf. Nur Hering<br />
und ich wurden «durchsucht». Hering wurde mit einem heftigen Schlag ins Gesicht traktiert, dass<br />
er zu Boden ging, nur weil er eine leere Streichholzschachtel bei sich hatte. Der Gestapomann, der<br />
mich durchsuchte, spürte meine stählernen Muskeln unter der Kleidung und sah mich prüfend an.<br />
Ich zeigte mich unerschrocken. Er fand nichts. Eine Weile nachdem sie fort waren, noch unter dem<br />
Eindruck ihres Versuchs, uns zu terrorisieren, fragte ich meinen Kameraden: «Meine Herren,<br />
möchte jemand von Ihnen eine Zigarette?». Bevor sie in die Zelle kamen, hatte ich gehört, was auf<br />
dem Flur gesprochen wurde und hatte noch gerade ein großes Päckchen schwarzer Tabak samt<br />
Blättchen und Streichhölzer ins Stroh verstecken können. Man tat alles was man konnte, um sich<br />
selbst und den anderen die Stimmung zu heben. Trotzdem quälte mich die Unsicherheit über<br />
mein Los. Jeder von uns machte sich Sorgen. Je nach Umständen und Ereignissen konnte es<br />
sowohl zur Verhaftung und Deportation als auch zur Erschießung als Geisel führen. Die<br />
Gutmütigkeit der Wärter hatte nichts zu bedeuten. Obwohl sie uns bedauerten, gaben sie uns zu<br />
verstehen, dass ihnen das Kriegsgericht drohte, wenn es zu einer Flucht kommen sollte, und sie<br />
demzufolge, bevor es zum Kriegsgericht käme, eher schießen würden.<br />
Seit unserer Verhaftung war eine Woche vergangen. Am 1. oder 2. Dezember wurden wir brutal,<br />
innerhalb weniger Minuten aus unseren Zellen geholt und mit Pack und Sack zum Innenhof<br />
gebracht, nicht zur Toilette sondern in zwei große, durch den Mittelflur von einander getrennte<br />
Stuben geführt. In diesem Gebäude mit nur einem von zwei Wachposten bewachten Ausgang<br />
verblieben wir mehrere Wochen.<br />
Wir machten nähere Bekanntschaft miteinander. Vor der Verhaftung hatte ich nur zwei der<br />
Genossen gekannt, meinen Kameraden an der Fakultät, Didier Hermann, und Josef Flesch, alias<br />
32
Sepi, der sein Staatsexamen Deutsch vorbereitete und den ich in 1942 im Freundeskreis Saint-<br />
Louis, von meinem Juraprofessor und Freund Claude Thomas geleitet, kennengelernt hatte.<br />
Sepi Flesch sollte später, in Januar 1994 - wie auch Ebel und Jumey, der Paläologe - aus dem<br />
Deportationskonvoi von Compiègne nach Buchenwald ausbrechen. Nach dem Krieg traf ich<br />
Flesch wieder und bis heute stehen wir miteinander in Verbindung. Er hat eine glänzende Karriere<br />
als Direktor einer Rentenkasse hinter sich. Ebel, Attaché bei der Präfektur zu Straßburg, sollte zwei<br />
Jahre nach Kriegsende unglücklicherweise im Rhein ertrinken. Jumey zeichnete sich aus als<br />
Archivist-Paläograf. Mein Professor für Zivilrecht, Claude Thomas, der seinen Schülern sehr nah<br />
stand, wurde bei der Razzia des Freundeskreises Saint-Louis nach dem “Attentat de la Place de la<br />
Poterne“ in Clermont, März 1944, gefasst. Bei diesem Attentat - im Film «Das Haus nebenan» (frz.<br />
Le Chagrin et la Pitié) von Marcel Ophüls dokumentiert - kamen vierzehn Soldaten einer<br />
Wehrmachtkolonne durch von den Widerstandskämpfern abgefeuerten Granaten um. Nach den<br />
Vergeltungsrazzien erhob Claude Thomas energisch Protest gegen die begangenen Brutalitäten<br />
und wurde unter strengster Geheimhaltung im Gefängnis zu Clermont eingesperrt. In Mai 1944,<br />
am Tag nach meiner Ankunft mit dem Konvoi aus Auschwitz sollte ich Claude bei seiner Ankunft<br />
in Buchenwald wiedersehen. Dort sprach ich ein letztes Mal mit ihm. Die Behandlung in<br />
Einzelhaft hatte ihn erschöpft, dazu kam noch ein Pneumothorax und trotz seiner<br />
außergewöhnlichen Geisteshaltung hatten ihn die Lebensbedingungen in Ellrich, eins der<br />
härtesten Kommandos des KZ Buchenwald-Dora, gebrochen. Viele Gesichter erscheinen mir vor<br />
Augen, jetzt wo ich mich an diesen Abschnitt unseres Schicksals im Gefängnis “92“ erinnere, und<br />
ich glaube, keinen von denen, die ich mir ins Gedächtnis eingeprägt hatte, zu vergessen. Ich kann<br />
weder über jeden einzelnen, noch über alle hier berichten. Es gibt jedoch drei Personen, drei<br />
hervorragende Professoren im Bereich der Wissenschaften, mit denen ich freundschaftlich<br />
verbunden war und die mir durch die informellen Gespräche in den vielen inaktiven Stunden<br />
unserer Haft eine neue Sicht auf die Welt und die Dinge verschafften.<br />
Der brillantesten unter den dreien - brillant im Sinn, der heutzutage auf den Begriff<br />
Kommunikation zutrifft - war Charles Sadron, damals 42. Seine Forschung im Bereich der<br />
Makromoleküle hatten bereits einen hohen Bekanntheitsgrad und es zwar kein Zufall, dass er<br />
nach dem Krieg in Orléans das Institut für makromolekulare Physik gründen und leiten sollte. Er<br />
wusste, dass er auf der Liste von Mathieu stand und wir konnte ihm die Angst vor der<br />
Erschießung nicht nehmen. Es ging so weit, dass, als er eines Abends wieder anfing, sich Sorgen<br />
zu machen, ich ihn zu beruhigen versuchte, indem ich ihn anfuhr und ihm rau zuschrie: “Jetzt<br />
reicht’s!“<br />
Der diskreteste der “drei Großen“, war Jacques Yvon, Mitte vierzig. Er unterrichtete in einem<br />
hochqualifizierten Bereich, den man später “Theoretische Physik“ nennen sollte. Seine Forschung<br />
sollte nach dem Krieg einen internationalen Bekanntheitsgrad erreichen. Während der letzten fünf<br />
Jahre seiner Laufbahn (1970-75) war er Direktor des am 18. Oktober 1945 von General De Gaulle<br />
gegründeten “Commissariat à l’Énergie Atomique“ (Kommissariat für Atomenergie) als einer der<br />
Nachfolger vom ersten Direktor, Frédéric Joliot-Curie. Es wäre also ein schwerer Verlust für die<br />
Nation und die Welt gewesen, wenn er in Buchenwald umgekommen wäre. Wie die meisten von<br />
uns wurde er Ende Januar 1944 dorthin deportiert. In Mai 1944 sollte ich ihn im KZ Buchenwald<br />
wiedersehen. In Buchenwald machte er sich damals - glücklicherweise zu Unrecht - große Sorgen,<br />
denn er meinte, von der Tuberkulose befallen zu sein. Seine Ehefrau stammte aus Oradour-sur-<br />
Glane, wo auch seine fünf Kinder geboren wurden. Ende 1944, noch in Buchenwald, erfuhr er viel<br />
später - ich weiß nicht, wie die mündliche Nachricht zu ihm kam -, dass seine gesamte<br />
verschwägerte Verwandtschaft bei dem Massaker und der Niederbrennung von Oradour durch<br />
eine SS-Division umkam. Dieses Kriegsverbrechen sollte beim Gerichtsverfahren in Bordeaux 1954<br />
wieder aufgenommen werden. Zum letzten Mal sah ich Jacques Yvon in den siebziger Jahren,<br />
anlässlich eines Diners zusammen mit seiner Frau und einigen Überlebenden. Er erschien mir sehr<br />
abgemagert. Einige Wochen später starb er an Krebs .<br />
Derjenige, der nach Außen als der bescheidenste von den drei erschien, später sich als der<br />
glänzendste herausstellte, war zweifellos Albert Kirrmann. Geboren 1900 war er achtzehn als das<br />
Elsass, nach dem Ersten Weltkrieg, wieder zu Frankreich kam. Zwei Jahre vorher hatte er sein<br />
Abitur bestanden und anschließend das Studium der Chemie an der Universität Straßburg<br />
angefangen. Es war damals eine Aufsehen erregende Initiative, die besten Studenten aus Elsass-<br />
33
Lothringen, wie Alber Kirrmann, auf Bescheinigung zur École Normale Supérieure ENS der<br />
Ulmer Straße zuzulassen. Kirrmann, der diese Schule absolvierte, war Professor der organischen<br />
Chemie an der Fakultät der Wissenschaften der Straßburger Universität, bei Kriegsbeginn nach<br />
Clermont-Ferrand ausgewandert. Nach seiner Rückkehr bei der Befreiung der<br />
Konzentrationslager sollte er Rektor dieser Universität werden. Ich hatte das Glück, mit ihm in<br />
Verbindung zu bleiben, als er später, am Schluss seiner Karriere, stellvertretender Direktor der<br />
École Normale Supérieure in der Ulmer Straße war. Leider hatte er kaum die Gelegenheit, seinen<br />
wohlverdienten Ruhestand zu genießen. Mehrere ihm sehr nahegehende Sterbefälle in seinem<br />
Umkreis schwächten ihn rasch. Sein letzter Ausgang führte ihn zu mir in einem Pariser Vorort, um<br />
meine kleine Agnes, drei Jahre alt, zu grüßen. Einige Wochen später, Ende 1974, erlag er dem<br />
Krebs. Er war ein vernünftiger Hugenotte, streng zu sich selbst, aber tolerant gegenüber den<br />
anderen, der seinen Mitgefährten, sowohl im Gefängnis als auch im Deportationslager, große<br />
moralische Unterstützung gab.<br />
Bevor ich mit meiner Geschichte weiterfahre, möchte ich noch auf die Schriften von Albert<br />
Kirrmann («Buchenwald, la grande ville» - Buchenwald, die große Stadt) und Charles Sadron («À<br />
l‘usine de Dora» - In der Fabrik zu Dora) hinweisen. Es sind m. E. die kompaktesten und<br />
objektivsten Berichte, die je über das Konzentrationslager Buchenwald und dessen Kommando<br />
Dora geschrieben und 1947 in den “Témoignages Strasbourgeois“ - (Verlag “Belles Lettres“),<br />
Neuausgabe 1954 und seitdem bestimmt vergriffen - veröffentlicht wurden.<br />
Erster Sonntag im Dezember. Wir alle waren überzeugt, dass nun die Verhöre vor der Gestapo<br />
folgen würden. Wir wurden aus unserem Schlafsaal geholt und zum Nebengebäude geführt. In<br />
einem großen Raum, der deutschen Einheit vorher als Mensa eingerichtet und nun leergeräumt,<br />
wurden wir in einer langer Kolonne, den Fenstern und dem Tageslicht gegenüber, aufgestellt und<br />
von einem eleganten Polizisten in Bürgerkleidung, unter Beistand eines Offiziers in Uniform,<br />
untersucht. Der Polizist begnügte sich, jeden einzelnen kurz zu untersuchen und fast jedem<br />
dieselben Fragen zu stellen, nämlich ob wir an der Universität eine deutschfeindliche Aktion<br />
führten, welcher politischen Richtung wir angehörten, ob wir uns als Franzosen oder als<br />
Deutschen betrachteten. Alles wurde schnell abgewickelt, ein Verhör war es eigentlich nicht. Einer<br />
von uns, Unbegaun, ein Weißrusse und Lektor für slawische Sprachen an der Universität,<br />
antwortet, dass seine einzige politische Aktivität darin bestanden hatte, nach der Revolution von<br />
1917 General in der Armee des Zars und in dieser Eigenschaft zweimal verwundet gewesen zu<br />
sein. Das schien den Polizisten, - so wie wir später erfuhren - den Reichskommissar Geissler, Chef<br />
der Gestapo für die Südzone Frankreichs (das gesamte, vor November 1942 nicht besetzte Gebiet),<br />
wohl beeindruckt zu haben. Unbegaun erzählte mir später, dass er tatsächlich Befehlshaber der<br />
Artillerieeinheit der Weißen Armee war, die Dnipropetrovsk in der Ukraine wiedereroberte.<br />
Diese “Allgemeine Übersicht“ war nur das Vorspiel zu den einzelnen Verhören, die in den<br />
nächsten Tagen stattfinden sollten.<br />
Ich wurde von einem Gestapomann in Zivilkleidung abgeholt und in ein Büro im zweiten Stock<br />
des Gebäudes, in dem wir seit mehrerer Tage eingesperrt waren, geführt. Kaum hatte ich mich auf<br />
den Stuhl vor der Schreibmaschine gesetzt und meine Personalien mitgeteilt, fragte der Offizier:<br />
«Sie kennen Weilbacher?». Mir blieb die Luft weg. «Ist er Student oder Professor?». Den Schlag<br />
von hinten sah ich nicht kommen. Voll auf die Backe. Noch einer, diesmal schmerzhafter, von der<br />
anderen Seite auf die Backe. Ich blutete. «Es ist der Kommissar bei der Polizeiverwaltung. Sie<br />
haben ihn aufgesucht.» «Sie schlagen mich, aber dutzen mich nicht. Gutes Zeichen!», dachte ich<br />
mir. Fast wie vorprogrammiert kam es heraus: «Im Juni und Juli, zweimal habe ich den<br />
Verantwortlichen bei der Verwaltung aufgesucht… wegen erforderlicher Lieferungen an die<br />
Ateliers de Construction du Centre, prioritär für die Eisenbahnproduktion, wie auf meiner<br />
Arbeitskarte vermerkt und von Mathieu am Tag meiner Verhaftung geprüft.» Alles gelogen, denn<br />
meine Arbeitskarte wurde erst im Oktober ausgestellt, als Henri Weilbacher bereits verhaftet war.<br />
In der Enge gedrängt meinte ich, auf diese Weise Zeit zu gewinnen, denn ich war mir sicher, dass<br />
sie daraufhin weitere Ermittlungen durchführen würden. Der Gestapomann, der mich<br />
hineingeführt und eingetragen hatte, gestattete mir, auf dem Flur das Gesicht zu waschen und<br />
warnte mich, dass sie mich am nächsten Tag wieder verhören würden. Dann brachte er mich zum<br />
Gemeinschafts-Aufenthalts-Schlafraum zurück. Ich überlegte, dass es ihnen wohl nicht möglich<br />
34
sein würde, meine Aussage über mein Vorgehen bei der Polizeiverwaltung von heute auf morgen<br />
zu prüfen.<br />
Am nächsten Morgen wurde ich als erster von demselben Gestapomann abgeholt. Das, was ich<br />
befürchtet hatte, traf nicht ein: keine Anspielung auf die Polizeiverwaltung. Jedoch wollte der<br />
Polizist mehr erfahren über Widerstandsaktivitäten an der Universität. Dasselbe wurde auch mit<br />
den anderen, die am Tag vorher verhört wurden, versucht. Gelassen antwortete ich, dass mir seit<br />
Anfang meines Studiums keinerlei Zeichen einer solchen Aktivität aufgefallen war. Mein Scherge<br />
begnügte sich, einige Bemerkungen - die ich hier nicht wiedergeben möchte - über die Feigheit der<br />
Franzosen, die noch nicht mal den Mut hätten, zuzugeben, dass die gesamte Universität von einer<br />
anti-deutschen Propaganda überflutet war, zu äußern. In dem gleichen Augenblick wusste ich,<br />
dass sie nichts Genaues wussten, dass Henri Weilbacher nichts über die Universität losgelassen<br />
hatte. Daraufhin fuhr mein Scherge plötzlich fort: « Sie sind nach dem Feldzug von Juni 1940 nach<br />
Zabern zurückgekehrt und anschließend zur Universität Heidelberg gegangen, bevor Sie 1941<br />
geflohen sind…?». Das konnten sie nur über Mathieu, der das gleiche Restaurant wie wir<br />
besuchte, erfahren haben.<br />
Die folgenden Verhöre dauerten noch zwei ganze Tage. Es wurde zu Routine. Die gleichen Fragen<br />
in Bezug auf den Widerstand an der Universität, die gleichen Antworten, nur nicht mit Bezug auf<br />
Sadron und Dumas (Pharmaziestudent, in Deportation verstorben). Mit einer Waffe bedroht<br />
wurde Sadron aufgefordert, mehr über seine Verbindung zu einem von ihnen gesuchten Professor<br />
im Widerstand preiszugeben. Dumas wurde mit Ohrfeigen traktiert, weil ihnen sein<br />
Personalausweis angeblich gefälscht erschien.<br />
Das war’s. Ich möchte noch hinzufügen, dass Kirrmann, verhört wie die anderen, trotzdem den<br />
Mut hatte, ihnen zu sagen, dass er seit mehreren Jahren an der gleichen Fakultät Professor war,<br />
somit seine Studenten gut kannte und demzufolge eine terroristische Aktivität verdammt gut<br />
abgeschirmt sein müsste, damit er nichts darüber erfahren hätte.<br />
Die zweite Dezemberwoche 1943 ging zu Ende. Mittlerweile kam es zu einer fast familiären<br />
Routine zwischen uns und den Wachposten der Luftwaffeneinheit, die uns verhaftet hatte, umso<br />
mehr weil wir Deutsch miteinander sprachen. Sie besorgten uns Pakete mit Lebensmitteln, warme<br />
Kleidung sowie eine Menge Studien- und Lesematerial, die von den Angehörigen und Freunden<br />
am Kasernentor übergeben wurden. Man hätte meinen können, als wir mit unserer Lektüre am<br />
großen Tisch saßen, dass wir in irgendeiner Bibliothek büffeln würden.<br />
Viele der Soldaten und Offiziere der Luftwaffe verhielten sich unserer Lage gegenüber besonders<br />
höflich, es war ihnen sogar unangenehm, uns zu bewachen. Einem Unteroffizier sagte ich, dass er<br />
in den Lesesaal gestürmt war und mir befohlen hatte, die Hände in den Nacken zu legen. «Aber<br />
ein Dreckschwein muss ich für Sie sein!», antwortete er. Ein anderer, ein Obergefreiter, der mit<br />
meinen Kameraden Witze machte, schreckte auf, als ich ihn anschnauzte: «Hol‘ dem mal die<br />
Zigarette aus der Fresse!». «Warst du das?!» staunte er und sofort entschuldigte er sich für die am<br />
Tag unserer Verhaftung begangenen Brutalitäten.<br />
Das völlig Unerwartete geschah am Morgen des zweiten Sonntags in Dezember 1943. Ein Soldat<br />
in Offiziersuniform, jedoch ohne Schulterklappen, etwa vierzig Jahre alt, ohne Waffen am Gurt,<br />
groß und blond überquerte den Innenhof und kam auf unser Gebäude zu. Was er zu den<br />
Wachposten sagte, weiß ich nicht, aber sie ließen ihn in den Flur eintreten und entriegelten die<br />
Tür. Er kam herein und sagte uns, auf Deutsch, etwa Folgendes: «Ich bin der Militärpfarrer der<br />
hiesigen Truppen. Erlauben Sie mir, Ihnen einen Besuch abzustatten.» Wir waren sprachlos, etwas<br />
misstrauisch. Kirrmann fand die Sprache wieder und zeigte auf sein Kriegsabzeichen der<br />
Wehrmachtsoldaten, die 1941 am Überfall auf die UdSSR teilgenommen hatten und, vor Moskau<br />
von den Russen gestoppt, den schrecklichen Winter 1941-42 erlebt hatten, auch Leningrad<br />
umzingelt hatten, ohne es erobern zu können. So brachte er das Gespräch in Gang.<br />
Der Pfarrer schien beruhigt und beschrieb uns die Lage an der russischen Front, erzählte von<br />
seinen ersten Kriegsjahren, holte insbesondre über das Schicksal und das Verhalten der<br />
Bevölkerung aus. Er betonte, dass es unter den Angegriffenen gar nicht mehr um politische<br />
Beweggründe ging. Das Volk kämpfte um sein Land und nicht für den Bolschewismus, die<br />
35
Kirchen wurden wieder dem Kultus geöffnet und ehemalige Offiziere des Ersten Weltkriegs<br />
hatten das zaristische Abzeichen des Sankt-Georg-Kreuzes wieder angesteckt. Kurzum, so schloss<br />
er, waren diejenigen, die diesen Krieg ausgelöst hatten, für “einen furchtbaren Wahnsinn“<br />
verantwortlich.<br />
Ich versuchte ruhig und tief zu atmen, um meine Emotion und Erregung zu verbergen. Auch<br />
viele andere um mich - das hatte ich sofort gemerkt - waren vom gleichen Gefühl erfasst: ein<br />
solches Vorgehen unter diesen Bedingungen bedarf einer gewaltigen Portion an Mut und eines<br />
enormen Selbstvertrauens. Dieser Mann hatte eine außergewöhnliche Charakterstärke, frei von<br />
jeder Leichtfertigkeit. Nach seinem Namen und der Adresse seines Pfarramtes in Deutschland zu<br />
fragen wäre zu gefährlich für ihn gewesen und ich konnte nie erfahren, wer er war und was aus<br />
ihm geworden ist. Als er einige Tage später wiederkam, um in dem Mädchenraum eine Messe zu<br />
lesen, waren sogar die Atheisten gerührt. Ich konnte einige Worte mit ihm wechseln, ihm meinen<br />
Namen und die Adresse der Madame Monier, rue Blatin in Clermont, nur zwei Häuser von<br />
seinem Kriegspfarramt entfernt, mitteilen. Die Nachricht wurde übergebracht. Anfang Januar<br />
1944, als wir alle entweder nach Compiègne oder nach Drancy abgeführt wurden und nur ich mit<br />
noch drei der unseren in eine Gefängniszelle eingesperrt wurde, gelang es ihm noch, mir einen<br />
Brief zuzuschieben und einen anderen mitzunehmen, obwohl wir immer strenger bewacht<br />
wurden. An einem Abend in Februar 1944 konnte er uns, etwa zwanzig Häftlingen, in einem der<br />
Zimmer noch eine Messe lesen. Hierauf komme ich noch zurück, denn zu der Zeit hatte ich Henri<br />
Weilbacher wiedergesehen. Aber an dem Abend, als er die Ritualgegenstände einsammelte, zog er<br />
mich ins Vertrauen. Er fühlte sich mehr und mehr bedroht und warnte mich: falls die Gestapo das<br />
Gerücht seiner Erschießung durch die Terroristen verbreiten sollte, würde dies bedeuten, dass in<br />
Wirklichkeit jene “Säuberungsinstanz des Nazismus“, die Gestapo selbst, ihn eliminiert hätte. Um<br />
den 10. März sah ich ihn zum letzten Mal, als er, von zwei Wärtern begleitet, noch schnell einigen,<br />
auch mir, an der Zellentür die Kommunion austeilte. Lang nach Kriegsende lief in den Kinos ein<br />
Film, der die Ergebenheit und Selbstlosigkeit eines deutschen Soldaten, eines Franziskaners, im<br />
Gefängnis zu Bourges schildert. Ob er den Krieg überlebte oder auch nicht, unser Pfarrer hat<br />
sicherlich eine gleiche Ehrung verdient und es könnte sein, dass ich bis heute der einzige bin, ihm<br />
diese Ehre zu erweisen.<br />
Mitte Dezember 1943 hatten wir bereits eine erhebliche Portion an Brutalitäten und<br />
Ausschreitungen erlebt, beobachtet oder am eigenen Leibe erfahren. Wir waren Zeugen eines<br />
Mordes (Collomb) und eines Mordversuches (Eppel). Genau am 16. Dezember wurden die<br />
Grenzen der Grausamkeit von einem Ereignis, dessen Zeugen und teilweise auch Teilnehmer wir<br />
waren, überschritten. Durchs Fenster sahen wir, wie eine Gruppe von etwa fünfzehn Männern<br />
und fünf oder sechs Frauen unter Schlägen mit den Gewehrkolben über den Innenhof zum<br />
Gebäude getrieben wurden, in dem wir während der ersten Tage unserer Haft eingesperrt waren.<br />
Es waren die gleichen Soldaten der Luftwaffe. Ein großer Stabsunteroffizier, der gleiche, der bei<br />
unserer Verhaftung so brutal vorgegangen war - wohl der einzige -, löste sich von der Gruppe,<br />
kam auf unseren Flur und schrie: “Alle vom Fenster zurücktreten! Wer am Fenster erscheint, wird<br />
erschossen!“. Schnell übersetzte Kirrmann auf Französisch für diejenigen, die kein Deutsch<br />
verstanden. Anderntags erzählten uns unsere Wärter, dass sie am frühen Morgen einen Einsatz<br />
hatten, um eine Gruppe Terroristen in der Nähe von Billom, westlich von Clermont-Ferrand, zu<br />
überraschen, zu umzingeln und zu fassen. Damals vermutete ich gar nicht, dass ich vier von ihnen<br />
einige Monate später wiedertreffen sollte, nämlich im Lager Flossenbürg. Von den vier sollten Jean<br />
Valet und Guy Gouttelessis überleben.<br />
Ab demselben Abend und während der zwei darauffolgenden Tage sahen wir die Gestapo in die<br />
Gebäude gehen, in denen die Maquisards eingesperrt waren. Es waren dieselben Gestapomänner,<br />
mit denen wir bei unserer Razzia zu tun hatten: Blumenkamm, Kalteis und ein kleiner, gemeiner<br />
Lothringer, Kasper genannt. Ich erinnere mich nicht mehr, wie wir ihre Namen erfuhren,<br />
wahrscheinlich nannten sie sich untereinander beim Namen in der Gegenwart der Wachposten,<br />
die dann später mit uns darüber sprachen. Dieselben Wachposten erzählten auch vom Leidensweg<br />
dieser Verhafteten, die in den zwei Tagen verprügelt wurden, um sie zum Anzeigen der<br />
Widerständler zu bringen, die - von einer jungen Maquisarde alarmiert - die Umzinglung<br />
durchbrachen und sich noch zeitig auf das Plateau Saint-Maurice retten konnten. Die Spannung<br />
stieg, als die drei Dreckskerle plötzlich in unseren Raum erschienen. Kalteiss schrie uns zu, uns<br />
nicht zu bewegen, sitzen oder stehen zu bleiben, wo wir uns befanden, sodass er die einzelnen<br />
36
Gesichter betrachten konnte. Da war auch dieser kleine Halunke Kasper, der mich und die beiden<br />
anderen nach Tabak durchsucht hatte. Offensichtlich suchten sie einen der Gruppe aus Billom, der<br />
sich möglicherweise in unsere Gruppe eingeschlichen hatte. Unverrichteter Dinge zogen sie ab.<br />
Pfeffer sah ganz blass aus. Er war einer der zwei polnischen Studenten an der Universität, die am<br />
25. November nicht wieder freigelassen wurden, und überdies auch Jude. 1939 wurde er in einem<br />
Infanterieregiment (RMV) eingezogen, danach war er aus der Kriegsgefangenschaft geflüchtet und<br />
nach Clermont gezogen, um sein Studium fortzusetzen. Im Jahre 1941, so erzählte er uns, war er<br />
Gefangener in einem Lager in der Nähe von Saarbrücken und bereitete eine neue Flucht vor. Eines<br />
Tages wurde bei ihm ein Klappmesser gefunden und er wurde in eine Baracke vor einen<br />
Polizisten in Zivil geführt. Während mehrerer Stunden verpasste ihm der Polizist - es war Kalteiss<br />
- alle zwei oder drei Minuten eine Ohrfeige, genau dosiert, sodass er jedes Mal auf den Boden fiel.<br />
Zwischen den Ohrfeigen las Kalteiss die Zeitung. So sollte es weitergehen, bis Pfeffer ihm gestand,<br />
wie er zu dem Messer gekommen war. Kalteiss hörte nur auf, weil Pfeffer - ohne Geständnis -<br />
endgültig das Bewusstsein verlor. Später sollte ich erfahren, ohne die genauen Umstände zu<br />
kennen, dass Kalteiss bei der Befreiung gefasst, entlarvt und zu Tode gesteinigt wurde. Pfeffer<br />
hatte damit gerechnet, nach dreißig Monaten von Kalteiss wiedererkannt zu werden.<br />
Wahrscheinlich hatte der Rohling seitdem mit so vielen anderen zu tun gehabt, sodass Pfeffer bei<br />
ihm keinerlei Erinnerung hinterlassen hatte. Nach dem Krieg, in Juni 1945, sollte ich Pfeffer<br />
wiedersehen, als ich mit dem Zug von Paris nach Clermont fuhr. Er war, wie auch Dreyfus und<br />
die anderen Juden, nach Auschwitz deportiert worden. Total erschöpft war es ihm gelungen sich<br />
in den H.K.B. Häftlingskrankenbau einzuschleichen und konnte dort überleben, während er<br />
zuschauen musste, wie Dreyfus dort umkam. Vor nur wenigen Jahren, in Oktober 1988, hörte ich<br />
zufällig, dass Dreyfus‘ Witwe nie etwas über das Schicksal ihres Mannes erfahren hatte. Selbst<br />
hatte ich seit der Befreiung keine näheren Angaben über Dreyfus, um seiner Witwe die traurige<br />
Nachricht überbringen zu können. Ich konnte auch nicht erfahren, ob die beiden Handlanger von<br />
Kalteiss nach dem Krieg gefasst wurden.<br />
Am Morgen des dritten Tages nach der Verhaftung der Maquisards wurden wir in kleinen<br />
Gruppen nacheinander nach draußen geführt. Es ging über weniger als hundertfünfzig Meter zum<br />
Schießstand, am anderen Ende der Kaserne. Dort bekamen wir Spaten und Hacken in die Hände<br />
gedrückt und wurden gezwungen, an zwei vormarkierten Stellen einen enormen, mannstiefen<br />
Graben auszuheben. Wir brauchten zwei ganze Tage und ein Teil des darauffolgenden Sonntags.<br />
Ich war voll bei der Arbeit, als einige Deutsche in Zivil, vom Schlägertyp und im Ledermantel,<br />
erschienen und unsere fertige Arbeit begutachteten. Wir ahnten schon, dass wir zwei<br />
Massengräber für eine standrechtliche Erschießung ausgeschaufelt hatten. Aber für wen? Für die<br />
von Billom? für uns selbst? für beide? Die Angst, die sich ausgebreitet hatte, war dermaßen groß,<br />
dass einer von uns bewusstlos auf den Boden sank. Eine qualvolle Nacht folgte. Die Spannung<br />
dauerte bis zum Ende des darauffolgenden Nachmittags. Die Wachposten nahmen Yvon und noch<br />
einen mit zum Verhörgebäude. Wir blieben den ganzen Tag eingesperrt, ohne Ausgang zu den<br />
sonst täglichen Putzarbeiten.<br />
Unsere zwei Kameraden wurden bloß zum Kehren und Schrubben der Soldatenzimmer abgeholt.<br />
Als sie bei Einbruch der Nacht wieder erschienen, war schon auf ihren Gesichtern zu lesen, dass<br />
Schreckliches geschehen war. Als sie in einem der Zimmer im ersten Stockwerk, in dem die<br />
Gestapo auch uns verhört hatte, aufräumten - so erzählten sie - hatten sie durch die<br />
abgeschlossene Tür Geräusche im Zimmer nebenan gehört: Rasseln von Ketten, erstickte Schreie,<br />
dumpfe Schläge… Abwechselnd spähten sie durch die Türrisse und was sie dann, nach einiger<br />
Zeit erblickten, erfüllte sie mit Schrecken und Entsetzen. Jeweils zu zweit aus der Gruppe im<br />
Erdgeschoss zum ersten Stockwerk geführt, wurden die Maquisards am Rücken gefesselt,<br />
mehrere bekamen Faustschläge auf den Körper, Fußtritte in die Genitalien und wurden nach<br />
draußen geschleppt, während zwei weitere geknebelt wurden. Unter den Peinigern waren auch<br />
Kalteiss und Kasper. Meine beiden Kameraden erlebten die Erschießung nicht, aber anderntags<br />
wussten die Wachposten uns zu berichten, dass die Unteroffiziere und Obergefreiten mit Helm<br />
und Waffen aufgerufen, in Reih und Glied außerhalb des Gebäudekomplexes auf dem Weg zum<br />
Schießstand aufgestellt wurden. Die Maquisards mussten an ihnen vorbeiziehen und wurden zu<br />
den zwei von uns ausgehobenen Gräben geführt. Dort wurden sie erschossen. Einer der Soldaten<br />
wusste, dass sich auch ein junges Mädchen unter den Opfern dieser «Bluthunde» befand. Allzu<br />
grotesk war, dass die Anlieger gegenüber dem Platz von den Fenstern im ersten Stockwerk mit<br />
37
Blick über den Zaun die Tragödie hatten beobachten können. Nicht alle wurden erschossen: drei<br />
Frauen kamen davon und wurden mit unseren Studentinnen eingesperrt. Eine von den drei war<br />
ein aufgewecktes Mädchen, über das ich später noch erzählen werde. Die überlebenden Männer<br />
blieben noch einige Tage in der Kaserne und wurden dann deportiert, die meisten von ihnen zum<br />
KZ Mauthausen. Drei von ihnen traf ich später im Lager Flossenbürg wieder und einer von ihnen,<br />
Jean Valet, erinnerte sich, dass nach der Erschießung die beiden, Kalteiss und Kasper, zu den<br />
Zellen der Verschonten kamen und ihnen sagten, dass die Deportation nach Deutschland nicht<br />
viel besser wäre. Kasper, von seiner Beteiligung geschafft und auf dem Boden sitzend, wurde von<br />
Kalteiss angefahren und als Waschlappen bezeichnet, weil er sich so hängen ließ!<br />
Unsere Wachposten wurden von einer Schar Soldaten aus einer anderen Gegend ersetzt. Es waren<br />
strengere Männer, mit den Aufgaben des Wärters vertraut. Mit diesen neuen kam es nicht zum<br />
Gespräch, wie mit den vorigen. Am 21. oder 22. Dezember erschien der Feldwebel der Kaserne mit<br />
einer bewaffneten Eskorte und las eine Liste mit den Namen der vier oder fünf jüdischen<br />
Kameraden vor. Sie sollten unmittelbare ihre Sachen packen. Wir konnten ihnen noch gerade<br />
einen Blick der Sympathie zuwerfen, denn was hätten wir ihnen schon sagen können!? Wir<br />
ahnten, dass ihr Schicksal besiegelt war. Mit Ausnahme von Pfeffer, der später über das<br />
Verschwinden der anderen berichtete, sollten wir weder Dreyfus, noch die anderen je<br />
wiedersehen.<br />
Trübseliger Abend, Stimmung der Erschöpfung. Wir teilten die Stubengemeinschaft in kleinere<br />
Gruppen auf, sodass eine Gruppe mit einer anderen in Verbindung stand. Im Lauf des<br />
Nachmittags des 23. Dezember 1943 waren wir fast alle rund um Albert Kirrmann versammelt. Er<br />
fasste die Situation zusammen: extrem harte Zeiten würden auf uns zukommen, vielleicht noch<br />
viel grausamer als die bisher erlebten; von allen Häftlingen sollten wir uns als die privilegierten<br />
betrachten, denn unsere guten Deutschkenntnisse und unser intellektuelles Niveau - in aller<br />
Objektivität - würden uns dabei helfen, uns besser, schneller und leichter an die Umstände<br />
anzupassen; wahrscheinlich würden wir mit Bezug auf die Zahl der Überlebenden am besten<br />
abschneiden und das Erlebte genau und detailliert, besser als andere, im Gedächtnis behalten. Er<br />
fuhr fort, dass uns demzufolge eine zweifache Aufgabe zufiel. Sofort und in der nahen Zukunft:<br />
wo wir uns auch befinden würden, ob nun zusammen in der Gruppe oder getrennt, bis zur<br />
individuellen Isolation, immer sollten wir unsere Fähigkeiten nutzen, nicht nur, um selbst aus der<br />
Not zu gelangen, sondern auch um, den Umständen entsprechend, allen anderen in Not oder<br />
Lebensgefahr Hilfe zu leisten. «Es ist noch wichtiger, erläuterte er, dass wir nach dem Krieg, wenn<br />
wir heimkehren und auf Unverständnis und Ablehnung vor solcher Grausamkeit stoßen, immer<br />
wieder die Wahrheit über das Geschehene und Erlebte in aller Objektivität, zu der wir fähig sind,<br />
ans Licht bringen. Gemeinsam wollen wir uns hierzu verpflichten, denn eine solche Verpflichtung<br />
wird uns auch stärken und motivieren, selbst überleben zu wollen.»<br />
Es war als ob sich in jedem selbst ein Zeremoniell, ein Ritual abspielte. Die Zustimmung war<br />
allgemein, in aller Stille, ohne dass irgendein Protest geäußert wurde. Unter denjenigen, die aus<br />
der Gefangenschaft wiederkehrten (im Vergleich mit dem Durchschnitt der Deportierten war die<br />
Überlebensrate in unserer Gruppe deutlich höher), ist mir niemand begegnet, der Kirrmanns<br />
Auftrag nicht nachgekommen war. Unsere erste Arbeit, nach der Heimkehr, war das Aufsetzen<br />
und Sammeln der Zeugnisse aller Straßburger, die über die Konzentrationslager berichten<br />
konnten. Wir verpflichteten uns und schlossen uns dem Schwur des Albert Kirrmann an. Dies<br />
sollte auch befolgt werden, denn beim Durchlesen der ersten “straßburger“ Zeugnisse war man<br />
vom Engagement jedes einzelnen überwältigt, dem am meisten benachteiligten Hilfe zu leisten. In<br />
der Hölle der Konzentrationslager war “Hilfe“ immer mit extremen Bedingungen verbunden,<br />
manchmal hatte sie Erfolg, manchmal kam es zum Scheitern und nicht selten endete sie mit dem<br />
Tod.<br />
Das Jahr 1943 neigte sich dem Ende zu. Wir verbrachten Weihnachten und Neujahr in unserem<br />
Gefangenenraum ohne Heizung. Das neue Jahr fing mit der üblichen Routine an, bis die Situation<br />
am Abend des 4. Januars eine Wendung nahm. Der Winterabend war bereits um fünf Uhr<br />
angebrochen, als eine Patrouille den Raum betrat, die bedeutend stärker als die Mannschaft, die<br />
unsere jüdischen Kameraden am 23. Dezember abgeführt hatte. Es war uns sofort klar, dass wir<br />
verlegt werden sollten. Der Unteroffizier-Dolmetscher des Gefängnisses las die Liste vor. Diesen<br />
Unteroffizier sollte ich später noch öfters treffen. Im Zivilleben war er Pfarrer, hieß La Bradine,<br />
war immer korrekt und zurückhaltend, machte die ganze Zeit eine zutiefst gelangweilte Miene, als<br />
38
Zeichen seines Abscheus, mit der Gestapo arbeiten zu müssen, die Häftlinge zum Verhör zu<br />
begleiten und später, manchmal in einem elenden Zustand, wieder zurückzubringen.<br />
Das Gepäck war schnell gerichtet: einige seltene und wertvolle Lebensmittelreserven samt den<br />
Wollklamotten zusammengebunden. Zwischen den Zurufen “schnell! schnell!“ durch hörte ich<br />
einen der Wachposten zu einem anderen sagen: “Treib sie nicht so!“, und das Tempo wurde<br />
allmählich langsamer. Wir durften miteinander reden, während wir gezählt und nachgezählt<br />
wurden. Fünf von uns waren nicht aufgeführt, darunter Sadron, Dumas und ich, die auf der Liste<br />
von Mathieu standen, was mich und mehr noch Sadron sehr beunruhigte. Von uns drei<br />
befürchtete Sadron, wie besessen, die Erschießung. Die zwei anderen waren Chalus und Kiehl,<br />
sodass wir uns völlig verunsichert fühlten. Nochmals fand Kirrmann die richtigen Wörter: «Im<br />
Vergleich mit den Kriegsgefangenen von 1940 haben wir bis zum Kriegsende dreieinhalb Jahre<br />
Vorsprung und das ist nicht wenig. Also, Mut!». Wir hatten noch die Gelegenheit, uns zum<br />
Abschied zu umarmen. Kaum hatten wir fünf uns wieder hingesetzt, als zwei Wachposten Sadron<br />
abholten. Man hatte ihn vergessen. Schnell musste er sein Marschgepäck wieder zusammenraffen,<br />
überließ uns das, was er nicht mitnehmen wollte, und ging mit einer misstrauischen Miene davon.<br />
Von den siebzig waren wir vier übrig geblieben. Ganz erstaunt, noch dort zu sein, schauten wir<br />
einander fragend an. Spät in der Nacht machten Dumas und ich den Entwurf eines Fluchtplans.<br />
Wir wussten, wo wir durch die Mauer ausbrechen konnten, um dann zu den Latrinen zu<br />
gelangen, dort über eine Mauer zu springen, um so auf der Straße zu landen. Und warum nicht in<br />
der gleichen Nacht? Ich hatte bereits einen der Wachposten ausgehorcht und nochmals<br />
angesprochen, um zu erfahren “was lief“. Ohne Zögern hatte er gesagt, dass es der richtige<br />
Augenblick zum Abhauen sei und dass er seine Augen nicht überall habe! Dumas wollte, dass<br />
seine Eltern, Apotheker in Clermont, benachrichtigt wurden, sodass ein Wagen auf der anderen<br />
Seite der Mauer bereitstünde. Er versicherte uns, anderntags eine Nachricht übermitteln lassen zu<br />
können, nämlich von einem Unteroffizier bei den Latrinen, der von seinem Vater mit<br />
Medikamenten versorgt wurde… Also, erst in der darauffolgenden Nacht könnte es los gehen.<br />
Anderntags, vor Sonnenaufgang, verlief bei den Toiletten alles wie vorgesehen. Der Unteroffizier<br />
versprach uns, anlässlich seiner täglichen Freistunde die Nachricht zu übermitteln. Ich selbst<br />
vertraute diesem Wachposten vollkommen und, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich den<br />
Fluchtversuch bereits in der vorigen Nacht gewagt. Für den Fall, dass uns auf der Straße keine<br />
Hilfe bereitstand, wurde vereinbart, dass jeder seinen Weg gehen und sein Versteck geheim halten<br />
sollte. Zusammen mit Dumas hatte ich den rechteckigen Umriss des zugemauerten Fensters<br />
markiert. Bereits in den ersten Tagen nach unserer Ankunft, also vor einem Monat, war dieses<br />
Fenster mit Backsteinen zugemauert worden, sodass die Wand vollkommen abgedichtet war. Ein<br />
Loch, groß genug für einen Mann, könnte mit einigen spitzen und stumpfen Werkzeugen, die wir<br />
uns besorgt hatten, schnell und lautlos aufgebrochen werden. Unsere Schuhe würden wir mit<br />
dicken Socken und Baskenmützen überziehen. Um vier Uhr nachmittags lag das eingesammelte<br />
Werkzeug versteckt unter dem Stroh, zusammen mit den Leinensäcken, um den Schutt<br />
aufzufangen und nichts herumzustreuen. Um vier Uhr nachts sollten wir die letzte Schicht<br />
durchbrechen und abhauen… mit Gottes Hilfe. Um vier Uhr nachmittags, also eine Viertelstunde<br />
im Voraus zum Zeitplan des Abendbrots, erschien der alte Unteroffizier der Kaserne, ohne die<br />
üblichen Begleitwachposten, befahl uns, unsere Sachen zu packen, und brachte uns zum<br />
Zentralgefängnis. Aus der Traum! Wir überquerten den Kasernenhof, gingen durchs Tor zur<br />
Straße und danach den Bürgersteig entlang bis zum Eingangstor des Zentralgefängnisses. Als wir<br />
aus dem Tor auf die Straße marschierten, kam eine Frau aus der Wirtschaft gegenüber. Sie hatte<br />
den Vorgang beobachtet. “Meine Mutter“, sagte Dumas. Mutig kam sie auf uns zu, lief weinend<br />
und seufzend einige Schritte neben ihrem Sohn bis zum Gefängnistor. Der Unteroffizier, murrend,<br />
ließ sie in Ruhe. Blass vor Aufregung und Emotion konnte sie ihren Sohn, der als letzter in den<br />
Warteflur eintrat, noch umarmen. Es war das letzte Mal. Dumas überlebte bis April 1945 im<br />
Kommando Flöha, Außenlager des KZ Flossenbürg, und wurde bei der Evakuierung des Lagers<br />
erschossen.<br />
Wir wurden durchs Gebäude und über einen Innenhof geführt und alle vier in eine der zwei<br />
großen Zellen, in der sich bereits ein Dutzend Gefangene befanden, eingesperrt. Im Halbdunkel<br />
konnte ich keine Gesichter erkennen. Ich rief die Menge hinein: «Guten Abend, Jungs! Kann man<br />
es sich hier irgendwie einrichten?». Eine Stimme meldete sich: «Was macht ihr hier?». Ich war<br />
sprachlos. Henri Weilbacher!? Er wusste also nicht, dass ich verhaftet worden war. Und er? Was<br />
39
machte er dort? Während die einen den anderen halfen, sich einzurichten, krochen wir in seine<br />
Ecke. Wir versuchten Dumas, der zweifach bedrückt war, sowohl wegen des misslungenen<br />
Fluchtversuchs als auch aufgrund des Wiedersehens mit seiner Mutter, unter die Arme zu greifen.<br />
Henri Weilbacher forderte mich auf, die ganze Geschichte zu erzählen. Schnell erledigt: die Liste<br />
von Mathieu, meine Vernehmung bezüglich unseres Treffens im Polizeirevier, meine Erklärung.<br />
Dazu wusste er zu berichten, dass er am ersten Oktober verhaftet wurde und bis November 1943<br />
unter strengster Geheimhaltung eingesperrt war, Hände und Füße mit Stacheldraht gefesselt (die<br />
Stellen seiner Kleidung an Ellbogen und Knien waren geflickt worden). Er wurde vom Führer der<br />
Gestapo Zone Süd, SS-Sturmbannführer Geissler, persönlich verhört. Eine Frau, im Dienst der<br />
Vichy-Miliz, aufgrund seiner Kontakte misstrauisch geworden, habe ihn angezeigt. Er nannte mir<br />
ihren Namen, den ich vergessen habe. Erst nach mehreren Wochen Verhör hatte Geissler das<br />
Thema des Widerstandsnetzes an der Universität angeschnitten, das Henri organisiert haben soll.<br />
Henri hatte alles geleugnet. Geissler hatte keinen einzelnen Namen nennen können, der ihn in<br />
Bedrängnis gebracht hätte. Es war also nicht auf diese Art und Weise, dass Mathieu über unsere<br />
Bekanntschaft erfahren haben konnte. Er stimmte meinem Vorwand zu, unter dem ich ihn in Juni<br />
1943 im Polizeirevier aufgesucht hatte, und wir vereinbarten, uns an diese Erklärung zu halten,<br />
falls wir nochmals zu dieser Angelegenheit verhört werden sollten. Er war der Meinung, dass die<br />
Sache mit Bezug auf ihn seit der Aufhebung seiner Geheimhaltung abgeschlossen war. In der<br />
Folge war er zusammen mit anderen eingesperrt worden, wie auch Kolonel Boutet und François<br />
Marzolf, die am gleichen Tag wie er verhaftet wurden. Es hatte keinen Sonderbefehl zur deren<br />
Überwachung gegeben und Marzolf war sogar für die Reinigungsarbeiten im Gefängnis eingeteilt<br />
worden.<br />
Zwei Monate, bis Anfang März 1944, sollten wir zusammen in der gleichen Zelle verbringen.<br />
Obwohl bis auf die Knochen abgemagert, war seine Geistesstärke unversehrt geblieben. In aller<br />
Diskretion gab er mir zu verstehen, dass Geissler hauptsächlich über die möglicherweise<br />
weitergeleiteten Nachrichten und Hinweise hinsichtlich der deutschen Luftwaffenbasis in Aulnay<br />
nah Clermont besorgt war. Das würde meiner Meinung nach reichen, um uns alle zu erschießen.<br />
Henri schien jedoch voller Vertrauen. Meine Überzeugung, dass der SS-Sturmbannführer Geissler<br />
beschlossen hatte, meinen Freund zu beseitigen, wurde Ende Januar während eines weiteren<br />
Gesprächs mit Henri bestätigt.<br />
Der Winter war streng und morgens mussten wir, um uns im Innenhof einigermaßen waschen zu<br />
können, das Eis von der Wasserzufuhr entfernen. Der einzige Vorteil solcher Wetterbedingungen<br />
war, dass wir in der Zwischenzeit unsere Klamotten wie flanellene Gürte und Wollsachen, die wir<br />
nachts um die Lenden trugen und die von sehr fortpflanzungsfähigen Läusen befallen waren, zur<br />
Parasitenbeseitigung auf die Leine hängen konnten. In wenigen Augenblicken wurden diese<br />
Parasiten samt ihren unzählbaren Eiern vom Frost getötet. Schnellstens wieder angezogen, trafen<br />
wir wieder in unserer Zelle ein und waren überglücklich, dass wir uns mithilfe einiger vorher<br />
eingesammelten Brennstoffe aufwärmen konnten. Eines Tages, nach der “Toilette“ wieder<br />
zurückgekehrt, saß ich auf der Bank neben Henri, während die anderen Kameraden sich auf ihren<br />
Matratzen zusammenkauerten. Seit einiger Zeit, einiger Tage, hatte sich der Schmerz in meinen<br />
zersplitterten Backenzähnen wieder bemerkbar gemacht. Mal der eine, mal der andere bloßgelegte<br />
Nerv verursachte mir über mehrere Wochen einen stechenden Schmerz, ein wahres Martyrium.<br />
Nachdem er nach mehreren Wochen Verhör von seinen Fesseln befreit und in ziemlich normale<br />
Haftbedingungen versetzt wurde . so erzählte mir mein Freund - ließ Geissler ihn vorführen und<br />
fing ein unerwartetes Gespräch an, als ob nie was passiert wäre. Wie unter Kollegen der Polizei<br />
ging das Gespräch über seine Karriere,, über seine Verantwortung. Unter anderem sagte er ihm,<br />
indem er sich selbst hochlobte, dass er zu seiner derzeitigen Aufgabe der Repression berufen<br />
worden sei, nachdem sein direkter Vorgesetzter, Reinhard Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei<br />
SIPO, 1942 in Prag von einem britischen Kommando erschossen worden war. Er sei, so fügte er<br />
hinzu, der Führer der Repressalien, der Verantwortliche für die Vernichtung der Ortschaft Lidice<br />
sowie für die Erschießung der Männer und die Deportation der Frauen und Kinder gewesen.<br />
Plötzlich, mitten in seiner Schilderung des Geschehenen, fragte Henri mich, weshalb ich so blass<br />
geworden war. Ich erwiderte, dass es ein blankgelegter Nerv sei, der wieder anfing, mich zu<br />
quälen. Das war diesmal gelogen, aber der einzige Vorwand, der mir einfiel, um mein Entsetzen<br />
zu verbergen. Wenn Geissler zu solchen Geständnissen überging, dann nur weil er bereits<br />
entschieden hatte, meinen Freund zu eliminieren, und er Katz und Maus mit ihm spielte. Es<br />
40
gelang mir noch, ich weiß nicht mehr wie, das Gespräch fortzuführen, indem ich vom Thema<br />
ablenkte. Ich war völlig erstaunt und gleichzeitig erleichtert, dass Weilbacher sich nicht bewusst<br />
war, dass die Enthüllung Geisslers sein Todesurteil bedeutete. Geissler, ähnlich wie Reinhard<br />
Heydrich, sollte im Frühjahr 1944, kurz nach meiner Deportation, für seine Verbrechen dank eines<br />
Scharfschützen des Widerstands, “Terroristen“ des Maquis zu Murat bezahlen: Geissler befand<br />
sich, seinen Notizen prüfend und nachdenkend - er hatte alle seine abzuhandelnden<br />
Angelegenheiten im Gedächtnis und nur er konnte die dazu in einem Heft eingetragenen Notizen<br />
entziffern - auf der Eingangstreppe zu einem beschlagnahmten Hotel; ein vorgerückter<br />
Maquisard, auf etwa vierhundert Meter Entfernung, hatte die Waffe bereit und, da es sich nur um<br />
einen Deutschen handeln konnte, schoß er: Eine Kugel reichte, um Geissler zu töten. Die<br />
Repressalien blieben nicht aus, blind und schrecklich. Mehrere Dutzend Personen wurden gefasst<br />
und erschossen, Hunderte von anderen (die genaue Zahl ist nicht bekannt) wurden nach Razzien<br />
in der Umgebung deportiert, die meisten von ihnen nach Mauthausen.<br />
Aufgrund dieser schrecklichen Repressalien sollten einige Gutgläubige nach Kriegsende<br />
behaupten, dass, in Anbetracht des grausamen Todes hunderter Franzosen als Vergeltung für den<br />
Tod eines einzelnen Mannes, der Widerstand im Grunde genommen nichts gebracht hätte und<br />
bloß ein überflüssiger Wahnsinn war. Dennoch hat der Tod dieses Mannes, Geissler, zu einer<br />
völligen Desorganisation des regionalen Kampfes gegen die zahlreicher werdenden<br />
Widerstandskämpfer geführt. Dazu kann ich ein bedeutendes Beispiel aufführen: Im besagten<br />
Heft des SS-Sturmbannführers Geissler war auch der Name des Berufssoldaten Kapitän Pavelet,<br />
zusammen mit mir verhaftet und deportiert, mit kabbalistischen und nur für Geissler<br />
verständlichen Notizen eingetragen; auf Befehl von Geissler wurde Pavelet von Mathieu, bereits<br />
ganz im Sold der Gestapo, aufgespürt und verhaftet. Im Gefängnis zu Clermont sagte Mathieu zu<br />
Pavelet: «Du hast das Glück, dass unser Führer Geissler getötet wurde, denn dein Name steht in<br />
seinem Heft. Seine Notizen zu deiner Person können wir leider nicht entziffern. Du entkommst<br />
zwar dem Galgen, jedoch nicht der Deportation.» André Pavelet, später Kolonel, erzählte mir<br />
selbst diese Begebenheit, lange nach unserer Heimkehr aus Flossenbürg und einige Monate vor<br />
seinem tödlichen Verkehrsunfall.<br />
Es ist anzunehmen, dass dem tschechischen Volk der Name des Mörders von Lydice bekannt ist,<br />
aber ich bezweifle, dass die Tschechen auch wissen, dass Geissler von einem französischen<br />
Maquisard erschossen wurde. In 1978 kam es fast zu einem eklatanten Zwischenfall, nämlich als<br />
die Presse bekannt gab, dass ein Interview mit der Witwe Geisslers im Fernsehen ausgestrahlt<br />
werden sollte. Frau Geissler war zum wiederholten Mal auf einer Reise in Frankreich, um sich wie<br />
gewohnt mit Produkten aus dem Périgord einzudecken! Der Skandal war abzusehen. Verbände<br />
ehemaliger Deportierter und deren Familien protestierten energisch und die Sendung wurde<br />
gestrichen. Ich schrieb einen Leserbrief an meine Tageszeitung, Le Monde, mit der Bitte meinen<br />
Bericht unter anderem über die kriminellen Tätigkeit des Geissler in Lydice, wie Weilbacher es mir<br />
übermittelt hatte, zu veröffentlichen. In einem sehr höflichen Brief motivierte Jean Planchais,<br />
damals stellvertretender Chefredakteur der Zeitung, die Nutzlosigkeit eines Heraufbeschwörens<br />
der Vergangenheit und schrieb: «Mein Vater ist in Dachau umgekommen und ich weiß nicht, wie<br />
ich das meinen Kindern erklären sollte.». Ich war von seinem Unverständnis aufs Tiefste gekränkt<br />
und schockiert. Die positive Seite der Ablehnung war jedoch, dass mir damals, vor fast zwölf<br />
Jahren, auf einen Schlag deutlich wurde, wie wichtig und nötig es war, dem Kirrmann gegebenen<br />
Schwur nachzukommen, die Botschaft weiterzugeben und meine eigene Kriegschronik<br />
niederzuschreiben.<br />
Im Gefängnis, auch “92“ genannt, reihten sich die Tage aneinander. Wir warteten gespannt auf<br />
Nachrichten. Bei jedem Erscheinen der Gestapo zuckten wir vor Angst zusammen.<br />
Neugekommene wurden gierig befragt. Und wie die menschliche Natur nun einmal ist, gab es<br />
auch Augenblicke der Freude und des Trosts. Eines Abends brachte der Wachposten einen<br />
“Neuen“, linkisch unbeholfen, völlig verwirrt, steif im Mantel, den Hut in den zitternden Händen.<br />
Von allen Seiten kamen die Fragen wie geschossen. Ich erinnere mich, wie er uns erklärte, dass er<br />
Blumenhändler in Clermont war und wie einer von uns, ohne die Miene zu verziehen und ohne<br />
sich beim Essen stören zu lassen, zu ihm sagte: «Den Hut kannst du ablegen, denn es wird hier<br />
noch etwas dauern.». Henri Weilbacher und ich bekamen einen Lachkrampf, der uns alles andere<br />
vergessen ließ. Einige Tage später nahm der Blumenhändler seinen Hut. Er wurde freigelassen.<br />
41
Angeblich, jedenfalls laut übereinstimmender Indizien, hatte seine Frau - durch Zahlung mit ihrer<br />
eigenen Person bei der Gestapo - seine Freilassung bewirkt.<br />
Eines anderen Tages, beim Gitter Ausschau haltend, schlug ich Alarm, als ich einen unbekannten<br />
Wachposten den Innenhof in unsere Richtung überqueren sah. Er öffnete die Tür und schüttelte<br />
die Hände einiger “Altgesessener“, die ihn angeblich kannten. Er konnte etwa Ende vierzig, fast<br />
fünfzig sein und - so sagte er - “im Zivilleben“ war er Gefängniswärter. Stolz zeigte er auf seine<br />
Abzeichen, unter denen auch die international anerkannte Gefängnismedaille, die er - so betonte<br />
er - vor 1933 bekommen hatte. Er brauchte einen zuverlässigen Dolmetscher und alle zeigten auf<br />
mich. «Ich komme mich von Ihnen verabschieden. Ich kann es nicht mehr ansehen, wie Patrioten<br />
wie Sie hier behandelt werden und deshalb habe ich um etwas gebeten, was sie mir nicht<br />
verweigern können, nämlich als Freiwilliger wieder an die Ostfront versetzt zu werden.» Beim<br />
Übersetzen war ich sehr gerührt. Dies war das zweite Mal, nach dem katholischen Pfarrer der<br />
Wehrmacht, dass ich ein Gefühl des tiefen Respekts vor dem vorbildlichen Verhalten eines<br />
deutschen Soldaten empfand. Weder den Pfarrer noch diesen Gefängniswärter sollte ich je<br />
wiedersehen.<br />
Die Aufzählung der Lichtblicke wäre unvollständig, wenn ich nicht eine Art Idylle, die ich einige<br />
Wochen lang erleben durfte, erwähnen würde. Bei “Titi“- den Spitznamen hatten wir ihr gegeben -<br />
hatte ich einen Stein im Brett. Sie wurde im vorigen Dezember zusammen mit den<br />
Widerstandskämpfern in Billom gefasst. Von denen, die nicht bei dem von den<br />
Universitätsstudenten ausgehobenen Graben erschossen wurden oder nicht deportiert wurden,<br />
waren nur Oberfeldwebel Frobert der Gendarmerie, bereits zusammen mit uns eingesperrt, und<br />
dieses pfiffige, noch keine achtzehn Jahre alte Mädel, zurückgeblieben. Die Deutschen, sowohl die<br />
Gestapo als auch die Wachposten, nannten sie spottend die “Terroristin“, gerade weil sie<br />
überzeugt waren, dass sie keine sein konnte. Sie wurde für die leichten Arbeiten auf dem<br />
Gefängnisflur eingesetzt. Von den Wächtern geneckt, spielte sie das Spielchen fröhlich mit, denn<br />
so gelang es ihr, zahlreiche für die Moral wichtige Nachrichten und Neuigkeiten zu verbreiten. In<br />
der Überzeugung, dass Titi während der Aktion gegen die Maquisards durch Zufall geschnappt<br />
wurde, nahmen die Schergen der Gestapo sie öfters, für einen oder zwei Tage, mit nach Royat,<br />
nördlich von Clermont-Ferrand, damit sie dort in ihrer beschlagnahmten Villa die Hausarbeiten<br />
erledigte. Obwohl ich andere Sorgen hatte, fielen mir doch schnell die äußerst freundschaftlichen<br />
Gesten auf, die sie, so oft sie dazu die Gelegenheit bekam, insbesondre an mich richtete. Eines<br />
Tages gelang es ihr, mir eine Botschaft, eine verhüllte Liebeserklärung, zuzuschieben. Sie verriet<br />
mir ihren Namen, Augusta, und schrieb, dass sie aus einer armen Familie mit zehn Kindern<br />
stammte. Ihr Vater führte ein Café. Jetzt, wo sie ganz tolle, mutige und liebevolle Leute getroffen<br />
hatte, war sie zum ersten Mal entzückt, sich in diesem Gefängnis zu befinden, umso mehr da sie<br />
mich sehen konnte. Deutlicher konnte sie wohl nicht sein… An einem Morgen im Februar, nach<br />
dem Waschritual am Brunnen, auf dem Weg zu den Toiletten, fasste ein Kamerad - er musste<br />
Bescheid gewusst haben - mich beim Arm und zog mich unter die eisernen Treppe, die zu den<br />
Zellen auf der Etage führte. Ich sollte ein Moment ruhig stehen bleiben. Er gab ein Zeichen, worauf<br />
“meine“ kleine hübsche Rothaarige erschien. Sie umarmte mich und küsste mich auf beide<br />
Wangen, um dann - ohne ein einziges Wort - sofort zu verschwinden, als ob sie sich schämen<br />
würde. Ein eigenartiges Gefühl, zugleich gerührt und genervt zu sein. Genervt, denn mich quälte<br />
ständig die Unsicherheit über mein Schicksal und ließ mir keinen Raum für Emotionen und<br />
Sentimentalität. Gerührt, indem ich mir sagte: endlich jemand, dem das Gefängnis zu bekommen<br />
scheint. Was ich erst später erfahren sollte und was in diesem Zusammenhang wohl wichtiger<br />
war, ist, dass Augusta nicht “zufällig“ bei der Razzia mitgefangen wurde. Sie war niemand anders<br />
als die Verbindungsfrau zu Coulandon, dem Verantwortlichen des Maquis im Departement Puyde-Dôme.<br />
Als sie am Morgen des 16. Dezember 1943 die Deutschen kommen sah, kam sie ihnen<br />
zuvor und lief im Nachthemd zum Dorf, um ihre Leute zu alarmieren: «Rettet euch! Die Deutsche<br />
kommen herauf!». Ein Teil der Résistants konnte der Gefangennahme entkommen. Zwar hatten<br />
die Deutschen eine junge Frau, die Alarm geschlagen hatte, gesehen und überall gesucht, jedoch<br />
wussten sie nicht, dass es gerade das bereits zusammen mit den anderen verhaftete Mädel war. Im<br />
Gefängnis war sie sehr beunruhigt: ihre Papiere waren gefälscht und unter den rotgefärbten<br />
Haaren wuchsen ihre natürlichen braunen allmählich nach. Sie befürchtete, eines Tages erkannt zu<br />
werden und suchte eine Möglichkeit zur Flucht. Sie hatte es fertig bekommen, für allerhand<br />
Arbeiten, auch außerhalb des Gefängnisses, eingesetzt zu werden, mit der Absicht, die erste<br />
Gelegenheit zu nutzen, um die Flucht zu ergreifen. Als sie wieder für die Hausarbeiten nach Royat<br />
42
mitgenommen wurde und dort übernachtete, fiel ihr auf, dass der Wachposten der Wehrmacht am<br />
Tor ein Neugekommener war. Am frühen Morgen schnappte sie sich in der Küche die<br />
Milchkanne, marschierte entschlossen auf den Wachposten zu und - in aller Ruhe, aber mit einer<br />
kolossalen Dreistigkeit - erklärte sie ihm - in Gebärdensprache mit ein Paar Brocken Deutsch -,<br />
dass sie wie jeden Morgen die Milch holen musste. Der verblüffte Mann ließ sie gehen und, einmal<br />
um die Straßenecke, war sie in Windeseile verschwunden. Als die Gestapo nur noch ihr<br />
Verschwinden feststellen konnte, führte sie grausame Ermittlungen innerhalb des Gefängnisses<br />
durch und erfuhr, dass Augusta damals den Alarm geschlagen hatte. Von Wut ergriffen<br />
mobilisierten sie anderntags ein ganzes Bataillon, um sie aufzuspüren. Sie wurde beinahe bei einer<br />
ihrer Schwestern geschnappt, konnte aber noch knapp entfliehen. Nach dem Krieg versuchte sie,<br />
mit mir Verbindung aufzunehmen, und erst nach Jahren, nachdem ich das Elsass verlassen hatte<br />
und nach Paris gezogen war, trafen wir uns wieder. Sie erzählte mir ihre Geschichte: wie sie bis<br />
zum Kriegsende im Maquis gelebt hatte, über die Befreiung ihrer Gegend, das Todesurteil für<br />
Mathieu, seine Hinrichtung, der sie beigewohnt hatte. Bis heute haben wir den Kontakt<br />
beibehalten. Heute ist Augusta Lorenzi eine dynamische und liebevolle Großmutter, die mit einem<br />
talentierten Bildhauer verheiratet ist. Meine Kinder mögen sie sehr und die Zuneigung ist<br />
beiderseits.<br />
Im Gefängnis blieb die Atmosphäre weiter erdrückend, nicht zuletzt aufgrund einer Reihe<br />
grausamer Ereignisse, wie sie unter anderem Frobert, dem Oberfeldwebel von Billom,<br />
widerfuhren; sie waren das Grauenhafteste, das ich während meiner Verhaftung im “92“ zu<br />
Clermont erfahren habe. Die Gestapo hatte ihn bei der Massenerschießung geschont, um ihn über<br />
seine Beteiligung bei der Abschirmung, wenn nicht sogar bei der Bildung des Maquis auf der<br />
Ebene Saint-Mauric nahe Billom zu befragen. Sie wollten vor allem wissen, wer seine Vorgesetzten<br />
innerhalb der klandestinen Organisation waren. In der Zelle spürten alle seine fürchterliche Angst.<br />
Ich kann mich erinnern, wie er an einem Nachmittag von einem Unteroffizier der Wachposten aus<br />
der Zelle geholt wurde. Er schnallte den Riemen über seine Oberfeldwebeljacke und ging, ohne<br />
ein Wort verlauten zu lassen. Wir sollten ihn nicht mehr wiedersehen. Als er abends nicht<br />
erschien, begriffen wir, Henri Weilbacher und ich, dass es ernst war. Anderntags konnte “Titi“ uns<br />
mitteilen lassen, dass er blutend und fast bewusstlos in eine Zelle geworfen worden war, in die<br />
Arme eines anderen Widerstandskämpfers, der ebenfalls “verschärft“ verhört wurde. Erst etliche<br />
Tage später erfuhren wir, dass er erneut “bearbeitet“ worden war und unter der Folter ohne<br />
Geständnisse gestorben war. Seine Leiche wurde in einen Sack genäht und später<br />
wiedergefunden.<br />
Die ersten Märztage 1944 wurden von einer Wende im Gefängnisleben geprägt. Die Verhaftungen<br />
nahmen zu, die Zellen wurden übervoll. An einem Nachmittag wurde unsere Zelle aufgeteilt: fünf<br />
von uns kamen zu sechs anderen in eine für sechs Häftlingen vorgesehenen Zelle: elf Männer auf<br />
engstem Raum zusammengepfercht. Alles musste ganz schnell gehen, in wenigen Minuten, sodass<br />
ich nicht einmal die Zeit hatte, den Unteroffizier zu fragen, ob ich mit Henri Weilbacher<br />
zusammenbleiben bleiben könnte. Ich hatte noch die Geistesgegenwart, mit Genehmigung des<br />
Wärters den Ofen und das Ofenrohr mitzunehmen, sodass wir abends Feuer hatten.<br />
Als ich fast zwanzig Jahre später, in November 1963, an der Organisation des 20. Jahrestags der<br />
Verhaftungen in Clermont beteiligt war, bekam ich die Genehmigung, die Strafvollzugsanstalt mit<br />
dem neun Namen “Centre Giscard“ - nicht mehr “92“ - zu besichtigen. In der Zelle, in der ich in<br />
März 1944 einige Tage verbracht hatte, stand der gleiche Ofen mit dem gleichen Ofenrohr an der<br />
gleichen Stelle, so wie wir ihn damals innerhalb von drei Minuten aufgebaut hatten.<br />
An dem Abend, nachdem wir uns einige Schaufeln Kohle besorgen konnten, blieb die Zelle nicht<br />
länger eiskalt. Unsere sechs Vorgänger - wir waren zusammen elf - gaben uns ihre Erleichterung<br />
kund, endlich ein wenig Wärme zu spüren. Dumas, Chalus und ich teilten die Reste unserer<br />
Vorräte. Die entspannte Atmosphäre brachte die Gespräche in Gang. Ein noch robuster Mann,<br />
bestimmt über fünfzig, fiel durch seine Persönlichkeit auf: Kommandant Billot, in 1914 - wie meine<br />
beiden Onkel - Freiwilliger, Kapitän im Alter von 26 Jahren. Er war - und die Gestapo wusste es -<br />
der Leiter des Widerstands im Departement Haute-Loire. Er berichtete uns über den Angriff auf<br />
das Gefängnis von Le Puy, wodurch ein Teil der Verhafteten die Flucht ergreifen konnten. Selbst<br />
wurde er zusammengeschlagen und anderntags sagte ihm der Folterknecht, dass er erfahren hatte,<br />
dass er kein Kommunist war, und sprach sein Bedauern aus, einen Ehemaligen des “Großen<br />
43
Kriegs“ verprügeln zu müssen! Er bot Billot sogar eine Zigarette an, aber letzterer lehnte kurz und<br />
entschlossen ab. Er war sich sicher, dass er aufgrund seines Alters diese schwere Zeiten nicht<br />
überleben würde. So war es: er starb im Deportationslager.<br />
Die Märztage, die wir in der Zelle verbrachten, schienen aufgrund der rasch aufeinander<br />
folgenden Ereignisse schnell zu vergehen. Noch einmal sah ich den deutschen Militärpfarrer, als<br />
er anlässlich eines Besuchs in den Zellen bestätigte, ein letztes Mal eine Nachricht von mir nach<br />
draußen überbringen zu können. Einen von meiner letzten 1000-Francs-Scheinen gab ich einem<br />
Wachposten, um uns Zigaretten zu kaufen. In der Nacht vom ersten Sonntag auf Montag, gegen<br />
Mitternacht, wurde die Tür der Zelle geöffnet und ein Wärter führte einen Neuverhafteten herein:<br />
«Der legt sich noch dazwischen!».<br />
Sofort schossen die Fragen los, um die letzten Neuigkeiten von draußen zu erfahren. Er stellte<br />
sich vor: Professor Géry von der Straßburger Fakultät. Er war mir nicht nur als angesehener<br />
Krebsspezialist bekannt, sondern auch wegen seiner freimütigen, manchmal unfeinen Sprache, die<br />
er aus seiner Studentenzeit beibehalten hatte. Ich erinnere mich, dass einer von uns, ein Landwirt,<br />
ihn eines Tages fragte, was Krebs nun eigentlich sei. «Ich weiß es nicht, antwortete er. Es gibt<br />
Leute, die meinen, es zu wissen. Seit dreißig Jahre beschäftige ich mich mit Krebsfällen und ich<br />
weiß es immer noch nicht.» Einige Wochen später wurde er wieder freigelassen und es war mir<br />
eine Freude, ihn im Herbst 1945 im Komitee zur Veröffentlichung der Straßburger Aussagen<br />
wieder zu treffen. Einige Jahre später sollte ich im Rundfunk über das Ableben des<br />
Krebsspezialisten Géry erfahren.<br />
In jenen Tagen fühlte ich mich schwach und fiebrig. Während des einzigen Spaziergangs der<br />
Woche, eine halbe Stunde lang, mussten mich zwei Kameraden beim Gehen unterstützen. Durch<br />
die Gitter zum Hinterhof des Gefängnisses grüßten einige, die mich kannten, mit Zeichen von<br />
Sympathie und Ermutigung. Meine größte Sorge waren die rasenden Schmerzen an den<br />
Backenzähnen; angeblich waren die Zahnnerven endgültig angegriffen.<br />
Der zweite Sonntag im März brach an. Gedränge auf dem Flur, Fluchen der Wächter in den<br />
Gängen. Durch den Spion in der Tür - der Deckel an der Außenseite war abgerissen - hörten wir,<br />
dass von einem Attentat und einer Razzia die Rede war. Der Obergefreite entriegelte die Tür und<br />
schrie: «Es fehlen noch zwei Männer für den Kohlendienst!» Zusammen mit einem anderen<br />
Zellgenossen meldete ich mich, trotz meiner Müdigkeit: über den ersten Innenhof, Richtung<br />
Zulieferungstor, Torflügel öffnen, Lkw quer zum Eingang, abladen. Zwei Soldaten und mehrere<br />
von uns gingen an die Arbeit, von einem ekelhaften Unteroffizier mit Revolver und zwei Soldaten<br />
mit Maschinengewehr bewacht. Auch Weilbacher hatte es geschafft, sich für diese Arbeit einsetzen<br />
zu lassen. Er sah verstört aus, blass vor Panik: «Boutet und Margolf wurden zum Tode verurteilt.»<br />
- «Und du?» - «Nein», konnte er kaum herausbringen. Seit langem versicherte er mir, sich zur<br />
Flucht entschieden zu haben, wenn er dazu käme, seine Männer draußen über die Tage und<br />
Stunden, an denen zweimal in der Woche Brennstoff geliefert wurde, zu benachrichtigen, sodass<br />
ein Auto für die Flucht bereit stünde, wenn er durch den Durchgang zwischen dem Längsträger<br />
und dem Tor stürmen würde. So weit hatte er es noch nicht organisieren können und vor den<br />
Augen dreier bewaffneter Männer hatte er überhaupt keine Chancen. Ich ahnte jedoch seine<br />
Versuchung, es zu wagen, sogar den Todesschuss heraufzubeschwören. Die nur wenigen Minuten<br />
Schaufelarbeit ließen es nicht zu, ihm einen Rat zu geben. Auf dem Rückweg zur Zelle rief jemand<br />
meinen Namen, ein junger Student, den ich nicht kannte, der mich aber wiedererkannt hatte. Er<br />
wurde im Freundeskreis Saint-Louis geschnappt, in der Nähe des Attentats.<br />
Er hatte gerade Zeit, mir das Attentat der “Place de la Poterne“ und die Repressalienrazzia im<br />
Freundeskreis Saint-Louis, dem auch er angehörte, und die Verhaftungen in diesem Stadtviertel<br />
kurz zu schildern. Kaum hatte ich meinen Kameraden in der Zelle die Geschichte weitererzählt,<br />
als die Tür wieder aufging. La Brazine, der Pfarrer-Dolmetscher rief mich. Schweigend folgte ich<br />
ihm zum Kommandoposten. Ich wurde neben zwei andere gestellt: ein luxemburgischer<br />
Deserteur, dessen Namen ich vergessen habe und der später exekutiert werden sollte, und einer<br />
der Wachposten, den ich kannte. Sofort wusste ich, was Sache war, noch bevor der Hauptmann,<br />
Kommandant des Gefängnisses, anfing zu schreien und uns durch eine Kostprobe seines<br />
gepflegten Wortschatzes seine Verachtung für solche Leute, wie wir, und sein Entsetzen über die<br />
Bestechung eines “seiner“ Soldaten zum Ausdruck zu bringen, der uns Rauchzeug beschaffen<br />
44
sollte. Dann wandte er sich zum Feldwebel, dem Chef der Wache: «Haben sie überhaupt das<br />
Recht, zu rauchen?» - «Nein, gar nicht!», antwortete der Arschkriecher. - «In dem Fall, acht Tage<br />
Dunkelzelle für beide!» Als ich über den ersten Innenhof geführt wurde, merkte ich gar nicht -<br />
meine Zellenbrüder erzählten es mir später -, dass der Dreckskerl von einem Unteroffizier mit<br />
dem auf mich gerichteten Revolver hinter mir herlief, so wie er auch hinter Boutet und Marzolf<br />
gelaufen war. Der Unterschied zu mir war, dass den beiden die Hände auf den Rücken gefesselt<br />
waren, für jeden zwei Paar Handschellen, vom Pulsgelenk des einen Arms zur Elle des anderen<br />
übereinander gekreuzt. So verbreitete sich dann auch das Gerücht, auch außerhalb des<br />
Gefängnisses, dass auch ich zum Tode verurteilt worden sei. Dieses Gerücht gelangte über den<br />
geheimen Weg bis nach Zabern ins Elsass, wie ich bei meiner Heimkehr aus der Deportation<br />
erfahren sollte.<br />
Als ich in unseren Gebäudetrakt eintraf, wurde ich von La Brazine erwartet. Ich konnte meine<br />
Sachen aus der Zelle mitnehmen und informierte meine Kameraden über meine Strafversetzung in<br />
die Dunkelzelle. Er führte mich gerade zwei Schritte weiter in die Dunkelzelle, neben den<br />
Toiletten. In dieser Zelle, die genau so wie die anderen aussah, nur dass sie viel feuchter war und<br />
es keine Fenster nach außen gab, waren schon zwei Häftlinge eingesperrt: Doktor Pierre Bassin<br />
und Pépin. Bassin wurde nach 40 Tagen Dunkelzelle wieder freigelassen, denn angeblich war er<br />
mit einem anderen Pierre Bassin verwechselt worden. Er ist heute 84, jedoch ernsthaft krank.<br />
Pépin wurde zusammen mit mir deportiert, überlebte die Lager, aber erlitt im Alter von 44 Jahren<br />
einen Herzinfarkt und starb fünf Jahre später. Ich habe noch Briefwechsel mit seinen Kindern.<br />
Wir waren ganz von den anderen Teilen des Gefängnisses abgeschnitten. Die Tür wurde nur<br />
geöffnet, um uns unsere täglichen Schnitte Brot hineinzuwerfen und eine Kelle Flüssigkeit in den<br />
Essnapf zu schütten. Aufgrund dieser kompletten Isolation vernahm ich erst später, was mit<br />
Weilbacher nach meiner Einsperrung geschehen war. Ich hatte mir ernsthaft Sorgen gemacht,<br />
denn ich befürchtete, dass - als Repressalien für das verübte Poterne-Attentat - die bereits in der<br />
Isolation befindlichen Gefangenen als erste füsiliert würden. Andere war schon vor uns dort und<br />
hatten ihre Namen in die feuchte Kreide gekritzelt. Einem war es gelungen ein Kruzifix zu malen<br />
und hinzuzufügen: «Fürchte dich nicht, glaube!».<br />
Es herrschte eine Stimmung der Brüderlichkeit. Pépin ließ uns keine Gelegenheit, zu grübeln.<br />
Immer wieder bat er uns, ein Verhör bei der Gestapo zu simulieren, damit er sich vorbereiten<br />
konnte, um sich nicht zu widersprechen oder zu verplaudern, falls es zu einem wiederholten<br />
Verhör kommen sollte.<br />
Am nächsten Tag merkte ich, dass ich wirklich Fieber hatte und dass sich im Rachen eine<br />
schmerzhafte Stelle bildete. Bassin konnte nichts machen, mich noch nicht mal untersuchen. Er<br />
versuchte mich zu trösten, indem er behauptete, dass die meisten Krankheiten ohne Medizin<br />
heilen. Ich sollte mich hinlegen, um meine Kräfte zu schonen.<br />
Fünf Tage gingen vorüber. Am 16. März, spät am Abend, ließ La Brazine öffnen und rief:<br />
«Margraff, nehmen Sie Ihre Sachen, sie werden verlegt!» und auf meine Frage fügte er hinzu, dass<br />
auch Dumas und Chalut fortgingen. Wir erscheinen etwa zu dreißig zum Appel, wurden jeweils<br />
zu zweien aneinander gekettet, stiegen in die Lkws und am Bahnhof wieder aus (gefesselt und mit<br />
dem Rucksack auf dem Buckel, sehr unbequem). Bei einem Nebengebäude des Bahnhofs warteten<br />
wir unter strengster Bewachung. Es war völlig düster. Wir hörten, wie die Wächter sich<br />
unterhielten und dass die Rede von einem Fliegeralarm war. In der Tat hörten wir kurz darauf das<br />
Dröhnen der ersten Bomber. Die Explosionen kamen näher, wir spürten die Druckwellen. Die<br />
viermotorigen Maschinen der Royal Air Force flogen genau über uns: sie zielten auf den<br />
Rangierbahnhof. Die Wucht der Druckwellen nahm zu, Scheiben klirrten. Ich bedauerte es, nicht<br />
mit Dumas sondern mit dem benommenen Landwirt zusammengekettet zu sein. Ich wollte<br />
Dumas noch bitten, zu helfen, uns gegenseitig zu befreien und die Rucksäcke auf den Boden zu<br />
stellen. Wenn die Wärter sich vor einschlagenden Bombe auf den Boden werfen sollten, würden<br />
wir - Fieber hin, Fieber her - zusammen in die Finsternis abhauen. Später erzählte mir Dumas, auf<br />
die gleiche Idee gekommen zu sein. Leider zogen die Bomber ab und gegen elf wir wurden aufs<br />
Gleis für die Reisenden geführt, umringt von einem mit Maschinengewehren bewaffneten Peloton,<br />
das von einem Riesen geführt wurde. Deutsche Offiziere, die den gleichen Zug nehmen wollten,<br />
kamen so nah auf uns zu, sodass sie uns durch Gebärden ihre Feindseligkeit äußern konnten.<br />
45
Die Gebärden mit den Händen, als ob sie sich die Kehle durchschneiden wollten, gaben deutlich<br />
zu verstehen, dass sie uns am liebsten am Galgen gesehen hätten. Weitere Deutsche in Zivil trafen<br />
ein und unter ihnen erkannte ich eine junge Frau, die bei der Razzia an der Universität in<br />
November 1943 an der “Auslese“ beteiligt gewesen war. Im Gefängnis hatten wir sie öfters<br />
gesehen und ihr wurde der Spitzname “Panther“ zugeteilt. Sie sollte niemals verhaftet werden,<br />
obwohl lang nach dem Krieg bekannt wurde, dass sie sich in Frankreich, verheiratet mit einem<br />
Franzosen, niedergelassen hatte. Wir stiegen in einen für uns reservierten Waggon des<br />
Expresszugs nach Paris ein und als der Zug abfuhr, konnte man das Feuer der Bombardierung<br />
sehen. Das Michelinwerk war getroffen und das Wohnviertel Sabourin stand in Flammen. Dort<br />
wohnten die Eltern von Chalus, der sichtbar in Verzweiflung geriet: auf dem Weg zum KZ, im<br />
Ungewissen über das Los seiner Familie.<br />
Wir saßen zusammen, jeweils zwei Verhaftete und ein Soldat, der die zwei bewachte, als der<br />
Führer des Konvois an uns vorbeiging. Zum ersten Mal an diesem Abend, ohne Gegenlicht oder<br />
Halbdunkel, sah ich endlich sein Gesicht. In den ersten Sekunden glaubte ich, einer Halluzination<br />
ausgesetzt zu sein. Ein Meter neunzig groß, die gleiche Trepannarbe an der Stirn, das gläserne<br />
Auge an der gleiche Stelle und - was meinen letzten Zweifel endgültig nahm - das Korrekte, das<br />
Menschliche seiner Person, denn er sagte uns, dass wir rauchen dürften und es uns bequem<br />
machen sollten: Häberle. Der gleiche Häberle, der im Herbst 1940 Kameradschaftsführer an der<br />
Universität Heidelberg war und dessen Annäherungsversuche mir aufgefallen waren. Nach<br />
dreieinhalb Jahren Krieg war er - obwohl ein erstes Mal zurückgewiesen - letztendlich doch noch<br />
eingezogen worden und es war ihm gelungen, auf einem Posten hinter der Front eingesetzt zu<br />
werden. Und nun war er dort, nicht an irgendeiner Stelle entlang der mehrere tausend<br />
kilometerlangen Front, sondern dort, im Zug von Clermont nach Paris. Was sollte ich tun? Sollte<br />
ich mich melden? Von sich aus hätte er, wie alle anderen, die mich Ende 1940 zum letzten Mal<br />
gesehen hatten, mich niemals wiedererkannt, so sehr hatte ich mich in der Zeit geändert. Wie<br />
konnte ich ihm ein diskretes Zeichen geben? Wie konnte ich auf eine Flucht anspielen? Auch in<br />
der Annahme, dass er während des Transits von einem Bahnhof zum anderen den Wächtern<br />
befohlen hätte, meine Ketten zu entfernen, dass er mich persönlich zur Toilette begleitet hätte,<br />
dass er mich hätte flüchten lassen und absichtlich daneben geschossen hätte,… das alles war nur<br />
Träumerei. Unter den heftigen Schmerzen im Rachen und mit 39,50 °C Fieber, hätte ich<br />
wahrscheinlich nur einige Schritte laufen können, um dann bewusstlos zu Boden zu fallen. Und<br />
dennoch… wenn er mich dann doch wie ein Karnickel niedergeschossen hätte…? Eins durfte ich<br />
nicht vergessen: eher als dem Kriegsgericht unterstellt zu werden, würde jeder Wärter schießen,<br />
um sich selbst zu schützen. Misstrauen war angesagt. Ich verhielt mich ruhig, rührte mich nicht<br />
und unternahm weiter nichts.<br />
Kapitel III<br />
COMPIÈGNE<br />
Vierzig Tage, vom 18. März bis 27. April 1994, sollte ich im Frontstammlager 122 zu Compiègne<br />
verweilen. Ich hatte das große Glück, mich, im Gegensatz zu den meisten anderen, während dieser<br />
vierzig Tage erholen zu können. Die Kommilitonen der Universität Straßburg, am vierten Januar<br />
aus dem Gefängnis abgeführt, waren alle noch im gleichen Monat zu den deutschen Lagern<br />
deportiert worden. Drei große Konvois mit insgesamt sechstausend Deportierten hatten geleert.<br />
Bei meiner Ankunft in März war das Frontstammlager 122 wieder besiedelt und man konnte<br />
spüren, dass neue Verlegungen nach Deutschland bevorstanden. Ich wurde nicht abgerufen für<br />
die Konvois des 4. und 20. April. Paul Engel dagegen wurde am 24. März bei einer Razzia nach<br />
dem Poterne-Attentat gefasst, landete am 25. März in Compiègne und wurde mit dem Konvoi des<br />
4. April nach Mauthausen deportiert. Er sollte die Gefangenschaft überleben, jedoch in 1946, zwei<br />
Wochen vor der Entdeckung der Wirkung des “Rimifon“, der Tuberkulose erliegen.<br />
Am Tag nach der Ankunft wurde ich als “krank und bettlägerig“ in meiner Baracke gemeldet.<br />
Professor Marsault, Arzt an der Krankenpflegestation, horchte mich ab und stellte die Diagnose:<br />
«Du hast keine Rachenentzündung, sondern eine schöne Eiterbeule. Ich lasse dich in die<br />
46
Krankenpflegestation aufnehmen und heute nachmittag schneide ich die Eiterbeule auf.» So<br />
gesagt, so getan, mithilfe eines Kollegen und eines Krankenpflegers, jedoch ohne Betäubung. Der<br />
fingerfertige Marsault, sogar ohne direkte Beleuchtung, schnitt mit dem Bistouri, auf den<br />
Millimeter genau, die betroffene Stelle auf und ließ mich Eiter und Blut ausspucken. Zwei Tage<br />
danach beseitigte er die restliche Infektion durch eine sehr erfreulich wohltuende Kürettage.<br />
Anschließend wurden mir noch fünf Tage Ruhe verschrieben, bevor ich zurück zu meiner Baracke<br />
geführt wurde. Diese mehr als rudimentäre “Krankenpflegestation“ im Frontstammlager zu<br />
Compiègne war die Drehscheibe für die Vermittlung aller Nachrichten aus dem Lager, eine wahre<br />
Meldekammer.<br />
Eines Abends in 1952 traf ich Marsault in Paris wieder, als ein Freund, Arzt im Nanterre-<br />
Krankenhaus, mich zu einem Gelage im Institut einlud. Der Professor-Chefarzt nahm am<br />
Fressgelage seiner Fachärzte teil. Groß war mein Erstaunen, als ich diesen Chefarzt als meinen<br />
Chirurgen der Krankenpflegestation zu Compiègne wiedererkannte! Ich erinnerte ihn daran, dass<br />
ich ihm das Honorar für die Behandlung von damals noch schuldete. Selbst war er, wie durch ein<br />
Wunder, von der Vernichtung seines Konvois des 2. Juli 1994 nach Dachau verschont geblieben.<br />
Fast neunhundert Tote durch Erstickung und Wärmestau wurden aus den Waggons geholt. Das<br />
Wiedersehen war herzlich und rührend. Obwohl er weit über sechzig war, hielt er bis fünf Uhr<br />
morgens durch. Als er abfahren wollte, eckte er mit seinem Wagen eine Laterne an, setzte ganz<br />
überlegen zurück und fuhr, stolz auf sein Manöver, davon. Etwas weniger stolz gestand er mir<br />
einige Wochen später, eine dickes Knöllchen im Briefkasten gefunden zu haben. In den Jahren<br />
nach diesem gedenkwürdigen Abend bis zu seinem Ableben, trafen wir uns fast jeden Monat bei<br />
den Diners der Ehemaligen aus Dachau, mit denen mich viele gute Kameradschaften verbanden.<br />
Der letzte Überlebende von den in Juni 1943 im Studentenvereinshaus Verhafteten, Doktor<br />
Bronner, war mehr als ein Jahr lang auf der Krankenpflegestation tätig und leistete vielen<br />
Kameraden vielleicht nebensächliche aber wertvolle Hilfe. Er wurde 1944 nach Neuengamme,<br />
südöstlich von Hamburg, deportiert. Trotz seines versteiften Beines, Folge eines Unfalls in der<br />
Adoleszenz, aber wahrscheinlich dank seines athletischen Körperbaus überlebte er die<br />
Deportation und verfolgte er eine lange Karriere als Chefarzt der Abteilung Augenheilkunde des<br />
straßburger Zivilkrankenhauses.<br />
Ich war stark abgeschwächt. Im weiteren Verlauf der Woche fiel es mir schwer, die dünne Suppe<br />
des Lagers herunterzuwürgen. Nachts schlief ich kaum. Im völlig verdunkelten Schlafraum mit<br />
etwa zwanzig “Betten“ bewegten sich die unruhigen Schatten der anderen Patienten auf den<br />
Pritschen und an einem großen Tisch in der Mitte des Raums, unterhielten sich vier oder fünf<br />
Krankenpfleger. Aus ihrem Wortwechsel konnte ich schließen, dass sie der - selbstverständlich<br />
klandestinen - Kommunistischen Partei angehörten. Ich täuschte vor, zu schlafen, spitzte die<br />
Ohren und lauschte während dieser drei Nächte ihrem Geflüster. Sie diskutierten die Strategie der<br />
Partei auf nationaler Ebene. Angeblich gehörten sie zu den Parteibonzen. Einer von ihnen war<br />
Marcel Paul, als Kranker meiner Gruppe eingetragen. Er sollte zusammen mit mir in die<br />
Deportation gehen. Bis dann wusste ich nicht von seiner Position innerhalb der<br />
Widerstandsbewegung der klandestinen Kommunistischen Partei auf nationaler Ebene. Aus dem<br />
Zusammenhang ihres Getuschels wurde mir zu meiner großen Überraschung klar, dass Marcel<br />
Paul, lang bevor Deutschland in Juni 41 Russland überfiel, bereits aktiver Résistant und Ausbilder<br />
für Kampfeinheiten war. Zurück im meinem Gebäude, nach der chirurgischen Behandlung, hatte<br />
ich mehrmals die Gelegenheit, mich mit Marcel Paul zu unterhalten. Er forderte mich auf, die in<br />
der “Pariser Zeitung“ abgedruckten Leitartikel von… Goebbels, Gauleiter in Berlin, zu übersetzen!<br />
Später sollten wir uns in Auschwitz wiedersehen, aber das ist eine andere Geschichte.<br />
Kaum war ich wieder in meine Baracke eingezogen - es muss um den 23. März gewesen sein -, als<br />
ein neues Konvoi aus dem Gefängnis zu Clermont eintraf. Zwei Genossen aus dem Abteil des “92“<br />
waren mit dabei und hatten viel Neues zu erzählen. Von den beiden Brüdern, Jehan und Alain<br />
Knoll-Dumars erfuhr ich, dass Henri Weilbacher, François Mazolf und Kolonel Boutet kurz vorher<br />
füsiliert worden waren, bei dem gleichen, von uns ausgehobenen Graben, wie die Maquisards von<br />
Billom. Meine Befürchtung, Geissler hatte entschieden, Weilbacher zu beseitigen, hatte sich<br />
bestätigt und obwohl ich das Drama vorausgesehen hatte, war ich von der Nachricht völlig<br />
erschüttert. Später sollte ich erfahren, insbesondre von seiner jungen Witwe, einer Schullehrerin,<br />
dass er sehr tapfer und furchtlos gestorben war. Meine Bitterkeit steigerte sich bei der Überlegung,<br />
47
dass wenn die Landung der Alliierten in 1943 stattgefunden hätte, er sich - wie viele andere - mehr<br />
offen in der Résistance hätte engagieren können und - paradoxerweise - weniger gefährdet<br />
gewesen wäre.<br />
Die Landung - die “Invasion“, wie die Deutschen sie bezeichneten - ließ auf sich warten. Der<br />
einzige Lichtblick, der meine Stimmung ein wenig heben konnte - war die Nachricht von den<br />
Brüdern Knoll-Demars, während mehrerer Wochen in unserer Baracke untergebracht -, dass die<br />
junge “Titi“, alias Augusta Fran, aus dem Gestapohaus in Royat geflohen war.<br />
Was meine Person betrifft, gibt es über die vierzig Tage in Compiègne weiter nicht vieles zu<br />
erzählen. Ich war zur Inaktivität gezwungen, hielt Ausschau nach einer Fluchtgelegenheit<br />
zwischen den Generalappels um acht Uhr morgens und fünf Uhr abends, während des<br />
Kartoffelschälens… Nach dem Kartoffeldienst wurden wir beim Ausgang des Raums sorgfältig<br />
kontrolliert und auf Reste durchsucht. Ich weiß nicht, wo die Kartoffelstärke letztendlich gelandet<br />
ist, jedenfalls nicht in unseren Essnäpfen. Ich versuchte, meinen Hunger zu vergessen, indem ich<br />
mich dem Kreis “Allgemeinkultur“ anschloss. Die Veranstaltungen wurden von mehreren<br />
verhafteten Intellektuellen auf hohem Niveau organisiert, um ihre Kameraden abzulenken. Bei<br />
einem dieser Treffen lernte ich Robert Desnos, einen poetischen Geist mit einer<br />
außergewöhnlichen Ausstrahlung, kennen. Er sollte mich im selben Deportationskonvoi begleiten.<br />
Mitte April 1944 waren wir etwa zweitausendfünfhundert Häftlinge. Nicht alle wurden wegen<br />
ihrer Teilnahme am Widerstand verhaftet. Viele waren einfach Opfer von den Repressalien nach<br />
dem Poterne-Attentat oder Zivilisten aus Murat, denen nach dem Attentat auf Geissler die<br />
Erschießung erspart geblieben war. Es gab auch einige schwarze Schafe, nämlich ehemalige<br />
Denunzianten bei der Gestapo - aus politischer Sympathie oder aus Habgier -, vor denen wir auf<br />
der Hut waren. Die Gestapo zögerte nicht, diese “Mitarbeiter“ einzusperren, nachdem sie ihre<br />
“Dienstverleihung“ voll ausgenutzt hatte. Sie wurden von uns frühzeitig ausfindig gemacht und<br />
unter Quarantäne gestellt. Einer von ihnen, bereits ernsthaft verletzt, konnte nur dank der<br />
Intervention der Deutschen und Evakuierung in ein kleines Nebenlager dem Lynchen<br />
entkommen.<br />
Am wenigsten auf die Deportation vorbereitet, etwa die Hälfte der Häftlinge im Lager<br />
Compiègne, waren diejenigen, die nie mit einer Verhaftung gerechnet hatten und<br />
“zufälligerweise“ bei einer Razzia gefasst wurden. Sie sollten dann auch die Todeszahl steigern.<br />
Für manche war die ihnen zugeteilte Behandlung wie eine Offenbarung und sie reagierten<br />
angepasst auf diese Situation. Die Mehrheit zeigte jedoch ein unerhörtes Verhalten. So fällt mir die<br />
Angelegenheit mit den etwa zweihundert verhafteten Männern aus Saint-Claude im Jura wieder<br />
ein. Mitte April landeten sie in Compiègne.<br />
Nach einem Sabotageakt auf Einrichtungen der Wehrmacht befahl die Kommandatur zu Saint-<br />
Claude, mittels Plakate in der Stadt, allen männlichen Einwohnern zu vorgegebener Zeit beim<br />
Rathaus vorstellig zu werden. Und sie gingen hin. Es kamen sogar einige S.T.O.-Verweigerer aus<br />
dem Maquis, auf Befehl ihres Führers, um sich zu erkundigen. Fast alle wurden gefasst und sofort<br />
nach Compiègne gebracht, ohne Vernehmung oder Verhör. Sie wurden in einem getrennten Lager<br />
untergebracht, aber wir konnten durch die Stacheldrahtabsperrung miteinander reden. Eines<br />
Tages brauchten die Deutschen eine größere Mannschaft für Aufräumungsarbeiten am Bahnhof<br />
zu Compiègne. Eine RAF-Bombardierung hatte einen Teil des Bahnhofs in Schutt gelegt. (Ein<br />
Zeichen, dass die Landung vorbereitet wurde: in den Wochen vor der “Invasion“ griff die RAF<br />
systematisch die Rangierbahnhöfe an.) Die gesamte Gruppe aus Saint-Claude kam zum Einsatz,<br />
von nur zwei Wachposten begleitet. Erst anderntags erfuhren wir mit Entsetzen, was geschehen<br />
war. Es gab Deserteure, aber - man staune - nur die Ukrainer, vermutlich zwangseingezogene,<br />
hauten ab. Keiner aus der Gruppe Saint-Claude ergriff die Flucht. Stärker noch: in Reih und Glied,<br />
ohne Wächter, präsentierten sie sich abends beim Wachposten am Eingangstor des Lagers, der sie<br />
anfangs nicht hereinlassen wollte. Wir schämten uns für sie!<br />
Ich weiß nicht, wie viele von ihnen in der Deportation umkamen, aber den Überlebenden wurde<br />
das Statut des “deportierten Résistants“, wie vom Gesetz von 1948 vorgesehen, verweigert. Wie<br />
mir später von einem Kameraden vor Ort - ich habe seinen Namen vergessen - erzählt wurde, war<br />
dieser Zwischenfall für einen unserer jüngsten Résistants die Gelegenheit zur Flucht. Der Junge,<br />
48
“Toto“ Virlojeux, war siebzehn und ich hatte ihn in unserer Zelle des “92“ kennengelernt. Sein<br />
Vater, Doktor Virlojeux, war Verantwortlicher einer Widerstandsorganisation. Februar 1944<br />
wurde die gesamte Familie verhaftet und demzufolge landete Virlojeux Junior in unserer Zelle.<br />
Sofort wurde ihm der Spitznamen “Toto“ zugeteilt und bis heute ist mir sein richtiger Vorname<br />
nicht bekannt. Er erzählte uns, dass die Deutschen seine Großmutter und seinen jüngeren Bruder<br />
freigelassen hatten, er und seine Eltern jedoch weiter verhaftet blieben. Erst später erfuhren wir,<br />
dass sein Vater sich unmittelbar nach seiner Verhaftung mittels Gift umgebracht hatte, um unter<br />
der Folter nichts Preis zu geben. Seine Mutter sollte in der Deportation sterben. Toto war um den<br />
23. März im gleichen Konvoi wie die Brüder Knoll-Demars nach Compiègne abgeführt worden.<br />
Nachdem die Arbeiterkolonne für den Bahnhof zusammengestellt wurde, musste sie<br />
gezwungenermaßen durch das Lager an unseren Baracken vorbeiziehen, um durch das Lagertor<br />
Richtung Stadt zu ziehen. Ich weiß nicht, ob jemand es ihm zuflüsterte oder ob er selbst die<br />
Initiative ergriff. Im Nu schloss sich Toto der Mannschaft an und verließ mit ihr das Lager. Es fiel<br />
ihm nicht schwer, sich davon zu machen. Wir alle hatten den pfiffigen, intelligenten und mutigen<br />
Jungen ins Herz geschlossen und ich war vor Freude und Erleichterung ergriffen, als ich vernahm,<br />
dass er sich hatte retten können.<br />
In diesem Transitlager, ich wiederhole es, gab es von allem. Einer der Häftlinge reizte besonders<br />
meine Neugier: er spazierte immer allein herum, in eleganter Kleidung mit englischem Mantel von<br />
feinem Schnitt, die Rosette der Ehrenlegion im Knopfloch, die Francisque - die Doppeltachse,<br />
Symbol des Pétain-Regims - demonstrativ angesteckt, und hielt sich von den anderen fern. Keiner<br />
redete mit ihm, er redete mit keinem. Einige von uns regten sich fürchterlich auf, denn sie<br />
empfanden die vichystische Francisque als arrogant und provozierend. Es drohte ein Eklat. Mein<br />
Freund Pépin, zusammen mit mir in der Zelle des “92“ in Clermont und seit dem 22. März wieder<br />
mit mir zusammen im Lager zu Compiègne, ergriff die Initiative, ging auf den Mann zu und<br />
erklärte ihm, dass weder der Ort noch die Zeit das zur Schau stellen dieses Abzeichens<br />
rechtfertigten; wenn er es nicht sofort entfernen würde, könnte es ihm vielleicht abgerissen<br />
werden. Marcel Paul, dem ich beim Spazieren ein Artikel von Goebbels aus der Pariser Zeitung<br />
übersetzte, klärte mich auf: er war René Bousquet, Generalsekretär der Vichy-Polizei unter Pétain!<br />
Ich hätte keinen Grund, ihn hier zu erwähnen, wenn nicht vor kurzem, nämlich während der<br />
Fernsehsendung “Histoires vraies“ (Wahre Geschichten) am 26. April 1990 über die Arbeiten von<br />
Simon Wiesenthal, der Präsentator Georges Delarue, Historiker des Widerstands, das Drama der<br />
3500 jüdischen Kinder aus Orléans nach der Rafle du Vel d’Hiv dokumentiert hätte; in der Sendung<br />
betonte er die Verantwortung des René Bousquet und bedauerte, dass das Verfahren gegen<br />
Bousquet wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit mehreren Jahren auf skandalöse Weise<br />
hinausgezogen wurde. Ich weiß nicht wann und wie dieses Verfahren weitergeführt wurde, auch<br />
nicht aus welchen Gründen Bousquet damals in Compiègne eingesperrt wurde. Ich erinnere mich,<br />
in einer Schrift - ich glaube von Henri Amouroux - gelesen zu haben, dass beim Einrücken der<br />
deutschen Truppen in die “Freie Zone“ in November 1942, der uns bekannte Kriegskommissar<br />
Geissler, Verantwortlicher der Gestapo für die Süd-Zone, eine unangenehme Überraschung<br />
erlebte, als er bei der Übernahme der Polizeiräumlichkeiten zu Vichy nur noch leere Büros fand:<br />
kein Personal, keine Akten. Laut Amouroux sollte die Initiative zum Aufräumen von Bousquet<br />
ausgegangen sein. Es ist jedenfalls schockierend, dass elf Jahre nach Eröffnung der Verfahren<br />
wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu Lasten von Leuten wie Bousquet, Generalsekretär<br />
der Vichy-Polizei, und Maurice Papon, Polizeileiter in Bordeaux, jemand wie Jean Legay, Direktor<br />
der Vichy-Polizei, verschont blieb, und das Verfahren gegen die anderen durch beabsichtigte<br />
Trägheit und Passivität ins Stocken geraten ist, während die Holocaust-Verleugner die Köpfe<br />
heben.<br />
Des Weiteren wurde die Stimmung von der Hoffnung auf die Landung der Alliierten geprägt.<br />
Nach der Wiedereroberung Nord-Afrikas, mit der Besatzung der Vichy-Zone als Folge, vermittelte<br />
BBC die Hoffnung auf die vollständige Befreiung unseres Landes, aber es war den Alliierten völlig<br />
klar, dass sie zu der Zeit noch nicht in der Lage waren, eine Landung auf das Festland mit Erfolg<br />
zu unternehmen. Dennoch war es ihnen wichtig, alle Informationen über die Lage in Frankreich<br />
erhalten. Diese Informationen konnten nur von den Widerstandskämpfern - auf die Gefahr hin<br />
demaskiert, verhaftet und unter Folter verhört zu werden - übermittelt werden. Die Überlebenden,<br />
die nicht exekutiert wurden, wurden in das Zentrallager zu Compiègne gebracht, um von dort<br />
nach Deutschland und Polen in verschiedene Konzentrationslager deportiert zu werden.<br />
49
Es gab sogar Zeitungen: neben der deutschsprachigen Pariser Zeitung konnte man in einer<br />
anderen, zensierten, aber interessanten französischen Tageszeitung - L’Écho de Nancy - die Berichte<br />
über den Petiot-Prozess lesen und die heftigen, wochenlang dauernden Kritiken über den Prozess<br />
zu Lasten von Pierre Pucheu in Algier verfolgen. Ohne dass irgendein Befehl oder Anweisung<br />
seitens der Besatzungsmacht erteilt wurde, traf die illegale Vichy-Regierung Zwangsmaßnahmen,<br />
erst gegen die Juden und später, nach dem Unternehmen Barbarossa und den Angriff auf die<br />
UdSSR am 22.06.1941, auch gegen die Kommunisten. Pucheu war Innenminister der Vichy-<br />
Regierung und - unter dem Vorwand, die “echten“ Franzosen vor der Erschießung als Geisel zu<br />
retten - legte den Deutschen auf eigene Initiative eine Liste mit Namen von ausschließlich Juden<br />
und Kommunisten vor. Nach der Landung der Alliierten in Nord-Afrika und dem Einmarschieren<br />
der Besatzungstruppen in die Frei Zone gelang es ihm, nach Algier, in das befreite Algerien zu<br />
fliehen, wo er - mit derselben ungeheuren Leichtfertigkeit - sich als Patriot präsentierte und nichts<br />
weniger als einen Ministerposten im Dienst des “Freien Frankreichs“ für sich beantragte. De<br />
Gaulle überstellte ihn dem Militärgericht. Zum Tode verurteilt wurde er während unseres<br />
Aufenthalts in Compiègne, gerade zu der Zeit, als die Namensliste für die Deportation aufgesetzt<br />
wurde, standrechtlich erschossen. Die “Milice Française“, die paramilitäre Organisation der Vichy-<br />
Regierung im Dienst der Nazis zur Bekämpfung des “Terrorismus“, machte großen Wirbel um die<br />
Affäre. Selbstverständlich war diese Art Tagespresse Wasser auf die Mühle der Nazis, die die<br />
Zeitung freigaben, umso mehr da die Milice ihnen bei den Operationen gegen den Widerstand in<br />
den Städten und im Maquis unentbehrlich war, denn im Frühjahr 1944 breitete sich der<br />
Widerstand erheblich aus.<br />
Wir, die Häftlinge, sahen ein, dass die Deutschen Truppen nun gezwungen wurden, die Front an<br />
der Atlantik zu verstärken. Demzufolge überließen sie der Miliz die Drecksarbeiten der<br />
Repressalien nach den Attentaten, die von den Maquisards, den französischen<br />
Widerstandskämpfern, sowohl in den Städten als auch auf dem Land verübt wurden. Es blieb den<br />
Widerstandskämpfern nicht anderes übrig, als ihre Feinde der Miliz einen nach dem anderen zu<br />
eliminieren. Aus diesem Grund bestand der Polizeileiter von Vichy im April 1944 - d.h. nachdem<br />
bereits zwei Konvois am 20. März und 5. April Frankreich in Richtung Mauthausen verlassen<br />
hatten - bei der Gestapo darauf, dass der darauffolgende Konvoi, der unsere, behandelt werden<br />
sollte, als ob er aus nur Juden und Kommunisten bestände. Er betrachtete Kommunisten und<br />
Juden als gleiche und fügte noch die Freimaurer hinzu. Es war aus lauter Opportunismus, dass die<br />
Gestapo eine solche Behandlung billigte. Nur die Milizführer setzten auf die Bildung einer Nazi-<br />
Regierung nach dem Endsieg und hofften in einer solchen Regierung die hohen Posten<br />
zugewiesen zu bekommen. Innerhalb der Gestapo glaubte keiner daran. Während unseres<br />
Aufenthalts in den Nazi-Lagern stellten wir manchmal fest, dass die Deutschen einen gewissen<br />
Respekt für ihre Feinde aufbrachten und deren Patriotismus schätzten. Den Milizleuten, den<br />
Landesverrätern gegenüber, zeigten sie nur Verachtung.<br />
Die Quarantäne, vierzig Tage Aufenthalt im Transitlager zu Compiègne hatte wir nun<br />
durchgehalten. Es war uns klar, dass die bereits erlebten Schwierigkeiten und Zwischenfälle noch<br />
ziemlich harmlos waren im Vergleich mit dem, was noch auf uns zukommen sollte: eine Welt der<br />
absoluten Grausamkeit. Um den 23. oder 24. April - in den vergangenen fünf Wochen hatte ich<br />
kein einziges Paket von draußen bekommen, während andere reichlich versorgt wurden - fühlte<br />
ich mich plötzlich schwach, bekam Fieber und empfand wieder Schmerzen im Rachen. Bei Appel<br />
um 17 Uhr wurde mir schwindlig und meine Kameraden mussten mich bis zu der<br />
Krankenpflegestation unterstützen. Krankenpfleger Ickel, Medizinstudent und Landesgenosse aus<br />
Reichshoffen im Departement Bas-Rhin, leitete alles in die Wege, um mich von Marsault als<br />
bettlägerigen Kranken eintragen zu lassen. Anderntags wurde mit der Zusammensetzung des<br />
Konvois angefangen. Nachdem alle auf den Appellplatz versammelt waren, wurden die Namen<br />
der Betroffenen laut vorgelesen. Meine Kameraden Dumas und Chalus kamen zur<br />
Krankenpflegestation, um mir mitzuteilen, dass wir alle drei aufgerufen wurden. Das bedeutete,<br />
dass alle Aufgerufenen anderntags zum Appellplatz geführt, die Namen auf der Liste abgehakt<br />
und jeder einer Leibesdurchsuchung unterzogen werden sollte. Danach sollten wir unter<br />
strengster Bewachung im Nebenlager eingesperrt die Nacht verbringen, um am darauffolgenden<br />
Tag zum Zug gebracht zu werden.<br />
Nur selten blieben Kranke von der Deportation verschont. Nach einer schlaflosen Nacht hatte ich<br />
jede Hoffnung, sogar die aufs Überleben aufgegeben. Morgens war jedoch das Fieber<br />
verschwunden. Ich versuchte noch nicht mal den Stand des Thermometers zu fälschen. Ein<br />
50
deutscher Militär mit der Liste der eingetragenen Kranken in der Hand kam vorbei. Bei jedem Bett<br />
machte er kurz Halt und hörte den Erklärungen des Krankenpflegers zu. Nur zwei Namen<br />
wurden gestrichen: Paul und Margraff. Marc Paul äußerte seine Unzufriedenheit. Ich werde noch<br />
auf ihn zurückkommen. Vom Krankenpfleger Ickel bekam ich ein Flakon Methylenblau in die<br />
Hand gedrückt, um mir den Rachen zu spülen. Nachdem die Koffer gepackt und weggebracht<br />
wurden, mussten wir den ganzen Nachmittag, bis Abends, zur Einzelkontrolle vor dem<br />
Offizierstisch in der Schlange stehen. Am Tisch saßen drei Unteroffiziere, die die Namen der<br />
Vorgeführten einzeln abhakten. Während der Wartezeit gelang es mir, mit einem der verhafteten<br />
Priester, ebenfalls auf der Konvoiliste, zu sprechen. Abt Louis Poutrain, Pfarrer in einem Dorf des<br />
Departements Hautes-Alpes, war mir aufgrund seines Eifers und seiner Ergebenheit den<br />
Kameraden gegenüber aufgefallen. Eines Tages während der Verhaftung hatte er in einer kleinen,<br />
als Kapelle eingerichteten Baracke eine Messe, bei der auch ich gegenwärtig war, lesen können.<br />
Damals hatte ich nicht mit ihm reden können, denn kaum hatte die Messe angefangen, als sie von<br />
mehreren Soldaten abgebrochen wurde. Die Deutschen vermuteten, dass unter der Kapelle<br />
insgeheim ein Fluchtgang gegraben wurde. Damals sprach ich einen der Wachposten auf Deutsch<br />
an und sagte ihm, dass ich als Jurastudent an der Universität bei einer Großrazzia gefasst wurde.<br />
Er ließ mich weiter in Ruhe, antwortete mir noch, dass wir Kollegen waren und wie ich auch er<br />
Jura studierte.<br />
Ich ging also auf Poutrain zu und bat ihn, aufgrund meiner damaligen Stimmung und meines<br />
Bedürfnisses nach Gelassenheit in Hinblick auf das Bevorstehende, mir die Absolution zu erteilen.<br />
Um mir die Moral zu heben, lenkte er taktvoll das Gespräch ab. Er war meiner Ansicht, man sollte<br />
den Tatsachen ins Auge sehen, dennoch fest entschlossen nach jeder Fluchtmöglichkeit Ausschau<br />
halten. Er meinte, mir auf diese Art zu helfen und Mut zum Durchzuhalten zu geben. Das war<br />
mein erster Kontakt mit Louis Poutrain und ich ahnte damals nicht, dass ich nach dem Krieg noch<br />
viele Jahre mit ihm in Verbindung bleiben sollte.<br />
Ich befand mich in der Reihe vor dem Tisch der Unteroffiziere, die einen alphabetisch klassierten<br />
Papierstapel mit den Namen der “Einzutragenden“ vor sich hatten. Etwa ein Meter vom Tisch<br />
entfernt versuchte ich die Listenüberschrift, umgekehrt gelesen, zu entziffern. Die Formalität<br />
dauerte nicht länger als drei oder vier Sekunden für jeden Häftling. Als ich mich unmittelbar vor<br />
dem Tisch und auf meine Formulare blicken konnte, in der kurzen Zeit, in der ich meine<br />
Personalien angab, las ich die vier letzten Buchstaben des Worts, von dem ich vermutete, der<br />
Name der Bestimmung zu sein: W-I-T-Z, also -witz. Mir fielen die Orte Austerlitz und Sokolnitz<br />
ein. Andere Kameraden hatten ebenfalls versucht, die Listenüberschrift zu entziffern, und so<br />
verbreitete sich das Gerücht - noch eins mehr - dass wir zum Lager Bitche, also nach Lothringen,<br />
abgeführt werden sollten und es sich um ein Lager wie viele andere handelte. Vor lauter<br />
Ermattung, auch aus Skepsis, wollte ich nicht widersprechen, noch weniger daraufhinweisen, dass<br />
Orte mit der Endung “-witz“ überwiegend in Böhmen oder Schlesien zu finden sind.<br />
Nach der Eintragung mussten wir uns, mehrere Meter auseinander, zur Leibesdurchsuchung vor<br />
den drei Soldaten aufstellen. Einige mussten ihre Schuhe ausziehen. Die Suche zielte auf metallene<br />
Gegenstände, die zum Aufbrechen der Waggons benutzt werden könnten, gesucht. Der alte<br />
Infanterist, der mich durchsuchte, sah mein Flakon Methylenblau nicht. Wir wurden in eine<br />
Wartebaracke eingesperrt, bewacht von einem Gestapomann in Zivilkleidung, der auch<br />
Französisch sprach. Wir verbrachten die Nacht in Hitze und Staub, der aufgrund der<br />
Überbelegung von den Liegen hochgewirbelt wurde. Am 27. April 1944, um fünf Uhr morgens<br />
ging es wieder zur Durchsuchungsstelle. Wir wurden in Hundertgruppen aufgeteilt. Jeder bekam<br />
noch einen Klumpen Brot und ein Stück synthetische Wurst. Die Kessel mit dem Tee des Hauses<br />
waren aufgestellt und jeder konnte noch einen Schluck aus der Kelle trinken. Keiner hatte<br />
irgendein Gefäß, um ein wenig von dieser Brühe mitzunehmen. Ich glaube, dass ich mein Flakon<br />
Methylenblau bereits ganz aufgebraucht hatte, jedenfalls hatte ich keine Rachenschmerzen mehr.<br />
Ein Unteroffizier, den Umständen gemäß Sonderführer genannt, gab seine Instruktionen zur<br />
Bildung der Zenturien. Er sprach fließend Französisch und dann und wann, zwischen den<br />
Anleitungen, wiederholte er, dass wir unserem Verhalten entsprechend behandelt werden sollten.<br />
Ich hörte, dass er befahl, die Kranken sollten in den Autobus einsteigen. Alle aus der<br />
Krankenpflegestation kamen näher. Ich schließ mich ihnen an, während die Kolonnen sich in<br />
Bewegung setzten, ein Offizier mit Maschinengewehr an der Spitze jeder Hundertgruppe, links<br />
51
und rechts eine geschlossene Reihe bewaffnete Wachposten. Einige Schummler versuchten in den<br />
Bus zu kommen. Es gab ein Gedränge. Ein Zögern machte sich in der Gruppe der Kranken<br />
bemerkbar: Wer kommt in den Bus? Der Sonderführer merkte, dass ich ihn fragend anschaute.<br />
“Der mit der weißen Decke in den Bus!“.<br />
Auf der Strecke zum Bahnhof saß ich auf der hinteren Sitzbank, neben einem bewaffneten<br />
Wachposten, der sein belegtes Brötchen aß. Der Bus wartete, bis die Hundertschaften über den<br />
Weg zum Bahnhof marschierten. Inmitten der angeblich Kranken erkannte ich der<br />
Kommunistenführer Marcel Paul, zusammen mit einigen Gehilfen aus dem Pariser Becken. Durch<br />
die Scheibe beobachtete ich den Marsch der Hundertschaften jeweils geführt von einem mit FM-<br />
Gewehr bewaffneten Unteroffizier, auf jeder Seite des Weges eine Reihe Wachposten, die Waffen<br />
schussbereit in der Hand. Ich erinnere mich, dass die Bevölkerung von Compiègne auf der Straße<br />
oder durch die Wohnungsfenster zuschaute. Angeblich war die Information über den Konvoi<br />
durchgesickert, denn in der Nähe vom Bahnhof sahen wir eine größere Menge schreiender Leute,<br />
von bewaffneten Soldaten in Schach gehalten. Bekannte und Freunde und winkten einigen von<br />
uns Abschiedsgrüße zu und gaben noch die letzten Nachrichten mit. Als die Türen der anderen<br />
Waggons zugeschoben und verriegelt wurden, kamen wir aus dem Bus und, krank oder nicht<br />
krank, stiegen in den letzten noch offenen Waggon ein. Kein einziger der Kranken war bettlägerig.<br />
Marcel Paul und einige seiner Freunde, militante Kommunisten aus der Pariser Gegend, waren<br />
auch dabei. Im letzten Augenblick sah ich, wie ein mit einem Gewehr bewaffneter Wachposten,<br />
die Stirn unter dem Helm in Schweiß gebadet, mit Mühe die Tür zuschob. Ich erkannte meinen<br />
Jura-Studiumkollegen, der mich damals anlässlich der Kontrolle in der Kapelle durchsucht hatte.<br />
Wir hörten den Riegel brutal einrasten. Der Boden des Waggons war mit Stroh bedeckt, in einer<br />
Ecke stand ein einziger Stuhl und ein Gefäß: der Abortkübel. Sofort durchsuchte ich das Stroh<br />
nach Werkzeug, denn es war schon mal passiert, dass Arbeiter der Eisenbahn Werkzeug im Stroh<br />
versteckt hatten, wie zum Beispiel in Januar 1944, sodass es J. Flesch gelang, das Gitter des<br />
Klappfensters zu entfernen und aus dem Zug zu springen. Ich fand aber nichts und die Luken<br />
waren mit Stacheldraht versperrt. Dennoch war diese Suchaktion nicht ganz erfolglos, denn so<br />
konnte ich die Reaktionen der anderen - die meisten kannten einander nicht - beobachten. Im<br />
Waggon gab es nur einen einzigen Stuhl und ein Gefäß, dass als Latrine benutzt werden konnte.<br />
Die meisten nagten schon an ihrem Brot. Wir waren nur fünfzig in unserem Waggon und nur<br />
wenige waren wirklich krank, während in den anderen siebzehn oder achtzehn Wagen die<br />
Häftlinge zu hundert eingesperrt waren. Also waren unsere Bedingungen fast menschlich, in<br />
Vergleich mit dem Albtraum, den die zusammengedrängten Kameraden in den anderen Waggons<br />
erleben sollten. Die Reise sollte vier Tage und drei Nächte dauern.<br />
Kapitel IV<br />
DIE DEPORTATION ZU DEN LAGERN<br />
Es dauerte noch lang, bevor der Zug sich mit einem heftigen Ruck in Bewegung setzte und<br />
langsam über die Schienen rollte, so langsam, dass wir nachmittags noch weit von der Grenze zu<br />
Lothringen entfernt waren, als er in einem Bahnhof Halt machte. Es gelang mir, mich auf Höhe des<br />
vergitterten Dachfenster hochzuziehen. Militärkonvois hatten sich angesammelt. Es wimmelte<br />
von Soldaten, manche schauten sichtlich erstaunt. Auf Deutsch rief ich ihnen zu und bat sie, uns<br />
Wasser zu besorgen. Etwas später reichte ich - aus meiner hängenden Position - fast eine halbe<br />
Stunde lang, hin und her meinen Gefährten Kanister voll mit Wasser und gab den Soldaten die<br />
leeren wieder zurück. Die Klappfenster unseres Waggons waren hoch angebracht. Ich musste<br />
mich strecken, um den Arm bis zur Elle aus der Luke zu reichen und die vollen Wasserkanister<br />
herein zu holen. Unter den von der Sonne beschienenen, schwarzen Waggondächern war es<br />
drückend heiß. Ich hörte, wie in den anderen Waggons nach Wasser gerufen wurde. Die<br />
Wehrmachtsoldaten eines wartenden Konvois hörten die Schreie und organisierten spontan eine<br />
Wasserverteilung. Ich erinnere mich, dass alle zu Trinken bekamen, als erster ein Flugzeugpilot,<br />
der einen Arm verloren hatte. Plötzlich hallten die Befehle, kurz und hart. Ich sah wie ein<br />
Unteroffizier der Wehrmacht entlang den Waggons lief und seinen Männern zuschrie,<br />
aufzuhören. Er war wahrscheinlich vom “Sonderführer“ angeschnauzt worden. Die Nacht verlief<br />
52
uhig, fast allen gelang es, zu schlafen. Als ich mich dann auch hingelegt hatte, dankte ein schon<br />
etwas älterer Mann demjenigen, der es geschafft hatte allen zu trinken zu geben. Es war General<br />
Renaud, ein hoher Beamte und Verantwortlicher des Widerstands.<br />
An der Grenze zwischen Frankreich und dem ins III. Reich annexierten Teil von<br />
Lothringen machte das Konvoi halt. Wir wussten, dass die vorherigen Konvois beim<br />
Grenzübergang nochmals kontrolliert wurden. .<br />
Erst am Morgen des zweiten Tages erreichte der Zug die Grenze zum annektierten Lothringen<br />
und hielt an: “Pagny-Moselle“ konnte ich durch die Luke lesen. Wir hörten ein Geräusch, erst in<br />
der Ferne, dann immer näher. Zwei Stunden später wurde die Waggontür brutal geöffnet. Drei SS-<br />
Männer stiegen ein und einem fiel es sofort auf: «Hier sind keine hundert!“. Eine neue<br />
Mannschaft übernahm die Begleitung und kontrollierte jeden Wagen. Mit dem Knüppel in der<br />
Hand drängten sie uns in eine Hälfte des Waggons. Ein brutaler Wächter zählte nach, indem er<br />
mit seinem Knüppel jedem von uns einen Schlag verpasste und auf die andere Flächenhälfte trieb.<br />
Die gleiche Zählung wurde in allen Waggons durchgeführt. Wir Kranken waren nur fünfzig, in<br />
den anderen Wagen wurden jeweils hundert Männer auf eine Hälfte zusammengetrieben, danach<br />
auf die andere Hälfte geknüppelt.<br />
Ich realisierte, dass wir, nur fünfzig, bei diesem Schicksal noch ein ungeheuerliches Glück hatten<br />
und wir sorgten uns, wie lang die Männer in den anderen Waggons, zu hundert<br />
zusammengedrängt und zum Stehen gezwungen, dieses Martyrium durchhalten würden.<br />
Letztendlich überlebten alle, obwohl in jedem Waggon zwei oder drei vom Delirium befallen<br />
wurden und, wie verrückt geworden, mehrere Tage lang nicht realisierten, wie ihnen geschah.<br />
Nur diejenige, die sich bei der Abfahrt des Konvois in zwei oder drei Waggons<br />
zusammengeschlossen hatten, - die meisten von ihnen Résistants, die sich bereits vorher kannten -<br />
, blieben, zwar total erschöpft, ziemlich unversehrt. Sie hatten sich selbst eine Disziplin auferlegt,<br />
indem abwechselnd, alle drei bis vier Stunden, ein Drittel des Waggonkontingents sitzen konnte,<br />
während die anderen stehen blieben.<br />
Der Zug fuhr weiter. Gegen Mittag machte er in einem Bahnhof halt: Trier. Einige von uns<br />
meinten, es wäre die Endstation und wir würden in der Moselgegend an die Arbeit gehen!<br />
Während dieses Stopps kam es zu einer ersten kurze Auseinandersetzung im Waggon. In<br />
barschem Ton sprach jemand mich an: «Junger Mann, ich bin Lehrer und Sie scheinen eine<br />
gewisse Bildung zu haben. Wie können sie behaupten, dass wir in Trier sind, in einem<br />
unzerstörten Bahnhof. Laut des Britischen Rundfunks ist die Stadt Trier von den Bombardementen<br />
zerstört.» Darauf konnte ich nur antworten, dass dieser Stadtteil eben nicht getroffen wurde.<br />
Weiter. Die zweite Nacht brach an. Der Zug fuhr schneller, regelmäßiger. Die Müdigkeit machte<br />
sich bei allen bemerkbar. Ein wenig frische Luft wehte durch die Klappfenster in den Wagen.<br />
Einige versuchten, sich bis zur Luke hochzuziehen, um sich in etwa orientieren zu können.<br />
Vergeblich. Ich zog mich hoch, als der Zug einen lange Kurve nahm. Unser Waggon war einer der<br />
letzten und ich konnte fast die ganze Länge des Konvois sehen. Alle Wagen, auf der Seite der<br />
Türe, waren mit Scheinwerfern beleuchtet. Durch die an den Waggons fixierte Beleuchtung war es<br />
den Wachposten möglich, jeden Häftling der einen Fluchtversuch wagen würde, sofort zu<br />
erschießen. Fluchtversuche aus diesem Konvoi gab es nicht. Ich ließ mich wieder herunterfallen,<br />
ohne im geringsten zu ahnen, wohin wir fuhren.<br />
Am Morgen des dritten Tages, also am 29. April, hielt der Zug an: “Apolda“. Kleine Baracken,<br />
dem Gleis entlang, mit amerikanischen Kriegsgefangenen. Junge Schüler kamen vorbei. Es war<br />
mir sofort klar, dass es nur ein Zwischenhalt war. Die Schiebetür wurde geöffnet. Pro Waggon<br />
durfte nur einer aussteigen. Ich sprang sofort herunter und der Wachposten zeigte auf die Eimer.<br />
Mit einem Eimer in jeder Hand rannte ich - “Schnell! Schnell!“ - zu einem riesigen Gebäude mit<br />
dem Schild “Aborte für Massentransporte“. Der Druck auf dem Leitungswasser war hoch und<br />
während die beiden Eimer sich füllten, konnte ich Gesicht und Pulsgelenke erfrischen. Wenigstens<br />
zweimal lief ich hin und her. Jeder im Abteil bekam zu trinken, aber nur zwei oder drei anderen<br />
Waggons bekamen die Erlaubnis, sich Wasser zu besorgen. Um die Wasserqualität habe ich mich<br />
damals nicht gekümmert.<br />
53
Während dieses Stopps wurde ich auf das Verhalten eines korpulenten SS-Offiziers aufmerksam.<br />
Nicht nur sein Stiernacken fiel mir auf, auch sein Benehmen: er überwachte das ganze Geschehen.<br />
Er war der Führer des Konvois. Ich merkte, dass er mich beobachtete. Vielleicht nur eine Sekunde<br />
- ich schleppte wieder zwei Eimer Wasser heran - kreuzten sich unsere Blicke, hatten wir<br />
Augenkontakt. Es wurde sogar erlaubt, aus einem anderen Waggon einen ziemlich korpulenten<br />
Kameraden, völlig erschöpft, zu uns zu holen. «Im Vergleich zum anderen Waggon ist hier das<br />
Paradies!», murmelte er, nachdem wir ihn hochgezogen hatten. Erst später erfuhr ich, dass Apolda<br />
ein Eisenbahnknoten in der Nähe des KZ Buchenwald war, und wir uns dementsprechend schon<br />
weit, nah Weimar, im Osten befanden. Der Zwischenhalt dauerte weit über zwei Stunden. Eine<br />
Nacht stand uns noch bevor.<br />
Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden ich, todmüde, in der darauffolgenden Nacht schlief, aber<br />
als ich morgens aufwachte, wussten zwei Genossen, denen es gelungen war, zur Luke<br />
hinaufzusteigen und hinauszuschauen, mir zu erzählen, dass wir in Richtung Breslau fuhren. Es<br />
ging also nach Polen oder nach Schlesien. Im Lauf des Vormittags hielt der Zug in der Nähe einer<br />
Stadt noch einmal an. Unmittelbar neben der Eisenbahnstrecke befand sich ein Gefangenenlager<br />
und von der anderen Seite der Stacheldrahtabsperrung riefen einige Gefangenen uns zu, dass sie<br />
Amerikaner waren und es einen Bombenalarm gab. In der Tat sah ich gerade noch durch die Luke<br />
auf der anderen Seite, wie etwa achthundert Meter weiter eine Artilleriestelle mit acht Kanonen<br />
feuerte. Bei einem Weichenwechsel im Lauf des Nachmittags - ich ahnte, dass wir uns bereits weit<br />
im Osten befanden - konnte ich einen alten Arbeiter neben dem Gleis fragen, wo sich das<br />
nächstgelegene Lager befand. Ich erinnere mich nicht mehr, ob er den Namen nannte, wohl dass<br />
antwortete: «Ein Unheilslager!». Etwas später kreuzten wir einen anderen Zug: Häftlinge in graublau<br />
gestreiften Drillichanzügen, verstörte Blicke, abgezehrte, ausgemergelte Gesichter… Bald<br />
sollten wir erfahren, woher sie kamen.<br />
Es war bereits spät am Nachmittag des 30. April 1944 als der Zug allmählich abbremste und<br />
endlich zum Stehen kam. Wir wussten, dass wir am Ziel waren, denn sofort beim Anhalten des<br />
Zuges bildeten die Wachposten ein Kordon an der geschlossen Seite der Waggons. Durch die<br />
Gitter schrieen uns zu, unsere Uhren und Ringe hinaus zu werfen, denn später würde uns sowieso<br />
alles genommen werden. Einige von uns fielen darauf herein… Ich erinnere mich nicht mehr, wie<br />
lange das Warten in der drückenden Hitze ohne Frischluft dauerte. Vielleicht eine Stunde,<br />
höchstens zwei. SS-Männer gingen ohne Eile den Waggons entlang, bekamen fast einen<br />
Lachkrampf als sie einige “Wasser! Wasser!“ schreien hörten. Ich fragte mich, wie es den anderen,<br />
zu hundert in einem Wagen, wohl gehen konnte. Dann, auf ein Mal, ging alles sehr schnell. Ich<br />
hatte nichts gesehen, niemanden hören kommen. Die Tür wurde brutal aufgeschoben. “Raus!<br />
Schnell! Schnell!“ kam es von allen Seiten. Teils wegen der Spannung, teils weil es nicht anders<br />
konnte, sprang ich als erster zum Boden, den ich eher ahnte als sah. Ich landete anderthalb Meter<br />
tiefer auf den Fersen ohne zu stürzen. Hinter mir hörte ich einen Knüppel durch die Luft sausen,<br />
ohne dass er mich traf. Die anderen Kameraden folgten und wir wurden unter lautem Rufen<br />
zusammengetrieben. Sofort war mir klar, dass wir uns in einem Judenlager befanden: die<br />
Gefangenen, die damit beauftragt wurden, uns in Reih und Glied zu stellen, sprachen jiddisch<br />
zueinander. Seit meiner Kindheit war ich mit dieser Sprache vertraut.<br />
Wir standen bereit, um in das Lager einzumarschieren. Zwei Lagerinsassen, mit dem “Empfang“<br />
beauftragt, führten einen der neugekommenen zu uns. Der Mann war sichtbar verrückt geworden<br />
und schrie lauthals: «On les aura!» («Die kriegen wir noch!»). Die SS grinsten und ließen ihn.<br />
Unser Häftling ging auf ein Motorrad zu, stieg auf, als wollte er davon fahren. Erst dann fielen<br />
drei Schüsse. Der Offizier mit dem Stiernacken kam langsam näher und, als er fast vor mir stand,<br />
schimpfte er laut: «Was soll das!? Drei Schüsse, um nur einen abzuknallen!».<br />
Ich bemerkte einen sonderbaren Geruch. Ein strenger, beißender Geruch verbrannter Asche, wie<br />
von einem gesengten Schwein, der mir die Luft nahm, obwohl ich mich im Freien befand. Einer<br />
meiner Kameraden neben mir ließ das Wort «Krematorium» fallen. Als ich, ohne aus der Reihe zu<br />
treten, den Kopf drehte, sah ich auf weniger als dreihundert Meter Entfernung eine Reihe von<br />
sechs oder acht Schornsteinen, die keinen Rauch, sondern wie ein Hochofen senkrecht meterhohes<br />
Feuer spuckten. Alle begriffen wir, dass dort Menschenleichen verbrannt wurden. Ich machte mir<br />
Gedanken über die Zahl der Toten, weniger über die Todesursache. Wie viele Leichen für eine<br />
solche Feuerwucht? wie viele Toten pro Stunde? pro Tag? seit Beginn?<br />
54
Wir waren in Birkenau, nah Auschwitz.<br />
Während unser Gepäck - das wir niemals wiedersehen sollten - abgeladen wurde, marschierte<br />
unsere Kolonne los. Über sechs- bis siebenhundert Meter, bis vor das offenen Lagertor, ging es<br />
einem Stacheldrahtzaun entlang. Mitten in diesem abgesperrten Bereich stand das Zentralgebäude<br />
mit dem Turm über einem Tor, wodurch ein Eisenbahngleis von unserer Ankunftsstelle aus in das<br />
Lager führte. Das Gebäude versperrte die Sicht auf die Basis der Schornsteine, die weiter Feuer<br />
spuckten. Beim Lagertor, dessen beide Flügel weit geöffnet waren, stand ein bewaffneter<br />
Wachposten, der uns mehrmals zuschrie: «Achtung! Hochspannung! Lebensgefahr!». Später<br />
verstanden wir, dass er uns nicht warnen wollte, sondern die Selbstmordkandidaten dazu<br />
anstacheln, sich in den Zaun zu werfen. Eine Einladung zum Selbstmord, denn bei einem Suizid<br />
wurde dem Wachposten ein zusätzlicher Urlaub genehmigt, weil er - laut offiziellen Berichts -<br />
“einen Fluchtversuch verhindert“ hatte.<br />
Hinter dem Tor ging es links ab, über einen verschlammten Weg hoch zu zwei riesigen Baracken,<br />
eigentlich eher zwei Scheunen ohne Fenster, mit dürftigen, von der Feuchtigkeit vermoderten<br />
Wänden. Der Boden, gehärtete Erde, war mit Wasserpfützen übersät. Das Gefühl der Müdigkeit,<br />
des Hungers, der Kälte wurde nun bei den meisten, die noch einigermaßen einen klaren Kopf<br />
bewahrt hatten, vom Gefühl des Grauens überragt: dort wurde Massenmord begangen! Viele<br />
Kameraden waren völlig verwirrt und wurden auf dem Weg zu den Baracken von anderen<br />
gestützt. In den Baracken angekommen, ließen die meisten sich, wie eine Menschentraube, zum<br />
Boden fallen. Die Nacht war eingetreten. Ich spreizte meine weiße Decke an einer Stelle, die mir<br />
nicht allzu feucht erschien, legte mich auf den Rücken und fiel in einen tiefen, schweren Schlaf.<br />
1. Mai 1944. Um etwa vier Uhr morgens wachte ich auf. Ich ging nach draußen, wo bereits zwei<br />
von uns Wache standen, obwohl der Tag noch nicht angebrochen war. Ich konnte den etwa zehn<br />
Meter breiten Weg, der zu den Baracken hinauf führte, kaum unterscheiden. Allmählich wurde es<br />
heller. Auf einer Seite war diese Allee über die gesamte Länge, etwa hundert Meter, mit einer<br />
undurchsichtigen Wand abgesperrt. Auf der anderen Seite stand ein gemauertes Gebäude. Es war<br />
mir am Vorabend nicht aufgefallen. Nach einiger Zeit Beobachtung, vielleicht einer halben Stunde,<br />
drang mir ein beißender Geruch in die Nase. Ich hörte Stimmen, Schreien auf der anderen Seite<br />
der Absperrung. Lang anhaltende Schreie überstimmten das Stöhnen einer Menschenmasse. In<br />
Angst und Schrecken versetzt war meine Aufmerksamkeit so gefesselt, dass ich nicht merkte, dass<br />
meine Kameraden aus der Scheune gekommen waren und rundum standen, dass ich keinen nach<br />
dem Warum dieser Schreie der Verzweiflung fragte. Meine Überzeugung stand fest: auf der<br />
anderen Seite standen Menschen im Angesicht ihres Todes. Die Reihe der feuerspuckenden<br />
Schornsteine und dieser beißende Geruch, das verzweifelte Schreien auf der anderen Seite… alles<br />
wies darauf hin, dass dort Massenmord begangen wurde. Bereits bevor ich aus der Baracke<br />
gegangen war, hatte ich meine Kameraden angsterfüllt miteinander reden gehört und aus dem<br />
Wortwechsel hatte ich schließen können, dass wir uns im Lager Auschwitz befanden, in einem<br />
Judenlager. Auschwitz war also der Name, der auf der Konvoiliste im Lager zu Compiègne zu<br />
entziffern war. Noch nie hatte ich den Namen gehört, obwohl die anderen Lager wie Buchenwald,<br />
Dachau, Neuengamme, Mauthausen und einige andere bereits während der Quarantäne in<br />
Compiègne, ohne weitere Angaben, erwähnt wurden. Ich war völlig verwirrt und mich quälte die<br />
Frage, wie diese Menschen dann wohl umgebracht wurden. Ich drehte durch. Ich stand immer<br />
noch vor der Baracke, entsetzt, verzweifelt, abwesend. Mein Blick schweifte über die Allee und ich<br />
erblickte - ohne sie wirklich zu sehen - die mit Schnee bedeckten Spitzen einer Bergkette, vielleicht<br />
dreißig Kilometer weiter: die Beskiden, der nördliche Teil der Westkarpaten.<br />
Der Tag war angebrochen, noch vor sieben Uhr. Ich hatte den Mann nicht sofort gesehen. Er war<br />
aus dem Gebäude gekommen und ging die Allee hinauf. Erst als er auf etwa fünfzig Meter von<br />
unserer Baracke entfernt war, sah ich den riesig großen SS-Offizier. Meine Intuition verdrängte<br />
jeden Gedanken über die Leichtfertigkeit meiner Initiative: als er nur noch zehn Meter von mir<br />
entfernt war, in Hörweite, machte ich drei Schritte nach vorne, ging in einwandfreie Hab-Acht-<br />
Stellung und - im feinsten Deutsch, das ich zu bieten hatte - sprach ihn an: «Gestatten Sie, Herr<br />
Unteroffizier, Sie um eine Auskunft zu bitten?» (Eigentlich hätte ich “Scharführer“ sagen sollen,<br />
aber zu jener Zeit war ich noch nicht mit den Dienstgraden innerhalb der SS vertraut.) Sichtbar<br />
erstaunt fragte er: «Was wollen Sie?». - «Wir sind gestern aus Compiègne in Frankreich, nach einer<br />
55
fünftägigen Reise eingetroffen und wir sind über den Empfang ohne Pflege und Versorgung sehr<br />
erstaunt.»<br />
Ich merkte wie er stutzte, wahrscheinlich von meiner Frechheit völlig überrascht, und ich<br />
rechnete schon mit einem Stiefeltritt in den Bauch. Ob es nun meiner einwandfreien Hab-Acht-<br />
Stellung oder meinem akzentfreien Deutsch zu verdanken war, ich weiß es nicht, aber es folgte<br />
kein Stiefeltritt, sondern die Antwort: «Sie kommen aus Frankreich in einem Judenkonvoi!».<br />
Blitzartig kam mir die Reaktion, obwohl ich mir gar nicht sicher war, ob das alles wohl stimmte:<br />
«Es gibt keinen einzigen Juden in unserem Konvoi. Wir sind alle Vollarier und es ist undenkbar,<br />
dass wir als Juden behandelt werden sollten.» Ich hätte ihm noch eine ausgeschmückte<br />
antisemitische Rede gehalten, wenn er - vielleicht mit vorgespieltem, aber immerhin mit Erstaunen<br />
- mich nicht unterbrochen hätte. Während er eine Notiz in sein Dienstheft eintrug, antwortete er:<br />
«Ich will mal sehen, was ich machen kann!», drehte sich um und ging zum Gebäude zurück. Erst<br />
dann drehte ich mich zu unserer Baracke um und sah - auf sicherer Entfernung - ein Dutzend<br />
Kameraden, die mich entsetzt, sprachlos und mit ernster Miene betrachteten. Ich verstand: obwohl<br />
sie weder gehört noch verstanden haben konnten, was ich dem SS-Offizier gesagt hatte, alleine die<br />
Tatsache, ihn angesprochen zu haben und mit ihm einen anscheinend durchaus gängigen und<br />
anstandslosen Wortwechsel zu führen, machte sie misstrauisch. Wenn Margraff auf die Weise zu<br />
einem SS-Mann spricht, dann steht er auf dessen Seite und, demzufolge, ist er ein Spitzel. Es wäre<br />
mir lieber gewesen, wenn sie mich gefragt hätten, wovon die Rede war. In dem Augenblick legte<br />
ich kein großes Gewicht auf ihre Reaktion, denn seit Monaten, seit der Haft im “92“ herrschte ein<br />
ständiges Misstrauen, gegenseitig und gegenüber Fremden, meist unbegründet, unter den<br />
herrschenden Bedingungen jedoch unvermeidbar. Dieses Misstrauen war durch die Trennung von<br />
den vertrauten Haftgenossen und Kameraden noch stärker geworden. Jeder wollte leben und<br />
überleben. Das was ich vorher auf der anderen Seite der Absperrung gehört hatte und was mir<br />
dabei deutlich geworden war, beschäftigte mich noch zu sehr und ich war überhaupt nicht bei<br />
Laune, um auf ihre Reaktion und Befürchtungen weiter einzugehen. Wie erstarrt vor der Baracke<br />
am Ende der Allee blickte ich auf die Wand am anderen Ende und angsterfüllt fragte ich mich,<br />
was nun kommen würde. Eine Stunde verging. Dann erschien plötzlich, am Ende der Allee, ein<br />
offenes Militärfahrzeug. Neben dem Fahrer stand ein SS-Offizier. Vor der Baracke hielt das<br />
Fahrzeug an und der Offizier rief uns zu: «Wo ist der, der Deutsch spricht?» - «Hier!». Mit<br />
angespannten Nerven und beklommenem Herz meldete ich mich und trat zwei Schritte nach vorn.<br />
Der SS-Mann - ich weiß nicht ob Lagerkommandant oder Gehilfe - fuhr fort: «Haben Sie<br />
unterwegs Verpflegung erhalten?» - «Außer den Männern in zwei Wagen, die Wasser trinken<br />
konnten, haben wir seit fünf Tagen gar nichts bekommen!». Keine weitere Fragen, ein kurzes<br />
Zeichen und der Wagen fuhr davon.<br />
Einige Sekunden war ich aus dem Lot. Als ich mich als deutschsprachiger meldete, hatte ich<br />
meine Antworten bereit, für den Fall, dass der SS-Mann im Wagen weiter auf den vorherigen<br />
Wortwechsel mit dem Riesen über unseren Judenstatus eingehen sollte. Nichts dergleichen! Der<br />
Typ schien nur darum besorgt zu sein, uns etwas zu Essen zu bieten!<br />
Ich drehte mich zu den Kameraden um, merkte deren fragenden Blick und spürte die Distanz. Ich<br />
sagte bloß, dass der SS-Mann sich um die Versorgung mit Lebensmitteln kümmern würde. Ich<br />
spürte, dass mein Auftreten vor dem SS-Offizier zu einem offensichtlichen, aber stillschweigenden<br />
Verdacht Anlass gegeben hatte. Es war das erste Mal, dass ich eine ernsthafte Initiative ergreifen<br />
konnte, um den anderen Hilfe zu leisten, wie Kirrmann es vorhergesehen und betont hatte. Von<br />
den Kameraden - zugegeben, sie waren von der Müdigkeit abgestumpft und dementsprechend<br />
überfordert - bemerkte ich eine ablehnende Reaktion. Zu diesem Punkt möchte ich hier etwas<br />
ausweiten.<br />
Noch lange Zeit nach diesem Zwischenfall, während mehrerer Monate, sollte dieses Misstrauen<br />
weiter anhalten und zu Zweifel über die Motivation meiner Initiativen Anlass geben. Das erste<br />
präzise Indiz für diese Distanzierung wurde einige Tage später vor Ort in Birkenau von Marcel<br />
Paul, vielleicht ungewollt, herbeigeführt. Nach den “Aufnahmeprüfungen“ - später werde ich<br />
hierauf zurückkommen - wurden wir über zwei Warteblocks verteilt. Ich war mit Marcel Paul im<br />
gleichen Gebäude. Es war ihm bereits gelungen, mit einigen Kommunisten, Altinsassen des<br />
Lagers, die sich als “solidarische Gemeinschaft“ organisiert hatten, Kontakt aufzunehmen. Eines<br />
Tages, nachdem er am Zaun mit einer verhafteten Frau gesprochen und von ihr einen Sack mit<br />
Proviant erhalten hatte, setzte er sich neben mich. In der Zeit, als er vom Zaun zu seinem<br />
56
Strohsack kam, konnte ich von den anderen im Block den Namen dieser Frau erfahren: Marie-<br />
Claude Vaillant-Couturier. Als er merkte, dass ich ihm zuschaute, stand er auf und kam zu mir:<br />
«Hör mal, ich möchte mir dir über etwas ziemlich ernsthaftes reden. Es lässt mir keine Ruhe.» -<br />
«Ich höre dir zu. Worum geht’s?» - Er drückte sich: «Nicht jetzt. Ich werde noch darauf<br />
zurückkommen.» - «Wann du möchtest.» Zu einer Unterredung kam es nicht. Zwei Wochen<br />
später, Mitte Mai, nachdem wir in Buchenwald wieder im gleichen Block landeten, ergriff ich die<br />
Initiative und fragte ihn, worüber er denn mit mir reden wollte. Er spielte Erstaunen vor und<br />
versicherte mir, sich nicht mehr an das vorige Gespräch zu erinnern. Für mich steht fest, dass die<br />
Wortwechsel mit dem SS-Scharführer in der Allee und mit dem SS-Offizier vor der Baracke in<br />
Auschwitz für den nötigen Klatsch gesorgt hatten und dass die kommunistische Zelle vor Ort sich<br />
vor mir in Acht nahm und die Parole weitergegeben hatte, auf der Hut zu sein und mich zu<br />
meiden, denn ich gehörte nicht zu ihnen. Im Lager Buchenwald sollte ich diesbezüglich noch mehr<br />
erleben. Später mehr dazu.<br />
Am Morgen des 1. Mai 1944, mal in der Scheune mal vor der Tür, versuchte ich, zu erfassen, wie<br />
uns geschah. Ich wurde wieder aufmerksam, als einige Altinsassen des Lagers mit etlichen Kübeln<br />
erschienen: Suppe, jedenfalls so wurde die gelatinöse Brühe mit Gerste, Grütze und getrocknetem,<br />
teilweise faulem Gemüse genannt. Es gab auch “Tee“: eine braune Flüssigkeit, die gerade noch<br />
warm war. Ich hatte Hunger und ich aß. Ich hatte Durst und ich trank. Dann viel mir erst die<br />
Gegenwart der polnischen Mannschaft auf; nicht nur diese sondern noch viele andere waren dem<br />
Lagerkommando zugeordnet. Es war eine Gruppe Polen, die für die “Aufnahmeprüfung“ am<br />
gleichen Tag eingesetzt wurde. In der alphabetischen Folge, laut Konvoiliste, bekamen wir eine<br />
Nummer auf den linken Unterarm tätowiert. Die Tätowierten wurden zu einem Gebäude am Ende<br />
der Allee gebracht. Ich hatte Zeit, M von Margraff war noch lange nicht an der Reihe, und<br />
spazierte zwischen den Baracken. Ein SS-Soldat ließ die Leiche von zwei während der Nacht<br />
verstorbenen Genossen aus der Baracke holen. Der SS-Riese kam vorbei, um den Ablauf des<br />
Tätowierens zu kontrollieren und sich der Lieferung der Lebensmittel zu vergewissern. In dem<br />
Augenblick, als ich ihn kommen sah und auf ihn zugehen wollte, um mich auf gut Glück zu<br />
melden, kam mir ein anderer Häftling zuvor und sprach ihn an. Ich hielt mich zurück, verärgert<br />
und verängstigt. Der andere Häftling war mir bereits in Compiègne, bei den “Kulturellen<br />
Treffen“, aufgrund seiner Mehrsprachigkeit aufgefallen. Er hieß Brasowitch und war Slawe. Als<br />
der Offizier verschwunden war, noch keine Minute später, sprach ich ihn an und fragte ihn,<br />
wovon die Rede war. Er wollte mir nichts sagen, auch nicht den anderen, die ihn befragten. Ich<br />
werde noch auf ihn zurückkommen, wenn es in der Folge darum geht, seine Erklärungen über<br />
seine angebliche Rolle bei der Entscheidung zur Verlegung unseres Konvois von Birkenau nach<br />
Buchenwald, elf Tage später, unter die Lupe zu nehmen. Diese Verlegung, spezifisches Ereignis<br />
nur für unser Konvoi, bedeutete im Grunde genommen die Rettung aus dem Auge des Zyklons<br />
und es ist zu gravierend und zu komplex, um es hier auf die Schnelle abzuwickeln. Im weiteren<br />
Verlauf werde ich anhand anderer Elemente, die ich im Lauf der Zeit mit Geduld und Objektivität<br />
zusammengetragen habe, tiefer auf diese Angelegenheit eingehen, umso mehr als sie für mich eine<br />
der Hauptgründe für das Aufsetzen dieser Chronik und das Übermitteln meiner Botschaft war.<br />
Der Nachmittag ging zu Ende als der Buchstabe “M“ für die Tätowierung an der Reihe war. Der<br />
Mann war geschickt, denn die Ziffern erschienen gleichmäßig und gut lesbar. “186011“ kann ich<br />
seitdem auf dem Unterarm lesen. Die Zahl war so angebracht, das sie für die Lagerbehörde von<br />
außen zu lesen war und es war ein reiner Zufall, dass meine Ziffern auch umgekehrt, also aus<br />
meiner Sicht, eine Zahl ergeben: 110681. Weniger geschickte Tätowierer hatten manche Nummern<br />
ziemlich verunstaltet. Einer hatte, als ihm aufgefallen war, dass er eine falsche Nummer<br />
angebracht hatte, den Fehler durchgestrichen und neu angefangen.<br />
Hier stellt sich die Frage - in Bezug auf die französische Reglementierung in Sache<br />
Invaliditätsrente - ab welchem Perfektionsgrad eine “waschechte“ Tätowierung als ästhetisch zu<br />
betrachten ist. Die Bestimmungen sehen ausdrücklich vor, dass eine Deportationstätowierung<br />
Grund zu einer Invaliditätsrente ist, wenn sie… unästhetisch ist. Die Frage ist hirnrissig, sogar<br />
grotesk, aber… bei der Erledigung der Formalitäten zu meiner eigenen Invaliditätsrente, vor<br />
fünfzehn Jahren, forderte der beratende ärztliche Ausschuss, in casu das Finanzministerium, ein<br />
Gegengutachten mit der Absicht, meine Invalidität anzufechten und abzulehnen, und zwar mit<br />
der Begründung, sie sei ästhetisch! Das Gegengutachten mit Bezug auf diesen “Schandfleck“ war<br />
ein Witz. Als die mit dem Gegengutachten beauftragte Ärztin die Länge und Breite der<br />
57
Tätowierung prüfte, fragte ich, ob sie die “korrigierte Fläche“ berechnen wollte. Jedenfalls habe ich<br />
diesen Zwischenfall sofort meinen Kameraden mitgeteilt und ich hoffe, dass es ihnen anders<br />
gegangen ist.<br />
Am Abend des 1. Mai 1944, bei Einbruch der Nacht, wurden die vom Unteroffizier verlangten<br />
Aufnahmeformalitäten beschleunigt. Die Kameraden, alle noch in Zivilkleidung, wurden in ein<br />
Gebäude geführt, wo sie sich ganz auskleiden mussten. Danach ging es zu den Tischen am<br />
anderen Ende des Raums, wo andere Deportierten die individuelle Karteikarte ausfüllten.<br />
Anschließend kamen sie, immer noch splitternackt, über einen Flur in einen Nebenraum. Zweimal<br />
schaute ein SS-Mann in Uniform herein und forderte, um den Vorgang zu beschleunigen, die<br />
“Behandlung“ von 100 Mann pro Stunde. Die Mannschaft der Häftlinge, die mit dieser<br />
Behandlung beauftragt waren, hatte sich selbst den pompösen Namen “Politische Abteilung“<br />
gegeben. In der Tat bildeten sie die bürokratische Exekutive innerhalb des Lagers Birkenau und<br />
waren der SS-Führung unmittelbar unterstellt. Sie waren eigentlich die einzigen, die wichtige<br />
Informationen und Nachrichten einholen konnten und waren an unserem Konvoi Nicht-Juden aus<br />
Frankreich äußerst interessiert. Dann und wann stand einer vom Tisch auf, um einige Worte mit<br />
den deutschsprachigen unter uns zu wechseln.<br />
Ich hatte versucht, das Auskleiden solang wie möglich aufzuschieben, indem ich diesen Kontakt<br />
mit den Häftlingen der “Politische Abteilung“ nutzte und mich mit einem Wiener Jude, Kurt<br />
Weilenbach, etwas älter als ich, länger unterhielt (nicht zu vertauschen mit Henri Weilbacher aus<br />
Clermont!). Ich erinnere mich nicht mehr, wie das Gespräch genau verlief, aber ich konnte ihn<br />
dazu bringen, mich und einige andere, die dazu die Fähigkeiten hatten, mit einzubinden, um das<br />
Abhandeln der Formalitäten zu beschleunigen. Kurz befragte er seine Mannschaft, die zustimmte,<br />
und zusammen mit zwei anderen wurde mir ein Platz am Tisch zugewiesen, um die<br />
Schreibarbeiten zu erledigen. So gewann ich einige Stunden, sitzend und angekleidet, während<br />
deren ich versuchte, Informationen über unser Schicksal zu gewinnen. Nachmittags, vor dem<br />
Aufruf meines Namens zur Tätowierung, hatte ich in der Baracke noch etwas schlafen können und<br />
nun spürte ich erstaunlicherweise, wahrscheinlich durch die Spannung der Situation bedingt,<br />
weder Müdigkeit noch Schlaf. Eigentlich eine groteske, sogar absurde Situation, denn das<br />
Notieren der Personalien, die besonderen Kennzeichen, die Namen der im Fall eines Unfalls zu<br />
kontaktierenden Personen, das Inventar der goldenen Zähne und der auf dem Boden<br />
zurückgelassenen persönlichen Gegenstände wurde zu einem Gemisch aus Verwirrung, Komik<br />
und Perversität. In den Lagern ergaben sich mehrmals Situationen aus der Tragik des Alltags.<br />
Schnell wurden die Schreibarbeit für mich zu Routinearbeit, sodass ich die Gelegenheit hatte,<br />
länger mit Kurt Weilenbach zu reden.<br />
Der Jude Kurt Weilenbach war Sohn eines wohlhabenden Wiener Goldschmieds. Seit 1942 hatte<br />
er in Birkenau überlebt. Im Lauf der Stunden entwickelte sich eine gegenseitige Sympathie.<br />
Irgendwann erwähnte ich, dass ich noch wenige Tage vor Kriegsanfang die letzten Bergsteigferien<br />
in den Schweizer Alpen überhalb von Davos verbracht hatte und mich nun im KZ befand. Auch er<br />
hatte in 1937 seine letzten Sommerferien - vor dem “Anschluss“ in September 1938 - in der<br />
gleichen Gegend und auf den gleichen Berggipfeln verbracht. In extremen Situationen, wie wir sie<br />
damals erlebten, bilden und entwickeln sich Gefühle sehr rasch. Nach kurzer Zeit herrschte<br />
zwischen uns beiden volles Vertrauen. Ich berichtete ihm über die letzten militärischen<br />
Gegebenheiten, über die bevorstehende Landung der Alliierten, über die Hoffnung auf den<br />
Endsieg, die uns den Mut zum Durchhalten gab. Ich spürte, dass er etwas Wichtiges fragen wollte<br />
und wartete geduldig… «Weiß man in Frankreich, was das Konzentrationslager Auschwitz ist?».<br />
Ich erklärte ihm, dass der Name uns völlig unbekannt war und ich ihn, vor kurzem in Compiègne,<br />
nicht entziffern konnte. «Compiègne? Alle Konvois aus Frankreich kommen aus Drancy!». Ich<br />
wollte unbedingt wissen, was nun dieses Lager von den anderen unterscheide, von den Lagern,<br />
über deren Existenz und Namen wir schon mal gehört hatten.<br />
Es war schon weit nach Mitternacht, gegen 3 Uhr morgens. Während er weiter auf den<br />
Formularen kritzelte und vorgab, mit mir über die Karteikarten zu reden, fing er an, mir das<br />
industrielle, systematische Exterminationsverfahren zu schildern. Neben dem bereits 1941<br />
entstandenen Lager Auschwitz I, dem “normalen“ Konzentrationslager, wurde 1942 Auschwitz II,<br />
gebaut. Auschwitz II, Birkenau genannt, wurde für die Massenvernichtung der Juden aus den<br />
verschiedenen von den Nazis besetzten Gebieten eingerichtet. Nur wenigen, für bestimmte<br />
58
Arbeiten vorläufig geeigneten, war die Vernichtung erspart geblieben. Er selbst machte Teil des<br />
Kommandos “Arbeitsabteilung“ zu Birkenau aus. Das Schreien, das ich am Morgen auf der<br />
anderen Seite der Absperrung gehört hatte, kam aus der “Sortierabteilung“, wo die aus dem<br />
Arbeitslager wegen Erschöpfung “aussortierten“ Häftlinge eingesperrt waren. Regelmäßig, am<br />
frühen Morgen, wurden die endgültig Arbeitsunfähigen aus dem Block geholt und zu den<br />
Gaskammern geführt. Dass fast unser gesamter Konvoi tätowiert und eingetragen wurde, war ein<br />
sicheres Zeichen dafür, dass uns nicht die Vergasung, sondern der Einsatz in irgendeinem<br />
Arbeitslager bevorstand. Bei anderen Konvois verlief es anders: sofort nach Ankunft wurde eine<br />
Selektion durchgeführt, indem die kräftigsten, die deutschsprachigen Ärzte und die hübschesten<br />
Frauen aus dem Konvoi geholt wurden; die anderen wurden zu den “Duschräumen“ - in<br />
Wirklichkeit Vergasungskammern - geführt, wo sie gezwungen wurden sich auszukleiden. Die<br />
Leichen wurden sofort nach der Vergasung in den Krematorienöfen, deren meterhohe Flamme ich<br />
bereits betrachten konnte, verbrannt. Ich erstarrte. Wenn ich nicht am Vortag, das Schreckliche<br />
und Grausame bereits geahnt hätte, wäre ich von der detaillierten Schilderung des Kurt<br />
Weilenbach wahrscheinlich in Schockzustand versetzt worden. Seine Aussagen gaben mir eine<br />
Ahnung, ein Vermuten von der Tragweite dieses Dramas. Ich beschwörte ihn, diese Informationen<br />
niemandem der Franzosen weiterzugeben. Der Selbsterhaltungsinstinkt und die unerschütterliche<br />
Hoffnung aufs Überleben sagten mir, ich musste es für mich behalten, denn wenn ich es in<br />
unserem Konvoi unter den zahlreichen Widerstandskämpfern verbreiten würde, könnte es zu<br />
einem Blutbad kommen. Mit geschlossenen Augen nickte Kurt mir zu und gab mir so zu<br />
verstehen - deutlicher ging es nicht -, dass Verschwiegenheit die allererste Voraussetzung zum<br />
Überleben war.<br />
Meine Uhr zeigte kurz vor 4 Uhr morgens, als Kurt, ohne mir etwas zu sagen, für längere Zeit<br />
verschwand. Als er endlich wiederkam, hatte er mehrere Scheiben Schwarzbrot mit Marmelade<br />
bei sich. Während ich die Butterbrote hinunterschlang, berichtete er mir, dass seine Kameraden<br />
beim Kommando einige Gesprächsfetzen von den SS-Offizieren auffangen konnten und daraus zu<br />
verstehen war, dass der Kommandant - zweifellos der Offizier, der uns am Morgen im Wagen<br />
besucht hatte - auf nähere Befehle aus Berlin wartete, auf die Entscheidung, uns nun vor Ort in<br />
Birkenau einzusetzen oder zu einem anderen Lager abzuführen. Das war nun eine äußerst<br />
wichtige Information, die ich meinen Kameraden unbedingt weitergeben wollte, wenn wir nach<br />
der sogenannten “Desinfektion“ wieder zusammentreffen würden. Am Morgen des 2. Mai 1944<br />
war ich einer von den letzten, die noch nicht eingetragen waren. Als ich meine persönlichen<br />
Gegenstände in eine Tüte steckte, ließ Kurt mir meine Schuhe - Kommissstiefel, mit Nägeln<br />
beschlagene Halbstiefel bis über den Knöchel - zurückgeben und trug auf der Karteikarte ein:<br />
“Schuhe behalten“. Er machte mir den Vorschlag, ihm meine Uhr, die ich bis dahin versteckt hatte,<br />
anzuvertrauen. (Es war der Uhrmacher Jacques Daubauch aus Nancy, der mir in September 1942,<br />
nach unserem gemeinsamen Aufenthalt im Gefängnis zu Metz, diese Uhr verkauft hatte.)<br />
Wir standen zusammengedrängt auf dem Flur. Drei oder von uns hatten sich freiwillig gemeldet,<br />
um uns den Schädel zu rasieren: kahl. Mehrere Polen des Kommandos, auf Hockern sitzend,<br />
rasierten rudimentär die Achsel- und Schamhaare, fast trocken, sodass an manchen Stellen die<br />
Haut bis zum Bluten zerkratzt wurde. Abt Poutrain, schämte sich, traute sich nicht. Ich nahm ihn<br />
bei der Hand und führte ihn behutsam zum Hocker. Als er wieder aufstand, sagte er, ganz<br />
schüchtern: “Meine armen Freunde, ihr tut mir wirklich leid».<br />
Wir waren die letzte Gruppe, etwa zweihundert, die in den Duschraum kamen. Ich kann mich<br />
nicht mehr erinnern, ob die Duschen wirklich funktionierten, ob wir uns überhaupt waschen<br />
konnten. Aber was wäre aus meinen Schuhen geworden, die ich - das weiß ich genau - noch zehn<br />
weitere Tage behalten konnte. Danach ging es weiter in die “Garderobe“, wo wir mit<br />
Lagerkleidung ausgestattet wurden. Es gab einen Zwischenfall, zwischen Dusche und Garderobe<br />
und er ist mir in Erinnerung geblieben, denn er entsprach der besonderen Aufmerksamkeit der SS-<br />
Lagerdirektion unserem Konvoi gegenüber. Wir hatten uns in mehrere Reihen aufgestellt. Einige<br />
von uns trugen weiter das Kruzifix um den Hals. Sie hatten es vorher nicht ablegen wollen, denn<br />
es bedeutete für sie der letzte Halt in dieser Extremsituation. Drei SS-Offizieren erschienen und<br />
schritten zur Kontrolle den Reihen entlang. Einer blieb vor einem Häftling in der ersten Reihe<br />
stehen, nahm das Kruzifix seines umgehangenen Rosenkranzes in die Hand und beim Betrachten<br />
des christlichen Kreuzes seufzte er: «Ach, du lieber Gott!». Das reichte, um über deren Einstellung<br />
und Verachtung gegenüber Leuten wie uns Bescheid zu wissen.<br />
59
Als ich ihm meine Uhr überreichte, sagte Kurt, ich sollte mich in der Garderobe, in der<br />
Effektenkammer, an den diensttuenden Polen wenden. Ich habe seinen Namen vergessen. Sofort<br />
als er mich sah - ich hatte die Schuhe noch an den Füßen - rief er mir zu: «Ah! Du bist also<br />
Margraff. Such dir etwas aus», und zeigte auf den Haufen zerlumpte Kleidung. Socken ohne<br />
Löcher, lange Unterhosen, so gut wie neu, eine dickes Hemd mit allen Knöpfen, eine solide Hose<br />
bis über die Knöchel, eine lange gefütterte Weste mit breiten Schultern und mit einem Knopf<br />
tailliert, dazu noch mein festes Schuhwerk. Fast elegant erschien ich meinen Kameraden beim<br />
Wiedersehen in der Baracke, wo wir gegenseitig die frisch rasierten Schädel begutachteten. Ein<br />
wenig überrascht, aber höflich, äußerte Herr Brasowitch den anderen gegenüber sein Kompliment:<br />
«Er sieht schick aus!».<br />
Die allgemeine Stimmung in den Baracken war nicht gut. Es gab allerhand Gerüchte. Die<br />
erschöpften, nicht mehr reaktionsfähigen Männer drängten sich um die Teekübel. Die einen<br />
schrieen den anderen zu: «Wir werden hier verrecken!». Ein Berufsoffizier der französischen<br />
Armee, Kommandant Carmeaux - später in Flossenbürg verstorben -, mutig, dynamisch, aber<br />
ungestüm - und der mich noch lange Zeit schief betrachten sollte - schaffte es, die Truppe<br />
zusammenzuführen und mit der gesamten Mannschaft Übungen vorzuführen, um dem “Feind“<br />
unsere Disziplin zu zeigen. Ich hörte, dass auch andere von den Polen des Kommandos erfahren<br />
hatten, dass wir nicht in diesem Lager bleiben sollte. Dementsprechend behielt ich die von Kurt<br />
Weilenbach erteilten Informationen für mich, um ihn nicht zu kompromittieren, und wartete ab.<br />
Später bestätigte Kurt mir, dass der Lagerkommandant immer noch nicht wusste, was er mit uns<br />
anfangen sollte.<br />
Falls ich mich gut erinnere, verbrachten wir noch eine Nacht in den schlammigen Baracken.<br />
Anderntags wurden wir, an der Hinterseite des Infektionsraums entlang, in ein Nebenlager<br />
geführt. Wir waren durch Stacheldrahtabsperrungen vom Lager der Zigeuner getrennt. Bei den<br />
Suppenkübeln gerieten sich verschiedene Familien in die Haare. Wir bezogen zwei lange Gebäude<br />
auf Betonsockeln, mit auf beiden Seiten drei bis vier Bettenetagen durch ein Mittelmäuerchen über<br />
der ganzen Länge getrennt. Auf der Seite des Barackeneingangs war in dieser Mauer eine Öffnung<br />
angebracht, auf der anderen Seite führte ein steinerner Schornstein zum Dach. Das ergab also eine<br />
Art von Sitzbank aus Stein, aber ich bezweifelte, dass es möglich wäre - wie der Blockvorsteher<br />
meinte - am Eingang der Baracke ein Feuer zu machen, um den Raum über die ganze Länge zu<br />
heizen. Der Blockvorsteher war Pole, etwa fünfundzwanzig Jahre alt, kräftig, gut gekleidet. Er<br />
erweckte den Eindruck, sich “angepasst“ zu haben. Ich bekam den Auftrag, seine Befehle auf<br />
Deutsch zu übersetzen. Er hieß… Pollack, ganz einfach, aber dafür konnte er nichts. Korrektes<br />
Verhalten, ein feiner Kumpel, etwas rau aber aufrecht. Er verbarg seine Sympathie für die<br />
Franzosen nicht. Er zeigte auf den mit Schnee bedeckten Bergrücken der Beskiden: «Da,<br />
versicherte er mir, in der Babia Gorá - das ist der polnische Name der Beskiden - da warten die<br />
Partisanen auf die erste Gelegenheit, wenn die Front näher rückt, um uns zu befreien.» Öfters<br />
suchten ihn seine Kollegen beim Kommando auf und plauderten eine Weile mit ihm und mit uns.<br />
Als ein SS-Offizier vorbei kam, gab er mir Zeichen, mich neben ihn zu setzen, um so die Gruppe<br />
vor dem SS-Mann abzuschirmen, denn die Kollegen hatten dort nichts zu suchen. Ab und zu<br />
bekam er Besuch von einer jungen, hübschen, warm gekleideten Polin, wie er mit Schreibarbeiten<br />
beauftragt. Eines Tages - ich saß mit Pollack in einer Ecke - kam sie reingerannt. Sie sah besorgt<br />
aus. Dem Kapo teilte sie mit, dass sie bei der Lagerkommandatur erfahren hatte, wir würden nach<br />
Flossenbürg abtransportiert. Sofort war sie wieder verschwunden. Zum ersten Mal hörte ich den<br />
Namen Flossenbürg. Pollack wusste mir zu erzählen, dass Flossenbürg seit 1941 als Straflager von<br />
Auschwitz I für nicht-jüdische Polen eingerichtet war. Dies sollte sich im weiteren Verlauf leider<br />
bestätigen, aber an dem Tag war ich mir der Bedeutung dieses Indizes nicht bewusst. Ich hielt es<br />
für besser und sinnvoller, nicht mit den anderen darüber zu reden.<br />
Noch acht Tage verbrachten wir inaktiv in diesem Teil des Lagers. Außer den beiden Appellen<br />
zur Zählung, morgens und abends, stand es uns frei, uns auszuruhen. Die Nahrung, eine<br />
Schleimsuppe, an die wir uns bereits gewöhnt hatten, wurde uns von ganz jungen Mädchen - die<br />
sich freiwillig gemeldet hatten, nur um überleben zu können - in Fässern herbeigeschleppt:<br />
Fassschlepperinnen wurden sie genannt. Während dieser acht Tagen bekam ich die Gelegenheit,<br />
mit den anderen Mithäftlingen seit Compiègne, Bekanntschaft zu machen, denn nur Dumas und<br />
Chalus waren mit mir aus Clermont nach Birkenau deportiert worden. Es gab einige große Namen<br />
60
der Widerstandsorganisation, wie z.B. die zwei bei ihrer Verhaftung Verletzten, Rémy Roure und<br />
André Boulloche, deren Familie bei klandestinen Aktionen umkamen. Rémy Roure, talentierter<br />
Journalist, war nach dem Krieg einige Jahre Mitarbeiter der Tageszeitung “Le Monde“, später bei<br />
“Le Figaro“. André Boulloche, ehemaliger Schüler der École Polytechnique, sollte 1958, unter<br />
Präsident de Gaulle, Kabinettsleiter des Bildungsministers Paul Ramadier werden, später<br />
Bürgermeister-Abgeodneter der Stadt Montbéliard. In 1977 kam er bei einem Unfall um, als sein<br />
Flugzeug in einen Orkan geriet. Auch Robert Desnos war dort, aber über ihn erzähle ich später<br />
mehr. Michel Gardère, ein Berufsoffizier, wurde in den Nachkriegsjahren als Stratege des Kalten<br />
Krieges bekannt. Zu den Häftlingen gehörten auch der alte Domherr Tanguy von Pont-Aven in<br />
der Bretagne und sein Neffe, ebenfalls Priester und ausgezeichneter Prediger mit<br />
Hochschulabschluss in Rom. Ich kann mich noch an seine Predigt, anlässlich des Festes der Jeanne<br />
d‘Arc, am 9. oder 10. Mai, erinnern. Hinten in der Baracke fand der alte Domherr, am Ende seiner<br />
Kräfte, für uns stärkende Wörter zu Mut und Hoffnung. Jacques De Barry hatte die Militärschule<br />
Saint-Cyr abgeschlossen und sollte später, nach einer zusätzlichen Ausbildung an der<br />
Militärschule Coëtquidan in der Bretagne, zu dem Oberbefehlsstab der Armee berufen werden<br />
und als ständiger Generalsekretär des Verteidigungsministeriums seine Karriere beenden. Neben<br />
denen noch viele andere, die ich hier nicht alle aufzählen möchte.<br />
So erlebten wir auch das Auftreten eines Arztes, von einem Krankenpfleger begleitet, der sich für<br />
unsere Gesundheit zu interessieren schien. Später stellte sich heraus, dass es niemand anders als<br />
Dr. Josef Mengele sein konnte. In den acht Tagen bekamen wir allmählich eine Ahnung von der<br />
systematischen Vernichtung der Juden und hatten das Gefühl, einer lebensbedrohlichen Gefahr zu<br />
entfliehen. Es war uns ziemlich egal, unsere eigenen Kleider dort lassen zu müssen, um in<br />
Lumpenuniformen herumzulaufen. Ich hatte noch das Glück gehabt, das Feinste, das Bestgeflickte<br />
aussuchen zu dürfen.<br />
11. Mai 1944 - Alles ging schnell. Wir wurden wieder zu den Duschen geführt und mussten<br />
unsere Kleidung gegen verschlissene gestreifte KZ-Drillichanzüge, Weste und Hose, tauschen.<br />
Kurt suchte mich ein letztes Mal auf, gab mir meine Uhr zurück und informierte uns, dass wir in<br />
einem Konvoi nach Buchenwald verlegt wurden. Ich schnappte mir einen der Anzüge, den<br />
schlechtesten von allen und eigentlich nicht viel mehr als Lumpen, zusammen mit den<br />
Holzschuhen, wie alle anderen. Ich ahnte, dass sich in Buchenwald oder in einem anderen Lager<br />
die gleiche Prozedur Dusche-Desinfektion-Kleidung wiederholen würde. Am Nachmittag<br />
befanden wir uns wieder in den schlammigen Scheunen, in denen wir die ersten zwölf Tage nach<br />
unserer Ankunft verbracht hatten. Alle waren müde, ziemlich erschöpft. Einige versuchten die<br />
Stimmung hochzuhalten, indem sie sich selbst und die anderen versuchten zu überzeugen, dass es<br />
nun zu einem “viel besseren“ Lager ging. Nicht wenige, etwa hundert, waren aufgrund des<br />
Klimawechsels mehr oder weniger erkrankt. Es war kalt in Zentraleuropa, am Fuß der Beskiden,<br />
und zusätzlich feucht in der Sumpfebene, durch die ein Flüsschen zur Weichsel zog. In Anbetracht<br />
der dort herrschenden, feindlichen Bedingungen, d. h. des Temperaturunterschieds zwischen dem<br />
Pariser Becken und Zentraleuropa im Monat April, der dürftigen Versorgung, der ungenießbaren<br />
Nahrung und der kargen Kleidung braucht es keinen zu wundern, dass etwa fünf Prozent unter<br />
uns, obwohl in den besten Jahren, an Bronchitis, wenn nicht schon Lungenentzündung, erkrankt<br />
waren. Die Häftlingen des Kommandos kamen mit den vollständigen Listen zu uns, hakten jeden<br />
einzeln ab, stellten die angeblich Kranken - mehr oder weniger arbiträr als solche eingestuft - in<br />
eine separate Reihe. Der Unteroffizier des ersten Morgens kam ebenfalls vorbei, eine Liste in der<br />
Hand, um einen von uns herauszupicken, einen Juden. Er wurde abgeführt. Ich habe nie von<br />
seinem Los erfahren. Einer der Elsässer, Lutz, hatte in der Vergangenheit ein Bein amputiert<br />
bekommen und trug ein Holzbein. Er schraubte es ab, sodass wir unsere persönlichen<br />
Gegenstände - darunter auch meine Uhr - darin verstecken konnten.<br />
Am späten Vormittag ging es los. Die Kranken blieben zurück. Langsam marschierten wir an<br />
mehreren Baracken entlang. Durch die Fenster einer dieser Einrichtungen warfen Mitarbeiter und<br />
Mitarbeiterinnen des Kommandos, Kollegen von Kurt, uns Nahrungsmittel, Zigaretten und<br />
Streichhölzer für die Reise zu, als Zeichen der Solidarität. Etwas weiter gingen wir an einigen<br />
Scheunen, genau wir die unseren, vorbei. Sie waren - im wahrsten Sinne - überfüllt mit Frauen, die<br />
uns zu verstehen gaben, dass sie ungarische Jüdinnen waren. Einige Tage nach unsere Abfahrt<br />
sollten sie vergast werden. Der Marsch endete bei der Eisenbahn, wo ein Güterzug wartete. Luken<br />
mit Gittern versehen, Fluchtmöglichkeit gleich Null. Wir stiegen fünfzig pro Waggon ein, in dem<br />
61
sich bereits Kanister mit “Tee“ und Säcke mit zerbrochenem Brot befanden. Ein SS-<br />
Hauptsturmführer ging der Rampe entlang und überwachte den Vorgang. Als wir alle in den<br />
Waggons waren, fragte er, auf etwa zwanzig Meter von mir entfernt - ich schaute noch aus der<br />
offenen Tür -, ob jemand von uns Deutsch sprach. Sofort meldete ich mich. Er beauftragte mich,<br />
indem er mich mit “Sie“ ansprach - ich werde die Übersetzung seiner Worte nie vergessen -, den<br />
anderen mitzuteilen «Sie gehen jetzt nach Buchenwald. Es ist ein gutes Lager, das ich seit 1939<br />
kenne. Sie finden auch Versorgung für die Reise. Sagen Sie ihnen auch, dass, wenn einer einen<br />
Fluchtversuch wagt, alle anderen im Waggon füsiliert werden.» Die Mitteilung wurde von<br />
Waggon zu Waggon weitergeleitet. Wir wurden tatsächlich, fünfzig pro Waggon, nach<br />
Buchenwald deportiert, mit offener Waggontür und zwei Wächter unmittelbar daneben.<br />
Ich werde über die Reise nach Buchenwald später ausführlicher berichten. Wir hatten nun<br />
Auschwitz hinter uns und fuhren nach Buchenwald. Warum, weshalb wurde unser Konvoi -<br />
abgefahren aus Compiègne in Frankreich, anfangs nach Auschwitz-Birkenau geleitet, danach<br />
zurück nach Buchenwald, um letztendlich, für die meisten von uns, am 25. Mai 1944 in<br />
Flossenbürg in der Oberpfalz (Nord-Bayern) einzutreffen - über solche Umwege geleitet? Die<br />
Regel, die ich mir selbst auferlegt habe, um diese Frage zu klären, ist an sich mühselig. Die<br />
Objektivität zwingt mich, die Richtigkeit der Interpretationen und der Behauptungen zu prüfen. In<br />
manchen Fällen sind die Aussagen von keinerlei Indizien sondern nur vom Bekanntheitsgrad der<br />
Betroffenen untermauert. Während der Zeit kurz nach Kriegsende, in der ich noch von dem mir<br />
gegenüber geäußerten Verdacht tief gekränkt war, ließ ich die anderen Überlebenden, damals<br />
noch zahlreich, reden. In der Tat konnte unser Konvoi eine relativ hohe Überlebenszahl<br />
verzeichnen, denn im Herbst 1945, nach gründlichen und hartnäckigen Ermittlungen, wurden fast<br />
700 Überlebende gezählt, d. h. ein Verlust von “nur“ 60 Prozent in den zwölf Monaten der<br />
Deportation.<br />
Was haben diese Überlebenden seitdem erzählt und ausgesagt? Dass wir dank des “Intelligence<br />
Service - I.S.“ von den Gaskammern verschont blieben! Bis 1950, als ich wieder im Elsass lebte,<br />
mein Studium zum Abschluss brachte und mich allmählich erholte, hörte ich nur hier und dort<br />
Anspielungen, ohne jede Begründung, hatte keinen Kontakt zu den anderen Überlebenden. In<br />
unserem Konvoi sollte einer der Verantwortlichen auf höchster Ebene des “Intelligence Service“<br />
deportiert worden sein, ein Franzosen, der von der Gestapo verhaftet wurde, ohne dass die<br />
Geheimpolizei sich der Wichtigkeit der Person bewusst war… In 1949 beschloss ich, Abt Louis<br />
Poutrain im Departement Hautes-Alpes aufzusuchen. Louis Poutrain war zu seiner<br />
Kirchengemeinde zurückgekehrt und hatte viele Kontakte zu den Überlebenden unseres Konvois<br />
wieder aufgenommen.<br />
Eine kurze Biographie des Louis Poutrain wird dazu beitragen, die Ausstrahlung und<br />
Glaubwürdigkeit dieses 1983 verstorbenen Priesters sowie den Grund meiner Initiative zu<br />
verstehen. Poutrain wurde Ende des neunzehnten Jahrhundert als Kind einer Großfamilie,<br />
Landeigentümer in Nord-Frankreich, geboren. Alle Kinder brachten es zum Abitur, zum<br />
Baccalauréat, eine Seltenheit zu jener Zeit. Zwei seiner Geschwister waren in eine<br />
Ordensgemeinschaft eingetreten. Eine seiner Schwestern war Superiorin einer Ordensprovinz im<br />
Nahost. Mit achtzehn, in 1916, meldete er sich als freiwilliger, kehrte als Offizier mit der<br />
Ehrenlegion aus dem Ersten Weltkrieg zurück und wurde dann Priester. Als junger Vikar in<br />
Boulogne-sur-Mer, im Departement Pas-de-Calais, begann er seine Karriere und setzte sich derart<br />
ein, dass seine Gesundheit darunter zu leiden hatte. Er erkrankte an einer eitrigen<br />
Rippenfellentzündung, die er - in einer Zeit ohne Antibiotika - gerade noch überlebte. Seine<br />
Vorgesetzten schickten ihn endgültig zu einem Dorf in den Alpen, wo das Klima seiner<br />
Gesundheit wohltat. Er blieb sehr mit seiner Heimat verbunden, hatte eine starke Beziehung zu<br />
dem Bruder, ebenfalls Vater einer Großfamilie, der den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern<br />
übernommen hatte. Dieser Bruder sollte 1951 bei einem Unfall mit einer defekten Maschine tödlich<br />
verletzt werden.<br />
Louis Poutrain hatte in der Gegend des Haut-Drac, aufgrund der erheblichen Landflucht nur<br />
noch karg bevölkert, Großes geleistet. Von Wäldern umgeben, ein wenig naiv und sehr<br />
wagemutig, beschloss er, eine Schreinerschule - heute “Lycée Professionnel Louis Poutrain“ - zu<br />
errichten, obwohl das Waldholz sich nur für grobes Balkenwerk eignete. Er gab jedoch nicht nach<br />
62
und gründete mehrere multiprofessionelle Werkstätte, die mit den Steuern der Privatindustrie<br />
finanziert wurden. Dazu konnte ich meinen kleinen Betrag leisten. Es kam jedoch nie zu einem<br />
industriellen Unternehmen, der Tourismus nahm die Überhand. Für das Dutzend in seiner Schule<br />
ausgebildete Schreinermeister, die sich vor Ort niedergelassen hatten, war es der entscheidende<br />
Anfang: die Wintersportstation Ocières-Merlette entstand und wurde ausgebaut - im Grunde<br />
genommen - dank des Durchhaltevermögens von Abt Louis Poutrain. Noch keiner hat<br />
irgendwann darauf hingewiesen, deshalb tue ich es hier.<br />
In 1949 war die Landschaft noch herrlich, unberührt vom Zulauf aus den Städten. Als wir - ich<br />
wurde von zwei Kameraden begleitet - im Auto, d. h. in einer Klapperkiste aus der Vorkriegszeit,<br />
durchs Drac-Tal fuhren, entdeckten wir eine Gedenkplatte an einem Felsen. Dort wurde in Juni<br />
1994 einer mit Namen Poutrain von der Gestapo erschossen, nicht Louis, sondern den jüngsten<br />
seiner zahlreichen Brüder, der, während sich sein Bruder Abt im KZ befand, im Dévoluy-Massiv<br />
den Widerstand organisierte. Erst fünfzehn Jahre später, anlässlich eines wiederholten Aufenthalts<br />
in der Pfarrei in 1966, sollte Louis Poutrain mich über seine Verhaftung, keineswegs im<br />
Zusammenhang mit den Aktivitäten seines Bruders, aufklären. Mehr als jedes andere Beispiel,<br />
sagt seine Geschichte vieles über seine Unbefangenheit und Zutraulichkeit, fast Leichtsinnigkeit,<br />
über seine Geisteshaltung aus.<br />
Während meines zweiten Aufenthalts in August 1966 erzählte er mir.<br />
Lyon, Winter 1943-44. Auf der hinteren Plattform der Straßenbahn standen fünf<br />
Wehrmachtsoldaten in Uniform. Fünf Elsässer. Zwangssoldaten. Auf Elsässer Mundart war die<br />
Rede von Desertieren, bei der erst möglichen Gelegenheit, die ihre zeitliche Verlegung nach Süd-<br />
Frankreich (seit Ende 1942 besetzt) bieten würde. Ein Mitreisender, Elsässer auf der Flucht, hatte<br />
der Unterredung zugehört und beim Aussteigen gab er ihnen den Tipp, ebenfalls auf Elsässer<br />
Mundart, nach Gap zu fliehen, zur Pfarrei “Sankt Johannes und Sankt Nikolaus“. Abt Poutrain<br />
würde sie dort aufnehmen und verstecken. Zu allem bereit gingen die fünf das Risiko ein,<br />
besorgten sich Zivilkleidung - Poutrain hatte diese Kleidung samt Marschgepäck aufbewahrt -<br />
und suchten den Pfarrer auf. Der Namen des Elsässers, der ihnen den Tipp gegeben hatte, war<br />
ihnen unbekannt. Es konnte ein Falle sein, aber der Pfarrer sorgte sich nicht. Als guter Samariter,<br />
im evangelischen Sinn des Worts, nahm er sie auf. Er sollte nie erfahren, wer der Elsasser war, der<br />
den Zwangssoldaten in der Strassenbahn den “Rat“ gegeben hatte. Einige Wochen später geschah<br />
das Drama. Poutrain wurde angezeigt. Er hat mir niemals den Namen des Denunzianten nennen<br />
wollen. Ein junger Mann, ein Milizionär, aus gutem Hause (ich glaube aus Gap), der öfters in der<br />
Gegend spazieren ging und ab und zu zur Pfarrei kam, meldete das Versteck der Zwangssoldaten<br />
bei der Kommandatur zu Gap. Poutrain wurde zusammen mit den fünf Männern verhaftet und<br />
der Gestapo gestellt. Keiner wurde verhört und - dies betonte Poutrain - keiner wurde<br />
misshandelt. Die fünf Deserteure würden, wie sonst üblich, nicht füsiliert, sondern zum Lager<br />
Compiègne abgeführt und von dort aus nach Deutschland deportiert. Von den fünf kamen zwei<br />
im KZ um. Die drei Überlebenden sind dem Abt ewig dankbar geblieben. Ich bin ihnen begegnet,<br />
ein erstes Mal anlässlich der Feier zum fünfzigjährigen Jubiläum des Abts, ein zweites und letztes<br />
Mal, leider, bei seinem Begräbnis. In hohem Alter war der Abt nach Paris umgesiedelt und wohnte<br />
bei einer anderen Schwester, die nicht Ordensschwester sondern Mutter, Großmutter und<br />
Urgroßmutter einer prächtigen Sippe geworden war.<br />
Diese Gelassenheit - sie ließ einen nicht ungerührt - hat Louis Poutrain bis zu seinem Lebensende<br />
ausgezeichnet. Als 1967, dreiundzwanzig Jahre später, der Freundeskreis der ehemaligen, mit<br />
unserem Konvoi Deportierten eine Pilgerfahrt nach Auschwitz unternahm, waren Louis und ich,<br />
zusammen mit etwa zwanzig Überlebenden, dabei. Vor Ort wurden wir von einer hervorragenden<br />
Führerin, Mira Odi, begleitet. Sie sprach Französisch und konnte uns ganz genaue Informationen<br />
über das Funktionieren der Gaskammern vermitteln. Ich werde später noch auf sie<br />
zurückkommen. Wieder zurück in Frankreich publizierte Louis einen Reisebericht in einer<br />
Monatszeitschrift, das auch ich abonniert hatte. Aufrecht wie immer schrieb er: «Heute habe ich<br />
Angst!». Das bedeutete, dass er damals die Jahre der Deportation wie in einem Traum erlebt hatte<br />
und sich deren bitteren Realität erst während der Reise bewusst geworden war. Im Lauf der vielen<br />
Jahre lernte ich Louis Poutrain besser kennen. Abgesehen von unserer gemeinsamen Geschichte in<br />
den Lagern und dem, was ich über unsere gemeinsamen Kontakten erfuhr, wusste ich im Sommer<br />
1949 nur wenig über diesen Mann.<br />
63
Ich erzählte ihm, was ich in Birkenau zwischen dem 1. und dem 12. Mai 1944 gesehen, gehört,<br />
erfahren und unternommen hatte, wie ich es hier erzähle. Ich betonte den Zusammenhang<br />
zwischen meiner Unterredung mit dem Unteroffizier vor der Baracke und der Intervention des SS-<br />
Offiziers in der Folge. Ich erklärte ihm, dass, meiner Meinung nach, demzufolge deutlich wurde,<br />
dass wir kein Judenkonvoi waren und wir einige Tage später, nach “Überprüfung“, zum Lager<br />
Buchenwald abgeführt wurden. Er hörte mir aufmerksam und gespannt zu, bat den jüngeren am<br />
Tisch, still zu sein und mir ebenfalls zuzuhören. Die Antwort blieb er mir schuldig. Ich rechnete<br />
mit näheren Angaben, weiteren Informationen, die er vielleicht seinerseits gesammelt hätte. Er<br />
schwieg. Ich merkte, dass er starke Emotionen empfand. Welche? Überraschung? Skepsis? Ich<br />
spürte, dass es keinen Sinn hatte, weiter zu bohren, ihn zu fragen, ob ihm diese unwahrscheinliche<br />
Geschichte über den “Intelligence Service“ bekannt war. Seit der Befreiung war ich einige Male<br />
aus dem Elsass zu den Treffen mit den Kameraden nach Paris gekommen und sie hatten einige<br />
Bruchstücke über diese “Affäre“ fallen lassen: es sei in unserem Konvoi, mit uns, einer der<br />
wichtigsten Widerstandsführer deportiert worden und dieser - so wurde erzählt - habe sofort nach<br />
unserer Ankunft in Birkenau mit einem früher deportierten Verbindungsmann Kontakt<br />
aufnehmen können. Dieser Verbindungsmann habe vor Ort die Möglichkeit gehabt, über ein<br />
geheimes Verbindungsnetz bis London, den britischen “Intelligence Service“ über unsere Ankunft<br />
zu benachrichtigen! Es war mir klar, dass ich sehr viel Zeit brauchen würde, um das Rätsel zu<br />
lüften, diese Geschichte zu überprüfen - wenn überhaupt überprüfbar. In der Tat dauerte es noch<br />
etwa dreißig Jahre, während deren ich - nach strenger Überprüfung - genaue Indizien und<br />
unanfechtbare Informationen sammelte, bis ich endlich wusste, was höchstwahrscheinlich passiert<br />
war. Dann wurde mir klar, weshalb Louis Poutrain nie darüber reden wollte, weder in 1949, noch<br />
in den Jahren danach.<br />
Viele von den Kameraden lebten im Pariser Becken und nach meinem Umzug nach Paris in 1951<br />
spürte ich das Bedürfnis, meine damaligen Weggenossen zusammenzubringen. Aus diesem<br />
Grund nahm ich an den Treffen des Vereins “Flossenbürg“ teil. Das Arbeitslager Flossenbürg war<br />
für die meisten von uns, nach Auschwitz und Buchenwald, die Endstation der Reise, die in<br />
Compiègne angefangen hatte. Der Verein wurde unmittelbar nach der Befreiung gegründet und<br />
stand unter der Schirmherrschaft der Angehörigen, die die Wahrheit über das Schicksal und den<br />
Tod ihrer Verwandten wissen wollten, was auch selbstverständlich war. “Flossenbürg“ war fest in<br />
den Händen einer kleinen Gruppe Witwen und Eltern, die nur ihre eigenen Belange und<br />
Vorrechte vor Augen hatten, vom schmerzenden Verlust der Angehörigen befangen und jedem<br />
Ziel, das einen Verein ehemaliger Deportierte kennzeichnen sollte, verschlossen. Der so<br />
zusammengestellte Verwaltungsrat verhinderte einfach das normale Funktionieren dieses Vereins.<br />
Jahr für Jahr fanden äußerst lebhafte, sogar stürmische Versammlungen statt, in dem Maße, dass<br />
1958 mehrere verärgerte Mitglieder, mehrmals auf unangenehme, manchmal grobe Art und Weise<br />
zurückgewiesen, die Entscheidung trafen, den “Freundeskreis der tätowierten Deportierten des<br />
Konvois vom 27. März 1944“ zu gründen. Einige Kameraden erklärten sich bereit, auf der Suche<br />
nach den Überlebenden das Land zu durchkreuzen, denn beim Verein “Flossenbürg“ gab es keine<br />
Kartei. Sie machten ihre Sache so gut, dass von den etwa 600 Heimgekehrten, letztendlich,<br />
dreizehn Jahre später, noch 301 Überlebende zusammentrafen. Somit wurde die voraussichtliche<br />
Statistik des Professors Robert Waitz, laut deren nach zehn Jahren die Hälfte noch leben würde,<br />
untermauert. Fast alle Überlebenden wurden gefunden, nur wenige fehlten. Die Organisatoren des<br />
großen Treffens von 1958 hatten mit viel Pomp auf den Einladungen angekündigt, dass wir<br />
unserem unbekannten Retter von Auschwitz dort begegnen würden. Das einzige positive<br />
Ergebnis war das zahlreiche Erscheinen der neugierigen Geladenen, etwa die Hälfte der<br />
Überlebenden. Der mysteriöse Retter erschien jedoch nicht und ließ nichts von sich hören. Wir<br />
wollten eine Polemik vermeiden, umso mehr da ein anderer Überlebender, der zwar nicht bei den<br />
Treffen erschien, jedoch den Mut hatte, seinen Namen zu nennen - Brasowitch -, von seiner Seite<br />
das Gerücht einer anderen, exklusiven Version verbreitete: Brasowitch eignete sich den Verdienst<br />
an, damals mit der Außenwelt Kontakt aufgenommen zu haben und somit die Entscheidung<br />
unserer Verlegung nach Buchenwald mitbestimmt zu haben! Ich schwieg. Die Verbitterung über<br />
die Bewertung meines Engagements in Mai 1944 hielt weiter an. Meine Skepsis wuchs in<br />
Anbetracht dieser widersprüchlichen Versionen, die nur die Ungereimtheit gemeinsam hatten und<br />
keine Basis für eine Debatte bilden konnten, da es an neuen Elementen mangelte und nicht belegt<br />
werden konnte, dass es überhaupt keinen unbekannten Retter gab.<br />
64
Die Jahre gingen vorbei. In Juni 1967 organisierte Dr. Paul Denis - stellvertretender Bürgermeister<br />
der Stadt Le Havre, Überlebender unseres Konvois und damals Vorsitzender des Vereins - eine<br />
Reise nach Polen, die in eine Pilgerfahrt nach Birkenau und einen Besuch der KZ-Stätte gipfeln<br />
sollte. Ich war mit dabei, zusammen mit etwa dreißig Kameraden, unter denen auch Louis<br />
Poutrain. Es war ein allgemeiner Erfolg und für mich mehr als eine hervorragende Kombination<br />
aus angenehmen Tourismus und besinnlichen Gedenkstunden, da ich unverhoffte, genaue und<br />
übereinstimmende Angaben über unser Konvoi, am Abend des 30. April 1944 dort eingetroffen,<br />
sammeln konnte. Im Lauf des ersten Tages, teilweise auch am darauffolgenden Tag, wurden wir<br />
von einer sowohl durch Objektivität als auch Kompetenz ausgezeichneten Person empfangen,<br />
geführt und informiert. Sie sprach perfekt Französisch, war 46 und, trotz den Strapazen des Kriegs<br />
und dem harten Leben in Polen, einfach schön. Mira Odi, 1921 geboren, hatte ihre Adoleszenz in<br />
Frankreich verbracht und bei ihrem Onkel, immigriertem Bergmann, in Brassac-les-Mines, südlich<br />
von Clermont-Ferrand gelebt. In 1939, nach ihrem Baccalauréat, fuhr sie nach Polen, um dort die<br />
Ferien bei ihren Eltern zu verbringen. Kurz vor ihrer geplanten Rückkehr nach Frankreich, am 1.<br />
September 1939, schließ sich die Falle: die Wehrmacht rückte in Polen ein. Ganz früh schloss sie<br />
sich der ersten polnischen Widerstandsorganisation “Armyra Kraîova“ (A.K.) an. Zur Zeit des<br />
Überfalls auf Polen war die UdSSR durch den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt, den Hitler-<br />
Stalin-Pakt vom 23. August 1939 gebunden. In 1941 wurde sie verhaftet, erlebte in Warschau das<br />
grausame Païvak-Gefängnis und wurde über einige andere Lager nach Ravensbrück deportiert. In<br />
1945 wurde sie aus dem KZ Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide befreit. Als die Gedenkstätte<br />
und das Museum eingerichtet und der Ort unter Denkmalschutz gestellt waren, wurde sie<br />
Verantwortliche und Führerin. Sie schenkte uns ihre besondre Aufmerksamkeit, denn unser Fall<br />
war, wenn nicht ein Einzelfall, eine Seltenheit und wahrscheinlich hatte sie nie die Gelegenheit,<br />
eine Gruppe Überlebende, die nicht aus rassistischen Gründen deportiert wurden, durch die<br />
Gedenkstätte zu führen. Die Kameraden wollten vor allem die Stätten oder deren Reste, wo sie die<br />
Tage zwischen dem 30. April und dem 11. Mai 1944 verbrachten, aufsuchen. Der Enthusiasmus<br />
war groß, als sie einige wieder entdeckten.<br />
In der Zeit blieb ich an Miras Seite. Sie erzählte über ihr Schicksal, ich über das unsere, genau wie<br />
sich die Ereignisse in Mai 1944 vor Ort abgespielt hatten. Sie präzisierte: Die Weiterleitung unseres<br />
Konvois, von der Eisenbahnrampe außen am Zaun entlang, der Eintritt durch die hintere Schranke<br />
und die erste Unterkunft in den Baracken, sowie die systematische Tätowierung, der<br />
alphabetischen Liste nach, am darauffolgenden Tag waren zuverlässige, sichere Zeichen dafür,<br />
dass unser Konvoi nicht auf dem direkten Weg zur Vernichtung in den Gaskammern war,<br />
sondern zu einem Arbeitslager weitergeleitet werden sollte. Die Wörter des Unteroffiziers - “Ich<br />
will mal sehen, was ich machen kann!“ - als Antwort auf meine Äußerung, - “Wir sind alle<br />
Vollarier!“ - wären also in diesem Rahmen zu interpretieren. Das war das allgemeine Vorgehen<br />
der SS, eine Vertuschung und Heuchelei, die es ihnen erlaubten, nicht selbst, sondern die<br />
Drecksarbeit von den anderen Häftlingen durchführen zu lassen und von dem Aufwand, dem<br />
Ärger und der Müdigkeit verschont zu bleiben. In unserem Fall, fügte Mari hinzu, weil es an<br />
jenem 1. Mai 1944 erst 6 Uhr morgens war, ist es wahrscheinlich, dass dieser Kommandoführer,<br />
der um die Zeit seinen Dienst antrat, nur routinemäßig zu uns kam, noch nicht wusste, was für ein<br />
Konvoi am Vorabend eingetroffen war, und meine Aussage über die nicht-jüdischen Franzosen<br />
aus Compiègne erst später, nach dem Wortwechsel vor den Scheunen, auf der Dienstelle bestätigt<br />
bekam.<br />
Mari, die sich sehr mit den Recherchen über den Holocaust in Auschwitz beschäftigt hatte,<br />
bestätigte mir zwei zusätzliche Elemente als zuverlässig und sicher. Erstens: gerade in Mai 1944<br />
war die Zahl der Vergasungen am höchsten und diese Aussage deckt sich mit den Beobachtungen<br />
des Professors Robert Weitz, der in den “Témoignages Strasbourgeoises“ präzisiert, dass eines<br />
Tages in Mai 1944 bis zu elftausend - 11 000 - Häftlinge durch Vergasung umgebracht wurden.<br />
Zweitens: das Drama der ungarischen Jüdinnen datiert ebenfalls von Mai 1944; mehrere tausend<br />
Jüdinnen, aus Ungarn nach Buchenwald deportiert, warteten mehrere Tage auf den Tod und es<br />
waren gerade diese Frauen, an deren Baracken wir auf dem Weg zum Zug nach Buchenwald<br />
entlang gelaufen waren.<br />
Einige Elemente stimmten überein, fügten sich in meinem Geist zusammen, blieben jedoch noch<br />
zu wage, um mir ein kohärentes Bild zu verschaffen. Den anderen Kameraden war es angeblich<br />
nicht wichtig, zu erfahren, was uns vor dreiundzwanzig Jahren genau geschehen war. Sie waren<br />
65
allzu sehr damit beschäftigt, die Stellen, an denen wir uns damals aufgehalten hatten, genau zu<br />
orten, denn mittlerweile war fast alles dem Erdboden gleichgemacht. Es gelang ihnen, auf einer<br />
riesigen, grünen Wiese den Umriss der beiden Scheunen, in denen wir die Nacht nach der<br />
Ankunft und vor der Abfahrt verbrachten, genau abzugrenzen.<br />
Louis Poutrain war vorbereitet. Mit Hilfe einiger Kameraden baute er seinen tragbaren Altar auf.<br />
Es war, als ob er auf dem Grundriss der Baracke einen Tempel errichtete. Er las eine Messe, ich<br />
war sein Messdiener. Es war eine rührende Zeremonie, auch für Mira, die ihre erste Gruppe<br />
Überlebende eines Konvois Nicht-Juden führte und sich ihrer Kindheit in Frankreich erinnerte. Sie<br />
konnte ihre Emotion nicht zurückhalten. Eine französische Ehegattin, polnischer Herkunft, nahm<br />
sie in den Arm und tröstete sie mit ihrer und unserer Zuneigung. Ein Hase kam kurz vorbei,<br />
schaute zu und lief wieder davon.<br />
Als wir die baufällige Installation zum Duschen und Rasieren erkannten, das Gebäude, in dem<br />
die SS-Offiziere uns aufgesucht und sich über unsere Kruzifixe und Rosenkränze lustig gemacht<br />
hatten, gingen wir alle hinein. Wir durchquerten die Installation und befanden uns dann vor dem,<br />
was von den Krematorien als Ruine übrig geblieben war. Mira erklärte uns, wie die<br />
Massenvernichtungen damals organisiert waren: sofort nach Ankunft eines Konvois fand eine<br />
kurze “Selektion“ statt, wonach die Deportierten sofort zu den Umkleideräumen, angeblich<br />
Duschräumen, geführt wurden; in den geschlossenen Raum wurde das Giftgas durch Öffnungen<br />
in der Decke eingeleitet und nach etwa einer halben Stunde durch Ventilation unter Druck wieder<br />
abgeführt; danach wurde der Raum auf der Seite des Krematoriums geöffnet und die Leichen<br />
wurden sofort in den unmittelbar angrenzenden Krematoriumöfen verbrannt. Die Duschräume<br />
waren abgerissen und von den Krematorien blieb nur noch die Vorderseite übrig, dort wo wir<br />
standen. Nach Oktober 1944, nach der Revolte der Deportierten des Kommandos, die mit diesen<br />
Arbeiten beauftragt wurden, sagte Mari uns, fanden keine “Vergasungen“ mehr statt. Bei dieser<br />
Revolte wurden nur zwei Öfen mit Dynamit gesprengt, die Meuterer wurden bis auf zwei - einer<br />
lebte 1967 in Israel, der zweite in Paris - alle getötet, ein SS-Offizier wurde lebendigen Leibes in<br />
den brennenden Ofen geworfen. Es war nicht aufgrund der Revolte, dass die Vergasungen<br />
aufhörten, sondern weil, nach den aufeinanderfolgenden Niederlagen der deutschen Truppen und<br />
dem Zusammenziehen aller Fronten, die von den Nazis geräumten Gebiete bereits von der<br />
Judenbevölkerung “gesäubert“ waren und einfach keine größeren Konvois mehr in Birkenau<br />
ankamen.<br />
Gespannt hörten die Kameraden den Erklärungen von Mira zu. In 1967 wussten sie alle, dass mit<br />
Gas getötet wurde, jedoch nicht damals, in Mai 1944. Nur ich wurde von Kurt Weilenbach<br />
während unseres nächtlichen Gespräch aufgeklärt. Vielleicht hatte es noch einige andere gegeben,<br />
die sich sofort der grausamen Massenvernichtung und deren schrecklichen Einrichtungen bewusst<br />
waren. Dank des Vortrags unserer Führerin wurde allen der genaue Ablauf und der Umfang des<br />
Holocausts konkret vor Augen geführt. So ging es auch dem Abt Poutrain, der im Nachhinein in<br />
einem Artikel für die Zeitung der Kirchengemeinde betonte, wie er 1967 dank der Erläuterungen<br />
von Mira vor Ort begriff, wie alles in Wirklichkeit verlaufen war, wie Millionen von Juden<br />
umgebracht wurden.<br />
Eine weitere Angabe in Bezug auf unser Konvoi wurde mir später vermittelt, fast durch Zufall,<br />
anlässlich eines Treffens, das Paul Denis für die Warschauer Abteilung der Veteranen organisiert<br />
hatte, kurz vor seinem Rückflug nach Frankreich. Beim Mittagessen saß mir gegenüber ein<br />
Militärarzt, Kolonel in Uniform, der Französisch sprach. Die Unterhaltung ging über die<br />
Lebensbedingungen in Polen, über seinen zweiten Beruf als Leiter einer Privatklinik, über die<br />
demographische Entwicklung in seinem Land, das nach 1945 300 Frauen für nur 1 Männer zählte<br />
(eine fast unumkehrbare Situation)… Plötzlich sagte mir Walter Leitz: «Ende April 1944 habe ich<br />
die Ankunft eures Konvois beobachtet.» Ein wenig beiseite stehend fuhren wir über das Thema<br />
fort, denn für mich war die Aussage eines überlebenden Augenzeuges äußerst wichtig. Er stimmte<br />
mir in allen Punkten zu, wie auch - und noch viel konkreter - in Bezug auf die Erklärungen von<br />
Mira: das Umgehen vom Zaun, um ins Lager zu kommen, wie es für alle zu einem Arbeitslager<br />
deportierten Konvois der Fall gewesen war; danach, am nächsten Tag, das Gerücht aus der<br />
“politischen Abteilung“, laut dessen wir ein Konvoi Franzosen, Nicht-Juden, waren und auf die<br />
Deportation zu einem anderen Lager warteten; später die Information im SS-Büro, laut deren wir -<br />
wie viele seiner polnischen, nicht-jüdischen Kameraden ab 1941 - nach Flossenbürg abgeführt<br />
66
werden sollten. Er hatte auch die Abfahrt aus Birkenau beobachten können und dieses Vorgehen,<br />
obwohl in der Vergangenheit nur selten vorgekommen, hatte ihn nicht gewundert. Niemals hatte<br />
er Indizien über ein außergewöhnliches oder einmaliges Vorgehen bekommen, obwohl er - wie<br />
Pollack und Weilenbach - der “Politische Abteilung“ angehörte und somit letztendlich doch<br />
immer die Geheimnisse der Lagerverwaltung.<br />
Zurück in Frankreich begann ich einen Briefwechsel mit Walter Leitz, der leider kurz danach<br />
abgebrochen wurde, denn ab 1968 erhielt ich keine Antwort mehr auf meine Briefe. Mira schickt<br />
mir jedes Jahr eine Weihnachtskarte. Sie ist berentet, hat ihre Dienstwohnung weiter behalten<br />
können. Ich antworte ihr regelmäßig, aber ich bezweifele, dass sie meine Korrespondenz erhält,<br />
denn, trotz meiner ausdrücklichen Bitte um Antwort, hat sie den Empfang meiner Briefe nie<br />
bestätigt. Aus diesem Grund konnte ich, zu meinem großen Bedauern, nicht das Risiko eingehen,<br />
ihr Pakete zu schicken, und ich hatte niemals das Vergnügen, sie in Frankreich zum Urlaub zu<br />
empfangen, obwohl ich sie dazu eingeladen hatte.<br />
Ab 1967 war es mir also in etwa möglich, den Wahrheitsgehalt der verschiedenen Versionen zu<br />
vergleichen: einerseits die Gerüchte und Geschichten über eine außergewöhnliche Behandlung<br />
und Rettung unseres Konvois, andererseits die Aussagen über eine geplante Weiterleitung zum<br />
Lager Buchenwald aufgrund einer gängigen Entscheidung im Rahmen des normalen<br />
Funktionierens der KZ-Organisation.<br />
Noch einige Jahren gingen vorbei. 1971 nahm ich zum letzten Mal am jährlichen Treffen des<br />
Freundeskreises der überlebenden “Tätowierten“ teil. Zum ersten Mal nahm Herr Brasowitch,<br />
deutlich gealtert, am Treffen Teil, erklärte jedoch sofort, nur als Beobachter gekommen zu sein.<br />
Einige, unter denen Louis Poutrain, nahmen gereizt die Herausforderung an - oder das, was sie als<br />
eine Herausforderung betrachteten - und forderten ihn auf, nun endlich zu erzählen, was er<br />
wusste. Seine Erklärungen waren sehr verwirrt und ich konnte verstehen, dass er, mit einer<br />
wichtigen Aufgabe innerhalb des Widerstands beauftragt, während der Deportation nach<br />
Deutschland jedoch noch in französischem Gebiet, die Gelegenheit genutzt habe, eine Botschaft<br />
aus dem Zug zu werfen. In dieser Mitteilung habe er den patriotischen Finder aufgefordert, seine<br />
Deportation an eine konfidentielle Adresse zu melden. Die Botschaft sei gefunden und übermittelt<br />
worden. Hierauf habe seine britische Organisation - er zitierte Sir Stafford Criffs - einen<br />
Alarmmechanismus ins Rollen gebracht, wodurch letztendlich den Deutschen mit Repressalien<br />
gedroht worden sei, falls das Konvoi des 27. April 1944 aus Compiègne in einem<br />
Vernichtungslager umkäme. Louis Poutrain sprang auf und in einer Wut, zu der ich ihn nie fähig<br />
glaubte, focht er jeden Punkt der Aussage von Brasowitch an, ohne jedoch einen einzigen<br />
Gegenbeweis vorzutragen! Alle Kameraden stimmten der Reaktion von Poutrain zu. Das war nun<br />
wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, um noch mehr Öl aufs Feuer zu gießen und die Verwirrung<br />
zu steigern. Ein weiteres Mal schwieg ich. Mit zusätzlichen Indizien rechnete ich nicht mehr.<br />
Dennoch! 1974 wurde ich wegen einer ganz anderen Angelegenheit von Frau Simon Veil,<br />
Ministerin in der Regierung Giscard d’Estaing, in ihrem Kabinett empfangen. Sie trug ein schickes,<br />
kurzärmliges Sommerjacket, sodass man ihre Auschwitz-Tätowierung sehen konnte. Sie wurde im<br />
Alter von siebzehn Jahren zusammen mit ihrer Mutter und Schwester deportiert. Das Gespräch<br />
nahm eine Wende, als wir unsere Nummern verglichen und sich herausstellte, dass sie genau zehn<br />
Tage vor mir in Birkenau eingetroffen war. Sie verstand und bejahte, ohne jeglichen Vorbehalt,<br />
meine damalige Initiative, nämlich dem SS-Offizier deutlich zu machen, dass wir kein<br />
Judenkonvoi waren. Sie konnte sich auch noch an die ungarischen, jüdischen Frauen, in Transit zu<br />
den Gaskammern, erinnern und meinte, dass dies der Grund und unsere Chance gewesen sein<br />
könnte, dass wir nach Buchenwald abgeführt wurden.<br />
Inzwischen, seit 1972, war der betagte Louis Poutrain in den Ruhestand versetzt und er hatte sein<br />
Drac-Tal verlassen, um bei seiner Schwester im Departement Seine-et-Marne unweit von meinem<br />
Departement Essonne einzuziehen. Wir gestatteten uns gegenseitig mehrere Besuche und<br />
allmählich bekam unsere Freundschaft eine neue Gestalt. Ohne es zu merken waren wir beim Du<br />
und in 1973 war er es, der meinen jüngsten Sohn in meiner Kirchengemeinde zu Saint-Germainlès-Corbeil<br />
taufte. Als wir eines Tages durch den großen Garten seines Schwagers spazierten,<br />
fragte ich Louis, mir endlich und in aller Ruhe zu erzählen, was er selbst über die “Affäre“ wusste.<br />
Er sagte mir, den Deportierten gut zu kennen, einen Landeigentümer aus seiner Heimat und<br />
67
Führer einer wichtigen Widerstandsorganisation. Weil es sich um ein militärisches Geheimnis<br />
handelte, hatte er versprochen, seinen Namen nicht zu nennen und, obwohl es ihm mir gegenüber<br />
leid tat, hielt er sein Versprechen. Wohl bedauerte er die äußerst konservative Einstellung und den<br />
religiösen Integrismus dieses Freundes. Bei unserer Ankunft in Auschwitz erkannte der Besagte<br />
unter den Häftlingen, die mit unserem “Empfang“ beauftragt waren, einen jungen Häftling, den<br />
Sohn eines wichtigen Agenten innerhalb seiner Organisation. “Bist du Soundso? Sohn von<br />
Soundso?“ - “Ja!“ - “Dein Vater schuldet mir Geld.“ (?) Von Sohn Soundso erfuhr er über die<br />
aktive Organisation im Lager. “Gibt es einen Verantwortlichen?“ - “Ja“ - “Dann, bring ihn zu<br />
mir!“. Als er mir die Folge der Geschichte erzählte, schein es für Louis Poutrain gar nicht<br />
erstaunlich, dass später - er wusste mir nicht zu sagen, ob es in den Minuten oder Stunden nach<br />
unserer Ankunft beim Einbrechen der Nacht war - ein SS-Offizier sich bei unserem Mann als<br />
Verantwortlicher der internen Organisation vorstellte und nach weiteren Anleitungen fragte.<br />
“Haben Sie ein Funkgerät?“ - “Jawohl!“ - “Dann funken Sie sofort meinem Agenten X, dass ich<br />
mich hier befinde, zusammen mit Widerstandskämpfern in einem Konvoi aus Compiègne, und<br />
dass man die vorgesehenen Maßnahmen nach Plan durchführen soll!“. Louis Poutrain erzählte<br />
weiter: Das bedeutete, dass sein Freund - Widerstandsmann -, der zusammen mit uns nach<br />
Auschwitz deportiert wurde, so wichtig war, dass der britische “Intelligence Service“, sofort nach<br />
Erhalten der Funkmitteilung, den Deutschen (SD oder Abwehr?) wissen ließ, dass, wenn einem<br />
einzelnen aus dem Konvoi etwas geschehen würde, die und die deutschen, in Großbritannien zum<br />
Tod verurteilten Spione exekutiert würden!<br />
Abt Poutrain träumte bestimmt nicht! Er hatte, mit 25 von einer schweren Rippenfellentzündung<br />
geheilt, während der ganzen Kriegszeit durchgehalten, fast arglos den Tod gestreift und war 1945<br />
wie in einer zweiten Jugend aus den Lagern heimgekehrt. Er glaubte dem Wort eines Mannes aus<br />
seiner Heimat und seinen Kreisen und fand die Geschichte ganz normal, ohne sich Fragen über<br />
deren Glaubwürdigkeit zu stellen. Ich verzichtete auf weitere Fragen, um dem fast achtzigjährigen<br />
heiligen Mann, meinem Freund, kein Leid zuzufügen.<br />
Weshalb glaubten die anderen, fast alle, ein solches Märchen? Es mag sein, dass der Mensch sich<br />
geschmeichelt fühlt, wenn von einer mysteriösen Aura umgeben ist. Ich betrachte die<br />
Angelegenheit als “Résistantialismus“, als “Widerständlerei“, und nicht als geschichtlichen<br />
Widerstand. Man sollte es nicht übertreiben. Welche sind nun, der Reihe nach, die präzisen und<br />
übereinstimmenden Fakten?<br />
Eins steht fest: Auschwitz war die von den Nazis entschiedene Bestimmung unseres Konvois - des<br />
einzigen von damals, Ende April 1944, von Compiègne aus (ich hatte den Namen, zumindest die<br />
letzten Buchstaben W-I-T-Z, auf der Deportationsliste entziffern können). In August 1941 gab es<br />
zwar einen Konvoi mit 1171 “nicht-jüdischen“ Häftlingen von Compiègne nach Auschwitz I,<br />
jedoch war zu der Zeit die Endlösung noch nicht entschieden und Auschwitz II - Birkenau noch<br />
nicht eingerichtet. Dieser Konvoi betraf kommunistische Militanten, die im Herbst 1939 - während<br />
des Sitzkriegs, “la Drôle de Guerre“ - von den französischen Behörden wegen anti-französischer<br />
Aktivitäten verhaftet wurden, danach - nach dem deutschen Angriff auf die UdSSR in Juni 1941 -<br />
von der Besatzungsmacht zusammengebracht und zu den deutschen Lagern deportiert wurden.<br />
Eines Tages, ganz zufällig, bin ich einem von diesen Kommunisten begegnet, als er in einem<br />
Pariser Restaurant am Nebentisch saß; ich habe ihn damals ausführlich befragt und der Fall ist in<br />
den Archiven des Yad Vashem in Jerusalem belegt.<br />
Das Besondere dieser Entscheidung ist aus der Situation im Frühjahr 1944, einige Wochen vor der<br />
Landung am 6. Juli 1944, zu erklären. Zur der Zeit der Besatzung Frankreichs brauchten die Nazis<br />
immer mehr die Mithilfe und Unterstützung der Vichy-Miliz, deren Polizeiaufgaben vollkommen<br />
willkürlich festgelegt wurden, um den Maquisards sowohl in der Stadt als auf dem Land Kontra<br />
bieten zu können. Obwohl gelegentlich unterstützt von den eigenen Truppen, die hauptsächlich<br />
zur Verteidigung gegen die Landung eingesetzt wurden, wäre es den einigen Dutzend ständigen<br />
Gestapo-Agenten ohne diese faschistischen Kollaborateure nie gelungen, die Splittergruppe der<br />
sogenannten “Terroristen“ in Schach zu halten und - noch weniger - auszuschalten. Die<br />
“Terroristen“ wurden nun eben so genannt, weil sie jede Gelegenheit nutzten, diese Dreckskerle<br />
unschädlich zu machen, sodass die Miliz allmählich ausgedünnt wurde. Indem sie auf ihren<br />
Einsatz an der Seite des Feinds und auf die Gefahr, der sie ausgesetzt waren, pochten, forderten<br />
die Milizführer, dass jeder gefasste Widerstandskämpfer, wenn nicht füsiliert, zu den Nazi-<br />
68
Vernichtungslagern deportiert werden sollte, so wie es mit den Juden geschah. Die<br />
Besatzungsmacht stimmte zu und gab deren ausdrücklichen Forderung statt, nämlich den großen<br />
Konvoi des 27. Aprils 1944 selbst überwachen zu können. Dieser unser Konvoi mit insgesamt 1.865<br />
Personen, größtenteils anlässlich der Maquiskämpfen in Februar, März und April 1944 gefasst,<br />
wurde in der Tat nach Auschwitz deportiert. Das erklärt jedoch noch nicht unsere darauffolgende<br />
Deportation nach Buchenwald. In der Folge werde ich den eigentlichen Grund dieses<br />
Weiterleitens genauer erklären, denn er steht in direktem Zusammenhang mit den Beziehungen<br />
zwischen Gestapo und Miliz.<br />
Laut des verbreiteten Gerüchts sollten wir den Gaskammern von Birkenau dank der Intervention<br />
einer außergewöhnlichen Widerstandsorganisation innerhalb des Lagers entkommen sein. Einer<br />
von uns sollte, unmittelbar nach dem Eintreffen in Birkenau, vom Bestehen dieser Organisation<br />
erfahren haben.<br />
Auf der einen Seite gibt es die Erklärung, mit dem Segen des Louis Poutrains, laut deren ein<br />
unbekannter Führer der Résistance die Rettung aus Birkenau bewirkt hätte, und auf der anderen<br />
Seite die Geschichte mit dem Funkbericht nach London, wie sie von Brasowitch erzählt wurde. Die<br />
zwei Erklärungen sind nicht übereinstimmend, sogar widersprüchlich, und heben sich gegenseitig<br />
auf. Sie sind unbefriedigend, da sie nur auf einem abstrakten und oberflächlichen Gedankengang<br />
basiert. Es bedarf einer näheren Betrachtung.<br />
Nehmen wir an, dass es tatsächlich eine mit Funkgerät ausgestattete, von einem britischen<br />
Agenten und gleichzeitig SS-Offizier infiltrierte Organisation gegeben hat. In dieser Annahme ist<br />
davon auszugehen, dass der SS-Offizier, der uns an dem besagten Morgen bei den Baracken<br />
aufsuchte und sich um unsere Versorgung während der Reise Sorgen zu machen schien, infolge<br />
der Reaktion des “Intelligence Service“ bereits den Befehl aus Berlin erhalten hatte, bis auf nähere<br />
Instruktionen und Befehle unseren Konvoi schonend zu behandeln. Dies erscheint mir einfach<br />
unmöglich, denn in dem Fall müsste der Kreis - vom Senden des Berichts, möglicherweise über<br />
mehrere Stationen, mit Rückmeldung der britischen Drohung an die KZ-Zentrale in Berlin bis zum<br />
Empfang der Befehle und deren Durchführung - in einer Nacht, vom Abend des 31 April bis zum<br />
frühen Morgen des 1. Mai, rundgegangen sein! Dies wäre absurd und würde implizieren, dass die<br />
britische Regierung - über eine klandestine Organisation vor Ort verfügend -, es zynisch geduldet<br />
hätte, das Juden massenhaft umgebracht wurden. Eine solche Enthüllung im Rahmen des<br />
Holocausts würde eine ungeheuerliche Reaktion auslösen.<br />
Der einzige Grund, weshalb dieser SS-Offizier - laut Kurt Weilenbach der Lagerkommandant -<br />
sich Mühe gab, sich über unsere Haftbedingungen zu informieren, kann nur auf einen<br />
Gegenbefehl aus Berlin zurückzuführen sein, nämlich dass der Konvoi aus Compiègne nach<br />
Auschwitz zu einem anderen, “normalen“ Lager weitergeführt werden sollte. Vielleicht hatte er<br />
diesen Befehl bereits erhalten, als wir uns noch im Zug auf der viertägigen Reise nach Auschwitz<br />
befanden. Ich frage mich, ob der merkwürdige, fast zwei Stunden dauernde Aufenthalt in Apolda,<br />
in der Nähe von Buchenwald und auf der halben Strecke nach Birkenau, sowie das Lüften einiger<br />
Waggons sich nicht durch einen Befehl an den “Sonderführer“, den Zug anzuhalten und<br />
telefonisch für weitere Befehle - Buchenwald oder Auschwitz - mit Berlin Kontakt aufzunehmen,<br />
erklären lässt. Vielleicht war der Befehl in Buchenwald noch nicht eingetroffen, vielleicht hatte<br />
Buchenwald derzeit nicht die “Möglichkeit“ unseren Konvoi, immerhin weit über tausend<br />
Häftlinge, in “Empfang“ zu nehmen. Demzufolge wäre es möglich, dass dem Offizier mit dem<br />
Stiernacken der Befehl, unseren Konvoi nach Birkenau weiterzuleiten, erteilt wurde.<br />
Vielleicht traf der Befehl erst später ein, nämlich am Tag unserer Ankunft oder anderntags in aller<br />
Frühe, sodass der besagte SS-Offizier sich vor Ort über unsere Identität vergewissern wollte. Und<br />
dennoch. Der Lagerkommandant, erstaunt von der Meldung des Scharführers über einen<br />
Deportierten, der behauptete, in seinem “Transport“ (administrative Bezeichnung für Konvoi<br />
innerhalb der Lager) sei kein einziger Jude, hätte vielleicht selbst die Initiative ergriffen, Berlin<br />
anzurufen, um genauere Angaben über den Konvoi und dessen “Behandlung“ zu erfahren. Bis auf<br />
weiteren Befehl wäre also nichts unternommen worden.<br />
Unabhängig vom Zeitpunkt, an dem der Gegenbefehl eintraf, bleibt jedoch die wesentliche Frage,<br />
aus welchem Grund ein Kurswechsel stattfand und unser Konvoi vom Schlimmsten verschont<br />
69
lieb. Ein Hypothese wäre, dass die deutsche Polizei in Paris die Wut der Vichy-Miliz dämpfen<br />
wollten und ihr versicherte, unser Konvoi wurde nach Auschwitz deportiert. Wie bereits erwähnt<br />
hatte die deutsche Polizei eine andere Vorstellung von der Kollaboration als die Vichy-Miliz. Das<br />
Konzept der Nazis umfasste Folgendes:<br />
a) Nach einer ersten Periode der Aufteilung in besetzte und freie Zone, vom Sommer 1940 bis<br />
November 1942, das besiegte Frankreich in seiner Gesamtheit unterwerfen, dessen gewaltige<br />
Ressourcen ausbeuten und das Vichy-System zum Weiterführen des Kriegs nutzen;<br />
b) Die Vichy-Miliz in den Kampf gegen den Widerstand einsetzen.<br />
Seit dem Sommer 1943 hatte sich die Résistance allmählich ausgebreitet, am Anfang noch sehr<br />
bescheiden, dann - als die Landung der Alliierten vorauszusehen war - immer stärker. Die Nazis<br />
brauchten die Hilfe der faschistischen Fraktionen Frankreichs im Kampf gegen jegliche Form der<br />
Résistance und sie besorgten der Miliz die Rüstung und die Waffen dazu. Dabei ließen sie die<br />
französischen Faschisten in dem Glauben, dass nach dem Endsieg in Frankreich ein faschistischer<br />
Staat, mit der Miliz in den Führungspositionen, errichtet werden sollte. Im Grunde empfanden die<br />
Deutschen nur Verachtung sowohl vor deren Naivität als auch vor der Kollaboration, die sie der<br />
Besatzungsmacht leisteten. Mit anderen Worten, sie betrachteten die Miliz als eine Clique von<br />
Vaterlandsverräter. Bei einigen Gelegenheiten konnte ich aus den Gesprächen heraus hören, dass<br />
sie mehr Respekt für die verhafteten Widerstandskämpfer als für die Überläufer, mit Laval an der<br />
Spitze, aufbrachten.<br />
Es ist also vorstellbar, dass die Nazis, von der Vichy-Miliz gedrängt, vorerst ihren Forderungen<br />
entgegenkamen und als Bestimmung auf den Listen “Auschwitz“ angaben; einmal die Wünsche<br />
der Miliz befriedigt, wurde das Ziel unseres Konvois schnellstens korrigiert, um uns zu einem<br />
“normalen“ Konzentrationslager weiterzuleiten. Das wäre also eine Erklärung für die Tatsache,<br />
dass die Deportierten des Konvois vom 27. April 1944 in Auschwitz mit Nummern tätowiert<br />
wurden, elf Tage dort “im Auge des Zyklons“ blieben und dann nach Buchenwald, später nach<br />
Flossenbürg weitergeleitet wurden. Diese Version bedarf keiner Geschichte-mit-Fortsetzung, um<br />
ein Rätsel zu erklären, dass letztendlich keins ist. Ich gebe ehrlich und offen zu, dass ich eine Zeit,<br />
zumindest bis meinem Besuch bei Louis Poutrain in den Alpen in 1949, geglaubt habe, dass mein<br />
damaliger Wortwechsel mit dem Scharführer am frühen Morgen nach unserer Ankunft in<br />
Auschwitz hätte die SS-Behörde auf einen Fehler in der Routenplanung aufmerksam gemacht und<br />
dass ich dazu beigetragen hätte, dass unser Konvoi vom Schlimmsten verschont blieb. Ein<br />
ziemlich einseitiger Gedankengang. Jedoch bin ich seit langem der Überzeugung, dass keiner von<br />
uns, weder ich noch die anderen, die Weiterleitung des Konvois bewirkt hat und uns so vor dem<br />
Tod gerettet hat. Es waren die Deutschen, die uns zurück in den Westen brachten, nach<br />
Buchenwald, wie der SS-Offizier es von mir bei der Abfahrt des Konvois am 11. Mai 1944 den<br />
anderen mitteilen ließ.<br />
Der Transfer nach Buchenwald dauerte vom Nachmittag des ersten Tages bis zum Morgen des<br />
dritten. Alle unsere Männer, mit Ausnahme von zwei oder drei Juden, die nach Identifikation im<br />
Lager zurückblieben, sowie etwa dreißig Kameraden (ich glaube, 29 gezählt zu haben), von denen<br />
einige später zum Lager Monowitz, Auschwitz III, gebracht wurden, waren dabei. Die<br />
Überlebenden des Lagers Monowitz sollten 1945 eine schreckliche Evakuierung erleben. Bis in die<br />
achtziger Jahre kamen fünf von den Überlebenden regelmäßig zu unseren jährlichen Treffen.<br />
Wir waren nicht mehr hundert, sondern nur fünfzig in einem Waggon. Wir hatten Platz, um uns<br />
zu setzen, sogar hinzulegen. Die offenen Waggontüren ließen frische Luft herein. In jedem<br />
Waggon hielten zwei Soldaten Wache, immer einer von beiden ein SS. Es gab Säcke mit Brot, zwar<br />
verschimmelt, aber immerhin. Zusammen mit dem warmen Getränk in den Kesseln erschien es<br />
uns wie das Paradies, verglichen mit den Bedingungen auf der Fahrt von Compiègne nach<br />
Auschwitz, wohl abgesehen von einigen Fußtritten, die den Wächtern zum Reflex geworden<br />
waren und reichlich ausgeteilt wurden. Von meinen Gefährten, seit der Verhaftung und<br />
Internierung, war keiner an meiner Seite. Ich kannte niemanden in meinem Waggon. Nur einen<br />
der Mitreisenden, Gustav Hilke, lernte ich näher kennen.<br />
Eine Reise ohne besondere Ereignisse, wenn nicht der Zwischenfall während der Halte in<br />
Dresden am Morgen des 12. Mai gewesen wäre. Die kurvenreiche Eisenbahnstrecke verlief über<br />
zwei Elbebrücken und gab uns einen Gesamtblick auf die wunderschöne Stadt, Prunkstück des<br />
Deutschen Reichs, frei. Der Zug hielt im Hauptbahnhof an. Zu der Zeit, im Frühjahr 1944 war<br />
70
Dresden noch intakt, denn erst Mitte Februar 1945, innerhalb von drei Tagen, wurde die Altstadt<br />
unter dem Luftangriff der Alliierten fast völlig vernichtet. Im Hauptbahnhof herrschte eine<br />
außergewöhnliche Aktivität. Zahlreiche Militäreinheiten füllten die Bahnsteige. Auf zahlreichen<br />
Zügen wartete Kriegsmaterial auf weiteren Transport. Die strategische Wichtigkeit der Stadt als<br />
Stützpunkt für die gesamte Ostfront stand außer Zweifel und dies rechtfertigte den<br />
systematischen Luftangriff, über den wir während unserer Haft erfuhren. Was uns noch mehr<br />
auffiel und schockierte, war das skandalöse Verhalten vieler weiblichen Hilfskräfte. In makellosem<br />
Weiß gekleidet, blonde Zöpfe auf dem Rücken, blaue Augen, eilfertig und dienstbeflissen reichten<br />
sie unseren Wachposten Kaffee und Suppe durch die offenen Waggontüren. Beim Anblick von<br />
den zusammengehäuften, erschöpften, abgezehrten, geschorenen und in Lumpen gekleideten<br />
Kameraden war ihnen keinerlei Mitleid oder Verzweiflung anzusehen. Sie blieben ungerührt als<br />
ob sie uns nicht gesehen hätten, als ob wir einfach nicht da gewesen wären. Offensichtlich waren<br />
es Mädels von gutem Dresdener Hause, die sich längst an das Elend der Häftlinge gewöhnt<br />
hatten.<br />
Ich habe überhaupt keinen Groll mehr gegen die deutsche Jugend von 1939, denn ich bin davon<br />
überzeugt, dass die Jugend von 1990 anders ist. Jedoch muss ich zugeben, dass der Übergang von<br />
einer Periode des tiefen Rachegefühls während der ersten zehn Nachkriegsjahren bis zur völligen<br />
Versöhnung heute nicht einfach war, obwohl ich mich hartnäckig bemüht habe. Der Kalte Krieg<br />
hat stark dazu beigetragen, dass sich die Annäherung zwischen beiden Völkern um drei<br />
Generationen verzögerte.<br />
Die erste Generation, heute weit über achtzig, hat sich in Massen für die Vorherrschaft der<br />
überlegenen germanischen Rasse begeistert, nachdem einige Tausenden ihrer Gegner in den für<br />
diesen Zweck eingerichteten Konzentrationslager beseitigt wurden. Paradoxerweise war dies nicht<br />
so schwer zu verarbeiten, denn gegebenenfalls konnte man ihnen klipp und klar die Vorwürfe ins<br />
Gesicht sagen. Bis Anfang der siebziger Jahre hatte diese Generation führenden Positionen sowohl<br />
in West- als auch in Ost-Deutschland inne. Ein Dialog mit diesen Leuten hatte keinen Sinn. Auch<br />
wenn ich hier etwas abschweife - ich bitte um Verzeihung -, möchte ich hier ein vielsagendes<br />
Beispiel erwähnen:<br />
Im September 1972 wohnte ich der Münchener Olympiade bei: 110 m Hürdenlauf. Neben mir saß<br />
ein korrekt aussehender Herr, etwa fünfzehn Jahre älter als ich, ausgestattet mit Fernglas,<br />
Programm- und Notizheft. Höflich, aber kühl, äußerte er mir zwischendurch seine Bemerkungen,<br />
auf Deutsch selbstverständlich. Ich stellte mir vor, der Mann hätte Offizier bei der Wehrmacht sein<br />
können. Das Rennen ging los. Von unserem Platz aus war schwer festzustellen, ob nun Millurn<br />
oder Guy Drut als erster über die Ziellinie kam und die Goldmedaille umhängen würde. Ich stand<br />
auf, um das Ergebnis auf dem elektronischen Bildschirm lesen zu können, sah, dass Drut zweiter<br />
wurde, und setzte mich wieder, alles im Schweigen. Mein Nachbar, in der Meinung, ich wäre einer<br />
seiner Landesgenossen, musste es angeblich los werden: “Das ist doch allerhand, dass die<br />
Franzosen hier eine Silbermedaille erhalten!“. Worauf ich ihm erwiderte, dass es mich überhaupt<br />
nicht wunderte, weil ich den Fortschritt dieses Athleten bei mir, in Paris, seit mehreren Jahren<br />
verfolgte. Sein Gesicht wechselte die Farbe. Ich ließ ihm seine Verwirrung.<br />
Der zweiten Generation, seltsamerweise, fiel die Annäherung schwerer. Es war die Generation,<br />
kurz vor 1939 geboren, die ab 1945 zur Grundschule gingen. Die Weltgeschichte wurde vom<br />
Kalten Krieg überschattet. Die Konfrontation zwischen Osten und Westen prägte durch<br />
systematisches Kaschieren der geschichtlichen Fakten den Geschichtsunterricht an den deutschen<br />
Primar- und Sekundarschulen. Ich könnte eine Reihe Gespräche mit jungen Lehrern und<br />
Lehrerinnen in den sechziger Jahren aufzählen, um ein Bild von deren politischen und<br />
geschichtlichen Ansichten zu vermitteln: der Versailler Vertrag von 1919/20 sei eine<br />
himmelschreiende Ungerechtigkeit, die Ideen Hitlers seien letztendlich berechtigt und - mit Bezug<br />
auf Frankreich - die Vichy-Regierung sei die rechtmäßige und der Widerstand eine terroristische<br />
Subversion. Zum verzweifeln.<br />
Dreißig Jahre nach dem Krieg gab es wie eine Beschleunigung in der Aufklärung der nach 1950<br />
geborenen Jugend. In der Folge werde ich über den ersten Brief, den ich 1974 von einem jungen,<br />
vierundzwanzigjährigen Journalisten - mittlerweile hervorragendem Redakteur der<br />
Kulturabteilung des Bayerischen Rundfunks BR3 - erhielt. Er schrieb mir, wie er während seiner<br />
Ausbildung und am Anfang seiner Karriere merkte, dass bestimmte Themen umgangen und<br />
71
geschichtliche Aspekte verschwiegen wurden. Dieser Mann und sein Vorgehen sind ein Beispiel<br />
von der Dritten Generation, die ein neues Licht auf die Zeit ihrer Großeltern warf.<br />
Als in den sechziger Jahren der Kalte Krieg die Annäherung zwischen Ost- und West-Europa<br />
erschwerte, griff die französische Presse das Thema Dresden auf und bedauerte das tragische Los<br />
der 150 000 Einwohner, die 1945 während der unnötigen Luftangriffe umkamen. Die Presse<br />
vernachlässigte jedoch zu erwähnen, dass im Februar 1945, mehr noch als im Mai 1944, Dresden<br />
der wichtigste strategische Punkt in der Verteidigung gegen die allgemeine sowjetische Offensive<br />
von Januar 1945 war. Der deutsche Überfall im Juni 1941, Operation Barbarossa, und die<br />
darauffolgende Offensive hatten der Sowjetarmee einen schrecklichen Aderlass zugefügt. Das<br />
Ausschalten dieses strategischen Knotenpunkts der deutschen Verteidigung, wozu die<br />
systematische Bombardierung der Stadt Dresden erforderlich war, ersparte den aufrückenden<br />
sowjetischen Truppen erhebliche weitere Verluste. Die rührenden Presseartikel über die angeblich<br />
unschuldige Bevölkerung führten mir - ohne Groll, ohne Aufregung - das Bild der schönen, jungen<br />
aber herzlosen Frauen im Dresdener Bahnhof vor Auge.<br />
Weiter. Bei klarem Wetter konnten wir die Landschaft betrachten. Ich glaube nicht, dass unsere<br />
Wachposten abgelöst wurden. Ich - und auch Hilke - erinnere mich nur, dass ein SS-Soldat, ohne<br />
Grund, einem Kameraden einen Holzschuh ins Gesicht warf. Er blutete stark. Als der SS-Mann<br />
dies merkte, ging er auf ihn zu und bot ihm seine Trinkflasche an. Ein typisches Beispiel für die<br />
SS-Basis.<br />
Während des ganzen zweiten Tages fuhr der Zug weiter in den Westen und am Morgen des 14.<br />
Mai machte er beim Lager Buchenwald halt. Durch den Torbogen mit den großen Buchstaben<br />
“Arbeit macht frei“ kamen wir in das Lager. Viele Häftlinge schauten uns durch die Gitter der<br />
Quarantäneabteilung fragend zu. Ich rief «Auschwitz», so dass sie wussten, woher wir kamen,<br />
und dann sofort «Université Strasbourg» . Es war ja mehr als wahrscheinlich, dass ein Teil unserer<br />
Kameraden mit den drei Konvois ab Januar 1944 hierhin deportiert wurde. Die Einrichtungen in<br />
Buchenwald waren ganz anders als in Birkenau. Nicht umsonst sollte Kirrmann seinen späteren<br />
Beitrag über unsere Deportation mit dem Titel “Buchenwald, die große Stadt“ versehen. Die<br />
gemauerten Desinfektions- und Kleiderräume, einzeln nummeriert, waren nach industrieller Art<br />
geordnet und organisiert. Wir wurden in einen Duschraum geführt und mussten unsere<br />
Auschwitz-Lumpen ausziehen. Der Raum war technisch ausgestattet, um Massendesinfektionen<br />
vorzunehmen. Einmal aus den Kleidern wurden wir, der eine nach dem anderen, unter Zwang -<br />
ohne Rücksicht auf offene Wunden und mit der einzigen Anweisung, die Augen zu schließen - in<br />
eine mit Kreosot gefüllte Badewanne untergetaucht. Jedes Ein- und Untertauchen dauerte knapp<br />
zwei Sekunden und nach gut einer Stunde waren mehr als 700 von uns auf diese Weise behandelt.<br />
Danach wurden wir mit kräftigen Strahlen aus Duschbrausen auf langen Wasserschläuchen vom<br />
Kreosot gereinigt. Anschließend erfolgte eine Läusebehandlung durch Pulverisation eines<br />
Insektizids auf die behaarten Körperteile. Ohne dass wir die Gelegenheit bekamen, uns mit<br />
irgendwelchen Lappen trocknen zu können, gelangen wir in den Kleiderraum. Unter Aufsicht<br />
eines einzigen SS-Soldaten warfen die für die Kleiderverteilung zuständigen Häftlinge uns aufs<br />
Geratewohl die Klamotten zu. Beim wachhabenden SS fragte ich nach einer etwas längeren Hose<br />
als die mir zugeteilte: «Herr Unteroffizier, die Hose ist mir zu kurz.» Mit einem Nicken stimmte er<br />
zu. Bevor wir den Raum verließen, machten wir vor einem Schalter halt. Ein Häftling<br />
norwegischer Herkunft überreichte jedem, nach Abhaken auf der Namensliste des Konvois, die<br />
beiden Segeltuchstreifen mit unserer neuen Nummer, die wir rechts auf die Hose und links auf<br />
den Jackenzipfel aufnähen sollten. Wir wurden zu den Quarantäneblocks 51 und 52 geführt.<br />
Das ganze Verfahren hatte etwa drei Stunden gedauert und durch den Tumult war das Wenige an<br />
Erholung, das wir während der Zugfahrt hatten genießen können, aufgebraucht. Angekommen<br />
beim Eingang der Quarantäneblocks waren wir alle wieder erschöpft. Als erster unserer Gruppe<br />
betrat ich den Raum. Hier musste sich jeder unter seiner neuen Nummer melden, aber die meisten,<br />
durch die Erschöpfung abgestumpft, krempelten den Jackenärmel hoch und glaubten die in<br />
Auschwitz tätowierte Nummer angeben zu müssen. Ich erkannte zwei Gesichter von der<br />
Straßburger Universität: Boris Ungebaun und Georges Straka, die bereits im Januar 1944 nach<br />
Buchenwald deportiert wurden. Ungebaun und zwei andere setzten sich an einen Tisch. Sie<br />
gehörten zum Kommando “Politische Abteilung“ des Lagers. Straka befahl mir, mich zu ihnen zu<br />
setzen und bei der Arbeit zu helfen. Er wollte mich sofort als Mitarbeiter dieses Kommandos<br />
72
eintragen. Der erste Kontakt mit dem “Blockältesten“ und seinem “Schreiber“ war entscheidend.<br />
Beide waren politische Häftlinge, alte Hasen der deutschen Kommunistischen Partei von vor 1933,<br />
und hatten bereits eine jahrelange Erfahrung des Lagerlebens. Sie waren sofort einverstanden, mir<br />
ihre Eintragungsarbeiten zu überlassen: Eintragen des Namen und der neuen Nummer ins<br />
Blockregister, gleichzeitig Verteilen der Gerstensuppe und Zuweisen der Schlafplätze auf den<br />
Strohsäcken der Etagenbetten, im hinteren Teil der Baracke angefangen, sodass jeder sich<br />
ausruhen konnte. Die größte Mühe hatten wir beim Eintragen der neuen Nummer, denn fast alle<br />
krempelten den Ärmel hoch und wollten die Auschwitz-Tätowierung zeigen, wie es in Birkenau<br />
zum Reflex geworden war. In Buchenwald galt eine neue Nummer, die auf den Jackenzipfel und<br />
auf die Hose genäht wurde. Die Schreibformalitäten waren ähnlich wie die, die ich 2 Wochen<br />
vorher zusammen mit Kurt in Auschwitz erledigt hatte. Die Arbeit wurde unterbrochen. Am<br />
nächsten Tag sollte es mit den Eintragungen weitergehen. Am ersten Abend bekam jeder, der zur<br />
Kontrolle in den Block hineintrat, einen Essnapf mit einer dicken Suppe aus einem großen Fass.<br />
Nach dem Essen und der Kontrolle, ging es zum Nachtlager. Selbst hatte ich etwa drei<br />
Überstunden geschafft, damit alles so schnell wie möglich erledigt wurde und alle endlich<br />
schlafen konnten. Als es dann so weit war und ich mich erschöpft hinsetzte, sagte der “Schreiber“:<br />
«Du warst uns eine große Hilfe. Jetzt sollst du etwas essen. In dem Gefäß sind noch etwa sechs<br />
Liter Suppe. Du kannst alles essen.». Ich glaube, fast die Hälfte gegessen zu haben, und<br />
glücklicherweise konnte auch ich mich hinlegen, um die Menge zu verdauen. Ich war ziemlich<br />
bestürzt und, bevor ich in einen tiefen Schlaf versank, erschien mir noch das Bild unserer zwei an<br />
einer Lungenentzündung erkrankten Kameraden, die wir zur Krankenpflegestation bringen<br />
hatten müssen. Der eine war Domherr Tanguy, Schuldirektor in Pont-Aven. Anlässlich des<br />
Namensfestes der Jeanne d’Arc hatte er uns in der Kapelle zu Compiègne eine aufmunternde<br />
Predigt gehalten. Der andere, Serge Carrière, mein kleiner Kamerad aus dem Block in Compiègne,<br />
war Sohn eines Schullehrers im Departement Tarn, der bereits 1943 in einen der ersten Maquis<br />
Frankreichs untergetaucht war. Der eiskalte Schlamm von Auschwitz hatte den zweiundsechzig-<br />
und den zwanzigjährigen sehr geschwächt. Tanguy verstarb anderntags auf der Krankenstation.<br />
Als ich davon erfuhr, bat ich den Kameraden im Block 51 um eine Minute der Stille zur Ehre und<br />
zur Seelenruhe unseres Kameraden. Nach den dreißig Sekunden völliger Stille fragte der<br />
“Blockschreiber“ sehr beeindruckt, wer dieser Verstorbene denn wohl war. Spontan sagte ich ihm<br />
die Wahrheit, nämlich dass Tanguy ein bekannter und sehr geschätzter Priester war. Das war<br />
spontan, aber unvorsichtig: der Antiklerikalismus der Kommunisten seiner Generation hatte auch<br />
ihn geprägt und er zeigte es mit einer Reaktion der Ablehnung. Glücklicherweise blieb es dabei.<br />
Die Nachricht unserer Ankunft war schnell rundgegangen. Nach dem täglichen Morgenappell, als<br />
ich aus meinem Verdauungsschlaf aufwachte, standen alle Häftlinge der Straßburger Universität<br />
auf der anderen Seite der Stacheldrahtabsperrung, die die Quarantäneblocks vom Rest des Lagers<br />
abtrennte. Ein wenig abseits der anderen fasste einer der Häftlinge den Stacheldraht mit beiden<br />
Händen, als ob er ein Zeichen geben wollte. Den ersten, den ich wiedererkannte, hatte ich seit Juni<br />
1943, seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen: André Royer. Der Blickkontakt war ergreifend und<br />
der Seufzer, der sich uns gleichzeitig entrang, äußerte unsere Verzweiflung besser als irgendein<br />
Wortwechsel, der uns in dem Augenblick unmöglich war. Nach etlichen Sekunden, die uns eine<br />
Ewigkeit schienen, kamen uns die Worte wieder. Ich sagte ihm, dass auch Georges Peter aus<br />
seinem Konvoi des 30. Oktober 1943 geflohen und zurück in die Auvergne geflüchtet war, dass<br />
sich unsere Widerstandsgruppe nach der Verhaftung des Bezirksleiters am 1. Oktober aufgelöst<br />
hatte. Er erzählte mir, dass er zusammen mit Thill aus dem gleichen Zug gesprungen war, jedoch<br />
erst hinter der Grenze, im Departement Moselle. Barfuß, in Unterhose waren sie zwei Tage durch<br />
die Gegend gezogen. Sie hatten die feindseligen Dörfer umgehen müssen, aus denen die<br />
Moselaner 1940 vertrieben wurden und die nun von Bessarabien-Deutschen besiedelt waren. Total<br />
erschöpft hatten sie sich dann entschieden, nachts in die Stadt Metz einzudringen, wo Thill eine<br />
Tante aufsuchen wollte. In Metz waren sie von einer Patrouille verhaftet und zum Verhör ins<br />
“Polizeigefängnis“ der Gestapo - das ich selbst im September 1942 kennengelernt hatte -<br />
eingesperrt worden. Sie hatten die Wahrheit nicht lang verschweigen können und zugeben<br />
müssen, aus einem Deportationskonvoi geflohen zu sein, und hatten ihre wahre Identität<br />
preisgegeben. Die Akte wurde der Gestapo in Berlin zum Entscheid übermittelt. Es hatte Wochen<br />
gedauert. Royer war in eine Doppelfalle geraten. Der Sicherheitsdienst hatte ausfindig gemacht,<br />
dass sein Vater Bahnhofsvorsteher in Saargemünd war. Seine Eltern hatten ihn besuchen und ihm<br />
Pakete zuschicken dürfen. Selbst hatte er keinen Fluchtversuch mehr gewagt, denn das hätte zu<br />
Repressalien gegen seine Eltern führen können. In Thills Fall hatte die Gestapo keine<br />
73
Familienverbindungen aufdecken können und Thill hatte nicht aufgegeben. (Ich kenne die<br />
damaligen Bedingungen vor Ort: Ausbrechen ist zwar schwer, kann aber mit Hilfe von draußen<br />
gelingen.) Thill war noch während der Ermittlungen geflohen. Er wurde nie gefasst. Erst nach<br />
dem Krieg sollte ich in Straßburg mit ihm reden können. André war einzeln, unter Eskorte, nach<br />
Buchenwald deportiert worden und dort hatte er den weißen Kreis, Zeichen eines vorherigen<br />
Fluchtversuchs, auf die Häftlingsjacke genäht bekommen. So sah ich ihn am 14. Mai 1944 in<br />
Buchenwald wieder. Sein Zustand war sehr befriedigend: er war geschickt, sprach auch Deutsch<br />
und so war es ihm gelungen, nützliche Kontakte mit den “Politischen“ des Lagers zu knüpfen.<br />
Einige von diesen deutschen Politischen waren verantwortlich für die Betreuung der Häftlinge im<br />
Lager und in den Fabriken. Er hatte eine gute Arbeit und gleichzeitig Zugang zu den<br />
“Informationen“. Außerdem empfing er, zwar in begrenzter Menge, Pakete mit Lebensmitteln und<br />
Unterwäsche, was seine Lebensqualität erheblich steigerte. In wenigen Minuten erzählte er mir<br />
das alles. Er rechnete sogar damit, sein weißes Abzeichen des wiedergefassten Ausbrechers bald<br />
ablegen zu können. - Manchmal gelang es einer supergeheimen Organisation innerhalb des<br />
Lagers, die Identität eines Verstorbenen aus der Krankenstation auf einen anderen Häftling zu<br />
übertragen. - Ich konnte ihm nur empfehlen, wenn möglich, die Identität zu wechseln, denn<br />
regelmäßig kam aus Berlin der Befehl, Meuterer und Ausbrecher zu liquidieren.<br />
Das Stimmengewirr beim Stacheldrahtzaun wurde lauter. Etwa dreißig Kameraden hatten sich an<br />
einer Stelle des Zauns angesammelt und hörten jemandem auf der anderen Seite zu. Zwischen den<br />
Köpfen durch sah ich Albert Kirrmann. Er hatte mich bereits bemerkt, als ich mit André Royer<br />
sprach. Statt sofort zu uns zu kommen, hatte er einfach, aber glänzend - das war eins seiner<br />
Talente - vorerst mal angefangen, die Stimmung seiner Zuhörer zu heben. «Um durchhalten zu<br />
können - wie seine Straßburger Gruppe es in den vier Monaten geschafft hatte - sollte man<br />
keinesfalls den Ereignissen vorgreifen, um nicht eine schwere, demoralisierende Enttäuschung<br />
erleben zu müssen. Die Landung der Alliierten wird uns jeden Tag offiziell gemeldet, jedoch<br />
werden alle Meldungen in der darauffolgenden Woche bestätigt oder dementiert. Demzufolge<br />
richten wir uns nach den Mitteilungen der Wehrmacht, der einzigen zuverlässigen Quelle.»<br />
Anschließend konnte ich mit Kirrmann sprechen. Er erstattete mir einen fast vollständigen Bericht<br />
über fast alle Deportierten des 4. Januars, vom Gefängnis “92“ zu Clermont über Compiègne bis<br />
Buchenwald. In der Tat wurden letztendlich alle am 25. Januar von Compiègne nach Buchenwald<br />
gebracht. Drei konnten sich davon machen: Ebel, Flesch und Imly. Viele wurden zu den<br />
verschiedenen Kommandos geschickt: Sadron zu Dora, Armand Utz und Tixier zu Flossenbürg.<br />
Unbegaun, Straka und Yvon waren in Buchenwald geblieben. In dem Augenblick fasste mich<br />
jemand am Arm und, als ich mich umdrehte, erkannte ich das Lächeln von Straka. Über Straka<br />
habe ich noch nicht ausgeweitet. Er war Lektor für Tschechisch an der Straßburger Universität<br />
und dank seiner Kenntnisse aller europäischen Sprachen war er in die “Politische Abteilung“, d. h.<br />
in die Bürokratie des Lagers aufgenommen worden. Die Politische Abteilung wurde von den alten<br />
deutschen politischen Häftlingen kontrolliert. Auch Unbegaun, Spezialist der slawischen Sprachen<br />
und Kultur, war mit dabei. Als guter Bekannter des Blockführers und des Schreibers, hatte Straka<br />
Zugang zum Quarantänelager, nicht nur um mit mir zu reden, sondern auch um Blockführer und<br />
Schreiber deutlich zu machen, dass wir Freunde waren.<br />
Im Lauf der Unterhaltung mit Straka, fragte ich ihn, ob er etwas unternehmen konnte, damit ich<br />
in der Schreibabteilung bleiben könnte. Er nickte mir zu. Anderntags suchte er mich auf und bat<br />
mich, ihm zu seiner Mannschaft, die gerade im Quarantäneblock eingetroffen war, zu folgen. Es<br />
sollte eine individuelle Kartei für jeden Neugekommenen angelegt werden, genau so wie ich es<br />
bereits in Birkenau mit Kurt Weilenbach gemacht hatte. Ein peinlich genauer und gleichzeitig<br />
grotesker Vorgang. Dieses Mal saß nicht Kurt, sondern - Überraschung! - Unbegaun an meiner<br />
Seite am Schreibtisch. Unbegaun, ehemaliger Kolonel der zaristischen Artillerie, war im Gefängnis<br />
zu Clermont aufgefallen, als er Geissler erwiderte, seine politische Aktivität äußere sich in den<br />
Verletzungen aus dem Kampf gegen den aufkommenden Bolschewismus. Im Kasernengefängnis<br />
hatte Unbegaun uns erzählt, dass er beim Kornilov-Putsch den Befehl über die Kornilov-Artillerie<br />
geführt und Onakropetrovsk erobert hatte. Vermutlich hatte er zahlreiche Beziehungen zu den<br />
Prominenten unter den emigrierten Weißrussen verschiedener politischen Richtungen. Nur dies<br />
kann seine Entlassung aus Buchenwald, einige Monate später, erklären. Ich sollte ihn 1945/46 in<br />
Straßburg wiedersehen.<br />
74
Den ganzen Tag und den darauffolgenden war ich mit den Schreibarbeiten im Block 51<br />
beschäftigt. Ich rechnete fest mit meiner Eingliederung in die “Arbeitsstatistik“, deren Kern<br />
ebenfalls aus überlebenden Kommunisten aufgebaut war, und wartete auf die Bestätigung seitens<br />
Straka. Einer der ersten, der sich am Anfang des Nachmittags zur Eintragung präsentierte, war<br />
Brasowitch. Sofort stellte ich ihn Unbegaun vor und betonte, dass er sich in Auschwitz eingesetzt<br />
hatte, um uns zu helfen. Die beiden Männer begannen ein Gespräch in slawischer Sprache, dass<br />
die restliche Zeit der Formalitäten dauern sollte. Es wurde mir klar, dass Brasowitch das erste<br />
Glied einer Kontaktenkette gefunden hatte, die es ihm ermöglichen sollte, in Buchenwald zu<br />
bleiben.<br />
Während dieser zwei Tage suchte André Royer mich erneut auf. Beim ersten Mal übergab er mir<br />
eine lange Unterhose und ein Flanellunterhemd, die seine Eltern ihm aus Saargemünd, aus dem<br />
annexierten Departement Moselle, zugeschickt hatten. Beim zweiten Mal waren es einige Scheiben<br />
Weißbrot aus einem neu eingetroffenen Paket. In der Regel war es verboten, doppelte<br />
Unterkleidung zu tragen, ohne es zu melden. Die Unterwäsche sollte sich als äußerst nützlich<br />
erweisen, erst auf der Höhe von Buchenwald, die dem kalten Wind von allen Seiten ausgesetzt<br />
war, und noch mehr, später, im Lager Flossenbürg in den Bergen der Oberpfalz. Monate später,<br />
als nur noch Fetzen übrig blieben, konnte ich doch noch einige davon als Taschentuch<br />
wiederverwerten. Ohne Taschentuch war es äußerst unangenehm, weil man in diesen Lagern<br />
dauernd verschnupft war. Dank André war ich besser gegen Lungenentzündung geschützt, eine<br />
Krankheit, die viele von uns traf und nicht selten, durch Mangel an Pflege, zum Tod führte.<br />
Während der drei darauffolgenden Tage ging die Arbeit mit den “Aufnahmeakten“ draußen in<br />
der Sonne weiter. Wir sollten voran machen, denn ein neuer Franzosenkonvoi aus Compiègne war<br />
eingetroffen und vorläufig in provisorischen, in aller Eile aufgerichteten Zelten untergebracht.<br />
Auch für diesen Konvoi waren die Formalitäten schnellsten abzuhandeln. Einer der<br />
Neugekommenen war Claude Thomas, mein Professor für Zivilrecht an der Straßburger Fakultät.<br />
Die Nazis hatten ihn im März 1944 bei einer Razzia im Cercle Saint-Louis aufgegriffen. Ich hatte<br />
die Ehre, seine Kartei aufzusetzen. Sein kartonierter Ordner war in der Vergangenheit bereits für<br />
einen anderen Häftling benutzt worden, denn auf dem Deckblatt war der Name des Vorgängers<br />
durchgestrichen. In solchen, nicht seltenen Fällen wurde über den durchgestrichenen Namen<br />
einen Vermerk wie “Meerschaum“ oder “Himmelfahrt“, oder irgendeinen grotesken<br />
mythologischen Begriff in Fettschrift angebracht, als Zeichen dafür, dass der Verstorbene im<br />
Krematorium verbrannt wurde. Trotz seiner vierzig Tage Einzelhaft im Kerker des “92“ sah<br />
Claude nicht allzu schlecht aus. Ich konnte nur zwei Kleinigkeiten für ihn tun. Im Block 52<br />
informierte ich einen anderen Magistraten, Roland, den ich im Waggon nach Auschwitz<br />
kennengelernt hatte, über seine Ankunft. Claude und Roland kamen beide aus Montpellier und<br />
kannten einander. Nach dem Krieg sollte Roland seine Karriere als Vorsitzender des<br />
Kassationshofes abschließen. Dann bat ich einen kräftigen, sechsundzwanzigjährigen<br />
Widerstandskämpfer, Gilbert Huguenin - zusammen mit uns im “92“ und nun im gleichen Konvoi<br />
mit Claude -, sich um Claude zu kümmern.<br />
Nach dem Krieg hatte ich nur einmal telefonischen Kontakt mit Gilbert, der nicht zu unseren<br />
Treffen kam. Gilbert teilte mir mit, dass Claude kurz nach seiner Ankunft zum Kommando Ellrich,<br />
dem Kommando Dora untergeordnet, geschickt wurde. Die Bedingungen im Nebenlager Ellrich<br />
waren hart. Ich hatte bereits kurz nach meiner Rückkehr aus Flossenbürg über den Tod van<br />
Claude erfahren. Einer der Überlebenden aus Ellrich, Paul Hagenmüller, hatte mir Bericht<br />
erstattet. Paul war ein Freund von André Royer und sollte später Professor an der Fakultät der<br />
Wissenschaften zu Bordeaux-Talence werden. Ich hatte ihn 1941 in Clermont kennengelernt. Er<br />
wurde im Juni 1943 im “Gallia“ aufgegriffen und seit November 1943 war er in Buchenwald.<br />
Während der dort gemeinsam verbrachten Tage suchte er mich öfters auf. Als Buchenwald-<br />
Veteran wusste er über die Lebensbedingungen ausführlich zu berichten. Aus seiner Analyse ging<br />
hervor, dass sich das Verhalten der Lagerbehörde gegenüber den Häftlingen seit Frühjahr 1943<br />
langsam aber stetig geändert hatte: abgesehen von der systematischen Vernichtung der Juden,<br />
wurde nun vermieden, die Häftlinge einen langsamen Tod sterben zu lassen. Paul hatte eine<br />
Erklärung.<br />
Als die Russen im Januar 1943 bei Stalingrad auf einen Schlag mehr als 100 000 Deutschen<br />
gefangen genommen hatten, begriffen die Nazis, dass der Feind demzufolge über ein<br />
abschreckendes Potenzial für Repressalien verfügte. Andererseits, im Rahmen der stetig<br />
75
wachsenden Rüstungsindustrie, stieg der Bedarf an kostengünstigen Arbeitskräften extrem hoch<br />
an und in den Konzentrationslagern, insbesondre in der “Großstadt Buchenwald“, bauten die<br />
Deutschen richtige Fabriken auf. Das führte übrigens dazu, dass die R.A.F. am 28. August 1944 die<br />
Fabriken in Buchenwald zielstrebig bombardierten. Die Folge war - so drückten es die deutschen<br />
Lagerveteranen von 1938 aus -, dass die Lager allmählich zur Heilanstalt evoluierten! Die<br />
Sterberate - bis 1943 noch um die 80-90% - war im Frühjahr 1944 auf 60-70% zurückgegangen. So<br />
lief es auch mit der Ernährung. Als die Fabriken produzierten und die Organisation der<br />
“Arbeitsstatistik“ an Wichtigkeit gewann, sorgte die Lagerverwaltung für eine bessere Verteilung<br />
der etwas ergiebigeren, zwar immer noch unterhalb des Existenzminimums portionierten<br />
Rationen. Auch die Hygiene bekam mehr Beachtung. Während der Quarantäneperiode erhielten<br />
wir serienmäßig eine Impfung. Ich weiß nicht genau wogegen, vermutlich gegen Typhus. Dazu<br />
kam, dass die Kapos politische Häftlinge - Rotwinkel - waren, unter denen viele ehemalige<br />
kommunistische Abgeordnete der Weimarer Republik, die 12 Jahre Haft überlebt hatten. Dennoch<br />
konnte keiner den langjährigen Internierten zustimmen, als diese behaupteten, Buchenwald wäre,<br />
im Vergleich mit früher, zu einem “Kurort“ geworden, denn zu jeder Zeit konnte irgendeine<br />
unvorhersehbare Schwierigkeit zum Tode führen.<br />
Das Gespräch mit Paul war aufmunternd, optimistisch. Es gab Hoffnung auf Überlebenschancen.<br />
Diese Hoffnung sollte ich in den folgenden Tagen brauchen. Auch die Tatsache, dass ich eines<br />
Abends nach dem Appell nochmals mit Jacques Yvon sprechen konnte, munterte mich auf. Um<br />
den 20. Mai erreichte uns die Mitteilung - ich war bei den Schreibarbeiten -, dass die Alliierten<br />
Monte Cassino, nördlich von Neapel, nach vier Monaten Kampf erobert hatten. Die Alliierten<br />
rückten nach Norditalien auf. Eine Offensive am Atlantik konnte nicht lange ausbleiben - so<br />
dachten und hofften wir alle.<br />
Dann, auf einmal, die Panne, fast ein Drama. Georges Straka kam zu mir. Er sah sehr besorgt aus.<br />
Während er bei der “Arbeitsstatistik“ die verschiedenen Arbeiten verteilte, hatte der “Kapo“ ihn<br />
in Schrecken versetzt. Der Kapo hatte Negatives über mich vernommen. Georges fragte mich, ob<br />
vielleicht jemand des Konvois versuchte, mir Schaden zuzufügen. Ich hatte sofort verstanden. Ich<br />
erzählte ihm, wie ich in Birkenau den SS-Unteroffizier, danach den Lagerkommandant<br />
angesprochen hatte und wie anschließend einige ihr Misstrauen mir gegenüber geäußert hatten.<br />
Als ich ihm dann sagte, dass auch Marcel Paul auf Abstand gegangen war, antwortete er, in der<br />
Vergangenheit bereits festgestellt zu haben, dass die Verantwortlichen der PCF - der<br />
Kommunistischen Partei Frankreichs - nicht allzu viel Skrupel hatten, die Nicht-Parteimitglieder<br />
schlecht zu machen, um sie durch die eigenen Leuten zu ersetzen. Straka versprach mir, sofort<br />
Bescheid zu geben, wenn er für mich eine andere Beschäftigung, gegebenenfalls in einer anderen<br />
Abteilung, finden sollte. Ich war völlig entmutigt. Die Angst, immer noch unterschwellig, flackerte<br />
wieder auf.<br />
Vielleicht war es die Verwirrung, vielleicht auch der Zufall, jedenfalls stand ich beim<br />
Abendappell ungewollt in der ersten Reihe. Auf dem Vorplatz, vor dem Block, in Fünferkolonnen<br />
aufgestellt, wurde die gesamte Mannschaft des Blocks jeden Morgen und Abend vom<br />
diensttuenden SS-Soldaten nachgezählt. «Still gestanden, Mützen ab!». Ich befand mich auf nur<br />
drei Schritte vom SS-Mann entfernt, als erster in der Reihe, und griff daneben. Meine Mütze - oder<br />
das, was eine Mütze sein sollte - hatte ich noch auf dem Kopf und erst beim zweiten Versuch hatte<br />
ich sie vorschriftsmäßig in der Hand. Der Blockführer, der für unseren Block zuständige SS-Mann,<br />
- wie konnte es auch anders sein - hatte es gemerkt und sagte zum “Blockältesten“: «Mach dem<br />
noch mal die Mütze ab.» Letzterer wiederholte den Befehl für die gesamte Mannschaft. In meiner<br />
Aufregung griff ich - Malheur! - nochmals ins Leere. Auch dieses Mal blieb die Mütze auf meinem<br />
kahl geschorenen Schädel! Was nun!? Der Blockführer befahl mir, mich auf den Boden zu legen,<br />
meinen Körper auf den gestreckten linken Arm zu stützen und mit der rechten Hand die Mütze<br />
abzunehmen, wieder aufzusetzen, immer weiter, bis er allen Reihen entlang gegangen war und<br />
nach abgeschlossenem Appel zurückkam. Dann befahl er mir, mich bäuchlings flach zum Boden<br />
zu werfen, wieder aufzustehen, fallen lassen, wieder aufstehen… Nach dreizehn oder vierzehn<br />
Fallenlassen-Aufstehen, als ich mir beim Hinfallen einen heftigen Schmerz im Unterleib zugefügt<br />
hatte, hörte ich auf, zu zählen. Wann sollte das aufhören? Wollte er mich ganz fertig machen? Ich<br />
biss die Zähne zusammen, bis der Fiesling sich bei etwa zwanzig entschied, das Hin und Her zu<br />
beenden. Dann befahl er mir, nur mir alleine, die Mütze abzunehmen. Dieses Mal gelang es mir.<br />
Die Bestrafung konnte nicht ausbleiben, wahrscheinlich mit der Begründung des<br />
76
“undisziplinierten Verhaltens“. Das bedeutete, ganz konkret, in der “Schreibstube“ - im Lagerbüro<br />
- fünfundzwanzig Hiebe mit der Peitsche aufs Gesäß. Fünfundzwanzig war das Maximum, denn<br />
über dieses Maß war die Folter tödlich. Mit einem dreckigen Grinsen sagte er dem Blockvorsteher,<br />
der mit seinem Register neben ihm stand: «Siehst du! Jetzt kann er es», und verschwand. Nachher<br />
sagte mir der Blockvorsteher: «Du hast Glück gehabt, dass er gut gelaunt war. Er hat schon einige<br />
auf diese Art beseitigt.». Auch das machte Teil der “Großstadt Buchenwald“ aus: das willkürliche<br />
Töten, vor dem keiner geschützt war und das zu jedem Augenblick zuschlagen konnte.<br />
Am nächsten Tag, ich glaube am 22. Mai, brachte André Royer eine schlechte Nachricht. Es war<br />
schon ein starkes Stück, dass er zu der Zeit durch die Absperrung der Quarantäneblocks gelangt<br />
war. Von Paul Hagenmüller, der mir in der Vergangenheit die Zuverlässigkeit der Informationen<br />
des Royers versichert hatte, kam die Nachricht, dass der größte Teil unseres Konvois - insgesamt<br />
tausend - “verlegt“ werden sollte. Die Bestimmung kannte er nicht, aber - so meinte er - ein großer<br />
Transfer, so eine runde Zahl ließ nichts Gutes vermuten. Nicht nach Dora, darüber war er sich<br />
sicher. Keine rosige Aussichten.<br />
«Scheiße! Ein SS! Versteck mich.» André versteckte sich hinter mir, ein SS-Soldat ging am Gitter<br />
vorbei. Dann flitzte er durch die Absperrung. Das war das letzte Mal, dass ich ihn sah, mit dem<br />
Zeichen des “Fluchtversuchs“ auf dem Rücken.<br />
Hagenmüller behielt Recht: die Informationen von André waren zuverlässig und aus guter<br />
Quelle. Am Nachmittag des 23. Mai ließ der Schreiber alle vor der Baracke antreten. Ich musste<br />
mich auf einen Tisch stellen und er druckte mir die Liste zum Appell in die Hand. Jeder, der<br />
seinen Namen von mir vorgelesen bekam, antwortete «präsent!». Fünfhundert Franzosen aus<br />
meinem Block, auch mir, stand eine neue Reise bevor. Dazu kamen nochmals fünfhundert<br />
Häftlinge aus dem zweiten Block: insgesamt tausend. Am Abend des darauffolgenden Tages<br />
waren alle tausend in einem großen Saal - der gelegentlich als Kino benutzt wurde - versammelt<br />
und, verwirrt und verzweifelt, verbrachten wir die Nacht teils auf den Sitzen teils auf dem<br />
blanken Beton zwischen den Sitzreihen. Anderntags, am frühen Morgen - wir waren wie gerädert<br />
- ging es zu einem Verladungsgebäude. An den Weg durchs Lager kann ich mich nicht mehr<br />
erinnern. Vor dem Einsteigen in die Waggons bekamen wir noch ein Stück Brot. Plötzlich kam ein<br />
Pole aus der “Politischen Abteilung“ angerannt und fragte in die Runde: «Französische<br />
Kameraden aus dem Block 51?». Ich vermutete, dass er jemanden aus dem Konvoi holen wollte,<br />
vielleicht mich, aber ich traute mich nicht, zu reagieren, denn ganz sicher war ich mir seiner<br />
Absicht nicht. Er hatte keinen Namen genannt. Es hätte vielleicht auch Schwierigkeiten gegeben.<br />
Also schwieg ich und, als der SS-Mann uns zubrüllte, stieg ich in den Waggon. Erst 1945 , nach der<br />
Heimkehr aus Flossenbürg, vernahm ich von Georges Straka, dass er tatsächlich versucht hatte,<br />
mich zurückzuhalten, und den polnischen Kollegen geschickt hatte.<br />
Als ich in den Waggon stieg, fragte ich den SS-Soldaten laut: «Muss das Stück Brot für den ganzen<br />
Tag reichen?». Etwas aus der Fassung geraten antwortete er: «Ja, dass muss für den ganzen Tag<br />
reichen!».<br />
Der Zug fuhr ab: fünfzig Männer in einem Waggon und keiner wusste, wohin. Die Türen blieben<br />
geschlossen, das Ziel war selbstverständlich geheim. Während der Fahrt kam ich endlich dazu,<br />
mich zu konzentrieren. Ich wollte alles, was unser Konvoi seit einem Monat erlebt hatte, gut im<br />
Gedächtnis behalten, denn geschriebene Notizen verstecken war unmöglich. Es war wichtig alles<br />
zu behalten. Anfang Januar 1944, als wir alle noch im “92“ saßen, hatte wir uns geschworen, nicht<br />
nur den anderen zu helfen, wo es möglich war, sondern auch - und nicht zuletzt - als<br />
Augenzeugen über die Schandtaten, denen wir alle ausgesetzt waren, zu berichten… falls wir<br />
überleben sollten. Der größten Gefahr, nämlich der, vergast zu werden - wie Kurt Weilenbach es<br />
mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit in Birkenau geschildert hatte - waren wir entflohen.<br />
Die nächste Zukunft erschien mir weniger bedrohlich. Während unseres kurzen Aufenthalts in<br />
Birkenau hatte mich eine Sache nachdenklich gemacht: der Einfluss der kommunistischen Zelle<br />
unter der Führung von Marcel Paul. Letzterer hatte es geschafft, seinen Gefolgsmännern die<br />
Deportation in unserem Konvoi zu ersparen. Dies erklärte teilweise, weshalb etwa 700 Kameraden<br />
nicht mit diesem Konvoi fuhren und wir nur noch knapp 1000 waren. Ich war mir sicher, dass<br />
Marcel Paul - trotz der in Compiègne geknüpften Beziehung - mich aus der “Politischen<br />
Abteilung“ gestrichen hatte. Georges Straka hatte es mir gesagt. Nachdem ich im März 1944 auf<br />
77
der Pflegestation in Compiègne den nächtlichen Gesprächen mit seinen Gefolgsmännern lauschen<br />
konnte, war ich der Überzeugung, dass Marcel Paul bereits vor dem “Fall Barbarossa“ des 22. Juni<br />
1941, vor Hitlers Überfall auf Russland und dem Bruch des Nichtangriffspakts vom 23. August<br />
1939, in der Résistance aktiv war. Der größte Schock, den ich vor gut einem Monat erlebt hatte,<br />
war und blieb meine Überzeugung, dass die Führung des III. Reichs nicht nur die totale und<br />
unmittelbare Ausrottung der europäischen Juden, sondern auch die langsame Vernichtung durch<br />
Arbeit aller anderen Deportierten in den Konzentrationslagern geplant hatte.<br />
Die Reise sollte bis am Abend des 27. Mai, ungefähr sieben Uhr, dauern. Ich merkte, dass wir<br />
wieder nach Westen fuhren, später eine Wende Richtung Süd machten. Der Zug gewann an Höhe<br />
und, nach einigen brutalen Weichenmanövern gegen Ende des Nachmittags, führte die<br />
Eisenbahnstrecke in die Berge hinauf. Nach etwa einer halben Stunde hielt er in einem<br />
Sackbahnhof an. Als die Waggontüre geöffnet wurden, erblickten wir inmitten von riesigen<br />
Granitquadern einen beachtlichen Kordon bewaffneter SS-Soldaten von mehreren Offizieren<br />
geführt. Auf einer Mauer las ich «Altenhammer». Kolonnen in fünfer Reihen wurden mühsam<br />
gebildet, auf beiden Seiten flankiert von SS-Soldaten. Ein SS-Soldat wurde von einem Offizier<br />
angeschnauzt: «Wenn einer stiften will, wie wollen Sie da schießen?!». Der Marsch ging hinauf zu<br />
einem Dorf, von den Ruinen eines Schlosses, grau und trist im hellen Abendlicht des<br />
Maienabends, überragt. Am Ortseingang ein altes, verwittertes Schild: «Flossenbürg». Ich<br />
erinnerte mich, dass mir dieser Name bereits in Auschwitz zugeflüstert wurde. In einem Garten<br />
blühte ein Kirschbaum, schneeweiß in der Berglandschaft. Das bedeutete, in dieser Jahreszeit und<br />
auf diesem Breitengrad, dass wir uns unterhalb 1000 Meter Höhe befanden. Die Lage war also<br />
nicht allzu schlecht.<br />
Als wir den Weg zur Kirche hinaufgingen, schauten einige Einwohner eher gleichgültig als<br />
neugierig zu. In den Fenstern der Herberge links von uns erschienen einige SS-Soldaten in<br />
Gesellschaft von jungen Dorfmädeln. Der Blick, den sie auf uns warfen, glich einer Frage: Wer<br />
sind denn diese Stümper? Angekommen an der Kirche bogen wir nach rechts ab. Dreihundert<br />
Meter vor uns erblickten wir das Lager: auf dem linken Berghang die terrassenartig aufgerichteten<br />
Baracken; auf dem rechten Hang, außerhalb des Lagerzauns, die Pavillons der SS-Offiziere und<br />
ihrer Familien am Fichtenwaldrand; mitten im Lager ein imposantes Gebäude aus Quaderstein,<br />
das Hauptgebäude für die Lagerverwaltung. Die letzte Strecke verlief auf der Ebene, durch einen<br />
ersten, mehrere Meter hohen, das gesamte Lager umgebenden Elektrozaun aus Stacheldraht, von<br />
bemannten Wachtürmen unterbrochen. Nach einigen Metern passierten wir einen zweiten<br />
Elektrozaun der gleichen Art und zwischen den beiden, über die ganze Länge rundums Lager,<br />
einen zusätzlichen Zaun aus spanischen Reitern. Der Kommandatur - auch “Jour-Haus“ genannt -<br />
entlang betraten wir das Lager. Das Gebäude mit Torbogen ohne Tor war im Stil - oder im<br />
Stilmangel - dem Gebäude bei der Zughaltestelle in Auschwitz ähnlich. Links und rechts ein<br />
Granitblock: auf dem einen “Arbeit macht frei“, auf dem anderen “Schutzhaftlager“. Auf den nicht<br />
allzu hohen Blöcken wirkte die Inschrift diskreter als auf dem großen Bogen über dem Tor zum<br />
KZ Buchenwald. Es ging weiter, den Fuhrparkhallen entlang. An der Ecke erschreckten wir alle:<br />
Häftlinge mit kahl geschorenen Schädeln, in gestreiften Drillingsanzügen bei der Arbeit. Sie<br />
behauten große Granitblöcke. Die bis auf die Knochen abgemagerten Körper konnten sich kaum<br />
noch heben, die völlig ermüdeten Gesichter starrten uns an. Später sollte ich erfahren, dass diese<br />
Häftlinge Teil der Disziplinartruppe ausmachten und bis in die Nacht zu Überstunden gezwungen<br />
wurden. Hier konnten wir uns bereits ein Bild von der äußerst harten Disziplin des Lagers<br />
machen. Endlich kamen wir auf dem Appellplatz an, linkerhand die Küche und rechterhand die<br />
Duschen. Vor unserem Quarantäneblock Nr. 16 machten wir Halt.<br />
Kapitel V<br />
FLOSSENBÜRG<br />
Nach einer vierwöchigen, strapazierenden Reise in die Deportation, von Compiègne über<br />
Auschwitz-Birkenau und Buchenwald, sollte ich elf Monate in diesem Arbeitslager Flossenbürg, in<br />
der Oberpfalz nah der tschechischen Grenze, verbringen. Ich möchte weder Bericht über den<br />
Alltag im Lager erstatten, noch die unerbittliche, langsame Agonie der meisten meiner Kameraden<br />
schildern. Ich werde mich darauf beschränken, bis jetzt noch nicht bekannte oder für mich<br />
78
tiefgreifende Fakten darzustellen. Auf mein Leben und Überleben werde ich nicht im Detail<br />
eingehen. Das klingt vielleicht paradox, nachdem ich ausführlich über meinen Aufenthalt in<br />
Auschwitz-Birkenau und Buchenwald, die jeweils nur einige Tage dauerten, berichtet habe. Das<br />
hängt mit dem sonderbaren Routenplan unseres Konvois zusammen. Für mich war es wichtig,<br />
diese außergewöhnlichen Umstände und Fakten objektiv zu analysieren und in meiner<br />
Eigenschaft als überlebender Augenzeuge scharfsichtig wiederzugeben. Ein anderer Grund - und<br />
vielleicht der Hauptgrund - für diesen Bericht war der Kontakt, in den siebziger Jahren, mit einem<br />
jungen deutschen Journalisten, der sich ausführlich, objektiv und eindringlich damit beschäftigt<br />
hat, eine Dokumentation über Flossenbürg, von der Errichtung in 1938 bis zum Fall des Dritten<br />
Reichs in 1945, aufzusetzen. Sein Werk übermittelt eine viel wichtigere Botschaft als meine<br />
wenigen, in einem Zug geschriebenen Seiten, die zusammen mit denen anderer Überlebenden der<br />
Straßburger Universität nach der Befreiung herausgebracht wurde. Alle diese Berichten sind in<br />
dem in Frankreich veröffentlichen Buch “De l’Université aux Camps de Concentration“<br />
nachzulesen. Einige Angaben über die ersten Tagen unseres Aufenthalts möchte ich jedoch<br />
machen.<br />
Als wir vor den Quarantäneblocks 20 und 21 standen, kamen einige Kapos - Verbrecher des<br />
Gemeinrechts mit grünem Dreieck unter der Lagernummer auf der Jacke, auch Grünwinkel<br />
genannt - auf uns zu und staunten: «Das sind ja Intellektuelle!». Einer von ihnen, der Hauptkapo<br />
des Blocks Nr. 5 sprach mich an: «Heute Abend hat man zum ersten Mal eine warme Suppe<br />
ausgeteilt, aber ihr seid zu spät, um sie genießen zu können.». Wir hörten, dass unser Konvoi der<br />
bis jetzt wichtigste nach Flossenbürg war, nachdem bereits am 25 Februar zwei andere mit<br />
insgesamt 750 Franzosen aus Buchenwald eingetroffen waren. Mitten im Winter eingetroffen<br />
wurden sie alle im Steinbruch eingesetzt und unter den herrschenden Bedingungen war ihre Zahl<br />
stark dezimiert worden. Meine Kameraden Cholas und Dumas, beide entsetzt, teilten mir mit,<br />
dass der junge Tixier, der bereits zusammen mit uns im “92“ war, am vorigen Tag völlig erschöpft<br />
verstorben war. Das hatte ihnen ein Krankenpfleger durch den Zaun um den Quarantäneblock<br />
mitgeteilt. Der Journalist Toni Siegert verfügt über die genaue Statistik mit Bezug auf das Los und<br />
die Überlebensrate der 750 Franzosen unseres Konvois. Es kann nachvollzogen werden, dass<br />
zwischen dem 25. Februar und dem 25. Mai 1994 zwei Drittel der deportierten Franzosen wegen<br />
Kälte und Erschöpfung durch die Arbeiten im Steinbruch zu Flossenbürg starben. Unsere<br />
Verzweiflung wurde etwas gelindert, als die Kapos uns berichteten, dass der Steinbruch<br />
allmählich an Wichtigkeit verloren hatte, denn innerhalb des Lagers wurden Ateliers für die<br />
Montage von Flugzeugmotoren, insbesondre für den Jäger Messerschmitt 109, errichtet.<br />
Während der ersten Woche wurden nur dann und wann einige von uns für die Arbeiten im<br />
Steinbruch abgeholt. Nicht selten kehrten sie abends mit Verletzungen am Fuß zurück. Die Sohlen<br />
unserer primitiven Holzschuhe boten nur wenig Schutz gegen die scharfen Granitsplitter. Am<br />
Morgen des zweiten Tages, während des Duschdiensts machten wir die Bekanntschaft eines brutal<br />
schlagenden und laut schreienden Kapos. Auch der SS-Arzt erschien und führte eine Auslese -<br />
vielmehr eine Parodie des Auslesens - anhand der Physiognomie und des Körperbaus durch. Ich<br />
strengte mich an, alles richtig zu übersetzen, den Schlägen auszuweichen, beim Duschen und bei<br />
der Verteilung der desinfizierten Buchenwald-Kleider zu helfen. Nachdem in Buchenwald der<br />
Papierkrieg und andere dazugehörende Aufgaben mich voll in Anspruch genommen hatten,<br />
bekam ich endlich die Gelegenheit, die Bekanntschaft eniger anderen Kameraden zu machen. Wie<br />
ich feststellen konnte, war die Welt, unsere Welt, klein.<br />
Als ich vor dem Block 51 auf einem Hocker stand und den siebenhundert Männern die praktische<br />
Durchführung irgendeines Befehls übersetzte, hörte ich wie von der anderen Seite des Zauns<br />
jemand rief: «Schau mal da! Margraff! Was machst du hier?». Pierre Gasché!, ein Schulkamerad am<br />
Zaberner Kolleg, sein Vater war Postvorsteher in Phalsburg. Nach sieben Jahren trafen wir uns<br />
innerhalb von kurzer Zeit an zwei verschiedenen Orten wieder: erst in Buchenwald, danach in<br />
Flossenbürg. Im Sommer 1943 war er in Lyon verhaftet worden. Nach dem Krieg sollten wir uns<br />
im Elsass treffen und, so weit mir bekannt ist, lebt er heute noch. In den ersten Tagen im Lager<br />
Flossenbürg half ich einem kräftigen Landwirt bei der Pflege einer infizierten Wunde am Bein, das<br />
bei seiner Verhaftung verletzt worden war. Er erzählte mir von seinem großen Gut in der Côte<br />
d’Or, wo er “Terroristen“ Unterkunft geboten hatte. Es stellte sich heraus, dass zur Zeit seiner<br />
Verhaftung sein Knecht, Vater eines taubstummen Mädchens, vorher auf dem Gut in Charny nahe<br />
Dijon gearbeitet hatte, dort wo ich nach meiner Verhaftung und Flucht im Juli 1940 Unterkunft<br />
79
gefunden hatte. Ich machte die Bekanntschaft des Inhabers einer Sägerei in Grand-Pressigny<br />
(Departement Indre). Als ich ihm erzählte, dass in dem gleichen Ort Francis Heintz, ein Freund<br />
aus meiner Kindheit, alle fünf Finger seiner Hand verloren hatte, bestätigte der Mann mir, dass<br />
dies in seiner Sägerei passiert war, dass Francis der Gefangenschaft entkommen war und seitdem<br />
im Maquis kämpfte. Beide, der Landwirt und der Betriebsleiter der Sägerei, sind im Lager<br />
verstorben. Nach dem Krieg vernahm ich von seinem jüngeren Bruder, dass Francis im Maquis<br />
gefallen war. Trotz seiner Verletzung war er ein hervorragender Scharfschütze. Beim Angriff der<br />
Deutschen auf seine Gruppe hatte er sie bei der Flucht gedeckt, wurde umzingelt und von den<br />
Angreifern brutal umgebracht.<br />
Auch konnte ich mich Robert Desnos annähern. Er gehörte dem gleichen Freundeskreis wie die<br />
zwei Brüder Knoll-Demors, meine Kameraden im “92“ zu Clermont, und hatte bei den<br />
“Kulturellen Treffen“ in Buchenwald mitgemacht. Am Anfang unserer Annäherung lief alles<br />
ziemlich schief.<br />
Wir alle hatten unsere Familie und Verwandten nicht vergessen und waren darauf bedacht, ihnen<br />
unsere Nachrichten zukommen zu lassen. Der Kapo unseres Blocks hatte uns gewarnt, dass nur<br />
eine einzelne Sendung im Monat gestattet wurde, eine lapidare Formel, auf einer Karte und auf<br />
Deutsch, etwa wie “Ich bin hier. Es geht mir gut. Du kannst mir jeden Monat schreiben“. Als ich<br />
die Karten einsammelte und Robert Desnos mir seine reichte, las ich ein melancholisches, aber<br />
hinreißendes Gedicht an seine Frau. Er wollte es nicht wahr haben, dass diese Art Korrespondenz<br />
Anleitung zur Abschaffung aller weiteren Briefwechsel mit der Außenwelt geben würde. Es ging<br />
so weit, dass ich, verzweifelt und erschöpft, anfing zu schreien, ihn als Vollidioten, als Blödmann<br />
und noch vieles andere beschimpfte. Die Brüder Knoll-Demors griffen ermittelnd ein. Eine Stunde<br />
später wurde der Zwischenfall mit einer Umarmung abgeschlossen. Einige Tage später fiel Robert<br />
ein weiteres Mal “gefährlich“ auf, als wir auf dem Appellplatz zusammenstanden und es darum<br />
ging, eine Gruppe für das Außenkommando zusammenzustellen. (Flossenbürg hatte mehr als<br />
hundert solcher Außenkommandos, Arbeitslager die dem Hauptlager untergeordnet waren.)<br />
Es war Anfang Juni 1944. Die Quarantäne in Flossenbürg ging zu Ende, einige Tage vor der<br />
Landung der Alliierten. Eine erste Gruppe mit etwa zweihundert Franzosen sollte selektiert<br />
werden, um zum Außenkommando Flöha in Niedersachsen, eins der Außenlager von Flossenbürg<br />
unweit von Chemnitz, übersiedelt zu werden. Scharführer Becker, mit der “Auslese“ beauftragt,<br />
befahl uns, uns in Reih und Glied aufzustellen. Becker war ein ruhiger Mann, solang man ihm auf<br />
Deutsch zu Wort stand. Sofort wenn er ein Wort Französisch hörte, war es mit der Ruhe vorbei. Er<br />
reagierte irritiert und es kam schon mal zu einem Stiefeltritt. Seit wir, Franzosen, in Flossenbürg<br />
die Mehrheit im Lager bildeten, waren wir für die SS-Männer und die Kapos wieder zum<br />
“Erbfeind“ geworden. Auf seinen Befehl folgte ich Becker bei jedem Schritt, um ihm jeweils den<br />
Beruf der einzeln befragten Häftlinge zu übersetzen. Manche ließen sich, selbstverständlich, was<br />
einfallen. Als Desnos an der Reihe war, antwortete er “Schriftkundiger“. Ich übersetzte mit<br />
“Schriftsteller“. «Nein, nicht Schriftsteller, sondern Schriftkundiger», erwiderte Desnos. Um dem<br />
bereits angesetzten Stiefeltritt des Scharführers zu entkommen, fügte ich schnellstens hinzu: «Er ist<br />
Redakteur, Sekretär”. Der Scharführer ließ es gut sein und ging weiter zum nächsten Häftling.<br />
Desnos war sich immer noch nicht bewusst, dass es keinen Sinn hatte, einem ungehobelten und<br />
ungebildeten Rohling den Unterschied zwischen einem Schriftkundigen und einem Schriftsteller<br />
zu erklären. Robert wurden zusammen mit etwa zweihundertzwanzig anderen Franzosen zum<br />
Außenlager Flöha deportiert. Letztendlich landete er in Theresienstadt, wo er am 8. Juni 1945,<br />
nach der Befreiung, verstarb. Auch Dumas wurde für Flöha selektiert. Dort sollte er während der<br />
Evakuierung des Lagers, in den letzten Stunden getötet werden.<br />
Ein zweiter Konvoi mit ungefähr hundertfünfzig Franzosen ging zum Außenlager Hersbrück,<br />
ungefähr achtzig Kilometer vom Zentrallager entfernt. Eine Katastrophe. Einige Wochen später<br />
traf ein Zug mit Leichen verstorbener Häftlinge aus Hersbrück in Flossenbürg ein. Die Leichen<br />
wurden im Krematorium verbrannt. Es wurde noch schlimmer als der bereits berüchtigte Kapo<br />
Hamm in Hersbrück zum Hauptkapo befördert wurde. Ich schätze, dass nicht mehr als zehn<br />
unserer Kameraden die extremen Bedingungen im Außenkommando Hersbrück überlebten.<br />
In den ersten Junitagen erfolgte eine neue Aufteilung. Etwa 650 Männer kamen in die<br />
Fabrikationsstätten, in denen anfangs die Arbeit auf die Herstellung von Einzelteilen beschränkt<br />
80
lieb, anschließend auch die Montage von Jagdflugzeugen und leichten Bombern stattfand. Ich<br />
kam zusammen mit etwa fünfzig Kameraden in Block 7 für die Unterkunft, Abteilung 3 für die<br />
Arbeit. In der Werkstatt 3 nieteten, schweißten und montierten mehr als dreihundert<br />
Zwangsarbeiter die Innenstrukturen für die Flügel des Messerschmitt 109 Jagdflugzeugs. Beim<br />
Arbeiten mit den verschiedenen Maschinen - bohren, schlagbohren, tiefziehen und nieten - war<br />
Vorsicht und Geschicklichkeit geboten, insbesondre an der riesigen Fräsmaschine, die über ein<br />
komplexes Steuersystem einzustellen war. Allen diesen Geräten fehlten Sicherheitsvorkehrungen.<br />
Wir waren erschöpft vor Hunger und Müdigkeit. Zwölf Arbeitsstunden am Tag - am Sonntag nur<br />
ein halber Arbeitstag - in einem höllischen Tempo und in einer lärmerfüllten Umgebung, fehlende<br />
Nachtruhe - wenn wir Glück hatten, konnten wir zu zweit auf einem sechzig Zentimeter breiten<br />
Strohsack schlafen -, und die unzureichende Ernährung machten uns nicht gerade munter und<br />
aufmerksam. In den sechs Monaten, von Juni bis Dezember, kam es zu mehreren Arbeitsunfällen.<br />
Anfang 1945 sollte es noch schlimmer werden. Nachdem ich mich in den vergangenen fünf<br />
Wochen überall und immer angestrengt hatte, um, wenn überhaupt möglich, die<br />
Lebensumstände und Haftbedingungen zu lindern, spürte ich trotz aller Anstrengungen zum<br />
Durchhalten, trotz aller vorgetäuschten Hoffnung, die völlige Erschöpfung und das Abgleiten in<br />
den Tod. Nach einigen Arbeitstagen empfand ich zum ersten Mal das Gefühl “davon zu gehen“.<br />
Während zwei Tagen versuchten mehrere Kameraden, denen ich in der Vergangenheit geholfen<br />
hatte, mich durch Wort und Tat aufzumuntern und zu unterstützen.<br />
Ich frage mich heute noch, wie es zu neuem Auftrieb kam. Mit einem Mal fühlte ich mich wieder<br />
fähig, weiter durchzuhalten. Viele andere schafften das nicht, denn manchmal reichte ein Zufall<br />
oder Zwischenfall - zum Beispiel wenn ein Kapo merkte, dass einer bei der Arbeit nachließ, und<br />
ihm einen Schlag versetzte -, um das Sich-gehen-lassen zu beschleunigen, den Sturz zu vollenden.<br />
So ging es dem Kaplan Tanguy aus Pont-Aven, dem Neffen des in Buchenwald verstorbenen<br />
Dekan der Fakultät. Der Kaplan war vom Tod seines Onkels sehr betroffen. Wir waren<br />
Augenzeugen seines Leidenswegs. Ein Kapo - paradoxerweise “Rotes Dreieck“, also politischer<br />
Häftling - hatte ihn ins Visier genommen. Seinen Namen habe ich vergessen, aber an seine<br />
Matrikelnummer 500 erinnere ich mich noch (ich trug die Nummer 10066). Bei der ersten<br />
Aufteilung nach dem Duschen hatte ich ihm geraten, nicht zu sagen, dass er Priester war, sondern<br />
Mathematiklehrer. Er geriet in die schlechteste Gruppe, nämlich unter dem Kapo, den wir später<br />
als “Killer“ bezeichnen sollten. An einem Morgen, als wir zur Arbeit aufrückten, konnte ich es<br />
nicht sein lassen, diesen Dreckskerl anzusprechen: «Du siehst doch, dass er krank ist!». Nach dem<br />
Blick, den er mir damals zuwarf, wundert es mich heute noch, dass er mich nicht sofort verprügelt<br />
hat. Glücklicherweise gab es auch andere Kapos. Sepp Weizel - grünes Dreieck, Verbrecher des<br />
Gemeinrechts - leitete die Arbeitsgruppe “Zaunbau“. Ich kannte ihn ein wenig, denn zwei<br />
Häftlinge aus Billom - Valet und Gouttelassis -, die bereits seit 1945 in Flossenbürg eingetroffen<br />
waren, arbeiteten in seiner Gruppe. Sepp Weizel kam zu mir und fragte mich, wer dieser<br />
wiederholt verprügelte Franzosen war. Es war Valet der antwortete: «Tanguy. Er ist Priester». -<br />
«Katholisch?» - «Ja!». Sepp, der bereits 1938 wegen Straftat im Lager Flossenbürg saß, erstaunte<br />
uns, als er sagte: «Meine Mutter war katholisch. Frag ihn, ob er in meinem Kommando arbeiten<br />
möchte, ich werde ihm etwas Ruhe gönnen.» Es war bereits zu spät. Tanguy hat es nicht mehr<br />
geschafft.<br />
Dieses tragische Ereignis habe ich mit Absicht erwähnt, um das Paradoxe - die Ausnahme<br />
bestätigt die Regel - zu illustrieren, um die Verantwortungen mit Bezug auf die Reaktionen in<br />
Extremsituationen zu ordnen. Die Nazis hatten das Lager Flossenbürg 1938 als Gefängnis für<br />
Verbrecher des Gemeinrechts eingerichtet. Erst im Winter 1939/40 wurde es erweitert und diente<br />
anfangs als Zwischenstation für sechshundert politische Häftlinge, die anschließend zum Lager<br />
Dachau abgeführt wurden. (Einer dieser Politischen sollte nach dem Krieg einer meiner besten<br />
Freunde werden.) Später trafen die ersten größeren Deportationkonvois aus den besetzten<br />
Ländern, insbesondre aus der Tschechei und aus Polen, in Flossenbürg ein.<br />
Wer waren diese ersten Häftlinge, Verbrecher des Gemeinrechts? Weshalb wurden sie verurteilt?<br />
Im Allgemeinen waren es keine Schwerverbrecher. Die Mehrheit stammte aus der Masse der<br />
Adoleszenten-Generation der Nachkriegszeit 1914-18, die nach dem Fall des deutschen<br />
Kaiserreichs in Armut aufgewachsen waren. Für viele Burschen aus der unteren Sozialschicht, am<br />
stärksten benachteiligt, waren Diebstahl und Raub zum Alltag geworden. Bettler, Vagabunden,<br />
Diebe und andere sahen sich wiederholt wegen kleinerer Verbrechen verurteilt. Nach Hitlers<br />
81
Machtübernahme sperrten die Nazis diese Verbrecher des Gemeinrechts, nach Strafvollzug, von<br />
den Gefängnissen in die Konzentrationslagern ein.<br />
Die Mehrheit dieser Häftlinge hatten die Bedingungen in den Lagern der ersten Generation nicht<br />
überlebt. In den Zeiten, in denen die Zahl der politischen Gefangenen zunahm und noch den<br />
Hauptteil der Häftlinge ausmachte, setzten die SS diese wenigen Überlebenden als Hilfskräfte für<br />
die “Betreuung“ anfangs der deutschen, später auch der ausländischen politischen Häftlinge ein.<br />
Indem die SS den Kapos die Aufsicht über die Häftlinge delegierten, brauchten sie sich nicht<br />
anzustrengen, sich die Hände nicht dreckig zu machen, um die von ihnen vorgeschriebene<br />
Disziplin einhalten zu lassen. Auf ihrer Seite gaben die “Grünen Dreiecke“ der Lagerführung zu<br />
verstehen, dass das Ganze ohne sie nicht funktionieren konnte.<br />
In Anbetracht dieser Evolution und Situation wird es deutlich, dass den Kapos, wie brutal sie<br />
manchmal auch waren, weniger Schuld als der SS vorgeworfen werden kann. Die SS versuchte,<br />
sich von der Drecksarbeit fern zu halten, verordnete jedoch gleichzeitig die disziplinären<br />
Vorschriften und Befehle. Diese Voraussetzungen führten dazu, dass mancher “Politischer“,<br />
nachdem er unter dem Terror der SS zusammengebrochen war, selbst der Brutalität und<br />
Gewalttätigkeit verfiel, während die wenigen “Grünen“, die die erste Hölle überlebt hatten, mehr<br />
Rücksicht nahmen und sich bemühten, niemanden zu misshandeln. Ich möchte dies anhand eines<br />
Beispiels illustrieren. Heinrich Bauer, ein vitaler Bayer, war mein Kapo in der riesigen Halle der<br />
“Abteilung 3“. Obwohl er dann und wann mal eine Backpfeife austeilte, achtete er auf eine<br />
gerechte Verteilung der Nahrung und versuchte, die Zahl der Arbeitsplätze von der Lagerführung<br />
erhöhen zu lassen, um alle etwas von der Müdigkeit zu verschonen. In den ersten Tagen, während<br />
der Einarbeitung, zerbrach der kleine Pierre Eudes ungeschicklicherweise einige Bohrer. Heinrich<br />
Bayer griff nach einem Besen und verpasste Pierre einen solchen Schlag, dass der Besenstiel brach.<br />
Anderntags kam der Bayer auf mich zu und bat mich, ihn bei Pierre für sein unbeherrschtes<br />
Verhalten zu entschuldigen; es gelang ihm, Pierre an einem weniger anstrengenden Arbeitsplatz<br />
zu beschäftigen. Es war auch diesem relativen Verständnis des Kapos Bauer mit zu verdanken,<br />
dass es mir gelang, mich nach meiner tiefen Erschöpfung wieder zusammenzureißen. Anfang 1945<br />
wurde Bauer zum Hauptkapo aller Ateliers ernannt. Er weigerte sich als Deutscher in die SS<br />
einzutreten, machte wie alle anderen mit bei der Evakuierung des Lagers. Bei den Prozessen der<br />
amerikanischen Armee, 1947, erschien er als Zeuge der Anklage .<br />
Am 7. Juni, als wir von der Arbeit zum Block zurückfanden, vernahmen wir es: die Landung der<br />
Alliierten hatte am Vortag stattgefunden! Die Vorarbeiter-Zivilisten hatten es den Häftlingen am<br />
Morgen mitgeteilt. Diesmal war es kein Märchen, keine Ente!<br />
Sofort stieg bei allen die Stimmung um ein vielfaches. Die Aussicht auf eine baldige Befreiung gab<br />
Hoffnung, zu viel Hoffnung. Manche rechneten mit der Befreiung von Paris innerhalb einer<br />
Woche, mit unserer Befreiung einige Wochen später. Das war es, wovor Kirrmann in Buchenwald<br />
gewarnt hatte: eine peinliche Enttäuschung, die das Überleben umso schwerer macht. Auf meiner<br />
Seite vertrat ich die Meinung, dass wenn die Russen die Offensive an der Ostfront wieder<br />
aufnehmen würden - was Ende Juni 1944 auch geschah - wir mit einer Befreiung im Monat<br />
September rechnen könnten und nur noch einen Sommer zu überleben hätten. Auch dies war eine<br />
Fehleinschätzung.<br />
Gerade der Winter 1944/45 war für viele ein Desaster. Es war wohl der härteste Winter in den<br />
Konzentrationslagern: jeden Tag, über das gesamte deutsche Gebiet, starben täglich fünftausend<br />
Deportierte in den Lagern, während fast alle besetzten Gebiete befreit worden waren.<br />
Bei Sommeranfang 1944 war das Wetter in Flossenbürg herrlich. In der Ferne, auf dem Berggrat<br />
am Horizont konnte man auf dem höchsten Punkt ein Kloster erblicken. Es erinnerte mich an den<br />
Mont Saint-Odile bei uns im Elsass. Eine Fläche von etwa dreißig Meter breit, sorgfältig abgeholzt<br />
und geräumt, trennte den äußeren Zaun vom dichten Bayerischen Wald, der für uns das<br />
“Draußen“, die Außenwelt symbolisierte. An einem frühen Julimorgen, als ich wie jeden Morgen<br />
auf die hochstämmigen Bäume schaute, erblickte ich es, als es vorsichtig aus dem Gestrüpp kam;<br />
mit seinen zarten und etwas verschwommenen Augen schaute es mich einige Sekunden an;<br />
unsere Blicke kreuzten sich, bevor das erschrockene, junge Rehkitz in den dunkleren Wald<br />
verschwand. Einige Sekunden hatte ich der Freiheit in die Augen geschaut.<br />
82
Ich kann unmöglich die erdrückende Stimmung, das beängstigende Leben während dieses<br />
monatelangen Kampfs, der zu oft mit dem Tod endete, im Lager Flossenbürg wiedergeben. Wir<br />
lebten zusammen, jedoch jeder für sich, isoliert in und durch sein eigenes Leiden, und jeder<br />
empfand am eigenen Leib das Drama des Überlebens oder des Todes. Flossenbürg war weniger<br />
bekannt als die anderen Lager wie Auschwitz, Buchenwald, Dachau und andere, über die nach<br />
der Befreiung von den Medien berichtet wurde. Wichtig ist, trotz den zahlreichen Schwierigkeiten<br />
des Aufsatzes, die allgemeinen Gegebenheiten als eine historische Botschaft an die jüngeren<br />
Generationen zu vermitteln. Der fragmentarische Charakter der Archive, die teilweise verstreut,<br />
teilweise von deren Autoren vernichtet wurden, erfordert eine besondre Wachsamkeit, sogar eine<br />
besondere Fähigkeit, um die Todeszahl mit Sicherheit feststellen zu können.<br />
Der wunde Punkt ist die Stichhaltigkeit der Hochrechnungen. In Anbetracht der Monstrosität des<br />
Verbrechens und um dieses Verbrechen mit umso mehr Vehemenz verurteilen zu können, haben<br />
einige in ihren Kommentaren der Zahleninflation nachgegeben und gerade weil dieser destruktive<br />
Wahnsinn jeder Form der Vernunft widerspricht, sind diese Zahlen in das kollektive Gedächtnis<br />
eingegangen. Dieser Übereifer gab Anlass zu dem, was Georges Walker “Hyperkritik“ nennt, und<br />
zu den negationistischen Darstellungen. Die Folgen waren besonders verhängnisvoll für die<br />
Schätzung der Todeszahl in Auschwitz-Birkenau, mehr als für den Fall Flossenbürg. Seit mehr als<br />
vierzig Jahren steht in Birkenau ein Gedenkmal mit der Zahl von vier Millionen Opfer des<br />
Naziregimes. Auch die Zahl, die vom Yad Vashem Museum in Jerusalem angegeben wird,<br />
übersteigt die Wirklichkeit. Das war ein gefundenes Fressen für die Neo-Wissenschaftler, unter<br />
denen Faurisson, der das Nicht-Bestehen der Gaskammer in seiner Doktorarbeit beweisen wollte.<br />
Echte Forschungsarbeit von einer unvergleichbaren peinlichen Genauigkeit wurde vom Museum<br />
Auschwitz geleistet. Die Ergebnisse wurden 1990 in der polnischen Tageszeitung “Gazeta“<br />
veröffentlicht und in “Le Monde“ des 17. Juli 1990 zitiert. Wenn man die Zahl von vier Millionen<br />
Toten nur für Auschwitz erwähnt, dann fügt man unter diesen einen fast mystischen Namen nicht<br />
nur die Gesamtheit der Opfer in den osteuropäischen Vernichtungslagern zusammen, d.h.<br />
Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Vilno, Majdanek, Belzec, Sobibor und Chelmno, sondern auch<br />
Judenbevölkerung, die in der Ukraine und in Weißrussland vor Ort ermordet wurde, wie Nicolai<br />
es mir bereits im September 1942 im Gefängnis zu Metz schilderte. Obwohl die sowjetrussischen<br />
Archive nicht zugänglich waren und somit nicht einbezogen werden konnten, ergeben die<br />
rezenten und genauen Arbeiten des Museums Auschwitz sowie die zuverlässige Statistik im Werk<br />
von Raoul Hilberg (“Destruction des Juifs d’Europe“, Fayard 1988) eine Zahl zwischen einem<br />
Minimum von 950 000 und einem Maximum von 1 200 000 für die Opfer in Auschwitz-Birkenau,<br />
d.h. eine viertel Million weniger als von anderen trotz strengen Recherchen angenommen.<br />
Demzufolge ist es nicht erstaunlich, dass bei vielen Zweifel aufkam, umso mehr als in Frankreich<br />
immer eine Form des Antisemitismus, meist unterschwellig, vorhanden war. Was sollte man<br />
antworten, wenn - wie es mir gegenüber einem alten Bekannten, der damals unter dem Vichy-<br />
Regime Karriere machte und heute als Top-Beambter des Landesplanungsministeriums seine<br />
Rente bezieht, geschah -, einer hinterlistig fragt, ob es die Gaskammern tatsächlich gegeben hat?<br />
Was hätte ich meinem gleichaltrigen Cousin aus dem Elsass, der als Zwangssoldat der Wehrmacht<br />
an der Ostfront desertierte und heute Apotheker in Ruhestand ist, antworten sollen, als er mir<br />
eines Tages unwiderlegbar vorrechnete, dass es unmöglich sei, so viele Juden in solchem kurzen<br />
Zeitraum und auf solcher beschränkten Fläche zu vergasen. Meine Antwort war meine<br />
Entscheidung, meinen bescheidenen Bericht über die elf in Auschwitz verbrachten Tage<br />
aufzusetzen. Ich bedanke mich bei ihnen dafür, dass sie mich dazu brachten, diese Initiative zu<br />
ergreifen. Im Bezug auf Flossenbürg war ich in den ersten Nachkriegsjahren völlig verwirrt, als ich<br />
die gleiche, gravierende Diskrepanz zwischen der wirklichen Todeszahl und der veröffentlichten,<br />
unmittelbar bestätigt fand.<br />
Als ich im Herbst 1945 vom Lesekomitee der Überlebenden der Straßburger Universität gebeten<br />
wurde, einen Entwurf über meine Beobachtungen im Flossenbürger Lager einzureichen, war die<br />
Erinnerung noch ganz frisch. In Gedanken zählte ich den Durchschnitt der von Mai 1944 bis<br />
August 1945 verbrannten Leichen anhand der Informationen, die täglich aus der<br />
Krankenpflegestation, dem Revier, durchsickerten. Für den Zeitraum von Juni bis August kam ich<br />
zu einem Durchschnitt von fünfundzwanzig pro Tag, für die drei Monate September bis<br />
November waren es vierzig, wonach die Zahlen in die Höhe gingen und nicht selten mehr als<br />
hundert pro Tag betrugen. So rechnete ich zusammen, dass während der gesamten Periode<br />
mindestens fünfundzwanzigtausend Häftlinge umkamen. Ich verfügte weder über die Listen der<br />
vorherigen Jahre noch über die der zahlreichen und weit verteilten Außenkommandos. Jedoch ist<br />
83
es schockierend, dass auf dem Schornstein des Krematoriums - auf die Einheit genau nach den<br />
verschiedenen Nationalitäten geordnet - die Gesamtzahl von über sechzigtausend Opfern<br />
eingraviert wurde. Das zeugt von Manipulation, entweder demagogischer Art oder impulsiv<br />
leidenschaftlich begangen, auf jeden Fall der Wahrheit schädigend.<br />
Ich war wütend, aber machtlos. Wütend, weil die Zahl der Toden dermaßen profaniert wurde.<br />
Machtlos, denn ich verfügte nicht über die Mittel, diese Zahl zu korrigieren. Dann kam mir der<br />
rettende Engel zur Hilfe.<br />
1974 empfang ich ein Brief aus Weiden, Kreisfreie Stadt im Tal der Waldnaab, in dem ein mir<br />
damals Unbekannter, Toni Siegert, ohne große einleitende Worte fragte, wie damals die<br />
Quarantäneblocks im präzisen Verhältnis zu den anderen Gebäuden auf dem Appellplatz<br />
angeordnet waren. Ich war perplex. In einem eher trockenen Rückschreiben bat ich ihn, mir seine<br />
Absichten und Motivationen mitzuteilen. Darauf empfing ich eine ausführliche Erklärung und<br />
Beschreibung seines Werdegangs in dieser Materie. Er war 1950 geboren und ältester Sohn seines<br />
aus Schlesien stammenden Vaters, der 1943 vor Stalingrad in die Kriegsgefangenschaft gegangen,<br />
1948 aus Russland heimgekehrt und seitdem als Flüchtling in Bayern sesshaft war. 1969, nach<br />
seinem Abitur, hatte er das Studium der Journalistik angefangen und, zur Zeit seines Schreibens,<br />
absolvierte er ein Praktikum bei der Lokalzeitung “Weidener Rundschau“. Diese Tageszeitung gab<br />
es bereits damals, während unseres Flossenbürger Aufenthalts. Anlässlich des dreißigsten<br />
Gedenktags der Kapitulation, war er mit dem Aufsatz der Hintergrundberichte über das Leben in<br />
Bayern während der Nazidiktatur beauftragt. Während dieser Arbeiten war er zu der Feststellung<br />
gekommen, dass die Ereignisse, die ihm in der Schule als wahrhaftig dargestellt worden waren,<br />
sich bei näherer Betrachtung und nach Prüfung als falsch erwiesen, sogar mit Absicht gefälscht<br />
worden waren, und dass die schlimmsten Fakten systematisch verschwiegen und mit dem Mantel<br />
des Schweigens umhüllt wurden. Das hatte ihn schockiert und empört. Er war entschieden, alle<br />
Mittel dazu einzusetzen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, und wählte die “Geschichte des<br />
Lagers Flossenbürg“ als Thema seiner Endarbeit. Als Referenz nannte er mir Ruth Jokush, die ich<br />
1947 in Dachau als junge Dolmetscherin bei den von den Amerikanern geleiteten Verfahren gegen<br />
die Kriegsverbrecher kennengelernt hatte. Ruth, eine wunderschöne Frau, Tochter eines<br />
Frankfurter Rechtsanwalts, war vor dem Krieg emigriert und heiratete später einen der ältesten<br />
unter den Überlebenden von Dachau, Hugo Jokech. Seitdem hatte sie sich unermüdlich für den<br />
Aufbau des Dachauer Museums eingesetzt. Es war Ruth, die Toni den Hinweis gegeben hatte, er<br />
könnte sich für alles, was im letzten Jahr des Flossenbürger Lagers geschehen war, an Henri<br />
Margraff wenden, der Deutsch sprach und sich während der Prozesse in Dachau durch ein<br />
hervorragendes Gedächtnis und eine bemerkenswerte Genauigkeit bei der Wiedergabe der<br />
Tatsachen ausgezeichnet hatte.<br />
Das war der Anfang einer jahrelangen Zusammenarbeit mit Toni Siegert. Mehrmals gestatteten<br />
wir uns gegenseitige Besuche, um meine Aussagen aufzunehmen, sogar zweimal auf dem<br />
Gelände des Lagers. Auf eigene Kosten folgte er einer Ausbildung zum Entschlüsseln und<br />
Klassieren von Archiven, und fuhr nach Washington, nachdem ihm der Zugang zu den<br />
“Arolschen“ Archiven gestattet wurde, nämlich die Archive, die die Amerikaner zusammengelegt<br />
und in die Vereinigten Staaten mitgenommen hatten. Darauf folgte eine lange, mühsame<br />
Benediktinerarbeit: neu klassieren, entziffern, zusammenlegen von Fakten und zählen der Opfer.<br />
Das Zählen der Toten erforderte die größte Sorgfältigkeit, denn nicht selten war die gleiche Person<br />
zweimal, oder sogar öfter, als verstorben in den Listen und Berichten des Zentrallagers und der<br />
Außenkommandos eingetragen. Es gelang ihm, die Geschichte der Lagerführung, insbesondre die<br />
Biographie der verschiedenen, aufeinanderfolgenden Lagerkommandanten zu rekonstruieren.<br />
Auf diese Art und Weise konnte er die einzelne Verantwortung der Grausamsten unter den SS-<br />
Männern ans Licht bringen. Bereits während der ersten Gespräche erwähnte ich ihm die mentale<br />
Grausamkeit des stellvertretenden Lageroffiziers, des Obersturmführers SS Ludwig Baumgartner<br />
(von seinen Freunden auch Lutz genannt). Er hatte seine Ausbildung 1933 im Hauptlager zu<br />
Dachau gehabt und war seit 1938 im Lager Flossenbürg, wo er bis 1945 alle Kriegsdienstgrade bis<br />
zum Obersturmführer durchlaufen hatte. Als wir 1944 in Flossenbürg landeten war der Dreckskerl<br />
gerade sechsundzwanzig. Auf ihn komme ich in der Folge noch zurück.<br />
Toni Siegert, assistiert von seiner jungen, zarten Ehefrau, brachte es zur Veröffentlichung eines<br />
etwa fünfzig Seiten umfassenden Hefts, das er, seinem wesentlichen Ziel entsprechend, mit dem<br />
84
Titel “30 000 Tote mahnen“ versah (Bayern in der NS-Zeit, Brodgat Verlag). Toni Siegert lässt<br />
Gerechtigkeit walten, sowohl auf der Seite derjenigen, die sich durch Manipulation der Statistiken<br />
ein Denkmal setzen wollten, als auch auf der Seite derjenigen, die die Übertreibungen der Ersten<br />
als Argument benutzten, um das Vernichtungssytem der Konzentrationslager im III. Reich in<br />
Zweifel zu ziehen, wenn nicht abzustreiten. Die Qualität seines Werkes wurde allgemein<br />
anerkannt und sein Beitrag wurde als siebtes und letztes Kapitel in das Gesamtwerk “Bayern in<br />
der NS-Zeit“ aufgenommen. Das sechste Kapitel betrifft das Lager Dachau und die ersten fünf<br />
Kapitel handeln von der Presse, die Kulte und die Kunst während desselben Zeitraums 1933-1945.<br />
Für Bayern, das größte Land Deutschlands und zur Zeit anscheinend führend in Wirtschaft und<br />
Kultur, stellt diese Sammlung ein Standardwerk der gegenwärtigen Geschichte Deutschlands dar<br />
und wird als Referenz auf Universitätsniveau zitiert.<br />
Die zahlreichen, recherchierten Gegebenheiten und die verschiedenen, bewiesenen Episoden, die<br />
das von den Opfern erlebten Drama schildern, hat Toni Siebert in ein bemerkenswertes,<br />
persönliches Archiv zusammengefügt. Gut aufbewahrt wird es dazu dienen, die Wahrheit zu<br />
erhalten und weiterzugeben. Ich zögere nicht, zu sagen, dass dieser junge deutsche Intellektuelle,<br />
tief christlich und heutzutage Vater einer Großfamilie, trotz der zarten Gesundheit seiner Ehefrau,<br />
zum wahren Gewissen des Lagers Flossenbürg geworden ist. Als ich ihn im Herbst 1989 zum<br />
letzten Mal bei ihm zu Hause traf, wollte ich ihm meine Dankbarkeit und Anerkennung erweisen.<br />
Ich gab ihm mein Heftchen, mit einer Bleispur auf dem Deckblatt, in dem ich, am 20. April 1945,<br />
einige Minuten vor dem Abmarsch aus Flossenbürg nach Dachau, in deutscher Sprache meine<br />
Personalien eingetragen hatte, mit der Bitte an denjenigen, der meine Leiche finden sollte, meine<br />
Familie zu benachrichtigen und ihr zu sagen, dass ich als Christ gestorben war. Bis dann hatte ich<br />
dieses Heft wie eine Reliquie aufbewahrt. Ich war der Meinung, dass Toni es verdient hatte, es<br />
aufzubewahren.<br />
Mitte Juni 1944. Das Mühlwerk des Lebens - oder vielmehr des Überlebens - in Flossenbürg<br />
mahlte: entweder anpassen, einen neuen Aufschwung schaffen, eine Stufe höher als vor der<br />
Deportation, oder untergehen, den verschiedenen Stufen der Erschöpfung hinunter: über die<br />
Krankenpflegestation - das Revier - in die Leichenhalle zusammen mit den anderen Leichen,<br />
danach, weiter zusammen, ins Krematorium unten in der Schlucht neben dem Revier. In wenigen<br />
Tagen, vielleicht in wenigen Wochen. Es genügte ein kleines Gedränge, einige Schläge.<br />
Der Morgen fing nachts an, genau um vier Uhr fünfzehn: “Kaffeeholer, raus!“. Vom zentralen<br />
Raum aus, dort wo der Blockführer untergebracht war, weckten uns die mit dem Stubendienst<br />
Beauftragten mit ihrem Befehl zum Kaffee-holen. In den beiden Seitengängen, die als Schlafraum<br />
eingerichtet waren, bevor die anderen sich rührten, sprangen die vier, am Vortag mit dem Kaffeeholen<br />
Beauftragten - auch ich war oft dabei - von den Strohsäcken hoch, schnellten die zwanzig<br />
Stufen auf vier Ebenen der Treppe vor der Baracke hinunter, rannten über den Appellplatz bis zur<br />
Küche, um dort nach den acht schweren Gefäßen mit der heißen Brühe zu greifen, nahmen<br />
Anlauf, um die Treppe wieder hinaufzusteigen, und stellten den “Kaffee“ genau um vier Uhr<br />
dreißig ab, als die Lichter angemacht wurden: Aufstehen! Ein Veteran, Häftling des Gemeinrechts<br />
namens Gressel (dem der Spitzname “Pfeife“ zugeteilt wurde), schwul und brutal, war zuständig<br />
für den ordnungsgemäßen Ablauf im Schlafsaal. Dieser “Schlafsaalkommissar“, wie wir ihn<br />
nannten, konnte es nicht sein lassen, uns aus dem Raum zu treiben, ohne dabei seinen Knüppel zu<br />
benutzen und uns als Räuberbande, als Berufskriminelle und Verbrecher zu beschimpfen. Für uns<br />
bedeutete dies, dass der Tag wie jeder andere begann.<br />
Waschlappen und Seife befanden sich im Wandschrank; im Waschraum mit den Wasserhähnen<br />
in einer Reihe - nur kaltes Wasser - wuschen wir uns, oder taten als ob. Vor den Toiletten ohne<br />
Spülung gab es jeden Tag allgemeines Gedränge. Anschließend stellten wir uns in die Reihe und<br />
reichten den Essnapf, um einen Keller von der “Morgenbrühe“ zu erhalten. In Abwartung des<br />
Appells für die jeweiligen Arbeitskommandos wurde die Decke genau quadratisch über den<br />
Strohsack gelegt; alles sehr sorgfältig, denn nicht selten wurden die vor lauter Erschöpfung wenig<br />
Geschickten mit Schlägen traktiert. Ruhrfälle, schlecht gepflegte, eiternde Wunden gab es immer<br />
wieder. Derjenigen, der ein Bild der Lage, der Stimmung und der Angst vor den Ungewissheiten<br />
und Bedrohungen des neuen Tages geben sollte, beneide ich sicherlich nicht. Durchhalten war<br />
angesagt.<br />
85
Um halbsechs gingen die einzelnen Gruppen die steinerne Treppe hinunter zu dem jeweiligen<br />
Kapo, der seine Mannschaft zusammenfügte, die Kranken zurückschickte und die Arbeitsfähigen<br />
in Fünferkolonnen im Marschschritt - alle mit dem Essnapf am Gurt - unter den Zaunbogen<br />
führte. Dort zählte die SS nochmals die genaue Zahl der “Auswärtigen“ (Abends musste dieselbe<br />
Zahl wieder zum Appell erscheinen, einschließlich der tagsüber Verstorbenen). Weiter ging es,<br />
entweder einige hunderte Meter weiter zu den Fabrikhallen oder zur Steingrube, innerhalb eines<br />
umzäunten und überwachten Geländes.<br />
Genau um sechs Uhr betätigte der Kapo die Sirene und jeder fing an seinem Arbeitsposten an.<br />
Zwei Stunden später heulte die Sirene: zehn Minuten Pause. Jeder bekam eine Schnitte Kleienbrot<br />
mit einer dünnen Schicht (synthetischen) Margarine, die er hungrig verspeist hatte, lange bevor<br />
die Sirene zur Fortsetzung der Arbeit aufrief. Punkt zwölf folgte eine (ganze) Stunde Mittagspause<br />
samt “Restauration“, d.h. eine dicke Suppe, vorwiegend mit getrockneten weißen Rüben, deren<br />
fast fauler Geruch uns bereits in aller Frühe, während des Appells auf dem Zentralplatz, aus den<br />
anliegenden Küchenräumen entgegen gekommen war. Unser Kapo Bauer verteilte die Rationen<br />
ganz genau, ohne ungerechtfertigte Vergünstigungen; nachdem er jeden Essnapf mit der Kelle<br />
gefüllt hatte, griff er zu seiner Tagesliste, rief jeden - der Nummerierung nach - zu sich, um noch<br />
eine zusätzliche Kelle auszuschütten. Dieses Vorgehen hatte für uns eine besondre Bedeutung,<br />
denn in den ersten drei Monaten, von Juni bis einschließlich August, trug auch das<br />
Gerechtigkeitsgefühl dieses “grünen“ Kapos, nebst der Motivation zum Durchhalten, die uns das<br />
Vorrücken der Alliierten bereitete, dazu bei, dass unter den Franzosen seiner Produktionsstätte<br />
nur zwei Tote zu bedauern waren, der Älteste und einer der Jüngsten.<br />
Um eins ging es weiter. Schnell wurden die zwei oder drei, die irgendwo - manchmal an den<br />
unmöglichsten Stellen - eingeschlafen waren, gesucht und geweckt. Ohne Unterbrechung wurde<br />
bis sechs Uhr weiter geschafft. Elf Stunden am Tag. Es konnte nie und nirgendwo die Rede davon<br />
sein, sich zu drücken. Die vorgeschriebenen Produktionsmengen erforderten ein rasendes<br />
Arbeitstempo. Hier wurde uns klar, welchen Vorteil unsere Zwangsarbeit der SS verschaffte. Wie<br />
Toni Siegert es später aufdecken und nachrechnen sollte, bezahlte das Unternehmen<br />
Messerschmitt die Arbeitsleistung an die “Deutschen Erd- und Stahlwerke“, exklusives Eigentum<br />
der SS. Die SS hatte für die - selbstverständlich kostenlosen - Arbeitskräfte, deren Unterkunft und<br />
Unterhalt zu sorgen und von den geleisteten Zahlungen behielt sie den größten Teil für sich. All<br />
das verlief unter der stillschweigenden Beihilfe und Deckung des Halbgottes Messerschmitt.<br />
Bekanntlich wurden während des Kriegs alle Einzelteile der Messerschmitt in den<br />
Konzentrationslagern zusammengebaut.<br />
Es ist nicht meine Aufgabe, hier die - übrigens immer noch weiterbestehende (heimliche)<br />
Zusammenarbeit zwischen dem Messerschmittunternehmen und den “Deutschen Erd- und<br />
Stahlwerken“ näher zu beleuchten. Jedoch kann und muss ich hier hinzufügen, dass die<br />
Gesamtheit der Produktionsstätten innerhalb des Lagers Flossenbürg täglich zwanzig<br />
Messerschmitt 109 auslieferten. Als wir ab November 1944 auch zur Arbeit am Sonntagmorgen,<br />
von sechs Uhr bis Mittag, gezwungen wurden und somit eine Arbeitswoche von sechsundsechzig<br />
bis zweiundsiebzig Stunden, abwechselnd in Tages- und Nachtschichten leisteten, wurde die<br />
Produktionszahl von zwanzig auf zweiundzwanzig Maschinen pro Tag gesteigert.<br />
Die Zahlen der diesbezüglichen Studien liegen mir nicht vor, ich kenne sie nicht auswendig. Ich<br />
erinnere mich an den Artikel in “Le Monde“ anlässlich des Todes des Messerschmitt-Gründers in<br />
1950, in dem erwähnt wurde, dass kein einziges von den in den KZ zusammengebauten<br />
Flugzeugen je abgehoben hat. In Bezug auf die Tausende von jedem von uns geleisteten,<br />
unbezahlten Arbeitsstunden, erinnere ich daran, dass es - aufgrund des fünfundzwanzigjährigen<br />
Kalten Kriegs - nie zu einem Friedensabkommen kam, indem die Entschädigungen hätten<br />
vereinbart werden können. Statt dessen wurde die Angelegenheit der Zwangsarbeit der<br />
französischen Häftlinge in den KZ im Oktober 1961 mit einem deutsch-französischen Abkommen<br />
abgehakt: die zwischen den beiden Völkern besiegelte Versöhnung sollte unberührt bleiben und -<br />
anstatt Entschädigungen und Wiedergutmachung zu fordern - zahlte der französische Staat den<br />
Überlebenden die Invaliditätsrente aus dem Staatshaushalt.<br />
Sechs Uhr abends: Ende des Arbeitstages. Alle versammelten sich zum Rückmarsch ins<br />
Zentrallager. An manchen Tagen bekam jeder einen Granitblock auf die Schulter und hatte diesen<br />
86
zur weiteren Bearbeitung ins Zentrallager mitzuschleppen. Es war überhaupt nicht zu wagen, sich<br />
den leichtesten Brocken auszuwählen, denn sofort wurde ein Block mit dem dreifachen Gewicht<br />
ausgesucht! Die Fünferkolonnen wurden im Vorbeischreiten an den Wachposten des “Jourhauses“<br />
nachgezählt. An den “normalen“ Tagen erfolgte der Abendappell auf dem Gelände vor den Blocks<br />
unter Aufsicht des SS-Blockverantwortlichen. Wenn die Zahl der jeweiligen Baracke sowie die<br />
Gesamtzahl aller Baracken nicht auf die Einheit stimmte, wurde ein Generalappell auf dem<br />
Zentralplatz durchgeführt.<br />
Regelmäßig wurde bei Rückkehr im Lager die eine oder andere Hundertgruppe zu einer<br />
gründlichen Leibesdurchsuchung abseits gestellt. Zweimal konnten wir einen solchen, mehrere<br />
Stunden dauernden Generalappel in anstrengender Hab-Acht-Stellung erleben. Einmal wurde<br />
meine Mannschaft, auch ich, einer Leibesdurchsuchung unterzogen. Auch dieses Mal hatte ich<br />
Glück! Ein genau so unerhörtes Glück wie damals in Buchenwald, als ich dem SS-Offizier beim<br />
Appell gegenüberstand. Statt von einem Kapo durchsucht zu werden, wurde ich bloß von einem<br />
SS-Stabscharführer, dem ein Meter neunzig großen Kleiber, “abgetastet. Als Stabsscharführer war<br />
Kübel mit der Disziplin und deren Koordination innerhalb des Lagers beauftragt. Er war zu faul,<br />
sich zu bücken, und griff nicht unterhalb des Knies. Unten, in jedem Hosenbein, hatte ich zwei<br />
rohe Kartoffeln versteckt, die für die “Organisation“ bestimmt waren (eine etwas edlere<br />
Bezeichnung für diejenigen, die in der Lage waren und die Gelegenheit hatten, etwas zu klauen).<br />
Die “Organisation“ war von einigen Kameraden im Kartoffelsilo der SS eingerichtet worden. In<br />
der Vergangenheit hatten wir bereits erleben können, wie solche Gemüsediebe bis zum Bluten<br />
geschlagen worden waren. Zwei Polen, bei denen ein in den Werkstätten hergestelltes Messer<br />
gefunden worden war, hatte die SS in den “Bunker“, im Arresthaus eingesperrt. Im gleichen<br />
Arresthaus sollten am 20. April 1945 General Oster, Admiral Canaris und der evangelische Pfarrer<br />
Dietrich Bonhoeffer brutal ermordet werden. Die Polen sahen wir nie wieder. Nach dieser Klau-<br />
und Durchsuchungsaktion, nach dem Schrecken war mir jede Lust zum “organisieren“, in gleich<br />
welcher Form, vergangen.<br />
Zum “normalen“ Tagesablauf ist noch hinzuzufügen, dass am Schluss des Appells, diejenigen<br />
aufgerufen wurden, für die Post - ein Brief, ein Paket - in die “Schreibstube“, das SS-Büro im Block<br />
I auf dem Appellplatz, eingetroffen und dort abzuholen war. “Und jetzt kommt etwas fürs Herz!“<br />
kündigte der Blockführer an manchen Abenden an, holte seine Liste hervor und rief diejenigen<br />
auf, denen auf Antrag der Zutritt zum Sonderbau unter Führung eines dazu beauftragten SS-<br />
Mannes genehmigt worden war. Jedes Zentrallager hatte seinen eigenen Sonderbau, seinen<br />
eigenen Puff.<br />
Zum Abschluss des Abendappells bekam jeder seine zweite Schnitte Margarinebrot samt einer<br />
Kelle “Tee“ oder - zweimal in der Woche - warme Suppe, jedoch viel dünner als am Mittag. Die<br />
Verletzten des Tages konnten sich auf der “Ambulanz“ außerhalb des Reviers unter dürftigen<br />
Bedingungen (bedenkliche Desinfektionsmittel, Papierverbände,…) versorgen lassen. Ab acht Uhr<br />
kroch man auf den Strohsäcken in den zwei Schlafsälen zusammen, nachdem man unvermeidlich<br />
vom “Pfeifenkopf“ mit Gummiknüppelschlägen traktiert worden war.<br />
So reihten sich die Junitage aneinander. Es erreichten uns keine weiteren Nachrichten über den<br />
Vorstoß der Alliierten nach der Landung anfangs Juni. Über ein Vordringen der Verbündeten im<br />
Westen hätten wir, zwar mit einigen Tagen Verzögerung, zweifellos erfahren. Die Vorarbeiter,<br />
deutsche Zivilisten, plauderten mit den Kapos über die neuesten Nachrichten und letztere<br />
plapperten sie innerhalb der Werkstätte weiter. Unsere Verzweiflung nahm zu, als die<br />
Vernichtungskraft der V1- und V2-Raketen hochgelobt wurde. Diese Raketen waren von der<br />
französischen Seite des Ärmelkanals auf Großbritannien gerichtet. In den Junitagen erhielten wir<br />
die zuverlässige Nachricht, dass die Russen die große Offensive an der Ostfront zu Minsk<br />
begonnen hatten, nachdem die Front sich seit April, seit unserer Abreise aus Compiègne<br />
stabilisiert hatte (damals in Compiègne hatte ich mir, dank meiner guten Kenntnisse der<br />
Geographie, den Verlauf der gesamten Ostfront ins Gedächtnis eingeprägt).<br />
Ich vernahm, dass ein russischer Offizier aus Block 5 mit einem der Franzosen reden wollte. Er<br />
hatte es geschafft, alle, die mit ihm auf Deutsch reden wollten, zu langweilen und abzuwimmeln.<br />
Ich suchte ihn in seinem Block auf, setzte mich auf einen Hocker und, während er mir - wie<br />
zweimal im Monat üblich - den Bart rasierte, beschrieb ich ihm die Lage in Frankreich vor der<br />
87
Landung. Er war höchst erstaunt, als ich ihm präzise, aus dem Gedächtnis den Verlauf der<br />
gesamten Ostfront, von Leningrad bis zu den Karpaten beschrieb. Unser Barbier war niemand<br />
weniger als General Pavlov, der im Herbst 1942 während der Schlacht zu Stalingrad gefangen<br />
genommen worden war. Warmherzig bedankte er sich, versicherte mir, dass Deutschland ganz<br />
gewiss besiegt werden sollte, wenn auch erst im Frühjahr 1945. Somit hatte er mir die Perspektive<br />
auf einen ganzen Winter im Lager Flossenbürg eröffnet!<br />
Der Rhythmus dieses routinemäßigen Lebens, auf Dauer erschöpfend und für manche tödlich,<br />
wurde am 3. August 1944 durch ein abscheuliches, von der SS sorgfältig inszeniertes Ereignis<br />
unterbrochen. Bereits am Vorabend war das Gerücht eines allgemeinen Appells am frühen<br />
Morgen durch die Blocks gegangen. Das konnte nichts Gutes bedeuten! In der Tat, gegen<br />
halbsechs morgens schallte der Befehl zum Antreten auf den Appellplatz. Die Mannschaften der<br />
letzten Blocks, also auch des unseren, schnellten als erste die Treppe hinunter, um sich vor den<br />
Blocks mit den niedrigen Nummern auf der schmalen Seiten des Appellplatzes aufzustellen. Die<br />
Männer aus den anderen Blocks gruppierten sich in geschlossenen Reihen auf der mittleren und<br />
hinteren, der längsten Seite des Platzes, bis zwischen Küchen- und Desinfektionsgebäuden. Ich<br />
befand mich in der zweiten Reihe und vor mir, auf etwa dreißig Meter, stand Abt Louis Poutrain<br />
in der ersten Reihe. Der Holzpfahl des Platzes, etwa dreißig Meter vor uns, war an dem Morgen<br />
auf einer Höhe von etwa drei Meter mit einem Stahlhaken und daran einem Strick mit Schlinge<br />
versehen worden. Darunter stand auf einem Tisch ein Schemel. Die Vorrichtung für eine<br />
Hinrichtung durch den Strang war vollständig.<br />
Neben dem Tisch hatte sich der Scharführer aufgestellt. Als alle Häftlinge auf den Zentimeter<br />
genau in Reih und Glied standen - das dauerte nur zwei bis drei Minuten - schallten seine Befehle:<br />
“Häftlinge, stillgestanden!“ - “Achtung, Mützen ab!“. Sechs- bis siebentausend kahlrasierte<br />
Männer standen stramm. In dem Augenblick kam Obersturmführer Baumgarten aus dem Block 1,<br />
überblickte die Reihen, holte einen Zettel aus der Tasche und rief den Führer des Blocks 17 zu sich.<br />
Ich konnte nicht hören, was er ihm sagte, aber der Blockführer ging zurück zu seiner Mannschaft,<br />
holte einen russischen Gefangenen aus den Reihen und führte ihn am Arm vor den<br />
Obersturmführer. Der Russe war unheimlich mager, sein Drillichanzug flatterte um ihn herum.<br />
Seine Augen waren tief in die Höhlen zurückgefallen. Seine Haut war fahl gelb. Er ging mit<br />
gekrümmten Rücken, ohne Fessel, den Essnapf am Gurt. Baumgartner warf ihm einen<br />
verächtlichen Blick zu, faltete sein Blatt Papier auseinander und las vor: «Häftling soundso (den<br />
Namen verstand ich nicht), geboren am… - die Gebärden des Offiziers zeigten den Unsinn einer<br />
weiteren Angabe der Personalien - ist wegen Flucht und Einbruchdiebstahl zum Tode durch den<br />
Strang verurteilt; vorher sind ihm fünfzig Schläge mit dem Stock zuzufügen.». Der Russe sagte<br />
kein Wort, schnallte seinen Essnapf vom Gurt und warf ihn auf den Boden, um deutlich zu zeigen,<br />
dass er sich nicht mehr ums Essen zu sorgen brauchte. Der Älteste unter den Häftlingen,<br />
Lagerältester Uhl, und einer der grünen Kapos, beide zum Henker ernannt, schleppten ihn zum<br />
Peitschblock und legten ihn hin, im geraden Winkel, mit dem Gesäß nach oben. Zwei russische<br />
Häftlinge standen mit dem Knüppel bereit, schlugen von beiden Seiten auf den Verurteilten ein.<br />
Unter den ersten Schlägen fing der Verprügelte an, laut in seiner Sprache zu schreien. Mir wurde<br />
nachher gesagt, dass er flehte, nicht weiter geschlagen, sondern sofort getötet zu werden. Ab den<br />
ersten Schreien hauten die beiden “Freiwilligen“, denen eine zusätzliche Ration Suppe<br />
zugesprochen wurde, mit immer weniger Überzeugung. Als er das merkte, befahl der wütende<br />
Baumgartner den Gefolterten vom Block zu holen und zum Galgen zu führen. Die beiden Henker<br />
hoben ihn auf den Tisch, dann auf den Schemel. Einer legte ihm die Schlinge um den Hals und<br />
rückte plötzlich den Schemel unter ihm weg. Der Körper fiel herunter, der Strang spannte sich. In<br />
der Zwischenzeit, in weniger als zwanzig Sekunden, ließ Baumgartner einige andere Kapos rufen<br />
und befahl ihnen, während der Gehängte noch mit dem Tod kämpfte, die zwei Freiwilligen<br />
nacheinander auf den Peitschblock zu legen und ihnen die restlichen Schläge, von denen der<br />
Verurteilte verschont geblieben war, diesmal kräftig auszuteilen. Während die dumpfen Laute der<br />
Schläge und der Schlagenden zu hören waren, ließ der Obersturmführer den russischen<br />
Dolmetscher zu sich rufen und befahl, für alle anderen zu übersetzen, dass ab sofort alle, die einen<br />
Prügelbefehl zu sabotieren wagen sollten, mit der doppelten Zahl der von ihnen simulierten<br />
Schläge rechnen konnten. Der Gehängte war noch im Todeskampf. Nach zwei oder drei Minuten<br />
ging ein Beben durch den Körper, die Knie wurden bis zum Gurt hochgezogen, fielen dann wieder<br />
herunter. Es war vollbracht. Wir standen immer noch mit entblößtem Haupt in Hab-Acht-Stellung.<br />
88
Der kleine Halunke-Kapo vom Duschraum stand vor mir in der ersten Reihe und machte sich mit<br />
Worten und Gebärden über den Ablauf des Todeskampfes lustig, zweifellos um vor Baumgartner<br />
gut abzuschneiden, und gab anzügliche Bemerkungen über den sexuellen Spasmus des Gehängten<br />
von sich. Ich schaute auf Abt Poutrain schräg vor mir. Sein Gesicht war ausdruckslos, zeigte<br />
keinerlei Emotion. Ich brauchte nicht zu fragen, ich war mir sicher, dass er betete. Auch ich hatte<br />
seit Anfang dieser makaberen Inszenierung gebeten, ohne dabei irgendwelche Emotionen zu<br />
empfinden. Die Erinnerung an diese Horrorszene prägte sich feste in mein Gedächtnis. Um mich<br />
herum machten sich unterschiedliche Reaktionen bemerkbar. Einige zeigten sich niedergeschlagen<br />
, andere hoben sich auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können. Im Nachhinein sollte ich<br />
feststellen können, dass diejenigen, die das Schauspiel des Todes nicht hatten verkraften können,<br />
in den darauffolgenden Wochen dem Tod zum Opfer fielen. Genau auf diesen Terroreffekt zielte<br />
die SS ab. Die beiden verprügelten Russen wurden brutal zu ihren Plätzen in den Reihen<br />
zurückgeschickt, gingen schwer stöhnend an meiner Reihe vorbei, die Hände auf dem Gesäß, das<br />
Gesicht geschwollen. Ihre zusätzliche Ration konnten sie vergessen.<br />
Das Drama, vom ersten Befehl zur Hab-Acht-Stellung des Scharführers Kubler bis zum letzten<br />
“Mützen auf! An die Arbeit“, hatte knapp zehn Minuten gedauert. Es war der Kapo unserer<br />
Gruppe, Bauer, der der Mannschaft den Befehl zum Aufmarsch zur Werkstatt erteilte.<br />
Durchhalten, weiter… mit dem Horrorbild vor Augen. Jeder Tag ist gleichzeitig auch ein Tag<br />
weniger, ein Tag näher an der Zeit, in der wir der Welt draußen über das Leben hier drinnen<br />
berichten werden, dachte ich mir. Oder wollten sie vielleicht alle umbringen, damit keine Zeugen<br />
über das Entsetzliche berichten könnten? Sie waren dazu in der Lage, hatten die Mittel, die letzten<br />
Überlebenden zu ermorden, bloß um sich davon machen zu können, wenn sich die Niederlage als<br />
unvermeidlich zeigen sollte. Dann konnte keiner dem Schwur Kirrmanns nachkommen. Während<br />
mehrerer Tage ging mir das nach, wurde ich von der Ungewissheit gequält. Es fiel mir schwer,<br />
wieder Mut und Hoffnung zu fassen.<br />
Endlich, um den 10. August 1944, traf eine erquickende Nachricht ein: ein deutscher Häftling<br />
unseres Blocks, der vor dem Krieg in Frankreich gefasst worden war und ziemlich gut Französisch<br />
sprach, hatte von seinem deutschen Vorarbeiter, einem Zivilisten, erfahren, dass die Front in der<br />
Normandie endgültig durchbrochen war und die Truppen schnell nach Paris aufrückten. Erst<br />
Anfangs September wurde uns die Evakuierung der deutschen Truppen und die Befreiung Paris<br />
durch die Alliierten bestätigt. An der Ostfront war der russische Angriff vom Juni 1944 bis vor<br />
Warschau vorgestoßen. In der polnischen Hauptstadt wütete der Aufstand. In den folgenden<br />
Tagen und Wochen trafen mehrere hunderte polnische Gefangene ein. Sie erzählten uns, dass nach<br />
nur einigen Tagen aussichtsloser Gefechte - Waffen und Munition hatten nicht ausgereicht -<br />
Warschau geplündert und mit Sprengstoff vernichtet worden war. Angeblich sollte Pavlov Recht<br />
behalten, indem er das Ende des Kriegs erst für den Frühling 1945 vorausgesagt hatte.<br />
Das schreckliche Leben im Lager Flossenbürg ging jedoch weiter, ohne dass der Ablauf und die<br />
Organisation auf irgendeine Art und Weise von den Niederlagen der deutschen Truppen an allen<br />
Fronten beeinträchtigt wurden. Der Sommer neigte sich dem Ende zu, die Bedingungen wurden<br />
allmählich schwerer, bedrohlicher. Obwohl wir fast alle in den Produktionsstätten arbeiteten,<br />
unter Dach und von den systematischen Schlägereien verschont, hatten wir schwer unter dem<br />
Nahrungsmangel zu leiden. Die einseitige, unausgeglichene Ernährung höhlte den von der Arbeit<br />
abgeschwächten Körper langsam aus. Wassersucht, Durchfall, zusätzliche Wundinfektionen mit<br />
Eiterbeulen und Phlegmonen waren für viele - aufgrund des Fehlens geeigneter Versorgung - die<br />
Vorzeichen des Todes. Hervé, ein junger Seminarist, kämpfte mit dem Mut der Verzweiflung<br />
gegen seine Tuberkulose. Ich erinnere mich noch an Gireaudeaux, Bürgermeister von Alfortville,<br />
einen großen und kräftigen Mann von etwa vierzig, der eines Tages sagte: «Wenn ich gewusst<br />
hätte, dass es so hart werden sollte, wäre ich nie in die Résistance gegangen!». Einige Tage später<br />
starb er im Außenkommando. Der kleine Lacombe, ebenfalls Student in Clermont-Ferrand und bei<br />
der allgemeinen Razzia im März 1944 nach dem Poterne-Attentat aufgegriffen, war überhaupt<br />
nicht auf diesen Horror vorbereitet und war wörtlich zusammengebrochen. Ihm fehlte die Kraft,<br />
sich aufrecht zu halten. Nach einigen Tagen entließ Schmitz ihn aus dem “Revier“, unter dem<br />
Vorwand, dass er an keinerlei Krankheit litt. Am dritten Septembersonntag war er, kreideweiß wie<br />
ausgeblutet, an den Holzbrettern der Baracke zusammengebrochen. Zusammen mit dem Schreiber<br />
der Blocks hob ich ihn hoch und wir trugen ihn bis unten bei der Treppe zum Revier. Trotz aller<br />
Bemühungen und Erklärungen des Schreibers wurde ihm der Zutritt verweigert. Schmitz hatte<br />
89
jeden Zutritt während seiner Abwesenheit untersagt. Zusammen brachten wir ihn zum Block 7.<br />
Erst anderntags kam er aufs Revier. Ich war der letzte, der ihm noch einige tröstende Wörter sagen<br />
konnte. Er starb noch in derselben Woche.<br />
Abt Poutrain fand noch die Kraft, sich von uns zu verabschieden. Er sollte in ein<br />
Außenkommando zum Holzfällen versetzt werden. Dank und aufgrund seiner Unverdorbenheit<br />
bereitete ihm die Aussicht auf die Arbeit neuen Mut, denn - so glaubte er - es würde wie in den<br />
Wäldern seiner Heimat Haut-Drac sein. Er hatte überhaupt keine Ahnung vom Sträflingsleben,<br />
das ihm bevorstand und es war ein wahres Wunder, dass er noch am Leben war, dass um den 10.<br />
Mai 1945 ein anderer, inzwischen befreiter französischer Häftling, Abt Garronne, ihn total<br />
erschöpft, an einem Baumstrunk zusammengebrochen, finden sollte. Er schaffte es, während viele<br />
andere den Winter 1945 nicht überlebten. Ich kann sie hier nicht alle nennen, möchte jedoch an sie<br />
erinnern.<br />
Am 26. September 1944 sorgte ein weiteres Drama für Entsetzen. Am Vortag, nach der<br />
Brotverteilung befahl der Blockvorsteher dem Pfeifenkopf Gressel, er sollte uns sofort zu den<br />
Schlafstellen befördern, um für die Zeremonie des nächsten Tages fit zu sein. Um halbsechs<br />
morgens - es war wie am vorigen 3. August - standen Tausende Häftlinge wieder in Reih und<br />
Glied auf dem Appellplatz. Diesmal stand ich weiter hinten, auf etwa vierzig Meter vom Galgen,<br />
aber durch die Reihen durch konnte ich die Exekutionsstelle erblicken. Der Verurteilte, wieder ein<br />
Russe, war bereits zur Stelle. Sein Drillichanzug, blau-weiß gestreift, schien wie neu.<br />
Möglicherweise war er verletzt oder gefoltert worden, denn sein linker Unterarm war mit weißem<br />
Stoff verbunden. Baumgartner holte seinen Zettel heraus, um das Urteil vorzulesen. Solche Urteile<br />
wurden von einem Scheingericht des SS-Zentraldienstes in Berlin gesprochen und die Kapos<br />
bestätigten immer wieder, dass die Betroffenen “regelrecht“ gerichtet und verurteilt wurden. Ich<br />
konnte nicht hören, was Baumgartner vorlas, rechnete aber damit, dass der Verurteilte auch<br />
diesmal auf den Block gelegt werden sollte. Es lief anders. Kaum hatte Baumgartner mit dem<br />
Vorlesen des Urteils angesetzt, als der Russe den Kopf drehte und den Offizier unterbrach, indem<br />
er irgendeinen Protest äußerte. Baumgartner gab ein Zeichen, den Befehl zur Vollstreckung, als<br />
wollte er sagen: Na gut, wenn er mich unterbricht, dann soll er eben hängen. Der Russe wurde auf<br />
den Schemel gehoben, die Schlinge wurde ihm um den Hals gelegt. Ich war auf das plötzliche<br />
Wegrücken des Schemels gefasst, doch der Henker zog nun behutsam den Schemel weg, sodass<br />
der Körper langsam herunter sank. Die gesunde Hand des Russen ballte sich zur Faust. Später<br />
erzählten mir die Männer aus den vorderen Reihen, dass Baumgartner, wütend und pikiert von<br />
der Widerrede und dem Mut des Russen, befohlen hatte: «Schemel langsam weg!».<br />
Dementsprechend hatte der Gehängte nicht das Bewusstsein verloren, wie es sonst durch den<br />
Schock des fallenden Körpers geschah, sondern war wie mit einem Knebel, beim vollen<br />
Bewusstsein, erwürgt worden. Das war nicht das letzte Verbrechen, nicht der letzte Mord des<br />
Obersturmführers und Lageradjudanten Baumgartner, der sich durch sinnlose Grausamkeiten<br />
auszuzeichnen wusste. Drei Monate später sollte er eine weitere Kostprobe vorführen, inzwischen<br />
in die Annalen der KZ-Geschichte eingegangen.<br />
Weihnachtszeit 1944. Der Weihnachtsbaum war aufgestellt. Zur Feier der Ardenner<br />
Gegenoffensive unter von Rundstedt genossen wir eine Sonderbehandlung: anstatt der üblichen<br />
Brühe bekamen alle einen Essnapf mit Nudeln und… Fleischbröckchen, während sechs Häftlinge,<br />
unter ihnen zwei Deutsche, ohne Generalappell gehängt wurden. Diesmal war ich nicht Zeuge.<br />
Das gesamte Lager genoss eine Sonderruhe und ich war in einer Gruppe eingebunden, die dazu<br />
verpflichtet wurde, im Desinfektionsblock das “Weihnachtskonzert“ des Häftlingsorchesters<br />
beizuwohnen. Im Nachhinein, als ich im Kommando Altenhammer, unterhalb des Dorfes<br />
Flossenbürg arbeitete, berichtete mir ein österreichischer politischer Häftling, der zur Hilfe bei der<br />
Vollstreckung des Todesurteils gezwungen wurde folgendes. Als er merkte, dass einer der<br />
Verurteilten, ein Deutscher, anfing zu weinen, ging Baumgartner auf ihn zu, beschimpfte ihn als<br />
Feigling und schlug mit seiner Peitsche auf ihn ein, bevor er ihn zum Galgen hochheben ließ.<br />
Trotz intensiver Ermittlungen - auch ich habe ihn gesucht - wurde Baumgartner nie gefunden, nie<br />
bedroht. Ich sah ihn zum letzten Mal am frühen Morgen des 20. April 1945, als ich mit der letzten<br />
Gruppe Häftlinge aus dem Lager Flossenbürg zum Lager Dachau evakuiert wurde. Während<br />
dieses Todesmarsches sollten über achthundert Häftlinge auf der Strecke erschossen werden.<br />
Baumgartner, vom gesamten Verlauf der Auftragsabwicklung sichtbar verärgert, stand beim<br />
90
Zählstand vor dem “Jourhaus“, heftig gestikulierend: «Los! los!». Erst später, nach der Befreiung<br />
wieder in Frankreich, erfuhr ich den genauen Grund seiner Wut.<br />
Der Arzt-Chirurg der Krankenpflegestation, Schmitz, war ein halb Verrückter. Er war für<br />
erhebliche Ausschreitungen verantwortlich, worauf ich hier nicht weiter eingehen möchte. Im<br />
November 1947 wurde er vor einem amerikanischen Kriegsgericht zum Tode verurteilt und als<br />
letzter Verurteilter einer Reihe Gerichtsverfahren im März 1948 exekutiert. Als im März 1945 der<br />
Typhus im Lager Flossenbürg wütete, wurde auch Schmitz befallen. Sein Nachfolger namens<br />
Adam, ein Wehrmachtsarzt, zeigte sich durch ein korrektes Verhalten aus. Der grüne Kapo des<br />
Reviers, Karl Schrade - mit doppelter deutsch-schweizer Nationalität - , obwohl Häftling des<br />
Gemeinrechts, stellte eine Ausnahme dar. Nie hatte man ihn einen Häftling schlagen gesehen. Er<br />
wurde bereits 1934 im Armenviertel von Berlin verhaftet, überlebte das Lager Osterwege, machte<br />
einen Transit über Buchenwald und war einer der “Ältesten“ in Flossenbürg. Unser Kamerad,<br />
Alain Legeais, Militärarzt, stand seit Juni 1944 als Krankenpfleger an seiner Seite und zwischen<br />
den beiden hatte sich eine Freundschaft angebahnt. Karl informiert Alain über alle von ihm<br />
erfahrenen Entscheidungen der SS und letzterer, mittlerweile auch mein Freund, gab sie mir<br />
weiter, soweit es ihm gelang. Ich war entsetzt als ich hörte, dass Kubler auf freiem Fuß war und<br />
auf einfache Vorladung vor dem Gericht erschien. Die Anklage erwähnte nur seine Mittäterschaft<br />
bei einem einzigen, einfachen Mord. Als ich zum Aussagen an die Reihe kam, meinte sein<br />
Verteidiger, den Freispruch bereits in der Tasche zu haben, und legte lässig mit seinen Fragen los.<br />
Seine Überheblichkeit war für mich ein zusätzlicher Grund, ihm den Zahn zu ziehen, indem ich<br />
die Moral dieses Individuums schilderte, unter anderem seine Beteiligung an den<br />
Leibesdurchsuchungen und Hinrichtungen durch den Strang. Kubler kam mit fünf Jahren Haft<br />
davon. In der Folge bat ich um einen Termin beim Untersuchungsrichter zu Weiden, um meine<br />
Klage zulasten von Baumgartner zu wiederholen, nach einer ersten Klage 1947 vor dem<br />
amerikanischen Gericht. Da wurde mir klar, dass der 1948 entfesselte Kalte Krieg die<br />
westdeutsche Gerichtsmaschinerie zur Ermittlung gegen Kriegsverbrecher völlig lahmgelegt hatte.<br />
Der Untersuchungsrichter empfing mich, teilte mir mit, sich völlig sicher zu sein, dass<br />
Baumgartner noch am Leben war, denn - so erklärte mir Herr Salze - er hatte sich 1951 noch in der<br />
Gegend aufgehalten, seine Frau hatte damals das dritte Kind von ihm bekommen. Das bedeutete,<br />
dass wenn man nur gewollt hätte… Allein war ich hilflos. In 1964 und 19675 war ich wieder vor<br />
Ort und aus den Gesprächen mit den Einheimischen konnte ich schließen, dass ein ehemaliger SS<br />
dann und wann in die Ortschaft kam und in den Wirtschaften schon mal fallen ließ, dass es im<br />
Lager nur Verbrecher gegeben hatte. Auch Simon Wiesenthal im Dokumentationszentrum in Wien<br />
schrieb ich damals. Er antwortete, dass das Verfahren gegen Baumgartner bei der Zentralen<br />
Bundesbehörde in Stuttgart - oder Karlsruhe, ich weiß nicht mehr genau - eingetragen war. Eine<br />
Begegnung mit meinem Freund Giesecke in Weiden 1957 klärte mich über den Grund für das<br />
Fehlen des Lagerkommandanten Koegel bei den Kriegsprozessen in 1947 auf. Koegel hatte ich<br />
zum letzten Mal, nicht am 20. April 1945 zusammen mit Baumgartner bei der Evakuierung des<br />
Lagers, sondern am darauffolgenden Tag, am 21. April, während des Marsches nach Dachau<br />
gesehen. Er überwachte die Verlegung der Mannschaften und begleitete im offenen Fahrzeug eine<br />
Kolonne, die an uns vorbeimarschierte, nachdem wir auf einer Wiese neben der Straße halt<br />
gemacht hatten. Gerhard Giesecke erklärte mir, dass das “Kaderpersonal“ einige Tage später, vor<br />
dem Aufmarsch der Amerikaner auseinander gegangen war und Koegel in der Gegend eine<br />
Beschäftigung als Bauernknecht mit der falschen Identität “Giesecke“ (!) gefunden hatte. Es gelang<br />
ihm, über ein Jahr unterzutauchen, bis ein ehemaliger deutscher politischer Häftling des Lagers<br />
Flossenbürg ihn wiedererkannte und nicht locker ließ, bis er von der örtlichen Polizei gefasst<br />
wurde, die die amerikanische Militärpolizei benachrichtigte. Bis die Amerikaner ihn anderntags<br />
abholen sollten, wurde Koegel auf dem Polizeirevier eingesperrt und als die MP vor Ort eintraf,<br />
um den großen Fang zu übernehmen, konnten sie nur noch feststellen, dass es Koegel, ohne<br />
Bewachung gelassen, gelungen war, sich zu erhängen.<br />
Die zweite öffentliche Hinrichtung des 26. Septembers hatte unsere Angst und Beklommenheit<br />
um ein mehrfaches gesteigert, die Hoffnung aufs Überleben noch etwas mehr verringert. Mit dem<br />
Monat Oktober machte auch der Herbst seinen Einbruch. In jener Region der “Steinpfalz“, bekannt<br />
für ihr raues Klima, war der Herbst 1944 mit viel Sonnenschein außergewöhnlich mild wie ein<br />
Altweibersommer. Seit meiner Verhaftung war fast ein Jahr vergangen. Im Lauf des Sommers<br />
hatte ich - wie einige andere Kameraden - eine Art “Adaptationsgleichgewicht“ erreicht, trotz des<br />
unabwendbaren Verschwindens meiner Kräfte, trotz des schrecklichen, andauernden Nagens des<br />
91
wahren Hungers, ein ganz anderes Gefühl als der gelegentliche “Riesenappetit“. Und wieder hatte<br />
ich Glück! Am 10. Oktober kam Kapo Bauer auf mich zu: «Du hast dich nun fast sechs Monate<br />
lang an dieser Nietenmaschine herumgequält. Ein anderer wird dich ersetzen. Geh zum Russen<br />
auf die Galerie. Er zeigt dir, was zu tun ist.» Es war in der großen Halle Nr. 6, unterhalb von und<br />
parallel an unserer Werkstatt, neben einem großen Ofen, in dem wir alle Reste verbrannten und<br />
unsere Essnäpfe wärmten. Mit einem leichten breitköpfigen Hammer und etwas Geschick wurden<br />
die Lamellen aus Duralumin, Längsstreben für die Flügel der Messerschmitt Me 109, gerichtet.<br />
Mehrere Meter lang, in mehreren Abschnitten in einem geraden Winkel gebogen, waren diese<br />
Lamellen in die eine oder andere Richtung verbogen. Ein gut dosierter Schlag mit dem Hammer,<br />
progressiv über die gesamte Länge, reichte, um sie wieder gerade zu richten, sodass das<br />
Montieren und Verschrauben einfacher verlief. Der Russe merkte sofort, dass ich ein Händchen<br />
dafür hatte und fast instinktiv den richtigen Schlag versetzte. Eine ruhige, schonende Arbeit,<br />
während deren ich ungestört nachdenken konnte. Dann und wann bekam ich die Gelegenheit mit<br />
den beiden Brüdern Knoll-Demars, meinen ehemaligen Zellgenossen im 109 zu Clermont, zu<br />
plaudern. (Jehan, der Ältere von beiden, ist heute über achtzig.) Die beiden, der eine dem anderen<br />
gegenüber sitzend, kontrollierten irgendwelche Schrauben auf ihre Festigkeit. Dank ihrer<br />
Freundschaft zu Karl Schrade, Kapo im Revier, hatten sie, nach Vermittlung von Schrade beim<br />
Kapo Heinrich Bauer, diesen Posten bekommen.<br />
Die Gedanke, einen Winter unter den im Lager Flossenbürg herrschenden Bedingungen<br />
durchhalten zu müssen, beschäftigte mich sehr, bis zu Besessenheit. Ich hatte bereits den Sommer<br />
als sehr schlimm empfunden. Dabei überlegte ich, dass der Konvoi mit siebenhundert Franzosen,<br />
der vor dem unseren am 25. Februar 1944, mitten im Winter eingetroffen war, einen Verlust von<br />
fünfundachtzig Prozent einzubüßen hatte, über nur eine Winterhälfte. Wie würde es uns gehen?!<br />
Fast alle russischen Deportierten, die die Hälfte des Lagers ausmachten und unter denen ich<br />
bereits zahlreiche gute Kameraden zählte, wiederholten mir ständig in diesem deutsch-russischen<br />
Flossenbürger Pidgin: «Szernsat stiri Krieg nix kaputt, szernsat piatch Krieg kaputt!» (Krieg nicht<br />
aus in 1944, Krieg aus in 1945). Es wäre utopisch gewesen, mit einem innerdeutschen<br />
Zusammenbruch der Front wie in 1918 zu rechnen. Die Nazi-Diktatur war dafür zu<br />
durchstrukturiert und -organisiert und sie verfügte über Tausende von Arbeitern, die ausgebeutet<br />
und als Geiseln gehalten wurden. Ich kam zu der Überzeugung, dass sie diesmal nur Schritt für<br />
Schritt weichen würden, bei jedem Fluss weiterkämpfen, bis zur vollständigen, absoluten und<br />
selbstzerstörerischen Vernichtung, bis zur bedingungslosen Kapitulation, und eine<br />
Ruinenlandschaft hinter sich lassen würden. Was mir letztendlich die Gewissheit über den Tod als<br />
Ende unseres Schicksals brachte, war die Überzeugung, zu der ich bereits lange vorher gekommen<br />
war, dass die Verwalter dieses Regimes keinerlei Spuren hinterlassen würden, keine Archive,<br />
keine Zeugen, die den Beweis für das Abscheuliche der Konzentrationslager vorlegen könnten.<br />
Wenn sie alles durch und durch organisiert hatten, dann sicherlich auch die Vernichtung des<br />
Systems, um sich letztendlich selbst auszulöschen. Sie würden uns alle töten.<br />
Die Schärfe meiner Analyse hatte mir einen Schrecken versetzt. Ich hatte mir selbst nichts<br />
vorgemacht, keine falsche Hoffnung aufkommen lassen. Ich konnte nur noch beten, wie ich schon<br />
seit längerer Zeit tat. Beten bot mir die Möglichkeit, eine Denkpause einzulegen, eine Weile<br />
abzuschalten. Jede schmerzliche Gebärde war zu Gebet geworden. Durch Beten konnte ich mich<br />
beruhigen, langsam, allmählich ruhiger und ruhiger… Ich lernte, gelassen zu meditieren. Die<br />
einfache Arbeit, einsam und ungestört, fast gemütlich, half mir dabei.<br />
Es überkam mich Mitte Oktober, als ich beim fast automatischen Schaffen in der Meditation<br />
versunken war. Ich fühlte mich wie von einem Schutzmantel umhüllt und nahm eine Stimme<br />
wahr, eine gleichzeitig kräftig schallende und dennoch zarte Stimme: «Habe keine Angst, ich bin<br />
da!» Kurz wie ein Blitz kam mir das Antlitz Christus vor Augen, wie auf den frommen Bildern<br />
dargestellt. Es war unnötig und sinnlos, den Blick auf die Galerie zu richten, von wo die Stimme<br />
zu kommen schien, denn es war mir klar, dass ich sein Antlitz nicht sehen würde, nicht sehen<br />
konnte. Er hatte mir seinen heiligen Geist geschickt. Ich arbeitete gelassen weiter, hämmerte<br />
unerschütterlich mit meinem Hämmerchen auf die Aluminiumlamellen. Er war noch da. Noch<br />
einmal wiederholte er: «Ich bin da!». Es schien mir ganz normal. Er hatte keineswegs<br />
vorhergesagt, dass ich lebendig davon kommen sollte. Er hatte mir nur gesagt, mich nicht zu<br />
fürchten, mir keine Sorgen zu machen.<br />
92
Über mehr als vierzig Jahre habe ich diese Offenbarung im Tiefsten meines Selbst aufbewahrt.<br />
Nicht dass ich Angst gehabt hätte, verspottet zu werden, sondern weil ich diese Gnade als<br />
einzigartigen Bestandteil meiner spirituellen Intimität betrachtete. Überdies bin ich genau das<br />
Gegenstück zu einer kontemplativen Natur und ich war und bin immer von meiner Unfähigkeit,<br />
eine Botschaft - die Botschaft - zu vermitteln, überzeugt. Sogar in den Nachkriegsjahren hielt ich<br />
mich gegenüber Abt Poutrain zurück, denn ich befürchtete, dass seine glänzende<br />
Unverdorbenheit - die er bereits beim Zwischenfall bezüglich der Gaskammern in Auschwitz<br />
gezeigt hatte - ein solches Geständnis meinerseits ohne die erforderliche Strenge akzeptiert hätte.<br />
Von Skrupeln befangen fragte ich mich jedoch, ob ich das Recht hatte, zu schweigen, ob nicht jeder<br />
Gläubige die Pflicht hätte, jeder nach seiner Fähigkeiten - wie gering sie auch sein möchten - den<br />
Glauben den Anderen um sich weiterzugeben, ohne ihn aufzudrängen.<br />
Im Lauf der Jahre hatte es mich immer mehr bedrückt, dass die Menschheit die Erinnerung an<br />
diese Epoche ihrer Geschichte allmählich aus ihrem Gedächtnis verdrängte. Wenn man es<br />
vernachlässigt, die Vergangenheit von gestern zu erforschen, wird es einem schwer fallen, das<br />
Geschehen von morgen zu begreifen. Der Geschichtsunterricht der jüngeren Generationen wird<br />
von unseren modernen Gesellschaften mehr und mehr, zum Vorteil der neuen exakten<br />
Wissenschaften vernachlässigt. Schlimmer noch: es ist so weit gekommen, dass Thesen und<br />
Hypothesen vorgetragen werden, anhand deren die Realität des Holocausts, der Gaskammern, der<br />
Vernichtungslager widerlegt werden. Demzufolge reifte in mir die Idee, wurde allmählich zu<br />
einem Pflichtgefühl, meine eigenen Erfahrungen und Gegebenheiten, als Beitrag zum<br />
Geschichtswissen, niederzuschreiben und sie meinen Zeitgenossen weiterzugeben. Konnte, sollte<br />
ich in diesem Bericht das, was für mich zu Wesentlichem geworden war, übergehen? Sollte ich<br />
über das Gefühl, Gott an meiner Seite zu haben, schweigen? Sollte ich diese Erfahrung wie ein<br />
Geheimnis für mich behalten? Dieses Dilemma quälte mich, erstarrte mich. Ich fühlte mich hilflos,<br />
unfähig dieses Problem allein zu lösen. Wer könnte mir helfen? Und dann, eines Tages fand ic h<br />
den Weg, ohne ihn wirklich zu suchen. Seit fast zwanzig Jahren kannte ich Jean-Marie Lustiger.<br />
Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre war er Pastor der Kirchengemeinde Sainte-<br />
Jeanne-de-Chantal zu Auteuil, ein Katzensprung von meinem damaligen Wohnsitz entfernt. Das<br />
wusste ich noch nicht, als ich damals an einem Abend in der Adventszeit mit einem Paket für die<br />
Bedürftigen der Kirchengemeinde zum Pfarramt zog. Pfarrer Lustiger nahm mein Paket dankend<br />
entgegen und nach einem ersten Wortwechsel begleitete er mich in sein Arbeitszimmer, um dort<br />
das Gespräch in aller Ruhe weiterzuführen. Dieser erste Kontakt war sehr fruchtbar und der erste<br />
einer längeren Folge. Öfters kam er zu uns - wir wohnten an der anderen Seite der Allee - allein<br />
oder vor einem seiner Priester begleitet, und teilte mit uns das von meiner Frau gerichtete Diner.<br />
Bis er Bischof von Paris wurde, folgte ich sein Curriculum aus der Entfernung. In Paris nahm ich<br />
mehrmals an den von ihm organisierten und geführten Treffen der verschiedenen Pfarrämter teil.<br />
In der Zeit wurde meine Achtung vor ihm immer größer, sodass ich ihn 1988 um eine<br />
Unterredung bat, ohne dabei den Grund zu nennen. Ich erklärte ihm meine Besorgnis, ich<br />
versuchte, ihm meine Erfahrung der göttlichen Gnade von damals zu schildern. Ganz ernst hörte<br />
er mir zu. Ich spürte, dass er mir Glauben schenkte. Das Gespräch dauerte länger als erwartet. Als<br />
ich auf seine Frage antwortete, dass er - nach mehr als vierzig Jahren Schweigen - als erster von<br />
diesem übernatürlichen Erlebnis erfuhr, bestand er ohne Zögern darauf, dass ich mich endgültig<br />
befreien und über diese Offenbarung berichten sollte. Ich musste es ihm versprechen. Er empfiehl<br />
mir, die wichtigsten Abschnitte und Ereignisse meiner Kriegsjahre niederzuschreiben oder zu<br />
diktieren. Als ich es ihm versprach, fühlte ich mich erleichtert, von der Ungewissheit über ein<br />
angepasstes Verhalten befreit. Es blieb mir “nur“ noch einen Anfang zu machen und das war für<br />
mich, einen normalen Menschen, dem nicht ganz normale Dinge geschehen waren, nicht so<br />
einfach, umso mehr da ich mich mit Schreiben und Stil überhaupt nicht auskannte. Ich konnte nur<br />
beten und den Versuch einfach wagen. Es war langwierig, denn angeblich war ich nur zum<br />
Kritzeln befähigt. Es fiel mir schwer, jedoch nicht an den Stellen, wo ich es erwartet hatte, nicht<br />
beim Aufsatz und bei den Formulierungen, sondern als es darum ging, gewisse Erinnerungen<br />
aufzurufen, fühlte ich mich am meisten bedrückt, spürte ich den größten Schmerz. Bereits am<br />
Anfang meiner Niederschrift, bei den Passagen über die ersten Stunden der Kriegsgefangenschaft<br />
erfuhr ich zum zweiten Mal das tiefe Gefühl der Scham wie damals, als wir Häftlinge unter den<br />
Blicken der Bevölkerung wie eine Herde Vieh zur ersten Sammelstelle zusammengetrieben<br />
worden waren. An dieser Stelle meines Berichts kam ich vorerst nicht weiter und es verging eine<br />
lange Zeit, bevor ich wieder mit dem Schreiben anfing.<br />
93
Am einfachsten war die Überschrift. Der Eindruck, den Albert Kirrmann damals im Gefängnis zu<br />
Clermont hinterlassen hatte, hatte eindeutig und maßgeblich unser weiteres Verhalten in den<br />
Lagern geprägt. Ich entschied mich, meinen Bericht dem Gedenken an Marcel Callo zu widmen.<br />
Bereits 1987 hatte ich von der Seligsprechung dieses jungen jocistischen Militanten erfahren. Ende<br />
des Winters 1945, am 19. März, war er im Kommando Gußen zu Mauthausen, dem<br />
mörderischsten Kommando dieses KZ mit Flossenbürg vergleichbar, grausam umgekommen. Ein<br />
Artikel in “Le Monde“ anlässlich der päpstlichen Beatifikation erwähnte, dass Marcel Callo Mitte<br />
Oktober, vor seiner Verlegung nach Mauthausen, in Flossenbürg eingesperrt worden war. Er<br />
befand sich also in meiner Nähe, als die Gottesbotschaft mich damals erreichte. Zweifellos hatte er<br />
es besser als ich verstanden, zu beten und seinen Glauben zu leben. Je mehr ich darüber<br />
nachdenke, um so stärker werde ich davon überzeugt, dass dank Marcel Callo damals der Heilige<br />
Geist über Flossenbürg wehte und dass es ihm zu verdanken war, dass Er mich aufsuchte. Deshalb<br />
ist es mir wichtig, an dieser Stelle an Marcel Callo zu erinnern.<br />
Das Leben ging weiter. Meine Besorgnis dauerte weiter an. Mit dem Einbruch der Winterkälte<br />
ließen meine Kräfte nach. Die Ungewissheit führte jedoch nicht mehr länger zur Verzweiflung,<br />
denn seit der Botschaft war meine Angst vor dem Tod verschwunden, sie hatte sich aufgelöst. Ich<br />
habe nun eine langes Leben hinter mir, mit Fehlern und Versagen, wie es auch Andere wohl erlebt<br />
haben, jedoch mit dem Unterschied, dass ich den Tod als Teil des Lebens betrachte und mein<br />
Leben so führe, dass ich mich eines Tages mit hellem Geist und gelassenem Herz verabschieden<br />
kann. Ich weiß nicht mehr, welcher Schriftsteller - Péguy oder Saint-Exupéry - es in Worten<br />
ausgedrückt hat: «C‘est toute une affaire de mourir proprement.» (Es ist nicht einfach, anständig<br />
zu sterben.). Keiner kann dies voraussehen oder planen. Ich selbst, als Gottgläubiger, konnte mich<br />
von der Obsession des Todes befreien und dank der Gnade, die mir in Flossenbürg zu Teil wurde,<br />
fühlte ich mich frei wie ich es in den Augen des Rehkitzes in der Morgendämmerung am<br />
Waldrand erblickt hatte.<br />
Ein einziges Mal in den Nachkriegsjahren befand ich mich in einer Situation, in der der Tod mir<br />
unabwendbar schien. Es war im Sommer 1969 während einer Bergtour auf dem Mont-Blanc, etwas<br />
überhalb der Goûter-Hütte, an der Stelle “les Barres Rouges“. Das Wetter war plötzlich<br />
umgeschlagen. Mein Bergführer, von meinen Fähigkeiten überzeugt, hatte mich, ohne mich vorher<br />
anzuseilen, aufgefordert die einzige delikate Stelle auf der Tour zu überqueren. Ich konnte den<br />
Pfad nicht erkennen und beim ersten Schritt rutschte ich aus. Etwa siebzig bis achtzig Meter war<br />
der Abgrund, sechshundert Meter tiefer der Gletscher. Während einiger Sekunden, vielleicht ein<br />
Dutzend, war mir klar, dass der zerschmetternde Sturz auf den Gletscher das Ende sein würde.<br />
Ich schrie nicht, keinen Ton, sondern richtete meine Gedanke auf den, der gesagt hatte, sich nicht<br />
zu fürchten. Ein kleiner Eiszapfen am Rand des Abgrunds sollte mich retten. Mit einem kräftigen<br />
Schwung gelang es mir, auf den Zapfen zuzusteuern und - den Zapfen zwischen den Beinen - vor<br />
dem Abgrund zu halten. Lucien Balmat, am Gelände der Berghütte, hatte mich in dem Nebel<br />
verschwinden gesehen und hatte den Wärter, Riton Bochatoy alarmiert. Letzterer hatte ihm bereits<br />
gesagt, dass mich nichts halten konnte. Claret-Tournier, mein Bergführer, hatte machtlos und<br />
fürchterlich entsetzt zuschauen müssen. Dann erblickte Lucien Balmat, der zurück zum Gelände<br />
der Berghütte gekommen war, den schwarzen Fleck meines Anoraks und sah, dass ich noch drin<br />
war. Sie schafften es bis zu mir und hoben mich bis zur Hütte: mit einer Risswunde am Knie, einer<br />
schmerzhaften Ferse und einer riesigen Schwellung an der Wade kam ich davon. An diesem Tag<br />
war ich zum Sterben bereit, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch so sein wird, wenn es<br />
wirklich an der Zeit sein wird.<br />
In der letzten Novemberwoche arbeitete ich in Nachtschicht. Der Vorarbeiter, ein Zivilist der<br />
Messerschmittwerke und seit mehreren Monaten für den guten Ablauf in der Werkstaat<br />
zuständig, überwachte den Schichtwechsel um 18 Uhr und verweilte noch einige Minuten,<br />
während die Mannschaft die Arbeit übernahm. Er war ein schweigsamer Kerl und hielt sich nicht<br />
weiter mit der Disziplin im Lager auf, sprach nur selten und, wenn es die Franzosen anging, dann<br />
ausschließlich zu mir. Irgendwie hatte er einen Draht zu mir, denn ab und zu “vergaß“ er seine<br />
Tageszeitung und ließ die “Weidener Rundschau“ in irgendeiner Ecke, in der Nähe meines<br />
Arbeitsplatzes liegen. So auch an jenem Abend. Die “Weidener Rundschau“ erwähnte einen<br />
Bericht des OKW (Oberkommando der Wehrmacht) mit einem kurzen Kommentar, laut dessen<br />
die deutschen Truppen, um einem Vorrücken des Feindes zu umgehen, sich ohne Kämpfe aus<br />
Zabern nach Straßburg zurückgezogen hatten. Über diesen Weg erfuhr ich, zwar mit einer Woche<br />
94
Verzögerung, dass meine Heimatstadt nicht zerstört wurde. Auch diesmal behielt Kirrmann<br />
Recht, indem er uns geraten hatte, nur die Mitteilungen der Wehrmacht Glauben zu schenken.<br />
Letztendlich nannte die Wehrmacht die Tatsachen immer beim Namen, auch wenn sie es so<br />
darstellte, als zogen sie sich siegreich zurück.<br />
Im Block 7, in dem ich seit sechs Monaten untergebracht war änderten sich die Bedingungen<br />
schlagartig und nahmen eine beunruhigende Wende. Der grüne Kapo, Häftling des Gemeinrechts<br />
und Aufseher unseres Blocks, wurde Anfang Dezember ersetzt. An der Stelle von Walter<br />
Stammer, der bestimmt nicht zur Zärtlichkeit neigte, kam Max der Berliner. Bereits sein Aussehen<br />
- weiße Haare, härte Gesichtszüge, blaue Augen, in denen die Grausamkeit funkelte - ließ nicht<br />
Gutes erhoffen. Als Vertrauensmann der SS war er lange Zeit Kutscher une somit der einzige<br />
Häftling des Gemeinrechts, dem erlaubt wurde, das Lager zu verlassen, um mit seinem Gespann<br />
zwischen Lager und Bahnhof zu kutschieren. Dieser Grüne - athletischer Körper, volltätowierte<br />
Brust und Prototyp der Berliner Schwerverbrechenorganisation - war bereits wegen seiner<br />
Brutalität im Lager berüchtigt. Er machte sich einen Spass daraus, nachts die Kameraden auf dem<br />
Weg zu den Toiletten aufzugreifen und zu verprügeln. Morgens hatten die Kameraden, die die<br />
Nachtschicht beendet hatten, es schwer an ihm vorbeizukommen, um sich im Schlafraum einige<br />
Stunden auszuruhen. Die Sterbefälle nahmen zu. Max hatte seine Sündenböcke, die hinhalten<br />
mussten, wie den armen Albert Chalus, den einzigen Übergebliebenen aus dem Gefängnis zu<br />
Clermont in meinem Block 7. Victor Cohalion, bei Billom aufgegriffen, musste als Prügelknaben<br />
hinhalten. Victor starb am 16. Dezember 1944, auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Verhaftung.<br />
Max schaffte es bis zur Befreiung des Lagers am 23. April 1945, als er sich versteckte, um der<br />
Evakuierung des Lagers zu entkommen, aber von den Russen, die im Lager zurückgeblieben<br />
waren, entdeckt und zum Tode gesteinigt wurde.<br />
Ich nahm mir vor, Kapo Bauer aufzusuchen, um ihm die Lage zu erklären. Vorsichtig und<br />
umsichtig bat ich ihm, mich für das zu bildende Kommando Altenhammer, unten im Dorf<br />
Flossenbürg, einzutragen, denn ich wusste, dass dort auch für Unterkunft gesorgt wurde. Er tat<br />
das Nötige und trug auch Pierre Eudes ein. Er bedauerte es, Pierre damals verprügelt zu haben.<br />
Auch schlug ich Jean Valet vor, dieselben Schritte bei Kapo Sepp Weigel zu unternehmen. Einige<br />
andere taten dasselbe bei ihrem Kapo, sodass wir am 20. Dezember 1944 in einer Gruppe zum<br />
Kommando Altenhammer versetzt wurden. In den ersten Tagen gingen wir die Strecke zwischen<br />
Lager und Kommando zu Fuß. Ab dem 26. oder 27. Dezember wurden wir endgültig in einem<br />
großen Gebäude mit Bettgestellen, Wasserhähnen und einem großen Essraum untergebracht. Das<br />
Gebäude reichte für sechshundert Häftlinge aus und war nur fünfzig Meter von der<br />
Montagewerkstatt des Messerschmitts 109 entfernt. Wir brauchten erst um fünf Uhr aufzustehen<br />
und - nicht zuletzt - waren von Schlägen verschont. Der grüne Kapo, ein Österreicher, zeigte sich -<br />
abgesehen von seinen Deliriumkrisen, während deren er blind um sich herum schlug - als ein<br />
durchaus freundlicher und fröhlicher Kerl und bemühte sich, unsere Lebensbedingungen zu<br />
verbessern. In Altenhammer sollte ich die letzten Monate Zwangsarbeit erleben, bevor ich, vom<br />
Typhus befallen, zurück zum Zentrallager gebracht werden sollte. Darüber später mehr.<br />
Von den sechs Monaten im Block 7 ist mir, aufgrund ihres ausgezeichneten Verhaltens, die<br />
Erinnerung an einige Deutschen, politische Häftlingen, geblieben. Als Bettgenossen - wir schliefen<br />
ja zu Dritt, manchmal zu Viert auf einem Strohsack - hatte ich zwei Kommunisten, vor der<br />
Verhaftung in führender Position, zwei von den insgesamt sieben im Lager Flossenbürg. Auf<br />
deren Jacken, im Rücken, war einen blauen Kreis aufgenäht: wiederholter Versuch zu Bildung<br />
einer politischen Gruppierung innerhalb des Lagers. Es dauerte nicht lange, bis sie begriffen<br />
hatten, dass ich ihre Gespräche auf Deutsch folgen konnte, aber sie zeigten mir ihr Vertrauen,<br />
indem sie mit der Analyse der politischen Lage in Deutschland fortfuhren. Golessa hat nie ein<br />
Wort mit mir gesprochen. Girnus erzählte mir, etwas weitschweifig, über sein Leben und<br />
Überleben im Lager. An zwei Sonntagen im Januar und Februar, als das gesamte Kommando<br />
Altenhammer zum Duschen im Zentrallager hochzog, hatte ich die Gelegenheit ausführlicher mit<br />
Girnus zu reden. Es war der Girnus, der später über mehrere Jahre Minister für Jungend und<br />
Erziehung in der DDR-Regierung werden sollte.<br />
Es war äußerst gefährlich, auch in verdeckter Sprache, über die Ereignisse, den bevorstehenden,<br />
unabwendbaren Zerfall des Dritten Reichs, über unsere Befreiung zu reden. Ende Dezember, vor<br />
meiner Versetzung zum Kommando Altenhammer, als ich an der Tischecke Girnus und Golessa<br />
95
gegenüber saß, sagte ich ihnen auf Deutsch - mezzo voce - zum Abschied: «Meine Herren, der<br />
Januar wird lang, der Februar kurz und im März wird der Frühling kommen.». Nie werde ich den<br />
dankenden Blick vergessen, den sie mir als Zeichen ihres Danks und ihrer Solidarität zuwarfen.<br />
Am 1. Januar 1945 hatte der neue Lebensrythmus im Kommando Altenhammer eingesetzt. Um<br />
fünf Uhr morgens schreitete der SS-Kommandoführer durch den ungelüfteten Schlafraum:<br />
«Aufstehen!». Nach der Morgenbrühe öffnete er das eiserne Tor zum Weg in die Montagehalle.<br />
Dort, den Montagereihen entlang, erfolgte der Appell. Erst um 18 Uhr ging es wieder nach<br />
draußen. Am Neujahr 1945 kam der SS-Unteroffizier, ein “Alter“ von etwa fünfzig, auf die Idee,<br />
seinen Beitrag zur Warmherzlichkeit zu leisten, indem er bei der Verteilung der Mittagssuppe<br />
verordnete, dass das Essen diesmal ohne Schläge verteilt werden sollte, und sich sogar<br />
überwandet, selbst einen Nachschlag auszuteilen. Ein allgemeines Fiasko! Er schaffte es nicht, die<br />
Ausgehungerten in Reih und Glied aufzustellen, wurde von der Unordnung und dem<br />
herrschende Chaos irritiert und, statt die Kelle zum Austeilen der Suppe zu benutzen, schlug er<br />
mit ihr um sich herum, auf die Köpfe und Rücken, bis die Kelle total verbogen und die Suppe<br />
nicht in den Essnäpfen, sondern auf dem Boden verteilt war. So zeigte sich die Fähigkeit der SS-<br />
Basis, eine humanitäres Verhalten an den Tag zu legen.<br />
Der Januar 1945 war schnell vergangen. Ein kleines Unterkommando, im Gebäude “Stich<br />
Altenhammer“ untergebracht, arbeitete an der Montage der V2-Raketen. Sie wahren nur zehn, alle<br />
Techniker, unter denen auch zwei Belgier. Ich weiß nicht wie, aber sie hatten es geschafft einen<br />
Radioempfänger zu basteln, mit dem sie die BBC hören konnten. Wie dann auch, Anfang Februar<br />
45 konnten sie der versammelten französischen Mannschaft wissen lassen, dass die Russen, die<br />
seit dem Sommer 1945 durch die Lücken der deutschen Front vorgedrungen waren, ihre große<br />
Endoffensive im Osten aufgenommen hatten. Einige Tage später, als ich mit der Montage der<br />
Kraftstoffzufuhrschläuchen an die Pilotenkanzel beschäftigt war, lauschte ich ein längeres<br />
Gespräch zwischen dem SS-Lageroffizier Schubert (1946 im Verfahren zu Dachau zum Tode<br />
verurteilt und exekutiert) und mehreren Vorarbeitern der Werkstatt, die durchgehend vor Ort<br />
blieben. Schubert beschwerte sich, dass seine Heimatstadt, Frankfurt an der Oder, in die Hände<br />
der Russen gefallen war. Dank meiner guten geografischen Kenntnisse war mir sofort klar, dass<br />
die Basis bei Stettin, im Herzen Preußens, für die Nazis verloren war. Aus dieser Region bezog das<br />
Dritte Reich den Hauptteil der Lebensmittel (tierische Produkte, Zuckerrüben, Getreide,…), was<br />
der lautstarke Forderung Hitlers nach Lebensraum für das deutsche Volk widersprach. Die Folgen<br />
bekamen wir kurz danach zu spüren: alle Kollektive, die Konzentrationslager als erste, mussten<br />
die für vier Wochen vorgesehenen Lebensmittel über fünf Wochen verteilen. So konnte es nicht<br />
weitergehen. Der kleine neunzehnjährige Labro aus Figeac, im Maquis des Departements Lot<br />
aufgegriffen, war an einer langen, schleppenden Tuberkulose verstorben. Hilflos mussten wir<br />
zuschauen, wie Marcel Gallot aus Montpellier jeden Tag schwächer wurde. Der<br />
siebenunddreißigjährige hatte bis dann durchgehalten, trotz eines schweren Ischiasleiden, das<br />
unter den herrschenden Bedingungen kaum auszuhalten war und ihn zum Krüppel machte. Eines<br />
Tages, auf dem Weg zu den Latrinen, gingen mehrere Kapos auf ihn los und beraubten ihn seines<br />
Schmucks, den er in seiner Zahnprothese versteckt hatte. Mit schwebt noch vor Augen, wie er, zur<br />
Unkenntlichkeit entstellt, liegend in der Karre zum Zentrallager zurückgebracht wurde und mir<br />
einen letzten Blick zuwarf. Nie werde ich diesen Blick vergessen. Nach dem Krieg brachte ich die<br />
Nachricht seines Todes seinem alten Vater in Straßburg, der kurz danach verstarb, und seinem<br />
Schwager, damals Direktor der Zeitung “Journal d’Alsace-Lorraine“.<br />
Gegen Ende Februar 1945 erlebten wir die Auswirkungen der Massenevakuierungen aus den KZ<br />
im Osten, dem Aufmarsch der russischen Truppen seit Januar zufolge. Die Eisenbahnstrecke nach<br />
Weiden lief unterhalb des Dorfes, knapp hundert Meter an unserem Mini-Kommando vorbei. Ein<br />
Abzweigung endete in unserer Halle, wo die gefertigten Teile - Kanzel mit Motor, Waffen und<br />
Zubehör, außer den Flügel - geladen wurden. Der Zug mit den Evakuierten fuhr langsam an uns<br />
vorbei. Ein grausames Bild. Die Häftlinge waren auf den blanken Ladeflächen ohne Überdachung<br />
zusammengepackt. Seit fast zwei Wochen waren sie unterwegs. Die Leichen wurden auf der<br />
Strecke zurückgelassen. Mehrere waren tot oder sterbend. Einige Tage später trafen etwa zwanzig<br />
dieser Evakuierten völlig erschöpft in Altenhammer ein. Ich glaube dort und damals das tiefste<br />
Elend erblickt zu haben.<br />
96
Seit Oktober, seit fünf Monaten hatte ich Gelassenheit überlebt, ohne mich allzu viel Sorgen zu<br />
machen. Auf diese Weise war es mir gelungen, die Hoffnung zu bewahren. Das war auch mein<br />
einziges Streben gewesen. Ich hatte mich, wenn es dazu kommen sollte, auf ein würdiges Sterben<br />
vorbereitet. Ich war mir bewusst, dass ich für mich selbst nichts Weiteres mehr machen konnte,<br />
und hatte mich entschieden, nicht länger auf mein eigenes Schicksal zu starren und die Chance<br />
wahrzunehmen, für die Anderen zu sorgen, so weit und so lang es mir ermöglicht werden sollte.<br />
Mit Gottes Hilfe!<br />
Anfang März schien der Winter zu weichen. Ich war sehr erstaunt, mich körperlich noch so gut zu<br />
fühlen, und konnte feststellen, dass es nicht nur mir so ging. André Lopez sagte mir, dass er sich<br />
seit langem nicht mehr so gut gefühlt hatte! Ich glaube, es war am 10. März, als die Jungs vom<br />
Kommando Stich uns den Fall von Remagen meldeten, wie sie im BBC-Funk vernommen hatte.<br />
Das sagte ihnen nicht allzu viel, aber ich kannte das Rheinland und wusste somit, dass die<br />
Amerikaner den rechten Rheinufer erreicht hatten und nun dem Dritten Reich - nach Preußen in<br />
Februar - auch das Rheinland verloren ging. Zu der Zeit ergab sich, dass die Evakuierten aus Ost-<br />
Europa vom Fieber befallen waren. Während einiger Tage stand ich ihnen zur Hilfe, brachte oder<br />
trug sie zu ihren Liegen. Die Karre, die mit Brot und Brühe zu Altenhammer herunter fuhr,<br />
brachte jeden Abend einige Kranken hoch zum Revier im Zentrallager.<br />
Und dann die Katastrophe. Es fing mit Fieber an. Noch drei Tage arbeitete ich weiter. Am Abend<br />
des dritten Tags holten meine Kameraden den Häftling, der zum Arzt genannt worden war. Er<br />
verfügte über nur ein Thermometer und einige Papierverbände. Amigos, ein Franzose, wurde<br />
1942 von einem Sondergericht des Vichy-Regimes zu einer lange Zwangsarbeitsstrafe verurteilt<br />
und nach Flossenbürg deportiert Er hatte sein Medizinstudium an der Uni Straßburg in Clermont<br />
abbrechen müssen. Als er mir die Temperatur nahm und 40°C ablas, sagte er bloß, ich sollte<br />
anderntags nicht arbeiten. Ich begriff, dass ich vom Fleckfieber befallen war. Die Epidemie war<br />
ausgebrochen und breitete sich schnell aus. Fleckfieber ist eine ansteckende Krankheit mit einer<br />
sehr langen Konvaleszenzperiode, die sich durch Impfung gut vorbeugen lässt. Die<br />
Infektionskrankheit wurde mir von den Läusen übertragen, wahrscheinlich beim Kontakt mit den<br />
bereits Befallenen unter den Neugekommenen. Der Ablauf ist nicht tödlich, aber wenn nach etwa<br />
zehn Tagen das Fieber noch über 41°C ansteigt, kann der Tod durch Hirnlähmung erfolgen.<br />
Amigos wusste es, aber wollte es mir nicht sagen, denn unmächtig aufgrund des Mangels an<br />
geeigneten Medikamenten. Zurück in Clermont im Juni 1945 vernahm ich, dass auch er vom<br />
Fleckfieber befallen worden war und dass die Amerikaner ihn bei der Befreiung des Lagers am 23.<br />
April sterbend angetroffen hatten. Sie hatten ihn nicht mehr retten können. Seine Familie hatte<br />
seine Leiche überführen lassen.<br />
Anderntags, noch vor dem “Aufstehen!“ um fünf, wollte ich zu den Latrinen, um meine<br />
Harnblase zu leeren (aufgrund der durch das starke Abmagern bedingten Inkontinenz waren wir<br />
gezwungen, mindestens einmal nachts zum urinieren aufzustehen.) Ich brach bewusstlos<br />
zusammen. Drei Tage lag ich flach, ab und zu dem Delirium verfallen. Im Einverständnis mit<br />
Amigos wollte ich die Verlegung zum Revier im Zentrallager vermeiden, zumindest aufschieben,<br />
denn die Krankenpflegestation war mittlerweile zu einem elenden Sterbesaal geworden. Ich kann<br />
mich gut an diese drei Tage erinnern, die von der spektakuläre Flucht des Polen Maïkowski am 25.<br />
März geprägt wurden. Es war ihm gelungen, die groß im Rücken seiner Zivilkleidung<br />
aufgetragenen Buchstaben “KL“ mit Hilfe von Benzin zu entfernen. Nach dem Morgenappell hatte<br />
er sich in einem Messerschmitt-Pilotenkanzel versteckt, die bereits am Vorabend auf der<br />
Anschlussrampe geladen worden war, um nach Passau zur weiteren Verarbeitung verfrachtet zu<br />
werden. Er sperrte sich selbst ein, indem er irgendwelche Schrauben festzog, wartete bis der Zug<br />
weit von Flossenbürg entfernt war, machte auf und haute ab. Gegen Mittag erfolgte,<br />
ausnahmsweise, ein Gegenappell. Die Kranken brauchten nicht aufzustehen, denn die Zahl<br />
stimmte! Morgens hatte sie sich um eine Einheit verzählt, als sie eine kleine Gruppe bei den<br />
Tiefbauarbeiten außerhalb des Lagers abgezogen hatten. Erst beim normalen Appell um 18 Uhr<br />
erwiesen sich die Zählungen des Morgens und des Mittags als falsch. Nach wiederholtem Zählen<br />
und Nachzählen mussten auch die Kranken antreten und wurde eine Zählung durch Abrufen der<br />
Namen vorgenommen. Es dauerte noch eine Ewigkeit bis der Fehler gefunden und die<br />
Abwesenheit des Polen Maïkowski festgestellt wurde. Um die Zeit war er weit von Flossenbürg<br />
entfernt. Trotz meines Zustandes empfand ich Freude, denn in der Vergangenheit war es auch mir<br />
zweimal gelungen, unter bedeutend weniger schweren Bedingungen die Flucht zu ergreifen, um<br />
97
danach in einer Fluchtorganisation mitzuwirken. Ich bewundere immer noch solche Leute wie<br />
André Roger und Georges Peter, die 1943 - wie Maïkowski 1945 - den Mut hatten, Risiko und<br />
Gefahr in Kauf zu nehmen, um die Freiheit wiederzufinden.<br />
Am vierten Tag war das Fieber immer noch nicht gewichen. Eine Verlegung zum Zentrallager<br />
war nicht mehr aufzuschieben. Ich konnte nur hoffen, dort einigermaßen gepflegt und versorgt zu<br />
werden. Es war am 25. März. Auch Pierre Eudes war erkrankt. Glücklicherweise war mein<br />
Strohsackgenosse, der junge Jean Valet, verschont geblieben. Eine zusätzliche Fleckfieberinfektion<br />
wäre für den Tuberkuloseleidenden tödlich gewesen. Man hob uns beide - Pierre und mich - auf<br />
die Brot-und-Suppe-Karre und wir fuhren - ohne Verdeck - die drei Kilometer zum Lager hoch.<br />
Vor dem “Jourhaus“ fand ich noch die Kraft, mich zur Krankenpflegestation zu begeben. Mehrere<br />
Ärzte-Häftlinge - im weißen Kittel, mit Thermometer - bezeichnete uns als typische Fälle. Ohne<br />
große Vorsicht wurden wir zu den Duschen geführt. Unsere Pfleger entschieden, eher das Risiko<br />
einer Lungenentzündung als das eines Hirnschlags einzugehen. Das Gefühl, eine Minuten lang<br />
nackt unter dem eiskalten Wasser zu stehen, war entsetzlich, aber es war das einzige zur<br />
Verfügung stehende Mittel, um das Fieber zu bekämpfen und das Schlimmste abzuwenden.<br />
Was danach, in den darauffolgenden Tagen geschah, weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nicht<br />
mehr, ob und wie ich verpflegt und genährt wurde. Ich erinnere mich nur noch, dass ich<br />
irgendwann, vielleicht sogar mehrmals, durstig und ausgetrocknet, mit einem Brennen im ganzen<br />
Körper, zu den Waschbecken gelang. Im Waschraum lagen mehrere Leichen. Instinktiv trank ich<br />
am Wasserhahn. Nach meiner Heimkehr in Zabern, im Mai 1945, suchte unser betagter Hausarzt<br />
mich auf, um den Krankenbericht nach Untersuchung aufzusetzen. Während des Großen Kriegs<br />
14-18 hatte er ähnliche Fälle erlebt. Er bestätigte mir, dass ich richtig gehandelt hatte, indem ich<br />
trots des Verbotes Wasser zu mir genommen hatte und durch diese Flüssigkeitsaufnahme das<br />
Fieber richtig bekämpft hatte.<br />
Ein deutscher Krankenpflegergehilfe, der mir beim Austreten aus der Dusche ein Nachthemd<br />
zugeworfen hatte, erzählte mir später, wie er mich wieder auf die Liege gelegt hatte, als ich nicht<br />
zu ihr zurückfand. Mein Delirium versetzte mir Halluzinationen. Eine dieser Wahnvorstellungen<br />
hat mich noch lange Zeit danach beeindruckt: ein junger Mann, mir ähnlich wie ein Bruder, liegt<br />
neben mir und spricht zu mir: «Hör mal zu. Einer von uns beiden wird sterben, wird davongehen.<br />
Ich werde an deiner Stelle gehen und dich retten.» Ich wollte protestieren, aber er gebor mir, zu<br />
schweigen. Als ich wieder zu mir kam, war der junge Mann verschwunden. Lange Zeit, ich<br />
glaube, während mehrerer Stunden, war ich davon überzeugt, dass sein Körper anstatt meines<br />
weggenommen wurde. Dann hörte ich, dass jemand zu mir sprach:«Margraff, du hast est<br />
geschafft! Alles in Ordnung. Ruhe dich aus.». Es war ein tschechischer Arzt. Er schien ganz<br />
verwirrt, als ich ihn fragte: «Ist Nürnberg gefallen?» - «Bald», antwortete er. - «Welcher Tag sind<br />
wir?» - «Den 3. April». Ich war fünf Tage im Delirium. Anfang 1947 erzählte mir eine tschechischer<br />
Freund, aus dem Erholungsheim kurz vor dem Fall des Eisernen Vorhangs wieder zurück in Prag,<br />
dass er ehemalige deportierte Ärzte kennengelernt hatte. Die hatten meinen Namen und meinen<br />
Fall erwähnt. Einer von ihnen, Dr. Popper, hatte mich damals behandelt und konnte sich an den<br />
Wortwechsel erinnern.<br />
Man behielt mich zwei Tage länger auf dem Revier und aufgrund meiner Schwäche wurde ich<br />
mit hier und da eingesammelten Kleidungsstücken und mit Pantinen an den Füßen ausgestattet<br />
zum “Erholungsblock“ verlegt. Dort besuchte uns, mindestens ein Mal, der neue Militärarzt, der<br />
junge Dr. Adam. Er sorgte sich um den Zustand der Überlebenden, schrieb Ruhe vor. Er hatte den<br />
berüchtigten Dr. Schmitz ersetzt, der ebenfalls von der Fleckfieberepidemie gefällt worden war.<br />
Viel konnte er in dem überbelegten und von der SS geführten Lager nicht erreichen. Um den 10.<br />
April, als mehrere Rekonvaleszenten eintrafen, wurde ich zum Block 5 verlegt. Nur alle zwei bis<br />
drei Tage bekamen wir zu essen.<br />
Ich wurde schächer und schwächer. Einige Monate vorher hatte ich, dank eines der weinigen<br />
eingetroffenen Pakete aus Zabern, Joseph Troffaes, einem erkrankten Belgier in meinem Konvoi,<br />
eine Hand voll Zuckerklümpchen zugesteckt. Im allgemeinem Durcheinander hatte er sich als<br />
“Reichsdeutsche“ ausgegeben. Ich traf ihn, in besserer Gesundheit, auf der Treppe des Blocks<br />
wieder. Er erkannte mich kaum wieder, versprach mir aber sofort, mir seine Schuld zu begleichen<br />
und, in der Tat, er brachte mir anderntags das Geschuldete, ein lebensrettender Beitrag.<br />
98
Am 14. April trafen nach mehreren Tagen Fußmarsch ein Teil der aus Buchenwald Evakuierten in<br />
Flossenbürg ein. Am 9. April hatte die 7. Amerikanische Armee das Lager Buchenwald erreicht<br />
und befreit. Ab dann gingen die verrücktesten, widersprüchlichen Nachrichten durchs Lager.<br />
Eines stand fest: die deutsche Front war endgültig durchbrochen worden. Auch sicher war, dass<br />
das schwedische Rote Kreuz Zugang zum KZ Buchenwald bekommen hatte. Einige Häftlinge<br />
zeigten mir amerikanische Zigaretten, die ihnen zugeworfen worden waren. Alle Juden im Lager<br />
Buchenwald waren zusammengerufen worden, nicht um umgebracht zu werden, wie sie anfangs<br />
glaubten, sondern um tatsächlich in die Freiheit entlassen zu werden.<br />
Am 15. April erreichte das allgemeine Durcheinander seinen Gipfel. Auf dem<br />
gegenüberliegenden, von dem Schloss überragten Hügel konnten wir mehrere Einschläge eines<br />
Artilleriegeschosses beobachten. Sie wurden von einer Vorstoßgruppe alliierter Panzer abgefeuert.<br />
Und dann merkten wir, dass die SS-Garnison abgehauen war! Schon fielen wir uns gegenseitig in<br />
die Arme. Mitten in der Nacht hörten wir Schreien. Die Wächter waren nicht durchgekommen,<br />
waren wieder da und am Morgen waren die Wachtposten wieder bemannt.<br />
Nach dem Eintreffen der Evakuierten aus Buchenwald war Block 5, wie die anderen, überfüllt.<br />
Wir schliefen zu viert auf einem Strohsack, auf den Betten, unter den Betten, über den ganzen<br />
Raum verteilt. Ich lag, dreifach gefaltet, zwischen zwei anderen Franzosen, zusammen vier auf<br />
einer Liege. Ich spürte und empfand nichts mehr, weder Müdigkeit, noch Schmerz, noch Hunger,<br />
noch Durst… nur noch, dass das Ende nicht mehr weit sein konnte. Den klaren Kopf hatte ich<br />
behalten und ich befürchtete irgendeinen unabsichtlichen Schlag oder Stoß von einen der vielen<br />
auf der Liege, der für mich das Ende bedeutet hätte, der mich hinunten geworfen hätte. Dann<br />
hätte man mich bewusstlos zu den Leichen im Waschraum geworfen, danach zum Krematorium<br />
verschleppt. Oder zum Scheiterhaufen, der unten im Schlucht, hinter dem Revier, angezundet<br />
worden war, weil das Krematorium “ausgelastet“ war und die Menge und Masse nicht mehr<br />
schaffte. Minutenweise verlor ich das Bewusstsein, nach etlichen Stunden kam ich wieder zu mir,<br />
konnte mich wieder bewegen. Als ich zum ersten Mal nach zwei Tagen den Aufruf zum<br />
Abenessen hörte, stand ich auf. Ich hatte alle Mühe, meinen Essnapf zu leeren, aber ich konnte<br />
wieder gehen. Es muss am 17. oder am 18. April gewesen sein. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee<br />
kam, zum Appellplatz hinunter zu gehen. Es wimmelte von Leuten. Ich ging bis zum Eingang<br />
zum Effektenkammer, wo ich einige Tage zuvor Troffaes getroffen hatte. Dort hatten sich die<br />
deutschen politischen Häftlinge zusammengefügt. Girnus hatte mich gesehen, bevor ich ihn<br />
erblickte, und kam auf mich zu. Er merkte sofort, dass ich am Ende war, bat mich, kurz<br />
zusammenzufassen, was mir geschehen war, und sagte: «Warte, ich bringe dir was!». Einige<br />
Minuten später kam er aus dem Block zurück und gab mir eine in Pergamentpapier verpacte<br />
Schnitte Brot mit Margarine. Er blieb bei mir, bis ich fertig gegessen hatte, um mich vor den zu<br />
erwarteten Ansturm der Hungrigen zu bewahren. Wir sprachen noch einige Worte miteinander.<br />
Nach dem Fall von Nürnberg war Deutschland in zwei geteilt. Die Amerikaner waren jedoch<br />
noch nicht bis Weiden, der Kreisstadt auf gut zwanzig Kilometer von Flossenbürg, vorgedrungen<br />
und von Weiden wehte weiter der Wind. Die SS blieb Herr im Lager und ließ sich von der Roten-<br />
Kreuz-Armbinde des Militärarztes Adam nicht weiter stören. Ich sah Girnus zum letzten Mal.<br />
Gerne hätte ich mich mit diesem typischen Vertreter und Intellektuellen des deutschen<br />
Kommunismus aus den zwanziger Jahren, Schrecken des Dritten Reichs, weiter und tiefgehender<br />
unterhalten.<br />
Am 19. April traf ich noch einige Kameraden aus dem Kommando Altenhammer, die zurück zum<br />
Zentrallager hinauf gekommen waren und sich beim Revier und bei der Effektenkammer<br />
angesammelt hatten. Einen Augenblick hatte ich mir überlegt, mich wieder in die Schreibstube<br />
versetzen zu lassen, aber ich wollte nicht das Risiko nehmen, mich wieder heraus werfen zu<br />
lassen, und kam zurück zum Block 5, wo ich in den fünf darauffolgenden Tagen dann und wann<br />
schlafen konnte. Die Restbestände aus der Küche wurden im großen Durcheinander verteilt, ich<br />
konnte mir noch zwei zusätzliche Kellen erbeuten und ein Leinensäckchen - weißt der Teufel,<br />
woher das herkam - mit Gerste füllen. Ich bleibe jedoch weiter davon überzeugt, dass die Hand<br />
voll Zucker vom Reichsdeutschen Troffaes und dem Margarinebrot des Kommunisten Girnus zu<br />
verdanken war, dass ich wieder zum Leben und zum Überleben kam.<br />
99
Am 20. April, fürh am Morgen, machten sich die ersten Anzeigen zur Evakuierung des Lagers<br />
bemerkbar. Von der Terrasse aus, auf gleicher Höhe unseres Blocks, sah ich wie den ersten<br />
aufmarschierenden Kolonnen, von den Fenstern des Vorratslagers aus, Decken zugeworfen<br />
wurden. Ich hörte den jungen tschechischen Schreiber des Blocks auf Deutsch zu André Boulloche<br />
sagen, dass die beste Methode, den Evakuierungsprozess aufzuhalten, wohl wäre, auf Träge zu<br />
schalten und erst im letzten Augenblick den Befehl zum Abmarsch zum Versammlungsgelände zu<br />
befolgen.<br />
Im Lauf des Nachmittags hockten wir alle noch bei den Blocks 5, 6, und 7 zusammen. Die<br />
Baracken unterhalb unserer Blocks hatten sich bereits geleert. Ein junger Serbe, den ich erst vor<br />
kurzem kennengelernt hatte, konnte sich - mangels Decke - noch zwei Mäntel beschaffen. Er<br />
tauschte mir mir den kürzeren für den übriggebliebenen Gerstenbrei: einen dicken und<br />
wasserabstößenden, bis zum Knie reichenden und leicht zu tragenden Raglan englischen Stils, der<br />
sich während des letzten und total verrückten Marsches als äußerst wertvolle erweisen sollte.<br />
Eine Tonne voll Zuckermelasse wurde zu unseren Terrasse hochgehoben. Einige versuchten, sie<br />
zu verteilen. Im Gedränge wurde die Tonne umgestoßen, die klebrige Masse lief aus und mehrere<br />
Häftlinge rutschen auf sie aus und fielen hinein. Ich konnte mir noch einen halben Essnapf des mit<br />
Erde verschmutzten Brei sichern, bevor zwei SS-Männer erschienen und uns unter<br />
Knüppelschlägen von der Terrasse hinunter trieben.<br />
Mit meinem Leinsäckchen, voll mit Gerste fest am Gurt, und dem Essnapf in der Hand gelang es<br />
mir, noch etwas von der Masse aufzulöffeln, bevor ich mich Lopez - später konnte er sich nicht<br />
mehr daran erinnern - und einigen anderen anschloss. Wir standen noch einige Minuten, die uns<br />
wie Stunden schienen, auf dem Platz, bis wir an die Reihe kamen und an dem sichtbar erzürnten<br />
Baumgartner eher tockelnd als marschierend vorbeiliefen und dem Lager Flossenbürg den Rücken<br />
kehrten. Es war noch hell. Von Flossenbürg sollten wir nach Süd-Bayern, nach Dachau in<br />
unmittelbarer Nähe, nördlich von München, Richtung Südwest. Flossenburg befand sich in der<br />
äußersten nord-östlichen Ecke dieses größten deutschen Landes.<br />
Pierre Eudes und ich waren nach dem Aufenthalt im Revier zum Block 5 verlegt worden, sodass<br />
wir uns vor diesem Abzug nach Dachau, später als »Todesmarsch« bezeichnet, nicht drücken<br />
konnten. Dagegen war André Lopez und Jean Valet das Umgekehrte gelungen und sie hatten das<br />
Kommando verlassen, um sich dem Evakuierungsmarsch anzuschließen. Später sollten wir<br />
erfahren, dass die Gruppe “Althammer“, die im Bereich des Reviers einquartiert worden war,<br />
nicht aus dem Lager evakuiert wurde und am Mittag des 23. April befreit wurde, genau am<br />
gleichen Tag und zur gleichen Stunde wie unsere letzte Marschkolonne auf etwa sechzig<br />
Kilometer vom Lager, nahe Cham. Unsere Kolonne hatte jedoch siebzig Stunden Marsch mit<br />
erheblichen Verlusten hinter sich.<br />
Dass Jean Valet es schaffte, durchzuhalten, war ein medizinisches Wunder, denn sofort nach<br />
seiner Rückkehr nach Frankreich, brach seine Tuberkulose entgültig und in vollem Ausmaß aus,<br />
sodass die Ärzte meinten, drei Viertel seiner Lungen amputieren zu müssen. Er überlebte.<br />
Die Männer, die am frühen Morgen des 20. Aprils zur Evakuierung angetreten waren, kamen am<br />
26. April in Dachau an, nach sechs Tagen erschöpfenden Marsches unter der Führung eines SS-<br />
Offiziers, der sich in der Gegend auskannte. Am gleichen 26. April wurde Dachau befreit. “Meine“<br />
Kolonne, ungefähr fünftausend Häftlinge beim Verlassen des Lagers Flossenbürg,, legte noch<br />
nicht mal die halbe Strecke zurück.<br />
Abgesehen von einer kurzen Rast nach Eintreten der Dunkelheit marschierten wir während der<br />
ganzen Nacht des 20.-21. Aprils. Bereits nach einer Marschstunde sahen wir die erste Leiche am<br />
Waldwegrand. Der Kopf war von einer Dumdumkugel zerfetzt, das Hirn nach allen Seiten<br />
geschleudert: Fluchtversuch. Das war der Anfang des Horrors, den ich hier nicht auführlicher<br />
beschreiben kann, jedoch später das Thema zahlreicher Berichte liefern sollte und auch von Toni<br />
Siegert analysiert, geklärt und zusammengefasst wurde. Im Lauf des darauffolgenden Vormittags<br />
wurde uns eine längere Rast auf einer Wiese neben der Straße gegönnt. Nachts und tagsüber hatte<br />
ich, Körnchen nach Körnchen, meine Gerste gekaut. Von der Wiese aus konnte ich beobachten,<br />
100
wie eine andere Kolonne unter der Führung von Koegel, stehend im Wagen, an uns vorbeizog.<br />
Ausgestreckt auf der Wiese, mit dem Kopf auf dem Gerstensäckchen konnte ich ein wenig<br />
schlafen. Als ich aufwachte, war mein Säckchen verschwunden… Als ich dann später einem<br />
natürlichen Bedürfnis nachging und meinen Stuhlgang betrachtete, merkte ich, dass ich die rohen<br />
Getreidekörner unverdaut ausgeschieden hatte. Der Köper hatte sie nicht verdaut, nicht<br />
assimiliert. Dabei fiel mir ein, was unser Lehrer der Naturwissenschaften uns im Unterricht<br />
beigebracht hatte: «Neben einem Berg Getreide werdet ihr vor Hunger sterben, wenn ihr nicht<br />
wisst, dass Getreidekörner nur dann verdaut werden können, wenn sie vorher in Wasser gekocht<br />
oder zu Mehl gemahlen wurden. Die ersten Menschen auf unserem Planeten lernten dies,<br />
nachdem sie das Feuer gemeistert hatten.“ Der Diebstahl des Säckchen erwies sich also als<br />
unwichtig.<br />
Gegen Tagesende brachen wir auf. Während der Rastplatz, vor der Kolonnenbildung, unter dem<br />
Befehl des begleitenden SS-Oberfeldwebels sorgfaltig durchsucht wurde, kam ein SS-Offizier, den<br />
ich vorher im Lager noch nie gesehen hatte, auf einem Häftling zu und fragte ihn, seinen Essnapf<br />
gegen eine Zigarette zu tauschen. Ich näherte mich, als ich merkte, dass der ängstliche Russe<br />
zögerte und brachte die Kühnheit auf, mich auf Deutsch einzumischen: «Er zögert, denn ohne<br />
Essnapf bekommt er nicht zu Essen.»; worauf der Offizier erwiderte: «Das Essen kommt erst<br />
später». Als ich in November 1947 als Zeuge vor dem amerikanischen Militärgericht in Dachau<br />
erschien, erkannte ich den SS-Offizier unter den Angeklagten. Schlundermann, so hieß er, wurde<br />
zu zehn oder fünfzehn Jahren Haft verurteilt. Zehn Jahre später, 1957, während des Verfahrens<br />
zulasten von Kubler in Weiden, berichtete mir der Untersuchungsrichter Saltz, dass<br />
Schlundermann, schwer krank, aus der Haft entlassen worden war. Wahrscheinlich starb er kurz<br />
danach.<br />
Bei der Bildung der ersten Kolonnenreihe am Abend des 21. Aprils machte sich eine gewisse<br />
Spannung bemerkbar. Offensichtlich versuchten die scharfsinnigsten unter den Häftlingen, sich<br />
ganz vorne in der Kolonne aufzustellen. Auch der Schreiber vom Block 5 war dabei. Es gelang<br />
auch mir, mich in der Kopfgruppe einzugliedern, denn mir war die stillschweigende<br />
Vereinbarung, so langsam wie möglich zu marshieren, bewusst geworden. Als ich mich kurz vor<br />
Abmarsch noch einmal umdrehte, sah ich Bernard Maletrat, Polizeiinspektor zu Le Havre, zum<br />
letzten Mal. Ich wusste nicht, dass er den Winter überlebt hatte. Zusammen mit einem belgischen<br />
Kameraden aus Lüttich, Georges Allard, waren wir während des Sommers und des Herbstes in<br />
der Abteilung von Kapo Bauer in einer Mannschaft gearbeitet. Während der kurzen<br />
Mittagspausen hatten wir versucht, uns auf eine Maxime spirituellen Denkens zu konzentrieren.<br />
Georges Allard hatte - ich weiß nicht, wie und wo - ein Gebetbuch in Taschenformat ausfindig<br />
machen können und im Atelier versteckt. Es war eins der Gebetbücher, die speziell für die<br />
französischen Kriegsgefangenen gedruckt und verbreitet worden waren, für den Fall, dass es im<br />
Stalag, im Stammlager, keinen Militärpfarrer geben sollte. Das war das Einzige, was wir hatten,<br />
um uns einigermaßen aus der Schwere unserer materiellen Notlage zu befreien. Einer der<br />
Gedanken, schon etliche Jahrhunderte alt, stammte von Thomas von Aquin: «Ohne ein<br />
Mindestmaß an materiellen Wohlstand ist Spiritualität gar nicht möglich».<br />
Ich wusste, dass Georges im Lauf des Winters verstorben war, und nun stand dort, einige Reihen<br />
hinter mir, Bernard, von zwei ebenso erschöpften Mithäftlingen unterstützt. Sie konnten sich<br />
kaum aufrecht halten, um zum zweiten Nachtmarsch aufzubrechen. Er hörte, dass ich seinen<br />
Namen rief, und warf mir einen Blick zu. Als ich ihm zunickte, um ihm Mut zu geben, erwiderte<br />
er mit einem »Nein«, um mir erkenntlich zu machen, dass es nicht mehr ging, dass er es nicht<br />
schaffen würde. Und so war es. Einige Tage später, nach unserer Befreiung in Cham, wussten mir<br />
andere Überlebende zu berichten, dass Bernard noch den Mut gefunden hatte, die beiden anderen<br />
davon zu überzeugen, ihn zurückzulassen, um so die eigenen Kräfte zu schonen. Während jener<br />
Schreckensnacht wurde er, am Schluss der Kolonne, erschossen.<br />
Unsere Wärter, die in 10-Meter-Abständen unsere Kolonne begleiteten, schafften es nicht, unser<br />
Tempo zu beschleunigen, denn der Rest zog sich in die Länge. In der ersten Stunde zeigte der<br />
Tscheche neben mir mehrmals auf frisch aufgewühlte Erdhaufen und gab zu verstehen, dass dort<br />
erschossene Häftlinge begraben lagen. In der Nacht fing es an, zu regnen. Ein leiser Regen, ohne<br />
Ende, der die Decken und die langen, bis zur Ferse reichenden Mäntel durchtränkte und das<br />
Marschieren erschwerte. Mir wurde der Vorteil eines bis nur zu den Knien reichenden Mantels<br />
bewusst. Wir marschierten weiter, sahen nur die Wärter seitlings der Kolonne, den Finger auf dem<br />
101
Abzug, schussbereit. Wir stolperten, wir fielen hin, wir halfen einander beim Aufstehen. Schüsse<br />
ballerten durch die Nacht. Manchmal wurde auf Flüchtlinge geschossen, meistens jedoch vor<br />
Nervosität, um die Marschierenden einzuschüchtern, um sie von einem Fluchtversuch<br />
zurückzuhalten. Wir waren am Ende unserer Kräfte, nicht mehr in der Lage, geschlossene und<br />
festentschlossene Gruppen zu bilden, uns auf die Wärter zu stürzen, ihre Waffen zu greifen und<br />
uns im Dunkel davon zu machen. Zweimal merkte ich, wie ich während des Marschierens<br />
aufwachte. Bis dann war mir nicht bekannt, dass man in Gehen schlafen konnte.<br />
Die Morgendämmerung war kaum zu ahnen, als die Spitze der Kolonne auf eine riesige Wiese<br />
zwischen Äckern geführt wurde. Diejenige, die sich bereits auf den Boden fallen lassen hatten,<br />
wurden von den Wärtern mit der Bajonettspitze gezwungen, wieder aufzustehen. Wir wurden<br />
weit weg von der Straße zusammengedrängt, sodass es einfacher war, uns in Schach zu halten. Als<br />
der Tag einbrach, war nur noch eine riesige, liegende Menschenmenge zu sehen, an manchen<br />
Stellen aufeinander gehauft, sogar mitten in den Wasserpfützen. Auch ich ging irgendwann<br />
bewusstlos zum Boden und kam erst wieder zu mir, als zwei Kameraden mich wach rüttelten,<br />
nachdem sie mich aus dem Schlamm geholt hatten. Am Ende der Nacht hatten sie sich absichtlich<br />
von den anderen überholen lassen, um nachschauen zu können, was am Ende der Kolonne vor<br />
sich ging: SS-Männer aus dem Lager marschierten in Reih und Glied hinter der Kolonne und<br />
töteten mit Kopfschuss alle diejenigen, die es nicht mehr schafften, aufzustehen und<br />
weiterzugehen. Unter dem Schock dieses Horrors hatten sie sich angestrengt, wieder nach vorne<br />
in der Kolonne aufzurücken.<br />
Als wir bereits mehrere Stunden auf der Wiese in der Kälte froren, nahmen die Wärter eine solche<br />
Stellung ein, dass wir gezwungen waren, uns in einem großen Kreis auf der Wiese fortzubewegen<br />
und uns allmählich der Straße näherten. Dort stand eine von Pferden gezogene Karre und zwei<br />
Soldaten reichten jedem, der am Gespann vorbeizog, einen Brocken Brot, solange der Vorrat<br />
reichte. Die letzten, etwa hundert Männer, mussten sich mit einer Handvoll Gerste, die ihnen in<br />
die Hände oder in die Mütze mit dem Becher ausgeschüttet wurde, zufrieden geben. (Diese<br />
Lebensmittelverteilung im Lauf der Evakuierung wurde während des Verfahrens in November<br />
1947 von den Verteidigern mehrerer Angeklagte ausführlich vorgetragen.) Als der Kreis<br />
“abgerollt“ war, standen etwa tausend Personen bereit, um weiterzumarschieren. Überall auf der<br />
Wiese konnte man Gestalten liegen sehen, die zum Aufstehen nicht mehr in der Lage waren.<br />
Mehrere wurden von ihren mutigen Kameraden hochgehoben, unterstützt und zu den bereits<br />
fortschreitenden Reihen geführt. Ein Dutzend blieb auf der Wiese, leblos zurückgelassen. Wir alle<br />
sahen, wie zwei SS-Männer mit der geladenen Waffe in der Hand von einem zum anderen<br />
Sterbenden gingen und jeden mit einem Kopfschuss erschossen. Einige versuchten noch, sich auf<br />
den Ellebogen hochzuheben, bevor sie dann doch ermordet wurden. Ich weiß noch, wie der große<br />
François Boucher - auch seit Clermont-Ferrand dabei - noch sagte: «Das gibt mehr Mut als eine<br />
Scheibe Brot!».<br />
Fast unglaublich während des ganzen Nachmittags des 22. Aprils und der darauffolgenden Nacht<br />
marschierten wir weiter. In der Nacht fielen noch mehrere Schüsse. Das Tempo wurde immer<br />
langsamer. Am Morgen des 23. Aprils erreichten wir Thirlstein, ein kleines Dorf im Tal eines<br />
Nebenflüsschens des Regens. Am Vormittag wurden alle Überlebende in einem Hain am Hang<br />
neben der Straße zusammengetrieben. Als ich die ersten Bäume auf einige Meter von der Straße<br />
erreichte, sank ich zusammen und schlief sofort ein. Ich weiß nicht, wieviel Zeit verging,<br />
wahrscheinlich mehr als eine Stunde, bis ich von einem schmerzhaften Tritt auf den Fuss geweckt<br />
wurde: ein mit einem Knüppel bewaffneter SS wollte wissen, ob ich noch lebte oder bereits tot<br />
war. Sofort hellwach sprang ich auf und sagte ihm «Weiter hinauf!“. Vorerst von meinem<br />
deutschen Wortlaut überrascht, ließ er mich weiter hinaufgehen. Es war die letzte Initiative seitens<br />
unserer Wachhunde, uns auf engsten Raum zusammenzutreiben, um uns mit einem Minimum an<br />
Wärtern und Aufwand in Schach halten zu können. Dazu hatten sie ihre Gründe, denn gegen<br />
Ende des Vormittags hörten wir das Ballern von Kanonen. Es konnte elf Uhr gewesen sein.<br />
Zwischen den Bäumen kam ein Mithäftling des Blocks 7 auf uns zu. Ich hatte ihn zum letzten Mal<br />
in Flossenbürg gesehen, als er mir in August 1944, auf Französisch, über den Vorstoß der<br />
Amerikaner in Avranches Bericht erstattet hatte. Diesmal, strahlend vor Glück, wusste er uns zu<br />
erzählen, dass die Amerikaner sich auf sieben km Entfernung befanden und schnell zu uns<br />
aufrückten. Ganz überzeugt war ich nicht, denn ich sah noch viele Wärter am Waldrand.<br />
102
Neue Kanonenschüsse, diesmal deutlich näher, nahmen mir den restlichen Zweifel. Die Panzer<br />
rückten näher. Auf der Straße zogen einzelne Grüppchen der Wehrmacht in großer Eile vorbei.<br />
Dann, plötzlich verlief alles sehr schnell. Ich blickte in die Richtung vom Dorf, wo wir am Morgen<br />
durchgezogen waren. Tief im Tal gelegen war es nicht zu sehen, aber ein laufendes Artilleriefeuer<br />
ging los und die Treffer waren wie aus dem Tal aufsteigende Geiser zu beobachten. Es kam vom<br />
Dorf und als das Feuer nach weniger als einer Minute eingestellt wurde, rollten die Panzer, wie<br />
dem Boden entsprossen, auf weniger als fünfhundert Meter auf uns zu. Im gleichen Augenblick<br />
ratterten die Maschinenpistolen auf unserer Seite. Es waren unsere letzten Wärter, die den<br />
Rückzug deckten und sich davon machten. Ein Kapitän der Wehrmacht, mit dem Revolver in der<br />
Hand, stand auf der Straße und schrie seinen Männern etwas zu, was ich nicht verstehen konnte.<br />
Das war für mich der letzte Schrecken, denn ich befürchtete, dass der Offizier den Befehl zu einer<br />
letzten Widerstandsstellung geben würde und in dem Fall wäre unserem Hain das gleiche<br />
Schicksal wie dem Dorf beschert worden; das hätte für uns alle das Ende bedeutet. Es verlief<br />
anders. Die Soldaten liefen davon, weiter auf der Flucht. Ich schrie den anderen zu, aus dem Hain,<br />
über die Straße zur Wiese, zum Bach zu rennen. Durch die Schneeschmelze war der Bach stark<br />
angestiegen. Valet, Boucher und ich - wo waren die anderen? - wadeten durchs Wasser. Wir<br />
erreichten ein kleines Häuschen. Rauch stieg aus dem Schornstein hoch. Schlaraffenland? oder nur<br />
eine Vision? Die dort untergebrachten deutschen Truppen hatten die Räumlichkeiten verlassen<br />
müssen, ohne fertig essen zu können: gebratene Täubchen, noch lauwarm auf dem ausgehenden<br />
Feuer, ein großer Korb voll mit Eiern, ein gerade angebrochener Topf Honig. Wir ließen es uns gut<br />
gehen.<br />
Wir befürchteten das Näherrücken des bewaffneten Kampfs, dem wir gerade aus dem Weg gehen<br />
wollten. Wir stiegen den Hang weiter hinauf, weiter weg von der Straße, bis zum Sägewerk. Unter<br />
riesigen Baumstämmen war eine Art Luftschutzraum mit einem rudimentären Erste-Hilfe-Posten<br />
eingerichtet. Erst dann bemerkte ich die Wunde am Fuß: der Riemen der Pantine hatte die Haut<br />
der Ferse bis auf den Knochen aufgerissen. Die Narbe ist heute noch zu sehen. Nachdem wir<br />
unsere Wunden und Verletzungen soweit verpflegt hatten, gingen wir den Hang weiter hinauf,<br />
bis zum großen Bauernhof, zu dem das Sägewerk gehörte. Seit langem arbeiteten dort<br />
französische Kriegsgefangene, zusammen mit einem polnischen Knecht. Einige unserer Kolonne<br />
hatten sich bereits dahin gerettet. Man kümmerte sich um uns. Der Pole brachte uns eine von der<br />
Bäuerin zubereitete Hühnerbrühe. Die Männer einer amerikanischen Patrouille überließen uns<br />
ihre Tagesration. Die darauffolgende Nacht schliefen wir im Heustall. (1965, zwanzig Jahre später,<br />
genau am 23. April, während der Pilgerfahrt in Begleitung von drei Kameraden sollte ich nicht nur<br />
das Häuschen der ersten Mahlzeit, sondern auch den polnishen Arbeiter wiedersehen. Der Pole,<br />
der kaum älter aussah als damals, war geblieben und hatte im Häuschen eine Unterkunft<br />
gefunden.) Nach drei weiteren Nächten im Dorf, wo inzwischen die Briten die Amerikaner<br />
abgelöst hatten, fand ich meine Kräfte wieder, um zur Stadt Cham aufzurücken. In der Kreisstadt<br />
Cham wurde - so sagten uns die Briten- die Regruppierung organisiert.<br />
Die Witwe eines deutschen Magistraten, in deren Haus wir die letzte Nacht verbrachten, hatte mir<br />
einen Anzug und ein Paar Schuhe ihres Sohns gegeben. Er war an der russischen Front gefallen.<br />
Entlang der Straße, die über sechs Kilometer nach Cham führte, lagen mehrere Leichen, Häftlinge<br />
unserer Kolonne. Nach zwei weiteren Tagen, untergebracht in einem klosterähnlichen Gebäude,<br />
wurden wir ganz plötzlich von den Amerikanern verlegt. Sie brauchten das Gebäude in Cham, um<br />
eine Einheit rumänischer Soldaten, die sich ergeben hatten, unterzubringen. Wir bekamen eine<br />
Unterkunft außerhalb der Stadt, in einem intakt gebliebenen, für die Hitlerjugend eingerichteten<br />
Heim. Dort sollten wir vom 24. April bis zum 3. oder 4. Mai bleiben. Unter den mehr als<br />
zweihundert Zusammengeführten aller Nationalitäten befanden sich mehrere Dutzend<br />
Überlebende aus den Konzentrationslagern. Die russische, französische und jugoslawische<br />
Nationalfahnen wehten am Fahnenmast. Ein britischer Offizier überwachte - “very british“ ernst -<br />
die Versorgung und Verpflegung, die uns von einigen Freiwilligen aus Cham - angeblich<br />
Honoratioren der Stadt - geleistet wurden. Eine Freiwillige der französischen Armee, dem<br />
militärischen Abzeichen nach Leutnant, kompetent und charmant, legte die Kontakte. Ich meine,<br />
es war Brigitte Gros, die es später zur Bürgermeisterin einer Pariser Vorstadt bringen sollte. Sie<br />
kümmerte sich um unsere Repatriierung. An einem Nachmittag trafen mehrere französische<br />
Militärplanwagen ein, von französischen Soldaten gefahren. Kaum waren wir eingestiegen, fuhren<br />
die Lkw mit Vollgas gen Westen, während der ganzen Nacht. Nur einmal wurde Halt gemacht.<br />
Am Morgen stiegen wir in Würzburg aus und wurden in einem blitzartig eingerichteten<br />
103
Auffangzentrum untergebracht. Würzburg war schwer von den Bomben getroffen worden, aber<br />
die Eisenbahn nach Frankreich war wieder in Betrieb gestellt worden. Am Nachmittag des<br />
daraufflogenden Tages stiegen wir in die Waggons eines langen Güterkonvois ein. Vierzig<br />
Personen pro Waggon. Die Überlebenden aus den KZs wurden über zwei Wagen verteilt. Es<br />
dauerte sehr lang, bis wir Frankreich erreichten: eine kleine französische Nationalfahne - eine<br />
Tricolore -, ganz bescheiden am Rande des Schotterbetts in die Erde gesteckt, zeigte uns, dass wir<br />
wieder in Frankreich waren. Freude! Umarmung! Freudentänen!<br />
Am 6. Mai waren wir die ersten Gäste des Repatriierungszentrums, das zu Boulay an der Mosel<br />
eingerichtet worden war. Wir waren die ersten, die aus der Deportation in diesem Zentrum<br />
eintrafen, noch vor den Kriegsgefangenen, die - insgesamt 1.200.000 - nun auch allmählich<br />
heimkehrten. Den Bediensteten, beim Anblick der ausgemergelten Kameraden völlig entsezt,<br />
fehlten die geeigneten Mittel zu unserer Versorgung. Sie konnten nicht mehr als unsere<br />
Repatriierungsausweise und die Reisedokumente ausstellen und uns anderntags zum Bahnhof<br />
nach Metz befördern. Außer mir nahmen alle den Zug nach Paris. Für alle bedeutete das der<br />
Abschied. Als wollten wir uns bei diesem Abschied gegenseitig unsere Solidarität äußern, erklang<br />
auf einmal - ganz spontan - Marseillaise unter dem Gewölbe des Bahnhofs, vor den verblüfften<br />
und sprachlosen Einwohnern der Stadt.<br />
Die Nacht verbrachte ich allein in einem anderen, fast leeren Auffangzentrum und anderntags,<br />
am 8. Mai gegen fünf Uhr morgens wurde ich von einer Rote-Kreuz-Krankenschwester geweckt.<br />
Sie brachte mich mit dem Krankenwagen zum Bahnhof, wo ich in den Omnibus nach Nancy<br />
einstieg. Noch vor acht Uhr kam ich an. Niemand beachtete mich. Von dort ging ich zu Fuß zur<br />
Felix-Faure-Straße und klingelte an der Haustür meiner alten Freunde Müller, die mich seit 1941<br />
nicht mehr gesehen hatten. Sie fielen aus allen Wolken.<br />
Nachdem ich die Freude des Wiedersehens etwas abgebremst hatte, erkundigten sie sich am<br />
Bahnhof, wo sie erfuhren, dass am gleichen Tag, kurz nach Mittag, der erste Schnellzug von Paris<br />
nach Straßburg geplant war. Bereits um vier Uhr stand ich auf dem Zaberner Bahnhof. Ich wollte,<br />
dass meine Eltern, am anderen Ende der Stadt, als erste von meiner Heimkehr erfuhren. Um die<br />
Stadtmitte und die Hauptstraße zu vermeiden, ging ich um die Stadt herum nach Hause. Mein<br />
Vater war im Gespräch mit dem Nachbarn. Als ich auf etwa dreißig Meter von ihnen entfernt war,<br />
bemerkten sie den kleinen, grotesk gekleideten Franzosen, der auf sie zukam. Ich hörte, wie mein<br />
Vater noch zum Nachbarn sagte: «Der Bursche kommt aus dem Krieg heim. Fragen wir mal, ob<br />
wir ihm helfen können.» Erst im Augenblick, als ich ihm zulächelte, erkannte er mich wieder. Er<br />
konnte seine Aufregung nicht verbergen. Die Nachricht meiner Heimkehr verbreitete sich wie ein<br />
Lauffeuer. Mein Jugendfreund, Lucien Host, Ende 1940 aus dem Elsass geflüchtet und zur Zeit<br />
meiner Verhaftung Lehrer in der Auvergne, suchte mich als erster auf und fasste auf<br />
übersichtliche Weise das Geschehen in der Zeit meiner Abwesenheit zusammen. Während unseres<br />
Gesprächs meldete der Rundfunk die Kapitulation Deutschlands.<br />
Seit unserer Befreiung im Örtchen Untertraubenbach, Gemeinde Thierlstein, am 23. April 1945,<br />
waren sechszehn Tage vergangen, in denen ich mich wieder normal ernähren hatte können, d.h.<br />
ich as von allem. Fast hätte eine ernsthafte, akute Leberbeschwerde mich außer Gefecht gesetzt,<br />
nachdem ich zusammen mit Freunden eine nicht ganz durchgebratene, fette Ganz verspeist hatte.<br />
Da ich mich zur Zeit meiner Befreiung nicht auf die Waage hatte stellen können, hielt ich es später<br />
für unwichtig, dies in Zabern nachzuholen. Jedoch war mir anzusehen, das ich bereits um etliche<br />
Pfunde zugenommen hatte. Trotzdem war ich noch ein Foto wert und in den zwei Tagen nach<br />
meiner Heimkehr stürmten die Amateurfotografen, ganz gerührt und mitfühlend, unsere gute<br />
Stube. Der menschliche Stoffwechsel war für mich immer ein Buch mit sieben Siegeln, jedoch weiß<br />
ich, dass mein Nacken, den ich von meiner Großmutter väterlicherseits - von der Riesin - geerbt<br />
habe, mir immer eine zusätzliche Ablage zur Verfügung stellt, etwa zehn Kilo Körpermasse mehr<br />
als bei den Kameraden, die zusammen mit mir den stetigen Hunger erlebt hatten. Eine zusätzliche<br />
Gabe fürs Leben und fürs Überleben.<br />
Rober Antelme, am 20. Oktober 1999 verstorben, wog zu “normalen“ Zeiten neunzig Kilo, jedoch<br />
nur noch zweiunddreißig, als 1945 François Mitterrand, junger Minister für Gefangene und<br />
Repatriierte zuständig, ihn im Sterbeheim des KZ Dachau antraf. Nach dem Todesmarsch zum<br />
Lager Dachau wurde er wegen Typhus zurückgehalten. Mit Hilfe der Schriftstellerin Marguerite<br />
104
Duras und einiger weiteren Kameraden seiner Widerstandsgruppe gelang es Mitterrand, ihn<br />
wieder nach Frankreicht zu bringen. Ich führe hier den Fall «Antelme» auf, denn das einzige<br />
Werk, das er uns hinterlassen hat (“L’espèce humaine“ - Die Spezies Mensch, Gallimard 1947, 1957<br />
neu aufgelegt) stellt ein Meisterwerk dar und beschreibt die Konfrontation der Menschenliebe mit<br />
dem Grausamen des Lebens in den Konzentrationslagern:<br />
«Er kam wieder, nachdem er sich als Freiwilliger für die Patrouille gemeldet hatte. Er kam<br />
wieder mit einem großen Sack, gefüllt mit Lebensmitteln. Jeden Tag, zwei Wochen lang,<br />
kam er wieder. Jedes Mal gelang es ihm, den anderen das Lebensnotwendige zu besorgen.<br />
Er schaffte es immer wieder. Am Ende der zweiten Woche erklärte er den anderen, dass<br />
seine Einheit das Dorf evakuieren wollte und sich zurückziehen, dass er nicht mehr<br />
kommen würde, dass sie aber wieder zu ihrem Dorf zurückkehren könnten. So war es. Sie<br />
fanden wieder eine Unterkunft in ihrem vernichteten Dorf, zwischen den Leichen unserer<br />
Zuaven, die mit Stich- und Hiebwaffen gekämpft hatten.»<br />
Epilog<br />
Das Rätsel um André Royer<br />
Nachdem sie mir, an jenem 8. Mai 1945, in groben Zügen die wichtigsten Ereignisse seit der<br />
Befreiung geschildert hatten, verweilten meine beiden Jugendfreunde, Lucien Host und seine Frau<br />
Malou, noch mehrere Stunden bei mir in Zabern und erzählten mir ausführlich das Widerfahren<br />
unserer gemeinsamen Bekannten. Es war Malou, die als erste im Lauf des Gesprächs den Namen<br />
André Royer fallen ließ. Ich war völlige überrascht, als ich von ihr erfuhr, dass ihr Vater, Inspektor<br />
der Eisenbahn in Lothringen, ein Vetter ersten Grads von André Royers Vater war, letzterer selbst<br />
Bahnhofsvorsteher in Saargemünd. Malou und André, beide Einzelkind, waren so gut wie<br />
zusammen aufgewachsen. Seit langem, zumindest seit Herbst 1944, seit ihrer Rückkehr ins Elsass<br />
aus ihrer Zufluchtstätte in den Cevennen wussten sie, dass André, im Juni 1943 von der Gestapo<br />
verhaftet, am 30. Oktober 1943 die Flucht aus dem Deportationskonvoi auf dem Weg nach Dachau<br />
gelungen war, dass er später wieder aufgegriffen und vom Gefängnis zu Metz in isolierter Haft<br />
nach Buchenwald gebracht worden war.<br />
Ich sage ihnen, das ich André im Mai 1944 im Lager Buchenwald wiedergefunden hatte, am<br />
Leben, aber aufgrund des Fluchtversuchs in einer bedrohlichen Situation. Ich versprach ihnen,<br />
mich bei meiner Rückkehr nach Clermont-Ferrand unmittelbar über sein Schicksal zu erkundigen.<br />
Immerhin gehörte André zu den Kameraden, die ich auf Anweisung des Henri Weilenbacher<br />
unter den Universitätsstudenten rekrutiert hatte.<br />
Anfang Juni 1945 stieg ich am Zaberner Bahnhof in den Zug nach Clermont-Ferrand. Beim<br />
Umstieg in Paris, kurz vor der Abfahrt, traf ich auf dem Bahnsteig - Überraschung! - drei<br />
Überlebende, ebenfalls auf dem Weg nach Clermont. Einer von den drei war Pfeffer, bereits vorher<br />
erwähnt, begleitet von… Paul Hagenmüller, der von der Evakuierung im April 1945 verschont<br />
geblieben war und die Befreiung im Lager Buchenwald erlebt hatte. Während der Zugfahrt kam<br />
das Gespräch bereits nach kurzer Zeit auf Royer. Paul versicherte mir, in gutem Glauben und mit<br />
Überzeugung, dass wir uns gar keine Illusionen über André machen sollten, denn als die SS zur<br />
Evakuierung aus Buchenwald angesetzt hatten, hatten sie alle, die aufgrund eines Fluchtversuchs<br />
aufgelistet waren, ermordet, um sich eine Sonderüberwachung während des Marsches nach<br />
Flossenbürg zu ersparen.<br />
Sofort nach der Ankunft in Clermont ging es zu unseren jeweiligen Universitätsfakultäten und ich<br />
begleitete Hagenmüller zu den Chemielabors, wo Kirrmann, ebenfalls wieder eingetroffen, bereits<br />
die Leitung seiner Abteilung übernommen hatte. Kirrmann sorgte für Emotionen, als er unser<br />
Leiden und unsere Toten in Erinnerung rief. Alle anwesenden Assistenten standen rundum uns<br />
und erkundigten sich nach Royer. Auch Kirrmann hatte die Befreiung des Lagers Buchenwald vor<br />
Ort erlebt und auch er war der Überzeugung, dass André ermordet worden war.<br />
105
In den darauffolgenden Tagen des Junis 1945 wurde von den Professoren und Studenten -<br />
insbesondre unter dem Impuls des Literaturprofessors Jean Lassus, Überlebender aus Dachau, die<br />
Basis zur Gründung, beim Semesterbeginn, des Vereins »Jean Cavailhès« gelegt. Bis 1940 war Jean<br />
Cavailhès Mathematikprofessor an der Straßburger Universität, danach, in Lille, Gründer des<br />
Widerstandsnetzes »Libération-Nord« und wurde von den Nazis fusilliert. Ziel des Vereins, ein<br />
Doppelziel, war, das Los und Schicksal all unserer Deportierten nachzugehen und unsere<br />
Augenzeugenberichte zur späteren Veröffentlichung aufzusetzen und einzusammeln.<br />
Alle Informationen und Angaben über das Verschwinden von André stimmten also überein.<br />
Außerdem berichtete Jean Lassus uns, dass die Eltern von André sich nicht mit dem Tod ihres<br />
einzigen Sohns abfinden wollten oder konnten. Noch im Herbst 1943 hatten sie ihn im Gefägnis zu<br />
Metz besuchen können und bis Herbst 1944 hatten sie ihm regelmäßig Pakete aus dem<br />
annektierten Departement Moselle ins Lager Buchenwald geschickt. Dementsprechend, aufgrund<br />
der moralischen Erfordernisse, ihnen unnötiges Leid zu ersparen, vereinbarten wir, den<br />
unglücklichen Eltern keine Besuche zu erstatten und André nicht in die Namensliste zum Nachruf<br />
unserer Vermissten einzutragen.<br />
Vierzig Jahre gingen vorbei…<br />
1985 rief Malou Host mich aus den Cevennen an. Lucien Host hatte sich als berenteter<br />
Schuldirektor in diesem Gebirge am Rande des Zentralmassivs zusammen mit Malou<br />
zurückgezogen. Malou rief mich in Paris an, mit der Meldung, dass André Royer noch am Leben<br />
wäre! Mehr als das, was ihre Groscousine ihr geschrieben hatte, konnte sie mir nicht sagen,<br />
nämlich dass ihre Verwandte im Fernsehsender FR3, in einer Sendung von und mit Pierre<br />
Bellemare, die Aussage einesÜberlebenden aus dem Gulag gehört hatte, laut welcher André in<br />
einem sowjetischen Lager noch am Leben war!<br />
Obwohl alles sehr wage und ich sehr skeptisch war, ließ ich nicht nach, sofort zu ermitteln.<br />
Vorerst bekam ich gar keine Antwort auf meinen Brief an Pierre Bellemare, in dem ich ihn um<br />
nähere Angaben mit Bezug auf seine Sendung des 19. Mais 1985 bat. Auch Paul Hagenmüller,<br />
mittlerweile Professor an der Fakultät der Wissenschaften in Bordeaux-Talence, hatte ich<br />
benachrichtigt. Paul, anfangs der Meinung, dass es sich um eine “Ente“ handelte, versprach mir<br />
darüber nachzudenken. In der Folge rief er mich innerhalb mehrerer Monate zweimal an.<br />
Beim ersten Telefonat - selbst hatte ich noch keinerlei Nachrichten seitens Bellemare erhalten - gab<br />
Paul mir einen wichtigen Hinweis: Ende August 1944, nach der Bombardierung der Buchenwalder<br />
Fabriken durch die R.A.F. wurden die Werkstätten, in denen Royer beschaftigt war, über die<br />
Kommandos verteilt und André wäre zum Außenlager Ascherleben, ganz im Osten, verlegt<br />
worden. Also war er im August 1945 unter denen mit dem Fluchtversuchsabzeichen, die vor der<br />
Evakuierung erschossen wurden. Jedoch, fügte Paul unmittelbar hinzu, wurde auch Aschersleben<br />
Mitte Februar 1945 bombardiert, wahrscheinlich von der russischen Luftwaffe. Die Liste mit den<br />
Opfern der Bombardierung sollte in Buchenwald eingegangen sein und André Royer war als<br />
verstorben aufgeführt, so wusste ein deutscher Häftling der “Politischen Abteilung“, ein<br />
ehemaliger Kommunist, Otto “von Magdeburg“, zu berichten. Damals hatte Paul sich mit diesem<br />
Otto angefreundet. Später rief Hagenmüller noch einmal an und versicherte mir, sich noch genau<br />
erinnern zu können - nach langem Hin- und Hergrübeln -, dass nicht der Name »Royer« in der<br />
Liste auftauchte, sondern dessen Name mit dem eines anderen Gefallenen, den Otto “von<br />
Magdeburg“ ihm genannt hatte, verwechselt wurde.<br />
Das Alles wurde hieb- und stichhaltig, denn inzwischen, nach vielem Hin- und Herfragen nach<br />
allen Seiten - zu weitführend, um hier näher zu beleuchten, obwohl die Geistesgroßzügigkeit und<br />
die Zuwendung mehrerer Leute dabei zu Tage kam -, hatte ich erreichen können, dass Claude<br />
Contamine bei Pierre Bellemare intervenierte und letzterer in seiner Antwort an den<br />
Generaldirektor des Fernsehsenders »Antenne 2« angab, dass er am Ende der Sendung von 1985,<br />
»Au nom de l’amour«, eine Liste mit dem Namen André Royer vorgeführt hatte. In der Folge<br />
wurde diese Namensliste dem Werk des Pierre Rigoulot, »Des Français au Goulag, 1917-1984«<br />
(Fayard Verlag) hinzugefügt.<br />
106
Das war ein Hinweis, völlig verschieden von dem, den Malous alte Cousine aus der Sendung<br />
herausgehört hatte. Es war nicht der Überlebende Malouniam, der während der Sendung den<br />
Namen André Royer erwähnt hatte, und die Liste in der Anlage zum Buch von Pierre Rigoulot -<br />
Liste, auf der auch ein Nachkommen von Talleyrand vorkam - datierte aus den fünfziger Jahren!<br />
Eine Erklärung erhielt ich im Januar 1987 durch einen Anruf eines Mitarbeiters von Pierre<br />
Bellemare, Herrn Arnaud Randon, der mir mitteilte, dass dieser Talleyrand 1956 in einem Lager<br />
verstorben war. Herr Randon setzte mich mit Pierre Rigoulot, damals Vorsitzender des Instituts<br />
für Sozialgeschichte, und gab mir auch die Adresse des Vereins der Familien der Vermissten,<br />
unter dem Vorsitz der Frau Hamburger.<br />
Am 19. Januar 1987 schrieb Pierre Rigoulot mir persönlich und legte seinem Brief eine Ablichtung<br />
einer 1958 in der französischen Botschaft zu Moskau erstellten Karteikarte bei: diese Karteikarte<br />
bestätigt, dass André Royer bei der Befreiung in 1945 tatsächlich im Kommando zu Ascherleben<br />
untergebracht war, zusammen mit etwa vierzig Häftlingen, von denen die eine Häfte von den<br />
Amerikanern befreit wurde und 1945 heimkehren konnten. Die andere Hälfte, von den Russen<br />
befreit, kehrte nie heim!<br />
Höchst außergewöhnlich, wie Pierre Rigoulot in seinem Brief vermerkte, war jedoch die Tatsache,<br />
dass die Karteikarte erwähnt, dass deren Anfertigung auf einer Information beruht, die vom<br />
Bürgermeister von Saargemünd vermittelt wurde und laut deren André Royer und seine<br />
Kameraden sich am Tag des 17. Dezembers 1945 noch in ziemlich guter Gesundheit befanden!<br />
Auch ich war der Meinung, dass man auf dieser Seite nachhaken sollte. Aber wie? Unverständlich<br />
ist, dass der Saargemünder Bürgermeister eine solche Nachricht übermittelt haben sollte, da,<br />
logischerweise, ihm die Nachricht von der französischen Botschaft aus Moskau erreichen hätte<br />
müssen, bevor er sie dann weiterleiten hätte können! Und was mir noch atemberaubender<br />
erschien, war die Tatsache, dass keiner von uns, heimgekehrten Universitätsstudenten, je davon<br />
erfahren hatte, obwohl wir die Ermittlungen und Nachforschungen innerhalb des Vereins<br />
Cavailhès gebündelt hatten.<br />
Ich hatte die Verbindung, zwar auf Entfernung, mit dem Vorsitzenden des Gerichts zu<br />
Saargemünd aufrecht erhalten. Gérard Bach war wie ich am 25. November 1943 in Clermont<br />
verhaftet worden und 1945 aus Buchenwald befreit. Nach einer langen Laufbahn in den<br />
Überseegebieten wurde er erste Vorsitzender des Berufungshofs. Obwohl ich feste überzeugt war,<br />
dass André seit langem umgekommen war, schrieb ich Gérard Bach einen Brief an seinen Amtsitz<br />
in Riom und erklärte ihm den Fall. Das war im Frühjahr 1987. In den darauffolgenden Tagen rief<br />
Gérard mich an. Er stand kurz vor dem Ruhestand, bestätigte mir seinen immer noch engen<br />
Kontakt nach Saargemünd und versprach mir, nachzugehen, was Ende 1945 im Bürgermeisteramt<br />
vor sich gegangen war. Ich warte heute noch auf eine Antwort, oder besser gesagt, ich erwarte<br />
keine Antwort mehr. Ich kenne Gérard als zuverlässig und treu und wenn er mir kein Zeichen<br />
gab, dann eben wiel er nichts ausfindig machen konnte.<br />
So bleibt der Fall André Royer ein Rätsel. Ich bin mir sicher, dass er lange gekämpft hat, bevor er<br />
in die Hoffnungslosigkeit und in den Tod versank. Er war bereit gewesen, sich in den Widerstand<br />
zu engagieren. Er war zu einer gewagten Flucht fähig gewesen. Er hatte sich sehr schnell an alle<br />
neuen Umstände und Bedingungen anpassen können. Es würde mich nicht wundern, dass er die<br />
Bombardierung des Kommondas Aschersleben genutzt hat, um die Identität zu wechseln, die<br />
Identität eines bei der Bombardierung gefallenen russischen Häftlings anzunehmen, was ihn<br />
danach bei der Befreiung des Kommandos durch die Sowjets vor neue Probleme gestellt hat. Wie<br />
dann auch, keiner dieser zwanzig Häftlinge wurde jemals freigelassen, denn - während des Kalten<br />
Kriegs - “der Kontakte mit dem westlichen Feind“ verdächtigt. Zur Zeit meiner Ermitttlungen<br />
erzählte mir Arnaud Randon, dass einer dieser zwanzig Häftlinge identifiziert worden war, dass<br />
der französische Botschafter ihn, von drei KGB-Männern umgeben, hatte sprechen können und<br />
dass seine Freilassung nicht in Frage gekommen war.<br />
Ich mache hier nicht dem Sowjetregime den Prozess. Ich habe damals, in den Zeiten der Gefahr,<br />
aufrechte und entschiedene Kommunisten kennengelernt. Ich schätze die Großzügigkeit eines<br />
Girnus und seiner Kameraden, die später von dem absolutistischen Bürokratismus ausgeschlossen<br />
107
wurden. Ich vergesse nie die Ablehnung und Verurteilung des Teufelspakts vom August 1939<br />
zwischen Hitler und Stalin seitens der deutschen Kommunisten der ersten Garde, die in<br />
Buchenwald eingesperrt wurden. Ich erninnere mich deren Überzeugung, dass nach dem Krieg<br />
Stalin in Lubjanka eingesperrt werden sollte. Ihre Hoffnungslosigkeit ist unvergleichbar groß<br />
neben der Verbitterung, die ich empfinde und die in mir nagt, bei dem Gedanke, dass André<br />
wegen des Hirnverbrannten eines der menschlichen Natur völlig entgegengesetzten Systems<br />
verschwand.<br />
108
MARGRAFF, Henri Marie-Joseph<br />
• geboren : 31.01.1920, Zabern, Departement Bas-Rhin<br />
• verstorben : 11.10.2006, Le Cannet, Departement Alpes-Maritimes<br />
• INHAFTIERUNGEN<br />
von bis Ort<br />
25.11.43 10.03.44 Clermont-Ferrand<br />
16.03.44 27.04.44 Compiègne<br />
• DEPORTATION<br />
Ankunft Abfahrt Ort<br />
27.04.44 12.05.44 Auschwitz<br />
13.05.44 25.05.44 Buchenwald<br />
25.05.44 23.04.45 Flossenbürg<br />
• Befreit am 23.04.45 in Flossenbürg<br />
• Ausweis des Widerstands Nr. 101730857<br />
• Tätowierung Auschwitz Nr. 186011<br />
Albert KIRRMANN (1900-1974)<br />
PERSONENVERZEICHNIS<br />
Geboren zu Straßburg am 28. Juni 1900 in einer elsässichen Familie, die Frankreich mit<br />
Herz und Seele und in der Sprache treu blieb.<br />
1918 wurde Albert Kirmann in die Deutsche Armee einberufen und es ist nur dem<br />
Waffenstillstand zu verdanken, dass er nicht gegen das eigene, freiwillig gewählte<br />
Vaterland zu kämpfen brauchte.<br />
Nach brilliantem Studiumabschluss brachte er es zu einem der Wegbereiter der modernen<br />
organischen Chemie. 1935 übernahm er den Lehrstuhl für organische Chemie an der<br />
Universität Straßburg.<br />
Infolge des Waffenstillstands von 1940 sah die Universität Straßburg sich gezwungen,<br />
nach Clermont-Ferrand auszuweichen. Dort führte Kirrmann seine Arbeit weiter, bis zu<br />
seiner Verhaftung am 25. November 1943 anlässlich der “Grande Rafle“. Bis zum 9. Januar<br />
1944 war er im Gefängnis zu Clermont-Ferrand, vom 10. bis zum 22. Januar 1994 im Lager<br />
zu Compiègne inhaftiert.Vor dort wurde Kirrmann am 24 Januar 1944 ins Lager<br />
Buchenwald deportiert, überlebte 15 Monate Haft und wurde am 19. April 1945 von der<br />
amerikanischen Armee aus dem Lager befreit. Sein Charisma, seine Großzügigkeit und<br />
seine Güte bedeuteten eine erhebliche Hilfe und Unterstützung für seine Gefährten, die<br />
zusammen mit ihm den Leidensweg des Konzentrationslagers erlebten.<br />
Nach dem Krieg führte er seine Arbeiten als Dozent und Forscher erst an der Universität<br />
Straßburg, später an der “ENS - École Normale Supérieure“ in Paris, rue d’Ulm, weiter<br />
und von 1955 bis 1970 übernahm er dort das Amt des stellvertretenden Direktors.<br />
Der Tod seines krebserkrankten Enkels, seines einzigen Sohns und seiner Frau, die noch<br />
schwerer als er unter diesen Verlusten leidete, trübten seine letzten Jahre. Am 3. Oktober<br />
1974 starb er an den Folgen einer Krebskrankheit.<br />
In seinem Bericht “Kirrmanns Schwur“ huldigt Henri Margraff diesen außergewöhnlichen<br />
Menschen.<br />
109
Henri MARGRAFF (1920-2006)<br />
Student an der Universität Straßburg in Clermont-Ferrand, Mitglied des ORA.<br />
Zurück aus der Deportation verbrachte er ein Jahr im Sanatorium und führte anschließend<br />
sein Jurastudium an der Universität Straßburg fort, wo er avocat stagiaire wird. 1950<br />
wechselte er in die Privatwirtschaft als Leiter der Personabteilung der S.E.V. MARCHAL<br />
in Paris.<br />
Mütterlicherseits - Cécile Wild - hatte Henri M. noch einen Vetter, der 1905 in die<br />
Vereinigten Staaten auswanderte (sein Name, Felix Jehl, ist auf Ellis Island bekannt;<br />
vermutlich wurde er als Einwanderer deutscher Herkunft eingetragen, denn seit 1871 war<br />
das Elsass an Deutschland angeschlossen, 1917 kämpfte er im amerikanischen Uniform<br />
zur Befreiung des Elsasses). Die Halbschwester der Cécile Wild wanderte 1926 ebenfalls in<br />
die VS aus und ihre Tochter, Paulette Lollar Roberts, wurde 1945 in New York geboren.<br />
Vor kurzer Zeit ging sie, nach einer erfolgreichen Karriere als Krankenhausmanagerin, in<br />
den Ruhestand und lebt im Bundesstaat New Jersey.<br />
Marcel CALLO (1921-1945)<br />
Als junger Schriftsetzer wurd Marcel Callo im Rahmen der Zwangsarbeitsmaßnahme STO<br />
(Service due Travail Obligatoire) nach Deutschland deportiert. Am 19. April 1944 wurd er<br />
aufgrund seiner Tätigkeit bei der Action Catholique (Katholische Aktion) in Gotha<br />
verhaftet und inhaftiert. Von Gotha wurde er zum Lager Flossenbürg gebracht, später<br />
zum Lager Mauthausen, wo er am 19. März an Erschöpfung starb.<br />
Am 4. Oktober 1987 wurde Marcel CALLO vom Papst Johannes-Paulus II selig<br />
gesprochen.<br />
François AMOUDRUZ (°07.09.1926)<br />
Im Alter von 17 Jahren verhaftet - wegen der Lebensmittelkarten, die er bei sich trug -<br />
wurde er nach Buchenwald und Flossenbürg deportiert. François Amoudruz ist der<br />
Bruder der Historikerin Madeleine Rébérioux. Nach seiner Rückkehr aus Deutschland<br />
schließ er das Jurastudium an der Straßburger Universität ab, wurde avocat stagiaire und<br />
brachte es zum Bankdirektor. Zur Zeit ist er weiter aktiv im Verein der Deportierten.<br />
André BOULLOCHE (1915-1978)<br />
Als Widerstandskämpfer wurde er am 27. April 1944 zum Lager Flossenbürg deportiert.<br />
Unter General De Gaulle war André Boulloche Bildungsminister. Er war Bürgermeister<br />
der Stadt Montbéliard. Er kam ums Leben bei einem Flugzeugunfall.<br />
Dietrich BONHOEFFER (4.2.1906 - 9.4.1945)<br />
Evangelischer Theologe, schloss sich der Widerstandsbewegung um Canaris an. Nach<br />
dem Attentat vom 20. Juli 1944 wurde auch Dieter Bonhoeffer verhaftet und nach<br />
Buchenwald, später nach Flossenbürg deportiert, wo er am 9. April 1945 gehängt wurde.<br />
Colonel Jacques BOUTET (1890 - 10.5.1944)<br />
Nach dem Einrücken der deutschen Truppen in die “Freie Zone“ (November 1942)<br />
organisierte Jacques Boutet die O.R.A. (Organisation de Résistance de l’Armee), eine<br />
Widerstandsbewegung innerhalb der französischen Armee, Kern des bewaffneten<br />
Widerstands in der Auvergne. Am 10. Mai 1944 wurde er fusilliert. Kurz vor seiner<br />
Erschießung schrieb er noch: «Heureux d’avoir servi la France!» (Glücklich, Frankreich<br />
gedient zu haben).<br />
Ursula BRANDT<br />
Auch «Panther» genannt, berüchtigt wegen ihrer Folterpraxen. Wahrscheinlich die<br />
Maîtresse vom Verräter Mathieu. Nach dem Krieg heiratete sie einen Franzosen und<br />
wurde nie gefunden.<br />
110
René BOUSQUET (1909 - 1993)<br />
Französischer Beamter, von Mai 1942 bis 31. Dezember 1943 Generalsekretär der Vichy-<br />
Polizei, während der Periode, in der die meisten der Judendeportationen stattfanden,<br />
insbesondre “Le Rafle du Vel d’hiv”, die Massenfestnahme im Pariser Winter-Velodrom<br />
am 16. und 17 Juli 1942. Wurde nach dem Krieg vom Höchsten Gerichtshof (Haute Cour<br />
de Justice) freigesprochen. Später wurde Bousquet im Journalismus und im Bankwesen<br />
tätig, wurde jedoch in den neunziger Jahren von der Justiz verhaftet, des Verbrechens<br />
gegen die Menschlichkeit beschuldigt und am 8. Juni wurde er, noch bevor das Urteil<br />
gesprochen wurde, von Christian Didier ermordet.<br />
Jean-Paul CAUCHI<br />
Geschichtsstudent und Leiter des “Front de la Jeunesse“ in Clermont-Ferrand. Er wurde<br />
Juni 1944 in Paris verhaftet, erst nach Buchenwald, später in einer Saline deportiert. Er<br />
wurde am 17. April 1944 erschossen.<br />
Paul COLLOMB<br />
Lehrer an der Fakultät der Philologie. Erschossen bei der Massenfestnahme am 25.11.1943.<br />
General Charles DELESTRAINT (1879 - 1945)<br />
Auf Vorschlag von Jean Moulin wurde er von De Gaulle zum ersten Befehlshaber der<br />
Armée Secrète, der Dachorganisation des Widerstands in der Süd-Zone, ernannt. Juni 1943<br />
wurde er festgenommen und zum Lager Struthof im Elsass deportiert, später nach<br />
Dachau, wo er am 19. April 1945, einige Tage vor der Befreiung des Lagers durch<br />
Genickschuss ermordet wurde.<br />
Robert DESNOS (4.7.1900 - 8.6.1945)<br />
Surrealistischer Dichter der Dada-Bewegung und Journalist.<br />
Aktiv in der Widerstandsbewegung “AGIR“, 1944 verhaftet und nach Auschwitz,<br />
Buchenwald, Flossenbürg und Floha deportiert. Am 8. Juni 1945, nach der Befreiung des<br />
Lagers, verstorben an Typhus in Theresienstadt.<br />
Paul DURRENBERGER<br />
Philologiestudent, 1943 in Paris verhaftet und zun Tode verurteilt, zum KZ<br />
Sachsenhausen deportiert. Mai 1945 in Prag verstorben.<br />
Pierre EUDES<br />
Zusammen mit Henri Margraff zum KZ Flossenbürg deportiert. Hat anlässlich der<br />
Beerdigung von H. Margraff eine rührende Rede gehalten.<br />
Brigitte GROS (1925 - 1975)<br />
Französische Politikerin und Schriftstellerin (Mitwirkung beim Film “Elle court, elle court<br />
la banlieue). Schwester von Jean-Jacques Servan-Schreiber und, zusammen mit Françoise<br />
Giroud, Mitgründerin der Wochenzeitung “L’Express“. Nach dem Krieg war sie Senator<br />
und Bürgermeisterin einer Pariser Vorstadt, Meulan.<br />
Guy GOUTTEBESSIS (°1927)<br />
Als Adoleszent nach Flossenbürg deportiert. Später machte er als Leiter der<br />
Personalabteilung der “Galleries Lafayette“ Karriere. Zur Zeit im Ruhestand in einem Ort<br />
zwischen Paris und Auvergne.<br />
Paul HAGENMULLER (°1921 zu Straßburg)<br />
Aufgrund seiner Tätigkeit in der Widerstandsbewegung am 28. Oktober 1943 nach<br />
Buchenwald deportiert. Am 15. April 1945 aus dem Lager, wo er Russisch lernte, befreit.<br />
111
Ehrenprofessor an der Fakultät in Bordeaux, Dozent und Forscher der Chemie. Mitglied<br />
der Wissenschaftsakademie Frankreichs und einer Reihe Wissenschaftsakademien über<br />
die ganze Welt.<br />
Léon HOEBEKE<br />
Im Ersten Weltkrieg wurde er schwer verletzt. Im Zweiten Weltkrieg ging er in den<br />
Widerstand. Am 27. April 1944 mit dem Konvoi der Tätuierten deportiert. Mitbegründer<br />
des Freundeskreises der Tätuierten.<br />
Georges HUSS<br />
Pharmazie-Assistent, an den Folgen einer Septizämie in Buchenwald verstorben.<br />
Alain und Jean KNALL-DEMARS<br />
Die beiden Brüder wurden deportiert. Nach dem Krieg gründeten sie ein kleines<br />
Unternehmen.<br />
Jean-Marie LUSTIGER (1926 - 2007)<br />
Geboren als Aaron Lustiger in einer jüdisch-askenasischen Familie. 1940 trat er in die<br />
Katholische Kirche. Seine Mutter wurde 1942 anlässlich einer Denunzierung ihres<br />
Arbeitgebers nach Auschwitz deportiert, wo sie in 1943 starb. Er war Pfarrer an der<br />
Sorbonne-Universität, Pastor der Kirchengemeinde Ste.-Jeanne-de-Chantal, Bischof von<br />
Orléans und Erzbischof von Paris. Eng mit Papst Johannes-Paulus II befreundet.<br />
Georges MATHIEU (1919 - 1944)<br />
Geboren zu Clermont-Ferrand. Militärschule Saint-Cyr in 1940, erreichte jedoch nicht den<br />
Jahrgang «Maréchal Pétain», hatte die Absicht nach London zu fliehen. Anfangs in Reihen<br />
des Widerstands an der Universität, wurde zur rechten Hand von Cauchy, Gründer des<br />
Widerstandsnetzes “Combat Étudiant“ als 1942 die Widerstandsbewegungen in<br />
Clermont-Ferrand zu “Mouvements Unis de la Résistance - M.U.R.“ fusionierten.<br />
Mathieu wurde zum Verräter und sein Verrat führte zur Massenfestnahme am 24. Juni<br />
1943 in der Gallia, dem Vereinshaus der Studenten aus Elsass-Lothringen, und zur<br />
Massenfestnahme am 25. November 1943. Er denunzierte alle seinen<br />
Widerstandsgruppen. Am 13. September 1944 wurde er verhaftet und versuchte sich als<br />
Doppelagent darzustellen. Er wurde dem Gericht zu Clermont überführt, zum Tode<br />
verurteilt und am 12. Dezember 1944 durch Erschießung hingerichtet, zu einem<br />
Zeitpunkt, da die Deportierten noch in den Lagern inhaftiert waren.<br />
François MARTZOLFF<br />
Jurastudent. Verhaftet wegen Spionage und am 10. Mai 1944 in Clermont füsiliert.<br />
Marcel PAUL (1900 - 1982)<br />
Kommunist und Widerstandskämpfer nach Buchenwald deportiert,wo er seinen<br />
kommunistischen Freunden und auch dem Juden Marcel Bloch, alias Marcel Dassault,<br />
half. Der Fleugzeugkonstrukteur war ihm sein Leben lang dankbar. In 1946<br />
kommunistischer Minister des Industriewesens.<br />
Jean MOULIN (1899 - 1943)<br />
Absolvierte das Jura-Studium. Als jüngster Sous-Préfet (Landrat) Frankreichs von De<br />
Gaulle damit beauftragt, den Widerstand zu gruppieren, Leiter des “Conseil National de<br />
la Résistance“ (Nationalrat des Widerstands). Verhaftet am 21. Juni 1943 auf<br />
Denunzierung, identifiziert und “befragt“ von Klaus Barbie starb er am 8. Juli 1943 an den<br />
Folgen der Folter in der Nähe von Metz, im Zug Paris-Berlin, der ihn zur weiteren<br />
Befragung nach Berlin bringen sollte.<br />
112
Am 19. Dezember 1964, unter General De Gaulle, wurde seine Asche im Pantheon<br />
beigesetzt.<br />
Christian PINEAU (1921 - 1995)<br />
Widerstandskämpfer. Am 14. Dezember 1943 zum Lager Buchenwald deportiert, April<br />
1945 befreit. Von 1945 bis 1958 sozialistischer Minister und Abgeordneter des<br />
Departements Sarthe. Als Außenminister war er an der Suez-Expedition mitbeteiligt. Am<br />
Verhandlungstisch des Rom-Abkommens zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.<br />
Unterzeichnete den Tunesien-Unabhängigkeitsvertrag als Vertreter Frankreichs. Weiter<br />
noch Schriftsteller: politische Sachbücher und Erzählungen für Kinder.<br />
Louis POUTRAIN (verstorben ím Dezember 1983)<br />
Junger Vikar, erst in Boulogne, später im Departement Hautes-Alpes, wo er eine der<br />
ersten Berufsschulen gründete. Als Widerstandskämpfer wurde er zum Lager Flossenbürg<br />
deportiert.<br />
Rémy ROURE (1885 -1966)<br />
Widerstandskämpfer, in Rennes verhaftet und nach Auschwitz und Buchenwald<br />
deportiert. War Journalist bei “Le Monde“ und “Le Figaro“.<br />
André ROYER<br />
Student der Wissenschaften, verhaftet bei der Massenfestnahme der “Gallia“ am 25. Juni<br />
1943 (-> MATHIEU). Nach erfolgreicher Flucht aus dem Zug während seiner<br />
Deportierung nach Deutschland wurde er wieder festgenommen und in ein<br />
Vernichtungslager (?) geschickt.<br />
Carles SADRON (1902 - 1993)<br />
Professor für Malkromolekullehre an der Straßburger Universität. Mitglied des<br />
Widerstandsnetzes “Combat“, am 23. November 1944 in Clermont verhaftet. In Januar-<br />
Februar 1944 nach Buchenwald deportiert, in Februar nach Dora (Matrikel Nr. 42013), am<br />
3. Mai 1945 in der Mecklenburger Gegend befreit. Von 1961 bis 1975 Inhaber des<br />
Lehrstuhls für Biophysik am Musée d’Histoire Naturelle (Museum für Naturgeschichte).<br />
Preisträger des Holweck-Preises von der British Physical Society in 1942.<br />
Toni SIEGERT<br />
Deutscher Journalist, der die Erinnerung an Flossenbürg wach hielt.<br />
Georges STRAKA<br />
Geboren am 22. Oktober 1910 zu Tabor (Tschechoslowakei). Doktor der Philologie der<br />
Prager Universität. Lektor Tchechisch und mit dem Fach “Allgemeiner Phonetik“ an der<br />
Straßburger Universität beauftragt. Verhaftet am 25. November 1943 und am 24. Januar<br />
1943 nach Buchenwald deportiert (Matrikel Nr. 42031). Am 23. April 1943 von den<br />
Amerikanischen Streitkräften unter General Patton befreit.<br />
Marie-Claude VAILLANT-COUTURIER (1912 - 1996)<br />
Kommunistische Widerstandkämpferin, nach Buchenwald und Ravensbrück deportiert.<br />
1946 und von 1967 bis 1973 kommunistische Abgeordnete.<br />
Jean VALET(° 1927)<br />
Überlebte trotz Tuberkulose. War Direktor der “Villages de Vacances“ (Feriendörfer) im<br />
Südosten Frankreichs, wo er immer noch lebt.<br />
113
Simone VEIL (° 13.7.1927 - Simone Jacob)<br />
Deportierte. Gesundheitsministerin unter Valéry Giscard d’Estaing. Das Französische<br />
Abtreibungsgesetz ist unter dem Namen Veil-Gesetz bekannt. Wurde als erste Frau<br />
Vorsitzende des Europäischen Parlements. Karlpreisträgerin 1981.<br />
Henri WEILBACHER<br />
Jurastudent, Sekretär beim Polizeiamt zu Clermont-Ferrand. Wegen Spionage verhaftet<br />
und am 25. März 1944 fusilliert.<br />
114
ANHANG<br />
KURZGESCHICHTE DER WIDERSTANDSBEWEGUNG AN DER<br />
STRAßBURGER UNIVERSITÄT ZU CLERMONT-FERRAND<br />
Jacqueline Bromberger<br />
Abzeichen “Combattant Volontaire“<br />
Abzeichen “Combattant Volontaire de la Résistance“<br />
Ritter der Ehrenlegion<br />
Bei der Kriegserklärung in 1939 wird Straßburg vom Französischen Generalstab zur Militärzone ausgerufen<br />
und - im Gegensatz zu den anderen Teilen von Elsass-Lothringen - von amtswegen evakuiert.<br />
Diese Evakuierung führt dazu, dass alle Straßburger Fakultäten, auch die der Protestantischen Theologie,<br />
samt Professoren und Studenten nach Clermont-Ferrand auswandern. Clermont-Ferrand hat zwar eine<br />
Universität, jedoch nur die Fakultäten Philologie und Wissenschaften nebst einer Jura-und<br />
Medizinhochschule.<br />
I. KAPITEL - Die 3 Perioden des Widerstands an der Straßburger Universität zu Clermont-Ferrand<br />
1. Periode: Juni 1940 - Anschluss von Elsass-Lothringen<br />
• “Nie“ zurück ins Reich!<br />
• Professoren und Studenten, unter denen auch J.P. Cauchi, bauen mit Hilfe des Vize-Rektors und des<br />
Generals Delattre de Tassigny, Militärgouverneur von Auvergne, das “Chalet de Gergovie“.<br />
2. Periode: Oktober 1941 - Aufbau und Organisation verschiedener Widerstandsbewegungen in<br />
Clermont-Ferrand<br />
• Auf Antrag des Juraprofessors Alfred Coste-Floret gründet J.P. Cauchi “COMBAT- ÉTUDIANT“.<br />
• Verteilung von Zeitungen und selbsthergestellten Sprengstoffen.<br />
3. Periode: November 1942 - Deutsche Besatzung der Süd-Zone - Errichtung der “Mouvements Unis de<br />
la Résistance - M.U.R.“ (Vereinte Widerstandsbewegungen)<br />
• “COMBAT“, “LIBÉRATION“ und “FRANC-TIEREUR“ fusionieren in die “Mouvements Unis de la<br />
Résistance“.<br />
• Henri Ingrand, zum Führer des Widerstands der 6. Region ernannt, bestätigt J.P. Cauchi in seiner<br />
Leiterfunktion des Studentensektors.<br />
• Gefälschte Dokumente, Organisation des Maquis und der Freischützen.<br />
• Georges Mathieu wird zur rechten Hand von J.P. Cauchi.<br />
II. KAPITEL - Einschreiten der Gestapo gegen die Straßburger Universität. Laut Himmler ein<br />
Unternehmen zum Nationalinteresse des Deutschen Reichs.<br />
Dezember 1942: Verhandlungen zwischen Reichsführer HIMMLER und VON RIBBENTROP,<br />
Außenminister des Reichs<br />
• Himmler.“Die Universität muss geschlossen und zurück ins Reich geführt werden: 500<br />
deutschstammige Professoren und Studenten!“<br />
• Von Ribbentrop und Abetz, Botschafter Deutschlands in Paris: “Jawohl! Aber den Widerstand muss<br />
unter Vorwand von Polizeiaktionen zerschlagen werden!“<br />
1943 - 1944: Massenfestnahmen und Verhaftungen in den Universitätsgebäuden<br />
24. Juni 1943: Massenfestnahme in den Lokalen des Studentenvereins “Gallia“<br />
• Massenfestnahme in der “Gallia“, rue Rabanese, Studentfoyer der Studenten aus Elsass-Lothringen.<br />
• Repressalien am gleichen Abend, nachdem tagsüber 2 Gestapomänner in der Wohnung des<br />
Professors Flandin, rue Haute Saint-André, getötet wurden: 37 Studenten verhaftet.<br />
25. November 1943: Die große Massenfestnahme<br />
• Große Massenfestnahme in den Fakultäten der Straßburger Universität zu Clermont-Ferrand<br />
• Die Operation wurde sorgfältig von der Gestapo in Vichy und Clermont-Ferrand vorbereitet und von<br />
einer Einheit der Luftwaffen unterstützt.<br />
• 1200 Personen werden festgenommen und verhört; 110 von ihnen bleiben inhaftiert<br />
115
• Verrat des Georges Mathieu<br />
• Protest seitens des Vize-Rektors Danjon an Pierre Laval<br />
8. März 1944: Festnahme im Hôtel-Dieu<br />
• Mitglieder der Medizin-Fakultät der Straßburger Universität und der Hochschule für Medizin zu<br />
Clermont-Ferrand werden nach Denunzierung von Maucour, Vize-Direktor des Hôtel-Dieu, wegen<br />
“Résistance“ von der Gestapo festgenommen.<br />
• Am gleichen Tag, kurz nachdem andere Mitglieder der Universität an ihrem Wohnsitz festgenommen<br />
wurden, werden in der rue Montlosier (Place de la Poterne) 3 Granaten auf ein Deutsches<br />
Detachement geworfen<br />
• Nach Befehl aus höchsten Instanzen beschleunigt das Deutsche Militärgericht zu Lyon die laufenden<br />
Verfahren und die Exekutionen: vom 24. März bis 10. Mai<br />
• 1944: 3 Jurastudenten aus Elsass-Lothringen werden füsiliert: Alfred Klein, Henri Weilbacher,<br />
François Martzolff<br />
III. KAPITEL - DAS LETZTE LEBENSJAHR DES GEORGES MATHIEU. VERRAT, URTEIL UND<br />
EXEKUTION<br />
5. März 1994 - 13. August 1944: Verrat - Die 192 Tage des Französischen Sonderkommandos des Mathieu<br />
• Nach seiner Teilnahme an der Massenfestnahme am 25. November 1943, gründet Mathieu -<br />
zusammen mit Vermière, Bresson und Sautarel - ein Französisches Sonderkommando, das für die<br />
Gestapo arbeitet und letztere bei allen ihren Einsätzen unterstützt: Durchsuchungen, Verhaftungen,<br />
Verhöre, Aktionen gegen den Maquis<br />
• Im August 1944 flüchten Mathieu und Bresson, versuchen, sich als Doppelagenten zu retten<br />
• Festnahme am 13. September 1944<br />
17. November 1944 - 12.Dezember1944: Verfahren Mathieu - Urteil - Exekution<br />
• Verfahren vor dem Justizhof zu Clermont-Ferrand fast genau ein Jahr nach der “Großen<br />
Massenfestnahme“. Die Überlebenden der Deportation sind noch nicht heimgekehrt<br />
• Zum Tode verurteilt wird Mathieu am 12. Dezember 1944 füsiliert<br />
NACHWORT - FAZIT<br />
1945, DIE HEIMKEHR<br />
Im Monat Mai 1945 kehren die ersten Überlebenden aus der Deportation heim. Die Straßburger Universität<br />
zählt 139 Tote: Professoren, Verwaltungspersonal und Studenten.<br />
Jean-Paul Cauchi, Gründer und Leiter des “Combat Étudiant“, der am 4. April 1944 in Paris festgenommen<br />
und nach Buchenwald deportiert wurde, wird von den Nazis während der Evakuierung des KZ<br />
Buchenwald vor dem Aufmarsch der Amerikanischen Armee am 18. April 1945 erschossen. Er wird zum<br />
Kapitän ernannt und mit dem “Croix de Guerre avec Palmes“ und mit der “Légion d’Honneur“ posthum<br />
geehrt.<br />
Das Lehrerpersonal aus Elsass-Lothringen kehrt nach Straßburg zurück, jedoch schließen die Fakultäten in<br />
Clermont-Ferrand ihre Türen nicht und Clermont-Ferrand wird zu einer vollständigen Universität.<br />
116