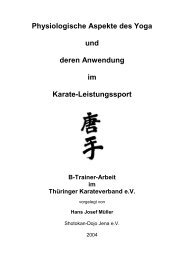Seminarfacharbeit - Kampfsport - Shotokan Dojo Jena eV
Seminarfacharbeit - Kampfsport - Shotokan Dojo Jena eV
Seminarfacharbeit - Kampfsport - Shotokan Dojo Jena eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ingt dem Schüler die technischen Fertigkeiten zur Selbstvervollkommnung bei. Er ist<br />
nicht in der Stellung, den Weg vollendet zu haben, ist aber dem Schüler auf dem Weg<br />
voraus und steht ihm mit seiner Wegerfahrung zur Seite. Beim Erlernen der<br />
praktischen Fähigkeiten überwacht der Sensei (Meister) den Schüler in seinen<br />
Tätigkeiten und kontrolliert ständig die innere Haltung des Schülers, also die geistige<br />
Einstellung des Deshi (Schüler) zu seinem Tun. Nur wenn diese im Einklang mit den<br />
ausgeführten Techniken steht, kann der Schüler sich auf dem Weg voran bewegen.<br />
Führt der Schüler die reine Form, die Techniken, völlig losgelöst von den geistigen<br />
Grundsätzen und der rechten Haltung (Shisei) aus, wird er sich weder technisch noch<br />
spirituell weiterentwickeln. Das für den Wegfortschritt unablässige Shisei beinhaltet u.<br />
a. den ständigen Kampf gegen das eigene Ich, der vom Meister immer von Neuem<br />
entfacht wird. Der Schüler bekommt vom Meister demzufolge nicht bloß rein praktische<br />
Herausforderungen im Erlernen neuer Bewegungen gestellt, sondern auch neue<br />
Hürden im Kampf gegen sich selbst. Eine Form, sich diesem Prozess des Wachstums<br />
und der Ich-Überwindung zu stellen, ist die Kunst des Kampfes, das Kempo.<br />
Das japanische Wort Kempo bedeutet wörtlich übersetzt „Lehre der Faust“. Es ist mit<br />
dem koreanischen Kwònbòp, dem vietnamesischen Quyen thuat sowie dem<br />
chinesischen Zeichen für Quanfa verwandt. Laut A. Dolin stellt es die „genaueste aller<br />
möglichen Varianten“ 4 zum Erfassen des Wesens der Kampfkünste dar. Kempo<br />
umfasst sowohl die geistigen als auch körperlichen Facetten sowie die althergebrachte<br />
Tradition und ständige Veränderung, die sich mit der Lehre der Kampfkünste<br />
verbinden. Die westliche Vorstellung, dass es sich beim Kempo lediglich um<br />
<strong>Kampfsport</strong> handele, erweist sich schon allein als falsch, wenn die Wurzeln der<br />
Kampfkunst genauer betrachtet werden. Sie liegen im Yoga und Taoismus, der<br />
Kontrolle der Lebensenergie Qi und der sogenannten „Bionik“, d.h. der Nachahmung<br />
von Tierbewegungen. Weitere Ursprünge stellen Zen-Buddhismus und Konfuzianismus<br />
dar. Sämtliche dieser Verfahren und Philosophien hatten ein gemeinsames Ziel: das<br />
Erlangen innerer Harmonie. Diese Zielsetzung kann jedoch nicht mit dem Besiegen<br />
von Gegnern verwirklicht werden, sondern nur in der harten und beschwerlichen<br />
Auseinandersetzung mit sich selbst. Da das Kempo eine Kunst des Dō darstellt, ist es<br />
nicht möglich den formalen Aspekt isoliert zu betrachten, sondern nur im<br />
Zusammenspiel mit den spirituellen Grundideen auf den wahren Gehalt der Künste des<br />
Kampfes zu schließen.<br />
4 zit. n. Dolin: Kempo, S. 13<br />
- 4 -