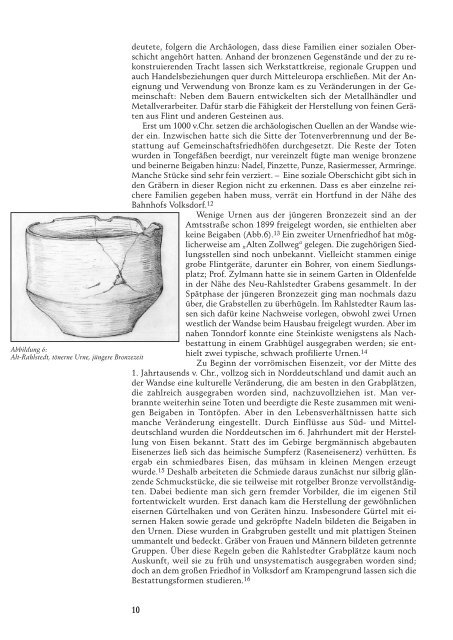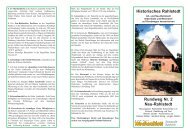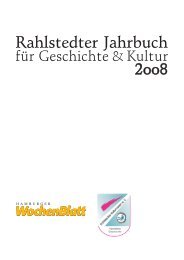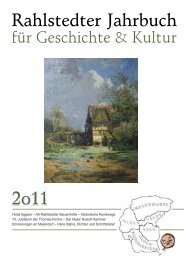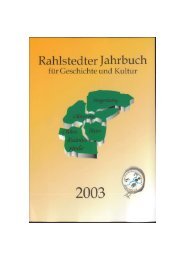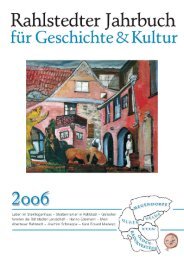Gewässerrestaurieren in Rahlstedt - rahlstedter kulturverein
Gewässerrestaurieren in Rahlstedt - rahlstedter kulturverein
Gewässerrestaurieren in Rahlstedt - rahlstedter kulturverein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abbildung 6:<br />
Alt-<strong>Rahlstedt</strong>, tönerne Urne, jüngere Bronzezeit<br />
deutete, folgern die Archäologen, dass diese Familien e<strong>in</strong>er sozialen Oberschicht<br />
angehört hatten. Anhand der bronzenen Gegenstände und der zu rekonstruierenden<br />
Tracht lassen sich Werkstattkreise, regionale Gruppen und<br />
auch Handelsbeziehungen quer durch Mitteleuropa erschließen. Mit der Aneignung<br />
und Verwendung von Bronze kam es zu Veränderungen <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>schaft:<br />
Neben dem Bauern entwickelten sich der Metallhändler und<br />
Metallverarbeiter. Dafür starb die Fähigkeit der Herstellung von fe<strong>in</strong>en Geräten<br />
aus Fl<strong>in</strong>t und anderen Geste<strong>in</strong>en aus.<br />
Erst um 1000 v.Chr. setzen die archäologischen Quellen an der Wandse wieder<br />
e<strong>in</strong>. Inzwischen hatte sich die Sitte der Totenverbrennung und der Bestattung<br />
auf Geme<strong>in</strong>schaftsfriedhöfen durchgesetzt. Die Reste der Toten<br />
wurden <strong>in</strong> Tongefäßen beerdigt, nur vere<strong>in</strong>zelt fügte man wenige bronzene<br />
und be<strong>in</strong>erne Beigaben h<strong>in</strong>zu: Nadel, P<strong>in</strong>zette, Punze, Rasiermesser, Armr<strong>in</strong>ge.<br />
Manche Stücke s<strong>in</strong>d sehr fe<strong>in</strong> verziert. – E<strong>in</strong>e soziale Oberschicht gibt sich <strong>in</strong><br />
den Gräbern <strong>in</strong> dieser Region nicht zu erkennen. Dass es aber e<strong>in</strong>zelne reichere<br />
Familien gegeben haben muss, verrät e<strong>in</strong> Hortfund <strong>in</strong> der Nähe des<br />
Bahnhofs Volksdorf. 12<br />
Wenige Urnen aus der jüngeren Bronzezeit s<strong>in</strong>d an der<br />
Amtsstraße schon 1899 freigelegt worden, sie enthielten aber<br />
ke<strong>in</strong>e Beigaben (Abb.6). 13 E<strong>in</strong> zweiter Urnenfriedhof hat möglicherweise<br />
am „Alten Zollweg“ gelegen. Die zugehörigen Siedlungsstellen<br />
s<strong>in</strong>d noch unbekannt. Vielleicht stammen e<strong>in</strong>ige<br />
grobe Fl<strong>in</strong>tgeräte, darunter e<strong>in</strong> Bohrer, von e<strong>in</strong>em Siedlungsplatz;<br />
Prof. Zylmann hatte sie <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Garten <strong>in</strong> Oldenfelde<br />
<strong>in</strong> der Nähe des Neu-<strong>Rahlstedt</strong>er Grabens gesammelt. In der<br />
Spätphase der jüngeren Bronzezeit g<strong>in</strong>g man nochmals dazu<br />
über, die Grabstellen zu überhügeln. Im <strong>Rahlstedt</strong>er Raum lassen<br />
sich dafür ke<strong>in</strong>e Nachweise vorlegen, obwohl zwei Urnen<br />
westlich der Wandse beim Hausbau freigelegt wurden. Aber im<br />
nahen Tonndorf konnte e<strong>in</strong>e Ste<strong>in</strong>kiste wenigstens als Nachbestattung<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Grabhügel ausgegraben werden; sie ent-<br />
hielt zwei typische, schwach profilierte Urnen. 14<br />
Zu Beg<strong>in</strong>n der vorrömischen Eisenzeit, vor der Mitte des<br />
1. Jahrtausends v. Chr., vollzog sich <strong>in</strong> Norddeutschland und damit auch an<br />
der Wandse e<strong>in</strong>e kulturelle Veränderung, die am besten <strong>in</strong> den Grabplätzen,<br />
die zahlreich ausgegraben worden s<strong>in</strong>d, nachzuvollziehen ist. Man verbrannte<br />
weiterh<strong>in</strong> se<strong>in</strong>e Toten und beerdigte die Reste zusammen mit wenigen<br />
Beigaben <strong>in</strong> Tontöpfen. Aber <strong>in</strong> den Lebensverhältnissen hatte sich<br />
manche Veränderung e<strong>in</strong>gestellt. Durch E<strong>in</strong>flüsse aus Süd- und Mitteldeutschland<br />
wurden die Norddeutschen im 6. Jahrhundert mit der Herstellung<br />
von Eisen bekannt. Statt des im Gebirge bergmännisch abgebauten<br />
Eisenerzes ließ sich das heimische Sumpferz (Raseneisenerz) verhütten. Es<br />
ergab e<strong>in</strong> schmiedbares Eisen, das mühsam <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en Mengen erzeugt<br />
wurde. 15 Deshalb arbeiteten die Schmiede daraus zunächst nur silbrig glänzende<br />
Schmuckstücke, die sie teilweise mit rotgelber Bronze vervollständigten.<br />
Dabei bediente man sich gern fremder Vorbilder, die im eigenen Stil<br />
fortentwickelt wurden. Erst danach kam die Herstellung der gewöhnlichen<br />
eisernen Gürtelhaken und von Geräten h<strong>in</strong>zu. Insbesondere Gürtel mit eisernen<br />
Haken sowie gerade und gekröpfte Nadeln bildeten die Beigaben <strong>in</strong><br />
den Urnen. Diese wurden <strong>in</strong> Grabgruben gestellt und mit plattigen Ste<strong>in</strong>en<br />
ummantelt und bedeckt. Gräber von Frauen und Männern bildeten getrennte<br />
Gruppen. Über diese Regeln geben die <strong>Rahlstedt</strong>er Grabplätze kaum noch<br />
Auskunft, weil sie zu früh und unsystematisch ausgegraben worden s<strong>in</strong>d;<br />
doch an dem großen Friedhof <strong>in</strong> Volksdorf am Krampengrund lassen sich die<br />
Bestattungsformen studieren. 16<br />
10