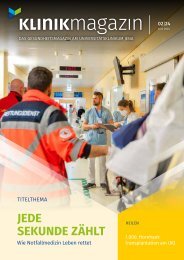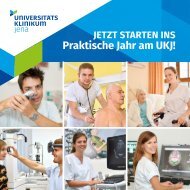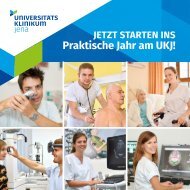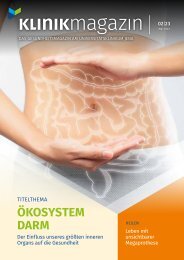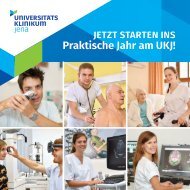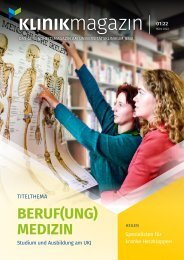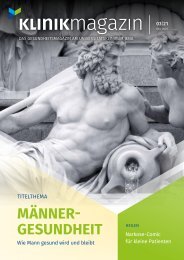UKJ-Klinikmagazin 1/2021
Blut - Saft des Lebens
Blut - Saft des Lebens
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Neben diesen häufigsten Therapiemethoden bieten wir<br />
auch ganz andere Verfahren an, wie Augentropfen aus<br />
Eigenblut oder die Hämodilution. Oft werden Patienten<br />
mit Durchblutungsstörungen am Auge wie einer<br />
Augenvenenthrombose damit behandelt – oder Patienten<br />
nach einem Hörsturz. Diese Erkrankungen entstehen, wenn<br />
das Blut zu dick ist und kleine, zarte Gefäße verstopft. Wir<br />
reduzieren das Blutvolumen und es fließt dadurch wieder<br />
schneller.<br />
Bei welchen Therapien arbeiten Sie eng mit<br />
anderen Fachbereichen zusammen?<br />
Dr. Rummler: Vor allem im Bereich Onkologie gibt es<br />
Überschneidungspunkte. Beispielsweise stellen wir die<br />
Stammzellpräparate her, die die Onkologen zur Therapie<br />
von Patienten mit Krebserkrankungen einsetzen. Aber auch<br />
bei der neuartigen CAR-T-Zell-Therapie für Patienten mit<br />
aggressivem Lymphdrüsenkrebs in der Klinik für Innere<br />
Medizin II unterstützen wir.<br />
Stimmt es, dass Eigenblutspenden immer seltener werden?<br />
Dr. Rummler: Früher war es normal, vor größeren Eingriffen<br />
wie Hüft- oder Kniegelenk-OPs Eigenblut zu spenden. Sollte<br />
eine Bluttransfusion während der OP notwendig sein, konnte<br />
auf das eigene Blut zurückgegriffen werden. Davon ist man<br />
mittlerweile abgekommen. Im vergangenen Jahr haben wir gar<br />
keine Eigenblutkonserve abgenommen. Ein Grund dafür ist,<br />
dass Fremdblutkonserven so sicher geworden sind.<br />
Aber was macht die Blutprodukte so sicher?<br />
Dr. Rummler: Unsere Zulassung regelt, wie unsere<br />
Blutprodukte beschaffen sein müssen, um wirklich sicher zu<br />
sein. Zum einen sind das gewisse Qualitätsanforderungen. So<br />
dürfen die Konserven ein gewisses Volumen nicht über- oder<br />
unterschreiten, es gibt einen Maximalwert für Kalium und einen<br />
Minimalwert für Hämoglobin, dem Sauerstoffträger im Blut.<br />
Zum anderen untersuchen wir das gespendete Blut natürlich<br />
auf viele verschiedene Krankheitserreger wie Hepatitis A, B<br />
und C, HIV, West-Nil oder auch auf Erkrankungen wie Syphilis.<br />
Und nur wenn all diese Anforderungen eingehalten werden,<br />
darf die Spende in unser Blutdepot – und schließlich zum<br />
Patienten.<br />
Testen Sie Blutspenden auch auf das SARS-CoV-2-Virus?<br />
Dr. Rummler: Nein, wir testen weder die Spender noch das<br />
gespendete Blut auf COVID-19. Denn es gibt bisher keinen<br />
Hinweis darauf, dass das Virus über Blutkonserven übertragen<br />
werden kann. Mit einem umfangreichen Fragebogen und<br />
Temperaturmessung prüfen wir bei jedem Spender, ob das<br />
Risiko einer COVID-19-Erkrankung vorliegt und entscheiden<br />
im Einzelfall, ob eine Spende möglich ist. Übrigens bewerten<br />
auch unsere Mitarbeiter nach diesem Schema regelmäßig ihr<br />
Erkrankungsrisiko.<br />
Nach der Spende wird das Blut im Labor umfangreich getestet.<br />
Wie hat die Corona-Pandemie die Transfusionsmedizin<br />
beeinflusst?<br />
Dr. Rummler: Wir waren zu Beginn verunsichert – sowohl in<br />
der Therapie als auch in der Blutspende. Können wir unsere<br />
Therapien noch durchführen? Wie stellen wir sicher, dass<br />
unsere chronischen Patienten Corona-frei sind? Und wie<br />
kann eine Blutspende unter Corona-Bedingungen ablaufen?<br />
Das war eine echte Herausforderung. Mit umfangreichen<br />
Hygienekonzepten, erweiterten Räumlichkeiten in der<br />
Therapie und einem Bestellsystem in der Blutspende haben<br />
wir uns aber zum Glück sehr schnell an die neue Situation<br />
angepasst.<br />
Stichwort: Patient Blood Management. Was genau verbirgt<br />
sich hinter dem Konzept, das 2017 am Jenaer Uniklinikum<br />
eingeführt wurde?<br />
Dr. Rummler: Das Patient Blood Management, kurz PBM,<br />
ist ein fächerübergreifendes Behandlungskonzept, um den<br />
Verbrauch von Fremdblut zu verringern. Bei diesem Konzept<br />
geht man prinzipiell davon aus, dass vor allem zu viele<br />
Erythrozytenkonzentrate übertragen werden. Und das kann<br />
– ohne richtige Indikation – dem Patienten auch schaden,<br />
von Fieber über Sepsis bis hin zum Tod. Deshalb setzt man<br />
an drei Säulen an: Bei geplanten Eingriffen betrachtet man<br />
die Blutwerte der Patienten vor der eigentlichen Operation.<br />
Liegt bei ihnen eine Blutarmut vor, kann diese bereits vor<br />
dem Eingriff entsprechend behandelt werden. Außerdem<br />
haben die Beteiligten des PBM auch die sogenannten<br />
Transfusionstrigger überarbeitet. Sie zeigen an, in welchen<br />
Fällen Fremdblut überhaupt notwendig und sinnvoll ist. Die<br />
letzte Säule besteht aus verschiedenen fremdblutsparenden<br />
Maßnahmen vor, während und nach den Eingriffen. Mit<br />
modernen blutsparenden Operationstechniken oder<br />
optimierten Blutentnahmen zu labordiagnostischen Zwecken<br />
lassen sich zusätzliche Blutverluste vermeiden. Und das alles<br />
war erfolgreich: Seit Einführung des PBM verbrauchen wir nun<br />
etwa 1.000 Erythrozytenkonzentrate weniger pro Jahr.<br />
Interview: Anne Curth<br />
KONTAKT<br />
Dr. Silke Rummler<br />
Direktorin des Instituts für<br />
Transfusionsmedizin am <strong>UKJ</strong><br />
03641 9-32 55 25<br />
sekretariat.itm@med.uni-jena.de<br />
01 | 21<br />
17