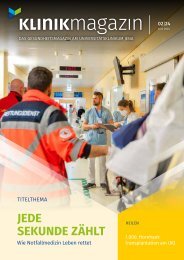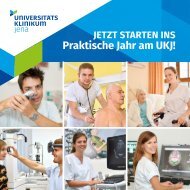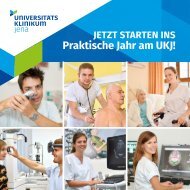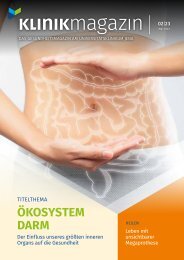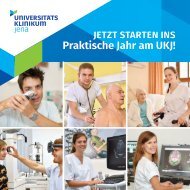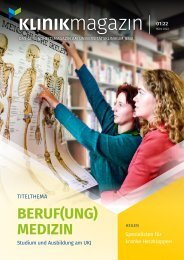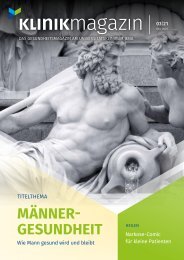UKJ-Klinikmagazin 1/2021
Blut - Saft des Lebens
Blut - Saft des Lebens
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
TITELTHEMA<br />
Unter Hochdruck arbeiten Forscher an der<br />
Frage, welche Therapien schwer erkrankten<br />
COVID-Patienten helfen. Foto: <strong>UKJ</strong><br />
Gibt es weitere Erkenntnisse dieser Art?<br />
Prof. Brunkhorst: Die REMAP-CAP-Studiengruppe ist ein von<br />
Intensivmedizinern und Infektiologen aufgebauter Zusammenschluss,<br />
an dem derzeit Intensivstationen in 14 Ländern<br />
in Europa, Kanada, USA, Australien, Neuseeland, Japan und<br />
Saudi-Arabien mitwirken. Die beteiligten Intensivstationen<br />
in Deutschland koordinieren wir vom Zentrum für klinische<br />
Studien am <strong>UKJ</strong>. Wir konnten unter anderem zeigen, dass<br />
intravenös verabreichtes Hydrokortison dem Organversagen<br />
bei COVID-19-Patienten mit schwerer Lungenentzündung<br />
entgegenwirkt und die Überlebenschancen erhöht. In einer<br />
anderen Studie wurden die Wirkstoffe Tocilizumab und Sarilumab<br />
untersucht, die seit Jahren bei rheumatischer Arthritis<br />
eingesetzt werden. Die Vermutung, dass diese die organschädigende<br />
Entzündungsantwort bei schwer Erkrankten<br />
COVID-19-Patienten abmildern, hat sich bestätigt. Das sind<br />
Meilensteine. Und so untersuchen wir in dieser einzigartigen<br />
weltweiten Kooperation gerade parallel die Wirksamkeit von<br />
15 verschiedenen Interventionen.<br />
Was ist für Sie besonders bemerkenswert?<br />
Prof. Brunkhorst: Unser Verständnis von COVID hat sich massiv<br />
verbessert. Heute wissen wir, dass eines der wesentlichen<br />
Merkmale der Erkrankung ist, dass es im Körper zu einer<br />
ausgeprägten Ausbildung von Blutgerinnseln kommt – auch<br />
in anderen Organen als der Lunge, also in den Darmgefäßen<br />
oder der Leber. So einen Fortschritt im Verständnis der<br />
Erkrankung und auch in der Behandlung hat es beispielsweise<br />
bei der Sepsis in 30 Jahren nicht gegeben. Was wir früher in<br />
einem Jahr gemacht haben, passiert heute in sechs Wochen.<br />
So etwas habe ich noch nie erlebt. Die neuen Erkenntnisse<br />
werden auch bei unserem Sepsis-Kongress im September in<br />
Weimar eine maßgebliche Rolle spielen.<br />
Warum sind diese schnellen Erkenntnisse möglich?<br />
Prof. Brunkhorst: Wir arbeiten in einem globalen Konsortium<br />
– nur so kann es gehen. In der Pandemie muss man die besten<br />
Köpfe suchen – und die sind nun einmal nicht alle in einem<br />
Land versammelt. Wir stehen mit Arbeitsgruppen in aller Welt<br />
in Verbindung, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Das<br />
können wir nicht kleinteilig an einer einzigen Uniklinik angehen,<br />
denn wir benötigen die Ergebnisse jetzt. Drei Mal in der<br />
Woche sitze ich in Zoom-Konferenzen mit den Kollegen aus<br />
aller Welt zusammen, da wird sehr fokussiert und konzentriert<br />
diskutiert. Das funktioniert hervorragend. Und wenn wir durch<br />
die Studien die Zeit verkürzen können, die Patienten auf den<br />
Intensivstationen verbringen müssen, dann schaffen wir dort<br />
auch wieder Kapazitäten für anderen Patienten.<br />
Warum passiert dies erst jetzt?<br />
Prof. Brunkhorst: Es war ein riesiger Fehler, dass wir in der<br />
gesamten Infektionsforschung den Faktor der respiratorischen<br />
Viren unterschätzt haben – und das weltweit. Es gibt<br />
einen mittlerweile viel zitierten Artikel aus dem Jahr 2018, in<br />
dem Bill Gates beschreibt, dass wir Milliarden dafür ausgeben,<br />
um Kriegsführung zu vermeiden, aber kaum Geld für Vorhersageparameter<br />
für respiratorische Pandemien. Diese Warnung<br />
war sehr weitsichtig. Christian Drosten war in Deutschland<br />
einer der wenigen, die nach den ersten SARS-Erfahrungen<br />
weiter auf diesem Gebiet geforscht haben. Wenn auf einem<br />
Gebiet bereits Expertise vorhanden ist, ist es leichter, diese<br />
auszubauen, als etwas neu aufzubauen. Das kann niemand<br />
allein schaffen, sondern funktioniert nur im Netzwerk mit<br />
internationalen Partnern. Man kann in der Forschung nicht<br />
darauf setzen, dass ein Land die Probleme allein löst. Und<br />
das gilt nicht nur für COVID-19. Wir haben durch die Pandemie<br />
gelernt, wie leicht es heutzutage ist, mit allen möglichen<br />
Kollegen regelmäßig Kontakt zu haben – das sollten wir in<br />
Zukunft auch für andere Forschungsgebiete nutzen.<br />
Interview: Anke Schleenvoigt<br />
Foto: www.lindgruen-gmbh.com<br />
„Erfolgreiche<br />
Forschung braucht<br />
ein internationales<br />
Netzwerk.“<br />
Prof. Frank Brunkhorst