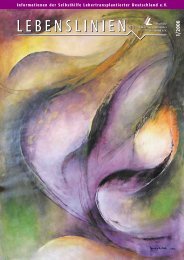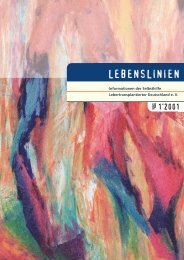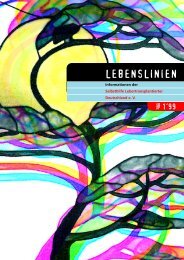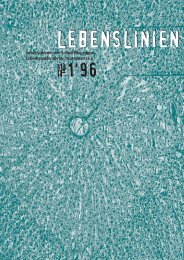1/2004 - Aktuell - Selbsthilfe Lebertransplantierter Deutschland e.V.
1/2004 - Aktuell - Selbsthilfe Lebertransplantierter Deutschland e.V.
1/2004 - Aktuell - Selbsthilfe Lebertransplantierter Deutschland e.V.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
XII. Falk-Leberwoche 2003<br />
Die XII. Falk-Leberwoche, die von der<br />
Falk-Stiftung veranstaltet wird, fand<br />
vom 14. bis 22. Oktober 2003 in<br />
Freiburg i. Br. statt. Dank der großzügigen<br />
Einladung der Stiftung konnten verschiedene<br />
Mitglieder/Vorstandsmitglieder unserer<br />
<strong>Selbsthilfe</strong> <strong>Lebertransplantierter</strong> an<br />
der Veranstaltung teilnehmen. Wir waren<br />
auch mit einem Informationsstand im<br />
Kongressgebäude präsent, ebenso bei<br />
den beiden Arzt-Patienten-Seminaren am<br />
18. Oktober 2003 in der Aula der Universität.<br />
Umfang und Organisation<br />
Mit rund 1.400 Teilnehmern aus fast 70<br />
Ländern ist die Falk-Leberwoche ein sehr<br />
bedeutendes wissenschaftliches Forum<br />
auf dem Gebiet der Lebererkrankungen.<br />
Neben starken Kontingenten aus <strong>Deutschland</strong><br />
und Österreich waren auch Wissenschaftler<br />
aus USA, Kanada und Japan zahlreich<br />
vertreten. Besonders auffallend waren<br />
die vielen Teilnehmer aus Osteuropa<br />
und Russland. Aber auch Teilnehmer aus<br />
China, Mongolien und Südamerika fanden<br />
sich in Freiburg ein.<br />
Mit der diesjährigen Veranstaltung wurde<br />
das Andenken von Hans Popper geehrt zu<br />
dessen 100. Geburtstag. Hans Popper war<br />
einer der international führenden Hepatologen,<br />
dessen Anfänge an der Wiener<br />
Universität waren, der dann aber – dem<br />
Nazi-Regime 1938 entflohen – seine<br />
wichtigsten Wirkungsstätten in Chicago<br />
und New York hatte.<br />
Die wissenschaftliche Tagung war in drei<br />
Teile gegliedert:<br />
� cholestatische Leberkrankheiten, Grundlagen<br />
und Therapie<br />
� Lebererkrankungen, Fortschritte in Therapie<br />
und Prävention<br />
� aktuelle Hepatologie, Molekular- und<br />
Zellbiologie<br />
Ergänzend gab es dann am 22. Oktober<br />
noch einen Workshop über die Prävention<br />
des Fortschreitens chronischer Lebererkrankungen.<br />
Insgesamt fanden rund 110 Vorträge mit<br />
anschließender Diskussion statt; außerdem<br />
noch zahlreiche Sitzungen zur Vorstellung<br />
von schematischen Überblicks-<br />
darstellungen (posters). Dieser Bericht<br />
kann somit nur gewisse Eindrücke vermitteln.<br />
Ein Kurzbericht über die beiden<br />
ersten Teile der Veranstaltung kann von<br />
interessierten Lesern Anfang <strong>2004</strong> unter<br />
der No. FSK 136/137 kostenlos von der<br />
Falk-Stiftung 1 angefordert werden.<br />
Highlights<br />
Der erste Teil konzentrierte sich auf die<br />
cholestatischen Leberkrankheiten wie<br />
PBC, PSC, AIH und Overlapsyndrom 2 .<br />
Viele neue wissenschaftliche Ansätze zur<br />
Erforschung dieser Krankheiten wurden<br />
vorgestellt, allerdings mit einer lapidaren<br />
Einschränkung: „Genetische, ätiologische<br />
und pathogenetische Aspekte primär biliärer<br />
Lebererkrankheiten sind noch immer<br />
schwer zu verstehen, doch stellen<br />
sie die unabdingbare Voraussetzung für<br />
eine bessere Behandlung dar.“ 3 Es wurden<br />
epidemiologische Ansätze vorgestellt,<br />
die z.B. regionale Konzentrationen<br />
von PBC sowie das überwiegende Auftreten<br />
bei Frauen als Ausgangspunkte für<br />
weitere Ursachenforschung vorschlagen<br />
bzw. das überwiegende Auftreten von<br />
PSC bei Männern; desgleichen wurde die<br />
Verursachung durch Viren, auch durch<br />
Bakterien sowie der weiterhin vermutete,<br />
aber nicht nachgewiesene Autoimmuncharakter<br />
der Krankheiten vorgetragen<br />
und diskutiert, wobei z.B. das Überwie-<br />
gen von Autoimmunkrankheiten bei Frauen<br />
zwar mit PBC, nicht aber mit Auftreten<br />
von PSC kompatibel wäre.<br />
Bei der medikamentösen Behandlung von<br />
PBC verzeichnet man zwar gewisse Erfolge<br />
mit Ursodeoxycholsäure (UCDA) 4 ,<br />
doch scheint längerfristig weiterhin die<br />
Lebertransplantation unumgänglich zu<br />
sein. Dann allerdings gilt: „PBC-Patienten,<br />
welche ein Lebertransplantat erhalten,<br />
haben eine hervorragende Überlebensrate.<br />
Die PBC kann bei Allotransplantaten<br />
rezidivieren; dies scheint sich allerdings<br />
auf das mittelfristige Überleben des Transplantats<br />
nicht auszuwirken.“ 5 Ähnliches<br />
scheint für PSC zu gelten.<br />
Ermutigende Zukunftsmusik gab es von<br />
Professor T.E. Starzl aus Pittsburgh. In<br />
Pittsburgh, einem der Pionierzentren für<br />
Organtransplantation, wurden klinische<br />
Versuche zur Reduktion der Immunsuppression<br />
durchgeführt, und zwar mit Empfängern<br />
verschiedener Organe. Dabei<br />
wurden noch auf Organe wartende Patienten<br />
über mehrere Stunden mit 5 mg/kg<br />
eines Breitspektrum-Antithymozytenglobulins<br />
eines Kaninchens behandelt. Die<br />
Immunsuppression nach erfolgter Transplantation<br />
konnte dann auf Tacrolimus<br />
beschränkt werden, wobei die Medikamentengabe<br />
nach vier Monaten auf je-<br />
LEBENSLINIEN 1/<strong>2004</strong> | HEPATOLOGIE<br />
25<br />
Foto: privat