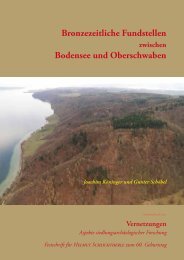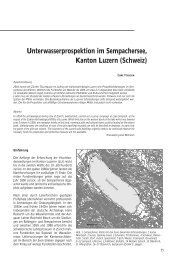pdf Seite 65–117 - terramare - Archäologische Dienstleistungen
pdf Seite 65–117 - terramare - Archäologische Dienstleistungen
pdf Seite 65–117 - terramare - Archäologische Dienstleistungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ichtung der Brücke nach Süden auf etwa 111°<br />
(Abb. 3). Die veränderte Ausrichtung wird den<br />
Verlauf des Flusses berücksichtigt haben und<br />
nimmt zugleich Bezug auf die heutige Parzellierung<br />
der Friedrichstadt und den Verlauf der<br />
heutigen Brückstraße. Darüber hinaus wurden<br />
die Pfeiler auf 17 m an der Basis verlängert und<br />
deren Abstände auf 14 m bis 15 m erhöht. Dies<br />
weist auf eine mögliche Verbreiterung der Fahrbahn<br />
hin, kann vorrangig aber mit dem neuen<br />
Konstruktionselement der Auflasten aus Sandsteinquadern<br />
auf den Pfeilerenden in Verbindung<br />
gebracht werden (Abb. 4).<br />
Diese Brückenphase kann anhand der Datierung<br />
des räumlich eingebundenen Pfostens<br />
Befund-Nr. 149 (Abb. 1) in die Zeit nach 1776<br />
datiert werden. Die von einem der Pfosten unmittelbar<br />
am östlichen Ufer gewonnene dendrochronologische<br />
Datierung von 1826 belegt eine<br />
Reparaturphase dieser letzten hölzernen Brückenkonstruktion.<br />
Gegen die hier vorgenommene Übertragung einzelner<br />
Daten auf die gesamte Konstruktion sind<br />
mehrere kritische Anmerkungen vorzubringen.<br />
Es handelt sich um keinen geschlossenen Befund,<br />
sondern um ein aufgrund der räumlichen<br />
Beziehung der einzelnen Pfosten erschlossenes<br />
Ensemble. Die Verwendung von Altholz aus<br />
anderen Bauten kann nicht ausgeschlossen werden,<br />
andererseits können ältere, noch standfeste<br />
Pfosten in eine neue Konstruktion integriert<br />
worden sein. Des Weiteren ist mit dem Austausch<br />
einzelner schadhafter Pfosten im Zuge<br />
von Reparaturen an der Substruktion zu rechnen.<br />
Die naturwissenschaftlichen Datierungen<br />
bieten demnach nur allgemeine Angaben zur<br />
Bestandszeit der Brücke, in Kombination mit<br />
ihrem Lagebezug und der Parallelisierung mit<br />
den Urkunden – Freigabe 1666 und Stadtplan<br />
von 1770 – gewinnen die hier vorgestellten Phasen<br />
und deren Datierung aber an Validität.<br />
Historischer Kontext<br />
Im Dreißigjährigen Krieg erstürmten kaiserliche<br />
Truppen – nach Gregorianischem Kalender<br />
– am 20. Mai 1631 die Stadt Magdeburg<br />
mit einer Brutalität, die selbst Zeitgenossen entsetzte.<br />
Als Magdeburger Hochzeit bezeichnet<br />
wird sie zum Ausdruck für unmenschliche und<br />
grauenvollste Verwüstung. Das neue Wort für<br />
dieses entsetzliche Mordbrennen lautet „magdeburgisieren“.<br />
Die Stadt wurde damit 1631 auch<br />
linguistisch Sinnbild für die Grauen des Dreißigjährigen<br />
Krieges.<br />
Die „Lange Brücke“ in Magdeburg<br />
1<br />
Die nachfolgende Besatzung dauerte bis zum 4.<br />
Januar 1632, als die kaiserlichen Soldaten unter<br />
der neuen schwedischen Belagerung abziehen<br />
und bei dieser Gelegenheit Wehranlagen, aber<br />
auch Schiffe und Brücken zerstörten. An diesem<br />
Tag wird die „Lange Brücke“, sofern sie noch<br />
Bestand hatte, endgültig zerstört worden sein.<br />
Die in einem Stich dargestellte Erstürmung der<br />
Stadt 1631 vom östlichen Elbeufer aus über die<br />
intakte Brücke entsprang insofern der Phantasie<br />
des Künstlers, als der Einfall von der Neustadt<br />
aus über das nordöstlich gelegene Neue Werk<br />
erfolgte (Priegnitz 1958, 16 f.).<br />
Der Wiederaufbau der Stadt begannt im März<br />
1632 mit einer Bestandsaufnahme: In Magdeburg<br />
lebten von geschätzten 25000 bis 30000<br />
Einwohnern vor der Zerstörung noch 449 Menschen<br />
(Schneider 1995, 75). Des Weiteren wurde<br />
Magdeburg vermessen und ein neuer Plan<br />
der Stadt erstellt. Mit dieser Aufgabe wurde im<br />
Februar Otto von Guericke betraut, der sie im<br />
April mit einem Riss abschloss. In diesem entwarf<br />
er auch eine neue Gliederung der Stadt, die<br />
sich durch zwei große, von Osten nach Westen<br />
laufende Hauptstraßen nun stärker zur Elbe<br />
hin öffnen sollte. Der Bau von Brücken in der<br />
Verlängerung der Straßenachsen dürfte an dieser<br />
Stelle bereits impliziert gewesen sein, zumal<br />
Guericke im gleichen Jahr einen Kostenvoranschlag<br />
für den Bau der „Langen Brücke“ vorlegte<br />
(Hoffmann 1850, 182 Anm. 2; 201 Anm.<br />
1. – Schneider 1995, 78).<br />
Ob zu diesem frühen Zeitpunkt bereits ein vollständiger<br />
Brückenzug über die gesamte, durch<br />
Inseln gegliederte Elbe bis zum anderen Ufer errichtet<br />
wurde oder ob man es mit einem Bau bis<br />
Abb. 3: Die Gliederung der<br />
Brückenpfosten in die Pfeilerbündel<br />
der zwei Brückenphasen.<br />
Bildausschnitt<br />
unten links: Lage der<br />
Brücke an der Alten Elbe<br />
(Kreis) und Befestigung der<br />
Stadt um 1632 (1).<br />
75