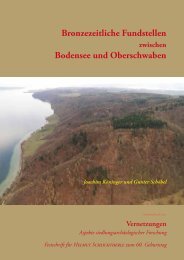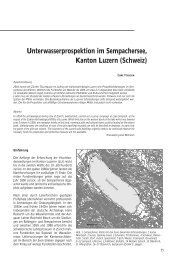pdf Seite 65–117 - terramare - Archäologische Dienstleistungen
pdf Seite 65–117 - terramare - Archäologische Dienstleistungen
pdf Seite 65–117 - terramare - Archäologische Dienstleistungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
die bis auf eine Ausnahme nahezu senkrecht stehen.<br />
Die Balken sind grob vierkantig zugerichtet,<br />
nur vereinzelte Exemplare sind vollständig<br />
überarbeitet oder lassen gar keine Bearbeitung<br />
erkennen. Die Erhaltung ist überwiegend gut,<br />
lediglich die Balkenköpfe sind in einzelnen Fällen<br />
nach oben verjüngt und rundlich verwittert,<br />
während andere durch den annähernd planen<br />
Abschluss noch die Spuren vom Abriss der<br />
Brücke von 1882 erkennen lassen. Die mittlere<br />
Balkenstärke (Kantenlänge oder Durchmesser)<br />
beträgt 19,12 cm und liegt nahe an dem Modal-<br />
und dem Medianwert von jeweils 20 cm.<br />
Die mittlere Abweichung vom genannten Mittelwert<br />
beträgt 5 cm. Die Pfeiler sind demnach<br />
zwar nicht normiert, aber doch sehr gleichmäßig<br />
gearbeitet.<br />
Einen guten Vergleich stellen vermutlich die<br />
Pfähle der Böschungsbefestigung an der Zollbrücke<br />
dar, die 2000/2001 bei Sanierungsarbeiten<br />
gezogen wurden. Von diesen Pfählen sind<br />
21 zu einem Kunstwerk arrangiert, das zwischen<br />
dem Max-Plank-Institut in Magdeburg und der<br />
benachbarten Jerusalembrücke über die Elbe betrachtet<br />
werden kann. Die Pfähle sind, wie die<br />
Brückenpfosten, grob zugerichtet und weisen einen<br />
annähernd viereckigen Querschnitt von ca.<br />
25 cm auf. Die maximale Länge liegt bei 4 m,<br />
soll ursprünglich aber bis zu 5 m betragen haben.<br />
Ein wesentliches Detail sind die aus jeweils<br />
vier Eisenbändern geschmiedeten, spitz zulaufenden<br />
Pfahlschuhe, die, mit eisernen Nägeln an<br />
der Basis befestigt, das Einrammen der Pfosten<br />
belegen. Die Eichenbalken weisen ca. 250 Jahrringe<br />
auf und wurden um 1750 gefällt (freundl.<br />
mündl. Mitt. Dr. Th. Gatzky, Magdeburg).<br />
Die Pfosten der Brücke gruppieren sich in vier<br />
Felder von 29, 55, 30 und 10 Stück, die mit<br />
Abständen von 11 m bis 14 m vom östlichen<br />
Ufer bis zur Mitte des Flussarmes reichen. Die<br />
Breite der Felder liegt zwischen 1 m und 2 m<br />
bei einer gleichfalls variablen Länge von bis zu<br />
17 m. Im Detail sind nur vage Pfostenreihen<br />
über die gesamte Länge eines Feldes zu erkennen,<br />
so dass zahlreiche Reparaturen belegt sind.<br />
Mit der Verdopplung der Felderbreite von 1 m<br />
auf 2 m ist zudem mit dem Neubau mindestens<br />
eines Pfeilers neben seinem Vorgänger zu rechnen.<br />
Gegebenenfalls deutet sich hierin aber auch<br />
ein vollständiger Neubau der gesamten Brücke<br />
an, wofür die leicht veränderten Fluchten der<br />
Pfostenreihen im ersten und zweiten Pfahlfeld<br />
sprechen. Die Ausrichtung beträgt im einen Fall<br />
etwa 111°, im anderen etwa 98°, gemessen von<br />
Norden im Uhrzeigersinn. Da die Ausrichtung<br />
sich stets nach der Strömung gerichtet haben<br />
Die „Lange Brücke“ in Magdeburg<br />
Befund-Nr. Labor-Nr. Holzart Beginn Ende Fälldatum<br />
170 49341 Eiche 1619 1666 1686<br />
149 49342 Eiche 1669 1756 1776<br />
– 1792 Eiche 1614 1806 1826<br />
Abb. 1: Die Ergebnisse dendrochronologischer Untersuchungen an drei Pfosten<br />
der Brückenkonstruktion (schriftliche Mitteilung K.-U. Heussner [Berlin],<br />
mündliche Mitteilung T. Weber [Magdeburg]).<br />
wird, kann dies als Hinweis auf einen Neubau<br />
und einen veränderten Flusslauf gewertet werden.<br />
Die naturwissenschaftliche Datierung anhand<br />
der geborgenen Holzproben ergab Fälldaten<br />
um/nach 1686 und um/nach 1776 (Abb. 1).<br />
Diese Daten sind um eine früher entnommene<br />
Probe mit einem Fälldatum um/nach 1826 zu<br />
ergänzen. Damit ergibt sich eine unregelmäßige<br />
Datenreihe über alle Jahrhunderte der Bestandszeit<br />
bis zum systematischen Abriss der Brücke<br />
nach dem vollendeten Neubau der heutigen<br />
Anna-Ebert-Brücke im Jahr 1882.<br />
Historische Quellen<br />
Für die Datierung und die Interpretation des archäologischen<br />
Befundes können zahlreiche historische<br />
Quellen herangezogen werden. Vorrangig<br />
ist der Kostenvoranschlag des Magdeburger<br />
Bürgermeisters Otto von Guericke zu nennen,<br />
der 1632, als Ingenieur in schwedischen Dienst<br />
genommen, den Auftrag für eine grundlegende<br />
Vermessung der Stadt und den Wiederaufbau<br />
der Festungswerke und Brücken erhielt (Abb.<br />
2. Stadtarchiv MD Lit. V, Nr. 22 [zitiert nach<br />
Hoffmann 1850, 201, Anm. 1]). Die Lohnkosten<br />
für 2 Meister, 10 Gesellen und 10 Tagelöhner<br />
werden pro Tag mit 5,5 Talern, die Bauzeit<br />
mit mindestens einem Jahr angegeben und die<br />
gesamten Kosten mit 5515 Talern veranschlagt<br />
(Stadtarchiv MD Lit. B, Nr. 219 [zitiert nach<br />
Hoffmann 1850, 201, Anm. 1]). Bei 300 Arbeitstagen<br />
im Jahr ergeben sich Lohnkosten<br />
von 1650 Talern, die verbleibenden 3865 Taler<br />
wurden vermutlich für Baumaterial, Werkzeug,<br />
Transport- und Lagerkosten, Bootsmiete und<br />
vermutlich Planungskosten für Guericke selbst<br />
veranschlagt.<br />
Für die Ausführung der Brücke sind gleichermaßen<br />
präzise Angaben bekannt. Sie sollte aus 24<br />
gedoppelten Jochen gebildet werden, die jeweils<br />
aus 23 mit Eisenschuhen bewehrten Eichenpfählen<br />
von 13,8 bis 15 m Länge bestehen. Die Pfähle<br />
sollten in drei Reihen gesetzt und mit drei eisernen<br />
Bolzen verbunden werden. Die gedoppel-<br />
73