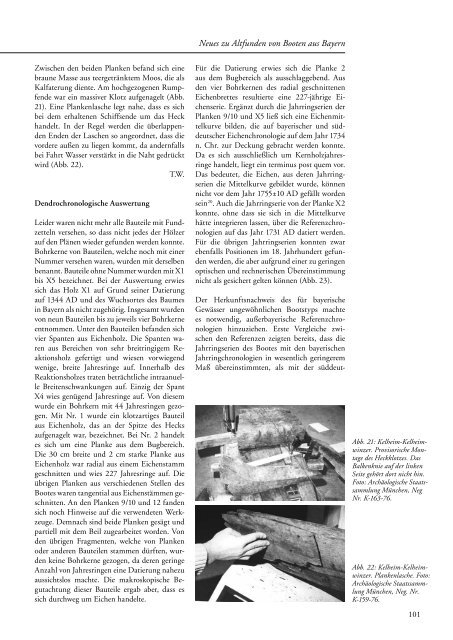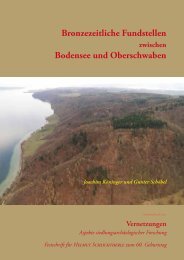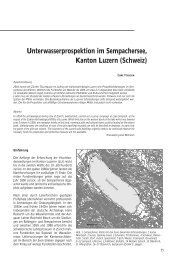pdf Seite 65–117 - terramare - Archäologische Dienstleistungen
pdf Seite 65–117 - terramare - Archäologische Dienstleistungen
pdf Seite 65–117 - terramare - Archäologische Dienstleistungen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zwischen den beiden Planken befand sich eine<br />
braune Masse aus teergetränktem Moos, die als<br />
Kalfaterung diente. Am hochgezogenen Rumpfende<br />
war ein massiver Klotz aufgenagelt (Abb.<br />
21). Eine Plankenlasche legt nahe, dass es sich<br />
bei dem erhaltenen Schiffsende um das Heck<br />
handelt. In der Regel werden die überlappenden<br />
Enden der Laschen so angeordnet, dass die<br />
vordere außen zu liegen kommt, da andernfalls<br />
bei Fahrt Wasser verstärkt in die Naht gedrückt<br />
wird (Abb. 22).<br />
T.W.<br />
Dendrochronologische Auswertung<br />
Leider waren nicht mehr alle Bauteile mit Fundzetteln<br />
versehen, so dass nicht jedes der Hölzer<br />
auf den Plänen wieder gefunden werden konnte.<br />
Bohrkerne von Bauteilen, welche noch mit einer<br />
Nummer versehen waren, wurden mit derselben<br />
benannt. Bauteile ohne Nummer wurden mit X1<br />
bis X5 bezeichnet. Bei der Auswertung erwies<br />
sich das Holz X1 auf Grund seiner Datierung<br />
auf 1344 AD und des Wuchsortes des Baumes<br />
in Bayern als nicht zugehörig. Insgesamt wurden<br />
von neun Bauteilen bis zu jeweils vier Bohrkerne<br />
entnommen. Unter den Bauteilen befanden sich<br />
vier Spanten aus Eichenholz. Die Spanten waren<br />
aus Bereichen von sehr breitringigem Reaktionsholz<br />
gefertigt und wiesen vorwiegend<br />
wenige, breite Jahresringe auf. Innerhalb des<br />
Reaktionsholzes traten beträchtliche intraanuelle<br />
Breitenschwankungen auf. Einzig der Spant<br />
X4 wies genügend Jahresringe auf. Von diesem<br />
wurde ein Bohrkern mit 44 Jahresringen gezogen.<br />
Mit Nr. 1 wurde ein klotzartiges Bauteil<br />
aus Eichenholz, das an der Spitze des Hecks<br />
aufgenagelt war, bezeichnet. Bei Nr. 2 handelt<br />
es sich um eine Planke aus dem Bugbereich.<br />
Die 30 cm breite und 2 cm starke Planke aus<br />
Eichenholz war radial aus einem Eichenstamm<br />
geschnitten und wies 227 Jahresringe auf. Die<br />
übrigen Planken aus verschiedenen Stellen des<br />
Bootes waren tangential aus Eichenstämmen geschnitten.<br />
An den Planken 9/10 und 12 fanden<br />
sich noch Hinweise auf die verwendeten Werkzeuge.<br />
Demnach sind beide Planken gesägt und<br />
partiell mit dem Beil zugearbeitet worden. Von<br />
den übrigen Fragmenten, welche von Planken<br />
oder anderen Bauteilen stammen dürften, wurden<br />
keine Bohrkerne gezogen, da deren geringe<br />
Anzahl von Jahresringen eine Datierung nahezu<br />
aussichtslos machte. Die makroskopische Begutachtung<br />
dieser Bauteile ergab aber, dass es<br />
sich durchweg um Eichen handelte.<br />
Neues zu Altfunden von Booten aus Bayern<br />
Für die Datierung erwies sich die Planke 2<br />
aus dem Bugbereich als ausschlaggebend. Aus<br />
den vier Bohrkernen des radial geschnittenen<br />
Eichenbrettes resultierte eine 227-jährige Eichenserie.<br />
Ergänzt durch die Jahrringserien der<br />
Planken 9/10 und X5 ließ sich eine Eichenmittelkurve<br />
bilden, die auf bayerischer und süddeutscher<br />
Eichenchronologie auf dem Jahr 1734<br />
n. Chr. zur Deckung gebracht werden konnte.<br />
Da es sich ausschließlich um Kernholzjahresringe<br />
handelt, liegt ein terminus post quem vor.<br />
Das bedeutet, die Eichen, aus deren Jahrringserien<br />
die Mittelkurve gebildet wurde, können<br />
nicht vor dem Jahr 1755±10 AD gefällt worden<br />
sein 20 . Auch die Jahrringserie von der Planke X2<br />
konnte, ohne dass sie sich in die Mittelkurve<br />
hätte integrieren lassen, über die Referenzchronologien<br />
auf das Jahr 1731 AD datiert werden.<br />
Für die übrigen Jahrringserien konnten zwar<br />
ebenfalls Positionen im 18. Jahrhundert gefunden<br />
werden, die aber aufgrund einer zu geringen<br />
optischen und rechnerischen Übereinstimmung<br />
nicht als gesichert gelten können (Abb. 23).<br />
Der Herkunftsnachweis des für bayerische<br />
Gewässer ungewöhnlichen Bootstyps machte<br />
es notwendig, außerbayerische Referenzchronologien<br />
hinzuziehen. Erste Vergleiche zwischen<br />
den Referenzen zeigten bereits, dass die<br />
Jahrringserien des Bootes mit den bayerischen<br />
Jahrringchronologien in wesentlich geringerem<br />
Maß übereinstimmten, als mit der süddeut-<br />
Abb. 21: Kelheim-Kelheimwinzer.<br />
Provisorische Montage<br />
des Heckklotzes. Das<br />
Balkenknie auf der linken<br />
<strong>Seite</strong> gehört dort nicht hin.<br />
Foto: <strong>Archäologische</strong> Staatssammlung<br />
München, Neg<br />
Nr. K-163-76.<br />
Abb. 22: Kelheim-Kelheimwinzer.<br />
Plankenlasche. Foto:<br />
<strong>Archäologische</strong> Staatssammlung<br />
München, Neg. Nr.<br />
K-159-76.<br />
101