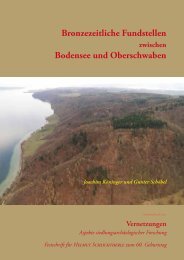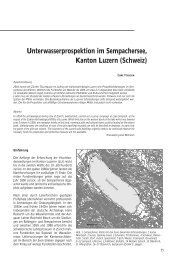pdf Seite 65–117 - terramare - Archäologische Dienstleistungen
pdf Seite 65–117 - terramare - Archäologische Dienstleistungen
pdf Seite 65–117 - terramare - Archäologische Dienstleistungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
nige Jahrringe auf. Daher wurde eine 14 C-Datierung<br />
durch eine AMS-Messung vorgenommen.<br />
Die Probe aus den äußeren Jahrringen des Einbaumes<br />
lieferte ein Datum auf 1250±30 AD.<br />
Aufgrund der Beilspuren ist anzunehmen, dass<br />
der Einbaum zeitnah nach dem Schlagen des<br />
Baumes aus dem noch frischen Stamm gearbeitet<br />
worden ist.<br />
Die Lebens- bzw. Nutzungsdauer des Bootes ist<br />
unbekannt. Bei sorgfältigem Umgang mit dem<br />
Wasserfahrzeug – z.B. Einlagern während der<br />
Wintermonate unter Wasser um Frostschäden<br />
zu vermeiden – kann der Einbaum viele Jahre<br />
in Benutzung gewesen sein. Die Verwitterung<br />
der Bordwände bei gleichzeitig relativ guter Erhaltung<br />
des Bodens deutet auf einen längeren<br />
Nutzungszeitraum hin.<br />
Fundlage<br />
Der Einbaum wurde in Schräglage an dem<br />
Steilufer in einer sandigen Bucht im Altarm<br />
„Schwarzer Wehl“ entdeckt. Nach dem Verwitterungszustand<br />
des aus dem Wasser ragenden<br />
Holzes, im Vergleich zu den unter Wasser liegenden<br />
Bereichen, hat das Boot eine längere<br />
Zeit, mehrere Wochen oder Monate, dort gelegen.<br />
Es kann sich nicht um die Fundlage in<br />
Situ handeln, da das Boot in der Fundlage seit<br />
dem Mittelalter mindestens den aus dem Wasser<br />
ragenden Teil durch Verwitterung eingebüßt<br />
hätte.<br />
Der Einbaum wurde wahrscheinlich in die angetroffene<br />
Fundlage gespült. Hierfür kommt<br />
das Hochwasser der Elbe im Frühjahr 2006 in<br />
Betracht. Dieses Hochwasser ist in den Medien<br />
kaum beachtet worden, da die Elbdeiche glücklicherweise<br />
gehalten haben und kaum Schäden<br />
entstanden. Die Wiesengebiete, in denen der<br />
Altarm gelegen ist, liegen im Deichvorland und<br />
wurden von diesem Hochwasser vollständig<br />
überflutet. Die Fluthöhe war im Gelände noch<br />
an Treibgut erkennbar, welches in Bäumen und<br />
Büschen hing.<br />
Es ist zu vermuten, dass mit diesem Hochwasser<br />
der Einbaum aus einer tiefer im Wasser liegenden<br />
Position freigespült wurde und über die<br />
Elbwiesen in den Altarm der Elbe gelangte.<br />
Im Vergleich zu den überfluteten Wiesen weist<br />
der Wehl im Altarm der Elbe wesentlich größere<br />
Wassertiefen auf. Die bei Hochwasser auf<br />
den Elbwiesen herrschende Strömung dürfte am<br />
Rande des Altarmes deshalb nachlassen. Treibgut<br />
dürfte also am ehesten hier absinken und<br />
zur Ablagerung gelangen. Auch der Einbaum<br />
Strandgut – ein Einbaum im Altarm<br />
wird aus diesem Grunde hier liegen geblieben<br />
sein. Nur das aufragende Heck war 20–30 cm<br />
in den Sand des Steilufers einsedimentiert, wobei<br />
der Sand möglicherweise ebenfalls durch das<br />
Hochwasser hierher verlagert wurde.<br />
Jedenfalls wird der Einbaum, der flach auf dem<br />
Sandgrund auflag und in dessen Innerem sich<br />
kaum Sand oder anderes Sediment befand,<br />
kaum am Fundort freigespült worden sein und<br />
zuvor dort über längere Zeit gelegen haben.<br />
Viel eher stammt der Einbaum ursprünglich<br />
von einem elbaufwärts gelegenen Ort.<br />
Ob der Einbaum durch ein Missgeschick verloren<br />
gegangen ist, während eines Winters aus der<br />
Einlagerung bei einem Hochwasser fortgespült<br />
wurde oder einfach in den Fluss entsorgt worden<br />
ist, ist unklar.<br />
Einbäume sind keine seltenen Fundobjekte im<br />
Elberaum. Der Bootstyp war für verschiedenste<br />
Einsatzmöglichkeiten gut geeignet und konnte<br />
in der Ausgestaltung seiner Nutzungsform angepasst<br />
werden. Die Herstellung eines Einbaumes<br />
ist zwar relativ arbeitsintensiv, aber einfach in<br />
der Ausführung. Es ist daher anzunehmen, dass<br />
Fischer oder andere Elbanrainer sich diese Fahrzeuge<br />
selbst gefertigt haben.<br />
Einbäume waren sicherlich als Verkehrsmittel<br />
und in der Fischerei auf der Elbe und auf ihren<br />
Nebenflüssen in großer Zahl im Einsatz.<br />
Das Querschott im Bootskörper bietet Anhaltspunkte<br />
zur Nutzung des Einbaums. Möglicherweise<br />
ist damit der Innenraum des Bootes in<br />
einen vorderen Abschnitt zum Transport von<br />
Waren oder Gütern und einen hinteren Bereich,<br />
in dem eine Person paddelnd gesessen hat, auf-<br />
Abb. 2: Der Einbaum<br />
in Fundlage. Die Lampe<br />
am Fuß der Fluchstange<br />
markiert das unter<br />
Wasser liegende Ende des<br />
Bootes. Foto: Matthias<br />
Lindemann, LDA.<br />
81