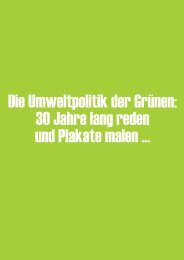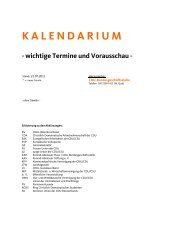Bürgerschaftliches Engagement - CDU Deutschlands
Bürgerschaftliches Engagement - CDU Deutschlands
Bürgerschaftliches Engagement - CDU Deutschlands
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Drucksache 14/8900 – 180 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode<br />
schiedenen Themen sind Elemente eines „kooperativen<br />
Föderalismus“, der dem Bund auch über seine Gesetzgebungskompetenz<br />
hinaus Einflussmöglichkeiten einräumt:<br />
Im Bereich der Bildungspolitik etwa, Kernbereich der<br />
Länderkompetenz, verfügt der Bund nicht nur über die<br />
Zuständigkeit für die Regelung der Berufsausbildung,<br />
sondern kann auch im Rahmen der Kultusministerkonferenz<br />
Anregungen geben. Die Forderung nach „civic education“,<br />
nach einer Unterstützung des Lernens von bürgerschaftlichem<br />
<strong>Engagement</strong>, richtet sich in diesem<br />
indirekten Sinne also durchaus auch an den Bund.<br />
Auf der anderen Seite vermag der Bund allein wenig:<br />
Wenn man zum Beispiel über eine Öffnung der gesetzlichen<br />
Unfallversicherung nachdenkt, sind viele Beteiligte<br />
einzubeziehen: die Trägerorganisationen des bürgerschaftlichen<br />
<strong>Engagement</strong>s ebenso wie die gewerblichen<br />
Unfallversicherungen, aber auch die Unfallversicherungsträger<br />
der öffentlichen Hand, wobei wiederum nicht<br />
nur der Bund, sondern auch die Länder und Kommunen<br />
beteiligt sind. Eine tragfähige Lösung setzt eine Zusammenarbeit<br />
bereits in der Konzeptionsphase voraus, zumal<br />
dann, wenn gesetzliche Regelungen auch mit finanziellen<br />
Verpflichtungen verbunden sind.<br />
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Förderung bürgerschaftlichen<br />
<strong>Engagement</strong>s durch den Bund in mehrfacher<br />
Hinsicht als Querschnittsaufgabe dar:<br />
– Im föderalistischen Staatsaufbau ist die Förderung<br />
bürgerschaftlichen <strong>Engagement</strong>s alles andere als eine<br />
genuine Aufgabe des Bundes; vielmehr ist <strong>Engagement</strong>förderung<br />
eher durch eine primäre Zuständigkeit<br />
der Länder, vor allem aber der Kommunen, geprägt.<br />
Maßnahmen des Bundes erfordern daher eine enge<br />
und für die jeweiligen Kompetenzen sensible Abstimmung<br />
mit den anderen föderalen Akteuren.<br />
– Die Förderung bürgerschaftlichen <strong>Engagement</strong>s ist als<br />
Reform- und Gestaltungsaufgabe in nahezu allen<br />
Politikfeldern angesiedelt. Dazu kommt, dass bürgerschaftliches<br />
<strong>Engagement</strong> nicht allein im „Dritten Sektor“<br />
freiwilliger Assoziationen stattfindet, sondern<br />
gleichermaßen in den Sektoren von Markt, Familie<br />
und Staat seinen Platz hat. Dieser Querschnittscharakter<br />
erfordert einerseits Maßnahmen, die dem jeweiligen<br />
Bereich angemessen sind, also eine gezielte Förderpolitik<br />
durch einzelne Ressorts. Andererseits<br />
müssen – zum Beispiel durch rechtliche Regelungen –<br />
bereichsübergreifend Rahmenbedingungen geschaffen<br />
werden, die für <strong>Engagement</strong> förderlich sind.<br />
Schließlich schafft erst die Koordination und Vernetzung<br />
einzelner Maßnahmen das schlüssige Gesamtbild<br />
einer Politik, die sich am Leitbild der Bürgergesellschaft<br />
ausrichtet.<br />
– In der Bürgergesellschaft ist der Staat nicht alleiniger<br />
oder auch nur primärer Förderer bürgerschaftlichen<br />
<strong>Engagement</strong>s, das vor allem von der Selbstorganisation<br />
unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure<br />
getragen wird. Der Erfolg staatlicher Förderung lässt<br />
sich vor diesem Hintergrund daran messen, inwieweit<br />
sie Prozesse bürgerschaftlicher Selbstorganisation<br />
ermöglicht und unterstützt, inwieweit sie zur Vernetzung<br />
von Akteuren und zu Synergieeffekten zwischen<br />
unterschiedlichen Förderbemühungen beiträgt.<br />
Gerade der letzte Punkt macht deutlich, dass Gesetzgebung<br />
zwar eine wichtige, aber keineswegs die einzige<br />
Möglichkeit der Förderung bürgerschaftlichen <strong>Engagement</strong>s<br />
durch den Bund ist. Ähnlich wie die Länder kann<br />
der Bund als Partner und Initiator bei der auf Bundesebene<br />
noch relativ schwach ausgeprägten Vernetzung von<br />
Akteuren bürgerschaftlichen <strong>Engagement</strong>s mitwirken.<br />
Dies gilt auch und vor allem für Netzwerke, die die Grenzen<br />
der gesellschaftlichen Sektoren übergreifen, und für<br />
die Koordination der <strong>Engagement</strong>förderung im Rahmen<br />
neuer Formen eines „kooperativen Föderalismus“.<br />
Außerdem werden Träger bürgerschaftlichen <strong>Engagement</strong>s<br />
durch finanzielle Zuschüsse des Bundes unterstützt.<br />
Unbürokratische Formen der Finanzierung zu finden<br />
(etwa durch Vereinheitlichung von Richtlinien und<br />
Zuwendungsverfahren), ist dabei eine ebenso wichtige<br />
Aufgabe wie die Verbreiterung der finanziellen Grundlagen<br />
bürgerschaftlichen <strong>Engagement</strong>s – etwa durch<br />
Einrichtung von Fonds, die nicht nur von den unterschiedlichen<br />
föderalen Ebenen, sondern auch von privatwirtschaftlichen<br />
Quellen gespeist werden.<br />
Schließlich kann auch die Anerkennung und Qualifizierung<br />
bürgerschaftlichen <strong>Engagement</strong>s, obgleich primär<br />
sicherlich nicht auf Bundesebene angesiedelt, durch den<br />
Bund wichtige Impulse erfahren. Der Bund kann bürgerschaftliches<br />
<strong>Engagement</strong> durch Kampagnen aufwerten<br />
und durch Forschungsaufträge den Kenntnisstand über<br />
dieses noch recht junge Politikfeld verbessern helfen. Die<br />
hier skizzierten Handlungsempfehlungen und Entwicklungsperspektiven<br />
für den Bund werden in Teil C, vor<br />
allem in Kapitel C2.4., ausführlicher dargestellt.<br />
2.4. Europäische Ebene<br />
Mit der Europäischen Union hat sich in den letzten Jahrzehnten<br />
eine supranationale politische Institutionenstruktur<br />
entwickelt. Die Europäische Union setzt wichtige<br />
Rahmenbedingungen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft<br />
– aber auch für das bürgerschaftliche <strong>Engagement</strong>.<br />
Die Europäische Union hat Regelungsbefugnisse, die den<br />
gemeinsamen Markt mit den Freiheiten von Kapital,<br />
Gütern, Dienstleistungen und Personen betreffen. Ihre<br />
Befugnisse sind in den Verträgen zur Europäischen Union<br />
von Maastricht (1993) und Amsterdam (1999) niedergelegt.<br />
Entstanden als Wirtschaftsgemeinschaft in den<br />
1950er Jahren des letzten Jahrhunderts, ist die Europäische<br />
Union heute auf dem Weg, auch eine politische<br />
Union zu werden. Die langsame Europäisierung der Mitgliedsstaaten<br />
und immer weiterer Politikbereiche zeichnet<br />
den Weg dieser Entwicklung vor.<br />
Auch eine europäische Bürgergesellschaft entwickelt sich<br />
erst allmählich. Dabei gibt es jedoch noch zahlreiche Hindernisse:<br />
Europa besteht nach wie vor aus nationalen<br />
Gesellschaften, die sich erst langsam europäisieren. Eine<br />
europäische Öffentlichkeit gibt es nur in Ansätzen. Und die<br />
europäischen Institutionen sind immer noch bürgerfern<br />
und leiden an einem Demokratiedefizit. Es gibt aber