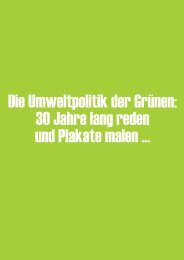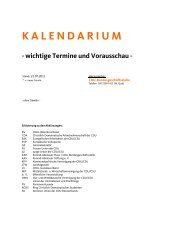Bürgerschaftliches Engagement - CDU Deutschlands
Bürgerschaftliches Engagement - CDU Deutschlands
Bürgerschaftliches Engagement - CDU Deutschlands
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Drucksache 14/8900 – 88 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode<br />
Die Umweltverbände stellen nicht nur – als Teil der Umweltbewegung<br />
– eine „Gegenmacht“ dar, sondern sie sind<br />
durch die Rio-Konferenz und die nachfolgenden UN-<br />
Weltkonferenzen der 1990er Jahre auch in ihrer Rolle als<br />
„Themenanwälte“ deutlich aufgewertet worden. Ihr Fachund<br />
Expertenwissen wird für viele Themen auf allen politischen<br />
Ebenen nachgefragt. Sie können auf Grund ihrer<br />
Verständigungskompetenz auch zu einer höheren Effektivität<br />
und Transparenz der Verhandlungsprozesse beitragen<br />
und die Positionen der von den Umweltproblemen<br />
direkt betroffenen Menschen einbringen. Sie steigern so<br />
die Legitimität der Verhandlungsprozesse und ihrer Ergebnisse<br />
(vgl. Beisheim 2001).<br />
Auch die Gründung des „Rates für Nachhaltige Entwicklung“<br />
auf Bundesebene sowie die Existenz entsprechender<br />
Kommissionen auf Länderebene, z.B. die Kommission<br />
für Zukunftsfragen in Hamburg, in denen die<br />
Umweltverbände durchweg vertreten sind, sind Ausdruck<br />
der gewachsenen Bedeutung der Bürgergesellschaft in<br />
diesem Feld. Auf der anderen Seite laufen die Expertinnen<br />
und Experten in den Verbänden Gefahr, sich von den<br />
gruppeninternen demokratischen Prozessen abzukoppeln<br />
und so selbst ihre Legitimation zu verlieren. Außerdem<br />
besteht das Problem der Überforderung der NGOs, wenn<br />
sie sich in die verschiedenen inter- und supranationalen<br />
Institutionen integrieren müssen. Die Inanspruchnahme<br />
von Beteiligungsmöglichkeiten und die Teilnahme an internationalen<br />
Konferenzen überfordert häufig gerade diejenigen<br />
NGOs in finanzieller Hinsicht, die in hohem<br />
Maße von bürgerschaftlichem <strong>Engagement</strong> leben. In den<br />
Umweltverbänden werden daher eine Aufwandspauschale<br />
oder die steuerliche Absetzbarkeit des tatsächlichen<br />
Aufwands für bürgerschaftlich Engagierte in nationalen<br />
und internationalen Gremien diskutiert. Ferner<br />
stellen die Umweltverbände die Forderung nach einer<br />
Erweiterung des Verbandsklagerechts entsprechend der<br />
Aarhus-Konvention auf.<br />
Auf der lokalen Ebene, insbesondere in Prozessen der<br />
„Lokalen Agenda 21“, spielen weniger die großen Umweltverbände<br />
als vielmehr lokale Gruppen und Initiativen<br />
eine Rolle. Im Abschlussdokument „Agenda 21“ der<br />
UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung im Jahr<br />
1992 in Rio de Janeiro wurden alle Kommunen aufgefordert,<br />
in einem Konsultationsprozess mit allen kommunalen<br />
Akteuren eigene Pläne für eine nachhaltige Entwicklung<br />
zu verabschieden:<br />
„Jede Kommunalverwaltung soll in einen Dialog<br />
mit ihren Bürgern, örtlichen Organisationen und<br />
der Privatwirtschaft eintreten und eine ‘kommunale<br />
Agenda 21’ beschließen. Durch Konsultation und Herstellung<br />
eines Konsenses würden die Kommunen von<br />
ihren Bürgern und von örtlichen Organisationen, von<br />
Bürger-, Gemeinde-, Wirtschafts- und Gewerbeorganisationen<br />
lernen und für die Formulierung der am besten<br />
geeigneten Strategien die erforderlichen Informationen<br />
erlangen.“ (Bundesministerium für Umwelt,<br />
Naturschutz und Reaktorsicherheit o.J.: 252).<br />
Da nachhaltige Entwicklung nicht einfach vom Staat verordnet<br />
werden kann, wird der gesellschaftlichen Diskus-<br />
sion und der Verständigung über Leitbilder, Handlungsfelder<br />
und Projekte in den einzelnen Kommunen Vorrang<br />
eingeräumt. Mit der expliziten Aufwertung von Bürgerbeteiligung,<br />
Information und Öffentlichkeitsarbeit in den<br />
Lokalen Agenda 21-Prozessen gewinnt auch bürgerschaftliches<br />
<strong>Engagement</strong> ein neues Handlungsfeld – analog<br />
zu anderen Initiativen der Erweiterung der Bürgerbeteiligung<br />
auf kommunaler Ebene.<br />
Zur Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in deutschen<br />
Kommunen gibt es erst vereinzelte empirische Erkenntnisse<br />
(vgl. zur Übersicht Pettenkofer 2001). Die vorliegenden<br />
Studien beziehen sich zumeist auf die Initiierung<br />
Lokaler Agenda 21-Prozesse; Erfahrungen mit der Einführung<br />
von Maßnahmen liegen dagegen wegen des kurzen<br />
Zeitraums bisher kaum vor. Gleichwohl zeichnet sich<br />
eine beachtliche Tendenz ab, Lokale Agenda 21-Prozesse<br />
auf kommunaler Ebene einzuleiten. Nach einer Untersuchung<br />
des Deutschen Instituts für Urbanistik haben fast<br />
90 % der Städte einen Beschluss zur Lokalen Agenda 21<br />
getroffen, fast drei Viertel der Städte haben bereits ein<br />
Leitbild für nachhaltige Entwicklung verabschiedet oder<br />
planen dies zu tun (vgl. Rösler 2000). Quantitativ betrachtet,<br />
kann man daher durchaus von einer steigenden<br />
Nachhaltigkeitsbewegung auf kommunaler Ebene sprechen,<br />
die durch die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung<br />
in der Bundesrepublik Deutschland ausgelöst<br />
wurde. Bei den inhaltlichen Schwerpunkten im Rahmen<br />
der Lokalen Agenda 21 dominieren die Themen Klimaschutz<br />
und Energie sowie Verkehr und die Versorgung mit<br />
regionalen Nahrungsmitteln („Aus der Region für die Region“).<br />
Hinter den hohen qualitativen Ansprüchen des Programms<br />
bleibt die Umsetzung in vielen Städten und Gemeinden<br />
bisher jedoch zurück. Folgende Probleme zeichnen<br />
sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits ab:<br />
– Vielfach wird vor Beginn der Lokalen Agenda 21-Prozesse<br />
nicht geklärt, welchen Status und welche Verbindlichkeit<br />
Vereinbarungen haben sollen, die in<br />
Agenda 21-Gremien getroffen werden. Haben Engagierte<br />
den Eindruck, dass ihre Ergebnisse von Rat und<br />
Verwaltung einfach ignoriert werden, sind Frustration<br />
und Rückzug eine naheliegende Konsequenz. Wie bei<br />
anderen Formen kommunaler Beteiligung ist es mit<br />
entscheidend für den Erfolg, dass bereits am Beginn<br />
des Prozesses geklärt wird, in welcher Form die Ergebnisse<br />
in den kommunalen Willensbildungs- und<br />
Entscheidungsprozess einfließen.<br />
– Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass von den Lokalen<br />
Agenda 21-Prozessen vor allem bereits aktive Bürgerinnen<br />
und Bürger mit guter Ausbildung angesprochen<br />
werden. Die in der Agenda 21 explizit geforderte<br />
Beteiligung von Jugendlichen, Frauen und benachteiligten<br />
Gruppen ist dagegen bisher nur in Ansätzen gelungen.<br />
– Dazu kommen Probleme, die nicht unmittelbar mit der<br />
Rolle bürgerschaftlichen <strong>Engagement</strong>s in Agenda<br />
21-Prozessen zusammenhängen. Die Integration ökologischer,<br />
sozialer und ökonomischer Dimensionen zu