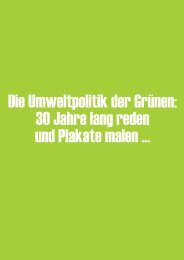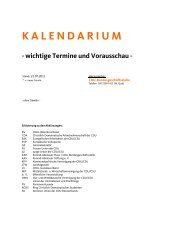Bürgerschaftliches Engagement - CDU Deutschlands
Bürgerschaftliches Engagement - CDU Deutschlands
Bürgerschaftliches Engagement - CDU Deutschlands
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 193 – Drucksache 14/8900<br />
Pluralisierung und Entgrenzung<br />
Zur Beschreibung des arbeitsgesellschaftlichen Wandels<br />
ist es sicherlich nicht hinreichend, allein die Abnahme des<br />
Erwerbsarbeitsvolumens und die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses<br />
als Ausgangspunkt der Analysen zu<br />
wählen. Eine solche Diagnose mag in den Zukunftsdebatten<br />
der 1990er Jahre um die „Krise“der Arbeit oder Erwerbsgesellschaft<br />
hinreichend gewesen sein (vgl. für die<br />
Bundesrepublik Deutschland Kommission für Zukunftsfragen<br />
der Freistaaten Bayern und Sachsen 1997a, 1997b,<br />
für die USA Rifkin 1995, für Frankreich Gorz 1989), eine<br />
eingehende Analyse empirischer Daten zur Beschäftigungssituation<br />
erzwingt jedoch eine differenziertere Interpretation<br />
(vgl. Hacket u.a. 2001, Mutz/Kühnlein 2001).<br />
Zunächst ist es (zumindest für die Bundesrepublik<br />
Deutschland und eine Reihe anderer europäischer Länder)<br />
zutreffend, dass das Volumen der Erwerbsarbeit langfristig<br />
tendenziell abnimmt (Klement 2001). Bei einem Anstieg<br />
der Erwerbsbevölkerung bedeutet dies, dass das<br />
durchschnittliche Erwerbsarbeitsvolumen pro Kopf der<br />
Erwerbspersonen ebenfalls sinkt1 . Dieser statistische<br />
Sachverhalt ist jedoch nicht mit einer Erosion des Normalarbeitsverhältnisses<br />
gleichzusetzen: Denn einerseits<br />
kann gezeigt werden, dass die absolute Zahl von Normalarbeitsverhältnissen<br />
in den vergangenen 30 Jahren stabil<br />
geblieben ist; andererseits ist gleichzeitig die absolute<br />
Zahl der atypischen Beschäftigungsverhältnisse deutlich<br />
gestiegen, weshalb insgesamt der Anteil von Normalarbeitsverhältnissen<br />
kontinuierlich zurückgegangen ist<br />
(Hacket u.a. 2001, Schmidt 2000). Diese Befunde zeigen<br />
zunächst, dass sich neben den „normalen“ Formen abhängiger<br />
Erwerbstätigkeit, die es vor allem in den industriellen<br />
Bereichen und teilweise im Dienstleistungssektor<br />
nach wie vor in hoher Zahl gibt, verschiedene Varianten<br />
befristeter Voll- und Teilzeitbeschäftigungen sowie eine<br />
Vielzahl prekärer Arbeitsverhältnisse entwickelt haben.<br />
Insbesondere an den „Rändern“ der Erwerbsgesellschaft<br />
sind in sozialer Hinsicht derartig unsichere Beschäftigungsformen<br />
entstanden. Zusätzlich haben sich im Bereich<br />
der selbständigen und freiberuflichen Erwerbstätigkeit<br />
zunehmend projektförmige Arbeitsstrukturen,<br />
kooperierende Netzwerke, Mikro- und Solounternehmen<br />
(vgl. Malone/Laubacher 1999) herausgebildet. Somit<br />
kann von einer Pluralisierung der Erwerbsformen gesprochen<br />
werden, und es ist denkbar, dass zukünftig die abhängige<br />
Erwerbsarbeit in Form der Lohnarbeit nicht mehr<br />
1 Sondervotum des Abg. Gerhard Schüßler (FDP) und des sachverständigen<br />
Mitglieds Rupert Graf Strachwitz: Die hier dargestellte<br />
Aussage ist bestreitbar. Das Volumen der Erwerbsarbeit ist<br />
weder objektiv vorgegeben noch gesetzmäßig tendenziell abnehmend.<br />
Das tatsächliche Volumen ist im Ergebnis davon abhängig, zu<br />
welchen Konditionen Arbeit auf dem Arbeitsmarkt angeboten und zu<br />
welchen Konditionen sie nachgefragt wird. In Deutschland ist die<br />
Arbeit auf Grund der hohen Lohnnebenkosten und der starken Regulierungen<br />
des Arbeitsmarktes für die Unternehmen vielfach zu<br />
teuer, was zu einer fallenden Nachfrage führt. Die Entwicklung in<br />
anderen Ländern (z.B. Dänemark, Niederlanden, Großbritannien,<br />
USA) zeigt, dass u.a. durch Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und<br />
Reformen der Alterssicherung sowohl die Nachfrage als auch das<br />
Angebot steigt und damit das Volumen der Erwerbsarbeit im Ergebnis<br />
auszuweiten ist.<br />
die dominante Organisationsform gesellschaftlicher Arbeit<br />
darstellt; Strukturen einer Neuen Arbeitsgesellschaft<br />
könnten sich herausbilden (vgl. Mutz 1999; auch Brose<br />
1998, 2000).<br />
Pluralisierung der Erwerbsformen bedeutet jedoch nicht,<br />
dass die Menschen nun nach einem anderen Ideal, wie<br />
etwa der flexibilisierten Projektarbeit oder nach freier Arbeitsgestaltung<br />
streben. Im Gegenteil: Die überwiegende<br />
Mehrzahl der Menschen orientiert sich immer noch am<br />
Leitbild des Normalarbeitsverhältnisses. Das normale<br />
und vor allen Dingen stabile und existenzsichernde Beschäftigungsverhältnis<br />
ist als motivationales Leitbild<br />
weiterhin prägend. Die Menschen bewegen sich in ihren<br />
vertrauten Denkstrukturen, während sich die Arbeitsgesellschaft<br />
längst in großer Schnelligkeit verändert hat. Die<br />
Leitbilder wandeln sich nur langsam und passen sich<br />
neuen Verhältnissen nur zögerlich an.<br />
Die Pluralisierung der Erwerbsformen hat zu Entgrenzungsprozessen<br />
geführt. Entgrenzung bezeichnet einerseits<br />
die Auflösung bisheriger Grenzen; es bedeutet andererseits<br />
aber auch die Herausbildung neuer Differenzierungen, deren<br />
Struktur oft noch nicht erkennbar ist. Mit der Diagnose<br />
der Entgrenzung der Arbeit wird eine Ausweitung der Arbeitsförmigkeit<br />
auf Tätigkeiten beschrieben, die bislang<br />
nicht als Arbeit galten (präzise formuliert geht es um eine<br />
„Laborisierung von Tätigkeiten“: Liessmann 2000). Wenn<br />
beispielsweise von Erziehungs-, Pflege- oder Betreuungsarbeit<br />
gesprochen wird, so deutet dies darauf hin, dass sich<br />
die bislang geltenden Grenzen zwischen Erziehung, Pflege<br />
oder Betreuung und Arbeit verschoben haben. Dies ist auch<br />
der Fall, wenn von „Bürgerarbeit“ als einer neuen Form des<br />
bürgerschaftlichen <strong>Engagement</strong>s gesprochen wird: Es wird<br />
so getan, als sei bürgerschaftliches <strong>Engagement</strong> lediglich<br />
eine andere Form der Arbeit. Aus dieser Perspektive bedeutet<br />
Entgrenzung der Arbeit, dass die Gesellschaft von<br />
einem „Ende der Arbeitsgesellschaft“ weit entfernt ist. Im<br />
Gegenteil: Die Arbeitsgesellschaft hat sich in unserem Leben<br />
sehr viel stärker durchgesetzt und befindet sich nun in<br />
einem Stadium, in dem nahezu alle Tätigkeiten – angelehnt<br />
an die industrielle Erwerbsarbeit – als Arbeit bezeichnet<br />
werden. Damit ist die Gefahr verbunden, dass bürgerschaftliches<br />
<strong>Engagement</strong> immer häufiger einer Nutzenabwägung<br />
und ökonomischen Rationalität unterworfen wird,<br />
die nicht zum Eigensinn des bürgerschaftlichen <strong>Engagement</strong>s<br />
passt (vgl. Jakob 2001b).<br />
Vor allem in den 1970er Jahren hat es eine weitere Form<br />
der Entgrenzung gegeben. Ausgelöst durch einen generellen<br />
Professionalisierungsschub hat eine Verberuflichung<br />
insbesondere des sozialen <strong>Engagement</strong>s stattgefunden:<br />
Freiwillige und unentgeltliche Tätigkeiten wurden zunehmend<br />
durch reguläre Beschäftigungsverhältnisse ersetzt –<br />
aus bürgerschaftlichem <strong>Engagement</strong> ist Erwerbsarbeit geworden.<br />
Dies war ein ambivalenter Prozess. Einerseits<br />
wurden somit im Bereich der Sozialen Arbeit zahlreiche<br />
Arbeitsplätze geschaffen, und es wurde ein hoher Professionalisierungsgrad<br />
erreicht. Dieser hat zu einer verlässlichen<br />
Versorgung mit sozialen Dienstleistungen geführt.<br />
Für das bürgerschaftliche <strong>Engagement</strong> waren diese Prozesse<br />
andererseits damit verbunden, dass das freiwillige