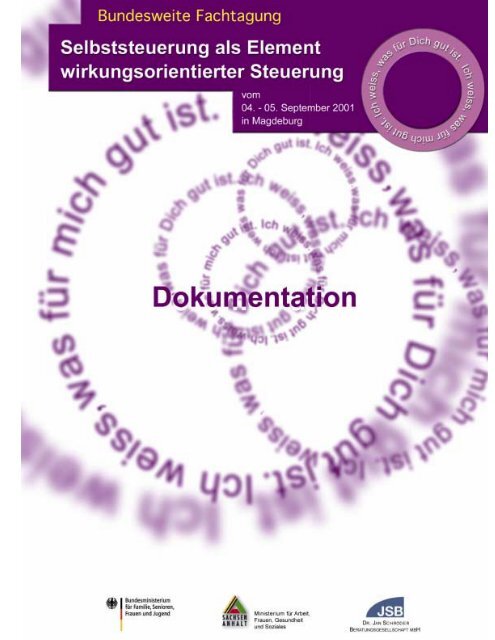Dr. Jan Schröder - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen ...
Dr. Jan Schröder - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen ...
Dr. Jan Schröder - Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2002 © JSB <strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong> Beratungsgesellschaft mbH<br />
Martinsplatz 2a, 53113 Bonn<br />
E-mail: jsbgmbh@jsbgmbh.de<br />
www.jsbgmbh.de<br />
ISBN 3 - 9807047 - 6 - 9<br />
Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Schröder</strong>, <strong>Jan</strong> (Hg.):<br />
Selbststeuerung als Element wirkungsorientierter Steuerung. / <strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong> (Hg.)<br />
Bonn: JSB, 2002<br />
ISBN 3 - 9807047 - 6 - 9<br />
2
1. Vorwort - <strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong>....................................................................................... 4<br />
2. Begrüssung und Einführung in die Thematik - Staatssekretär Peter Haupt.............. 8<br />
3. Begrüssung - Staatssekretär Prof. <strong>Dr</strong>. Dieter Schimanke....................................... 14<br />
4. Der aktivierende Staat - wer steuert wen?- Prof. <strong>Dr</strong>. Bernhard Blanke................... 22<br />
5. Fördert die Sozialgesetzgebung die Selbststeuerung der Klient/-innen?<br />
- Prof. <strong>Dr</strong>. Anne Friedrichs..................................................................................... 38<br />
6. Das persönliche Budget - Selbststeuerung der Klienten/-innen zwischen<br />
Selbstbedienung und Mitverantwortung <strong>für</strong> die eigene Zukunft: Erfahrungen aus der<br />
Niederländischen Behindertenhilfe - Liesbeth Reitsma .......................................... 47<br />
7. AG1: Der Heimvertrag und die Selbststeuerung der Bewohner/innen<br />
- Knut Lehmann, <strong>Dr</strong>. Bernd Schubert ..................................................................... 64<br />
8. AG2: Leistungsvereinbarung zwischen Kommune und Leistungserbringer als<br />
Instrument der Selbststeuerung der Träger - Wolfgang Klein, Dirk Terlinden ........ 75<br />
9. AG 3 Jugendhilfe: Qualitätsentwicklungsverfahren nach §78 a ff. SGB VIII als<br />
Unterstützung der Selbststeuerung von Einrichtungen?<br />
- Rainer Kröger, Jutta Lanfermann-Verweyen ........................................................ 78<br />
10. AG 4 Behindertenhilfe: Persönliches Budget und die Selbststeuuerung behinderter<br />
Menschen - <strong>Dr</strong>. Gerd Schneider, Joachim Speicher, <strong>Dr</strong>. Annette Wilcke............... 81<br />
11. Podiumsdiskussion: Chancen und Grenzen der Selbststeuerung, Kommentare<br />
aus Sicht der Betroffenen, des Sozialrechts, der Kommune sowie aus Trägersicht<br />
- Heike Baehrens, <strong>Dr</strong>. Peter Gitschmann, Liesbeth Reitsma, <strong>Dr</strong>. Bernd Schulte,<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong> .................................................................................................... 87<br />
3
1. Vorwort - <strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong>, JSB mbH<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier in Magdeburg begrüssen<br />
zu können. Besonders begrüssen möchte ich natürlich Sie beide, Herrn Staatssekretär<br />
Haupt und Herrn Staatssekretär Prof. <strong>Dr</strong>. Schimanke. Sie haben es zusammen mit<br />
Ihren Ministerien möglich gemacht, dass diese Tagungsreihe zu einem Themenkomplex,<br />
das uns noch einige Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte beschäftigen wird, stattfinden<br />
kann. Dazu ein paar Erläuterungen:<br />
Die sogenannten Magdeburger Gespräche beschäftigen sich seit Mai 2000 mit dem<br />
Themenkreis „Wirkungsorientierte Steuerung in der sozialen Arbeit“. Vorangetrieben und<br />
gestaltet werden diese Gespräche von einer kleinen Gruppe von Idealisten in den Ministerien,<br />
Frau von Keyserlingk, Frau Keller, Herr MDir Tack im <strong>Bundesministerium</strong>, Herr<br />
Lehmann im Landesamt <strong>für</strong> Versorgung und Soziales in Sachsen-Anhalt, Herr <strong>Dr</strong>. <strong>Dr</strong>.<br />
Nehring, Frau <strong>Dr</strong>. Theren im Sozialministerium des Landes Sachsen-Anhalt, die begonnen<br />
hat, sich Gedanken zu machen, was wirkungsorientierte Steuerung sein kann, wie<br />
sie funktionieren kann.<br />
In der ersten Tagung stand daher die Auseinandersetzung mit einigen Begrifflichkeiten<br />
und die Positionsbestimmung im Vordergrund. Herausgearbeitet wurden einige zentrale<br />
Entwicklungsstränge die allesamt zur wirkungsorientierten Steuerung hinführen.<br />
Vom <strong>für</strong>sorglichen Versorgungsstaat<br />
zum aktivierenden<br />
schlanken<br />
Staat<br />
Von der Struktur- über<br />
die Prozess- zur Ergebnisqualität <br />
Wirkungsorientierte<br />
Steuerung<br />
Von der input- über die<br />
output- zur outcomeorientierten<br />
Steuerung<br />
Von der konditionalen<br />
zur finalen Rechtsetzung<br />
Abbildung 1 Entwicklungsstränge in Richtung wirkungsorientierter Steuerung<br />
4
Ein Entwicklungsstrang führt von der Struktur- über die Prozess- zur Ergebnisqualität. In<br />
der Konsequenz wurden in der ersten Tagung Fragen bearbeitet wie: Wieviel Strukturqualität<br />
brauchen wir eigentlich, um positive Ergebnisse bei unseren Nutzern und Nutzerinnen<br />
zu erzielen? Hiermit soll allerdings nicht Wirkung mit Ergebnisqualität gleichgesetzt<br />
werden.<br />
Bereits damals stand schon die Frage im Raum: Wer soll wirkungsorientiert steuern?<br />
Dies wird ein Hauptthema der heutigen Tagung sein. Dahinter steckt der Entwicklungsstrang<br />
„Vom <strong>für</strong>sorglichen Versorgungsstaat zum aktivierenden schlanken Staat“. Herr<br />
Prof. Blanke, ich bitte das Nebeneinander von aktivierend und schlank zu entschuldigen.<br />
Dies spiegelt lediglich die Vermischung in der öffentlichen Diskussion wieder. Sie werden<br />
sicherlich nachher Ihren Teil dazu beitragen, dies zu sortieren.<br />
Ein dritter Strang führt von der input- über die output- zur outcome-orientierten Steuerung.<br />
Auch die kommunale Verwaltungsreform hat nach 10 Jahren endlich auch das<br />
Thema Wirkung entdeckt.<br />
Und ein letzter Strang, zu dem uns ein Schweizer Kollege in der letzten Tagung eine<br />
Steilvorlage geliefert hat, ist die Entwicklung von der konditionalen – also der Regelsteuerung<br />
– zur finalen (vulgo: zielorientierten) Rechtsetzung.<br />
In der zweiten Tagung, im Dezember letzten Jahres, haben wir uns dann mit dem Thema<br />
„Anreizsysteme in der sozialen Arbeit als Instrument wirkungsorientierter Steuerung“<br />
auseinander gesetzt, bspw. ausgehend von folgender Fragestellung: Was hat heutzutage<br />
der Betreiber eines Jugendheimes davon, wenn er einen Jugendlichen in die <strong>Familie</strong><br />
reintegriert. Betriebswirtschaftlich nicht viel! Er hat einen leeren Platz und damit ein Finanzierungsproblem.<br />
Gleiches gilt auch <strong>für</strong> aktivierende Pflege in Altenheimen und Sie<br />
können es <strong>für</strong> fast alle Felder sozialer Arbeit durchdeklinieren. Erfolg wird oftmals mit<br />
Kundenverlust und damit Einnahmeverlust bestraft<br />
Dies ist aber nur ein Zweig dessen, was wir unter der Überschrift „Anreizsysteme“ diskutiert<br />
haben. Ein weiterer zentraler Anreiz <strong>für</strong> wirkungsvolle soziale Arbeit ist die Motivation.<br />
Was bringt Menschen dazu, in Wirkungen zu denken? Auch hierzu hat die zweite<br />
Tagung Anstösse gegeben.<br />
Verlassen wir aber nun den Rückblick und wenden wir uns der vor uns liegenden Tagung<br />
zu.<br />
Setzt man sich mit dem Komplex „Wirkung“ näher auseinander, stößt man irgendwann,<br />
früher oder später, unvermeidlich auf die Frage: Wer definiert die erwünschten, mit öffentlichen<br />
Geldern zu finanzierenden Wirkungen? Wenn einem Menschen ein persönliches<br />
Budget übereignet wird, sei es <strong>für</strong> die Kinderbetreuung in Form einer KITA-Card,<br />
sei es jetzt wie im SGB IX vorgesehen <strong>für</strong> den Behindertenbereich, dann kommt schnell<br />
die Frage auf: Was darf man denn damit?<br />
Wer definiert, was man damit darf?<br />
5
Dies ist die Frage, die uns in dieser Tagung begleiten wird. Ich möchte versuchen das<br />
anhand nachfolgender Grafik ein wenig zu illustrieren. Auf dieser werden die leitenden<br />
Fragestellungen bei der wirkungsorientierten Steuerung im Sozialstaat abgebildet:<br />
• Wer finanziert Wirkungen (hoffentlich nicht nur Leistungen)?<br />
• Wer definiert Wirkungen?<br />
Einzelne<br />
???<br />
persönliches Budget<br />
(SGB IX)<br />
???<br />
Wer zahlt, bestellt die Musik ? JSB<br />
Wer finanziert<br />
Wirkungen ? Staat<br />
???<br />
Selbsthilfegruppen, Verbände, Sozialversicherungen<br />
kommunale Altenhilfe<br />
???<br />
© JSB <strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong> Beratungsgesellschaft mbH<br />
Jugendhilfe<br />
??? ???<br />
Altenpflege<br />
Einzelne<br />
Wer definiert<br />
Wirkungen ?<br />
Staat<br />
Abbildung 2 Trends der Wirkungsdefinition und -finanzierung<br />
Versucht man die verschiedenen Hilfebereiche in diesem Schema einzusortieren, dann<br />
ist die Antwort auf die Frage:<br />
„Wer zahlt bestellt die Musik - stimmt das wirklich?“<br />
nicht mehr so ganz einfach zu geben. Es gibt Bereiche, z.B. die erzieherischen Hilfen in<br />
der Jugendhilfe, in denen der Staat gemeinsam mit Verbänden, trotz aller wohllautenden<br />
Formulierungen im Hilfeplanverfahren, de facto massiv mitbestimmt, was mit den Jugendlichen<br />
geschehen soll. Insofern habe ich mir erlaubt „Wer definiert Wirkung?“ relativ<br />
stark in die Nähe des Staates zu rücken, ohne jetzt den ein oder anderen Verband als<br />
staatsnahe Organisation bezeichnen zu wollen. Mit der Qualitätsentwicklung nach §§78<br />
SGB VIII werden seit kurzem Möglichkeiten eingeräumt, dem Einzelnen mehr Steuerungsmacht<br />
in die Hand zu geben. Wird dies genutzt werden? Ich weiß es nicht...<br />
Im SGB IX ist mit dem persönlichen Budget eine faszinierende Konstellation ermöglicht<br />
worden. Der Staat finanziert und der/die Einzelne definiert Wirkung. Eine völlige Verkehrung<br />
dessen, was wir bislang kennen. Wenn man in das SGB IX hineinschaut und die<br />
ersten Verhandlungen zur Umsetzung des persönlichen Budgets betrachtet, kann man<br />
allerdings schnell ins Grübeln kommen. Da heißt es bspw. in einem Sitzungsprotokoll<br />
6
ei der Vorbereitung eines Modellprojektes zum persönlichen Budget zunächst: „Es<br />
muss sich um die Leistungsberechtigten drehen.“ Der 7. Punkt des Protokolls lautet<br />
dann: „Es müssen Zugangsbarrieren geschaffen werden, damit die Qualität der Einrichtungen<br />
gesichert bleibt.“ Da kommen dann doch Fragen auf: Geht es wirklich um Wirkung?<br />
Ein anderer Bereich, den wir hier betrachten, ist die Altenpflege, ein Bereich der letztlich<br />
vom Einzelnen über Versicherungen finanziert wird. Die Definitionsmacht liegt allerdings<br />
im Wesentlichen beim Staat oder staatsnahen Institutionen, den Sozialversicherungen.<br />
Ob es durch das PQSG wirklich zu einem stärkeren Einfluss von Heimbewohnern und -<br />
bewohnerinnen auf die zu verfolgenden Wirkungsziele kommt oder ob nicht letztlich<br />
doch der ordnungspolitisch Wirkungen herbeikontrollierende Ansatz künftig dominieren<br />
wird – wir werden sehen... Vielleicht kommen wir hier auf der Tagung weiter.<br />
Betrachten wir als Letztes die kommunale Altenhilfe. In NRW zieht sich das Land weitestgehend<br />
aus der Finanzierung zurück. Insofern ist es immer mehr ein Bereich den der<br />
Einzelne/ die Einzelne finanzieren muss und damit auch definiert, welche Wirkung will<br />
sie/ er denn zu Hause haben? Wo das hingeht, ist völlig offen. Ist es die Richtung reiner<br />
Marktwirtschaft, mit Käufermacht der Einzelnen kauft - oder verbleibt noch ein Rest<br />
staatlicher Definition? Unter anderem hiermit beschäftigt sich das Bundesmodellprojekt<br />
„Wirkungsorientierte Steuerung in der kommunalen Altenhilfe der Stadt Leverkusen“. Mit<br />
allgemeingültigen Antworten tue ich mich derzeit schwer. Ich hoffe die Tagung, wird uns<br />
an dieser Stelle ein Stück weiter helfen.<br />
Definitionsmacht und Finanzierungspflicht sind demnach sehr unterschiedlich verteilt.<br />
Unklar ist, inwieweit selbststeuernde Elemente künftig eine stärkere Rolle spielen können<br />
und sollen. Mit der Hoffnung auf einige erhellende und vielleicht auch richtungsweisende<br />
Erkenntnisse möchte ich diese einleitenden Überlegungen beenden.<br />
7
2. Begrüssung und Einführung in die Thematik<br />
- Staatssekretär Peter Haupt<br />
Peter Haupt, Staatssekretär im <strong>Bundesministerium</strong> <strong>für</strong> <strong>Familie</strong>, <strong>Senioren</strong>, <strong>Frauen</strong> und<br />
Jugend<br />
Lieber Herr Kollege Professor Schimanke, Herr <strong>Schröder</strong>, meine Damen und Herren,<br />
Soziale Arbeit steht zunehmend unter dem <strong>Dr</strong>uck knapper Kassen und der Forderung<br />
nach mehr Wettbewerb. Die Frage, wo<strong>für</strong> öffentliche Gelder verwendet werden, ist berechtigt<br />
und notwendig. Doch im Bereich der sozialen Arbeit fällt es schwer zu sagen,<br />
was eigentlich mit den aufgewendeten Mitteln erreicht wird. Was ist beispielsweise der<br />
Erfolg der Pflege in einem Altenheim? Objektive Kriterien, wie die Verbesserung des<br />
Gesundheitszustandes, greifen nicht. Vor dem Hintergrund des allgemeinen Konsenses<br />
in unserer Gesellschaft, ein Altern in Würde und weitest gehender Selbständigkeit zu<br />
erhalten, ist es sicherlich ein Erfolg, wenn sich eine Bewohnerin oder ein Bewohner im<br />
Heim wie zuhause fühlt. Über Erfolg oder Misserfolg entscheidet der Mensch, an den<br />
sich soziale Arbeit richtet und der deren Leistung in Anspruch nimmt.<br />
Daher muss bei allen Überlegungen der Mensch im Mittelpunkt stehen. Welche Bedürfnisse<br />
hat er? Doch neben seinen Wünschen muss sich soziale Arbeit auch an den gesellschaftlich<br />
anerkannten Zielen und den professionellen Grundsätzen sozialer Arbeit<br />
orientieren. Inwieweit soziale Arbeit sich an diesen Kriterien messen lassen kann, entscheidet<br />
über ihren Erfolg.<br />
Das Konzept der wirkungsorientierten Steuerung stellt, wie der Name schon sagt, die<br />
Wirkung in den Vordergrund. Grundlage <strong>für</strong> die Beschreibung einer Wirkung ist die Frage,<br />
welches Ziel wird überhaupt verfolgt. Dieses Ziel kann nur von allen Akteuren gemeinsam<br />
definiert werden. Die Betroffenen müssen ebenso damit einverstanden sein<br />
wie Kostenträger und Leistungserbringer. Auf der Basis dieses Konsenses kann die<br />
Wirkung von Maßnahmen im Hinblick auf die Zielerreichung bewertet werden. Gelingt<br />
es, eine solche Bewertung in Kennzahlen zu gießen, könnten auch (finanzielle) Anreize<br />
<strong>für</strong> besonders gute Ergebnisse vereinbart werden.<br />
So weit die Theorie, sie klingt einleuchtend und gar nicht so schwierig. Konfrontiert mit<br />
der Realität zeigt sich, dass schon die Definition von Zielen, die konkreter sind als das<br />
Ziel der Erhaltung der Selbständigkeit älterer Menschen, nicht so einfach ist. Diese<br />
Denkweise erfordert das Verlassen eingefahrener Bahnen. Angebote, die schon seit<br />
Jahren durchgeführt werden, müssen auf den Prüfstand bezüglich ihrer tatsächlichen<br />
Wirkung. Das Infragestellen des bisherigen Tuns fällt häufig Kostenträgern ebenso<br />
schwer wie Leistungsanbietern. Doch vor dem Hintergrund von Einsparungszwängen<br />
muss sich soziale Arbeit im Interesse aller zu zielgerichteteren Maßnahmen entwickeln.<br />
Warum denken wir über Selbststeuerung nach?<br />
Sozialpolitik kann nicht zentral definieren oder gar verordnen, was der/die einzelne Leistungsempfänger<br />
benötigt. Dazu ist sie „zu weit weg“ vom Einzelfall. Die persönliche Si-<br />
8
tuation und die individuellen Bedürfnisse kennen die Klienten und Klientinnen selbst am<br />
besten, bisweilen unterstützt von Personen, die eng mit ihnen zusammenarbeiten oder –<br />
leben: Verwandte, Betreuer, Ehrenamtlich etc.. Selbststeuerung der Klienten stellt eine<br />
konsequente Umsetzung dieses Gedankens dar. Der hohe Stellenwert des Wunsch-<br />
und Wahlrechtes in allen Sozialgesetzen trägt dieser Tatsache Rechnung.<br />
Sozialpolitische Steuerung kann sich bei der Umsetzung dieses Prinzips nicht der Mittel<br />
der Ordnungspolitik bedienen, sondern ist auf Gestaltungskräfte des bzw. der einzelnen<br />
angewiesen. Gute soziale Leistungen lassen sich nicht herbei “kontrollieren“ – sie beruhen<br />
auf einer aktiven Rolle der Klienten.<br />
Sozialpolitische Steuerung sollte nicht in erster Linie aus der zentralistischen Festschreibung<br />
von Standardleistungen oder Strukturqualitäten und deren Sicherung bestehen.<br />
Standards stehen schnell im Konflikt zur erwünschten Individualisierung sozialer<br />
Hilfen. Vielmehr sind Verfahren so flexibel zu gestalten, dass Individualität ermöglicht<br />
wird. Dazu kann eben auch gehören, dass Behinderte ihre Teilhabe an der Gemeinschaft<br />
entgegen dem Willen des Betreuers durch den Besuch eines Heavy Metal Konzertes<br />
realisieren – ohne dass gleich eine Neid- oder Sinndebatte hervorgerufen wird.<br />
Aufgabe einer modernen Sozialpolitik ist es demnach, Rahmenbedingungen <strong>für</strong> eine<br />
solche, möglichst weitgehende Übernahme der Verantwortung durch Leistungsberechtigte<br />
zu schaffen. „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist die Maxime der Sozialpolitik und als solche<br />
bereits eine Aufforderung zur Aktivierung.<br />
Zwei Möglichkeiten einer solchen Aktivierung werden derzeit intensiv diskutiert:<br />
• Verfahren, die Beteiligung / Mitsprache sichern: Festlegung von Verfahren, die eine<br />
starke Position der Klienten bei der Ausgestaltung der individuellen Ausgestaltung<br />
von Hilfen sichern: Heimbeirat im Heimgesetz; Hilfeplanung im SGB VIII.<br />
• Persönliches Budget: Umsetzung eines Mottos der Berliner Behinderten Verbände:<br />
„In meiner Hand die Mark macht mich stark“: vgl. die persönlichen Budgets im SGB<br />
IX, in gewisser Weise auch Pauschalierungen von Sozialhilfe.<br />
Die radikale Lösung der persönlichen Budgets führt in der Konsequenz zu einer Nachfragesteuerung.<br />
Leistungserbringer definieren nicht mehr <strong>für</strong>sorglich in Kooperation mit<br />
Leistungsträgern, was gute und sinnvolle Leistungen sind – die Klienten und der von<br />
ihnen geschaffene und definierte Markt bestimmen, was benötigt wird. Nicht nur die individuelle<br />
Leistungsgestaltung, sondern die gesamte Angebotspalette folgt auf diese<br />
Weise dem Willen der Leistungsberechtigten.<br />
Die Festlegung von Verfahrensregelungen dagegen überlässt die Gestaltung der Angebotspalette<br />
einem sozialpolitischen Aushandlungsprozess zwischen Staat / Kommune,<br />
Trägern, ggf. ergänzt um Vertreterinnen und Vertreter der Betroffenen. In der Tradition<br />
unseres Sozialstaates mit meist schwachen Interessensvertretungen der Klienten hat<br />
dies meist eine <strong>für</strong>sorgliche und damit zum Teil bevormundende Gestaltung zur Folge.<br />
Selbststeuerung findet im Rahmen der bestehenden Angebotspalette erst bei der Gestaltung<br />
individueller Hilfen statt – oder auch nicht.<br />
9
Es spricht also einiges <strong>für</strong> die radikale Variante und die Einführung von Marktprinzipien.<br />
Allerdings handelt es sich nicht um einen Markt im klassischen Sinn, da hier öffentliche<br />
Gelder ausgegeben werden und viele Klienten dauerhaft auf soziale Leistungen existentiell<br />
angewiesen sind. <strong>Dr</strong>ei Punkte sind daher bei der Einführung von Marktprinzipien in<br />
jedem Fall zu beachten:<br />
Marktversagen, d.h. einen temporären oder partiellen Wegfall von Sozialleistungen soll<br />
es in sozialen Märkten nicht geben. Hier<strong>für</strong> müssen zumindest Wirkungsziele und Anspruchskriterien<br />
definiert sein – mit der Möglichkeit des Rechtsweges <strong>für</strong> Anspruchsberechtigte<br />
bzw. <strong>für</strong> Interessensverbände (SGB IX). Marktprinzipien dürfen nur soweit greifen,<br />
dass es nicht zu extremen Unterschieden in der Bedarfsdeckung kommt – sei es<br />
durch erhebliche Unterschiede in der örtlich vorhandenen bzw. zugänglichen Angebotspalette,<br />
sei es durch eingeschränkte Artikulations- oder Durchsetzungsfähigkeit bestimmter<br />
Klienten(gruppen).<br />
Ein neu gekaufter Fernseher, der beim Championsleague Endspiel kaputt geht, mag<br />
zwar einen gewissen emotionalen Schaden in der <strong>Familie</strong> hinterlassen – den Fernsehermarkt<br />
über die derzeitigen Sicherheitsregeln hinaus zu regulieren ist sozialpolitisch<br />
dennoch verzichtbar.<br />
Anders sieht dies beispielsweise bei pädagogischen oder betreuerischen Leistungen<br />
aus – Verbraucherschutz muss gewährleisten, dass ein Mindestmass an Wirkung erzielt<br />
wird. Ein derartiger Verbraucherschutz kann vom Staat / den Kommunen selber wahrgenommen<br />
werden – denkbar wäre aber auch entsprechend der holländischen Erfahrungen<br />
eine strukturelle Unterstützung von Interessensvertretungen der Klienten, wiederum<br />
eine Form der Selbststeuerung. Verbunden werden muss dies im Vorfeld mit Verfahren<br />
der Qualitätsentwicklung, die greifen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.<br />
„Der empfindlichste Körperteil vieler Menschen ist ihr Geldbeutel – insbesondere, wenn<br />
der Nachbar mehr hat.“<br />
Erhalten <strong>Familie</strong>n pro Kind 2000,- DM an Stelle des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatzes<br />
– und kann dieses Geld auch der Großmutter des Kindes <strong>für</strong> ihre Bemühungen<br />
am Wochenende gegeben werden - dann entsteht schnell eine neidgefärbte<br />
Umverteilungsdebatte, nicht zuletzt auch erheblicher Widerstand der bestehenden.Träger.<br />
Sozialpolitik muss Selbststeuerung behutsam einführen, offensiv die beabsichtigten Wirkungen<br />
kommunizieren und deutlich machen, dass Menschen in der Regel die vom<br />
Staat überlassenen Gelder zweckentsprechend einsetzen. Dies zeigen zumindest die<br />
niederländischen Erfahrungen.<br />
Daher führen nur Markt und sozialpolitische Verfahrensregeln gemeinsam zum Ziel –<br />
letztere können auch als Instrumente der Selbststeuerung organisiert werden.<br />
Mit der Tagungsreihe „Magdeburger Gespräche“ hat das BMFSFJ gemeinsam mit<br />
dem Ministerium <strong>für</strong> Arbeit, <strong>Frauen</strong>, Gesundheit und Soziales und der <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong> Beratungsgesellschaft<br />
mbH die Diskussion zwischen Theorie und Praxis angestossen.<br />
10
Bisher wurden in dieser Reihe Tagungen zu folgenden Themen durchgeführt:<br />
• „Wirkungsorientierte Steuerung in der sozialen Arbeit“<br />
• „Anreizsysteme in der sozialen Arbeit – ein Weg zur Wirkungsorientierung?“<br />
Das <strong>Bundesministerium</strong> <strong>für</strong> <strong>Familie</strong>, <strong>Senioren</strong>, <strong>Frauen</strong> und Jugend finanziert darüber<br />
hinaus Modellprojekte:<br />
Zu nennen ist zunächst „WISA – Wirkungsorientierte Steuerung sozialer Dienste in der<br />
Altenhilfe“ (Projektbeginn Sommer 2000).<br />
Das Projekt wird von „Netz Werk – gemeinnützige Gesellschaft <strong>für</strong> Betreutes Wohnen,<br />
Pflege und Rehabilitation“ in 3 Kommunen durchgeführt.<br />
Am Projekt beteiligen sich die Kommunen Stadt München, Stadt Freiburg und Landkreis<br />
Quedlinburg. Der erste Arbeitsschritt in diesem Projekt war die Identifizierung besonders<br />
problematischer und interessanter Arbeitsfelder der Altenhilfe in den Kommunen.<br />
In München wurde der Bereich der „Pflegergänzende Leistungen“ ausgewählt. Folgende<br />
Fragestellungen liegen dem Projekt zugrunde:<br />
• Welche Leistungen werden erbracht?<br />
• Wer finanziert?<br />
• Wer berät mit welchem Ziel?<br />
• Welche Wirkungen können erzielt werden, z.B. längerer Verbleib in der eigenen<br />
Wohnung?<br />
In Freiburg befasst das Projekt sich mit dem Übergang aus Akutkrankenhaus/Reha/<br />
Kurzzeitpflege in stationäre Pflegeheime.<br />
Ausgangslage ist die zum Teil völlig unterschiedliche und konfligierende Interessenlage<br />
bei den betroffenen Institutionen. Die Frage ist, welche Steuerungsmöglichkeiten hat die<br />
Kommune in diesem durch SGB V und SGB XI geprägten Bereich überhaupt.<br />
Als zweites Thema wird in Freiburg eine „Wirkungs- und Potenzialanalyse von Begegnungsstätten“<br />
durchgeführt.<br />
In Quedlinburg wurde eine ähnliche Thematik wie in Freiburg ausgewählt. Es geht um<br />
die Steuerung des Übergangs in stationäre Einrichtungen. Daneben wird eine „Wirkungsanalyse<br />
der Förderung der offenen Altenhilfe in Zusammenhang mit ehrenamtlichen<br />
Tätigkeit“ durchgeführt.<br />
In allen drei Feldern wird die derzeitige Situation in Bezug auf die Problemfelder erhoben.<br />
Hierbei wird ein besonderer Wert auf die Situation und die Wünsche der Nutzer<br />
gelegt. Auf dieser Basis wird vergleichbar mit der Vorgehensweise in Leverkusen, ein<br />
Konzept wirkungsorientierter Steuerung entwickelt.<br />
11
In Leverkusen fördert das BMFSFJ das Projekt " Wirkungsorientierte Steuerung in der<br />
kommunalen Altenhilfe " ( Projektbeginn 7/ 2001).<br />
Ab dem 1.1.2001 fallen die Landesmittel zur Förderung komplementärer Dienste in<br />
NRW sukzessive weg. Unter komplementären Diensten werden in NRW Leistungen<br />
freier Träger der Alten- und Behindertenhilfe wie z.B. hauswirtschaftliche Hilfen, Hilfen<br />
zur sozialen Integration und zur selbständigen Lebensführung sowie Betreuung und Beratung<br />
Hilfe- und Pflegebedürftiger verstanden. Die Mittel der Kommune reichen nicht<br />
aus, um die bisherigen Maßnahmen ohne Landesmittel in vollem Umfang weiter zu finanzieren.<br />
Durchschlagende Argumente <strong>für</strong> eine Umschichtung von Finanzen aus anderen<br />
kommunalen Aufgabenbreichen zugunsten der Altenhilfe sind schwer zu finden, da<br />
es wenig Anhaltspunkte <strong>für</strong> die tatsächlichen Wirkungen komplementärer Dienste gibt.<br />
Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Leverkusen den gesamten Bereich der komplementären<br />
Dienste auf den Prüfstand gestellt.<br />
Die Kommune strebt daher eine Veränderung der kommunalen Steuerung in diesem<br />
Bereich an. Im Vorfeld des Projektes konnte die Kommune die Träger von Angeboten im<br />
Bereich der komplementären Dienste da<strong>für</strong> gewinnen, gemeinsam über neue Wege<br />
nachzudenken und sich den daraus ergebenden Konsequenzen zu stellen.<br />
Das Gesamtprojekt ist zweiphasig angelegt:<br />
Zu Beginn der wirkungsorientierten Steuerung stehen die Gewinnung konzeptioneller<br />
Grundlagen, die Abstimmungsprozesse mit den Beteiligten und die gemeinsame Zieldefinition,<br />
auf die sich alle Beteiligten festlegen (Phase I). In der gemeinsamen Diskussion<br />
wird eine Grobkonzeption <strong>für</strong> die zukünftigen Steuerungsmechanismen entwickelt. An<br />
zwei konkreten Projekten, „Unterstützung pflegender Angehöriger“ und „Lebensraumorientierte<br />
Netzwerkhilfe <strong>für</strong> ältere Menschen“ wird die neue Form der Steuerung in der<br />
Realität durchgespielt und Wirksamkeit getestet.<br />
Ziel der 2. Phase des Projektes ist es, auf dieser Basis <strong>für</strong> alle Bereiche Leistungsvereinbarungen<br />
als Grundlage der Finanzierung zu schließen. Anfangs werden die Leistungsvereinbarungen<br />
voraussichtlich primär leistungsorientiert sein und erst im weiteren<br />
Prozess zunehmend Aspekte der Wirkungsorientierung erhalten. In einem weiteren<br />
Schritt können Anreize <strong>für</strong> besonders gute Wirkungen ausgehandelt werden. Dieses<br />
strukturierte Verfahren erfordert die Abklärung zahlreicher Details. Steuerungsebenen<br />
und Inhalte, Kooperations- und Kommunikationsstrukturen, Berichtslegung etc. müssen<br />
geklärt werden. Nur wenn alle Beteiligten im Konsens auf das Ziel der wirkungsorientierten<br />
Steuerung zugehen, kann das Verfahren letztlich zum Erfolg führen.<br />
Das WISA- Projekt unterscheidet sich insofern vom Projekt in Leverkusen, als es sich<br />
nur auf einzelne modellhafte Bereiche bezieht und somit nicht die Steuerungsstruktur<br />
eines ganzen Arbeitsfeldes in einer Kommune umgestaltet. Die Zahl der beteiligten Träger<br />
und die möglichen Konesequenzen sind nicht vergleichbar. Allerdings ermöglicht<br />
das WISA- Projekt einen Einblick, wie unterschiedliche kommunale Strukturen mit der<br />
Thematik „Wirkungsorientierte Steuerung“ umgehen und eine sehr detaillierte Betrachtung<br />
der einzelnen Arbeitsbereiche.<br />
12
Das Modellprojekt in Leverkusen ist eine „Wirkung“ der beiden vom BMFSFJ initiierten<br />
Fachtagungen im Rahmen der Magdeburger Gespräche. Die in den Tagungen entwickelten<br />
theoretischen Verfahren sollen in der Stadt Leverkusen angewendet werden.<br />
Auslöser <strong>für</strong> das Projekt ist die durch die Rückführung des Landeszuschusses entstandene<br />
Finanzknappheit bezüglich komplementärer Dienste. Die Thematik „Wirkungsorientierte<br />
Steuerung“ steht mithin unter hohem Erfolgs- und Realisierungsdruck. Das Projekt<br />
bietet die Möglichkeit, erstmalig den Umbau der Steuerung in der Altenhilfe zu begleiten<br />
und die dabei gewonnen Erfahrungen auch <strong>für</strong> andere Kommunen nutzbar zu<br />
machen.<br />
Die Erprobung wirkungsorientierter Steuerungsverfahren in Kommunen ist mit Blick auf<br />
die Weiterentwicklung von Altenhilfestrukturen von besonderem Interesse. Alle Überlegungen<br />
seitens des BMFSFJ müssen sich an der Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit<br />
in den Kommunen messen lassen. Die Umsetzung wirkungsorientierter Steuerung<br />
zwingt die Beteiligten in einem ersten Schritt Wirkungsziele zu vereinbaren. Damit wird<br />
die Diskussion um die Fragen, wem dient die Altenhilfe und was wollen wir erreichen,<br />
notwendig. Eingefahrene Angebotsstrukturen werden hinterfragt. Sinnvoll kann diese<br />
Frage aber nur durch die Einbeziehung der Nutzer beantwortete werden, da sich die<br />
Wirkung des Angebots ja auf ihn richtet, somit wird auch außerhalb von Heimen eine<br />
stärkere Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer gefördert. Auf der Grundlage der Wirkungsziele<br />
können „wirkungsvolle“ Angebote geschaffen werden und bestehende Angebote<br />
bezüglich ihrer „Wirksamkeit“ hinterfragt werden. Zielsetzung ist die Verteilung finanzieller<br />
Mittel danach auszurichten, wie die angestrebte Wirkung am besten erreicht<br />
werden kann. Mit einem solchen Verfahren wird auch deutlich, welche Ziele wegen fehlender<br />
Mittel nicht erreicht werden können. Die Diskussion über notwendige Angebote<br />
und die <strong>für</strong> die Finanzierung benötigten Mittel kann so versachlicht werden. Die Begleitung<br />
dieses Prozesses in der Stadt Leverkusen und im Modellprojekt WISA kann auch<br />
<strong>für</strong> die Diskussion der Strukturfragen auf Bundesebene wichtige Impulse geben.<br />
Ich wünsche uns eine erfolgreiche, weiterführende Veranstaltung und gute Anregungen.<br />
13
3. Begrüssung - Staatssekretär Prof. <strong>Dr</strong>. Dieter Schimanke<br />
Prof. <strong>Dr</strong>. Dieter Schimanke, Staatssekretär im Ministerium <strong>für</strong> Arbeit, <strong>Frauen</strong>, Gesundheit<br />
und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt<br />
Lieber Herr Bundesstaatssekreär Haupt, meine Damen und Herren!<br />
Gestatten Sie mir einige Anmerkungen zu meinem Vorredner. Zunächst fand ich es natürlich<br />
gut, dass wir in dem vorangegangen Referat gehört haben, wie wesentlich bei der<br />
heutigen Fragestellung die Länder und die Kommunen sind und dass wir hier eine gemeinsame<br />
Aufgabe haben. Wir haben es gelegentlich, gerade auch in der Sozialpolitik,<br />
damit zu tun, dass der Bund uns immer sagt, was denn richtig ist und wo es langgeht.<br />
Heute aber thematisieren wir einen kooperativen Ansatz, und deshalb habe ich natürlich<br />
den “Bundesstaatssekretär” so betont. Zudem ist es auch gut, wenn jemand in eine Führungsposition<br />
auf Bundesebene kommt, der vorher bei Ländern und Kommunen, sogar<br />
bei einem Stadtstaat tätig gewesen ist.<br />
Ich möchte positiv aufnehmen, dass wir fast schon eine Institution haben, nämlich drei<br />
Veranstaltungen zur Thematik „Wirkungsorientierter Steuerung im sozialen Bereich“. Wir<br />
sind gerne bereit, weiter mitzumachen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir hier Mitarbeiterinnen<br />
und Mitarbeiter im Geschäftsbereich des Ministeriums haben, die diese<br />
Thematik sehr gerne und auch engagiert und kompetent betreiben. Die Idee kam vor<br />
dreieinhalb, vier Jahren von Herrn Lehmann. Damals haben wir mit den leitenden Herren<br />
im Landesamt und in den Ämtern <strong>für</strong> Versorgung und Soziales - die hier vertreten<br />
sind – über dieses Thema gesprochen.<br />
Wir nehmen es gerne auf, dieses Thema weiter zu traktieren. Natürlich, wir haben seit<br />
14 Tagen eine Haushaltssperre, das bedeutet aber eigentlich nur, intelligentes Verwaltungshandeln<br />
ist jetzt erforderlich. Auch in Zeiten von Haushaltssperren kann man natürlich<br />
weiterhin vernünftig arbeiten. Es sind nur andere Rahmenbedingungen, unter denen<br />
man anzutreten hat. Auf einen Aspekt möchte ich Sie noch unbedingt hinweisen. Sie<br />
dürfen Magdeburg nicht verlassen, ohne dass Sie in der „Otto“-Ausstellung gewesen<br />
sind. (...) Ich hätte natürlich gerne das Münzrecht, das ja Magdeburg einmal gehabt hat,<br />
das würde manche unserer finanziellen Probleme vielleicht erleichtern. Aber wir befinden<br />
uns ja gerade im gegenläufigen Trend, dass vieles sogar auf europäischer Ebene<br />
geregelt werden kann, wie z. B. Finanzfragen. (...)<br />
Um den Bogen nun von “Otto” zu unserer heutigen Zeit zu schlagen, lehne ich mich an<br />
die Ausstellungsbesprechung in der Zeit, die, wie der Spiegel kaum etwas Kritikwürdiges<br />
an dieser Ausstellung gefunden hat - mit einer Ausnahme – dass mit einer anschaulichen<br />
Rezeptionsgeschichte eine Brücke über den Abgrund von 1000 Jahren hätte gebaut<br />
werden können. Das ist jedoch nicht einfach. Ebenso schwierig ist dies in unserem<br />
Bereich des Sozialen. Wir können insofern nur eine Anleihe machen, dass diese Ausstellung<br />
unter dem Motto “Europa” steht und wir auch mit unserer Thematik es inzwischen<br />
ebenfalls mit einer europäischen Dimension zu tun haben. Dies hatten wir bei<br />
unserer letzten Tagung angesprochen. (...)<br />
14
Heute geht es um die Frage der Selbststeuerung und ich denke wir müssten unterschiedliche<br />
Aspekte betrachten.<br />
Zunächst einmal ist Selbststeuerung als ein Instrument zur Bestimmung und damit auch<br />
der Weiterentwicklung des Outcomes, zu betrachten, das im Rahmen der sozialen Arbeit<br />
eben das Resultat im Sinne der tatsächlich bewirkten Effekte beschreibt. Ich komme<br />
mit einigen Beispielen noch darauf zurück.<br />
In den beiden Tagungen, die hinter uns liegen, ist bereits viel über Ergebnisqualität diskutiert<br />
worden. Ich kann mich erinnern, dass ich dies selber in meinem Referat auf der<br />
ersten Tagung ausgeführt habe. Aber wir brauchen, so wurde es klar und deutlich herausgearbeitet,<br />
- und daran mangelt es nach wie vor - eine eindeutige Zielbestimmung<br />
und Definition des Erfolges. So einfach ist es formuliert, so schwer ist es in der Praxis.<br />
Sie hatten, Herr <strong>Schröder</strong>, vorhin ausgeführt, dass wir in Kontinentaleuropa sehr viel<br />
über Recht und Gesetz steuern. Das können Sie übrigens bei den Urkunden im Museum<br />
schon nachlesen, dass dies auch schon vor 1.000 Jahren so gewesen ist. Allerdings<br />
gehen wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten zunehmend dazu über, dass wir immer<br />
eine Zielorientierung, eine Zweckbestimmung haben, also das, was wir unter finaler<br />
Konditionierung verstehen. Bloss was bedeutet das?<br />
Beim Blick in den neuen Gesetzentwurf “Behindertengleichstellung” fällt dort natürlich<br />
eine Zielbestimmung, auf. Aber was folgt daraus? Ist dies schon die inhaltliche Steuerung?<br />
Welche Schritte und Verfahren müssen nachfolgen, damit Sie nachher auch messen<br />
können, ob dieses Gesetz Erfolg hat? Wir selber haben im Augenblick ein Behindertengleichstellungsgesetz<br />
in der Schlussrunde im Landtag von Sachsen-Anhalt. Genau<br />
diese Frage wird dort auch gestellt. Wir wollen natürlich, über diese Zielbestimmung<br />
auch Prioritäten setzen. Auch in der Praxis wollen wir Akzente setzen - müssen jedoch<br />
den Finanzleuten sagen, dass zunächst eine Zielbestimmung keine unmittelbar finanziellen<br />
Folgen hat, denn andernfalls hätte ein solches Gesetz kaum eine Chance. So<br />
sieht man schon auf dieser Ebene der finalen Konditionierung - also hier auf Gesetzesebene<br />
-, in welcher Konfliktsituation wir stehen. Als Fachleute sind wir natürlich auch<br />
gefragt: Wie definieren wir, wie messen wir, wie bestimmen wir den Erfolg? Selbststeuerung<br />
als Element wirkungsorientierter Steuerung und damit auch der Definition des Erfolges<br />
kann unter zum Teil sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auch der Beteiligten betrachtet<br />
werden. Zum einen handelt es sich um die Selbststeuerung der Betroffenen,<br />
heute auch Klienten genannt oder Kunden. Diese Sichtweise äußert sich in einem kundenorientierten<br />
Ansatz, der Qualität mit der Erfüllung von Kundenanforderungen gleichsetzt,<br />
also so, wie wir auch in der Verwaltung unsere Bürger und Bürgerinnen als Kunden<br />
definieren. Die Versorgungsverwaltung des Landes Sachsen-Anhalts ist hier geradezu<br />
beispielhaft. Wir haben, um nur ein Highlight zu nennen, im Schwerbehindertenbereich<br />
den sogenannten “taggleichen Bescheid” entwickelt, der bundesweit beachtet wird.<br />
Unsere Bürger und Bürgerinnen kommen morgens und nach einer relativ kurzen Zeit<br />
gehen sie, wenn alle Unterlagen vorliegen, schon mit dem Bescheid nach Hause. Also<br />
eine Kundenorientierung.<br />
Gerade im sozialen Bereich stellt sich immer wieder die spannend und intensiv diskutierte<br />
Frage, inwieweit der Klient/die Klientin als Abnehmer / Abnehmerin der Leistung in<br />
15
der Lage ist, nun auch Angebot und Erfolg entsprechend und hinreichend zu beurteilen.<br />
In meiner Diskussion mit den Fachverbänden der Ärzte vor 14 Tagen war das eine der<br />
Streitfragen. Im Gesundheitswesen wissen wir ja ohnehin sowieso nicht, wer nun eigentlich<br />
was steuert. Es handelt sich dabei um ein sehr komplexes Steuerungssystem. Mit<br />
den Mustern “Wettbewerb/Markt” auf der einen Seite und staatliche Steuerung auf der<br />
anderen Seite kommen wir hier nicht weiter. Eine wichtige Person oder Institution, die<br />
Leistungen beeinflusst und darüber entscheidet ist natürlich der Arzt oder die Ärztin. Es<br />
gibt jedoch noch den Patienten und die Patientin. Oft meint der Arzt/ die Ärztin, der Patient<br />
könne das gar nicht beurteilen oder mindestens nur in bestimmten Grenzen. Dies<br />
wäre daher eine Grenzlinie <strong>für</strong> den kundenorientierten Ansatz. Wobei ich dies eher als<br />
Frage, denn als Ergebnis verstehen möchte.<br />
Ich will hierbei nicht verkennen, dass diese Problematik der Kundenfähigkeit, die sich<br />
auch in einer begrifflichen Schwierigkeit niederschlägt, durchaus ernst zu nehmen ist. In<br />
Westdeutschland ist ja diese Diskussion durchaus älter und begann in den 70er Jahren.<br />
Wenn ich z. B. beim Gesundheitsbereich bleibe, entwickelten sich Begriffe bezüglich der<br />
Selbstorganisation der Patienten, wie Patientenanwälte usw..<br />
Auf der anderen Seite kauft auch der Staat oder die entsprechende Behörde Leistungen<br />
von den Leistungserbringern als Kunde ein, ebenso wie der Empfänger der Leistung<br />
eben auch Kunde ist und vom Staat die Leistung als Endverbraucher übernimmt. Deshalb<br />
gibt es auch eine Kontroverse in der Fachliteratur zu dem Kundenbegriff.<br />
Beispielhaft zu dieser Thematik ist das Pflegeversicherungsgesetz und die dort agierenden<br />
Klienten bzw. Kunden; Denn hier handelt es sich um einen Kreis von Personen, die<br />
zwar als Pflegebedürftige der Hilfe bedürfen, auf alle Fälle aber mindestens in der Lage<br />
waren und überwiegend wohl auch noch sind, das Leben selbst zu gestalten, Bedürfnisse<br />
zu formulieren und zu meistern. Hier wäre es in der Tat fatal, wie es in den Anfängen<br />
der klassischen Altenhilfe noch üblich war, die persönliche Kompetenz und Fähigkeit<br />
und damit letztlich das Recht auf Selbstbestimmung abzusprechen. Aber – wie gesagt –<br />
es gibt möglicherweise Grenzen. Der Entwurf eines 3. Gesetzes zur Änderung des<br />
Heimgesetzes bzw. das Gesetz selber misst ja nun, ich darf mit Erlaubnis des Verfassers<br />
Herrn Haupt zitieren, diesem Thema ja nun eine besondere Bedeutung zu. Sie<br />
schreiben in § 2 Abs. 1: „Zweck des Gesetzes ist es, die Selbständigkeit, die Selbstbestimmung<br />
und die Selbstverantwortung der Bewohnerinnen und Bewohner zu wahren<br />
und zu fördern.“. Damit hat das Heimgesetz endgültig den Charakter eines Ordnungsgesetzes,<br />
ja fast eines besonderen Polizeigesetzes verlassen und hat hier einen materiellen<br />
Ansatz bekommen. Wir werden zu beachten und ich denke auch mitzugestalten<br />
haben, was daraus tatsächlich folgen wird. Die stärkere Selbststeuerung als Ausfluss<br />
dieses Selbstbestimmungsrechtes zeigt sich im Bereich der Angebote zur Versorgung<br />
älterer Bürgerinnen und Bürger durch eine intensive Marktentwicklung, das heisst einer<br />
zunehmenden Angebotssteuerung durch Nachfrageverhalten. Es zeigt sich, dass –<br />
wenn auch zum Teil mit Hilfe der Angehörigen, Betreuer oder sonstigen Personen – die<br />
älteren Menschen ein zwar noch eingeschränktes, aber doch zunehmend sich deutlich<br />
abzeichnendes aktives Marktverhalten entwickeln und insofern eine Selbststeuerung,<br />
die Bestimmung von Art, Qualität und Umfang der Leistung ausüben. Die Leistungsanbieter<br />
reagieren auf diese kundenorientierte Selbststeuerung.<br />
16
Das als Obersatz. Wenn Sie nun z. B. das Hotel verlassen, hat gegenüber, eine Investmentgesellschaft<br />
im Rahmen der Fehlsteuerung erst einmal ein Bürogebäude errichtet.<br />
Dieses war nicht vermarktbar, wie auch, denn da<strong>für</strong> hat es nie einen Bedarf gegeben –<br />
solche Häuser haben wir hier im Osten nie gewollt. Dies ist eine Fehlsteuerung sondergleichen<br />
gewesen, fehlgesteuert durch indirekte Förderung, das heisst durch Steuersubventionierungs-Allokation<br />
heisst das bei den Volkswirten, also richtige Fehlallokationen.<br />
Auch das Ministerium gegenüber, hier im Seepark, ist eine solche Fehlallokation.<br />
Deshalb ziehen wir auch in zwei Monaten aus und beziehen ein eigenes Gemäuer, das<br />
uns der Bund dankenswerter Weise geschenkt hat. Aber was macht der Investor, wenn<br />
er zweimal den Schnitt gemacht hat. Er macht daraus ein Altenpflegeheim, das auch<br />
belegt ist. Frau Ruddat, die ja hier unter uns ist, ist ja bei uns im Haus die Planerin. Das<br />
Haus kommt in ihrem Plan gar nicht vor. Aber es gibt ein Angebot und es gibt eine<br />
Nachfrage. Wir frotzeln uns immer so gegenseitig und sagen: “Wissen Sie eigentlich wie<br />
weit Ihre Planungszuständigkeit reicht? Von hier bis zur Kreuzung.“. Hier existiert offensichtlich<br />
Selbststeuerung bzw. Angebot und Nachfrage. Insofern möchte ich auch den<br />
Ball von Herrn Haupt aufnehmen, den wir natürlich sehr kritisch fragen müssen: Ist das<br />
die Qualität? Ist das der Inhalt, den wir wollen? Nun ist das Pflegeversicherungsgesetz<br />
ein Gesetz, das auch den privaten Anbieter befördert und ihn zum wesentlichen Akteur<br />
auf der Angebotsseite macht. Wir hatten damals als Länder andere Vorstellungen. Es<br />
gab jedoch eine F.D.P. in der damaligen Bundesregierung, die in diesem Bereich darauf<br />
achtet, dass das Marktprinzip stabilisiert eingebracht wird. Wir sehen die Folgen und die<br />
Qualitätsfrage müssen wir gleichwohl in Frage stellen.<br />
Selbststeuerung ist eben nicht nur eine Frage der Kundenseite, sondern auch der Anbieter.<br />
Lassen Sie mich eine Parallele zu unseren aktuellen Debatten im Lande anführen,<br />
weil sie auch schlaglichtartig beleuchtet, in welchen Spannungslagen und vielleicht<br />
auch in welchen tradierten Denkmustern wir uns befinden. (...) Gestern Abend hatten wir<br />
eine wesentliche Diskussionsrunde im Krankenhausbereich. Wir versuchen zurzeit eine<br />
mittelfristige Krankenhausplanung <strong>für</strong> das Land noch in diesem Jahr abzuschliessen,<br />
also eine Planung bis zum Jahre 2005/2006. Traditionell ist es ja nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz<br />
aus dem Jahr 1972 so, dass der Staat, in diesem Falle die<br />
Länder, eine Planung aufstellen; erst eine mittelfristige Orientierung und dann eine Jahresplanung,<br />
aus der heraus auch Rechtsfolgen <strong>für</strong> Angebot bzw. <strong>für</strong> Abrechnungen mit<br />
den Kostenträgern erwachsen. Die Annahme ist auch heute noch relativ verbreitet, dass<br />
der Staat wissen müsse, was das richtige Angebot ist. Ist diese Annahme aber eigentlich<br />
noch richtig? Müssen wir nicht längst dazu übergehen, zu fragen: Welche Leistungen<br />
werden in Zukunft im Gesundheitsbereich benötigt? Welche Menge und Qualität<br />
und auch in welcher Art werden wir diese Leistungen anbieten und wie bzw., in welchem<br />
Umfang sollen dies die einzelnen Häuser erbringen? Das heisst, dass wir bei den Leistungsanbietern<br />
ein Umdenken in die Richtung brauchen: Wo ist denn eigentlich in Zukunft<br />
unser Platz? Wo, in welcher Form und in welchem Umfang werden wir gebraucht<br />
und wie weit müssen wir uns darauf einstellen? Das Land bzw. die Länder werden nicht<br />
mehr diese starke steuernde Funktion haben, vielmehr die bestimmt zu erwartende notwendige<br />
Leistungsmenge, letztlich auch das Angebot. Im Rahmen unserer Krankenhausplanung,<br />
der mittelfristigen Krankenhausplanung, müssen wir daher unsere Häuser<br />
<strong>für</strong> die Zukunft fit machen.<br />
17
Sie müssen sich selber überprüfen, ob das, was sie bisher getan haben, im Umfang und<br />
auch in der Ausrichtung überhaupt noch in Zukunft gebraucht wird? Vielleicht müssen<br />
andere Schwerpunkte gesetzt oder ein Stück der Angebote zurückgefahren werden.<br />
Daher besteht der Konflikt eigentlich nicht zwischen den Krankenhausträgern, den<br />
Krankenhäusern und dem planenden Land, sondern darin, dass die Häuser sich selbst<br />
zukunftsfähig machen müssen, zumal wir parallel inzwischen durch die Bundesgesetzgebung<br />
auch ein anderes Abrechnungssystem in die Welt gesetzt haben. Dabei geht es<br />
genau um diese Leistungsmengen. Es sind die berühmten “DRG”, auch wenn man sie<br />
jetzt ja nicht mehr so zitieren darf, so das Bundesjustizministerium. Im Rahmen der<br />
Rechtsförmlichkeitsprüfung heisst es korrekt „Fallpauschalen-Einführungsgesetz“. Was<br />
es eigentlich nicht ist. Vielleicht besteht jedoch das Justizministerium nur aus Juristinnen<br />
und Juristen, die nur Deutsch und Latein können, so wie man es auch den alten Urkunden<br />
im Museum entnehmen kann. Mit “Diagnosis-Related-Groups” können sie eben<br />
nicht soviel anfangen. Hintergrund ist ja, dass es hier einen neuen Ansatz im Sinne von<br />
Mengen und Leistungsabrechnungen, gibt. Insofern sind wir hier tatsächlich bei der<br />
spannenden Frage: Wie müssen sich auch die Anbieter von Leistungen überprüfen? Wir<br />
müssen sie eigentlich im Sinne der Selbstreflexion, vielleicht auch im Sinne der Selbststeuerung<br />
zukunftsfähig machen“ - und wir nehmen uns als Land ein Stück weit zurück.<br />
(...)<br />
Wir hatten einen Gutachter aus Schleswig-Holstein, Professor Rüschmann, der uns das<br />
alles auf 400 Seiten aufgeschrieben hat. Darüber diskutieren wir im Lande, auch sehr<br />
sachbezogen, aber eben in die Richtung der Überprüfung der Angebotsstrukturen der<br />
Krankenhäuser selbst.<br />
Wir haben es natürlich auch zunehmend mit begrenzten, bzw. gedeckelten Budgets zu<br />
tun. Auf gedeckelte Budgets hatten wir uns damals im Mai 1995, bezüglich der überörtlichen<br />
Sozialhilfe verständigt. Dies fliesst in die Rahmenverträge nach § 93 BSHG ein.<br />
Gedeckelte Budgets haben natürlich ihre Vor- und Nachteile. So hat es positive Auswirkungen,<br />
wenn man sich selbst überprüft, ob alles so gemacht werden muss, wie bisher<br />
oder ob im Rahmen der gedeckelten Budgets auch neue Spielräume erarbeitet werden<br />
können, z. B. im Sinne einer stärkeren Umsteuerung von der stationären zur ambulanten<br />
Versorgung. Das könnte einer der positiven Effekte sein.<br />
Herr Haupt, Sie hatten das Thema angesprochen, auch durchaus mit kritischen Tönen.<br />
Ich möchte einen weiteren Aspekt anfügen. Bei unseren Versuchen einer Budgetierung<br />
im Zuwendungsbereich, sowie einer Globalsteuerung, haben wir folgendes festgestellt:<br />
auch die Verwaltung ist darauf nicht eingerichtet. Wir haben hier in Sachsen-Anhalt<br />
praktisch die niedersächsische Verwaltung, also so eine richtig gestandene, aus dem<br />
19. Jahrhundert entwickelte und geprägte Verwaltung, übernommen. Also wir haben den<br />
Haushalt klassisch aufgestellt. In der Landeshaushaltsordnung haben wir die berühmte<br />
Verwaltungsvorschrift nach § 44 LHO, die hieß über Jahrzehnte “Vorläufige Verwaltungsvorschrift”.<br />
Inzwischen ist sie sozusagen endgültig. Das ist die Form unserer Steuerung.<br />
Der Zuwendungsbescheid wird dann irgendwann im Laufe des Jahres gefertigt<br />
und dann gibt es Verwendungsnachweise, natürlich werden die ordentlich ausgewertet<br />
und zum Schluss stellt der Rechnungshof fest, da fehlen ja noch drei Belege. Das ist<br />
das Muster.<br />
18
Um aus diesem System herauszutreten und inhaltliche Ziele zu erreichen, benötigen wir<br />
eine neue Methode und die neue Methode bedeutet eben nicht klassischer, obrigkeitsstaatlicher<br />
und hoheitlicher Zuwendungsbescheid, sondern bedeutet Verhandeln, bedeutet<br />
Verabredung, bedeutet Verträge, bedeutet Zielvereinbarungen. Das machen Sie<br />
einmal mit einer Verwaltung, die es gar nicht gewöhnt ist, etwas wie ein Zielsystem zu<br />
entwickeln und sich zu fragen, was wollen wir eigentlich, wohin wollen wir, wenn wir diese<br />
oder jene Einrichtung einem Budget versorgen und eben ein entsprechendes Ergebnis<br />
herauskommt. Umgekehrt muss sich auch der Empfänger natürlich anders orientieren.<br />
Er geht ein gewisses Risiko ein, aber er hat natürlich auch Chancen. Diese Chancen<br />
selbst einmal zu erschließen, das ist ein Prozess, der auch nicht sofort mit jedem zu<br />
machen ist. Vielmehr muss dies zunächst mit ausgewählten Bereichen erfolgen. Wir<br />
sind auf dem Weg, aber noch nicht am Ende. Es ist auch schwierig, z. B. im Bereich der<br />
Gesundheitsförderung, nicht nur die Ziele zu definieren, sondern die Messung zu<br />
bestimmen. Es geht nicht mehr nur darum zu belegen, dass 600.000 oder 700.000 Mark<br />
ausgegeben sind. Entscheidend ist vielmehr, ob sich der Gesundheitszustand, das Gesundheitsbewusstsein,<br />
die Einsicht, verändert hat, ob in diesem Lande dennoch Raucher<br />
oder Trinker sind oder es Leute gibt, die zum Zahnarzt müssen? Beim Landessportbund,<br />
da frage ich immer die Abteilung: Wie ist der Medaillenspiegel? Das ist z. B.<br />
ein Messindikator. Wir akzeptieren auch 4. Plätze, z. B. unser Speerwerfer Raimund<br />
Hecht, wird seit 10 Jahren immer Vierter. Wie messe ich Erfolg? Wie messe ich Ergebnisse<br />
im Rahmen der Zielvereinbarungen?<br />
Wir müssen auf diesem Weg weitergehen und wir haben, denke ich, einen z. B. sehr<br />
guten Ansatz im Bereich der Jugendpolitik. Das ist die Jugendpauschale. Wir haben in<br />
ganz knappen Worten, im Rahmen eines Erlasses die inhaltliche Zielsetzung aufgeschrieben.<br />
Die Kreise, als örtliche Träger der Jugendhilfe, bekommen eine Zuweisung<br />
nach einem Schlüssel, der sich schlicht und ergreifend an der Zahl der Kinder und Jugendlichen<br />
in diesem Kreis orientiert, ein bisschen veredelt nach Verdichtungsraum und<br />
ländlichem Raum.<br />
Sie müssen die entsprechende Pauschale, in diesem Sektor einsetzen, müssen mindestens<br />
50 % Geld dazu legen und können dann selber agieren. Wir hatten am letzten<br />
Sonnabend Kinder- und Jugendtag, es kamen viele kleine Verbände und Vereine, die<br />
beklagten, sie würden diskriminiert, und das eigentliche Ziel der Jugendpauschale, nämlich<br />
einen bestimmten Sektor oder ein bestimmtes Spektrum auszustatten wird nicht erreicht.<br />
Da seien die etablierten Wohlfahrtsverbände und das kommunale Jugendamt, die<br />
vorrangig die Jugendhäuser förderten, wo sich ohnehin nur noch die Rechten träfen. Sie<br />
sehen also selbst, wenn Sie diesen neuen Weg gehen, haben Sie eine ganze Fülle von<br />
Anschlussproblemen.<br />
Als ein weiteres Beispiel möchte ich den Bereich der Enthospitalisierung anführen, denn<br />
hier kann man die Problematik im Zeitrafferstil ablesen. Das Thema finden Sie bereits in<br />
einer großen Psychiatrie-Enquete der 70er Jahre in Westdeutschland. Westdeutschland<br />
hat dann vier Jahrzehnte gebraucht, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen<br />
und auf den richtigen Weg zu bringen. Die ostdeutschen Länder mussten das in relativ<br />
kurzer Zeit bewältigen.<br />
19
Dahinter steht der Integrationsgedanke aus der Behindertenpädagogik, also die Normalisierung<br />
der Lebensbedingungen auch schwer und schwerstbehinderter Menschen.<br />
Man war zu der Auffassung gelangt, dass die individuellen Fähigkeiten zu entwickeln<br />
seien und der Persönlichkeit in stärkerem Maße Rechnung getragen werden müsse.<br />
Genauso wie in Westdeutschland hatten wir Grosseinrichtungen. Wir haben hier im<br />
Lande Sachsen-Anhalt seit 1994/95 mit einem Landesprogramm Enthospitalisierung,<br />
intensive Anstrengungen unternommen eine Verbesserung der Lebensbedingungen der<br />
Heimbewohner in diesen sogenannten psychiatrischen Großeinrichtungen zu verbessern.<br />
Sofort zeigten sich auch schon die Probleme. Eine derartige Herausentwicklung<br />
der hospitalisierten Personen, die teilweise 20 bis 30 Jahre dort wohnten, musste behutsam<br />
unter Berücksichtigung sowohl der entstandenen Bedürfnisse der Betroffenen, als<br />
auch der Größen- und Organisationsstruktur der Träger erfolgen. Ich möchte das ganz<br />
deutlich sagen: Wenn Sie dort mit einem modellhaften oder einem idealistischen Ansatz<br />
kommen, treffen Sie auf die Realsituation. Die Menschen haben dort ihre Heimat, es gibt<br />
Verbünde zwischen den betroffenen Personen, aber auch zwischen den Betreuerinnen<br />
und Betreuern, Pflegepersonal und der betroffenen Personen. Wir müssen daher bei<br />
den gewachsenen Strukturen der Betroffenen selbst ansetzen, aber wir müssen auch<br />
den Trägern sowie dem Personal eine Perspektive geben. Sie können eben nicht von<br />
heute auf morgen eine Großeinrichtung halbieren, sei es in der Kapazität oder bezüglich<br />
des Personals.<br />
Wir haben jedoch - und darauf sind wir, denke ich, mit Recht auch stolz - in der ersten<br />
Phase viel erreicht. Wir haben die Kapazitäten in den Großeinrichtungen maßgeblich<br />
abgebaut und haben die Einrichtungen, so gut es ging, auch inhaltlich profiliert. In der<br />
Ausgangslage hatte man nicht zwischen seelisch, geistig, mehrfach und sonstig behinderten<br />
Menschen differenziert. Die Einrichtungen haben im Rahmen einer Landesplanung<br />
ihr jeweiliges Profil erhalten, um besser eine individuelle Betreuung und Entwicklung<br />
der dort lebenden Menschen zu gewährleisten. In einem Werkstattgespräch zur<br />
Enthospitalisierung im vergangenen Winter hier in diesem Hause, wurde daher diskutiert,<br />
dass nach Schaffung entsprechender Räumlichkeit und baulicher Voraussetzung<br />
nunmehr die Schaffung effizienter und dauerhafter Koordinierungsmechanismen erforderlich<br />
ist, um die inhaltliche Aufgabe der Enthospitalisierung, d. h. die Ermöglichung<br />
eines selbstbestimmten und aktiven Lebens den Menschen mit Behinderung, zu gewährleisten<br />
Dieser Ansatz der Enthospitalisierung ist auch in unserem Rahmenvertrag<br />
nach § 93 BSHG eingeflossen. Der Rahmenvertrag ist im letzten Jahr abgeschlossen<br />
worden, immerhin ein sehr, auch konzeptionell beachtliches Werk von 80 Seiten. Dies<br />
haben wir gemeinsam mit den Anbietern zu Stande gebracht. Wenn Sachsen-Anhalt<br />
häufig als Schlusslicht bezeichnet wird, im Bereich Arbeitsmarkt ist das auch zutreffend,<br />
wenn allein die Statistik und nicht die Realität betrachtet wird, denn wir haben dieselbe<br />
Erwerbstätigenquote wie Rheinland-Pfalz, nur sind hier wesentlich mehr Menschen im<br />
erwerbsfähigen Alter und wollen auch einer bezahlten Arbeit nachgehen, so sind wir im<br />
Bereich der Enthospitalisierung sehr weit vorn. Wir haben es in relativ kurzer Zeit, d. h.<br />
in fünf bis sechs Jahren erreicht, einen konzeptionellen Ansatz nicht nur zu entwickeln,<br />
sondern auch schon in weiten Teilen zu verwirklichen.<br />
20
Ich will auch keine endgültigen Ergebnisse präsentieren, sondern nur ein Schlaglicht auf<br />
das Thema des Kongresses werfen und darauf hinweisen, wo wir konkrete Ansätze<br />
nicht nur sehen, sondern auch praktizieren.<br />
In allen Bereichen gibt es Klärungsbedarf, gibt es Bedarf der konzeptionellen Weiterentwicklung.<br />
Insofern bin ich Herrn <strong>Schröder</strong>, bzw. Ihrer Gruppe ISB, sehr dankbar, dass<br />
Sie hartnäckig am Thema bleiben. Wir sind gerne bereit, die Arbeit in dieser Form oder<br />
in anderer Form hier in Magdeburg, einem guten Ort <strong>für</strong> die Sozialpolitik, fortzusetzen.<br />
Das kann ich nur nachhaltig unterstreichen.<br />
Ich hoffe wir treffen uns noch häufiger hier. Schönen Dank.<br />
21
4. Der aktivierende Staat - wer steuert wen?<br />
- Prof. <strong>Dr</strong>. Bernhard Blanke<br />
Prof. <strong>Dr</strong>. Bernhard Blanke, Universität Hannover<br />
Meine Damen und Herren!<br />
Mein Thema „Der aktivierende Staat – wer steuert wen?“, formuliert eine Frage, die mir<br />
Herr <strong>Schröder</strong> gestellt und die mir großes Kopfzerbrechen bereitet hat, weil die Formel<br />
„Der aktivierende Staat“ oder auch die Konzeption in der Tat noch lange nicht so ausgearbeitet<br />
ist, dass ich Antworten auf all die Fragen geben könnte, die z.B. heute morgen<br />
die beiden Staatssekretäre aufgeworfen haben. Deshalb möchte ich versuchen, erst<br />
einmal eine Grundkonzeption des „Aktivierenden Staates“ zu skizzieren.<br />
Zunächst eine provokante, vor allem durch persönliche Erfahrungen als „Staatsdiener“<br />
und professionelle Lehren aus Beratungstätigkeiten begründete Feststellung: Der Staat<br />
in seinen Institutionen und Akteurskonstellationen, vor allen Dingen mit seinem Personal,<br />
ist weit davon entfernt, eine Idee der „Aktivierung“ überhaupt zu verstehen. Das hat<br />
auch eine repräsentative Mitarbeiterbefragung in Niedersachsen ergeben, die wir 1999<br />
durchgeführt haben. Wir leben noch immer in der Welt, die Max Weber sehr schön in<br />
seinem Bürokratiemodell beschrieben hat, in welchem die Staatlichkeit, das Staatliche,<br />
gruppiert ist um den Hoheitsgedanken und die Bürokratie, gruppiert um Dienstwege und<br />
Regelsteuerung, um interne Kontrollen – also quasi immer nur um Selbstkontrolle, eine<br />
Art von Selbststeuerung der Bürokratie, die wir eigentlich nicht wollen. Der Prozess, sich<br />
aus dem bürokratischen Modell zu einem mehr dienstleistenden oder auch mehr manageriellen<br />
Modell fortzubewegen, dauert bestimmt noch 20 bis 30 Jahre. Ich werde den<br />
Endpunkt nicht mehr erleben, an dem ich sagen könnte, jetzt ist der Staat endlich so<br />
„modern“, wie wir aktiven Bürger ihn gerne haben wollen. Ich denke, diese Tradition von<br />
hoheitlicher Staatlichkeit lastet auch im Sozialsystem, in der ganzen Sozialverwaltung<br />
und vor allen Dingen in den Interaktionen zwischen denen, die direkt im sozialen Bereich<br />
tätig sind, Dienstleistungen erbringen, und den anderen, die kontrollieren, finanzieren<br />
und eigentlich weitgehend beengen. Wer etwas bewegen will, muss also überlegen,<br />
wie man in diesem existierenden Institutionensystem überhaupt zur Frage nach der Wirkungsorientierung<br />
gelangen kann.<br />
Das Hauptproblem, das in den vorangegangenen Referaten immer wieder formuliert<br />
wurde, ist, dass wir mittlerweile über eine Menge von eingeführten Instrumenten verfügen,<br />
die alle etwas mit neuer Steuerung, Wirkungsorientierung und Modernisierung zu<br />
tun haben. Nur ist das Institutionensystem an sich nicht das Thema der Modernisierung.<br />
Mein Ansatz, den ich mit anderen teile, ist derjenige, dass ohne Reform der Institutionen<br />
alle Instrumente schief laufen, oder aber kontraproduktive Wirkung zeitigen. Sie können<br />
erst gar nicht ihre Wirkung entfalten, die man ihnen zuschreibt. In einem hochkorporatistischen<br />
Verbändesystem sind die großen Verbände z. B. alle sehr stark daran<br />
orientiert, den Staat nachzuahmen, zu imitieren. Wenn ich das sage, ist es nicht bösartig<br />
gemeint, sondern dies lässt sich aus systemtheoretischer Sicht als Ko-Evolution be-<br />
22
zeichnen und hat sich in den letzten ca. 80 Jahren über Finanzierungs- und Regulierungsstrukturen<br />
eben so entwickelt.<br />
Wenn Sie in ein solches System beispielsweise plötzlich „Wettbewerb“ einführen, kann<br />
dieser nicht funktionieren, d.h., der Wettbewerb erzeugt das nicht, was man eigentlich<br />
wollte und will. Diese Verbindung, hierauf lege ich großen Wert, zwischen Institutionen<br />
und Instrumenten, muss wirklich sehr genau beachtet werden. Das heißt: Mein Ansatz<br />
bei der „Aktivierung“ ist eigentlich Institutionenpolitik. Und insoweit möchte ich erst einmal<br />
denken, wirklich denken, noch nicht so weit planen und handeln. Denken, wie ich an<br />
das Institutionensystem herankomme, mit welchen Kategorien, mit welchen Maßstäben<br />
und Erwartungen, um all das zu erreichen, was wir wollen. Das bedeutet - ich berufe<br />
mich hier ein bisschen auf André Heller, der sagte, die wahren Abenteuer seien im Kopf<br />
- wir müssen erst einmal im Kopf vieles ausräumen und umdenken, bevor wir tatsächlich<br />
etwas „machen“ können. An diesem Punkt höre ich häufig den Vorwurf, das sei a) zu<br />
abstrakt und b) zu idealistisch. Aber diese beiden Vorwürfe nehme ich gerne an, eben<br />
im Sinne von Heller: Wenn im Kopf keine Abenteuer stattfinden, dann kann man auch<br />
auf der instrumentellen Ebene nicht viel erreichen.<br />
Zum aktivierenden Staat selbst, zum Begriff der „Aktivierung“: Es gibt mehrere Versionen,<br />
die sich zum Teil widersprechen und sogar gegeneinander stehen. Eine berühmt<br />
gewordene Version ist diejenige, die Bodo Hombach im Jahr 1998 in die Welt gesetzt<br />
hat. Sie erinnern sich an die komische Formel „von der Hängematte zum Trampolin“.<br />
Hombach u.a. bezogen sich damals im Kontext einer zum Teil falschen Orientierung an<br />
Großbritannien auf die Aktivierung einzelner Personen, die aus irgendwelchen Gründen<br />
auch immer -wie es dort hieß- abhängig vom Wohlfahrtsstaat geworden seien und deshalb<br />
zu aktivieren wären. Diese Linie setzt sich im Grunde bis heute im populistischen<br />
Zweig der Sozialhilfedebatte „Arbeit statt Sozialhilfe“ fort.<br />
Der Kernpunkt einer solchen Idee ist eine radikale Trennung: hier ist der Staat oder ein<br />
Institutionensystem und am Ende dieses Institutionensystems gibt es eine Interaktion<br />
zwischen einer Instanz im staatlichen, öffentlichen Bereich und einer Person. Das Institutionensystem<br />
insgesamt will nun diese Person oder Personengruppe „aktivieren“. Wir<br />
sehen einen sehr einseitigen Ansatz von Aktivierung, der auch in England so nicht praktiziert<br />
wird, aber ich glaube, dass das genau ein Reflex des Problems war oder ist, dass<br />
bei uns Staatlichkeit immer nur so gedacht wird, der Staat solle andere aktivieren. Dann<br />
lautet meine erste Frage: Wie aktiviert der Staat eigentlich sich selbst? Nur „schlank“<br />
und „fit“ sein reicht nicht aus. Wie kann ein weitverzweigtes Institutionensystem, welches<br />
weitgehend in der bürokratischen Tradition denkt und handelt, überhaupt Personen aktivieren?<br />
Wenn die Institution sich selbst nicht (ver)ändert, kommt nie Aktivierung heraus,<br />
sondern immer nur Zwang. In diesem Konnex der Debatte über die Sozialhilfe, konzentriert<br />
natürlich auf HLU-Empfänger, die arbeitsfähig sind etc., musste der Deutsche Städtetag<br />
erst mühsam der „hohen“ deutschen Politik beibringen, dass es sich ja nur um maximal<br />
400.000 Personen handelt, von denen sich schon viele in Maßnahmen befinden.<br />
Mit der Metapher vom „Trampolin“ laufen Aktivierung oder der Aktivierungsbegriff falsch.<br />
Das strahlt auch in andere Sozialbereiche aus, indem immer dieses Verhältnis suggeriert<br />
wird: die Institution und der Einzelne oder die Einzelperson. Das halte ich <strong>für</strong> falsch<br />
oder nur <strong>für</strong> ein ganz kleines Stückchen der Wahrheit.<br />
23
Es gibt eine andere Tradition des Aktivierungsbegriffes, die sehr stark aus dem Kommunitarismus<br />
stammt, also aus Amerika, zum Teil aus Großbritannien. In dieser Tradition<br />
geht es darum, die Gemeinschaft oder die Gesellschaft zu aktivieren. Das ist etwas anderes<br />
als der auf die Einzelperson bezogene Aktivierungsansatz. Stichwort Soziales<br />
Kapital: Eine insofern ganz interessante Debatte, da sie kleine und große Gemeinschaften<br />
anvisiert und sehr stark auf die örtliche Ebene zielt. Das lässt sich zum Teil aufgreifen,<br />
auch mit unserem bzw. mit meinem Konzept. Es reicht aber auch noch nicht aus.<br />
Denn es besteht die Gefahr einer „schleichenden Privatisierung“. Wenn wir uns die Stiftungen,<br />
Institutionen und auch Vereine ansehen, die vor allem dieses Konzept propagieren,<br />
dann entdecken wir letztlich das Konzept einer schleichenden Privatisierung oder<br />
einer Staatsentlastung. Es kann ja positiv sein, den Staat aus vielen Gründen entlasten<br />
zu wollen, die zum Teil heute morgen schon genannt worden sind: Finanzierungs-,<br />
Steuerungs- und Wissensprobleme. Der Staat oder das öffentliche System können vieles<br />
gar nicht mehr leisten und nicht wirklich „orientiert“ steuern. Es mag ja sein, das dies<br />
nur die Gemeinschaften könnten, wo Reziprozität jedenfalls zwischen den an der Gemeinschaft<br />
Teilhabenden herrscht. Stichwort „partnership“: Man kennt sich. Man hat geteilte<br />
Gerechtigkeitsnormen. Der Austausch muss hier nicht über lange Umwege der<br />
Bürokratie, sondern kann vor Ort erfolgen. Diese Gedanken sind nicht einfach von der<br />
Hand zu weisen. Sie gehen aber eben im Blickwinkel der politischen Steuerung meines<br />
Erachtens zu sehr auf Staatsentlastung aus und übersehen das Problem des Solidarausgleichs<br />
auf größerer Ebene. In der deutschen Diskussion werden kommunitaristische<br />
Ideen neuerdings in einer dritten Version mit einer Reform des Subsidiaritätsprinzips<br />
verbunden. Hier kommt mir der Aspekt der Reform des Institutionensystems viel zu kurz.<br />
Deshalb eine vierte Perspektive, die ich zusammen mit anderen seit einigen Jahren verfolge.<br />
Das Konzept ist keineswegs fertig ausgebaut, sondern es geht um einen Prozess,<br />
den wir versuchen mit dem Ziel weiterzuentwickeln, eine aktivierende Steuerung zu<br />
konzipieren, d.h. den Staat und die öffentlichen Instanzen eben nicht aus ihrer Verantwortung<br />
zu entlassen, sondern in guter alter sozial-demokratischer, jetzt also nicht parteiorientiert,<br />
sondern in sozialer und demokratischer Tradition, den öffentlichen Bereich<br />
in der Pflicht zu behalten. In den letzten 100 Jahren hat der Sozialstaat so viele Aufgaben<br />
aufgebaut, die nicht einfach „an die Gesellschaft“ zurückzugeben sind. Wir müssen<br />
also den bestehenden Aufgabenbestand durchforsten und überlegen, wie wir ihn neu<br />
strukturieren. Dieser Ansatz kommt aus dem Bereich der Verwaltungsreform, Staatsmodernisierung<br />
und Aufgabenkritik.<br />
Wenn Sie sich mit Staatsmodernisierung beschäftigt haben, wissen Sie, dass das<br />
Hauptwort in den 90er Jahren der „Schlanke Staat“ war. Herr <strong>Schröder</strong> hat heute morgen<br />
schon gesagt: „Schlanker, aktivierender Staat“. Das kann man aber natürlich nicht<br />
zusammenziehen, denn es sind zwei ganz verschiedene Modelle. Der „Schlanke Staat“<br />
war die Konzeption der „Scholz-Kommission“ und bildete sozusagen den Ausgangspunkt,<br />
an dem ich mit ein paar Leuten in der Niedersächsischen Staatskanzlei überlegt<br />
habe, dass es das doch nicht sein kann. Müssen wir nicht einen Gegenbegriff entwickeln,<br />
um die schleichende Privatisierung, die bloße Staatsentlastung und die Delegation<br />
von Aufgaben an die Bürger, die darauf gar nicht vorbereitet sind, zu vermeiden?<br />
Dies waren nämlich die Kurzkonzepte des „Schlanken Staates“, bei denen die Frage der<br />
24
Staatsaufgaben eine große Rolle spielte. Es hat sich relativ leicht und schnell herumgesprochen,<br />
dass Aufgabenkritik nötig sei. Wenn Sie die gesamte Entwicklung der<br />
Staatsmodernisierung und Verwaltungsreform in den letzten fünf oder zehn Jahren betrachten,<br />
ist allerdings Aufgabenkritik praktisch unmöglich, wenn der Ansatz des<br />
„Schlanken Staates“ verfolgt wird, dass nämlich der öffentliche Bereich im weitesten<br />
Sinne und der staatliche Bereich im engeren Sinne selbst daran gehen, die Aufgaben<br />
neu zu definieren.<br />
Das kann nicht funktionieren. Es gibt ein paar Beispiele in Landesverwaltungen, wo Aufgabenkritik<br />
darin bestand, zehn Prozent der bestehenden kleinen Leistungen und Aufgaben<br />
abzuschaffen oder zu bündeln. Viele einzelne kleine Dinge waren sozusagen per<br />
se nicht mehr einsichtig und summierten sich schon zu beachtlichen Geldmengen, die<br />
die Verwaltung aus sich selbst heraus einsparen konnte. Die Hamburger Verwaltungsreformer<br />
berichteten einmal stolz, eine Milliarde DM eingespart zu haben, und kein<br />
Mensch hätte es bemerkt. Das bedeutet also: eine Milliarde DM wurde bisher ohne jede<br />
Wirkungsorientierung ausgegeben, weil es ja ohnehin keiner gemerkt hat. Soweit geht<br />
also die administrative Aufgabenkritik.<br />
Wenn es dann aber weiter darum geht, den Staat wirklich umzubauen, zu modernisieren<br />
und Aufgaben neu zu definieren, dann ist dies ist eine Frage der Aushandlung mit den<br />
Bürgern, eine Frage der Demokratie; denn alle Staatsaufgaben sind im demokratischen<br />
Prozess entstanden. Erste Aufgabe des aktivierenden Staates wäre eine wirkliche Demokratiereform.<br />
Ich gehe jetzt ganz hoch in die Institutionen und sage: wenn wir das<br />
alles wollen, was heute morgen besprochen worden ist, und die wahren Abenteuer im<br />
Kopf liegen, dann müssen wir es auch wagen, an die Feinheit der Demokratiereform zu<br />
gehen, und aus diesem Kontext ist mein oder unser Konzept „Aktivierender Staat“ entstanden.<br />
Ich halte es <strong>für</strong> sehr wichtig, diese Vorgeschichte zu beleuchten, weil uns häufig<br />
vorgeworfen wird, wir seien nur „Betriebswirte“, und Aktivierung ginge instrumentell<br />
und generell in Richtung Staatsentlastung. Genau das wollen wir aber nicht, sondern<br />
eine ganz andere Art von Staatlichkeit.<br />
In Niedersachsen wurde von uns deshalb eine Bürgerbefragung mit folgenden Fragen<br />
durchgeführt: Was soll der Staat unbedingt leisten? Was meint der Bürger? Was könnte<br />
er eventuell selber machen? Wir haben Alternativen aufgestellt: Finanzkürzung oder<br />
Beibehaltung von Aufgaben? Könnte der Bürger etwas selbst beitragen? Wie groß ist<br />
eigentlich die Bereitschaft der Bürger, repräsentativ betrachtet, Aufgaben zu übernehmen,<br />
was ja die Kommission „Schlanker Staat“ wollte? Alle unwichtigen Nichtkernaufgaben<br />
des Staates sollten an die Gesellschaft zurückgegeben werden. Keiner hat die Gesellschaft<br />
jedoch gefragt, ob sie die Aufgaben wiederhaben will. Wie soll das denn auch<br />
gehen?<br />
Wir haben die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Dabei stellte sich unter dem Stichwort<br />
„Demokratiereform“ eine interessante Konstellation heraus: Die Bürger - wir haben sehr<br />
genau nach sozialstrukturellen Merkmalen untersucht - bei den Ergebnissen zu dieser<br />
Frage gab es überhaupt keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, den Einkommens-<br />
und Bildungsgruppen - sind bereit, Aufgaben neu mitzugestalten, das heißt<br />
auch, Verantwortung zum Teil selber zu übernehmen, wenn „da oben“, im Staat, ein<br />
besseres Management geleistet würde. Die Bürger sagen: Wir nehmen nur dann Aufga-<br />
25
en wieder zurück und übernehmen nur dann wieder mehr Verantwortung <strong>für</strong> öffentliche<br />
und soziale Aufgaben, wenn wir wissen, dass der Staat, der öffentliche Bereich mit unserem<br />
Geld auch ordentlich umgeht. Dann sind wir auch bereit, potenziell auf Leistungen<br />
zu verzichten. Diese Kombination von Bürgerengagement und Staatsmodernisierung<br />
im Sinne der Modernisierung des Managements empfinde ich als eine hochgradig<br />
interessante Konstellation, die ich nun auch weiter in Bezug auf den Aktivierungsansatz<br />
verfolge.<br />
(Die Ergebnisse der hier genannten Befragungen sind nachzulesen unter:<br />
www.aktivierender-staat.de)<br />
Erster Punkt: Staatsmodernisierung im Sozialbereich ist nur dann sinnvoll, wenn man<br />
sich die Veränderung im Sozialstaat in den letzten Jahren selbst ansieht. Meine These<br />
ist, dass sich der Sozialstaat immer mehr zum sozialen Dienstleistungsstaat entwickelt.<br />
Dies ist nicht so sonderlich neu. Aber den Trend muss man sehr genau betrachten, er<br />
lässt sich quantitativ nachrechnen. In den öffentlichen Haushalten nehmen die Ausgaben<br />
der sozialen Dienstleistungen proportional ständig zu. Fragt man die Bürger: Was<br />
verstehen Sie unter Sozialstaat? Dann ist es die Versicherung, soziale Sicherheit durch<br />
(Sozial-)Versicherung. Den meisten ist gar nicht klar, dass eine Vielzahl von Dienstleistungsaufgaben,<br />
sei es über Transfers finanziert, wie im Gesundheitswesen, sei es über<br />
direkte Dienstleistung, mittlerweile mehr und mehr das Gewicht dieses Sozialstaats<br />
ausmachen. Es ergibt sich also eine ganz interessante Verbindung zwischen sozialem<br />
Dienstleistungsstaat, neuem Management und dem Bürger.<br />
Herr Haupt sagte heute morgen, dass wir eine neue Steuerung im Sozialbereich benötigen.<br />
Meine Steuerungskonzeption baut sich nun in der Tat auf diesen drei<br />
Elementen auf, die ich kurz zitiert habe:<br />
a) Dienstleistungssektor - unser Sozialstaat als sozialer Dienstleistungsstaat.<br />
b) „Better Management“ - besseres Management im öffentlichen Bereich.<br />
c) Bürgerengagement.<br />
Diese drei Pfeiler helfen ganz gut weiter, wenn man sich modellartig klarzumachen versucht,<br />
was Aktivierung oder aktivierender Staat bedeuten kann.<br />
Zweiter Punkt: Ich will ganz kurz gewissermaßen die Steuerungsgrammatik des aktivierenden<br />
Staates entwickeln. Es sind mehr Postulate als empirische Belege und sie beziehen<br />
sich zum Teil auf die internationale Literatur. Wir finden im internationalen Bereich<br />
eine sehr ausgefeilte Diskussion über „Governance“. Das bedeutet, den Weg von<br />
der instrumentellen Steuerungsfrage zur „Regierungsfrage“ zu gehen. Die Autoren sehen<br />
sich den „öffentlichen Sektor“ nicht mehr im Max Weberschen Sinne von oben an<br />
(Staat, Verwaltungshandeln, physische Gewaltsamkeit, Hoheitlichkeit), sondern betrachten<br />
den realen Staat, den realen öffentlichen Sektor und seine Strukturen. Ich erinnere<br />
ganz kurz auch an deutsche Autoren wie Renate Mayntz, Fritz Scharpf und andere.<br />
Demnach ist Steuerung nur noch interaktiv und kooperativ zu denken. Das heißt: Weg<br />
von der Hierarchie hin zur Kooperation, hin zur Netzwerksteuerung.<br />
26
Wie aber funktionieren solche Netzwerke und kooperative Strukturentatsächlich, wie es<br />
Franz Xaver Kaufmann einmal formuliert hat: Solidarisch steuern?<br />
Die Realität einer irgendwie gearteten solidarischen Steuerung ist schon lange zu beobachten.<br />
Im Sozialbereich, vor allem im sozialen Dienstleistungsstaat existieren nicht<br />
einseitig Markt oder Staat. Diese Trennung gibt es seit 100 Jahren <strong>für</strong> Deutschland nicht<br />
mehr. Der deutsche Sozialstaat hat schon immer ein kompliziertes System aus Freier<br />
Wohlfahrt, Gewerkschaften, Kassen- und Ärzteverbänden, ein „Gewusel“ der Interaktion<br />
zwischen gesellschaftlichen Organisationen, hoheitlichem Bereich und Bürokratien aufgebaut.<br />
Und darin genau liegt das Problem unseres Sozialbereiches. Die Institutionen<br />
sind das Entscheidende. Wenn wir Wirkungsorientierung erreichen wollen, dann müssen<br />
wir die Institutionen und ihre Interaktionen so konstellieren, dass dieses Konzept überhaupt<br />
erst möglich wird. Deshalb gehe ich von einem gestuften Steuerungsprozess aus:<br />
<strong>Dr</strong>itter Punkt: In vier Stufen versuche ich jetzt im Sinne von Postulaten neue Denkweisen<br />
oder vier neue Prinzipien in unser bestehendes Institutionensystem einzuführen.<br />
Meine These lautete zunächst, sich an das Institutionensystem heranzuwagen, da wir<br />
sonst nicht aktivieren und auch keine Wirkung erzeugen können. Die folgende These<br />
lautet: Wir brauchen gar keine große Umwälzung unseres Institutionensystems, weil ein<br />
solches Vorhaben gerade in Deutschland gar nicht möglich ist. Im internationalen Vergleich<br />
ist es zwar in verschiedenen Ländern in den letzten zehn Jahren im Prozess der<br />
Staatsmodernisierung oder der Verwaltungsreformen im engeren Sinne zum Teil zu<br />
sehr radikalen Umbrüchen im institutionellen Bereich gekommen. Lange Zeit wurden<br />
von meinem leider verstorbenen Freund Frieder Naschold Beispiele aus den institutionell<br />
radikal modernisierten Ländern angeführt: Beispiel Neuseeland: Totales Contracting,<br />
Dezentralisierung, Quasimärkte noch und nöcher. Liest man nun nach zehn Jahren<br />
die neuesten Berichte über Neuseeland, ist ein erhebliches Maß an Enttäuschung feststellbar.<br />
Es war die schöne Zeit der Betriebswirte und der Unternehmensberatungen.<br />
Dies gilt <strong>für</strong> viele Länder, sozusagen <strong>für</strong> die „Hardliner“. Das Experiment ist insbesondere<br />
im sozialen Bereich aus vielen Gründen weitgehend schief gelaufen. Der Hauptgrund<br />
ist einfach: Die Art des manageriellen, rein betriebswirtschaftlichen Denkens hat systematisch<br />
sämtliche Vertrauensgrundlagen untergraben, auf welche die soziale Steuerung<br />
angewiesen ist. Ich bin richtig erfreut darüber, dass auch die englischsprachige Literatur<br />
nun wieder den Begriff „Trust“ entdeckt; Vertrauensbildung und Solidarität als notwendigen<br />
„Zuschlag“ zu dieser hochgradigen „Verbetriebswirtschaftlichung“ der sozialen Bereiche.<br />
Wir müssen uns diese Erfahrungen einfach genau ansehen, um nicht selber, weil<br />
zu spät gekommen, die Fehler anderer zu wiederholen.<br />
In unserem Institutionensystem verfügen wir über „soziales Kapital“ und Vertrauensbeziehungen.<br />
Alle, die in diese Vertrauensbeziehung eingebunden sind, müssen nun die<br />
Aufgabe der Modernisierung richtig ernst nehmen. Hierbei kommt man um mehrere Dinge<br />
nicht herum: Die Rollen in diesem System müssen neu definiert werden, wobei auch<br />
an zum Teil alte Traditionen angeknüpft werden kann. Aber wenn wir die Rollen nicht<br />
neu definieren, werden wir im Sinne der Wirkungsorientierung das System nicht effizienter<br />
und effektiver gestalten. Auch im sozialpolitischen Bereich dürfen wir den Effizienzgedanken<br />
nicht tabuisieren oder verteufeln. Wir müssen ihn vielmehr im Rahmen von<br />
Vertrauensbeziehungen aufnehmen. Wir finden eine paradoxe Entwicklung vor: Effizienz<br />
27
in den öffentlichen Bereichen, die solidarisch gesteuert sind, ist erst dann thematisierbar,<br />
wenn die Partner, die bisher gemeinsam steuern, in wechselseitigem Vertrauen darin<br />
übereinstimmen, dass die Effizienzfrage eine entscheidende Frage ist. Eine isolierte<br />
Herangehensweise führt aus unserer Sicht zum Scheitern wie in Neuseeland oder in<br />
den USA.<br />
Wir benötigen eine neue Rollendefinition in alten Institutionen. In der Bundesrepublik<br />
Deutschland werden wir nie eine komplette Institutionenreform beschert bekommen. Die<br />
sozialwissenschaftliche Forschung liefert hier gute Erkenntnisse. Stichwort: Pfadabhängigkeit.<br />
Die Institutionen entwickeln in einem relativ langen Zeitrahmen Handlungskorridore<br />
immer so um die berühmten fünf Grad herum, die der „Tanker“ gerade noch<br />
schafft, um sich auf Dauer zu verändern. Wenn wir Teile von Institutionen verändern<br />
wollen, z.B. bestimmte blockierende Teilinstitutionen, brauchen wir sowohl neue Rollendefinitionen<br />
als auch kooperatives Handeln. Stichwort: Gesundheitswesen, das zu meinem<br />
Hobbybereich geworden ist. Seit 15 Jahren denke nicht nur ich darüber nach, wie<br />
man die Kassenärztliche Vereinigung als Relikt der Notstandsgesetzgebung der Weimarer<br />
Republik abschaffen kann.<br />
Jetzt sehe ich, dass sich der Gedanke verbreitet. Das stimmt mich sehr hoffnungsfroh.<br />
Ich möchte die etwas paradoxe These aufstellen, dass die Abschaffung der KV im Sinne<br />
der Wirkungsorientierung vom Patienten nicht bemerkt würde. Die Ärzte und die Kassen<br />
würden es allerdings merken. In einem so eingespielten korporatistischen System aus<br />
KV und Kassen müsste dann natürlich auch bei der Gegenseite etwas geändert werden.<br />
Denn ein Wettbewerb mit alten bürokratischen Krankenkassen wäre eine Farce. Viele<br />
Ärzte wären begeistert, insbesondere die Jüngeren. Sie wollen die Zwangsmitgliedschaft<br />
und diese Undurchsichtigkeit der Abrechnungen nicht mehr. Das System schafft<br />
einen unnötigen Overhead und wenig „Gerechtigkeit“. Im Sinne der Effizienz gehen zudem<br />
Ressourcen verloren, von denen nie ein Pfennig beim Endverbraucher, dem Patienten,<br />
ankommt, sondern die sich in reiner Verwaltung und Konfliktbewältigung selbst<br />
auflösen. Dies ist ein Punkt, an dem man im Rahmen eines gesamt-institutionellen Systems<br />
beispielhaft Teilinstitutionen abschaffen kann und abschaffen muss, um Wirkungsorientierung<br />
in dem Sinne zu erzeugen, dass man Leistung aktiviert, beschleunigt und<br />
Ressourcen spart, ganz so wie es die Engländer immer schön ausdrücken: Money follows<br />
the patients. Die gesamten Ressourcen müssen soweit wie möglich dezentral verwendet<br />
werden.<br />
Die Gesundheitspolitik spricht hier immer von „Wirtschaftlichkeitsreserven“. Ich lese aber<br />
nirgendwo etwas von der Institution. Ich kann doch keine Wirtschaftlichkeitsreserven im<br />
Gesundheitsbereich nutzen, wenn ich die Institutionen an bestimmten Punkten nicht ändere,<br />
so lautet hier mein Credo.<br />
Also neue Rollendefinition plus partielle institutionelle Veränderung. Und dann<br />
Verantwortungsklärung: Wir müssen in diesem Zug noch einmal neu klären, wer<br />
eigentlich <strong>für</strong> was verantwortlich ist. Welche Instanz kann auf welcher Ebene<br />
Verantwortung übernehmen im Sinne einer Verantwortung <strong>für</strong> potenzielle Wirkung?<br />
Nicht nur Zuständigkeiten im Sinne von „Ich bin zuständig“, also bekomme ich Geld,<br />
folglich habe ich Macht, sondern, ich meine, wirkliche Verantwortungsübernahme. An<br />
diesem Punkt sagen meine Mitarbeiter immer: „Jetzt kommst du in den Tugenddiskurs“.<br />
Das will ich aber gar nicht. Ich begreife Verantwortung durchaus auch ökonomisch im<br />
28
nicht. Ich begreife Verantwortung durchaus auch ökonomisch im Sinne von „Accountability“,<br />
von Rechenschaftspflichtigkeit. Nicht nur als moralische Verantwortung, sondern:<br />
wer kann <strong>für</strong> welche Leistungen und welche Folgen wirklich Verantwortung übernehmen?<br />
Das müssen wir neu sortieren.<br />
Weiterhin müssen wir versuchen, über alle Ebenen hinweg aktivierende Steuerung zu<br />
erreichen. Hier<strong>für</strong> können wir vorhandene Institutionen und Akteurskonstellationen, bereits<br />
vorhandenes Staatshandeln auch nutzen. Ich will im Grunde gar nicht soviel abschaffen,<br />
sondern wirklich neu sortieren. Frontal gegen Institutionen und etablierte Verhaltensweisen<br />
anzugehen nützt gar nichts. Man muss das, was an Verhaltensweisen da<br />
ist, aufnehmen, neu konstellieren, richtig nutzen und damit Ressourcen frei machen. Ich<br />
bin sicher, dass, genauso wie die Bürger bei unserer Befragung die Idee ganz toll fanden,<br />
im Zusammenspiel neue Verantwortung zu übernehmen, alle Professionellen, alle,<br />
die im System arbeiten, das auch sehr gerne tun würden.<br />
<strong>Dr</strong>ei Jahre nach der Bürgerbefragung haben wir eine Spiegelbefragung der Mitarbeiter<br />
der Landesverwaltung Niedersachsens durchgeführt und fast genau die gleichen Fragen<br />
gestellt. Die Ergebnisse waren hochgradig interessant. Es kam heraus, dass der Staat<br />
und der öffentliche Bereich sich wirklich auf den Bürger zubewegen. Viele Ideen sind<br />
identisch. Aber noch laufen Bürger und Staat leider aneinander vorbei. Wobei sich die<br />
Angestellten und Beamten im öffentlichen Bereich noch nicht richtig vorstellen können,<br />
wie sie denn jetzt eigentlich mit dem Bürger umgehen sollen. Die bürokratische Denkweise,<br />
die Mixtur aus „dem Bürger dienen“ und ihn aber auch gleichzeitig „bewachen“,<br />
sitzt so fest, dass sich die Beschäftigten meistens gar nicht vorstellen können, mit dem<br />
Bürger zu kooperieren. Die Kooperation mit den Bürgern ist aber die neue Aufgabe der<br />
Verwaltung. Wir können eine Bewegung feststellen, die man forcieren und zielgenauer<br />
führen muss. Um die Dienstleistungsidee wirklich auch in die Apparate hineinzubringen,<br />
kann man viel über Qualifizierung, Aufklärung, Dialoge und Personalentwicklung erreichen,<br />
damit Bürger und Staat sich stärker aufeinander zubewegen. Das erfordert also<br />
aktivierende Steuerung auf verschiedenen Ebenen.<br />
Ein weiterer Punkt, der mir ganz wichtig ist: Wir brauchen ein vollkommen neues Wissensmanagement.<br />
Das Informationsproblem gerade über den sozialen Bereich ist riesig.<br />
Es gibt unheimlich viele Experten in ihren einzelnen Feldern, aber das vorhandene<br />
Wissen wird nicht „kommuniziert“ und geht nicht nach oben. Die Politik und die Politiker<br />
wissen es nicht. Es gibt immer auch Ausnahmen, wie die heute anwesenden Staatssekretäre,<br />
die hervorragend qualifiziert sind. Ab und zu gibt es auch mal eine Ministerin,<br />
jetzt in Niedersachsen Frau <strong>Dr</strong>. Trauernicht, die das auch versteht. Aber das sind einfach<br />
zu wenig Leute. Der Sozialbereich muss sich jedoch neu aufstellen, um in der Marketing-Sprache<br />
zu reden. Wir müssen uns alle neu aufstellen, auch im Wettbewerb, in<br />
der Konkurrenz um die Budgets, dabei ist dann Information das A und O. Ich nehme als<br />
Beispiel wieder die Frage der Sozialhilfe, Stichwort „Koch-Debatte“. Was in der letzten<br />
Zeit auch sozialdemokratische Politiker plötzlich von sich gegeben haben, hat mir wirklich,<br />
jetzt werde ich etwas vulgär, die Schuhe ausgezogen. Im Bereich der so genannten<br />
„Armutspolitik“ gibt es tatsächlich ein Recht auf Leistung ohne Gegenleistung. Missverstandener<br />
Blair, missverstandener New Deal. Gegenleistung würde bedeuten zu „aktivieren“.<br />
Das hieße, die Personen müssten leistungsfähig sein, dann greift „Hilfe zur<br />
Selbsthilfe“. Die Gegenleistung ist kein Tauschprinzip. So aber wird gesagt: „Wenn ihr<br />
29
nicht arbeitet, bekommt ihr kein Geld.“ Das geht nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes<br />
sowieso nicht. Aber allein die Art und Weise, wie darüber diskutiert<br />
wurde, empfand ich als eine Katastrophe. Diesen öffentlichen „Dialog“ fand ich verrottet.<br />
Wenn nicht der Deutsche Städtetag endlich ein paar Zahlen, die ja alle zugänglich<br />
sind, hinterhergeschoben hätte, dann hätten wir ein größeres Problem. Sie sehen: diese<br />
Frage des Wissensmanagements erscheint ganz besonders wichtig.<br />
Ich komme jetzt zu einem Modell, in dem ich versucht habe, die verschiedenen Prinzipien,<br />
die ich bisher angedeutet und entwickelt habe, einmal zusammenzufassen:<br />
Verantwortungsstufung und Aktivierung im Sozialstaat - im Spiel von Angebot und Nachfrage<br />
30
STEUERUNGS-STUFEN:<br />
Vision/<br />
Commitment<br />
Goals/<br />
aims<br />
Objectives<br />
Targets:<br />
results and<br />
standards<br />
ÖFFENTLICHE ANBIETER:<br />
Politik Verwaltung<br />
RECHTSRAH-<br />
MEN/<br />
INFORMATION/<br />
MODERATION<br />
Wähler/<br />
Staatsbürger<br />
VERHAND-<br />
LUNGS-<br />
SYSTEME<br />
Organisationen/<br />
Verbände<br />
Kollektive<br />
Leistungserbringer<br />
KOOPERATION<br />
IM<br />
LEISTUNGS-<br />
ANGEBOT<br />
Professionen<br />
Individuelle<br />
Anbieter<br />
KOPRODUKTI-<br />
ON VON LEIS-<br />
TUNGEN<br />
Konsument/<br />
Kunde<br />
Entscheidung<br />
über<br />
Prioritäten<br />
(Strategien)<br />
Zielklare<br />
Kooperation<br />
Produkt- und<br />
Prozess-<br />
Optimierung<br />
Angemessenheit/<br />
Gerechtigkeit<br />
NACHFRAGER: © Bernhard Blanke 2000<br />
31<br />
BEWERTUNGS-KRITERIEN:
Links sind Steuerungsstufen abgetragen und zwar in der klassischen Form der Steuerung<br />
über Ziele. Rechts stehen Bewertungskriterien, mit denen Zielerreichung „gemessen“<br />
werden kann. Wirkungsorientierung bedeutet ja, dass ich Ziele und die gewünschte<br />
Wirkung sehr genau definieren muss, um festzustellen, ob ich sie auch erreicht habe.<br />
Ich unterscheide vier Stufen der Zielformulierung. Das ist übrigens nicht nur von mir,<br />
auch in Großbritannien wird z. B. versucht, über Public Spending Agreements (PSA) in<br />
einzelnen Bereichen genau dies von staatlicher Seite her zu organisieren, beginnend<br />
mit einer politischen Vision, einem Commitment, die sagt: „Wir wollen in Zukunft dies<br />
und jenes erreichen.“ Unsere Politiker sagen leider nicht, was sie in Zukunft erreichen<br />
wollen. Eine Selbstverpflichtung der großen Politik über die klare Zielerreichung müsste<br />
eingefordert werden. Im Hochschulbereich sehe ich in England eine sehr schöne Entwicklung,<br />
bei der in Kommissionen und Debatten <strong>für</strong> alle Beteiligten auch Commitments<br />
auferlegt worden sind. Als schönstes Commitment empfand ich eine Verpflichtung der<br />
Studenten, ihre Leistungskraft der Universität zur Verfügung zu stellen. Das habe ich<br />
meinen Studenten erzählt: „Ihr seid ein Teil Input dieses Systems der Universität. Eure<br />
Leistung ist Teil des Systems. Wenn Ihr nicht gut in den Seminaren arbeitet, kommt dabei<br />
nichts heraus, und Ihr könnt auch nichts lernen.“ Deshalb also Kooperation. Ob sie<br />
es verstanden haben? So eine Art von Vision/Commitment würde ich mir auch im sozialpolitischen<br />
Bereich wünschen. Insgesamt klare und generelle Ziele, die natürlich auf<br />
handhabbare „Departments“ heruntergebrochen werden müssen, beispielsweise als<br />
Zielkorridore <strong>für</strong> einzelne Zweige der Sozialpolitik, aus denen man dann Zwecke <strong>für</strong> einzelne<br />
Maßnahmen im Jugendhilfe- oder betrieblichen Bereich entwickeln kann.<br />
Daraus resultieren dann sogenannte Targets, Ziele <strong>für</strong> den Einzelnen, die festlegen, was<br />
im Einzelfall passieren soll. Soweit die Steuerungsstufen über Ziele. Im Prospekt der<br />
Tagung wurde die Frage gestellt: „Ist die präzise Formulierung von Wirkungszielen<br />
durch Politik erforderlich oder reicht es, Verfahrensregelungen zur Qualitätsentwicklung<br />
vorzugeben?“ Ich würde beides be<strong>für</strong>worten. Man darf sich den Prozess aber im sozialpolitischen<br />
Bereich oder auch generell nicht so vorstellen, dass es möglich wäre, aus<br />
allgemeinen Visionen und Commitments jedes Einzelziel abzuleiten. Dies ist der große<br />
Denkfehler, der häufig gemacht wird. Wenn die Politik den alten bürokratischen Denkstil<br />
so weiterführt, denkt sie, dass sie das könne.<br />
Hier müssen wir Abstufungen vornehmen. Es gibt hier vor allen Dingen einen ganz wichtigen<br />
Schnitt in der Mitte, bei der Umsetzung von großen Zielen in die Bereichsziele und<br />
die Zwecksetzung <strong>für</strong> Einzelne. Hier besteht ein Übersetzungsproblem, welches man<br />
nicht bürokratisch von oben durchsteuern, sondern nur kooperativ lösen kann. Es handelt<br />
sich also um zwei ganz verschiedene Felder. Man könnte es auch so formulieren:<br />
Der Schnitt zwischen den beiden ersten Stufen und den zwei folgenden bezeichnet eine<br />
Unterscheidung von „ermöglichenden“ Faktoren und dem Bereich des tatsächlichen<br />
Leistungsgeschehens. Ich kann im Einzelfall auf der Ebene des Leistungsangebots<br />
selbstverständlich einzelne Zwecke festlegen. Ich würde immer ganz im Sinne von Max<br />
Weber nach Ziel und Zweck unterscheiden. Ich kann Zwecke festlegen, <strong>für</strong> die ich ganz<br />
bestimmte Mittel auch zur Verfügung stellen kann. Nehmen wir ein Krankenhaus als<br />
Beispiel. Dort kann ich <strong>für</strong> den Betrieb das genau durchführen. Ich kann aber niemals<br />
genau sagen, wie diese Zwecksetzungen, die mit klaren Mitteln auch in Bezug auf Wirkungen<br />
bearbeitbar sind, mit den größeren Zielen des Gesundheitswesens als Ganzem<br />
zusammenhängen. Das ist ein Transformations- und Übersetzungsproblem, an dem die<br />
32
Hierarchie endet. Hier sind also Dialog, Kooperation, auch dialogische Evaluation gefragt.<br />
Keine Ex-Post-Evaluation von Modellen, bei der das Modell nach fünf Jahren evaluiert<br />
ist, aber bereits nicht mehr existiert. Stattdessen liegt uns dann ein Evaluationsprojekt<br />
vor, aus dem wir nichts lernen. Sie kennen wahrscheinlich alle die uralte Tradition:<br />
Modellprojekt, Evaluation, kein Geld mehr <strong>für</strong> das Modell, aber der Bericht ist schön und<br />
die Wissenschaft hat etwas gelernt.<br />
Hier muss man ganz anders herangehen, z. B. zeitnah und kooperativ-dialogisch evaluieren.<br />
Kommen wir zu den Stufen zurück und beginnen mit der Politik. Was kann sie<br />
denn wirklich „bewirken“?<br />
Die Politik würde ich als Arena definieren, in der die verantwortlichen Personen im direkten<br />
Kontakt zum Wähler stehen, ständig im Wahlkampf, und in der sie auf die Öffentlichkeit<br />
reagieren müssen und gleichzeitig das Anbietersystem steuern sollen. Diese Arena<br />
kann eigentlich nur Verantwortung <strong>für</strong> kluge Rahmensetzung und vor allem <strong>für</strong> Informationsmanagement<br />
übernehmen. Was ich der hohen Politik vorwerfe, ist, dass sie die<br />
Aufgabe von Informations- und Wissensmanagement nicht richtig übernimmt. Niemand<br />
kann es derzeit. Es werden Enquete-Kommissionen eingesetzt, es gibt verschiedene<br />
„Räte“, aber als Hauptaufgabe muss viel mehr über Information gesprochen und es<br />
müssen Dialoge über Prioritäten geführt werden. Das gilt in gleicher Weise <strong>für</strong> die Bundes-<br />
als auch <strong>für</strong> die Landes- und Kommunalpolitik. Notwendiges Heraushalten aus den<br />
engeren Zweckbestimmungen, da<strong>für</strong> Rahmensetzung und vor allem Informationspolitik.<br />
In der zweiten Stufe, in Anlehnung an Scharpf, haben wir es mit dem Verhandlungssystem<br />
zu tun, wo die Verwaltung interveniert, die nicht mehr unmittelbar auf den Wähler<br />
sieht, sondern weisungsmäßig an Rechts- und Finanzrahmen gebunden ist, aber auch<br />
sehr frei in ihren Entscheidungen, mit gesellschaftlichen Organisationen im weitesten<br />
Sinne zu kooperieren. Auch hier müssen die Rollen genauer neu definiert werden. Das<br />
Wichtige ist nicht das Feilschen um Geld und Machtpositionen zwischen Staat und Verbänden,<br />
sondern – ich weiß, es ist idealistisch und blauäugig – die Hauptaufgabe dieses<br />
Verhandlungssystems wäre, zielklare Kooperation zu entwickeln. Es wird ja kooperiert.<br />
Allerdings in einer Art „neuer Unübersichtlichkeit“. Auch in den einzelnen Sozialgesetzen<br />
finden sich immer mehr kooperative Elemente, neue Rollenverteilung, Verantwortlichkeit,<br />
zielklare Kooperation. Wenn auf dieser Ebene Prioritäten über Strategien und zielklare<br />
Kooperation erzielt werden, dann können auf der betrieblichen Stufe, wo kollektive<br />
Leistungserbringer und Professionals zusammenarbeiten, die Leistungsangebote kooperativ<br />
entwickelt werden.<br />
Unser heutiges Problem ist, dass überall Managementverfahren eingeführt werden, aber<br />
kein Mensch weiß, welches Ziel die Organisation eigentlich hat. Was wollen wir eigentlich<br />
künftig? Instrumente werden auf dieser Ebene meist ungeprüft aus „der Wirtschaft“<br />
von außen eingeführt. Aber von innen wird nicht an diesen neuen Instrumenten, die ich<br />
sehr be<strong>für</strong>worte, gearbeitet. Ich habe überhaupt nichts gegen Betriebswirtschaft oder<br />
Ökonomie, ich bin ja von Haus aus Ökonom. Der organisatorische Sinn ergibt sich aber<br />
nur, wenn der Reformprozess im klaren Zielrahmen und in klaren kooperativen Strukturen<br />
verläuft. Nur so kann man sich an die „neue Steuerung“ annähern.<br />
33
Die letzte Stufe ist dann die, mit der ich im Rahmen von Aktivierungskonzepten begonnen<br />
habe, das Verhältnis des Einzelnen, des Konsumenten, des Kunden, des Klienten<br />
usw. - wie man ihn denn nennen will - des Bürgers in seinen verschiedenen Räumen zu<br />
den Institutionen. Ich halte den Kunden-, den Klienten-, den Patientenbegriff jeweils <strong>für</strong><br />
sich <strong>für</strong> problematisch, weil wir außerhalb des unmittelbaren Leistungsgeschehens, in<br />
dem man diese Rolle als Patient oder als Klient innehat, alle Bürger sind. Die Grundlage<br />
unseres Aktivierungskonzeptes ist der demokratische Prozess, das Verhältnis von Staat<br />
und Bürger. Wir alle müssen uns daran erinnern, dass wir wirklich Bürger sind und zwar<br />
gleich in mehrfacher Hinsicht. Wir haben unsere Pflichten, aber wir haben auch unsere<br />
Rechte. Wir sind eigentlich diejenigen, die auch mit unserem System, das wir uns gewählt<br />
haben, sehr viel härter umgehen und sehr viel stärker Effizienz, Effektivität und<br />
Qualität einfordern müssen. Aber wir müssen auch kooperieren. Der Kundenbegriff jedoch<br />
beinhaltet keine Kooperation, er reduziert auf Kauf- und Verkaufsverhältnisse. Der<br />
Klientenbegriff ist natürlich hoheitlich strukturiert. Der Patientenbegriff spielt -bösartig<br />
gesagt- sowieso keine Rolle im Gesundheitswesen. Der Patient steht zwar im Mittelpunkt,<br />
aber damit allen im Weg. Wenn wir hier nicht dezidiert und „nachhaltig“ die Frage<br />
des Bürgerengagements, der neuen Bürgerrolle, der „Citizenship”, wie die Engländer<br />
sagen, die auch ihre Probleme damit haben, stellen, dann kommen wir an dieser Leistungskette<br />
nicht zum Abschluss. Es handelt sich um eine Leistungskette von der Politik<br />
bis zum „Kunden“, die so verbessert und über verschiedene Stufen aktiviert werden<br />
muss, dass am Ende wirklich der Bürger, der in verschiedenen Rollen auftritt, seinem<br />
Staat gegenüber auch die Wirkung bekommt, <strong>für</strong> die er sein Geld gibt und <strong>für</strong> die er die<br />
Politiker wählt, aber an der er/sie auch mitarbeiten und mitgestalten muss. Das ist mein<br />
Gesamtkonzept.<br />
Ich danke <strong>für</strong> Ihre Aufmerksamkeit.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong>:<br />
Herzlichen Dank, Herr Prof. Blanke. Sind von Ihrer Seite Nachfragen? Punkte, wo Sie<br />
Sich vielleicht noch klarere Antworten wünschen würden? Unklarheiten? – Das ist im<br />
Augenblick nicht der Fall. Herr Prof. Blanke, erlauben Sie mir eine Frage: Wie weit sind<br />
Ihres Erfahrungswissens nach erste Umsetzungsschritte im Hinblick auf diese - Sie haben<br />
es Leistungskette genannt - Steuerungspyramide, Zielhierarchie könnte man es<br />
auch nennen? Sind Ihnen da Beispiele bekannt im Inland oder auch Ausland?<br />
Prof. <strong>Dr</strong>. Bernhard Blanke:<br />
Das Hauptproblem sind die Schnittstellen. Wie werden diese Schnittstellen so gemanagt,<br />
dass die Leistungsaktivierung wirklich funktioniert, dass Prioritäten gut gesetzt und<br />
daraus zielklare Kooperation und Prozessoptimierung gemacht werden? Die Experimente<br />
im internationalen Bereich der Staatsmodernisierung arbeiten eigentlich immer an<br />
diesen Schnittstellen. In der Institutionen-Ökonomie gibt es den Begriff des „Principle-<br />
Agent“-Problems, wir können auch sagen: Beziehungen zwischen Auftraggeber/Auftragnehmer<br />
oder Leistungsnachfrager/Leistungsanbieter. Die Frage wird gestellt,<br />
wie diese Beziehungen optimal zu gestalten sind. Einige haben das durch „Outsourcing“<br />
und Vertragskaskaden, also immer mehr Verträge zwischen den verschiedenen Ebenen,<br />
gelöst. Das wirft jedoch ungeheure Probleme auf, weil damit die Vertragskosten<br />
34
steigen. Je mehr Verträge geschlossen werden, desto mehr muss der „Principle“ verhandeln<br />
und kontrollieren, dass alles auch funktioniert. Im englischen Gesundheitsbereich<br />
wurde versucht, ganz stark zu kontraktualisieren. Die niedergelassenen Ärzte bekamen<br />
ein Budget und schlossen selbst Verträge mit verschiedenen Krankenhäusern<br />
und anderen Leistungsanbietern. Dieses Fund Holding hat fünf oder sechs Jahre funktioniert,<br />
führte aber ganz logisch zu einer Konzentration bei den GP. Die guten alten<br />
Hausärzte haben sich plötzlich alle zusammengeschlossen und auf Grund der Vertrags-<br />
und Verhandlungsmacht größere Firmen gegründet. Viele Kleine konnten da nicht mithalten<br />
und wurden keine Fund Holders. Der Effekt war, dass die Patienten der großen<br />
Fund Holders, die Gutsituierten, die Gebildeten, die so etwas verstehen, verhandeln,<br />
Alternativen suchen. Bei den kleinen Praxen blieben die Ärmeren hängen. Diese Art von<br />
Vermarktlichung und Vertraglichung führt zur Selektion, zum sogenannten „Cream<br />
Skimming“. Die Leute, die Geld haben, holen sich die besseren Patienten. Jetzt ist der<br />
Wechsel umgekehrt. Die neue Regierung macht etwas ganz anderes, installiert jetzt<br />
Primary Health Care Groupes auf lokaler Ebene. Die fassen alle zusammen in Praxisnetzwerke<br />
mit Hausarztfunktion, wo nicht mehr jeder einzelne Vertrag verhandelt wird,<br />
sondern sehr viel stärker Kooperation stattfindet. Das scheint nun erheblich besser zu<br />
funktionieren. Man kann also auch im instrumentellen Bereich ganz gut sortieren, was<br />
wirklich in so eine Art von Aktivierungs-Leistungskette hineinpasst. Je mehr Einzelverträge,<br />
desto schlechter. Ich setze vielmehr auf Kooperation und Koproduktion, vor allem<br />
im Gesundheitsbereich. Das ist die eine Variante.<br />
Die andere Variante ist die dänisch-schwedische, die man mit „Agenturbildung“ bezeichnen<br />
kann, wobei quasi-autonome Instanzen geschaffen worden sind. Agentur <strong>für</strong><br />
X, Agentur <strong>für</strong> Y. Auch mit Verträgen, aber in einem beibehaltenen öffentlichen Sektor.<br />
Das funktioniert in Schweden auf Grund der hohen staatlichen Verantwortung insgesamt,<br />
wegen der geringen Verbandlichung und der geringen Korporatisierung besser,<br />
weil dort nicht -salopp gesagt- so viele Leute immer mitgeredet haben. Ich habe nichts<br />
gegen Mitbestimmung und Bürgerengagement, aber zu viele Einflüsse im Rahmen eines<br />
diffusen „Subsidiaritäts“- Prinzips, wo die Rollen gar nicht klar sind, schaffen Probleme.<br />
Das Problem der Freien Wohlfahrtsverbände z. B. ist ja, dass sie im Augenblick<br />
nicht mehr wissen, welche Rolle sie eigentlich spielen sollen. Sind sie Sozialadvokatoren<br />
<strong>für</strong> die kleinen Leute, sind sie „Dienstleister“ und Betriebe, sind sie Verbände, die<br />
Politik machen, die Verhandlungen führen, oder sind sie auf der oberen politischen Ebene<br />
die letzten, die z. B. überhaupt noch die Armutsfrage stellen? Sie stecken wirklich<br />
in einer ganz schwierigen Situation. Andere Länder haben dieses Problem nicht, weil sie<br />
andere Institutionen haben. Ich denke, dass unsere Hauptschwierigkeit darin liegt, zu<br />
klären, wie man in diesen Strukturen die Verantwortung so setzen kann, dass auch immer<br />
klar ist, dass beispielsweise Verbände, wenn sie sich auf der Ebene von Verhandlungen<br />
bewegen, dort ihre Rolle haben, aber nicht alles vermischen. Dass sie nicht behaupten,<br />
die Klienten zu vertreten. Die Krankenkassen vertreten beispielsweise die Patienten<br />
nicht. Dass hier vielmehr Autonomisierung auch im Sinne der Selbststeuerung<br />
auf den verschiedenen Ebenen eingeführt wird.<br />
Ich denke schon, dass sich insgesamt eine Richtung im internationalen Vergleich feststellen<br />
lässt. Weg von der staatlichen Fremdsteuerung, hin zu irgendeiner Art von kooperativer<br />
Selbststeuerung und verantwortungsdifferenzierenden Dezentralisierung, gerade<br />
im sozialen Dienstleistungsbereich. Und dies liegt schlicht an der neu gestellten<br />
35
Frage der Wirkungsorientierung, bei der ganz verschiedene Wirkungsdimensionen betrachtet<br />
werden müssen. Ich habe heute weitgehend gehört, es ginge immer um die<br />
Wirkung im Einzelfall. Das ist zu wenig! Wir müssen mehrere, möglicherweise fünf Wirkungsdimensionen<br />
klassifizieren. Steuert man daraufhin, kommt man auch zu einer Stufung.<br />
Individuelle Wirkung im Einzelfall? Nicht nur: Sie haben gesagt, ich zitiere Herrn<br />
<strong>Schröder</strong>, (aggregierte) Wirkung <strong>für</strong> die Gruppe. Es geht nicht um den einzelnen Sozialhilfeempfänger,<br />
sondern es geht auch um bestimmte Gruppen von Personen, z.B. jugendliche<br />
Sozialhilfeempfänger, Langzeitarbeitslose oder gesundheitlich Eingeschränkte.<br />
Der Einzelfall ist häufig nur ein Exempel <strong>für</strong> die Gruppe. Das ist der Blickwinkel der<br />
Politik, die eine ganz bestimmte Gruppe als Problemgruppe definiert und „bearbeitet“.<br />
Hinzu kommen noch soziale oder gesellschaftliche Wirkungen. Es soll ja nicht nur die<br />
einzelne Person aktiviert, sondern es soll immer auch eine gesellschaftliche Wirkung im<br />
Umfeld erzielt werden. Entweder generalpräventiv oder im Sinne der positiven Wirkung.<br />
Im Pflegebereich ist zum Beispiel immer die <strong>Familie</strong> mitbetroffen. Ich habe neulich im<br />
Kontext einer Qualitätsmanagement-Initiative und einer Befragung über Wirkung und<br />
Zufriedenheit gesagt: Wer ist denn jetzt eigentlich der Kunde? Der Patient? – Nein, da<br />
hängt ein ganzes Kundensystem dahinter. Die müssen Sie auch noch befragen. Was ist<br />
mit der <strong>Familie</strong>? Ist denn die <strong>Familie</strong> zufrieden, wenn der Patient ganz schnell wieder<br />
nach Hause kommt, wie es die Leute von der Effizienzsteuerung möchten, oder ist die<br />
<strong>Familie</strong> vielleicht sogar zufrieden, wenn sie dieses Problem <strong>für</strong> eine Woche los ist und<br />
sich erholen kann? Das ist ganz schwierig. Oder im sozialen Umfeld: Wie sieht es mit<br />
dem Stadtteil aus, wenn ich hier etwas mache? Das ist also die dritte Wirkungsdimension.<br />
Dann interessiert die Politik besonders die symbolische Wirkungsdimension. „Wir tun<br />
etwas Gutes. Wir schaffen das Problem weg.“ Häufig geschieht dies durch Neudefinition<br />
des Problems. Hier müssen wir sagen: Übernehmt bitte Verantwortung <strong>für</strong> das, was ihr<br />
an Wirkung anvisiert. Übernehmt vor allem auf der politischen Ebene die Verantwortung<br />
<strong>für</strong> die Politik. Macht ganz klar, was ihr wirklich wollt und könnt, sonst fördern wir nur<br />
noch Zynismus im Sozialbereich. Schließlich sind wir noch mit einem riesigen Problem<br />
konfrontiert, nämlich mit der Wirkung der Wirkung auf andere Wirkungen. Also die<br />
Rückwirkung von solchen Maßnahmen. Die Kybernetik zweiter Generation.<br />
Das bedeutet, dass die Politik sich überhaupt nicht einbilden kann, durch politische,<br />
zentrale Steuerung, nicht einmal durch das Verhandlungssystem, die komplexen Wirkungsdimensionen<br />
in den Griff zu bekommen. Deswegen muss über das System der<br />
Verantwortungsstufung nachgedacht werden. Ich sage: Zielklarheit, Prioritätensetzung,<br />
Verantwortungsübernahme und Kooperation. In der nächsten Ebene geht es eher um<br />
die Leistung selbst. Hier muss mehr Verantwortung nach unten. Mehr Dezentralisierung.<br />
Aber dieser Bereich muss die Verantwortung auch wirklich übernehmen, bis hin zu Effizienz-<br />
und Effektivitätsfragen. Es muss Kooperation herrschen. Wir dürfen eigentlich<br />
nicht mehr an einzelne Rollen wie Kunden, Patienten oder sonst etwas denken, sondern<br />
es handelt sich um koproduktive Prozesse. Keine soziale Dienstleistung hat irgendeine<br />
Wirkung, wenn nicht Koproduktion stattfindet, wenn nicht Patient und Arzt, Klient mit<br />
Helfer usw. zusammenarbeiten. Und dies muss organisiert werden. In den Vereinbarungen,<br />
Entgeltvereinbarungen etc. müssen auch die Spielräume vorhanden sein, um<br />
koproduktive Prozesse wirklich zu befördern. Das kostet potenziell Geld. Aber vielleicht<br />
36
kann man es auf anderen Ebenen erwirtschaften. Wenn ich weniger Bürokratie, weniger<br />
Kontrolle benötige und das Geld nach unten „umschichte“, dann habe ich das Geld vor<br />
Ort <strong>für</strong> die Wirkungen zur Verfügung. Das mag blauäugig sein, aber Sie wissen ja, die<br />
wahren Abenteuer sind im Kopf.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong>:<br />
Herzlichen Dank, Herr Prof. Blanke. Im Prinzip haben Sie auch noch einmal den Bogen<br />
geschlagen zu dem, was Herr Staatssekretär Haupt quasi zum Schluss unserer letzten<br />
Tagung sagte: Wirkungen kann man nicht herbeikontrollieren. Es müssen andere Mechanismen<br />
greifen.<br />
37
5. Fördert die Sozialgesetzgebung die Selbststeuerung der<br />
Klient/-innen? - Prof. <strong>Dr</strong>. Anne Friedrichs<br />
Prof. <strong>Dr</strong>. Anne Friedrichs, Fachhochschule Emden<br />
Ganz herzlichen Dank Herr <strong>Dr</strong>. <strong>Schröder</strong>, meine Damen und Herren, dass Sie mir heute<br />
als vierter Rednerin vor der Mittagspause noch zuhören wollen, aber wir haben vorhin<br />
gehört, dass in Sachsen-Anhalt auch vierte Plätze noch hoch geehrt werden. Deshalb<br />
vertraue ich darauf, dass das nicht nur im Sport sondern auch hier gilt und ich mich noch<br />
verständlich machen kann mit meinen Ausführungen.<br />
Als ich vor einigen Wochen damit begonnen habe, mich auf diese Tagung und diesen<br />
Vortrag vorzubereiten, habe ich mich zunächst mit der Frage beschäftigt, wie ich den<br />
der Begriff der Steuerung, bzw. der Selbststeuerung verstehen und <strong>für</strong> diesen Vortrag<br />
definieren kann. Das war schon deshalb nicht einfach, weil die Sozialgesetzgebung, mit<br />
der ich mich ja insbesondere beschäftigen soll, den Begriff der Steuerung und der<br />
Selbststeuerung nicht kennt und nicht verwendet, übrigens auch nicht in den in jüngster<br />
Zeit verabschiedeten Sozialgesetzen, wie dem SGB IX und dem PQsG. Die Übertragung<br />
dieser Begriffe aus der Alltagssprache oder aus einem anderen wissenschaftlichen<br />
Zusammenhang auf das Recht ist kaum möglich, wie ich gleich deutlich machen werde.<br />
Ich möchte Ihnen den Weg zeigen, den ich bei meinem Versuch, diesen Begriff <strong>für</strong> meinen<br />
sozialrechtlichen Überlegungen zu operationalisieren, gegangen bin und werde dabei<br />
die vielen Irrwege, auf die ich unterwegs geraten bin, weglassen, um einerseits<br />
meine Redezeit nicht zu überschreiten und andererseits einen Rest Klarheit in dieser<br />
Diskussion zu bewahren.<br />
Ich habe, um mich diesem Begriff inhaltlich zu nähern, damit begonnen, im "dtv-Lexikon<br />
unter dem Begriff Steuerung" nachzuschauen und habe folgende Definitionen gefunden:<br />
1. Psychologie<br />
Prüfende, auswählende oder hemmende Tätigkeit des Ich in bezug auf Triebregungen,<br />
Gefühlsäußerungen und Handlungen; sie vollzieht sich unter dem Einfluß innerer und<br />
äußerer Kotrollmechanismen und dient als rationale, planmäßige Verhaltenslenkung der<br />
aktiven Verwirklichung übergeordneter Ziele oder der reaktiven Beantwortung äußerer<br />
Einflüsse<br />
2. Technik<br />
Vorgang und Vorrichtung zur Erzwingung des vorgesehenen Ablaufs der Bewegung u.a.<br />
in einer Maschine durch Betätigen da<strong>für</strong> vorgesehener Vorrichtungen.<br />
Es handelt sich also sowohl in der Psychologie als auch in der Technik um kontrollierte<br />
und vor allem kontrollierbare Vorgänge.<br />
Den Begriff der "Steuerung" kennen wir im Alltag vor allem aus der Sprache der Technik.<br />
Seit den 70iger Jahren spielt er aber auch in der sozial- und verwaltungs-<br />
38
wissenschaftlichen Diskussion eine gewichtige Rolle. Bei der Suche nach einer Definition<br />
in diesem Arbeitsfeld bin nach längerem Suchen auf Renate Mayntz 1 gestoßen. Renate<br />
Mayntz hat sich 1986 ausführlich in einem Diskussionsbeitrag mit dem Begriff der<br />
Steuerung in den Sozialwissenschaften befasst. Die Lektüre dieses Beitrags war sehr<br />
hilfreich <strong>für</strong> mich, hat er doch einerseits bestätigt, was ich schon im Vorfeld geahnt hatte,<br />
dass nämlich der Begriff der Steuerung inflationär genutzt wird - und daran hat sich bis<br />
heute nichts geändert. Andererseits existiert der Begriff auch in zahlreichen Abwandlungen<br />
( wie Steuerungszweck, Steuerungsinstrument und auch Selbststeuerung), über<br />
deren Bedeutung ebenfalls kaum Einigkeit besteht und bestehen kann, weil eben schon<br />
der zentrale Begriff unklar ist. Dennoch nennt Mayntz in ihrem Beitrag einige gedankliche<br />
Eckpfeiler, die wesentlich dazu beitragen, den Begriff zu strukturieren:<br />
Sie spricht zunächst vom Steuerungssubjekt, mit dem der Akteur gemeint ist, der aktiv<br />
und bewußt einen Prozeß in Gang bringt oder beendet oder der die Richtung einer Entwicklung<br />
gezielt beeinflußt.<br />
Dazu bedient er sich eines Steuerungsinstruments, also eines Mittels, das er bewußt<br />
zur Steuerung des Prozesses einsetzt. Das können Geld- oder Sachmittel sein oder<br />
auch Marktprinzipien oder Gemeinschaftsbindungen, aber eben nur dann, wenn sie vom<br />
Steuerungssubjekt bewußt und gezielt eingesetzt werden. Unbeabsichtigte, zufällige<br />
Einflüsse, egal ob sie erwünscht oder unerwünscht sind, zählen nicht zu den Steuerungsinstrumenten.<br />
Gegenstand der Steuerung ist immer ein Steuerungsobjekt, dessen Entwicklungsrichtung<br />
gezielt verändert werden soll. Nach Mayntz gehört zum Charakter des Steuerungsobjekts<br />
auch, dass es Systemcharakter besitzt, d.h., dass sich das Steuerungsobjekt<br />
auch dann eigendynamisch weiterentwickeln würde, wenn der gezielte Steuerungseingriff<br />
nicht stattfinden würde. Ziel der Steuerung in diesem Sinne ist also die Änderung<br />
der Richtung der Entwicklung des Steuerungsobjekts in Abgrenzung von lediglich punktuellen<br />
Eingriffen und /oder der Schaffung neuer Systeme.<br />
Und letztlich gehört zum Bild der Steuerung, dass diese eine Intention, ein Steuerungsziel<br />
hat und dass der Einsatz des Steuerungsinstruments eine Wirkung hin zu dem erwünschten<br />
Ziel haben sollte.<br />
Wenn ich nun versuche, diese Definition auf das Thema meines Vortrages - also auf die<br />
Frage, ob die Sozialgesetzgebung die Selbststeuerung der Klienten/Klientinnen fördert-<br />
anzuwenden, so kann ich noch relativ einfach festlegen, wer Steuerungssubjekt ist,<br />
nämlich der Sozialgesetzgeber, sei es im Bund oder in den Ländern.<br />
Schwieriger wird es schon bei der Frage nach dem Steuerungsinstument. Zweifellos ist<br />
Steuerungsinstrument die Sozialgesetzgebung selbst. Sie soll nach dem Willen des Gesetzgebers<br />
dazu beitragen, dass bestimmte vom Gesetzgeber gewünschte Ziele, wie<br />
soziale Grundsicherung, Wahrung der Menschenwürde, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft<br />
u.s.w., erreicht werden. Steuerungsinstrument kann aber auch der Klient<br />
1 Renate Mayntz, Steuerung, Steuerungsakteure und Steuerungsinstrumente: zur Präzisierung des Problems in :Universität-<br />
Gesamthochschule Siegen, HiMoN-Dislussionsbeiträge70/86<br />
39
selbst sein, wenn ich mir den Titel unserer Tagung anschaue: "Selbststeuerung als Element<br />
wirkungsorientierter Steuerung". In diesem Sinne soll der Klient durch Selbststeuerung<br />
zur Erreichung übergeordneter gesetzlicher Ziele - quasi als Werkzeug zur<br />
Verwirklichung wirkungsorientierter Steuerung - beitragen. Er ist dann ein Steuerungsinstrument<br />
in der Hand des Sozialgesetzgebers.<br />
Gleichzeitig ist er aber auch Steuerungsobjekt, weil er - entweder allein oder als Teil<br />
eines sozialen Systems - Gegenstand der Steuerung ist, dessen Entwicklung in bestimmter<br />
Weise durch das Instrument der Sozialgesetzgebung verändert und beeinflußt<br />
werden soll.<br />
An dieser Stelle bitte ich um Verständnis da<strong>für</strong>, dass ich mich mit der Frage ob eine einzelne<br />
Person ein System und damit überhaupt ein Steuerungsobjekt im Sinne der Definiton<br />
von Renate Mayntz sein kann, schon aus Zeitgründen nicht auseinandersetze. Es<br />
mag hier die These ausreichen, dass auch eine Person in ihrer Entwicklung durch bestimmte<br />
Einflüsse gezielt gelenkt werden kann.<br />
Probleme mit der Zuordnung gibt es weiterhin dann, wenn man nach den Intentionen,<br />
also nach den Steuerungszielen fragt. Da ist zum einen das , was der Titel meines Vortrages<br />
impliziert, nämlich das Ziel der Selbststeuerung der Klienten und auf der anderen<br />
Seite finden wir in den Sozialgesetzen Ziele wie Eigenverantwortlichkeit, Gemeinschaftsbezogenheit,<br />
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und vieles mehr. Die<br />
Selbststeuerung ist also einerseits gewünschte Wirkung der Sozialgesetzgebung und<br />
damit Steuerungsziel, andererseits aber auch - wie ich es oben beschrieben habe- ein<br />
Steuerungsinstrument, mit dessen Hilfe der Gesetzgeber bestimmte weitergehende Ziele<br />
der Sozialgesetzgebung, wie z.B. die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erreichen<br />
will. Das ist solange kein Problem, solange der Gesetzgeber und der einzelne<br />
Klient sich über die gewünschten Ziele und die Wege dorthin einig sind. Besteht diese<br />
Einigkeit nicht mehr, kann diese Situation dazu führen, dass die Steuerung des Gesetzgebers<br />
zur Bevormundung wird, was in der Diskussion der vergangenen Monate um die<br />
persönlichen Budgets in der Sozialgesetzgebung deutlich geworden ist.<br />
Bevor ich darauf und auf einige andere Beispiele eingehe, möchte ich Ihnen vorstellen,<br />
mit welchen Begriffen, Mitteln und Inhalten der Gesetzgeber , der ja den Begriff der<br />
Steuerung, der Steuerungsziele und -instrumente zwar sicher kennt, aber eben nicht<br />
verwendet, im Sozialrecht seine politischen Vorstellungen zu realisieren versucht. Ich<br />
werde das beispielhaft anhand von drei Gesetzen darstellen, dem BSHG, dem SGB VIII<br />
und dem SGB IX. Dabei werde ich versuchen, der oben vorgestellten Definition von Renate<br />
Mayntz die entsprechenden Begriffe aus dem Sozialrecht gegenüberzustellen, wobei<br />
ich auf das Steuerungssubjekt nicht mehr eingehe und voraussetze, dass wir uns<br />
darüber einig sind, dass das der Gesetzgeber selbst ist.<br />
5.1 Steuerungsziele<br />
Gemeinsam ist dem BSHG und dem SGB VIII und IX , dass sie jeweils am Anfang des<br />
Gesetzestextes die jeweiligen Steuerungsziele beschreiben, diese aber anders benennen,<br />
wie nun an den einzelnen Gesetzen dargestellt werden soll.<br />
40
Bundessozialhilfegesetz<br />
§ 1 BSHG ist mit der Überschrift "Inhalt und Aufgabe der Sozialhilfe" überschrieben und<br />
nennt in Abs.2 S.1 als Aufgabe, dem Empfänger der Hilfe die Führung eines Lebens zu<br />
ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. In Abs. 2 S. 2 wird dann als weitere<br />
Aufgabe der Sozialhilfe festgelegt, dass sie den Hilfeempfänger soweit wie möglich<br />
befähigen soll, unabhängig von ihr zu leben und fügt gleichzeitig einschränkend hinzu,<br />
dass der Hilfeempfänger hierbei nach seinen Kräften mitzuwirken hat.<br />
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)<br />
Das SGB VIII nennt in § 1 Abs.1 S.1 als maßgebliches Ziel aller Kinder- und Jugendhilfe,<br />
dass sich der junge Mensch zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen<br />
Persönlichkeit entwickeln soll, ohne dies allerdings ausdrücklich als "Ziel" zu bezeichnen.<br />
Eine erste Konkretisierung erfolgt dann im Abs. 3, wonach Jugendhilfe insbesondere<br />
zur Verwirklichung des eben genannten übergeordneten Ziels:<br />
� junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu<br />
beitragen soll, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen<br />
� Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen<br />
soll<br />
� Kinder und Jugendliche vor Gefahren <strong>für</strong> ihr Wohl schützen soll<br />
� dazu beitragen soll , positive Lebensbedingungen <strong>für</strong> junge Menschen und ihre <strong>Familie</strong>n<br />
sowie eine kinder- und jugendfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen<br />
§ 2 SGB VIII trägt zwar die Überschrift "Aufgaben der Jugendhilfe", enthält aber bei genauem<br />
Hinsehen einen Leistungskatalog ( Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer<br />
Kinder- und Jugendschutz ...) und nicht Aufgaben im Sinne von Zielen oder Steuerungszielen.<br />
Eine weitere Konkretisierung des in § 1 SGB VIII genannten Ziels erfolgt in § 9, in dem<br />
es um die Grundrichtung der Erziehung sowie um die Gleichberechtigung von Jungen<br />
und Mädchen geht.<br />
Das SGB VIII nennt auch in den nachfolgenden Vorschriften Ziele, die teilweise unmittelbar<br />
mit bestimmten Leistungen verknüpft sind; so soll z.B. die Jugendsozialarbeit (§<br />
13 SGB VIII) zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen und zur Überwindung individueller<br />
Beeinträchtigungen beitragen. Ich werde die zahlreichen Zielbestimmungen des<br />
Kinder- und Jugendhilferechts hier aber schon aus Zeitgründen nicht vollständig nennen<br />
können und beschränke mich daher auf die allgemeinen Ziele, die ich oben dargestellt<br />
habe.<br />
SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)<br />
Auch das gerade erst verabschiedete SGB IX beginnt in § 1 mit der Benennung von Zielen,<br />
ohne diese ausdrücklich so zu nennen. Die Leistungen nach diesem Gesetz sollen<br />
erbracht werden, um die Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in<br />
41
der Gesellschaft Behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen zu fördern,<br />
Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei soll den besonderen<br />
Bedürfnissen behinderter und von Behinderung bedrohter <strong>Frauen</strong> und Kinder<br />
Rechnung getragen werden. Eine Konkretisierung der Ziele der sog. Leistungen zur<br />
Teilhabe findet sich in § 4. Sie sollen dazu beitragen,<br />
1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu<br />
verhüten oder ihre Folgen zu mindern,<br />
2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu<br />
überwinden, zu mindern, oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den Bezug<br />
von Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern,<br />
3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft<br />
zu sichern oder<br />
4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in<br />
der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung<br />
zu ermöglichen oder zu erleichtern<br />
Ebenso wie im SGB VIII finden sich auch im Rehabilitationsrecht im nachfolgenden<br />
Text Ziele, die hier ebenfalls aus Zeitgründen ungenannt bleiben müssen. Dabei scheint<br />
es mir aber noch der Hinweis wichtig, dass sich die Ziele - wie im SGB VIII und im<br />
BSHG immer auf die Leistungsberechtigten selbst beziehen und nicht auf die Gesellschaft<br />
insgesamt, auch wenn z.B. § 8 Abs. 1 SGB XI die pflegerische Versgorgung der<br />
Bevölkerung ausdrücklich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe bezeichnet und damit<br />
die Verantwortung der <strong>Familie</strong>n <strong>für</strong> ihre pflegebedürftigen Angehörigen zwar nicht aufhebt<br />
, aber doch den Fokus von den <strong>Familie</strong>n - sprich den Müttern und Töchtern- weg<br />
zur Gemeinschaft lenkt . Eine vergleichbare Norm ist mir aus den Gesetzen, die ich<br />
hier vorstelle nicht bekannt.<br />
5.2 Steuerungsinstrumente im Sozialrecht<br />
5.2.1 Das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten<br />
Nach § 33 I S.2 SGB I soll bei der Ausgestaltung von Rechten und Pflichten den Wünschen<br />
der Berechtigten entsprochen werden, soweit sie angemessen sind. Dadurch<br />
trägt der Gesetzgeber der Tatsache Rechnung, dass es bei der Bearbeitung individueller<br />
Probleme, der persönlichen Verhältnisse, der Leistungsfähigkeit oder des Bedarfs<br />
eines Leistungsberechtigten, aber auch bei der Frage der beruflichen oder gesundheitlichen<br />
Zukunft subjektive Elemente gibt, die vom Gesetzgeber oder vom Sozialleistungsträger<br />
nicht berücksichtigt werden können 2 . Ein Mindestmaß am individuellen Wünschen<br />
gepaart mit der Möglichkeit, unter einer wenn auch nur kleinen Auswahl selbstverantwortlich<br />
eine Entscheidung treffen zu können, ist notwendige Voraussetzung <strong>für</strong> eine<br />
positive Fortentwicklung. Gerade im Rehabilitationsrecht gilt, dass das Vorhandensein<br />
von Wünschen auf der einen Seite und das Bemühen, diese angemessen zu berücksichtigen<br />
, auf der anderen Seite notwendig ist, um das jeweilige Ziel der Rehabilitation<br />
2 Felix Welts/Constanze Sulek: Die individuelle Konkretisierung des sozialrechtlichen Anspruchs auf Rehabilitation in VSSR5/2000<br />
S. 453 ff.<br />
42
zu erreichen. Das Wunsch- und Wahlrecht enthält <strong>für</strong> den Fall, dass die Meinung des<br />
Anspruchsinhabers und des Sozialleistungsträgers differiert eine gesetzliche Wertung<br />
zugunsten des Anspruchsinhabers. Die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts ist nicht<br />
an die Geschäftsfähigkeit oder Handlungsfähigkeit im Sinne des § 36 SGB I gebunden.<br />
Auch die Wünsche von Menschen, die z.B. einer Betreuung unterliegen, sind zu berücksichtigen.<br />
Der Sozialleistungsträger hat die Wünsche zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens<br />
zu beachten und darüber hinaus zu fördern. Will der Leistungsträger sich anders - also<br />
gegen den Wunsch des Berechtigten entscheiden, so hat er dies zu begründen und<br />
trägt im Verfahren die Darlegungs- und Beweislast. Nach diesen allgemeinen Ausführungen<br />
nun zu den speziellen Ausformungen des Wunsch- und Wahlrechts:<br />
Bundessozialhilfegesetz<br />
§ 3 BSHG wurde 1961 mit dem Bundessozialhilfegesetz geschaffen und ist damit die<br />
älteste Norm, die den Grundsatz der Individualisierung und des Wunsch- und Wahlrechts<br />
im Sozialrecht festschreibt. § 33 SGB I wurde 1975 in teilweiser Anlehnung an §<br />
3 BSHG geschaffen. § 3 BSHG kann ebenso wie § 33 SGB I nicht nur bei der Bestimmung<br />
von Art, Form und Maß der Sozialhilfe, sondern auch als Auslegungsregel <strong>für</strong> unbestimmte<br />
Rechtsbegriffe wie Zumutbarkeit, Härte, Vertretbarkeit und Angemessenheit<br />
herangezogen werden.<br />
Erheblich später (1984) wurde § 3a S.2 BSHG eingeführt, der den Vorrang ambulanter<br />
vor stationärer Hilfen festschrieb und damit das Wahlrecht einschränkte, was 1996 noch<br />
dahingehend verschärft wurde, dass nun stationäre Hilfe zu gewähren ist, wenn ambulante<br />
Hilfe mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden und stationäre Hilfe zumutbar<br />
ist. Eine weiter Beschränkung beinhalten § 3 Abs.1 S.2 und Abs. 2 S.2 BSHG im<br />
Hinblick auf stationäre Hilfen. Die Prüfung der Angemessenheit im Rahmen des § 3<br />
BSHG bezieht sich auf den sozialhilferechtlichen Bedarf und seine Bestimmung im Einzelfall.<br />
Der Mehrkostenvorbehalt bezieht sich auf die Deckung dieses Bedarfs, wobei<br />
hier eine restriktive Auslegung geboten ist und es keine absolute Obergrenze geben<br />
darf.<br />
Bei der Frage nach der Individualisierung ist bei Eingliederungshilfemaßnahmen ebenfalls<br />
§ 46 BSHG zu beachten, der die Aufstellung eines Gesamtplans vorschreibt und<br />
hierbei den behinderten Menschen zur Verwirklichung seiner Rechte beteiligen muß.<br />
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)<br />
Ebenso wie in der Sozialhilfe ist das Wunsch- und Wahlrecht traditionell in der Kinder -<br />
und Jugendhilfe verankert. § 5 SGB VIII regelt das Recht der Leistungsberechtigten,<br />
zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen und Wünsche<br />
hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern, denen entsprochen werden soll, soweit<br />
dies nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist. Auch hier besteht also<br />
der Konflikt zwischen dem Gebot der individuellen Leistungserbringung und dem Gebot<br />
der wirtschaftlichen Leistungserbringung.<br />
Dabei gilt das Wahlrecht nach § 5 SGB VIII nicht nur <strong>für</strong> Angebote verschiedener Träger,<br />
sondern auch zwischen verschiedenen Angeboten des gleichen Trägers. Dabei ist<br />
zuerst die Geeignetheit des Angebots zu prüfen und anschließend die Erfüllung des<br />
43
Wunschrechts, sowie der Mehrkostenvorbehalt. Das Wunschrecht bezieht sich im Unterschied<br />
zum Wahlrecht auf die nähere Ausgestaltung der Hilfe , die Personen, Inhalte,<br />
Methoden, Arbeitsformen und die äußeren Rahmenbedingungen der Leistung bezieht.<br />
Erheblich stärker als im BSHG hat der Gesetzgeber das Individualisierungsprinzip im<br />
SGB VIII durch das vorgeschriebene individuelle Hilfeplanverfahren implementiert. Dabei<br />
soll durch die Beteiligung der leistungsberechtigten Sorgeberechtigten, aber auch<br />
der Kinder und Jugendlichen nicht nur eine bessere Verfahrensposition <strong>für</strong> diese geschaffen<br />
werden, sondern es geht um die Verbesserung der Qualität der Hilfeleistung, in<br />
dem Sinne , wie es die Tagungsbroschüre andeutet, dass nämlich in aller Regel die Betroffenen<br />
die eigentlichen Experten <strong>für</strong> ihre Probleme und die möglichen Lösungswege<br />
sind und erzieherische Hilfen gegen den Willen der Betroffenen nicht geeignet im Sinne<br />
des Gesetzgebers sein können. Das in § 36 Abs.1 S. 3 u. 4 SGB VIII festgelegte<br />
Wunsch - und Wahlrecht ist daher auch stärker ausgeformt , als das allgemeine nach §<br />
5 SGB VIII. Einerseits dadurch , dass eben neben den Leistungs-berechtigten auch die<br />
Kinder und Jugendlichen zu beteiligen sind und dadurch, dass § 36 eine "Muß"- Vorschrift<br />
ist im Unterschied zu § 5, der eine "Soll"-Regelung enthält, also Ausnahmen zuläßt.<br />
SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)<br />
Das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten ist auch im SGB IX als Muß-<br />
Vorschrift festgehalten, um die Eigenverantwortlichkeit und das Selbstbestimmungsrecht<br />
behinderter Menschen zu stärken. Nach § 9 Abs. 1 S. SGB IX ist bei der Entscheidung<br />
über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zu Teilhabe den<br />
berechtigten Wünschen der Leistungsempfänger zu entsprechen. Dies gilt <strong>für</strong> alle Behinderten<br />
also auch <strong>für</strong> geistig und psychisch Behinderte und soll neben der Stärkung<br />
der Selbstbestimmung auch zur Motivation und zur Förderung der Tragfähigkeit familiärer<br />
Bindungen beitragen.<br />
5.2.2 Der Hilfeplan<br />
Das Wunsch- und Wahlrecht ist ein klassisches Instrument, mit dessen Hilfe der Gesetzgeber<br />
der Individualisierung - ich will gar nicht sagen der Selbststeuerung - Rechnung<br />
zu tragen. Ein weiteres Instrument des Gesetzgebers in der Sozialgesetzgebung<br />
zur Förderung der Individualisierung ist der Hilfeplan.<br />
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)<br />
Der Hilfeplan ist am stärksten ausgeprägt im § 36 SGB VIII, der zwingend vorschreibt,<br />
dass Kinder und Jugendliche sowie deren Personensorgeberechtigten, also in der Regel<br />
die Eltern, an der Aufstellung eines Hilfeplanes zu beteiligen sind. Darüberhinaus ist neben<br />
dem Jugendamt jeder, der zum Gelingen der Entwicklung einer Zukunftsperspektive<br />
<strong>für</strong> das Kind einen Beitrag leisten könnte, beteiligt, vielleicht der Träger einer Maßnahme,<br />
Lehrer, Erzieher und andere. Dass im Rahmen der Aufstellung und der Durchführung<br />
des Hilfeplanes die Wünsche der Kinder und Jugendlichen bzw. der Eltern in<br />
besonderer Weise zu berücksichtigen sind, ist eine besondere Ausformung des<br />
Wunsch- und Wahlrechts im SGB VIII.<br />
44
Bundessozialhilfegesetz<br />
Auch im BSHG ist ein Hilfeplan vorgesehen, aber nur im Bereich der Eingliederungshilfe,<br />
das heißt bei Maßnahmen <strong>für</strong> behinderte Menschen. Es gibt keine Verpflichtung zur<br />
Erstellung eines Hilfeplans z.B. <strong>für</strong> jugendliche Arbeitslose oder <strong>für</strong> Kinder die von der<br />
Sozialhilfe leben. Das heißt im BSHG ist diese Vorschrift lediglich bezogen auf die Personengruppe<br />
der behinderten Menschen, die dann auch an der Erstellung des Plans<br />
beteiligt werden müssen. Meine Erfahrungen in diesem Bereich sind aber erheblich<br />
schlechter als im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere bei der Umsetzung<br />
der Beteiligung in der Praxis. Schon allein deshalb, weil die Auswahlmöglichkeiten z.B.<br />
in der Stadt Emden, aus der ich komme, mit ca. 50.000 Einwohner nicht so breit sein<br />
können, dass von einer wirklichen Ausübung eines Wunsch- und Wahlrechts oder einer<br />
Aufstellung eines individuellen Gesamtplans die Rede sein kann.<br />
SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen)<br />
Das SGB IX hat einen Hilfeplan nicht vorgesehen. Ich denke, dass das nicht vergessen<br />
oder übersehen worden ist, sondern dass das damit zusammenhängt, dass das SGB IX<br />
eine Art vorgeschaltetes, also eine Art Klammergesetz ist, welches vor allem Maßnahmen<br />
aus anderen Gesetzen koordinieren soll. Wir haben im SGB IX zwar nicht die Verpflichtung,<br />
den Hilfeplan <strong>für</strong> einzelne Personen zu erstellen, aber die Rehabilitationsträger<br />
haben die Pflicht, die Leistungen der verschiedenen Rehabilitationsträger, der<br />
Krankenkassen und der Sozialhilfeträger zu koordinieren. Von einer Beteiligung der<br />
behinderten Menschen ist dort aber nicht die Rede. Das heißt im Einzelfall muss man<br />
wieder auf Spezialgesetze zurückgreifen. Das sind die beiden klassischen Instrumente,<br />
nämlich das Wunsch- und Wahlrecht und der Hilfeplan, den das BSHG vorsieht.<br />
Mit einem Blick auf die Uhr möchte ich noch kurz auf eine Besonderheiten eingehen,<br />
nämlich das sogenannte persönliche Budget im SGB IX, was ja sehr viel diskutiert worden<br />
ist und jetzt als ein mögliches Instrument <strong>für</strong> die Selbststeuerung der Klienten gegeben<br />
ist. Wenn man sich allerdings anschaut, was im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens<br />
aus der ursprünglichen Idee geworden ist, dann muss man Bedenken bekommen,<br />
ob diese wirklich umgesetzt worden ist. Das persönliche Budget ist insofern eine Neuerung<br />
als das Rehabilitationsrecht klassischer Weise nur sogenannte Sachleistungen<br />
vorsieht. Es gibt davon einige wenige Ausnahmen, z.B. gibt es im Pflegeversicherungsrecht<br />
die Geldleistung statt der Sachleistung, wobei diejenigen die die Geldleistung annehmen,<br />
bestraft werden, weil die Geldleistung bei gleicher Pflegestufe nämlich erheblich<br />
niedriger ist als die Sachleistung. Wir haben auch in anderen Bereich, z.B. im BSHG<br />
die pauschale Geldleistung, die es als Regelsatz jeden Monat <strong>für</strong> die Sozialhilfeberechtigten<br />
gibt.<br />
Die Besonderheit im neuen SGB IX sollte sein, dass im Bereich der sozialen Rehabilitation<br />
zur Erreichung des Ziels der gleichberechtigten Teilhabe der Menschen an der Gesellschaft,<br />
Geldbeträge zur Verfügung gestellt werden sollten, mit denen die Behinderten<br />
wirklich selbständig, selbststeuernd und selbstbestimmt umgehen können.<br />
Wenn man sich jetzt den Gesetzestext anschaut, dann wird man sehen, dass es da<br />
doch erhebliche Einschränkungen gibt. Zum einen deshalb, weil diese Geldleistung<br />
45
nach dem Gesetzestext nur dann erbracht werden kann, wenn die Leistung hierdurch<br />
voraussichtlich bei gleicher Wirksamkeit wirtschaftlich zumindest gleichwertig ausgeführt<br />
werden kann. Es wird also verglichen, was kann der Rehabilitationsträger anbieten, was<br />
kostet das, welche Wirkung hat das voraussichtlich. Und wenn wir jetzt dem behinderten<br />
Menschen das Geld geben, ist er oder sie dann in der Lage, mit dem gleichen Budget,<br />
das der Rehabilitationsträger verbrauchen würde, die gleiche Wirkung zu erzielen. Darüber<br />
hinaus wird den behinderten Menschen die Beweislast <strong>für</strong> diese voraussichtliche<br />
Wirksamkeit übertragen und verpflichtet, dem Rehabilitationsträger geeignete Unterlagen<br />
hierzu zur Verfügung zu stellen. Ich bin ganz gespannt, wie sich das in der Praxis<br />
darstellen wird.<br />
Ich denke dass bei uns in Deutschland bei der Frage nach den Budgets <strong>für</strong> behinderte<br />
Menschen zur gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft sehr deutlich wird, mit<br />
wieviel Misstrauen diese Diskussion belastet ist und dass noch weitgehend die Annahme<br />
verbreitet ist, dass man die Entscheidung über die richtige Verwendung des Geldes<br />
den behinderten Menschen eben doch nicht überlassen kann. Frau Reitsma wird uns<br />
nachher darüber berichten, ob solche Be<strong>für</strong>chtungen aus niederländischer Sicht richtig<br />
sind, denn dort werden die persönlichen Budgets nur teilweise gebunden, aber teilweise<br />
auch ganz ungebunden an die Klientinnen und Klienten weitergegeben. Wir werden ja<br />
nach dem Mittagessen hören, wie es die Niederländer machen. Ich glaube die sind da<br />
schon ein ganzes Stück weiter als wir. In England gibt es die sogenannten "peergroups"<br />
, das heißt also Gruppen von Betroffenen, die sich in solchen Fragen gegenseitig<br />
unterstützen und die miteinander ihre Interesse vertreten. Der Staat stellt auch Geld<br />
da<strong>für</strong> zur Verfügung, dass diese Betroffenen sich fortbilden können, um sich dann tatsächlich<br />
mit guter Qualität beraten und unterstützen zu können. Wir können in diesem<br />
Punkt noch viel von unseren Nachbarn im europäischen Ausland lernen und ich wünsche<br />
uns allen, dass wir mit noch viel mehr Vertrauen in die Kompetenzen der Klientinnen<br />
und Klienten an diesen Themen weiterarbeiten.<br />
Vielen Dank <strong>für</strong> Ihre Aufmerksamkeit.<br />
46
6. Das persönliche Budget - Selbststeuerung der Klienten/innen<br />
zwischen Selbstbedienung und Mitverantwortung<br />
<strong>für</strong> die eigene Zukunft: Erfahrungen aus der Niederländischen<br />
Behindertenhilfe - Liesbeth Reitsma<br />
Liesbeth Reitsma, Per Saldo (Vereinigung van Budgethouders), Utrecht (NL)<br />
Meine Damen und Herren,<br />
zuerst möchte ich den Organisatoren dieses Kongresses danken <strong>für</strong> die mir gebotene<br />
Gelegenheit, hier in meiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied von "Per Saldo" und ebenfalls<br />
Budgetinhaber, zu Ihnen über das Personengebundene Budget zu sprechen.<br />
Das Personengebundene oder kürzer das Persönliche Budget will ich Ihnen aus den<br />
gesundheitspolitischen Entwicklungen in den Niederlanden und dem Algemene Wet Bijzondere<br />
Ziektekosten, AWBZ, heraus erläutern. Dieses Gesetz regelt die Sonderleistungen<br />
der Krankenversicherungen <strong>für</strong> die sogenannten unversicherbaren Risiken chronisch<br />
kranker, behinderter und alter Menschen.<br />
Auf folgende Punkte gehe ich dabei näher ein:<br />
1. Gesundheitspolitische Entwicklungen in den Niederlanden.<br />
2. Die Indikation; Zutritt zum System von Vorkehrungen.<br />
3. Eignet sich das Persönliche Budget <strong>für</strong> jeden?<br />
4. Das Prinzip des Persönlichen Budgets.<br />
5. Die Organisation des PB heute.<br />
6. Neue Regeln ab dem ersten <strong>Jan</strong>uar 2002.<br />
7. Unsere Zusammenarbeit mit den politischen Parteien und den Ministerien.<br />
8. Zukunftsaussichten <strong>für</strong> das persönliche Budget.<br />
9. Aufgaben und Zukunft des Vereins der Budgetinhaber "Per Saldo".<br />
6.1 Gesundheitspolitische Entwicklungen in den Niederlanden<br />
In den Niederlanden unterscheidet man im Gesundheitswesen drei Stufen. Die wichtigste<br />
Person in der ersten Stufe ist der praktische Arzt oder Hausarzt. Er gilt als Torhüter<br />
des Gesundheitswesens. Auf der zweiten Stufe stehen die Spezialisten, die ihre Praxis<br />
fast ausschließlich in Krankenhäusern ausüben, zum Teil als Angestellte, aber größtenteils<br />
als freie Unternehmer. Auf der dritten Stufe befinden sich die Superspezialisten in<br />
den Universitätskrankenhäusern.<br />
Alle Krankenversicherungen bieten großzügig bemessene Leistungen an. Pflichtversichert<br />
sind alle Lohn- und Rentenempfänger, deren Einkommen unter der sogenannten<br />
Wohlstandsgrenze liegt. Das sind etwa 70% der Bevölkerung. Die Versicherungsbeiträ-<br />
47
ge werden über die Sozialabgaben vom Lohn oder der Rente einbehalten. Alle anderen<br />
müssen sich privat versichern, auch freie Unternehmer. Die Privatversicherungsbeiträge<br />
werden von den Versicherten direkt an die Versicherungen gezahlt.<br />
Die Beiträge <strong>für</strong> das AWBZ, das allgemeine Gesetz zu den Sonderleistungen, werden<br />
mit den Versicherungsbeiträgen einbehalten oder gezahlt. Sie sind kürzlich erhöht worden.<br />
Die Staatskasse steuert nur 0,4% der Gesamtkosten der Gesundheits<strong>für</strong>sorge bei.<br />
Zusätzlich zu den Standardleistungen kann man sich weiter versichern. Einige Leistungen<br />
müssen vollständig aus eigenen Mitteln bezahlt werden. Bei einigen anderen Leistungen,<br />
wie häuslicher Pflege, psychologischer Betreuung, alternativen Therapien, einigen<br />
Medikamenten, Physiotherapie und anderen mehr, muss zur Versicherungsleistung<br />
eine einkommensabhängige Selbstleistung erbracht werden. Diesen Betrag nennt man<br />
in den Niederlanden das "Bremsgeld", weil der Staat hiermit den Gebrauch der Bürger<br />
von Dienstleistungen des Gesundheitswesens abbremsen will. Das Bremsgeld stellt allerdings<br />
<strong>für</strong> viele <strong>Familie</strong>n eine bedeutende extra Belastung dar. Krank sein ist teuer,<br />
während häufig durch Arbeitsausfall auch noch das Einkommen zurückgeht und das<br />
Krankengeld nur 70% des Lohnes beträgt. Arbeitgeber können die fehlenden 30 % freiwillig<br />
zuschießen. Auch können sie <strong>für</strong> diesen Betrag eine Sonderversicherung abschließen.<br />
Wie Sie sehen sind in den Niederlanden die goldenen Zeiten Vergangenheit geworden.<br />
"Die Bäume wachsen nicht mehr in den Himmel", wie ein früherer Minister-Präsident das<br />
so treffend beschrieb.<br />
Im Rahmen der Europäischen Zusammenarbeit wurde im Vertrag von Maastricht und<br />
später in Amsterdam beschlossen, das Gesundheitswesen innerhalb der Länder der<br />
Europäischen Union zu nivellieren. Als Folge davon wurde das weithin so gepriesene<br />
Gesundheitswesen der Niederlande stark zurückgeschnitten. Den Krankenhäusern wurde<br />
der Etat gekürzt, die häusliche Pflege wurde kräftig eingeschränkt.<br />
Positiv zu bewerten ist die den Einrichtungen gemachte Auflage, ihre Verwaltung durchschaubar<br />
zu machen und die Höhe ihrer Ausgaben zu verantworten.<br />
Versicherungsträger und Einrichtungen hatten zum Teil große Geldreserven angelegt.<br />
Die mussten nun angesprochen werden, was durchaus in Ordnung ist. Schließlich handelt<br />
es sich um öffentliche Gelder, mit denen auf dem Kapitalmarkt spekuliert wurde. Die<br />
Einrichtungen dürfen 10 % in Reserve halten, um eventuelle finanzielle Einbußen auffangen<br />
zu können.<br />
Viele der politischen Maßnahmen haben zu großer Unruhe unter Arbeitnehmern im Gesundheitswesen<br />
und bei den Bürgern geführt.<br />
Das Entstehen von Wartelisten<br />
Die eher erwähnten Veränderungen sind zum Teil Ursache zunehmender Wartezeiten<br />
<strong>für</strong> Behandlungen in Krankenhäusern. Sie haben zweifellos von der Abwanderung von<br />
Personen mit einer hohen Ausbildung in andere Länder gehört. Gleichzeitig lassen sich<br />
gutbetuchte Herzkranke in Amerika operieren, und <strong>für</strong> Knieoperationen reist man ins<br />
sonnige Spanien.<br />
48
Patienten- und <strong>Senioren</strong>organisationen haben mit Hilfe gerichtlicher Urteile ein Recht<br />
auf Behinderten<strong>für</strong>sorge und häusliche Pflege erwirkt. Auf Grund dieser Urteile hat der<br />
Staat die Zuschüsse <strong>für</strong> diese Dienste aufgestockt.<br />
Aber es gibt mehr Ursachen <strong>für</strong> den großen <strong>Dr</strong>uck, unter dem das Niederländische Gesundheitswesen<br />
steht. Wegen ständig steigender Kosten wird der Zugang zu Diensten<br />
der zweiten und dritten Stufe erschwert werden. Aber Patienten sind mündiger geworden<br />
und Dank sei den Entwicklungen in der Informationstechnologie gut unterrichtet über<br />
weltweit neue Entdeckungen auf dem Gebiet der Medizin, und sie wollen die neuen<br />
Möglichkeiten auch ausschöpfen.<br />
Neue Therapiemöglichkeiten haben zu Diskussionen geführt, wie zum Beispiel über das<br />
Recht des Einzelnen auf Behandlung. Jede Einrichtung des Gesundheitswesens hat<br />
heutzutage <strong>für</strong> die Auseinandersetzung mit den zunehmend komplexen Problemen eine<br />
ethische Kommission. Hier untersucht man Fragen der Lebensqualität, berät man sich<br />
zu dem Problem des endlos Weiterbehandelns gegenüber der Akzeptanz des unvermeidlichen<br />
Endes. Weltweit wird noch lange diskutiert werden, und immer neu stellt sich<br />
die Frage, ob alles was möglich ist auch immer getan werden muss und was man unter<br />
Lebensqualität versteht.<br />
Patientenverbände haben erreicht, dass auf manchen Gebieten der Fürsorge den Wünschen<br />
der Bürger mehr Rechnung getragen wird. Kranke und <strong>Senioren</strong> wollen möglichst<br />
lange im eigenen Heim bleiben, unterstützt durch das notwendige Maß an Pflege,<br />
Betreuung und Hilfe im Haushalt. Hier geht es um Lebensqualität, und Fürsorge wird zu<br />
einer Sache der gesamten Gesellschaft. Die großen Pflegeheime, gut versteckt in waldreichen<br />
Gegenden verschwinden. Wohnexperimente kleinen Umfangs mit Pflegestationen<br />
im eigenen Stadtteil werden in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen.<br />
Auf diese Weise ermöglicht man <strong>für</strong> die Menschen mit kleinen Schönheitsfehlern mehr<br />
Integration und Beteiligung am gesellschaftlichen Leben.<br />
Menschen werden immer älter. Das bringt unweigerlich eine Steigerung des Konsums<br />
aller Formen von Sorge mit sich. Die niederländische Gesellschaft hat sich so sehr verändert,<br />
dass es nur noch selten möglich ist, <strong>für</strong> Pflege und Betreuung auf <strong>Familie</strong>nmitglieder<br />
zurück zu fallen: Die <strong>Familie</strong>n sind kleiner geworden, Kinder ziehen fort, Männer<br />
und <strong>Frauen</strong> stehen voll im Beruf und sind allein schon dadurch nicht in der Lage, Pflegeaufgaben<br />
zu erfüllen. Das Arbeitsrecht (das noch nicht endgültig beschlossen ist)<br />
räumt nur eine Kurze Zeit ein <strong>für</strong> Pflegeurlaub, bei dem dann 70 % des Gehaltes weitergezahlt<br />
wird.<br />
Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt also, während das Angebot an Pflegepersonal und<br />
Pflegebudgets zurückbleibt. Bei vielen Pflegebedürftigen führt das zu Einsamkeit und<br />
stillem Leid.<br />
Inzwischen hat sich ein neuer Markt entwickelt <strong>für</strong> wohlhabende <strong>Senioren</strong>. Luxuswohnungen<br />
mit einem reichhaltigen Angebot an Pflege- und Fürsorgemöglichkeiten werden<br />
gebaut. Die Wohnungen werden vermietet oder verkauft, immer mit hohen monatlichen<br />
Kosten <strong>für</strong> die besonderen Dienstleistungen.<br />
49
Die örtliche Umgebung<br />
Innerhalb jeder Gemeinde oder jeden Kreises gibt es einen Sozialdienst <strong>für</strong> <strong>Senioren</strong>,<br />
Behinderte und chronisch Kranke. Sie bieten Leistungen an wie "Tischlein deck dich",<br />
kleine handwerkliche Reparaturen im Haus, Fußpflege und Frisör in der eigenen Wohnung,<br />
alles gegen nur eine geringe Vergütung.<br />
Diese Leistungen werden zum großen Teil ehrenamtlich erbracht. Es wird leider aber<br />
immer schwieriger, genug Menschen zu finden, die noch auf längere Zeit bereit sind,<br />
sich <strong>für</strong> solche Tätigkeiten zu binden. Die Politik versucht dem entgegen zu wirken. Dieses<br />
Jahr wurde zum Beispiel zum "Jahr des ehrenamtlichen Mitarbeiters" ausgerufen,<br />
um die Bevölkerung auf ihre sozialen Aufgaben und Möglichkeiten aufmerksam zu machen.<br />
Die wichtigste Ursache am Mangel an freiwilligen Helfern ist die zunehmende Individualisierung<br />
in einer wirtschaftlich starken Gesellschaft. Außerhalb von Arbeit und<br />
<strong>Familie</strong> will man die Freizeit nicht durch feste Verpflichtungen einschränken. Viermal im<br />
Jahr Urlaubmachen findet man wichtiger. Die Pflegebedürftigen Mitbürger bleiben dabei<br />
auf der Strecke.<br />
Image des Gesundheitswesens<br />
Gegenüber den steigenden Bedürfnissen nach Pflege und Betreuung stehen gesundheitspolitische<br />
Sparmaßnahmen. Der Reiz, eine Laufbahn im Gesundheitswesen zu suchen,<br />
nimmt ab. Personalmangel, zunehmende Belastung des verbleibenden Personals<br />
und eine schlechte Presse entmutigen außerdem junge Leute, eine Ausbildung <strong>für</strong> einen<br />
Beruf in diesem Sektor zu machen. In vielen Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern<br />
und Pflegeheimen, führt dies zu erhöhtem Arbeitsausfall durch Krankheit.<br />
Der Staat versucht dem mit Gehaltserhöhungen entgegen zu wirken, jedoch ohne Erfolg.<br />
Ebenso erfolglos sind die Versuche Personal aus dem Ausland an zu werben, weil<br />
entweder die Ausbildung unzureichend ist oder die Kenntnis der niederländischen Sprache<br />
fehlt, und sprachliche Kommunikation ist in diesen Berufen unabdingbar.<br />
Ausbildungen<br />
Staatliche Sparmaßnahmen treffen auch Universitäten und Hochschulen. Für etliche<br />
Studienrichtungen hat man einen Numerus Fixus eingeführt, was in einigen Jahren zu<br />
einem jetzt schon vorhersehbaren Mangel an Hausärzten und Zahnärzten führen wird.<br />
Schon seit Jahren fehlen Augenärzte und Orthpäden. Für einige Ausbildungen hat man<br />
das Quotum inzwischen wieder erhöht. Die steigende Tendenz, medizinische Leistungen<br />
der zweiten und dritten Stufe in die Richtung der ersten zu verschieben kann dort<br />
nur zu weiterer Belastung und Personalmangel führen. Besonders betroffen sind hiervon<br />
die großen Städte.<br />
Engpässe<br />
Es gibt einige große Gruppen von Sorgebedürftigen, die aus dem Netz von Maßnahmen<br />
ausgeschlossen sind. Viele psychisch Kranke leben buchstäblich auf der Straße oder<br />
fristen ein mühseliges Dasein in kleinen, von Pflegepersonal unzureichend unterstützten<br />
50
Wohngruppen. Will man psychisch Kranke wirkungsvoll resozialisieren, müssen die verfügbaren<br />
Zuschüsse drastisch aufgestockt werden.<br />
Bürgerinnen und Bürger lassen Ihre Forderungen in der Politik auch hören, aber dort<br />
wird noch allzu oft anders entschieden, trotz großen Wohlstandes und einer gut gefüllten<br />
Staatskasse. Die Extraleistungen, die dem Gesundheitswesen bis jetzt zugewiesen<br />
wurden sind unzureichend und können die Lage nicht verbessern, solange der Personalmangel<br />
bleibt.<br />
Poldermodell und Dezentralisation<br />
Die Niederlande haben sich <strong>für</strong> eine Landespolitik auf Abstand entschieden. Gesellschaftliche<br />
Einrichtungen wie Krankenversicherungsträger, Leistungsträger, Provinz-<br />
und Gemeindeverwaltungen, Gewerkschaften und Patientenverbände müssen an einem<br />
Strick ziehen, um die von der Staatskasse bewilligten Gelder zu verteilen und Planungsmodelle<br />
<strong>für</strong> die Zukunft zu erstellen. Auch Absprachen über Umfang, Preis, Qualität<br />
und Mitspracherecht müssen auf dieser Ebene getroffen werden.<br />
Netzwerke<br />
In jeder Stadt oder jedem Kreis muss es ein Forum von Betroffenen geben, das als Mitsprachegremium<br />
nach Verabredung mit der Gemeindeverwaltung die politischen Maßnahmen<br />
und die Ausgaben <strong>für</strong> das Gesundheitswesen kritisch beobachtet. Auch die Sozialleistungen<br />
werden von dort aus geprüft. Das Provinzialforum sammelt und analysiert<br />
die Ergebnisse, die aus den Gemeinden kommen, stellt Vergleichungen an und informiert<br />
die Bürger, die Zentralregierung und die Patientenverbände.<br />
Die nationale Dachorganisation von Chronisch Kranken und Körperbehinderten, der<br />
"Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad", kurz "CG-Raad" und die Dachorganisation<br />
<strong>für</strong> alle Patienten- und Behindertenverbände, die "Föderation der niederländischen Patienten-<br />
und Konsumentenverbände", in deren Vorstand ich sitze, leiten auf nationaler<br />
Ebene die Verhandlungen mit Vertretern der Landespolitik. So entsteht ein flächendeckendes<br />
Netzwerk. Diese Arbeit erfordert ein großes Maß an Einsatz der Vorstände<br />
aller Patienten-, Behinderten- und <strong>Senioren</strong>verbände. Alle Vorstandsmitglieder arbeiten<br />
ehrenamtlich. Nur die Mitarbeiter der Büros werden aus den mäßig fließenden staatlichen<br />
Zuschüssen entlohnt.<br />
Neuordnung des Gesundheitswesens und eine allgemeine Basisversicherung<br />
In der 2002 beginnenden neuen Legislaturperiode wollen die politischen Parteien das<br />
Gesundheitswesen reformieren. Der Plan <strong>für</strong> die Modernisierung des "Allgemeinen Gesetzes<br />
zu den Sonderleistungen der Krankenkassen" wurde am 3. Juli diesen Jahres<br />
vom Gesundheitsministerium der Öffentlichkeit vorgestellt.<br />
Die Bürger des Landes müssen in den kommenden Monaten mit Hilfe einer umfangreichen<br />
Kampagne umfassend über die Neuerungen, über ihre Rechte und Pflichten in<br />
diesem Zusammenhang, aufgeklärt werden.<br />
51
Ich hoffe, Ihnen so in großen Zügen einen Einblick in das niederländische Gesundheitswesen<br />
gewährt zu haben, in die jüngsten Entwicklungen und die Erwartungen <strong>für</strong> die<br />
Zukunft.<br />
Im Folgenden gehe ich näher auf die Regelungen ein, <strong>für</strong> den Zugang zu Gesundheitseinrichtungen<br />
im Allgemeinen und zum Erwerb des Persönlichen Budgets im Besonderen.<br />
6.2 Indikation - Zugang zu den Pflegeleistungen<br />
Die Indikation<br />
Ehe man Langzeitpflege beanspruchen kann, muss nach dem AWBZ (Allgemeines Gesetz<br />
zu Sonderleistungen) und dem WVG (Gesetz zu Sonderleistungen <strong>für</strong> Behinderte)<br />
durch eine Indikationskommission geprüft werden, ob eine Pflegeleistung oder ein<br />
Hilfsmittel zugewiesen werden kann. Die Kommission erstellt eine Indikationsempfehlung.<br />
Dabei wird vom Antragsteller angegeben, ob er Hilfe in Form von Sachleistungen<br />
oder ein Persönliches Budget in Anspruch nehmen will. Im zweiten Fall wird er über<br />
Möglichkeiten und Regeln des PB unterrichtet.<br />
Die Organisation der Ausführung<br />
Im Augenblick liegt die Verantwortung <strong>für</strong> die Indikationskommissionen bei den Gemeinden.<br />
Häufig fehlt es da an der nötigen Kenntnis der Materie, und man delegiert die Aufgaben<br />
an Pflegeeinrichtungen. Man ist sehr bemüht, die Indikationsregeln besser zu<br />
gestalten. Gesprächsprotokolle wurden erstellt, und Personal wurde hierzu geschult.<br />
Wissenszentren wurden eingerichtet, wo man Informationen über Hilfsmittel, Krankheiten<br />
und ihre Folgen und vieles mehr einholen kann. Indikationsorgane sollen in Zukunft<br />
größere Gebiete bedienen. Noch nicht voll geklärt ist die Frage nach der zuletzt verantwortlichen<br />
Instanz <strong>für</strong> diese kräftigen Indikationsorgane. Bis jetzt sind es nach dem Gesetz<br />
noch die Gemeinden. Man denkt <strong>für</strong> die Zukunft eher an größere Verbände.<br />
Warum all diese Reformen?<br />
Ganz zu Anfang war die Indikation eine Aufgabe der Pflege- und Hilfsorganisationen.<br />
Die Folgen lassen sich raten: dem Antragsteller wurde zugewiesen, was die Organisation<br />
gerade an Leistung zu bieten hatte, die wirklichen Bedürfnisse wurden hintangestellt,<br />
während sie doch Ausgangspunkt einer unabhängigen, objektiven und umfassenden<br />
Indikation sein sollten. Die Indikation sollte, um es mit ein paar Modewörtern zu sagen,<br />
"fragegesteuert" und "fragegerecht" durchgeführt werden.<br />
Der Indikationsbeschluss<br />
Mit der Indikationsempfehlung geht der Antragsteller zur Verwaltungsstelle seiner Krankenversicherung,<br />
wo ein Indikationsbeschluss gefasst wird.<br />
52
6.3 Das Organisieren der eigenen Pflegeleistungen<br />
Mit dem Indikationsbeschluss wendet man sich an einen Hilfs- und Pflegedienst, an eine<br />
Hauspflegestation, eine andere Einrichtung oder an einen selbständig arbeitenden Pfleger<br />
oder an eine Maatschaft.<br />
Will der Antragsteller seine Hilfe mit einem Persönlichen Budget verwirklichen, muss er<br />
mit einer selbständig arbeitenden Person einen Pflegevertrag abschliessen.<br />
Benötigt man andere Maßnahmen, zum Beispiel Transport, Hilfsmittel, Änderungen in<br />
der Wohnung, einen Rollstuhl oder Rollator, dann wendet man sich an die entsprechende<br />
Stelle der Gemeindeverwaltung, wo diese Leistungen aus Mitteln des eher erwähnten<br />
Behindertengesetzes (WVG) realisiert werden.<br />
Wie Sie sehen, müssen Leistungsberechtigte noch immer viele Behördengänge machen,<br />
ehe sie endlich ihren Leistungsanspruch erfüllt kriegen.<br />
Nach- und Neuindikation<br />
Periodisch müssen Indikationen neu beurteilt werden. Treten beim Betroffenen zwischenzeitlich<br />
Veränderungen im Leistungsbedürfnis ein, kann er eine Neuindikation beantragen.<br />
Da der Zugang zu den Hilfeleistungen durch alle Regelungen von der Indikation bis zum<br />
Leistungsvertrag ziemlich lang ist, hat man <strong>für</strong> Notfälle gesondert Absprachen mit den<br />
Versicherungen und den Gemeinden gemacht.<br />
Beschwerde und Berufung<br />
Der Antragsteller hat die Möglichkeit, gegen eine Indikationsempfehlung oder einen Indikationsbeschluss<br />
bei einer unabhängigen Kommission in Berufung zu gehen. Gegen<br />
den Spruch der Berufungskommission kann innerhalb von sechs Wochen beim Amtsrichter<br />
Beschwerde eingereicht werden.<br />
Die Urteile der Amtsgerichte werden von Juristen mit großem Interesse registriert und<br />
ausführlich in der Fachpresse besprochen.<br />
Ob dem Antragsteller letztendlich mit diesen langen Prozeduren gedient ist, ist eine offene<br />
Frage. Häufig sieht er davon ab, weil ihm der Mut, die Energie und das Durchhaltevermögen<br />
<strong>für</strong> den langen Rechtsgang fehlen.<br />
6.4 Das Prinzip des Persönlichen Budgets<br />
Körperbehinderte, chronisch Kranke, geistig Behinderte und <strong>Senioren</strong>, die <strong>für</strong> mehr als<br />
drei Monate ein Pflege- und Betreuungsbedürfnis haben, wollen Hilfe, die ihren persönlichen<br />
Umständen gerecht wird: selbst seine Kinder erziehen, arbeiten oder erneut in ein<br />
Arbeitsverhältnis eintreten, studieren, Hobbys und ehrenamtlicher Tätigkeit nachgehen,<br />
zum Beispiel in einer Patientenorganisation.<br />
53
Es ist auffallend, dass in unserer Wohlstandsgesellschaft Behinderten ein aktives Teilnehmen<br />
am gesellschaftlichen Leben kaum zugebilligt wird. Auch bietet man zu wenig<br />
Möglichkeiten, die am besten geeigneten Hilfeleistungen selbst zu wählen. Das Angebot<br />
der regulären Hilfs- und Pflegedienste ist unzureichend auf die Bedürfnisse ihrer Klienten<br />
ausgerichtet. Kurzum: Hilfs- und Pflegeorganisationen sind den gesellschaftlichen<br />
Entwicklungen nicht gefolgt. Die ambulanten Pflegedienste fordern zum Beispiel von<br />
ihren Klienten, dass sie während der Leistungserbringung zu Hause sein müssen. Auch<br />
kommt es regelmäßig vor, dass Pflegepersonal der Hauspflegeorganisation einen Tag<br />
um acht Uhr morgens erscheint und am nächsten erst um elf Uhr. Durch einen derartigen<br />
Mangel an zuverlässigen Absprachen kann man zum Beispiel nicht rechtzeitig an<br />
seiner Arbeitsstelle erscheinen. Das kann zu Konflikten mit dem Arbeitgeber, ja schließlich<br />
zur Entlassung führen.<br />
Noch allzu oft werden chronisch Kranke, Behinderte und <strong>Senioren</strong> zu Pflegeobjekten<br />
reduziert und als Patienten betrachtet statt als Mitbürger. Ihr Pflegeplan wird zum Lebensplan<br />
erklärt.<br />
Der Protest der Betroffenen wurde deutlich hörbar und führte schließlich zur Entwicklung<br />
des Personengebunden Budgets als Alternative zu den regulären Hilfs- und Pflegediensten.<br />
Zu Unrecht wird gelegentlich gedacht, das Persönliche Budget sei zur Kostenreduzierung<br />
erfunden worden. Der eigentliche, auch von der Politik getragene Grund<br />
war der ständige Einbruch des herkömmlichen Systems in das Privatleben der Leistungsberechtigten.<br />
Hat eine Person ein umfassendes Pflegebedürfnis, dann kann es geschehen, dass von<br />
der Hauspflegestation bis zu dreißig verschiedene Personen in einer Woche in das<br />
Haus dieser Person kommen, die jeder eine Teilaufgabe erfüllen. Das Privatleben des<br />
Pflegeempfängers und seiner Hausgenossen wird hierdurch gravierend gestört.<br />
Setzt sich dieser Zustand über Jahre hinweg fort, kann das ernste Folgen haben.<br />
Mit diesem Hintergrund taten sich vor fünfzehn Jahren einige <strong>Frauen</strong> und ein Mann<br />
zusammen, um sich erst einmal gegenseitig ihre Not zu klagen und dann gemeinsam<br />
nach innovativen Ideen zu suchen <strong>für</strong> eine bessere Form von Hilfeleistung. Ich gehörte<br />
damals auch zu dieser Gruppe. Wir besuchten die Vereinigten Staaten, Dänemark und<br />
Norwegen, um zu sehen, welche Wege man dort mit Pflegebudgets eingeschlagen hatte.<br />
Die Stiftung "Independent Living" in Amerika kam mit ihren Ideen der Gestaltung unserer<br />
Wünsche am nächsten.<br />
Zur gleichen Zeit kam eine Gruppe von Eltern geistig behinderter Kinder zusammen, um<br />
nach einer Lösung <strong>für</strong> ähnliche Probleme zu suchen.<br />
Ideen allein reichen natürlich nicht aus. Es galt auch, andere zu überzeugen. Es musste<br />
verhandelt werden. In Den Haag musste eine Lobby gebildet werden zur Beeinflussung<br />
der Mitglieder der Gesundheitskommission des Parlaments, zur Einflussnahme bei den<br />
politischen Parteien, den Versicherungsträgern, der Gewerkschaften und nicht zuletzt in<br />
den eigenen Reihen. Die neugewonnen Einsichten mussten pausenlos verteidigt werden:<br />
Hilfe nach Maß, Verstärkung der Position der Leistungsberechtigten, Emanzipation.<br />
Erst mit einem Persönlichen Budget ist man imstande sein Leben selbst zu gestalten,<br />
54
selbst bestimmen, wen man zur ganz intimen Körperpflege und am Bett zulassen will.<br />
Pflegepersonal denkt allzu häufig nicht darüber nach, was das <strong>für</strong> den Pflegebedürftigen<br />
bedeutet. Sie tun die Arbeit oft schon lange, und begreifen gar nicht, dass der Klient<br />
Wünsche haben könnte über die Art und Weise in der die Hilfe gegeben wird und dass<br />
ein Leistungsempfänger sein Recht auf Integrität seiner Person und seines Privatlebens<br />
respektiert wissen möchte. Reguläre Pflegestationen haben ihre eigenen, oft ungeschriebenen<br />
Regeln nach denen ihr Personal sich richten muss.<br />
Als Budgetinhaber ist man selbst Arbeitgeber und kann sein Personal nach eigenen<br />
Wünschen und Ideen handeln lassen, das häufig begeistert ist über diese Form der Arbeit:<br />
sie dürfen selbst mitdenken über die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit tun. Der<br />
Leistungsempfänger ist jetzt der Chef. Diese Art der Hilfe kann natürlich nur im guten<br />
Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Pflegepersonal funktionieren.<br />
Das Prinzip des Persönlichen Budgets ist also:<br />
� Das Persönliche Budget ist ein Geldbetrag, mit dem man eigenes Personal einstellen<br />
kann.<br />
� Das PGB ist ein wichtiges Instrument, dass den Inhaber befähigt, die eigenen Möglichkeiten,<br />
durch massgenaue Hilfe zu erwerben, optimal aus zu schöpfen.<br />
� Das Persönliche Budget garantiert eine qualitativ bessere Leistung.<br />
Das Persönliche Budget lässt sich folgendermassen zusammenfassen:<br />
Der Budgetinhaber kann seinen persönlichen Lebensplan verwirklichen, wobei:<br />
� Er selbst über Form, Umfang und Ort der Leistungserbringung bestimmt und entscheidet,<br />
wer die Leistungen erbringt;<br />
� er selbst verantwortlich ist <strong>für</strong> die getroffenen Entscheidungen;<br />
� seine Eigenart und Unabhängigkeit gewahrt bleiben;<br />
� er <strong>für</strong> geleistete Dienste kein "Dankeschön" mehr zu sagen braucht.<br />
Jeder, der <strong>für</strong> längere Zeit auf intensive Pflege angewiesen war, kann sich in diesen<br />
Punkten wiedererkennen. Es ist nicht leicht zu akzeptieren, dass andere in Ort, Form<br />
und Inhalt über Dein Leben bestimmen können. Die Regie über das eigene Leben in<br />
Händen behalten bedeutet Eigenverantwortung tragen zu wollen und zu können.<br />
6.5 Ist das Persönliche Budget <strong>für</strong> Jedermann geeignet ?<br />
Grundsätzlich eignet sich das Persönliche Budget <strong>für</strong> jeden, der auf Langzeithilfe angewiesen<br />
ist. Man hat in jedem Fall die Freiheit zwischen einem Budget oder einem Kollektivangebot<br />
zu wählen. Der zukünftige Budgetinhaber muss sich selbstverständlich seiner<br />
Verantwortung als Arbeitgeber bewusst sein und <strong>für</strong> eine sorgfältige finanzielle Abwicklung<br />
Sorge tragen. Diese Aufgaben sollte man nicht unterschätzen. Bei der Erledigung<br />
der unvermeidlichen Verwaltungsaufgaben kann man die Hilfe von <strong>Familie</strong>nmitgliedern,<br />
Freunden oder Fachkräften einholen, um als Budgetinhaber gut zu funktionieren. Beispiele<br />
hier<strong>für</strong> sind auf dem Gebiet der Fürsorge <strong>für</strong> geistig Behinderte zu finden, wo El-<br />
55
tern und andere <strong>Familie</strong>nmitglieder die Arbeitgeberrolle übernehmen. Bei vielen Interessengemeinschaften,<br />
wie zum Beispiel bei "Per Saldo", kann man Informationen und Unterstützung<br />
auf diesem Gebiet bekommen. Sollte es einem Budgetinhaber trotz allem<br />
nicht gelingen, seinen Aufgaben gerecht zu werden, so sind im System Sicherheiten<br />
eingebaut, die da<strong>für</strong> Sorge tragen, dass eine Rückkehr in das System der Sachleistungen<br />
möglich ist.<br />
Anfänglich gab es Politiker, die meinten, man könne Menschen die Verantwortung <strong>für</strong><br />
die Geldmittel, die sie <strong>für</strong> ihre Hilfeleistungen benötigten, nicht anvertrauen. Die Gefahr,<br />
das Geld würde uneigentlich verwendet werden, wäre zu groß. So etwas hat sich nie<br />
ergeben. Die Menschen haben die beantragte Hilfe bitter nötig, um im täglichen Leben<br />
einigermaßen mithalten zu können. Bei den ersten Experimenten in den neunziger Jahren<br />
ließ man die Budgetinhaber über den genehmigten Gesamtbetrag verfügen. Dabei<br />
zeigte sich, dass man äußerst sorgfältig mit dem Geld umging, ja durch scharfe Verhandlungen<br />
mit dem Pflegepersonal mehr Stunden beköstigen konnte als mit dem heutigen<br />
System möglich wäre. Sehr schnell wurde offenbar, dass durch ein Persönliches<br />
Budget die Lebensqualität des Budgetinhabers erstaunlich verbessert wurde.<br />
Es ist äußerst wichtig, dass zukünftige Budgetinhaber vor der Entscheidung, das Abenteuer<br />
zu wagen, gründlich über alle Regeln und Verantwortlichkeiten aufgeklärt werden.<br />
6.6 Die gegenwärtig geltenden Regeln <strong>für</strong> das Persönliche Budget<br />
Das Gesundheitsministerium hat 1995 bestimmt, dass Menschen, die länger als drei<br />
Monate auf Pflege und Unterstützung angewiesen sind, im Rahmen des Persönlichen<br />
Budgets einen Geldbetrag zur Verfügung bekommen können als Alternative zu Sachleistungen.<br />
Heute verfügbare Gelder zur Bezuschussung von Persönlichen Budgets und dem<br />
Allgemeinen Gesetz zur Sonderleistungen (AWBZ)<br />
� Die Kosten <strong>für</strong> Pflege und Betreuung betragen f 295 Millionen Gulden, wovon tausend<br />
Gulden pro Budgetinhaber an Verwaltungskosten abgehen. Vom Juli 2001 an<br />
gibt es 20700 Budgetinhaber.<br />
� Die Kosten des Persönlichen Budgets <strong>für</strong> geistig Behinderte betragen <strong>für</strong> 7600<br />
Budgetinhaber 135 Millionen Gulden.<br />
� Die Kosten <strong>für</strong> Schwerbehinderte mit extrem hohem Pflegebedarf, belaufen sich auf<br />
5,1 Millionen Gulden <strong>für</strong> drei regionale Experimente mit 100 Teilnehmern, die seit<br />
<strong>Jan</strong>uar 2001 laufen.<br />
� Das Budget <strong>für</strong> die Sorge <strong>für</strong> Psychisch Kranke beträgt 19 Millionen Gulden <strong>für</strong> das<br />
Jahr 2001. Mit Experimenten wurde 1998 in fünf Regionen ein Anfang gemacht.<br />
2001 wurde das Persönliche Budget <strong>für</strong> diese Zielgruppe allgemein eingeführt mit<br />
150 Teilnehmern.<br />
� Zum Vergleich: die Gesamtausgaben <strong>für</strong> die oben genannten Budgetgruppen belaufen<br />
sich auf etwa 450 Millionen Gulden. Die Ausgaben <strong>für</strong> Sachleistungen aus dem<br />
AWBZ belaufen sich auf 30 Milliarden. Die Ausgaben <strong>für</strong> die Persönlichen Budgets<br />
sind da vergleichsweise sehr bescheiden!<br />
56
� Durch Aufstockung der Zuschüsse ist die Anzahl der Budgetinhaber seit <strong>Jan</strong>uar<br />
2001 mit 6000 auf insgesamt 28.500 Personen gestiegen. Die extra Zuschüsse wurden<br />
den regionalen Stellen der Krankenversicherungen bewilligt, um die Wartelisten<br />
in der häuslichen Pflege zu verkürzen.<br />
Innerhalb der Regelung <strong>für</strong> Pflege und Betreuung besteht das Budget aus drei Teilen:<br />
� Regelung der einkommensabhängigen Selbstbeteiligung<br />
� Pauschalbetrag<br />
� Bezugsanspruch.<br />
Der Krankenversicherungsträger legt auf Grund der Stundenzahl und der Art der Hilfeleistung<br />
das Bruttobudget fest. Jugendliche unter 18 Jahren sind freigestellt von Selbstbeteiligungen,<br />
da sie häufig noch kein eigenes Einkommen haben und entweder bei ihren<br />
Eltern oder in einer Einrichtung wohnen, wo sie nur ein Taschengeld erhalten.<br />
Der Versicherungsträger vermindert den Bruttobetrag des Budgets mit der Selbstbeteiligung.<br />
Das Budget besteht dann aus dem Pauschalbetrag und dem Bezugsanspruch.<br />
Nach Unterzeichnung des Vertrages zwischen dem Budgetinhaber und dem Versicherungsträger<br />
wird der Antrag bei der Sozialen Versicherungsbank deponiert, wo die Budgetgelder<br />
verwaltet werden. Der Pauschalbetrag wird halbjährlich (1200 Gulden) auf das<br />
Konto des Budgetinhabers überwiesen.<br />
Die übrigbleibenden Bezugsansprüche werden durch die Sozialversicherungsbank verwaltet.<br />
Aus ihnen werden sowohl die Kosten <strong>für</strong> Hilfeleistungen als auch die Steuer- und<br />
Sozialabgaben bestritten.<br />
6.7 Neue PGB Regelungen ab dem 1. <strong>Jan</strong>uar 2002<br />
Vorläufig hat man sich entschieden, neue Regelungen als allgemeine Verwaltungsmaßnahme<br />
dem Allgemeinen Gesetz zu den Sonderleistungen der Krankenversicherungen<br />
(AWBZ) hinzu zu fügen.<br />
Wegen der vielen Beschwerden über die heutigen Regelungen von Budgetinhabern und<br />
der Exekutivorgane, den Versicherungsträgern und der Sozialversicherungsbank, sollen<br />
die Regelungen zum Persönlichen Budget grundlegend verändert werden.<br />
In der Gesetzesnovelle des Ministers sollen innerhalb der Modernisierung des<br />
AWBZ folgende Funktionen flexibel eingesetzt werden:<br />
� Tägliche Verrichtungen im Haushalt<br />
� Allgemeine tägliche Pflegeverrichtungen<br />
� Gemeindekrankenpflege<br />
� Betreuung<br />
� Aktivierende und beratende Unterstützung<br />
57
� Behandlung *<br />
� Wohnen *<br />
Die Kategorien Behandlung und Wohnen bleiben im Bezug auf das Persönliche Budget<br />
vorläufig noch außerhalb der Diskussion. Bei den Sachleistungen werden sie schon mitberücksichtigt.<br />
Definition des Leistungsumfangs nach Klassen<br />
In der heutigen Praxis wird bei der Indikation die Summe der Stunden, die <strong>für</strong> die unterschiedlichen<br />
Funktionen benötigt werden, festgestellt. Man spricht von einem X-<br />
Stundensystem. Auf Grund dieser Summe wird der Bruttobetrag des Persönlichen Budgets<br />
ausbezahlt.<br />
In dem neuen System soll mit einer Budgetsystematik gearbeitet werden. Ein Vorteil<br />
wäre die einfachere Handhabung, und es gewährt einigen Spielraum bei Veränderungen<br />
des Gesundheitszustandes. Zwischenzeitliche Neuindikationen werden dadurch<br />
seltener nötig sein. Von Nachteil ist die Grobmaschigkeit des Systems, wodurch das<br />
individuelle Sorgebedürfnis weniger präzise umschrieben werden kann. Eine mögliche<br />
Variante wäre die Definition einer Anzahl an Klassen. So entsteht ein Matrixmodel aus<br />
Funktionen und Klassen. Die Klassen könnten aus der heutigen Sorgepraxis abgeleitet<br />
werden. Die Höhe der Entlohnung des Pflegepersonals wird gekoppelt an die Klasse,<br />
oder wie Sie sagen, die Pflegestufe. Dabei muss gewährleistet sein, dass das selbständig<br />
arbeitende Personal die gleichen Rechte und Möglichkeiten hat, wie das Personal in<br />
den Einrichtungen.<br />
Umschlagmoment<br />
Dem Leistungsberechtigten darf aus der Wahl zwischen einem Persönlichen Budget<br />
oder Sachleistungen kein finanzieller Vor- oder Nachteil entstehen. Kollektive Sachleistungen<br />
in einer Einrichtung bieten Vorteile durch den Umfang der Leistungen <strong>für</strong> eine<br />
Gruppe von Klienten gleichzeitig. Für die Leistungen durch ein Persönliches Budget gilt<br />
ein Maximumbetrag. Wenn der Pflegebedarf extrem ist, kann es im Vergleich mit der<br />
Heimpflege zu einem Umschlag kommen, wo aus Kostengründen zur Aufnahme in eine<br />
Einrichtung geraten wird. Das bedeutet übrigens nicht, dass der Leistungsempfänger<br />
seine Hilfe nicht mehr zu Hause bekommen darf, wohl aber dass er die Extrakosten<br />
selbst wird tragen müssen. In außergewöhnlichen Härtefällen, bei denen aus medizinischen<br />
Erwägungen von Heimpflege ab zu raten ist, kann eine Sonderregelung in Kraft<br />
treten.<br />
Abschaffung der Zentralverwaltung durch die Soziale Versicherungsbank<br />
Die als sehr bürokratisch empfundene Verwaltung durch die Soziale Versicherungsbank<br />
wird abgeschafft, eine Einsparung von 28,5 Millionen Gulden, die effektiver verwendet<br />
werden sollen.<br />
Zur Durchführung des Persönlichen Budgets entwickelt man zwei Alternativen.<br />
58
Alternative:<br />
Der Budgetinhaber erhält einen Geldbetrag, der abhängig vom Umfang, monatlich,<br />
dreimonatlich oder halbjährlich als Vorschuss überwiesen wird. Über jede Vorschussperiode<br />
wird vorläufig abgerechnet. Der Budgetinhaber liefert die Personalien seines Pflegepersonals<br />
und die Zahlungsbelege zur Feststellung der zu leistenden Steuer- und Sozialabgaben.<br />
Bei zweckfremder Anwendung der Gelder wird die folgende Vorschusszahlung<br />
entsprechend gekürzt, und sollte der Budgetinhaber außerstande sein, seine Ausgaben<br />
zu belegen, kann das Budget beendet werden und möglicherweise zurückgefordert.<br />
In diesem Vorschlag hat der Budgetinhaber die Verantwortungen eines Arbeitgebers.<br />
Unterstützung bei den Verwaltungsaufgaben<br />
Wenn er es wünscht, kann ein Budgetinhaber die Dienste einer Organisation beanspruchen,<br />
die kostenfrei seine Verwaltungsaufgaben übernimmt. Dieser speziale Dienst ist<br />
eingestellt auf Wunsch der verschiedenen ausführenden Sozialversicherungsorgane.<br />
Alternative:<br />
Der zweite Entwurf sieht vor, dem Budgetinhaber statt Bargeld Gutscheine über den<br />
Budgetbetrag zur Verfügung zu stellen. Das Pflegepersonal wird mit diesen Gutscheinen<br />
entlohnt, die beim Krankenversicherungsträger umgetauscht werden. Für zweckfremden<br />
Gebrauch wird der Budgetinhaber zur Verantwortung gerufen und kann er möglicherweise<br />
auf die Pflegesachhilfe zurückverwiesen werden.<br />
Zusammenfassend: Die erste Variante sieht vor, dass der Krankenversicherungsträger<br />
beauftragt ist mit der Zuweisung von Persönlichen Budgets, der Bevorschussung<br />
und der Abrechnung.<br />
In der zweiten Variante liefert der Versicherungsträger nach Budgetzuweisung Gutscheine<br />
an den Budgetinhaber zur Bezahlung des Pflegepersonals, das die Gutscheine<br />
bei der Versicherung einlöst.<br />
In beiden Fällen ist der Versicherungsträger innerhalb seines Verwaltungsbezirks verantwortlich<br />
<strong>für</strong> Kontrolle auf die zweckdienliche Anwendung der Gelder.<br />
Pauschalbetrag<br />
In beiden Alternativen kann dem Budgetinhaber ein begrenzter Pauschalbetrag zur Verfügung<br />
gestellt werden. Dies wäre möglicherweise sinnvoll, wenn der Klient nur wenige<br />
Stunden Hilfe im Haushalt benötigen sollte und der Pauschalbetrag hier<strong>für</strong> ausreichen<br />
würde.<br />
Das niederländische Parlament wird Ende September dieses Jahres feststellen, welche<br />
Budgetform von den Fraktionen bevorzugt wird. Bis dahin gibt es <strong>für</strong> die Lobby der Patientenverbände,<br />
unter ihnen "Per Saldo", eine Menge zu tun. Klienten bevorzugen die<br />
erste Alternative. Die letzte Entscheidung ist Sache der Politik.<br />
59
6.8 Die Zusammenarbeit mit den politischen Parteien und den Ministerien<br />
Aus den vielen formalen und informalen Kontakten mit politischen Parteien und Mitgliedern<br />
des parlamentarischen Sonderausschuss <strong>für</strong> Gesundheitspolitik hat sich eine gute<br />
Zusammenarbeit mit "Per Saldo" entwickelt. "Per Saldo" hat freien Zugang zu Kommissions-<br />
und Fraktionsmitgliedern, und deren Büros wenden sich ihrerseits mit Fragen an<br />
"Per Saldo".<br />
Auch mit Sachbearbeitern der unterschiedlichen Ministerien werden ausgezeichnete<br />
Kontakte gepflegt zu gegenseitiger Information und Beratung. Man initiiert wissenschaftliche<br />
Projekte oder arbeitet daran mit. Dank sei der vielen positiven Ergebnisse dieser<br />
Zusammenarbeit sind viele andere Organisationen aus demselben Sektor zur Mitarbeit<br />
bereit.<br />
6.9 Erwartungen <strong>für</strong> die fernere Zukunft<br />
Ich hatte bereits angedeutet, dass <strong>für</strong> die Zukunft eine enorme Erweiterung des Persönlichen<br />
Budgets auf andere Anwendungsgebiete im Dienstleistungssektor zu erwarten ist.<br />
Bis heute sind alle Einrichtungen des Gesundheitswesens in den Niederlanden einer<br />
zentralen Regelung und Kontrolle unterworfen. Jede Einrichtung bietet ihr Leistungspaket<br />
an. Die Nachfrage spielt so gut wie keine Rolle. Dies will man ändern. In Zukunft soll<br />
die Nachfrage das Angebot bestimmen, wobei auch Raum geschaffen wird <strong>für</strong> neue<br />
Entwicklungen.<br />
Um die Qualität der Dienstleistungen zu garantieren, soll ein Normierungssystem und<br />
ein System von Qualitätszertifikaten eingeführt werden. Einrichtungen und selbständig<br />
arbeitende Pfleger müssen ein Zertifikat haben, mit dem sie ihre Qualifizierung <strong>für</strong> ihre<br />
Tätigkeiten nachweisen können. Man erhofft sich so einen Ausgleich in Angebot und<br />
Nachfrage und eine natürliche Preisentwicklung.<br />
Mögliche zukünftige Anwendungsgebiete <strong>für</strong> das Persönliche Budget<br />
Auf ganz unterschiedlichen Gebieten wird zur Zeit untersucht, welche Möglichkeiten <strong>für</strong><br />
Persönliche Budgets sich ergeben könnten. Hier folgt eine Übersicht der zu untersuchenden<br />
Sektoren:<br />
� Ein produktabhängiges Budget <strong>für</strong> Hilfsmittel (Gesundheitsministerium).<br />
� Maßnahmen <strong>für</strong> Behinderte im Rahmen des Gesetzes WVG (Sozialministerium). Es<br />
handelt sich hier um behindertengerechte Anpassungen in Wohnungen, die Lieferung<br />
von Rollstuhl, Sportrollstuhl, Rollator, Vergütung von Umzugskosten und so<br />
weiter.<br />
� Maßnahmen auf dem Gebiet von Wohnen und Sorge (Ministerium <strong>für</strong> Raumordnung,<br />
Bauwesen und Städtebau). Neue, kleine Wohnformen innerhalb der Stadtteile.<br />
� Rehabilitationsbudget <strong>für</strong> Arbeitsunfähige (Sozial- und Arbeitsministerium). An drei<br />
Stellen laufen momentan noch einige Experimente.<br />
60
� Außerordentliche Sozialhilfe (Sozial- und Arbeitsministerium). Die Verwaltung liegt<br />
bei den Gemeinden. Für Personen mit Einkommen an oder unter dem gesetzlich<br />
festgestellten Minimum können Gutscheine ausgegeben werden <strong>für</strong> größere Sonderausgaben,<br />
wie Anschaffung einer Waschmaschine, eines Kühlschranks, Lehrbücher,<br />
Schulgeld und dergleichen.<br />
� Gutscheine <strong>für</strong> den Unterricht an Hochschulen (Unterrichtsministerium)<br />
� Experimente an 6 bis 10 Hochschulen mit 500 bis 1000 Studenten, die gleichzeitig in<br />
mittleren und kleinen Betrieben arbeiten und eine Ausbildung machen, laufen von<br />
<strong>Jan</strong>uar 2001 bis zum September 2003.<br />
� Im Rahmen der Politik der ständigen Weiterbildung können individuelle Budgets <strong>für</strong><br />
die Kosten von Berufsausbildung und Erwachsenenbildung eingerichtet werden (Unterrichtsministerium).<br />
6 bis 10 Experimente mit 100-200 Studenten laufen von Februar<br />
2001 bis Februar 2002. Die Kosten betragen 2,5 Millionen Gulden.<br />
Dies ist nur eine Auswahl aus den bis jetzt untersuchten oder bereits eingeführten Möglichkeiten<br />
<strong>für</strong> ein Persönliches Budget. Wie Sie sehen, versuchen sich zunehmend andere<br />
Ministerien mit dem Persönlichen Budget.<br />
6.10 Die Budgetinhabervereinigung "Per Saldo" heute und in Zukunft<br />
Die etwa 6000 Mitglieder von "Per Saldo" sind Budgetinhaber oder Interessenten. Die<br />
Mitglieder bestimmen die Politik der Organisation. Mit der zunehmenden Anzahl Budgetinhaber<br />
steigt die Mitgliederzahl allmählich an. Unser telefonischer Informationsdienst<br />
beantwortet Fragen, verweist an andere Instanzen und erteilt Ratschläge. Dieser Dienst<br />
steht übrigens auch Anrufern zur Verfügung, die noch kein Mitglied sind. Die Arbeit des<br />
Büros wird durch Bezuschussung durch das Gesundheitsministerium und die Mitgliederbeiträge<br />
finanziert. Die Zuschüsse werden allerdings auf längere Sicht abgebaut<br />
werden. Dann muss "Per Saldo" sich ausschließlich aus eigenen Mitteln unterhalten<br />
können.<br />
Viele Menschen, die ihr erstes Budget erhalten haben kommen zu "Per Saldo" <strong>für</strong> Informationen<br />
und Beratung. Auch Lohnberechnungen kann man dort ausführen lassen.<br />
Sollte zwischen Budgetinhaber und Pflegepersonal ein Arbeitskonflikt entstehen, kann<br />
der juristische Sachbearbeiter des Vereins zu Rate gezogen werden. Dieser Service ist<br />
allerdings so arbeitsintensiv, dass "Per Saldo" erwägt, diesen Dienst gesondert aus zu<br />
bauen und gegen Bezahlung an zu bieten.<br />
Eine einfache Mitgliedschaft kostet pro Jahr 50 Gulden, die aus dem Pauschalbetrag<br />
des Persönlichen Budgets bezahlt werden darf. Dies sind die Leistungen, die den<br />
Mitgliedern <strong>für</strong> ihren Beitrag geboten werden:<br />
� mal pro Jahr erscheint ein Nachrichtenbulletin.<br />
� Es werden Broschüren über wichtige Themen herausgegeben, auch auf Englisch,<br />
Arabisch und Türkisch. Bis jetzt sind 12 Broschüren erschienen.<br />
61
� Man verfügt über spezifische Fachkenntnisse, um allochthonen Bürgern die richtige<br />
Unterstützung bieten zu können.<br />
� Halbjährlich findet eine allgemeine Mitgliederversammlung statt.<br />
� Regional werden Tagungen zu relevanten Themen veranstaltet<br />
� Beginnende Budgetinhaber können ein speziales Training bekommen.<br />
� Ein Informationstelefon <strong>für</strong> alle Fragen mit Bezug auf das Persönliche Budget.<br />
� Vermittlung bei der Suche nach Pflegepersonal.<br />
� "Per Saldo" untersucht Möglichkeiten zur Einrichtung einer eigenen Servicestation<br />
<strong>für</strong> die Vermittlung von Pflegepersonal und die Lieferung von Hilfsmitteln gegen reduzierte<br />
Preise. Jetzt schon ist es Mitgliedern von "Per Saldo" möglich, gegen Vorzeigen<br />
ihrer Mitgliedskarte bei den offiziellen Lieferanten Hilfsmittel billiger ein zu<br />
kaufen.<br />
� Regionale Kontaktstellen.<br />
� Kollektive Interessenvertretung und Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium,<br />
den unterschiedlichen Instanzen der Versicherungsträger, Einrichtungen des<br />
Gesundheitswesens und den Pflegediensten.<br />
� Wissenschaftliche Studien zum Funktionieren des Persönlichen Budgets.<br />
� Betreiben einer Website und Beantworten von E-Mail.<br />
Erweiterung des Leistungsangebots und andere Wünsche <strong>für</strong> die Zukunft.<br />
Der Vorstand denkt daran, das Leistungsangebot <strong>für</strong> die Mitglieder breitgefächert zu<br />
erweitern. Auch untersucht man die Möglichkeiten, neue Formen von Persönlichen Budgets<br />
zu schaffen. Hier sind noch viele Wünsche offen. Ein besonderer Wunsch ist zum<br />
Beispiel ein Budget, das es Schwerstbehinderten ermöglichen könnte, gleichberechtigt<br />
am gesellschaftlichen Leben teil zu nehmen.<br />
Beirat<br />
Der Vorstand wird unterstützt durch eine Resonanzgruppe, die als Beirat tätig ist.<br />
Noch ein paar wissenswerte Fakten:<br />
� Im vergangenen Jahr hat "Per Saldo" sein fünfjähriges Bestehen gefeiert.<br />
� In diesem Frühjahr erschien das wunderschöne Jubiläumsbuch "Glanz" mit vielen<br />
Beiträgen von Mitgliedern zum Persönlichen Budget und einer Übersicht über Vergangenheit,<br />
Gegenwart und Zukunft des PB.<br />
� Auf Grund der Erzählungen der Budgetinhaber in dem Buch "Glanz" darf man feststellen,<br />
das die eigene Regie in der Organisation ihrer Pflegeleistungen als Bereicherung<br />
erfahren wird, die ihre Lebensqualität bedeutend verbessert.<br />
� Voriges Jahr wurde "Per Saldo" <strong>für</strong> den begehrenswerten Preis "Die Krönung der<br />
Arbeit" durch das Sozialministerium nominiert. "Per Saldo" kam auf den zweiten<br />
Platz.<br />
62
� In diesem Sommer wurde die Direktorin des Büros vom Gesundheitsministerium<br />
geehrt zum Dank <strong>für</strong> ihren großen Einsatz bei der Realisierung der Modernisierung<br />
des Allgemeinen Gesetzes zu den Sonderleistungen der Krankenversicherungen<br />
(AWBZ) und die Vereinfachung der PB Regelungen.<br />
� Das Büroteam arbeitet mit großer Begeisterung an der Zukunft. Viele der Mitarbeiter<br />
sind selbst behindert und Budgetinhaber. Gerade durch das Persönliche Budget hat<br />
so mancher endlich wieder die Möglichkeit bekommen am Arbeitsleben teil zu nehmen.<br />
Ehrenamtliche Helfer gesellen sich dazu, um zu erfahren, ob es auch ihnen gelingen<br />
kann, einen regulieren Arbeitsplatz aus zu füllen mit all den Fachkenntnissen,<br />
die sie besitzen.<br />
Hiermit schließe ich meine Ausführungen. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen Einblick in das<br />
niederländische Gesundheitswesen verschaffen konnte und besonders in das Phänomen<br />
des Persönlichen Budgets. Sollten Sie noch Fragen an mich haben, werde ich sie,<br />
soweit es mir möglich ist, in der Diskussionsrunde beantworten.<br />
Ich bedanke mich <strong>für</strong> Ihre Aufmerksamkeit<br />
63
7. AG1 - Der Heimvertrag und die Selbststeuerung der Bewohner/innen<br />
- Knut Lehmann, <strong>Dr</strong>. Bernd Schubert<br />
Moderation: Knut Lehmann Landesamt <strong>für</strong> Versorgung und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt,<br />
Halle<br />
<strong>Dr</strong>. Bernd Schubert, pflegen & wohnen, Hamburg<br />
Bevor die Teilnehmer in die Diskussion einstiegen, erfolgte zunächst eine kurze thematische<br />
Einführung zum Konzept der Wirkungsorientierung:<br />
Ergebnisse sozialer Dienstleistungen lassen sich in die nachfolgend aufgeführten Ebenen<br />
differenzieren.<br />
Schon die Bereitstellung leistungsbereiter Potentiale (Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
sowie Personal) hat Ergebnischarakter. Von ihnen geht eine gewisse<br />
Leistungen - Wirkungen?<br />
Bereitstellung leistungsbereiter<br />
Potentiale<br />
Inanspruchnahme der Potentiale<br />
durch die Nachfrager<br />
Gewünschte Veränderung<br />
bei den Nachfragern<br />
Auswirkungen auf die<br />
gesellschaftliche Wohlfahrt<br />
Versorgungssicherheit<br />
Produkte/Leistungen<br />
(Sachzielebene)<br />
Leistungswirkungen<br />
(Formalzielebene)<br />
Leistungsfolgewirkung<br />
(Erfüllung sozialpolitischer<br />
Versorgungsauftrag)<br />
1. Ebene<br />
2. Ebene<br />
3. Ebene<br />
4. Ebene<br />
Versorgungssicherheit <strong>für</strong> die potenziellen Bewohner/innen aus. D.h. dass im Bedarfsfall<br />
auch die notwendigen Leistungen erbracht werden können.<br />
Die anschließende Ergebnisebene sind die abgegebenen Leistungseinheiten, die z.B. in<br />
Form von Betreuungsstunden oder Pflegeleistungen ("kleine Morgentoilette") beschrieben<br />
werden können.<br />
Erst hieran schließt sich die Ergebnisebene der Leistungswirkungen an, auf der die Erreichung<br />
der eigentlich beabsichtigten Folgen der Abgabe von Leistungseinheiten erfasst<br />
wird. Als Folgen der Leistungsabgabe sind hier z.B. die angestrebten Veränderungen<br />
bzw. der Erhalt von Fähigkeiten der Leistungsempfänger oder auch bestimmte Zustände<br />
wie etwa "körperliches Wohlbefinden" zu beschreiben.<br />
64
In der nächsten Ergebnisebene werden dann Leistungsfolgewirkungen, wie etwa die<br />
Erfüllung eines sozialpolitischen Versorgungsauftrages erfasst.<br />
Im Mittelpunkt der weiteren Betrachtung steht somit die 3. Ergebnisebene der Leistungswirkungen.<br />
Die Wirkungsmessung in der Altenpflege richtet sich auf die Erreichung des individuellen<br />
Wohlbefindens der Bewohner/innen. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht hierzu<br />
die weitere Untergliederung dieser generellen Zielsetzung in ihre Dimensionen, ohne<br />
jedoch an dieser Stelle einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen.<br />
Soziale<br />
Geborgenheit<br />
Wirkungsmessung in der<br />
Altenpflege<br />
Psychisch-seelisches<br />
Wohlbefinden<br />
Teilnahme am<br />
gesellsch. und<br />
kulturellen Leben<br />
Individuelles<br />
Wohlbefinden<br />
Körperliches<br />
Wohlbefinden<br />
Bestmöglicher<br />
Gesundheitszustand<br />
Ressourcen und Kontext des<br />
Bewohners/der Bewohnerin<br />
Quelle: modifiziert nach JSB<br />
Körperliche<br />
Fähigkeiten<br />
Individuelles Wohlbefinden lässt sich in die Dimensionen des psychisch-seelischen<br />
Wohlbefindens sowie des körperlichen Wohlbefindens differenzieren. Dabei bestehen<br />
zwischen diesen beiden Dimensionen vielfältige Wechselwirkungen. Psychischseelisches<br />
Wohlbefinden wird erreicht bzw. positiv unterstützt, wenn den Bewohnern/innen<br />
soziale Geborgenheit sowie Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen<br />
Leben geboten wird. Körperliches Wohlbefinden wird erreicht bzw. positiv unterstützt,<br />
wenn ein bestmöglicher Gesundheitszustand erreicht werden kann sowie körperliche<br />
Fähigkeiten erhalten oder wieder erlangt werden.<br />
Individuelles Wohlbefinden kann über die exemplarisch aufgeführten Dimensionen allerdings<br />
nur erreicht werden, wenn auch die Ressourcen und Kontakte eines Bewohners /<br />
einer Bewohnerin Berücksichtigung finden, die daher die Abbildung der Wirkungsdimensionen<br />
abschließt.<br />
Die Wirkungsmessung und Wirkungssteuerung soll mit der nachfolgenden Abbildung<br />
weiter veranschaulicht werden.<br />
65
Ausgehend von der Wirkungsziel-Ebene des "bestmöglichen Gesundheitszustandes"<br />
sind Indikatoren abzuleiten, mit deren Hilfe die Wirkungsziele konkretisiert werden. Aus-<br />
Beispiel zur Wirkungsmessung<br />
Wirkungsziel-Ebene: Bestmöglicher Gesundheitszustand<br />
Indikator-Ebene: Freiheit von Gesundheitsrisiken<br />
Kennzahlen-Ebene: z.B. Anzahl Dekubitus-Fälle < 2%<br />
oder Entzündungen bei Dauerkatheter < 1%<br />
Prozess-Ebene: Qualitätsstandards zur Häufigkeit und<br />
Vorgehensweise bei Umlagerungen/Katheterreinigung<br />
gehend von dem aufgeführten Indikator der "Freiheit von Gesundheitsrisiken" erfolgt im<br />
nächsten Schritt die Bestimmung von Kennzahlen. Mittels Kennzahlen wie etwa der Anzahl<br />
der Dekubitusfälle werden Maßgrößen bestimmt, deren Erreichung handhabbar<br />
abgebildet werden kann und hierdurch die Erreichung der Wirkungsziele zumindest in<br />
Grenzen steuerbar macht.<br />
Die abschließend aufgeführte Prozessebene zeigt auf, dass <strong>für</strong> eine sicherere Erreichung<br />
der Wirkungsziele Qualitätsstandards erforderlich sind. Hier werden <strong>für</strong> die Handlungsebene<br />
Vorgehensweisen beschrieben, die eine Kennzahlenerreichung ermöglichen.<br />
Schritte in Richtung der Wirkungsorientierung lassen sich auch an Änderungen der betriebswirtschaftlichen<br />
Kalkulations- bzw. Steuerungslogik in Einrichtungen der Altenpflege<br />
erkennen, wie die nachfolgende Abbildung zeigt.<br />
66
Änderung der Kalkulations-/<br />
Steuerungslogik<br />
gestern<br />
Vorhandene Ressourcen<br />
Kosten<br />
Budget<br />
Leistungen<br />
heute<br />
Leistungen<br />
Notwendige Ressourcen<br />
Kosten<br />
Budget<br />
morgen<br />
Wirkungen<br />
Leistungen<br />
Notwendige Ressourcen<br />
Kosten<br />
Budget<br />
In der Vergangenheit, die vom Selbstkostendeckungsprinzip geprägt ist, gingen Kalkulations-/Steuerungsüberlegungen<br />
zunächst von den vorhandenen Ressourcen aus, d.h.<br />
wie viel Personal, Gebäude, Ausstattung etc. vorhanden sind. Die mit ihren Kosten bewerteten<br />
Ressourcen werden organisatorischen Einheiten (z.B. Abteilungen) dann als<br />
Budgets zugeordnet und hier wird dann geschaut, welche und wie viel an Leistungen<br />
denn nun erbracht werden können.<br />
Mit der Umstellung des Systems auf leistungsgerechte, prospektive Entgelte sollte sich<br />
die Kalkulations-/Steuerungslogik dahin gehend ändern, dass die notwendigen Leistungen<br />
den gedanklichen Ausgangspunkt bilden. Aus diesen wird dann der erforderliche<br />
Ressourceneinsatz abgeleitet, dieser mit Kosten bewertet und den organisatorischen<br />
Einheiten als Budgets zugewiesen. (Anmerkung: Hier kam aus dem Teilnehmerkreis<br />
allerdings die Aussage, dass man immer noch von den vorhandenen Ressourcen ausgehen<br />
würde.) Auf diese Weise haben dann die Budgets auch erst einen Bezug zu den<br />
Leistungsbedarfen, der in dem betreffenden Bereich betreuten Menschen.<br />
Für die Zukunft ist eine Weiterentwicklung der Kalkulations-/Steuerungslogik unter der<br />
Überschrift der Wirkungsorientierung denkbar und wünschenswert. Hier sollte dann den<br />
notwendigen Leistungen noch die angestrebten Wirkungen vorangestellt werden, d.h.<br />
ausgehend von den angestrebten Wirkungszielen und den individuellen Ressourcen<br />
und Potentialen der Bewohner/innen werden die notwendigen Leistungen bestimmt.<br />
Wie kommen jetzt aber die Aspekte der wirkungsorientierten Steuerung im Alltag von<br />
Pflegeheimen zum Einsatz? Wirkungsorientierung richtet sich auf das individuelle Wohlbefinden<br />
der Bewohner/innen und dessen Erreichung wird von den individuellen Ressourcen<br />
und damit auch Wünschen der Leistungsempfänger bestimmt. Welche Möglich-<br />
67
keiten bestehen denn überhaupt, oder sollten bestehen, hinsichtlich der Selbststeuerungsmöglichkeiten<br />
der Bewohner/innen? Vor dem Hintergrund dieser Fragestellung<br />
steht der Heimvertrag als rechtliches Bindeglied zwischen dem Heim und den Leistungsempfängern<br />
im Blickpunkt dieses Workshops.<br />
Die nachfolgende Folie skizziert kurz die Bedeutung des Heimvertrages an Hand ausgewählter<br />
Stichpunkte.<br />
Anmerkungen zum Heimvertrag<br />
–Normierung Heimvertragsrecht im Heimgesetz<br />
–Einrichtungsphilosophie spiegelt sich in der<br />
Rechtsstellung des Bewohners im Heimvertrag<br />
–Gebot der Einzelleistungsbeschreibung<br />
–verständliche und transparente Bekanntgabe der<br />
Leistungen gegenüber dem Bewohner<br />
–zu beschreibende Leistungen:<br />
–Wohnraumüberlassung<br />
–Verpflegung<br />
–Hauswirtschaftliche Versorgung<br />
–Pflege (Pflege, med. Behandlungspflege, soz. Betreuung)<br />
–Zusatzleistungen, ärztl. Betreuung, Therapien, kulturelle/soziale<br />
Leistungen<br />
Welche möglichen Ansatzpunkte bestehen denn nun <strong>für</strong> die Einräumung von Selbststeuerungsmöglichkeiten<br />
im Heimvertrag? Die nachfolgende Abbildung zeigt hierzu Beispiele<br />
auf.<br />
68
Z.B. :<br />
Heimvertrag und Selbststeuerung?<br />
Sanktionsmöglichkeiten<br />
Wahlleistungen<br />
Verweis auf weitere<br />
Instrumente<br />
Wirkungsbezogene<br />
Schwerpunkte<br />
Heimvertrag<br />
Einbeziehung<br />
Bewohner<br />
Qualitätsgarantie<br />
(Preis-Leistungs-Verhältnis)<br />
Verantwortung<br />
Heimbeirat<br />
Im Heimvertrag können den Bewohnern/innen als Möglichkeiten zur Selbststeuerung<br />
z.B. Wahlleistungen angeboten oder es können auch Wahlmöglichkeiten bei der Speiseversorgung<br />
sowie Abwahlmöglichkeiten von z.B. hauswirtschaftlichen Leistungen angeboten<br />
werden.<br />
Des Weiteren können auch wirkungsbezogene Schwerpunkte des Heimes im Hinblick<br />
auf die angestrebten Wirkungsziele vereinbart werden. Dies entspräche der Selbstverpflichtung<br />
des Heimes auf die Erreichung oder zumindest Anstrebung des individuellen<br />
Wohlbefindens der Bewohner/innen. Diese Selbstverpflichtung könnte noch weiter konkretisiert<br />
werden.<br />
Es können aber auch Qualitätsgarantien aufgenommen werden, in denen etwa die Ausprägungen<br />
der Freiheit von Gesundheitsrisiken in ihren Merkmalswerten festgelegt werden.<br />
Weitere Möglichkeiten zur Einräumung von Selbststeuerungsoptionen liegen in der<br />
Festlegung der Verantwortlichkeiten des Heimbeirates oder der Einbeziehung der Bewohner/innen,<br />
die explizit in den Heimvertrag aufgenommen werden könnten.<br />
Es werden sich mit Sicherheit nicht alle Aspekte im Heimvertrag regeln lassen, es besteht<br />
aber durchaus auch die Möglichkeit im Heimvertrag auf den Einsatz weiterer Instrumente,<br />
wie z.B. des Qualitätsmanagements zu verweisen. Schließlich könnten auch<br />
Sanktionsmöglichkeiten, wie z.B. Rückerstattungen von Entgelten bei Schlecht- oder<br />
Minderleistungen festgeschrieben werden.<br />
Mit den nachfolgend aufgeführten Einstiegsthesen wurde schließlich in die Diskussion<br />
übergeleitet.<br />
69
Heute<br />
Morgen<br />
Einstiegsthesen<br />
Selbststeuerung der<br />
Bewohner/innen ist in den<br />
aktuellen Heimverträgen nicht<br />
vorgesehen.<br />
Die Maximierung des<br />
Individualnutzens maximiert<br />
den Kollektivnutzen.*<br />
* Wahlleistungen und Wirkungsziele werden in<br />
den Heimverträgen fixiert und sichern die<br />
optimale Verwendung der Ressourcen in einem<br />
„durchlässigen“ Versorgungssystem.<br />
Die Diskussion wurde sehr offen und konstruktiv geführt und daher soll an dieser Stelle<br />
noch einmal allen Teilnehmenden ausdrücklich gedankt werden.<br />
Die Darstellung der Diskussionsergebnisse erfolgt an dieser Stelle an Hand der im Forum<br />
präsentierten Folien, die jeweils kurz erläutert werden.<br />
Ergebnisse -1-<br />
Indikationen bei Eintritt ins Heim (Pflegestufe, Demenz,<br />
schlechte Wohnung, soziale Indikation)<br />
Selbststeuerungsmöglichkeiten vorhanden (z.B. Wahlmenüs,<br />
Zeitkorridore <strong>für</strong> Mahlzeiten, Freizeitangebote)<br />
Abwahl von Reinigungsleistungen oder Essen kann Gefahren<br />
bergen<br />
Klientel nimmt Selbststeuerungsmöglichkeiten nur gering<br />
(weiter abnehmend) in Anspruch<br />
frühzeitige Förderung der alten Menschen notwendig<br />
rechtzeitige Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen<br />
(Wohnung)<br />
70
Bei den Überlegungen zur Einräumung von Selbststeuerungsmöglichkeiten wird die Differenzierung<br />
der verschiedenen Indikationen der Bewohner/Innen beim Eintritt ins Heim<br />
notwendig. Die Möglichkeiten zur Einräumung von Selbststeuerungsmöglichkeiten z.B.<br />
<strong>für</strong> Demente oder <strong>für</strong> Bewohner/innen mit hoher Pflegestufe werden als eher gering eingeschätzt.<br />
Eintritte ins Heim aus Gründen einer ungeeigneten Wohnung oder aus drohender<br />
Vereinsamung lassen zwar weitergehende Selbststeuerungsmöglichkeiten zu,<br />
hier stellt sich aber die Frage ob eine Unterbringung im Heim die geeignete bzw. angemessene<br />
Betreuungsform ist.<br />
Grundsätzlich werden in den derzeitigen Heimverträgen bereits Möglichkeiten zur<br />
Selbststeuerung eingeräumt. Diese beziehen sich in erster Linie auf Wahlmenüs, Zeitkorridore<br />
<strong>für</strong> Mahlzeiten oder auch Freizeitangebote. Die Einräumung von Abwahlmöglichkeiten<br />
wird eher kritisch gesehen, da hier die Fürsorgepflicht des Einrichtungsträgers<br />
Belästigungen oder gar Gefährdungen auszuschließen hat.<br />
Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Möglichkeiten zur Selbststeuerung eher wenig<br />
in Anspruch genommen werden und hier in der Tendenz die Inanspruchnahme rückläufig<br />
ist.<br />
Selbststeuerung der Bewohner/innen setzt auch eine gewisse Selbstständigkeit im Hinblick<br />
auf Fähigkeiten/Fertigkeiten voraus. Hierzu wurde festgestellt, dass eine möglichst<br />
frühzeitige Förderung notwendig ist, um dem Verlust von Fähigkeiten/Fertigkeiten vorzubeugen<br />
und dadurch die Nutzung von Selbststeuerungsmöglichkeiten stärker zu fördern.<br />
Einzügen in ein Heim aufgrund einer unzureichenden Wohnsituation, ist durch die rechtzeitige<br />
Schaffung angemessener Wohnangebote zu begegnen, um Bewohner/innen<br />
möglichst lange in vorstationären Angebotsformen betreuen zu können.<br />
Ergebnisse -2-<br />
ignung des persönlichen Budgets/Einkaufsmodells, um<br />
institutionelle Angebote zu verändern?<br />
betreute Hausgemeinschaften“ fördern Fähigkeiten und<br />
Zufriedenheit (Modell aus NL)<br />
onsulenten (bei der Kommune angestellt)<br />
ilfebedarfsbestimmung und -fortschreibung<br />
weckbindung der Mittel und Verwendungsnachweis<br />
aufzeit seit 5-6 Jahren<br />
bei Bedarf Informationen über Frau Reitsma)<br />
Im weiteren Verlauf der Diskussion kam die Frage auf, inwieweit die Ansätze des persönlichen<br />
Budgets bzw. von Einkaufsmodellen geeignet sein können, um institutionelle<br />
71
Angebote zu verändern. Hiermit könnte z.B. der frühzeitige Einzug in ein Heim durch<br />
andere Wohnangebote verzögert werden.<br />
In den Niederlanden werden hier betreute Hausgemeinschaften angeboten, die eine<br />
gute Akzeptanz haben und die sowohl die Fähigkeiten als auch die Zufriedenheit der<br />
Bewohner/innen fördern.<br />
Fraglich ist an dieser Stelle aber die Übertragbarkeit des Modells. In den Niederlanden<br />
werden die Bewohner/innen beispielsweise durch sogenannte Consulenten betreut, die<br />
bei der Kommune angestellt sind. Hier wäre zu bestimmen, wer in Deutschland diese<br />
Aufgabe wahrnehmen kann. Es gibt entsprechende Verfahren der Hilfebedarfsbestimmung<br />
und -fortschreibung, die ggf. anzupassen sind. Die zur Verfügung gestellten Mittel<br />
unterliegen einer Zweckbindung mit entsprechenden Verwendungsnachweisen, deren<br />
Verfahren zumindest kritisch zu hinterfragen wären. Auch die bisherige Laufzeit des Projektes<br />
ist möglicherweise zu gering, um valide Erfolgsurteile zu rechtfertigen.<br />
Ergebnisse -3-<br />
Pflegeheim als Angebotsform weiterhin notwendig aber nicht<br />
mehr mit Heimcharakter<br />
demographische Entwicklung (Lebensalter, Singles, junge Alte)<br />
erfordert zeitnahe und planvolle Systemänderung<br />
abgestuftes Angebotssystem, aber jeder Baustein muss sich<br />
rechnen<br />
Finanzierung und Programmatik in der ambulanten Pflege<br />
derzeit im Widerspruch<br />
Modellversuch in Sachsen-Anhalt, der Versorgungsstruktur<br />
breiter anlegt, um Eintritt in stationäre Pflege hinaus zu<br />
schieben/zu vermeiden<br />
Festzuhalten blieb, dass Pflegeheime als Angebotsform weiterhin notwendig sein werden.<br />
Hier sollte aber der Heimcharakter kritisch auf den Prüfstein gestellt werden.<br />
Für die weitere Entwicklung der Angebotsformen ist zudem zu berücksichtigen, dass<br />
aus der demographischen Entwicklung neuen Anforderungen an die Leistungserbringer<br />
hervor gehen. Die Schaffung neuer Angebote oder auch die Weiterentwicklung der bestehenden<br />
Angebote erfordert eine zeitnahe und planvolle Systemänderung.<br />
Ziel sollte ein abgestuftes Angebotssystem sein, wobei hier erst am Ende der Versorgungskette<br />
die stationäre Unterbringung in Heimen stehen kann. Natürlich muss sich<br />
72
hier jedes Glied der Versorgungskette wirtschaftlich rechnen, da es keine Quersubventionierungen<br />
geben soll.<br />
Im Hinblick auf die Stärkung gerade früher Glieder der Versorgungskette ("Ambulantisierung")<br />
wurde jedoch festgestellt, dass es zwischen der Finanzierung und Programmatik<br />
in der ambulanten Pflege einen deutlich wahrgenommenen Wiederspruch gibt. Einerseits<br />
soll die ambulante Versorgung von stationären Angeboten den Vorrang haben,<br />
andererseits wird von den Anbietern gerade in diesem Bereich ein besonders ehrgeiziger<br />
Spardruck erlebt.<br />
Im Hinblick auf die Versorgungskette wurde noch auf einen laufenden Modellversuch in<br />
Sachsen-Anhalt hingewiesen.<br />
Ergebnisse -4-<br />
Klärungsbedarfe/Fragen:<br />
–wirtschaftlicher Ressourceneinsatz in kleinen Betreuungseinheiten<br />
–ausreichende Finanzierung<br />
–notwendiges Personal (quantitativ und qualitativ)<br />
–personelle Beziehungskonstanz<br />
–Franchising<br />
–Arbeitsverhältnisse der Betreuenden (Status)<br />
–Heimaufsicht<br />
–wie weit gehen die Aufgaben<br />
–Verhältnis zum MdK<br />
–Ordnungspolitik oder Leistungskontrolle<br />
–<strong>für</strong> ambulant und stationär<br />
Die Diskussion zeigte eine ganze Reihe von Klärungsbedarfen / Fragen auf, die sich vor<br />
allem mit der Übertragung von Modellen des persönlichen Budgets in betreuten Hausgemeinschaften<br />
auf die Pflegelandschaft in der Bundesrepublik auseinander setzen.<br />
So ist zu überprüfen, wie denn in kleinen Betreuungseinheiten eine wirtschaftliche Leistungserbringung<br />
sichergestellt werden kann. Hier wurde es aus dem Kreis der Diskussionsteilnehmer<br />
ausdrücklich gewünscht, dass eine selbständige Inanspruchnahme von<br />
Leistungen bei ambulanten Anbietern erfolgt.<br />
Daneben ist selbstverständlich eine ausreichende Finanzierung sicherzustellen. Die zur<br />
ambulanten Pflege geschilderte Situation kann hier nicht zielführend sein.<br />
73
Des Weiteren ist auch das notwendige Personal erforderlich. Der zur Zeit wahrgenommene<br />
Fachkräftemangel ist bei Weiterentwicklungen der Leistungsangebote kritisch zu<br />
beobachten. Unter Umständen können hier aber auch gerade durch die Änderungen der<br />
Angebotsformen wieder attraktivere Arbeitsbedingungen geschaffen werden.<br />
Bei der Ambulantisierung der Betreuung ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass eine<br />
angemessene Beziehungskonstanz gewahrt bleibt. Täglich wechselnde Betreuer oder<br />
Hauswirtschaftskräfte können die Bewohner/innen eher verunsichern. Dieser Aspekt ist<br />
auch zu berücksichtigen wenn etwa über Franchising-Modelle nachgedacht wird, über<br />
die Pflegeleistungen in den betreuten Wohngemeinschaften erbracht werden.<br />
Im Unterschied zu den Niederlanden ist auch die arbeitsrechtliche Situation der Betreuenden<br />
genau zu betrachten. Je nach Status als Selbstständige oder Arbeitnehmer stellen<br />
sich andere Anforderungen.<br />
Abschließend wäre auch noch die zukünftige Stellung der Heimaufsicht zu klären, deren<br />
Aufgaben sich von den Consulenten unterscheidet. Hier sind der Aufgabenumfang aber<br />
auch die Abgrenzung gegen den MdK zu klären und ob es sich um ein Instrument der<br />
Ordnungspolitik oder der Leistungskontrolle handeln soll. Ferner wäre auch der Geltungsbereich<br />
im Hinblick auf die Versorgungskette zu bestimmen.<br />
74
8. AG2 - Leistungsvereinbarung zwischen Kommune und<br />
Leistungserbringer als Instrument der Selbststeuerung<br />
der Träger - Wolfgang Klein, Dirk Terlinden<br />
Moderation: Wolfgang Klein, Caritasverband Leverkusen e.V.<br />
Dirk Terlinden, Stadtverwaltung Leverkusen<br />
Erfahrungen mit Leistungsvereinbarungen und deren kritische Würdigung<br />
Mit Leistungsvereinbarungen zur "Wirkungsorientierten Steuerung" - hier zur "Selbststeuerung<br />
durch die Leistungserbringer" - wird Neuland in den Verhältnissen zwischen<br />
Kommune und Leistungserbringern betreten. Auf unterschiedlichstem Niveau werden<br />
Kontrakte zur Gewährung von Zuschüssen oder Teilleistungsentgelten vereinbart. Im<br />
Vordergrund stehen nach wie vor die Leistungs- oder sogenannte Produktbeschreibungen<br />
durch die Kommune sowie der Nachweis über die Verwendung der Mittel. Auch<br />
wenn einige Beteiligte über die bestehende Absicht von gemeinsam zu entwickelnden<br />
Vereinbarungen sinnen, wird deutlich, dass die Begrifflichkeiten "Wirkungsorientierung"<br />
und "Selbststeuerung" unterschiedlich interpretiert werden. Die wesentliche Hemmnis<br />
liegt im mangelnden Glauben, einem gemeinsamen Ziel verpflichtet zu sein. Die Schwierigkeiten,<br />
Bedürfnisse und somit deren Befriedigung (den Grad der Wirkung) zu beschreiben<br />
und alle Beteiligten an dem Prozess zu beteiligen sind offen erkennbar. Deutlich<br />
wird, dass beide Seiten sich um Besitzstände und Machteinflüsse sorgen. Auf Nachfrage<br />
wurde jedoch deutlich Änderungsbedarf hinsichtlich der Wirkungsorientierung benannt.<br />
Wobei allerdings die Frage "Was passiert mit unserem Geld" und nicht die Frage<br />
"wie können Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es den Trägern ermöglichen,<br />
eigenverantwortlich und ergebnisorientiert im Sinne einer Selbststeuerung zu operieren"<br />
im Vordergrund steht.<br />
Möglichkeiten und Chancen der Weiterentwicklung von Leistungsvereinbarungen<br />
Zur erfolgreichen Weiterentwicklung von Leistungsvereinbarungen - hier waren sich<br />
alle Arbeitsgruppenmitglieder einig - ist die Beteiligung aller Betroffenen zu gewährleisten.<br />
Die Bedürfnisermittlung sowie die Beschreibung der Leistung, die Zieldefinition sowie<br />
die Methode der Gradmessung des Erreichten ist im demokratischen Konsens zwischen<br />
Kostenträger, Leistungserbringer und Leistungsnehmer sowie den Mitarbeitern<br />
und den Akteuren im sozialen Umfeld zu gestalten. Durch Schaffung eines durchgängig<br />
transparenten Steuerungssystems wird Vertrauensbildung unterhalb der Beteiligten<br />
möglich. Gegenüber der Politik und Öffentlichkeit kann im System eine Einheit der Sprache<br />
geschaffen werden und so seinen Einsatz als Sozialmarketinginstrument finden.<br />
Eindeutig definiert werden muss, wer Vertragspartner ist und wer welche Funktion im<br />
Steuerungssystem übernimmt. Teilziele sind so zu benennen, dass sie voneinander abgrenzbar<br />
sind. Wird ein Ziel nicht erreicht, ist eine genauere Analyse der Gründe möglich.<br />
Nicht jedes objektive Ziel ist mit den individuellen Bedürfnissen deckungsgleich.<br />
Das Ziel, die Vermeidung von Heimunterbringung mag zwar objektiv richtig sein, kann<br />
aber konträr zu dem Wunsch eines älteren Bürgers stehen, gerade in einem <strong>Senioren</strong>heim<br />
die Kontakte zu finden, die Ihm in seinem häuslichen Umfeld aus verschiedenen<br />
75
Gründen verwehrt bleiben. Das dadurch bedingte Nichterreichen eines objektiven Zieles<br />
ist bei der Messung zu berücksichtigen, und die Leistung entsprechend anzupassen und<br />
zu bewerten<br />
Durch die Festlegung von quantifizierbaren Kriterien und das Setzen von zeitlichen und<br />
inhaltlichen Eckpunkten wird ein permanentes Controlling ermöglicht. Es muss den Akteuren<br />
bekannt sein, welche Konsequenzen zu erwarten sind, wenn festgelegte Ziele<br />
nicht erreicht werden.<br />
Nach klarer Benennung von Zielen kann die monetäre Bewertung erfolgen. Hier ist darauf<br />
abzuzielen, dass zunächst der Leistungserbringer definiert, wie er die Leistung vergütet<br />
haben möchte. Durch die gegebene Transparenz wird ein vergleichbarer Wettbewerb<br />
gefördert. Grundlage muss allerdings sein, dass private Anbieter den gleichen Zugang<br />
bekommen wie Wohlfahrtsverbände oder ähnliche Institutionen. Letztendlich fördert<br />
dieses System eine Grundlage zur inhaltlichen Diskussion. Die Politik wird in die<br />
Lage versetzt, Vorgaben hinsichtlich der sozialpolitischen Schritte und der Ergebnisse<br />
zu erarbeiten. Zudem wird sie mit der Frage konfrontiert, welchen Wert sie der Erreichung<br />
der von ihr gesteckten Ziele beimisst. Durch diese monetäre Bewertung wird die<br />
Leistungsbeschreibung geprägt sein. Da, wie oben bereits beschrieben, das Erreichen<br />
von Zielen in der sozialen Arbeit von sehr unterschiedlichen Faktoren abhängt ist auch<br />
die Vergütung daraufhin auszurichten. Dies kann durch entsprechende finanzielle Anreize,<br />
z.B. externe Ressourcen einzubinden, oder durch ein Bonussystem vielleicht ein<br />
höheres als nur kostendeckendes Entgelt erzielen zu können, erreicht werden. Starre<br />
Vergütungsmodelle die sich ausschließlich an den Kosten der Leistung orientieren, finden<br />
in der beschriebenen Weise der Leistungsvereinbarung keinen Platz mehr. Eine<br />
Frage muss jedoch im Vorfeld geklärt sein. Trägt der Leistungserbringer bei dieser vielschichtigen<br />
Problematik das alleinige finanzielle Risiko bei der Nichterreichung von Zielen?<br />
Im Sinne der Gewährung einer Planungssicherheit, aus dessen erzeugter Ruhe nur<br />
optimale Arbeit gestaltet werden kann, ist auch hier im Vorfeld Einigkeit und Klarheit, so<br />
die Arbeitsgruppe, zu erzielen.<br />
Anforderungen an Gesetze und Akteure<br />
Durchaus konträr wurde die Frage behandelt, ob zur Erreichung der Ziele in der Altenhilfe<br />
weitere gesetzliche Vorgaben notwendig seien. Erfreulich hierbei war die Einigkeit<br />
von Vertretern der Kommunen und der Träger, dass hierauf verzichtet werden könne,<br />
wenn man die Verhandlungen als gemeinsame Aufgabe verstehe. Die hierdurch ausgedrückte<br />
Zuversicht, zeugt von einer Annäherung der Vertragspartner. Diesen Weg erfolgreich<br />
zu beschreiten bedarf einer hohen persönlichen Motivation aller Beteiligten. Die<br />
Motivation zu fördern und zu erhalten wird eine zukünftige Herausforderung darstellen.<br />
Als Fazit der Arbeitsgruppe bleibt festzuhalten, dass die Gruppenmitglieder grundsätzlich<br />
den Abschluss von Leistungsvereinbarungen begrüßen und <strong>für</strong> ihren jeweiligen Bereich<br />
anstreben. Hierbei sind sicherlich die regionalen und trägerspezifischen Unterschiede<br />
und Besonderheiten zu berücksichtigen. Dieser Veränderungsprozess braucht<br />
jedoch Zeit. Es muss deutlich werden, dass nicht jedes gesteckte Ziel zu erreichen ist.<br />
Aber es stellt schon einen Erfolg dar, wenn analysiert werden kann, warum das Ziel<br />
nicht erreicht werden konnte.<br />
76
Ob sich jedoch die Leistungsvereinbarung als geeignetes Instrument der Selbststeuerung<br />
der Träger erweist, kann sich nur im laufenden Prozess entscheiden. Die Arbeitsgruppe<br />
hat dies nicht definitiv feststellen können.<br />
77
9. AG 3 Jugendhilfe - Qualitätsentwicklungsverfahren nach<br />
§78 a ff. SGB VIII als Unterstützung der Selbststeuerung<br />
von Einrichtungen? - Rainer Kröger, Jutta Lanfermann-<br />
Verweyen<br />
Moderation: Rainer Kröger, AFET, Hannover<br />
Jutta Lanferman-Verweyen, Essen<br />
Inhalte der AG:<br />
1. Zum Instrument der Qualitätsentwicklungsvereinbarung, Input<br />
2. Stand der Umsetzung sowie der mit der Einführung gesammelten Erfahrungen,<br />
Austausch<br />
3. Qualitätsentwicklungsverfahren als Unterstützung der Selbststeuerung von Einrichtungen?<br />
4. Kritische Würdigung des Instrumentes Qualitätsentwicklungsvereinbarung aus<br />
Sicht der wirkungsorientierten Steuerung,<br />
5. Notwendige künftige Entwicklungen bei den Akteuren,<br />
Erstellen eines Anforderungsprofils.<br />
Zentrale Ergebnisse der Diskussion:<br />
Die Frage der Selbststeuerung wirft weitere Fragen auf, die da sind: Wem dient das?<br />
Wozu Selbststeuerung? Wer steuert wen? Wer steuert auf welcher Ebene? Wie sieht<br />
der Bezugsrahmen aus?<br />
Die Leistungsberechtigten, Kinder, Jugendliche und Eltern, sind immer noch Objekt der<br />
Vereinbarungen zwischen Trägern von Einrichtungen der Erziehungshilfe und Trägern<br />
der öffentlichen Jugendhilfe. Die Betroffenen sowie die Praxis mit ihrem<br />
Erfahrungswissen sind in einem hochentwickelten System nicht an den (Dach) Vertragsverhandlungen<br />
beteiligt.<br />
Partizipation muss demzufolge als ein Kriterium <strong>für</strong> die Qualität des vorzuhaltenden<br />
Leistungsangebotes benannt und umgesetzt werden.<br />
Gefordert wird eine Diskussion zur Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe auf breitester<br />
Ebene, an der Betroffene und Beschäftigte sowie Politik beteiligt sind. An dieser Stelle<br />
ist zu betonen, dass auch der Jugendhilfeausschuss in die kommunale Qualitätsdiskussion<br />
einzubinden ist aufgrund seiner Zuständigkeit <strong>für</strong> Grundsatz- und Strukturfragen der<br />
örtlichen Jugendhilfe.<br />
Gegenstand der Qualitätsentwicklungsvereinbarung sind die Grundsätze und Maßstäbe<br />
<strong>für</strong> die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie geeignete Maßnahmen zu<br />
ihrer Gewährleistung. Die Kombination einer prozessbezogenen Fachdiskussion zum<br />
78
Qualitätsthema in einem äußerst komplexen Bezugsfeld sowie das auf Kooperation angelegte<br />
Aushandlungsgeschehen zwischen Kostenträger und Leistungserbringer gestaltet<br />
sich in der Praxis einerseits als schwierig und andererseits als faszinierend.<br />
Eine Grundschwäche in der "Zunft" der Jugendhilfe besteht doch darin, dass es derzeit<br />
keinen Konsens und somit auch keine Darstellung der Inhalte von Qualitätsentwicklungsvereinbarungen<br />
gibt. Um den Anforderungen des Gesetzes gerecht zu werden,<br />
muss es zeitnah zu gemeinsamen Festlegungen zur Qualitäts(weiter)entwicklung kommen.<br />
Gegenstand der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen sind Aspekte der Struktur-, der<br />
Prozess- und der Ergebnisqualität. Es ist ein lohnenswertes Ziel, dass ganz konkret vor<br />
Ort Träger in veränderter partnerschaftlicher Kooperation Vereinbarungen zur Qualitätsentwicklung<br />
erarbeiten und dieses neue Instrument umsetzen. Zwar richtet sich die Vorschrift<br />
in erster Linie an Qualitätsentwicklungen in Einrichtungen, bezieht aber auch die<br />
Beratungs- und Entscheidungsabläufe im Jugendamt ein. Dieses wird <strong>für</strong> den eigenen<br />
Handlungsbereich ebenfalls Qualitätskriterien beschreiben müssen und das Handeln<br />
daran überprüfen. Erst wenn Strukturen und Instrumente als Voraussetzungen angelegt<br />
sind, kann ein System der Jugendhilfesteuerung greifen.<br />
Eine qualitätsbezogene Wirkung der gesetzlichen Neuregelung ist die Anregung zu einer<br />
transparenten Kooperation zwischen Kostenträger und Leistungserbringer. Die Vereinbarungen<br />
zur Qualitätsentwicklung sind demzufolge ein Instrument zur Verbesserung<br />
der Zusammenarbeit zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und dem Träger<br />
und den Einrichtungen der Erziehungshilfe.<br />
Der Bundesgesetzgeber hat zum ersten Mal eine Verbindung hergestellt zwischen<br />
Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen. Die betriebswirtschaftliche<br />
und fachliche Intention werden dadurch miteinander verkoppelt, dass der Gesetzgeber<br />
den Abschluss aller drei Vereinbarungen zur Voraussetzung <strong>für</strong> eine Übernahme<br />
des Entgeltes erklärt und dadurch die beiden Zielrichtungen zusammenführt. Eine Herausforderung<br />
und Chance liegt in dem Erhalt der gesetzlich geforderten Einheit sowie in<br />
der Dynamik der Qualitätsdiskussion, ob sie letztlich zum Steuerungsinstrument in dem<br />
dreigliedrigen Vertragssystem wird.<br />
Wenn ein neues System als komplexes Unterfangen eingeführt wird, gibt es erfahrungsgemäß<br />
Blockaden und Ängste, die Qualität der eigenen Arbeit zu formulieren. Anstatt<br />
offensiv über Qualität und Instrumente konstruktiv zu streiten, verhält sich die Jugendhilfe<br />
eher defensiv. Feststeht, es ist erst der Anfang eines Prozesses, ein "junges Pflänzchen".<br />
Das, was praktisch vorliegt, sind erste (Zwischen)Schritte zu einem gemeinsamen<br />
Verständnis, zu Grundsätzen.<br />
Der Blick zurück zeigt zaghafte Konturen von Veränderungen im Sinne von fachlicher<br />
Weiterentwicklung im Laufe der Jahre. Die heutigen Diskussionen in ihren zielbezogenen<br />
fachlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekten haben deutlich eine andere dialogische<br />
Qualität.<br />
79
Notwendige zukünftige Entwicklungen:<br />
Die öffentliche Jugendhilfe muss ihr Profil verändern in Richtung Dienstleister. Sie muss<br />
sich öffnen <strong>für</strong> weiterentwickelte Berufsbilder, Aufgaben- und Personalprofile.<br />
Der öffentliche Träger muss sich bewusst sein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
im ASD eine Schlüsselposition haben und notwendige Konsequenzen daraus ableiten.<br />
Das Thema Personalentwicklung tritt in den Vordergrund.<br />
Es besteht dringender Bedarf nach der Entwicklung von handlungsforschenden Instrumenten<br />
in Kooperation mit Hochschulen sowie nach fortlaufender Evaluation und Dokumentation.<br />
Anzufragen sind die vorhandenen (Verwaltungs)strukturen. Zukunftsfähig im Sinne der<br />
wirkungsorientierten Steuerung ist ein offenes System der Jugendhilfesteuerung, das<br />
Leistungsberechtigte und auch Praxis systematisch integriert.<br />
Die längst fällige Qualitätsdebatte ist einzuläuten, es besteht dringender Handlungsbedarf.<br />
Mit einer großen Bereitschaft der an der Qualitätsentwicklung beteiligten Personen zur<br />
Offenheit kann der Prozess gelingen.<br />
Abschliessend - oder last not least:<br />
Wie bewerten Sie das Instrument Qualitätsentwicklungsvereinbarung aus Sicht der wirkungsorientierten<br />
Steuerung?<br />
18 abgegebene Stimmen (Punkte); 12 AG Mitglieder halten das Instrument <strong>für</strong> gut im<br />
Sinne von angemessen, sinnvoll, chancenreich; eine Enthaltung; 5 kritische Stimmen.<br />
Literatur 3<br />
3 Renate Mayntz, Steuerung, Steuerungsakteure und Steuerungsinstrumente: zur Präzisierung des<br />
Problems, Universität-Gesamthochschule Siegen, HiMoN-Dislussionsbeiträge 70/86<br />
Felix Welts/Constanze Sulek: Die individuelle Konkretisierung des sozialrechtlichen Anspruchs auf<br />
Rehabilitation in VSSR5/2000 S. 453 ff.<br />
80
10. Ergebnisse der AG 4 Behindertenhilfe - Persönliches<br />
Budget und die Selbststeuerung behinderter Menschen –<br />
<strong>Dr</strong>. Gerd Schneider, Joachim Speicher, <strong>Dr</strong>. Annette Wilcke<br />
Moderation: <strong>Dr</strong>. Gerd Schneider, Leipzig<br />
Joachim Speicher, Paritätische Psychiatrische Dienste, Main<br />
<strong>Dr</strong>. Annnette Wilcke, Hamburg<br />
Einleitung<br />
Die Einführung „persönlicher Budgets <strong>für</strong> Menschen mit Behinderung“ in Rheinland-<br />
Pfalz (1997) und anderen Bundesländern führte in allen Kreisen der Beteiligten zu einer<br />
Vielzahl an Fragen und Einsprüchen, aber auch zu frenetischem Beifall und euphorischen<br />
Bejahungen.<br />
In der Tendenz hatten vergleichbare Projekt im Ausland 4 auf verschiedenen Ebenen<br />
offensichtlich bemerkenswerte Erfolge zu verzeichnen. Kurz gesagt: Zufriedenheit, Lebensqualität<br />
und Selbstbestimmung der Budgetinhaber stiegen im Vergleich zu Nutzern<br />
herkömmlicher Sachleistungen. Gleichzeitig wurde vielerorts festgestellt, dass diese<br />
neue „Instrument“ zumindest kostenneutral eingeführt werden konnte.<br />
Persönliche Budgets - wie sie die Selbstbestimmung fördern können<br />
Die Arbeitsgruppe 4 der 3. Magdeburger Tagung hat die Fragen und Kontroversen sowie<br />
die Möglichkeiten und Grenzen intensiv diskutiert.<br />
Im Ergebnis hat die Gruppe sowohl Rahmenbedingungen als auch notwendige Prozessvariablen<br />
formuliert. Will man mit „Persönlichen Budgets“ den Grad der Selbstbestimmung<br />
(hier synonym zu: Selbststeuerung) optimieren, so müssen diese Rahmenbedingungen<br />
nach Einschätzung der Teilnehmer/innen notwendigerweise zwischen allen<br />
Beteiligten je nachdem bearbeitet und/oder verhandelt und /oder vereinbart werden.<br />
„Persönliche Budgets“ in Rheinland-Pfalz<br />
Der rheinland-pfälzische Modellversuch ist in entscheidenden Punkten stark geprägt<br />
vom (in Zeiten knapper Ressourcen durchaus nachvollziehbaren Motiv) Kosten einzusparen.<br />
Er verzichtet bislang weitgehend, gleichermaßen einen Wettbewerb über Qualität<br />
anzuregen. Gefördert wird nur der Preiswettbewerb. Die Folgen dieser radikalmarktwirtschaftlichen<br />
Vorgehensweise müssen in den Fokus der Diskussion gestellt<br />
werden.<br />
Das SGB IX sieht in § 17 die Möglichkeit der Erprobung persönlicher Budgets in der gesamten<br />
Republik vor. Damit ist das Thema nicht mehr nur eine rheinland-pfälzische<br />
Spezialität.<br />
4 Vgl. hierzu die Ausführungen in der Dokumentation zur 1. Magdeburger Tagung über die Entwicklung in Holland.<br />
81
Die Arbeitsgruppe hat folgende Problemstellen erarbeitet:<br />
Problemstelle 1 - Auswahl des Personenkreises<br />
Zu welchem Zeitpunkt auch immer – bei der Einführung persönlicher Budgets wird man<br />
entscheiden müssen, ob dieses neue Form allen Menschen mit Behinderungen zuteil<br />
werden soll oder nur einem eingeschränkten Personenkreis.<br />
Öffnet man die Budgets <strong>für</strong> alle, muss man zwangsläufig sich über die Formen der Unterstützung<br />
und Bedarfsartikulierung einig werden, die insbesondere <strong>für</strong> jene Menschen<br />
notwendig werden, die sich aufgrund ihrer Beeinträchtigungen nicht über Bedarfe und<br />
Ziele äußern können.<br />
Schränkt man andererseits den Zugang ein, müssen nachvollziehbare und transparente<br />
Kriterien der Abgrenzung und Auswahl gefunden werden.<br />
In der Tendenz war die AG der Auffassung, das persönliche Budget allen Personen zugänglich<br />
zu machen, <strong>für</strong> die diese Leistung eine bedarfsgerechte Hilfe darstellt. Selbstbestimmung<br />
kann nicht ein Privileg einiger, sondern muss der Anspruch aller Menschen<br />
mit einem entsprechenden Hilfebedarf sein.<br />
Problemstelle 2 - Indikation<br />
Nahtlos schließt daran die Frage an, wie der vorgenannte Hilfebedarf ermittelt werden<br />
kann. In Rheinland-Pfalz sind zur Zeit vier Stellungnahmen notwendig, die die sogenannte<br />
Verwaltungskonferenz beim örtlichen Sozialhilfeträger benötigt, um einen Antragsteller<br />
als Budgetinhaber anzuerkennen.<br />
Es werden in umfangreichen Befragungsbögen die Meinungen des Betroffenen, des<br />
Sozialmedizinischen Dienstes, des Sozialhilfeträgers und der aufnehmenden/abgebenden<br />
Einrichtung berücksichtigt. Allerdings liegt kein einheitliches Verfahren<br />
vor, wie diese Stellungnahmen am Ende in die Entscheidung einfließen, ob ein Budget<br />
gewährt wird oder nicht. Auch nicht, in welche der drei vorgesehenen Budgetstufen<br />
eingeordnet werden soll.<br />
Die Arbeitsgruppe vertrat die Meinung, dass hier zwingend die Einführung eines Hilfeplanverfahrens<br />
5 erfolgen muss, das - vielleicht eingebettet in entsprechende kommunale<br />
Hilfeplankonferenzen - die Zielvorstellungen des Hilfesuchenden berücksichtigt. Das<br />
Verfahren müsste dialogisch darauf ausgerichtet sein, insgesamt alle Beteiligten einzubeziehen.<br />
Die Beteiligung des Klienten in einem solchen Hilfeplanverfahren ist unabdingbar. Die<br />
Teilnehmer/innen waren der Meinung, dass damit mit dem Instrument „Persönliches<br />
Budget“ tatsächlich fachlich die Selbstbestimmung und die Wahlfreiheit des Hilfeempfängers<br />
gefördert werden könnte.<br />
5 Vgl. die entsprechenden Ausführungen in der Dokumentation zur 1. Magdeburger Tagung<br />
82
In einem entsprechenden Hilfeplanverfahren müssen sich die professionellen Leistungsanbieter<br />
am Hilfebedarf und seiner Quantität orientieren. So kann der Wettbewerb<br />
über Qualität initiiert und zugleich ein Preis- und Lohndumping zulasten professioneller<br />
Leistungsqualität verhindert werden.<br />
Das setzt aber voraus, dass der individuelle Hilfebedarf und die daraus erforderlichen<br />
Hilfeleistungen notwendigerweise die Basis der Kalkulation des Persönlichen Budgets<br />
bilden müssen.<br />
Der Arbeitsgruppe war hier aber auch eine Klarstellung wichtig:<br />
Die Freiheit, sich den Anbieter oder die Hilfeart seiner Wahl auszusuchen, muss dem<br />
Budgetinhaber unbenommen bleiben.<br />
Problemstelle 3 – Bedarfsdeckung<br />
In Rheinland-Pfalz leitet sich die Höhe der Budgets aus dem Vorbild der Pflegeversicherung<br />
ab. Der individuelle Hilfebedarf des Budgetinhabers und die sich daraus ableitenden<br />
Leistungen stehen nicht im Zentrum der Überlegungen, wie hoch der zu gewährende<br />
Budgetbetrag zu sein hat.<br />
Die Vermutung, dass hier offensichtlich primär aus Gründen der Kosteneinsparung pauschalierte<br />
und knappe Beträge gewählt worden sind, liegt nahe. Die individuelle Bedarfsdeckung<br />
wird in den Hintergrund gedrängt.<br />
Natürlich muss der Budgetinhaber auch im Kreis der Nachbarn, Freunde und <strong>Familie</strong> die<br />
Leistungen, die er benötigt, finden dürfen und mit „Anerkennungsbeträgen“ aus seinem<br />
Budget bedienen können.<br />
Im Alltagsleben geschieht dies schließlich ständig in vergleichbarer Weise. Wenn der<br />
Budgetinhaber auf professionelle Hilfe angewiesen ist, weil die notwendig Leistungserbringung<br />
doch komplizierter ist als erwartet? Dann müssen Budgetinhaber auch aufgrund<br />
ihrer Budgetausstattung in der Lage sein, sich am Markt professioneller Anbieter<br />
und Leistungen bedienen zu können.<br />
Budgetinhaber in Rheinland-Pfalz treffen aber nicht auf solche Alltagsgegebenheiten.<br />
Sie können bislang auf keinen funktionierenden Markt zurückgreifen, der den Qualitätswettbewerb<br />
der professionellen Anbieter stützen würde.<br />
Problemstelle 4 – Einkauf von Leistungen<br />
Geänderte Geschäftsbeziehungen<br />
Die professionellen Leistungsanbieter müssen sich daran gewöhnen, attraktive und bedarfsorientierte<br />
Angebote zu unterbreiten. Sie werden zukünftig nicht mehr allein<br />
bestimmen, wie der Bedarf ihrer Klienten aussieht und wie man ihn zu decken gedenkt.<br />
Und die Leistungsträger müssen akzeptieren, dass persönliche Budgets, die die Nutzung<br />
eines solchen Marktes auch ermöglichen sollen, die Teilhabe nicht von vornherein<br />
aufgrund ihrer Höhe eher ausschließen.<br />
83
Marktförderung und Verbraucherberatung<br />
Persönliche Budgets – so übereinstimmend die Teilnehmer/innen der Arbeitsgruppe –<br />
führen zu einer verstärkten marktwirtschaftlichen Orientierung in der Eingliederungshilfe.<br />
Der damit einhergehende Strukturwandel muss von allen Beteiligten planvoll und<br />
zielgerichtet vollzogen werden.<br />
Was darf in der Entwicklung „Persönlicher Budgets“ nicht eintreten?<br />
� Die individuellen Bedarfe werden festgestellt, aber die Budgets als finanzielle Ressource<br />
der einzelnen Hilfeempfänger reichen nicht aus, eine wiederkehrende Nachfrage<br />
entstehen zu lassen.<br />
� Eine Nachfrage ist nicht ausreichend, um einen Anbietermarkt zu initiieren.<br />
� Budgetinhaber als Marktteilnehmer und Verbraucher sehen sich Angeboten gegenüber,<br />
deren Preis-Leistungsverhältnis und Qualität sie ohne Verbraucherberatung<br />
und Information nicht angemessen beurteilen können.<br />
Der Arbeitsgruppe erscheint es, dass das Instrument „Persönliches Budget“ als Element<br />
wirkungsorientierter Steuerung ohne öffentliche Markt- und Strukturförderung, wie sie<br />
allenthalben in anderen Branchen alltäglich und selbstverständlich ist, nicht zur „Wirkung“<br />
kommt.<br />
Verbraucherberatung<br />
Beim Aufbau des Instruments der „Persönlichen Budgets“ spielt zu Beginn die öffentliche<br />
Förderung von unabhängigen Beratungsmöglichkeiten (z.B. auch durch Erfahrenen-<br />
und Betroffenenverbände) eine zentrale Rolle.<br />
In der Umgestaltung ihrer Dienste und Einrichtungen müssen sich die Träger und ihre<br />
Mitarbeiter darauf einrichten können, bedarfsgerechte „Kundenberatung“ erbringen zu<br />
können.<br />
Problemstelle 5 – Inanspruchnahme der Leistungen<br />
Betroffene, Angehörige, Mitarbeiter und die Verantwortlichen in den Einrichtungen, aber<br />
auch bei den Leistungsträgern müssen den Umgang mit dem neuen Instrument und<br />
seinen Prämissen erlernen und einüben. Das erfordert die Bereitschaft aller und natürlich<br />
auch die Bereitschaft, diesen Wandel finanziell zu fördern.<br />
Verwendungsnachweis<br />
In Rheinland-Pfalz werden die Budgets direkt und in bar an die Hilfeempfänger ausgezahlt.<br />
Ein Verwendungsnachweis ist nicht erforderlich. Eine Laufzeit und eine formalisierte<br />
Überprüfung der Wirksamkeit ist (noch) nicht vorgesehen. Begründet wird dieses<br />
Vorgehen häufig mit der Erzielung einer maximalen Selbstbestimmung.<br />
84
Damit gewinnen die Budgets eher einen Charakter, der dem eines „Gehaltes“ vergleichbar<br />
ist. Das hat natürlich auch sein Gutes: Gehaltsempfänger lassen sich in der Regel<br />
auch nicht vorschreiben, wie und wozu sie ihr Geld verwenden werden.<br />
Niemand wird bestreiten, dass Gehälter zur Verbesserung der Teilhabe am Leben in der<br />
Gesellschaft nicht unwesentlich beitragen. Wie die Teilhabe dann aussieht, ist eine rein<br />
individuelle Angelegenheit. Es wäre sicher aberwitzig, wenn der, der das Gehalt auszahlt,<br />
vorschreiben würde, wie oft und wann und mit wem der Gehaltsempfänger ins<br />
Kino oder ins Restaurant oder nach Mallorca zu gehen hat. Gehälter werden ohne Festschreibung<br />
eines Verwendungszwecks ausgezahlt. Die Zielorientierung festzulegen ist<br />
nicht Angelegenheit dessen, der zahlt.<br />
Genau hierin besteht der gravierende Unterschied zu persönlichen Budgets. Sie werden<br />
vom Kostenträger in Rheinland-Pfalz als Mittel zur ambulanten Eingliederungshilfe verstanden.<br />
Zielorientierung und Erfolgskontrolle<br />
Damit ist eine Zweckbindung und Zielorientierung der Mittel vorgegeben, die überprüft<br />
werden muss.<br />
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: überprüft werden muss die Zielorientierung.<br />
Das heißt, eine Überprüfung darf sich nicht auf die freie Wahl der Mittel beziehen.<br />
Wie der Budgetinhaber seine Ziele erreichen möchte, ist seiner Selbstbestimmung<br />
zu überlassen.<br />
Da es aber bei der Auszahlung der Budgets um die Rechtsgrundlage der Eingliederungshilfe<br />
geht , kann es keine Entscheidungsfreiheit geben zwischen einer Verausgabung<br />
der Budgets im Sinne der Eingliederungshilfeziele oder einer völlig anderen,<br />
dem Belieben anheimgestellten Bestimmung.<br />
Wenn das wirklich gewünscht wäre, dann müssen behinderte Menschen auskömmliche<br />
Grundrenten oder tatsächlich bedarfsdeckende Gehälter bekommen, nicht aber persönliche<br />
Budgets.<br />
In der Arbeitsgruppe war man sich einig, dass damit in jedem Fall Verfahren zum Berichtswesen<br />
und zur Dokumentation notwendig werden, die eine zielorientierte Erfolgskontrolle<br />
ermöglichen.<br />
Mit dieser Erfolgskontrolle schließt sich der Zirkel in einer erneuten Indikationsstellung<br />
entweder mit der Gewährung eines erneuten Budgets oder aber mit der Feststellung,<br />
dass vielleicht keine Bedarf mehr besteht.<br />
Fazit:<br />
Persönliche Budgets werden sehr dazu beitragen können, den betroffenen Menschen<br />
ihre Selbstbestimmung zu ermöglichen. Sie werden helfen, die Angebote professioneller<br />
Hilfen bedarfsorientierter und zielbestimmter an den Interessen der Klienten auszurichten.<br />
85
Persönliche Budgets werden aber zu einem Instrument falsch verstandener Marktorientierung,<br />
wenn sie nicht eingebettet sind in die individuelle Bedarfsdeckung und in einen<br />
Markt, der sich über den Qualitätswettbewerb professioneller Anbieter definiert.<br />
So wie die Arbeitsgruppe 4 mit ihren Arbeitsergebnissen in der guten „Magdeburger“<br />
Tradition der kooperativen und produktiven Auseinandersetzung zwischen Leistungsträgern,<br />
Leistungserbringern und anderen Beteiligten stand, muss auch die Weiterentwicklung<br />
„persönlicher Budgets“ eine integrative Aufgabe aller sein. Sie erfordert unabdingbar<br />
die Kooperation aller Verhandlungspartner. Die Weiterarbeit lohnt!<br />
86
11. Podiumsdiskussion - Chancen und Grenzen der Selbststeuerung<br />
- Kommentare aus Sicht der Betroffenen, des<br />
Sozialrechts, der Kommune sowie aus Trägersicht -<br />
Heike Baehrens, <strong>Dr</strong>. Peter Gitschmann, Liesbeth Reitsma,<br />
<strong>Dr</strong>. Bernd Schulte, <strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Podiumsdiskussion mit: Heike Baehrens, Diakonisches Werk, Stuttgart; <strong>Dr</strong>. Peter<br />
Gitschmann, Behörde <strong>für</strong> Arbeit, Gesundheit und Soziales, Hamburg; Liesbeth Reitsma,<br />
Per Saldo, Utrecht (NL); <strong>Dr</strong>. Bernd Schulte, Max-Planck-Institut <strong>für</strong> ausländisches und<br />
internationales Sozialrecht, München<br />
Moderation: <strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong>, JSB mbH, Bonn<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Zum Abschluss der Tagung wollen wir das, was von Ihnen gestern in den Arbeitsgruppen<br />
diskutiert wurde, mit den gestrigen Referaten verbinden. Wir verlassen jetzt also<br />
wieder die Instrumentenebene. Ich habe vorhin schon etwas ketzerisch angedeutet,<br />
dass es ein typisch deutscher Weg ist, über Instrumente das Heil in der sozialen Arbeit<br />
zu suchen. Ich möchte den Dezernenten aus Leverkusen zitieren, der zu seiner Motivation,<br />
sich auf wirkungsorientierte Steuerung einzulassen, sagte: „Was nützen mir all die<br />
Instrumente, wenn ich nicht weiß, wo<strong>für</strong> ich sie einsetze.“ Präziser kann man es nicht<br />
auf den Punkt bringen. Nichtsdestotrotz möchte ich das Thema Instrument noch mal als<br />
Einstieg nutzen, um dann langsam auf die Systemebene zu kommen.<br />
Ich begrüße zunächst einmal, zu meiner Linken, Frau Heike Baehrens. Sie ist Geschäftsführerin<br />
des Diakonischen Werkes Württemberg, zuständig <strong>für</strong> Jugendhilfe, Altenhilfe,<br />
Behindertenhilfe und Ambulante Pflege. Frau Reitsma ist Ihnen ja bereits von<br />
ihrem gestrigen Vortrag bekannt. Ganz links von mir begrüße ich Herrn <strong>Dr</strong>. Bernd Schulte<br />
vom Max-Planck-Institut <strong>für</strong> ausländisches und internationales Sozialrecht in München,<br />
der dort zum Sozialrecht forscht und der sich aus internationaler Perspektive noch<br />
einmal kritisch zu dem äußern wird, was wir hier diskutiert haben. Besonders freue ich<br />
mich, dass es uns gestern auf Grund der hervorragenden Leistungen unserer Scouts<br />
gelungen ist, doch noch jemanden aus dem kommunalen Bereich <strong>für</strong> das Podium zu<br />
gewinnen: Herr <strong>Dr</strong>. Peter Gitschmann von der Behörde <strong>für</strong> Arbeit, Gesundheit und Soziales<br />
in Hamburg aus dem Bereich Eingliederungshilfe, Behindertenhilfe. Ich darf auch<br />
Sie herzlich begrüßen. Danke, dass Sie sich ein Herz gefasst haben, ich hoffe Sie haben<br />
nicht zu schlecht geschlafen, nachdem wir Ihnen das gestern Abend nahe gelegt<br />
haben.<br />
Herr <strong>Dr</strong>. Gitschmann, ich möchte gleich meine erste Frage an Sie richten. Ist das persönliche<br />
Budget, wie auf dieser Tagung hier angekündigt, eine Einladung zur Selbstbedienung<br />
der Klienten oder wird es sich am Schluss darauf reduzieren, dass man zwischen<br />
Mahlzeiten wählen darf?<br />
87
<strong>Dr</strong>. Peter Gitschmann<br />
Nach meiner Überzeugung weder noch. Es ist sicher kein Allheilmittel, ein völlig neues<br />
Angebot <strong>für</strong> alle behinderten Menschen, sondern nach meiner Überzeugung eine wichtige<br />
zu entwickelnde weitere Option in der Behindertenhilfe und in der Rehabilitation. Für<br />
wen es insbesondere in Frage kommt, welche Bedarfe damit auch gut gedeckt werden<br />
können: da muss man einfach Erfahrungen machen und sollte entsprechend offen sein.<br />
Man sollte eines nicht tun, was in der Diskussion immer mal wieder als Gefahr von mir<br />
gesehen wird, nämlich versuchen, das vorher theoretisch festzulegen, sondern wir sollten<br />
jetzt einfach in die Praxis gehen und schauen was passiert. Dann wird sich dieses<br />
Element stabilisieren und auch Profil gewinnen. Natürlich dürfen aus meiner Sicht persönliche<br />
Budgets auch nicht beliebig sein. Also die aus dem Budget finanzierte Mallorca-Reise<br />
– ich versuche mir das immer vorzustellen, weil das immer als nächstes<br />
kommt – war angeblich total erfolgreich. Was kann das dann <strong>für</strong> ein Eingliederungs- oder<br />
Rehabilitationsbedarf gewesen sein? Mag alles vorstellbar sein. Aber wichtig ist<br />
doch, ein persönliches Budget bleibt Eingliederungshilfe, bleibt Rehabilitationsleistung,<br />
die nach SGB IX ausgeprägt ist. Das heißt, ein gewisser Rahmen ist vorgegeben, der<br />
kann nicht überschritten werden. Und wenn dann innerhalb dieses Rahmens und innerhalb<br />
vereinbarter Ziele <strong>für</strong> die Budgetverwendung, das ist das entscheidende Element<br />
der Steuerung, dann auch die Maßnahme Reise nach Mallorca sinnvoll ist, dann kann<br />
sie stattfinden und dann sehe ich da kein Problem. Wenn es aber diesen Rahmen überschreitet,<br />
dann ist es ein Problem und dann muss man sicherlich sehr schnell darüber<br />
reden, wie man das bereinigen kann. Ein weiterer Aspekt, den ich erwähnen will, vielleicht<br />
schlägt das auch schon ein bisschen eine Brücke zu dem was insbesondere Professor<br />
Blanke gestern gesagt hat, ich denke es ist ein Rollenwechsel aller Beteiligten<br />
erforderlich. Damit das ans Laufen kommt und funktionieren kann. Ein persönliches<br />
Budget als hoheitliche Gabe, die verliehen wir dann da<strong>für</strong> besonders Qualifizierte an<br />
Hand eines Kriterienkataloges, das wäre sicherlich ein Irrweg. Ich denke man muss sich<br />
verständigen. Man muss kommunizieren und einen Konsens finden. Darüber, welche<br />
Ziele der Eingliederung, der Rehabilitation man verfolgen will und wie viel Geld, welches<br />
Budget man denn da<strong>für</strong> braucht. Und zu dem Konsens gehört auch die gemeinsame<br />
Überzeugung des Sozialhilfeträgers, der diese Leistung ja bewilligt, und des behinderten<br />
Menschen, dass es sinnvoll ist, dies mit einem persönlichen Budget zu versuchen. Dieser<br />
Konsens sollte gesucht werden und das bedeutet also, dass erhebliche Rollenveränderungen<br />
allenthalben stattfinden müssen. Ein Sozialhilfeträger bewilligt halt nicht<br />
mehr eine Sachleistung, soundsoviel DM Kostenzusage oder so etwas, sondern er moderiert<br />
eine Konferenz, einen Kommunikationsprozess, er stellt einen Konsens über Ziele,<br />
über die Laufzeit, über die Budgethöhe fest. Dazu braucht er Qualifizierung und Begleitung.<br />
Niemand aus den Sozialämtern kann das aus dem Stand zur Zeit. Da müssen<br />
wir auch daran denken. Aber auch der behinderte Mensch muss sich halt tatsächlich in<br />
die Rolle begeben desjenigen, der das Wie der Budgetverwendung dann auch wirklich<br />
selbst bestimmt. Möglicherweise mit qualifizierter Unterstützung und Anleitung. Aber das<br />
ist seine Rolle und das muss er wollen und können. So auch die Kriterien in Großbritannien:<br />
„willing and able“. Und die Leistungsanbieter, um das auch noch zu sagen, können<br />
auch daran mitwirken, sollten sich aber auch insofern öffnen, dass sie vielleicht dann<br />
doch bedürfnisorientierte neue Angebote ausprägen, die gerade <strong>für</strong> Budgetnehmerinnen/<br />
Budgetnehmer in Frage kommen. Das ist alles ein gemeinsamer Lernprozess, von<br />
dem ich hoffe, dass er unter der Überschrift „persönliche Budgets“ in Gang kommt, in-<br />
88
dem man gemeinsam ausprobiert und das entwickelt und dann wird es Kontur haben.<br />
Und da halte ich, das will ich auch noch sagen als Brücke zur gestrigen Diskussion, den<br />
Impuls des SGB IX <strong>für</strong> eine ungeheure Chance. Die Aufforderung, Modelle zu erproben.<br />
Und zwar nicht nur in der Sozialhilfe, das muss ich auch noch sagen. Die Rehabilitationsträger,<br />
der Sozialhilfeträger ist nur einer, sollen solche Modelle erproben. Das heißt<br />
diese Perspektive wird geöffnet über die Sozialhilfe hinaus. Und hier können wir in geeigneten<br />
Fällen darüber reden, ob ein Budget nicht neben den Eingliederungshilfeleistungen<br />
auch aus Krankenversicherungsleistung, aus Rentenversicherungsleistung, als<br />
Reha-Leistung jeglicher Couleur gespeist werden kann. Das ist spannend und das verändert<br />
ein System, welches bisher noch viel zu sehr kausal und viel zu wenig final orientiert<br />
ist.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Frau Reitsma, mir ist gestern aufgefallen, dass beim persönlichen Budget das, was frei<br />
zur Verfügung steht, mit 200 Gulden im Monat eigentlich doch relativ wenig ist. Traut<br />
man den Menschen nicht mehr zu? Oder ist der geheime Fahrplan nicht doch der, wir<br />
versuchen es billiger zu machen?<br />
Liesbeth Reitsma<br />
Die Diskussion die hier stattfindet, über die Reise nach Mallorca, hat es natürlich auch in<br />
Holland gegeben. Man hatte Angst, dass Leute nicht in der Lage sind, selber zu<br />
bestimmen, was notwendig ist im Leben, um überhaupt zu überleben. Das war bei uns<br />
natürlich eine ganz wichtige Sache. Der Staat hat damit auch begründet, dass erst einmal<br />
mit einem Freibetrag von 200 Gulden pro Monat angefangen wird. Ich habe aber<br />
auch erzählt, dass 2002 eine neue Regelung kommt. Da<strong>für</strong> sind zwei Alternativen vorgesehen,<br />
die Diskussionen laufen noch, ich weiß im Moment noch nicht wie entschieden<br />
wird. Die erste Alternative ist dann, dass die Leute das Geld in einer ganz großen Summe<br />
bekommen, die als Einkommensteil zu bezahlen ist. Die zweite Alternative sind Gutscheine.<br />
Auch da ist wieder ein bisschen Misstrauen vorhanden, können die Leute das?<br />
Bei den Experimenten, die es gegeben hat, bevor man angefangen hat, haben die Budgetinhaber<br />
den ganzen Betrag bekommen. Der wurde auch gut verwendet und es gab<br />
überhaupt kein Problem mit der Bestimmung von Geld. Das wurde später gut nachgewiesen:<br />
Welche Auftraggeber wurden dabei einbezogen usw.? Auch <strong>für</strong> die Steuerung<br />
war das wichtig, damit man das gut kontrollieren kann. Für mich ist es keine Frage. Die<br />
Leute bekommen eine Indikation und die Indikation ist ganz nah mit der Person verbunden:<br />
Was braucht man? Wie viele Stunden Pflege? Wie viele Stunden Betreuung sind<br />
notwendig? Das sind Beträge, ausgerichtet auf Stunden. Und die Leute brauchen die<br />
200 Gulden pro Monat, das ist notwendig.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Das heißt, ihre Botschaft lautet: Die Betroffenen wissen wirklich, was sie brauchen.<br />
89
Liesbeth Reitsma<br />
Man kann Unterstützung bekommen, auch wenn man seinen eigenen Lebensplan noch<br />
nicht so richtig vor Augen hat. Und dies ist vielleicht mit der Einsicht verbunden, wie läuft<br />
meine Krankheit? Verläuft sie wirklich progressiv oder geht es langsam? Wann muss ich<br />
wieder eine neue Indikation haben? Solche Sachen kann man gut beobachten.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Nun ist das persönliche Budget als Begriff ja nichts Neues. Wenn man genau in das<br />
SGB XI hineinschaut, kennen wir schon Geldleistungen. Also, so ganz neu ist es doch<br />
nicht. Frau Baehrens, wie bewerten Sie die Erfahrungen mit den Geldleistungen, die ja<br />
schon einen Misstrauensabschlag beinhalten, wie wir gestern gehört haben?<br />
Heike Baehrens<br />
Ich bin jetzt überrascht, dass Sie direkt auf das SGB XI kommen, aber genau da haben<br />
wir das persönliche Budget in Deutschland schon, auch wenn es dort nicht so bezeichnet<br />
ist. Aber diese Geldleistungen sind im Grunde nichts anderes als ein persönliches<br />
Budget. Hier wird dem pflegebedürftigen Menschen dieses Geld unmittelbar zur Verfügung<br />
gestellt. Zur freien Verwendung. Sie können es einsetzen <strong>für</strong> Sachleistungen. Sie<br />
können die Pflegedienste oder andere Hilfen da<strong>für</strong> in Anspruch nehmen oder auch<br />
selbst sich Personal sozusagen beschaffen und auch vor allem die Leistungen von Angehörigen<br />
können jetzt auf diese Weise tatsächlich zu einem gewissen Maße vergütet<br />
werden. Und nicht zu vergessen auch die möglichen Rentenversicherungsleistungen,<br />
die in Anspruch genommen werden können. Wir haben da im Grunde schon eine Form<br />
von persönlichem Budget in unserer Sozialgesetzgebung als ein Element. Und ich finde,<br />
das funktioniert relativ gut.<br />
Es waren alle bei Einführung der Pflegeversicherung überrascht, dass diese Geldleistungen<br />
in so hohem Maße in Anspruch genommen wurden. Und trotzdem sind die Pflegedienste<br />
praktisch in gleich hohem Maße weiter in Anspruch genommen wurden oder<br />
haben sogar noch weiter expandiert. Das lief also praktisch parallel. Insofern führt - das<br />
muss man sich glaube ich noch mal klar machen - die Einführung von einem persönlichen<br />
Budget - jedenfalls wenn man die Erfahrung aus der ambulanten Pflege übertragen<br />
kann - nicht automatisch dazu, dass sich das Hilfesystem verändert. Sondern es<br />
führt zunächst einmal dazu, dass die Betroffenen Spielräume bekommen, wirklich <strong>für</strong><br />
eigene Entscheidungen, <strong>für</strong> Selbstbestimmung, welche Pflegeleistungen oder welche<br />
unterstützenden Leistungen sie in Anspruch nehmen wollen, und das sollte auch weiterhin<br />
das Hauptziel sein. Trotzdem hat es zu Veränderungen geführt. Es hat zu einer enormen<br />
Ausdifferenzierung in der Hilfelandschaft im ambulanten Bereich geführt. Und<br />
dieses, denke ich, ist positiv. Das ist positiv <strong>für</strong> die Betroffenen, weil sie einfach ein viel<br />
größeres Leistungsspektrum haben, weil sie viel mehr Möglichkeiten haben auszuwählen.<br />
Ich denke, es ist auch positiv <strong>für</strong> unsere Dienste, die damit neue Spielräume gefunden<br />
haben, auch Dinge auszuprobieren.<br />
Man muss aber trotzdem sagen, dass es bei dem ganzen Thema einen dicken Haken<br />
gibt und dieser Haken wurde in dieser Tagung bisher nicht diskutiert. Deshalb ist es mir<br />
wichtig, das auch gleich in diesem einleitenden Statement zu sagen. Das ist mir auch im<br />
90
nachhinein bei Frau <strong>Dr</strong>. Friedrichs aufgefallen, das hätte ich gestern nach Ihrem Referat<br />
noch fragen können. Es gibt ein wesentliches weiteres Steuerungselement in der Sozialgesetzgebung<br />
und das sind nämlich die neuen Finanzierungssysteme. Das sind unsere<br />
neuen Entgeltsysteme, die eigentlich darauf setzen, dass im Vereinbarungswege eine<br />
Verständigung getroffen wird über die Vergütung der Leistung. Und dieses funktioniert in<br />
der Praxis nicht, das muss ich auf Grund meiner Erfahrungen auf der Verhandlungsebene<br />
der Verbände sowohl in bezug auf das BSHG als auch in bezug auf das Pflegeversicherungsgesetz<br />
als auch in bezug auf das KJHG sagen. Es funktioniert im Moment am<br />
besten in der Jugendhilfe, jedenfalls bei uns in Baden-Württemberg, und ich weiß, dass<br />
das in anderen Ländern unterschiedlich ist. Wir haben weit entwickelte Leistungsbeschreibungen,<br />
deshalb auch qualifizierte Leistungsvereinbarungen und daraus abgeleitet<br />
Vergütungsvereinbarungen.<br />
Es funktioniert nicht im BSHG-Bereich und es funktioniert nicht im Pflegeversicherungsbereich,<br />
weil wir hier keine funktionierenden Leistungsvereinbarungen haben. Im BSHG<br />
ist das Problem, dass die Leistungsvereinbarungen nicht schiedsstellenfähig sind, und<br />
damit wird im Grunde nur über den Preis geredet. Sobald eine Einigung über die Vergütungsvereinbarung<br />
da ist, unterschreibt die Kostenträgerseite jede Leistungsvereinbarung,<br />
jedes Leistungsversprechen, aber eben nur dann, wenn man sich über den Preis<br />
verständigt hat. Da gibt es keine Verständigung, sondern im Grunde ein einseitiges<br />
Preisdiktat. Unterschreib oder unterschreib nicht, ansonsten kriegst du deine Leistungsvereinbarung<br />
nicht. Und das ist hoch problematisch. Ich bin im Grunde froh, dass über<br />
das Pflegequalitätsleistungsgesetz jetzt auch die Leistungsvereinbarung im Bereich der<br />
Pflege kommt und bin auf die Erfahrungen gespannt, die wir dann miteinander machen.<br />
Ich gehe davon aus, dass dort die Leistungsvereinbarung schiedsstellenfähig ist. Und<br />
das gibt natürlich noch einmal eine neue Chance, dieses Vereinbarungsprinzip, wie es<br />
eigentlich vorgesehen ist, auch wirklich zu realisieren. Denn dann muss man sich verständigen<br />
und hat <strong>für</strong> den Fall der Nichtverständigung wirklich ein Konfliktregelungsmittel,<br />
nämlich die Schiedsstellen.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Wenn man sich das anhört, Herr <strong>Dr</strong>. Schulte, könnte man ja eigentlich zu dem Schluss<br />
kommen, diese ganze Verhandlungsebene zwischen staatlichen Behörden und Leistungserbringern<br />
sollten wir doch stark zurückfahren, es klappt ohnehin nicht. Über Wirkungen<br />
wird noch nicht geredet. Es ist Preispoker, was Sie gerade dargestellt haben.<br />
Ich kann mich auch selber an die baden-württembergischen Verhandlungen erinnern,<br />
wo man mit Korridoren rein ging und irgendwo musste es ein Ergebnis geben, ein finanzielles<br />
Ergebnis. Es ging nicht um die Wirkung, die bei den zu pflegenden Personen<br />
raus kommt. Würden Sie uns anraten, auch aus internationaler Perspektive, doch noch<br />
stärker Geld ohne extreme staatliche Kontrolle zu vergeben. Vielleicht unter Verzicht<br />
dieses Kreislaufes, den Herr <strong>Dr</strong>. Schneider aufzeichnete, denn im ambulanten Pflegebereich<br />
gibt es einen solchen Kreislauf nach meinem Kenntnisstand nicht. Sollten wir da<br />
noch stärker auf marktliche Modelle setzen und den Leistungsberechtigten wirklich das<br />
Geld in die Hand geben und vertrauen, das wird schon was, auch wenn wir keine Vertrauenskultur<br />
in der Republik haben.<br />
91
<strong>Dr</strong>. Bernd Schulte<br />
Wenn Sie mich jetzt so dezidiert danach fragen, möchte ich sagen: klare Antwort ja, aber<br />
unter ganz gewissen Kriterien und <strong>für</strong> ganz bestimmte Personengruppen. Wir gehen<br />
ja im übrigen schon diesen Weg. Wir sind gerade darauf hingewiesen worden im Zusammenhang<br />
mit dem Pflegegeld. Interessant beim Pflegegeld sind zwei Gesichtspunkte,<br />
die man vielleicht noch hinzufügen könnte. Das eine ist, dass wir keine Verwendungsnachweise<br />
verlangen, sondern wir fragen nur, ob die Pflegebedürftigkeit abgebaut<br />
wird. Und wenn die Schwiegertochter oder die Tochter das tun, und sie tun das unentgeltlich,<br />
dann können der Pflegebedürftige und die pflegende Person das Geld anders<br />
verwenden. Das ist ein wichtiger Punkt. Da ist sehr viel Freiheit mit verbunden.<br />
Der zweite Punkt ist, dass der Wert des Pflegegeldes geringer ist als der Wert der entsprechenden<br />
Sachleistungen. Damit ist eine sehr intelligente und auch sparsame Lösung<br />
entwickelt worden. Gleichwohl wählen ungefähr 80 Prozent der Personen, die die<br />
wertvollere Sachleistung in Anspruch nehmen könnten, die weniger wertvolle Geldleistung.<br />
Und warum tun sie das? Weil nämlich zur Autonomie, zum Status des Bürgers<br />
dazu gehört, dass er finanziell disponieren kann. In unserer Gesellschaft ist der Bürger<br />
eben auch Marktbürger. Es geht um finanzielle Handlungsfreiheit in der Marktgesellschaft.<br />
Wenn wir das Normalisierungsprinzip einführen wollen, etwa Normalisierung <strong>für</strong><br />
alte Menschen, <strong>für</strong> Pflegepersonen und auch <strong>für</strong> Behinderte, dann müssen wir diese<br />
Personen in die Lage versetzen, so zu leben wie jeder andere auch. Wir alle leben mit<br />
unserem eigenen Budget. Das kommt aus der Erwerbsarbeit und bei anderen Gruppen,<br />
die keine Erwerbsarbeit ausüben können, kommt das eben aus Sozialtransferleistungen.<br />
Aber das Ziel sollte sein, auch diesen Personen die Möglichkeit des freien Wirtschaftens<br />
zu geben. Das sollte der Grundsatz sein. Er unterliegt natürlich Einschränkungen, vor<br />
allen Dingen Einschränkungen wirtschaftlicher Art. Im Ergebnis kann es natürlich nicht<br />
teurer sein als die Sachleistung, d.h. das Budget kann nicht höher sein als die entsprechende<br />
Sachleistung. Deswegen habe ich schon gesagt, die damals gefundene Lösung<br />
bei der Pflegeversicherung sei intelligent, weil sie sozusagen nicht nur den gleichen<br />
Wert hat, sondern sie hat sogar weniger, insofern spart der Staat etwas. Das war an<br />
sich eine gute Lösung, wie ich finde.<br />
Ein dritter Punkt. Ich komme heute zum letzten Mal auf Mallorca zurück. Das Beispiel<br />
war ja ein bisschen anders. Das Beispiel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war,<br />
jemand geht nach Mallorca und was tut er da, er trinkt Sangria, obwohl er eine Medikation<br />
bekommt, die sich mit dem Alkohol nicht gut verträgt. Jetzt frage ich Sie ganz pointiert,<br />
was tun wir dann? Wenn wir als „normale“ Versicherte, die vielleicht auch Krankenleistungen<br />
in Anspruch nehmen und ihre Medikation haben und nach Mallorca fahren,<br />
kann es auch passieren, dass wir eine Medikation zu uns nehmen und gleichzeitig<br />
Sangria zu uns nehmen und uns das gesundheitlich nicht bekommt.<br />
Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob der Sozialstaat die Aufgabe hat, zwar in unserem<br />
Falle zuzulassen, dass wir rauchen und Auto fahren und alle möglichen andere gefährlichen<br />
Sachen machen und Berg steigen usw. und uns selber schädigen im Ernstfall -<br />
sobald aber jemand Sozialtransferleistungen bekommt, etwa als Behinderter oder als<br />
Pflegeperson, auf einmal als <strong>für</strong>sorglicher Sozialstaat sagen: „Da musst du aufpassen,<br />
das geht nicht“. Der <strong>für</strong>sorgliche Sozialstaat darf bei uns an sich nur eingreifen, wenn<br />
92
eine Person nicht eigenverantwortlich handeln kann. Da<strong>für</strong> haben wir das Betreuungsrecht,<br />
früher das Vormundschaftsrecht <strong>für</strong> Volljährige. Aber unterhalb dieser Schwelle<br />
meine ich, darf der Einzelne selber entscheiden.<br />
Es gab vor Jahren in den USA und in England eine intensive Diskussion, pointiert geführt<br />
unter dem Slogen: Das Recht des Einzelnen auf seine Psychose. Das heißt, die<br />
Frage stellen, ob man ein Recht darauf hat, gegen eine psychische Erkrankung nicht<br />
behandelt zu werden. Ich würde sagen, im Grundsatz, auch hier ja (Grenze: lebensbedrohliche<br />
Selbstgefährdung). Und da können wir von den Niederlanden viel lernen, auch<br />
aus der Sterbehilfediskussion, die schwappt da ein bisschen rein. Wobei das bei uns in<br />
Deutschland ein besonders heikles Thema ist. Aber da können wir viel lernen über das<br />
Menschenbild unseres Sozialstaates.<br />
Ich unterstreiche noch einmal das, was gestern Herr Blanke gesagt hat. Das einzige, wo<br />
ich mit seinen Ausführungen nicht konform gehe, ist der Begriff, den er gewählt hat: der<br />
„aktivierende Sozialstaat“. Das klingt ein wenig, das hat er selber gesagt, als sei der Sozialstaat<br />
derjenige, der die anderen so auf Trapp bringt. Das wird auch gemeinhin unter<br />
dem Begriff so verstanden. Deswegen würde ich diesen Begriff nicht wählen. Ein Idealbegriff<br />
ist der kooperative Sozialstaat. Der Sozialstaat, der in sich kooperiert, wenn der<br />
Bund sich mit den Ländern und Gemeinden ergänzt und vielmehr der auch mit den<br />
Marktkräften kooperiert, mit der freien Wohlfahrtspflege, den Selbsthilfebewegungen<br />
und natürlich mit dem Bürger. Das Rechtsinstrument, idealiter, ist in dem Falle nicht das<br />
Gesetz, „Par ordre du mufti“, der Obrigkeitsstaat auch im Fürsorgebereich, sondern<br />
Handlungsinstrument ist die Vereinbarung, der Vertrag, das Aushandeln. Wenn wir diesen<br />
Begriff wählen, kommen wir auch zu einer gewissen Gleichordnung der einzelnen<br />
Partner bis hin zu den Leistungsträgern und Leistungserbringern. Ein kooperativer Sozialstaat<br />
wäre ein Gegensatz zu dem, was wir früher waren, ein korporatistischer Sozialstaat.<br />
Das ist die internationale Terminologie: „corporate social (oder welfare) state“.<br />
Damit war gemeint, dass wir ein Sozialstaat sind, der auf der Sozialpartnerschaft -<br />
Stichwort Arbeiterversicherung - fußt. Einen Sozialversicherungsstaat nannte es Herr<br />
Blanke, wo jetzt die Sozialpartner eine große Rolle spielen und auch die „vermachteten“<br />
Verbände, die Krankenkassenvereinigungen wurden bereits genannt. Diese Struktur ist<br />
überholt, was die Sozialpartner angeht - deshalb überholt, weil das Arbeitsverhältnis<br />
nicht mehr so prägend ist, dass die Sozialversicherung allein darauf aufbauen kann.<br />
Nehmen wir wiederum die Pflegeversicherung, eine intelligente Lösung bei aller Unvollkommenheit<br />
(„Teilkasko-Versicherung“) ein gutes Gesetz. Pflegepersonen werden auf<br />
Grund einer Nichterwerbstätigkeit in die Sozialversicherung eingebaut. Eine sehr gute<br />
Lösung. Das geht in die Richtung des kooperativen Sozialstaates, der die Bürger stärker<br />
so nimmt wie sie sind, in der Vielfalt ihrer Rollen. Der Bürger ist nicht, wie damals zu<br />
Bismarcks Zeiten in erster Linie Arbeiter und deswegen als solcher versichert, sondern<br />
Bürger kann auch Hausfrau sein, der Bürger kann Pflegeperson sein, der Bürger kann<br />
Kind sein, Jugendlicher usw. An diese verschiedene Rollen muss jeweils angeknüpft<br />
werden.<br />
93
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Sie ersparen uns die Zertifizierung der pflegenden <strong>Familie</strong>n. Das ist schon mal tröstlich.<br />
Frau Reitsma, Sie wollten direkt noch etwas sagen.<br />
Liesbeth Reitsma<br />
Das hat mein Herz angesprochen, was Sie gesagt haben. Danke schön. Im Moment gibt<br />
es in Holland eine ganz große Diskussion über die Gleichberechtigung von Bürgern.<br />
Was wir immer noch sehen, obwohl wir schöne Vorbilder haben <strong>für</strong> den BGB ist, dass<br />
die Bürger, die eine Krankheit oder eine Behinderung haben, doch eine andere Art Behandlung<br />
bekommen als wir uns eigentlich wünschen. Ich glaube, dass das im Moment<br />
eine ganz große Diskussion ist, weil auch unser Grundgesetz im holländischen Staat<br />
da<strong>für</strong> keine Regeln kennt. Man hat wohl Sachen aufgenommen <strong>für</strong> Leute, die homosexuell<br />
sind, aber nicht <strong>für</strong> Bürger, die eine Behinderung haben. Deswegen führt die<br />
Dachorganisation im Moment eine ganz große Diskussion mit der Regierung, um das zu<br />
verändern. Und wenn im Zeichen der Gleichberechtigung jeder, der eine Behinderung<br />
oder eine Krankheit hat oder alt wird und Gebrechen hat, die gleiche Behandlung bekommt,<br />
dann glaube ich, dass das ein großer Schritt weiter in die Richtung ist, dass wir<br />
auch die gleichen Rechte bekommen.<br />
<strong>Dr</strong>. Peter Gitschmann<br />
Um die Podiumsdiskussion zu eröffnen würde ich gerne mal was mit Frau Baehrens diskutieren,<br />
nämlich ihre Einschätzung des Vertragsrechtes im SGB XI und BSHG. Ich sehe<br />
es wirklich völlig anders. Ich halte dieses neue Vertragsrecht, gerade unter dem Aspekt<br />
der Ermöglichung von Selbststeuerung <strong>für</strong> einen richtigen und guten Ansatz. Denn<br />
hier wird in einem Maße, wenn es funktioniert, Transparenz geschaffen über Leistungen,<br />
über Leistungsinhalte, über Qualität und eben dann auch über Preise, die es bisher<br />
nicht gab. Das ermöglicht mehr Selbststeuerung als wir im guten alten Kostendeckungsprinzip<br />
und Pauschaleinheitspflegesatz in der Eingliederungshilfe jemals hatten.<br />
Ich teile auch nicht ihre Einschätzung, dass es überhaupt nicht funktioniert und dass<br />
allenthalben nur über die Vergütungsvereinbarung geredet wird. Ich habe keinen Überblick<br />
wie es insgesamt aussieht, aber <strong>für</strong> Hamburg kann ich es relativ gut beurteilen und<br />
da ist es ausdrücklich anders. Wir haben sehr dezidierte präzise Leistungsvereinbarungen,<br />
in der Eingliederungshilfe, in der ambulanten und in der stationären und in der teilstationären.<br />
Wir haben sehr differenzierte Qualitätsvereinbarungen, ein vereinbartes<br />
Berichtswesen zur Qualitätsentwicklung, und wir machen Qualitätsprüfungen. Und wir<br />
reden auch über die Vergütung. Als Letztes, was ich auch nicht teile ist Ihre angedeutete<br />
Lösung, man möchte das doch alles Schiedsstellenfähig machen und dann ist doch die<br />
Schiedsstelle da, die diese ganzen Probleme löst. Das halte ich auch <strong>für</strong> vollkommen<br />
falsch. Wir haben diesen gesetzgeberischen Auftrag seit 1.1.1999, das ist ebenfalls ein<br />
gemeinsamer Lernprozess, wo sich was miteinander entwickeln muss. Was völlig anders<br />
und völlig differenzierter ist als bisher. Ich denke wir sind da auf dem Weg. Und<br />
jetzt zu sagen, wir brauchen einen <strong>Dr</strong>itten, der <strong>für</strong> uns entscheidet, das ist eigentlich<br />
schon die Kapitulation vor diesem Auftrag. Würde ich also völlig anders sehen. Ich denke<br />
es lohnt auf diesem Weg weiterzugehen.<br />
94
Bandwechsel<br />
Heike Baehrens<br />
Es ist richtig, dass wir nicht unbedingt zusätzliche gesetzliche Regelungen brauchen.<br />
Aber wir brauchen eine Weiterentwicklung vorhandener gesetzlicher Regelungen. Ich<br />
habe vorher einiges genannt.<br />
Ich würde in Anknüpfung an Herrn Schulte auch meinen, und da widerspreche ich ihm<br />
auch ein Stück, dass es eine dringende Notwendigkeit gibt, etwas zu verändern. Die<br />
Geldleistungen, die derzeit gegeben werden, sind nämlich im Verhältnis zu den Leistungen,<br />
die <strong>für</strong> die Sachleistungen gegeben werden, deutlich zu niedrig. Damit ist kein echter<br />
Anreiz gegeben, den vorhandenen Konsens „ambulant vor stationär“ wirklich zu fördern.<br />
An der Stelle, meine ich, ist das Pflegeversicherungsgesetz nicht intelligent, sondern<br />
es ist in der Wirkung eher kontraproduktiv. Wenn diese persönlichen Budgets wirklich<br />
eine Chance haben sollen und wir damit dem ambulanten Sektor einen deutlichen<br />
Entwicklungsschub geben wollen, dann muss an dieser Stelle mehr investiert werden<br />
und da muss man einfach eine Verschiebung vornehmen. Es muss jetzt sowieso über<br />
die Zuschüsse in der Pflegeversicherung entschieden werden und dann kann man in<br />
diesem Rahmen etwas neu ordnen. An der Stelle sehe ich z. B. einen notwendigen Weiterentwicklungsbedarf.<br />
Aber um jetzt auf das einzugehen, was Sie gesagt haben, Herr Gitschmann. Ich sehe<br />
Sie gar nicht im Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Denn wir als Leistungserbringer<br />
versprechen uns von dem Vereinbarungsprinzip eigentlich, dass wir wirklich zu<br />
partnerschaftlichen Verhandlungen kommen. Das hat der Gesetzgeber gewollt. So lese<br />
ich jedenfalls die Regelung im BSHG, so lese ich auch die Regelungen zur leistungsgerechten<br />
Vergütung im Pflegeversicherungsgesetz und so ist auch die Intention des § 78<br />
SGB VIII. Wir erleben jedoch, dass unsere Partner, die in der Regel eben Vertreter der<br />
von Herrn Schimanke gestern bezeichneten überforderten Verwaltung sind. Die Verwaltung<br />
ist im Grunde noch nicht darauf eingerichtet, sich mit den Leistungserbringern tatsächlich<br />
partnerschaftlich darüber zu verständigen, was ist Leistungsinhalt, wie soll die<br />
Leistungsqualität aussehen und wie kommen wir dann wirklich von einer fundierten Leistungsvereinbarung<br />
zu einer angemessenen Vergütungsvereinbarung. Damit, und das<br />
behaupte ich jetzt so schlicht, sind unsere Verhandlungspartner in der Verwaltung derzeit<br />
überfordert. Und deshalb ziehen sie sich immer mehr auf Formen hoheitlichen Verwaltungshandelns<br />
zurück, indem sie versuchen, im Grunde Richtlinien <strong>für</strong> die Finanzierung<br />
von BSHG-Leistungen herauszugeben und so einseitig zu definieren, wie die maximale<br />
Pauschale aussieht. Dann hat der Träger nur noch die Möglichkeit, diese Vereinbarung<br />
zu unterschreiben oder sie nicht zu unterschreiben. Er hat keine Wahl, wenn es<br />
dann kein Organ gibt, das dann noch schlichten kann. Natürlich sind wir im Fachausschuss<br />
Sozialhilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers beteiligt. Zu diesem Thema reden<br />
die Leistungserbringer in Baden-Württemberg mit einer Stimme, was sonst auch nicht<br />
immer der Fall ist, aber es hat keine Auswirkungen, weil die Landräte, die in der Verbandsversammlung<br />
gemeinsam mit der Verwaltung entscheiden, natürlich unter Kostengesichtspunkten<br />
entscheiden und hier nicht die Umlage <strong>für</strong> den überörtlichen Sozialhilfeträger<br />
erhöht haben wollen.<br />
95
Das sind ganz einfache Mechanismen, die dazu führen. Ich glaube gar nicht, dass es<br />
Unwilligkeit ist. Sondern es ist einfach die Tatsache, dass die Ressourcen begrenzt sind.<br />
Die sind sowohl bei den überörtlichen Sozialhilfeträgern, als auch bei den Pflegekassen<br />
begrenzt und sie sind natürlich auch auf unserer Seite, in unseren Einrichtungen begrenzt.<br />
Es muss ein Ausgleich zwischen diesen unterschiedlichen Interessen gefunden<br />
werden und es muss auch eine Schlichtungsmöglichkeit geben, wenn das Vereinbarungsprinzip<br />
in diesem Sinne nicht funktioniert. In Teilen funktioniert es, da gebe ich Ihnen<br />
Recht, und ich nenne da<strong>für</strong> auch das Beispiel der Jugendhilfe. Aber wo es nicht<br />
funktioniert und es keine Verständigung gibt, da brauchen wir Schlichtungsregelungen<br />
und die hat der Gesetzgeber mit der Schiedsstelle geschaffen, die es im SGB XI gibt. Im<br />
BSHG haben wir das Problem, dass die Schiedsstelle nur über die Vergütungsvereinbarung<br />
entscheiden kann. Kommt eine Leistungsvereinbarung nicht zu Stande, gibt es<br />
nicht die Möglichkeit, sich an die Schiedsstelle zu wenden. Über das Personal wird aber<br />
in der Leistungsvereinbarung entschieden. Damit haben wir an dieser Stelle einen unauflösbaren<br />
Konflikt.<br />
Knut Lehmann<br />
Zwei kurze Bemerkungen. Es ist ganz klar, die Mittel sind begrenzt und ich finde, dass<br />
es eine Akzeptanz darüber geben muss, dass so etwas wie ein Budget da ist. Ich finde,<br />
man kann nicht sagen, angemessen heißt, der andere muss alles bezahlen, was wir <strong>für</strong><br />
angemessen halten, denn das, was die Leistungserbringerseite <strong>für</strong> angemessen hält, ist<br />
ja selber fragwürdig. Da haben wir im Gesundheitssystem unendlich viele Beispiele. Von<br />
daher denke ich, dass diese gegenseitige Akzeptanz, dass wir bei begrenzten Mitteln<br />
gemeinsam darüber diskutieren, wie wir sie optimal ausgeben, auf der Leistungserbringerseite<br />
nicht immer vorhanden ist.<br />
Die zweite Bemerkung ist die Frage, wie Sie die Verwaltung dann beschreiben, da gibt<br />
es auch eine umgekehrte Perspektive. Es ist immer die Frage, wie erlebt die Verwaltung<br />
die Leistungserbringerseite und insofern machen Sie es sich ganz einfach und Sie spielen<br />
auf ein Vorurteil an, das wir im Moment haben und das ja auch in der Öffentlichkeit<br />
heftig diskutiert wird. Ich glaube nicht, dass das sehr hilfreich ist. Ich verstehe Ihre Kritik.<br />
Das ist auch <strong>für</strong> die Verwaltung ein Umlernprozess, aber umgekehrt ist es auch so, dass<br />
ihr Definitionsmonopol, das Sie faktisch haben, eigentlich konterkariert werden müsste<br />
durch eine Fachlichkeit auch auf der Seite der Verwaltung, damit wir zu einem angemessenen<br />
Miteinander kommen.<br />
Und ob Sie drittens immer die Interessen der Betroffenen vertreten oder die Interessen<br />
der Einrichtungsträger, das möchte ich gerne auch noch mal diskutiert haben. Insofern<br />
ist mir die Art der Leistungserbringung ihrer institutionellen Organisationsform selber<br />
fragwürdig. Auch das müsste man mit diskutieren.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Herr <strong>Dr</strong>. Schulte, Sie wollten, glaube, ich in eine andere Richtung. Es ging noch mal um<br />
die Höhe und Qualität persönlichen Budgets in der Pflegeversicherung.<br />
96
<strong>Dr</strong>. Bernd Schulte<br />
Zunächst noch einmal zur Pflegeversicherung. Die Leistungshöhe, da stimme ich Ihnen<br />
zu, die halte ich auch <strong>für</strong> unzureichend. Vor allen Dingen halte ich die Pflegestufe III <strong>für</strong><br />
problematisch, weil dann immer noch Menschen auf die Sozialhilfe angewiesen sind,<br />
ebenso die Vernachlässigung von psychischen Beeinträchtigungen, die auf der Pflegestufe<br />
I nicht adäquat berücksichtigt werden. Das weiß ich alles. Ich habe einen Sohn,<br />
der als Zivi in der Pflege gearbeitet hat, ich kann allein von daher zur Genüge erzählen,<br />
welche Mängel dieses Gesetz hat. Aber man muss dem Gesetzgeber auch zwei Dinge<br />
zu Gute halten: Zunächst einmal hat er sich auf ein neues Feld begeben. Da ist es immer<br />
so, dass man später nachreparieren muss. Das kann man im vorhinein nicht alles<br />
wissen. Das zweite war, dass die Sache auf der Kippe stand. Und es durfte nur ein Versicherungsbeitrag<br />
von 1,7 % herauskommen, sonst wäre die Pflegeversicherung gescheitert.<br />
Und nur weil es so auf der Kippe stand, muss man das, was gemacht worden<br />
ist, auch von der Leistungshöhe her akzeptieren. Man muss in diesem Falle an sich <strong>für</strong><br />
das dankbar sein, was dort als Fortschritt <strong>für</strong> das Sozialsystem insgesamt erreicht worden<br />
ist. Eines habe ich bereits erwähnt, nämlich die Einbeziehung der Pflegepersonen in<br />
die soziale Sicherung. Ein zweiter Punkt ist, dass das unabhängige Budget eben auch<br />
partiell verwirklicht worden ist, sozusagen innerhalb der deutschen Tradition, ohne dass<br />
man jetzt diesbezüglich ins Ausland gucken musste und geguckt hat. Das halte ich <strong>für</strong><br />
eine ganz wichtige Sache. Und die dritte Sache ist, dass auch die Qualitätsdiskussion in<br />
diesem Bereich in einer ganz anderen Weise angestoßen worden ist.<br />
Und jetzt noch eine zweite Bemerkung: Ich habe mich vorhin etwas über das Ergebnis<br />
der Arbeitsgruppe II gewundert, die gesagt hat, wir brauchen kein Altenhilfegesetz. Ich<br />
bin in dem Punkte dezidiert anderer Meinung. Wir brauchen kein Altenhilfegesetz in dem<br />
Sinne, dass wir jetzt irgendwelche neuen Leistungen einführen oder Modi der Leistungsfestsetzung<br />
bestimmen. Da stimme ich mit Herrn Gitschmann voll überein, das soll in<br />
den Strukturen gemacht werden, die wir jetzt entwickelt haben, und die bisher auch<br />
noch nicht ausgereift und ausprobiert sind. Aber wenn man mit dem, was ich als kooperativen<br />
Sozialstaat bezeichnet habe, ernst machen will, dann müssen wir im Altenhilfebereich<br />
ähnliche Strukturen haben wie im Bereich des KJHG. Das heißt, wir müssen<br />
auch eine Vorschrift haben, in der steht, welche Ziele der Altenhilfe heute bestehen und<br />
mit welchen Instrumenten und mit welchen Steuerungsmitteln usw. das erreicht werden<br />
soll.<br />
Wir haben in unserem Sozialstaat ein Element, was gestern noch nicht so präzis zum<br />
Ausdruck kam, und das ist das gegliederte System. Wenn ich polemisch wäre, würde<br />
ich sagen, das „zergliederte“ System der sozialen Sicherung. Das führt unter anderem<br />
zu folgender Situation: Ein alter Mensch wird pflegebedürftig und kommt heute aus dem<br />
Krankenhaus in eine Pflegeeinrichtung. Sie können nach Frankfurt gehen, eine hoch<br />
entwickelte Stadt, und es ist keiner in der Lage, ihnen auf Knopfdruck zu sagen, welche<br />
Pflegeplätze in welchen Einrichtungen unter welchen Konditionen zu welchen Preisen<br />
und mit welcher Ausstattung heute zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden.<br />
Das ist eine ganz simple Sache der Koordinierung, aber eine solche Koordinierung der<br />
Altenpolitik und der Altenhilfepolitik gibt es zur Zeit nicht. Und das kann man auch nicht<br />
allein freiwillig machen. Wir kennen das baden-württembergische Modell, da ist das mit<br />
guten Ergebnissen erprobt worden. Aber ich meine, das dass zentral geregelt werden<br />
97
muss. Auf Freiwilligkeit kann man sich da nicht verlassen. Und um diese Transparenz<br />
der Altenhilfestrukturen herzustellen brauchen wir ein solches Orientierungsgesetz, kein<br />
Leistungsgesetz. Es sollen also nicht neue Leistungen eingeführt werden, sondern es<br />
soll ein Orientierungsgesetz in ähnlicher Weise wie das KJHG sein. Dort werden dann<br />
die Rollen der einzelnen Beteiligten, Leistungserbringer, Leistungsträger, Kommunen,<br />
Bund, Länder, beschrieben. Dort wird die Verantwortung des Bundes <strong>für</strong> die Formulierung<br />
von Zielen festgeschrieben. Und dort wird dann auch vorgesehen, dass es <strong>für</strong> die<br />
Einzelnen irgendeine Stelle geben muss, an die sie sich wenden können und die die<br />
Verantwortung da<strong>für</strong> trägt, dass der Einzelne die Informationen und Beratungen bekommt,<br />
die er braucht. Insofern bin ich ein großer Anhänger von Herrn Ziller aus dem<br />
hessischen Sozialministerium, der der erste war, der ein Altenhilfegesetz gefordert hat.<br />
Ich glaube, ich bin der zweite gewesen. Deswegen habe ich mich gefreut, dass Frau<br />
Bergmann auf einer Podiumsdiskussion im Dezember 1999 in Dortmund gesagt hat,<br />
dass sie in dieser Legislaturperiode das Altenhilfegesetz nicht schafft, dass sie aber fest<br />
vor hat, das Altenhilfegesetz in der nächsten Saison auf den Parcours zu bringen. Jedenfalls<br />
hat sie es seinerzeit versprochen und ich halte es <strong>für</strong> zentral wichtig.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Von links kommt <strong>Dr</strong>uck auf mich zu, wir mögen hier den Dialog zwischen Finanziers und<br />
Leistungserbringern fortführen. Das möchte ich aber nicht. Herr <strong>Dr</strong>. Schulte, mir fiel auf,<br />
als Sie jetzt über das Altenhilfestrukturgesetz redeten, in einem solchen Gesetz müsste<br />
geklärt werden, wer da mit wem - die Kommunen mit den Leistungserbringern usw. -<br />
Ziele aushandelt. Die Leistungsberechtigten tauchen irgendwie nur am Rande auf. Meine<br />
Frage an Sie, Frau Reitsma. Was mich gestern beeindruckt hat ist, dass in dem Leistungskatalog,<br />
der aus den persönlichen Budgets finanziert wird, auch so etwas wie aktivierende<br />
Momente benannt wurden. Das steht bei uns plakativ irgendwo im SGB XI und<br />
es findet sich hinten in dem, was finanziert wird, kaum wieder. (...) Welche Rolle haben<br />
die Patientenvereinigungen bei der Entwicklung von Zielen und <strong>für</strong> die ganze Gesetzgebung<br />
gespielt, die am Schluss ins persönliche Budget mündete?<br />
Liesbeth Reitsma<br />
Ich denke, dass die Patientenvereinigungen in Holland das Feuer angezündet haben<br />
und auch die Wünsche eingebracht haben. Ich habe es gestern schon gesagt, dass wir<br />
am Anfang vor 15 Jahren mit 15 Personen unsere Not geklagt haben. Ich war vier Jahre<br />
gelähmt, habe in einem Rehabilitationszentrum gewohnt und habe „da viel mit dem Personal<br />
gemacht“ und gefragt, „warum tun sie das, was sie tun“. „Weswegen tun sie das,<br />
auf diese Art?“ Ich interessierte mich da<strong>für</strong>, weil das mein Beruf war. Das war der Punkt<br />
<strong>für</strong> mich, um zu sehen, wie veraltet das Gesundheitssystem im Moment ist, und zu fragen:<br />
Wie kann man das ändern?“ Mit 15 Personen habe ich das besprochen. Ich war<br />
dann wieder zu Hause, aber noch ziemlich gelähmt und habe das in verschiedener Art<br />
zu den entsprechenden Behinderungen und Krankheiten besprochen. Und habe dann<br />
später auch gesagt, wir können doch weiter über die Situation klagen, aber wir müssen<br />
auch einen Plan machen. Das ist dann weiter ausgeübt worden. Wir haben dann erst<br />
einmal gekuckt, mit welche Patientenorganisationen wir dieses Problem besprechen<br />
können, weil auch die Patientenorganisationen in dem Moment auch nicht so gut organisiert<br />
waren.<br />
98
Im Moment sind die Patientenorganisationen wie auch die Dachorganisation sowohl in<br />
der Provinz als auch in den Städteteilen ganz gut organisiert und benutzen alle ihre<br />
Möglichkeiten, um mit den Gemeinden und der Provinz zu sprechen. Die Beschlüsse<br />
von dort müssen mit dem Patientenverein besprochen werden. Wenn die ihre Zustimmung<br />
nicht geben, dann kommt das nicht durch. Das ist im Moment die Regel. Und das<br />
ist auch im Moment mit dem Ministerium so abgesprochen.<br />
Ich glaube, dass dazu hier in Deutschland noch etwas fehlt. Auch, weil es wirklich erstaunlich<br />
ist, dass hier niemand von den Patientenvereinen anwesend ist. Ich habe<br />
Herrn <strong>Schröder</strong> gefragt, ob die eingeladen sind, ich verstehe das nicht. Und die <strong>Senioren</strong>parteien<br />
sind auch nicht hier. Die haben dabei doch eine wichtige Rolle zu spielen,<br />
auch demografisch gesehen <strong>für</strong> die Zukunft. Wenn wir in Holland sehen, dass bis 2040<br />
so eine große Menge Leute älter und älter werden und auch eine Menge an Pflege<br />
brauchen, dann glaube ich nicht, dass die nicht in der Lage sind, um das zu besprechen<br />
und auch ihre Rolle zu spielen. Wir sollten auf europäischer Ebene versuchen, eine<br />
bessere Zusammenarbeit zu finden, auch in Deutschland, aber das ist nur ein Umweg.<br />
Ich denke, dass auch Sie die Verantwortung haben, auch Repräsentanten aus den Patientenvereinigungen<br />
mitzunehmen und denen zu sagen, lasst uns das zusammen machen.<br />
Es ist nicht gut, dass Sie entscheiden, wie die Zukunft der personengebundenen<br />
Budgets aussieht, unabhängig davon, wie gut ihre Meinung dazu ist. Ich glaube, dass<br />
Sie überzeugt sind, dass es gut geht. Ich finde es nicht gut, dass das nicht zusammen<br />
gedacht wird.<br />
<strong>Dr</strong>. Bernd Schulte<br />
Eine Bemerkung zu dem niederländischen Engagement. Ich würde sagen, dass ein persönliches<br />
Budget auf die Weise wie in den Niederlanden in Deutschland nicht zu Stande<br />
kommen kann. Und zwar deshalb nicht, weil wir diese Strukturen, die dort vorhanden<br />
sind, nämlich diese Patients Organisations, wie es im Englischen heißt, einfach<br />
schlichtweg nicht haben. Und warum haben wir sie nicht? Einer der Gründe, die ich da<strong>für</strong><br />
namhaft machen würde, ist, dass dieses Potenzial, was dort in Lobbyismus mündet, -<br />
ähnlich in Schweden und im Vereinigten Königreich -, bei uns sehr stark von den großen<br />
Wohlfahrtsverbänden absorbiert wird. Genauso, wie die anderen Länder solche Wohlfahrtsverbände<br />
wie wir nicht haben, mit dieser Zahl von Freiwilligen, haben wir sozusagen<br />
dieses freie Potenzial nicht, weil die Leute, die bei ihnen in den Patientenverbänden<br />
sitzen, bei uns zum Teil in den Wohlfahrtsverbänden sitzen. Dann sagen natürlich die<br />
Wohlfahrtsverbände, wir nehmen diese Lobbyfunktion auch wahr. Und das tun sie auch.<br />
Aber sie machen das natürlich nicht 100-prozentig, sondern sie sind gleichzeitig Leistungserbringer,<br />
zum Teil Leistungsträger, sie sind also politische Lobbyisten <strong>für</strong> ihre Organisation,<br />
sie sind auch Arbeitgeber <strong>für</strong> ihr Personal. Das sind Rollenkonflikte, die es<br />
ausschließen, würde ich dezidiert sagen, dass man so effektiv lobbyistisch wirken kann<br />
wie in Holland oder im Vereinigten Königreich.<br />
Eine zweite Bemerkung möchte ich zum Verbraucherschutz machen, das klang heute<br />
Morgen mal an. Dort gibt es ein ähnliches Problem. Der Verbraucherschutz ist bei uns<br />
auch sehr schwach entwickelt. Ich bin im letzten Jahr in London gewesen beim dortigen<br />
Consumer Council. Dort sind allein 12 Personen nur mit dem Vergleich von medizinischen<br />
und sozialen Leistungen beschäftigt. Das ist auch ein Phänomen, was wir bei uns<br />
99
so nicht haben und was wir so schnell auch nicht heranziehen können. Deshalb meine<br />
ich, wir müssen gerade aus den Niederlanden lernen, dass wir lernen müssen, die selben<br />
Ergebnisse mit unseren Mitteln zu erzielen, nämlich etwa in Anknüpfung an die<br />
Pflegeversicherung oder in Anknüpfung an das BSHG, welches an sich auch ein hervorragendes<br />
Gesetz ist. Wie gestern Herr Blanke sagte, müssen wir uns stärker zur Dienstleistung<br />
hin entwickeln. Dabei fiel mir der § 8 BSHG ein. Da steht drin, Ende der 50er<br />
Jahre formuliert, erst Dienstleistung, dann Sachleistung, dann Geldleistung. Also lehrt<br />
insofern der Rechtsvergleich auch sich auf das Eigene zurückzubesinnen. Das gilt auch<br />
<strong>für</strong> Ministerpräsidenten: die brauchen nicht nach Wisconsin fahren, sondern sollen in<br />
den nächsten Wahlkreis gehen. Denn wenn ich weiß, dass in Deutschland beispielsweise<br />
ein Rechtsanspruch eines jeden auf das soziale Existenzminimum besteht, verfassungsrechtlich<br />
abgesichert, dann muss ich jedem, auch wenn er nicht arbeiten will, etwas<br />
zu essen geben und kann ihn nicht verhungern lassen, wie es in den USA der Fall<br />
sein kann. Insofern zeigt auch dieses Beispiel die Begrenztheit des Vergleichs und lehrt,<br />
dass man zwar reisen soll, aber dann sozusagen sehen kann, durch das Reisen lernt,<br />
wie die Verhältnisse zu Hause sind. Durch die Niederlande lernen wir, was wir hier haben<br />
und dann muss man schauen, wie man mit unserem Instrumentarium ein ähnliches<br />
Ergebnis erzielen kann.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Ich habe einige Meldungen.<br />
Herr ...<br />
Zum Problem der Beteiligung der Betroffenen. Ich finde, es ist auch kein Zufall, dass<br />
eine holländische Vertreterin hier sitzt und die Betroffenen vertritt. Und ich denke mir, wir<br />
müssen zum Ersten feststellen, dass wir mit unserem System, in dem nur Profis über<br />
Menschen philosophieren, ein Wohlfahrtssystem der Bevormundung und der Entmündigung<br />
in Deutschland geschaffen haben und jetzt völlig erstaunt sind, nachdem wir mit<br />
unserem System den Menschen entmündigt haben, warum sie hier nicht sitzen und den<br />
Mund auftun. Das ist eine Situation, die ist typisch deutsch. Die ist obrigkeitsstaatlich<br />
geprägt und wir müssen dort umlenken. Wenn es diese Strukturen nicht gibt und wenn<br />
Ihre These, Herr Schulte, wirklich stimmt, dass die Träger der Wohlfahrtspflege, ich sage<br />
immer provozierend die Wohlfahrtsmafia, eine solche Entwicklung verhindert, dann<br />
muss man die Wohlfahrtsverbände abschaffen. Ich sage das auch sehr deutlich, sehr<br />
pointiert und auch sehr provozierend. Ich denke, die Bundespolitik ist eigentlich aufgefordert,<br />
diese Struktur die wir brauchen herzustellen. Neben den öffentlichen und freien<br />
Träger brauchen wir einen dritten Part, der uns hilft, aus der Sackgasse heraus zu<br />
kommen. Das sind die betroffenen Menschen, <strong>für</strong> die wir Leistung zu erbringen haben,<br />
sowohl als öffentliche als auch als freie Träger. Und dann müssen wir diese Selbsthilfestruktur<br />
schaffen und fördern. Sie hatten gestern gesagt, Sie waren in Amerika und haben<br />
sich diese Bewegung „Independent Living“ angesehen, haben sich die zum Vorbild<br />
genommen. Es gibt ja auch bei uns Beispiele, das Selbsthilfezentrum in München, es<br />
gibt Empowerment-Ansätze und ich finde, es ist eine Herausforderung an den Bund und<br />
an die Länder, diese Struktur zu schaffen. Zu schaffen, dass die betroffenen Menschen<br />
aus der Entmündigung herausgeführt werden und tatsächlich durch Selbsthilfe, Förderung<br />
und Selbsthilfeverbände dazu kommen, mitzumachen und uns, die wir Profis sind,<br />
100
endlich zu sagen, was wirklich notwendig ist und wohin wir unser professionelles Handeln<br />
ausrichten sollen.<br />
Knut Lehmann<br />
Eine kurze Bemerkung zu Ihnen. Das, was Sie beschreiben, die bundesdeutsche Wirklichkeit,<br />
stimmt so überhaupt nicht. Natürlich haben wir eine ganz starke und vielfältige<br />
Selbsthilfebewegung. Und alle Forschungen, die das in der Bundesrepublik untersucht<br />
haben, weisen nach, dass rund ein <strong>Dr</strong>ittel der erwachsenen Bevölkerung ehrenamtlich<br />
und selbsthilfemässig tätig ist. Wenn auch in unterschiedlichen Formen. Die Kritik an<br />
dem System der freien Wohlfahrtspflege besteht völlig zu Recht, aber ich finde, Sie<br />
zeichnen ein Zerrbild. So ist die Realität in der Bundesrepublik nicht, wie Sie es beschreiben.<br />
Das war aber nicht mein Grund, mich zu melden. Sondern ich habe einen anderen<br />
Punkt. Ich bemerke hier immer so eine implizite Staatskritik. Man muss auch überlegen,<br />
dass die Selbstbestimmung bestimmter infrastruktureller und gesellschaftlicher Voraussetzungen<br />
bedarf, die nur die Politik selber herstellen kann. Wenn Herr Schulte ein Altenhilfegesetz<br />
fordert, dann fordert er staatliches Handeln. Insofern müssen wir noch<br />
mal genau überlegen, ob wir nicht ein bisschen das Kind mit dem Bad ausschütten,<br />
wenn wir so diskutieren, wie es implizit manchmal formuliert wird. Alleine die Selbstbestimmung<br />
wird nicht greifen, wenn wir nicht die zivilisatorischen Voraussetzungen da<strong>für</strong><br />
schaffen, dass <strong>für</strong> Menschen, die sich auf dem Markt und in der normalen Gesellschaft<br />
nicht in der Weise durchsetzen können, sozusagen infrastrukturelle Voraussetzungen<br />
geboten werden, damit sie sich artikulieren können, soweit es ihnen noch möglich ist.<br />
Ich finde das ist ein wichtiger Punkt. Das sollten wir berücksichtigen. Denn je mehr wir<br />
bisher staatliche Leistungen <strong>für</strong> behinderte oder andere schwierige oder benachteiligte<br />
Gruppen vergesellschaften, desto mehr kommt die Politik in eine Gewährleistungsfunktion<br />
im Sinne der Vorgabe, aber auch des Controlling. Ich denke das sollte man fairer<br />
Weise mit diskutieren. Das haben Sie in den Niederlanden auch und wenn ich in die<br />
<strong>Dr</strong>ogenpolitik gucke und wie sich das in Amsterdam verändert hat, dann gibt es auf einmal<br />
dort eine relativ starke Gewährleistungsfunktion, eine rigide Ordnungsfunktion, weil<br />
man sagt, ganz bestimmte Zustände können wir nicht zulassen, ohne dass nicht andere<br />
nachhaltig beeinträchtigt werden. Und wir haben <strong>für</strong> die Autos einen TÜV. Und wir müssen,<br />
wenn wir solche Selbstbestimmung zulassen, <strong>für</strong> die Leistungserbringer irgendeine<br />
Art von gesellschaftlicher Kontrolle mit positiven und negativen Sanktionsmöglichkeiten<br />
schaffen. Und das geht nur dann, wenn die Politik das auch macht und auch durchsetzt.<br />
Herr ...<br />
Ich versuche, mich ganz dicht an dem zu halten, was bis jetzt diskutiert wurde. Es freut<br />
mich sehr, dass ein Schwerpunkt die Beobachtung dieses Verhandlungssystems ist,<br />
etwa §§ 93 ff BSHG. Also, ein System, das gerade versucht, zu entstaatlichen und eine<br />
gerechte Regelung zu finden. Wir hatten eine kleine Kontroverse hier im Podium zur<br />
Wirksamkeit des 93er Systems. Was mir auffällt ist, dass das 93er System sich sehr<br />
geheim abspielt. Man erfährt gar nicht, wie die Verhandlungen sind. Das scheint mir ein<br />
Demokratiemangel zu sein. Und das zweite, was hier angesprochen worden ist, betrifft<br />
die Rolle der Wohlfahrtsverbände, die eben doch eine Doppelrolle haben und die Frage<br />
101
ist, ob sie sie durchhalten können. Sie sind Anbieter, Mitkonkurrenten und sie sind Repräsentanten<br />
öffentlicher Interessen. Das ist wirklich ein Problem. Herr Schulte hat uns<br />
schon einen schönen Hinweis gegeben, lassen Sie uns die Verbände nicht abschaffen,<br />
aber überlegen, wie man diese Rollendiffusion etwas auseinander bringen kann.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Herr Gitschmann, Sie sind nervös geworden, als es um die Beteiligung ging, hatte ich<br />
den Eindruck?<br />
<strong>Dr</strong>. Peter Gitschmann<br />
Nun hat es Herr Lehmann schon gesagt. Das war wirklich etwas holzschnittartig, Entmündigung<br />
als eine Diagnose oder es gibt alle diese Strukturen gar nicht, um Herrn<br />
Schulte noch mal zu verkürzen. Ich wollte einfach unterstreichen, ich finde durchaus,<br />
dass hier Staat und Gesetzgeber auf dem richtigen Weg sind. Ich wollte noch einmal<br />
auf das SGB IX hinweisen, in dem a) eine Selbsthilfeförderungsverpflichtung verankert<br />
ist zu Lasten der Rehabilitationsträger, das ist sicherlich ein sinnvoller Schritt. Und b) an<br />
ganz vielen Stellen, wo eben auch etwas auszuhandeln, etwas noch zu gestalten, verpflichtende<br />
Beteiligung der Interessenvertretungen behinderter Menschen vom Gesetzgeber<br />
vorgesehen ist. Das ist der richtige Weg. Dieses wäre vielleicht auch im Kontext<br />
der Gesetzgebung zum § 93, um auf den Vorredner einzugehen, noch etwas präziser<br />
sinnvoll gewesen. Dann hätten wir vielleicht diesbezüglich auch mehr Transparenz als<br />
das tatsächlich der Fall ist. Ich wollte ansonsten nur noch darauf hinweisen: Unser Modellkonzept<br />
„Persönliche Budgets“ in Hamburg haben wir gemeinsam mit den Interessenvertretungen<br />
der behinderten Menschen entwickelt. Es ist ein gemeinsames konsensuales<br />
Konzept, was von diesen Gruppen mitgetragen wird, von „Autonom Leben“, von<br />
der Landesarbeitsgemeinschaft <strong>für</strong> Behinderte, von den Elterninitiativen vor allem. In<br />
dieser Konzeptdiskussion waren die Wohlfahrtsverbände nicht beteiligt. Sondern wir<br />
haben das in dieser Partnerschaft entwickelt und auch schriftlich miteinander vereinbart<br />
wie wir es machen wollen. Und <strong>für</strong> die Öffentlichkeitsarbeit, um die Budgets dann auch<br />
anzubahnen, ist eine Kooperation mit People First verabredet, damit es auch wirklich<br />
transportiert und ein Stück weit realisiert werden kann. Ich denke so kann es gehen und<br />
so sollte es auch gehen.<br />
Liesbeth Reitsma<br />
Ich finde es gut, dass Sie sich so viel Mühe machen, um das Problem zu lösen und dass<br />
Sie auch schauen, wie es in anderen Ländern geht. Was ich meinte, ist, dass Leute, die<br />
aus ihrem täglichen Leben selbst die Erfahrung haben, versorgungsabhängig zu sein<br />
und die wissen, welche Probleme es <strong>für</strong> die <strong>Familie</strong> gibt, ein krankes Kind zu haben,<br />
einen geistig behinderten Ehemann zu haben oder einen <strong>Senioren</strong>, dass diese Menschen<br />
einbezogen werden sollen. Und da man sehr große Probleme in der Zukunft erwarten<br />
kann, denke ich, dass es wichtig ist, dass Sie einen Plan machen, wie Sie die<br />
Leute gut versorgen können. Für die Zukunft denke ich, dass es wichtig ist, dass Sie im<br />
Ministerium oder in anderen Organisationen - ich kenne das System in Deutschland natürlich<br />
nicht so gut - versuchen, soviel wie möglich und auf jeder Stufe Leute einzubeziehen,<br />
die die Probleme kennen und die direkt damit beschäftigt sind. In Holland hat<br />
102
das Ministerium auch den Patientenvereinigungen Geld zukommen lassen, um zu erreichen,<br />
dass wir in der Lage waren, die Patienten auch zu trainieren, um sich zu beteiligen<br />
und mitzudenken. Das ist natürlich wichtig. Wenn man kein Geld hat, um eine Versammlung<br />
zu organisieren, dann gelingt es natürlich auch nicht. Man muss etwas haben, um<br />
das Ergebnis zu unterstützen.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Frau Baehrens, wie geht es jetzt Ihnen als Trägervertreterin. Von der einen Seite werden<br />
hier staatlich finanzierte und unterstützte Patientenvereinigungen gefordert, ich gehe<br />
jetzt nicht auf die Abschaffung der Wohlfahrtsverbände ein, von der anderen Seite<br />
wird kooperative Verhandlungskultur von jemandem eingefordert, der, überspitzt ausgedrückt,<br />
nach Ihrer Aussage noch gar nicht in der Lage ist zu verhandeln. Wir haben gestern<br />
im Pausengespräch darüber gesprochen. Es wird zunächst in der Verwaltung Sozialingenieure<br />
geben müssen, was immer das ist. Wenn ich das sehe und dann kommen<br />
Diskussionen wie im Rahmen des Qualitätssicherungsgesetzes, Verwandte in Heimbeiräte.<br />
Wie gehen Sie als Wohlfahrtsverbände damit um? Öffnen Sie sich? Wo geht es<br />
lang?<br />
Heike Baehrens<br />
Ich traue mir fast nicht mehr zu sagen, dass wir uns da auch engagieren. Denn es entsteht<br />
in so einer Diskussion immer der Eindruck, dass sind so schreckliche Apparate,<br />
die im Grunde eigentlich die Innovation aufhalten. Dabei ist mein Eindruck von innen<br />
eigentlich der, dass wir genau diejenigen sind, die diese Innovation an vielen Stellen<br />
betreiben. Ich will nur ein Beispiel sagen. Wir haben die Situation, jedenfalls in den stationären<br />
Pflegeeinrichtungen, dass der Anteil der dementen Bewohnerschaft bei nachgewiesen<br />
50 bis 80 Prozent ist. Nun machen Sie mal in so einem Heim einen Heimbeirat.<br />
Das ist eine schwierige Aufgabe. Dann müssen Sie Lösungen finden, die eben nicht<br />
nur danach gucken, wie finde ich noch diesen einen oder diese drei aus der Einrichtung,<br />
die vielleicht noch in der Lage und willens sind, mitzudenken und mitzubegleiten, sondern<br />
dann versuchen wir natürlich Formen zu entwickeln, die das erweitern, indem wir<br />
Kreisseniorenräte einbeziehen, indem wir mit <strong>Senioren</strong>vereinigungen zusammenarbeiten<br />
und so versuchen, einen funktionierenden Heimbeirat zu Stande zu bringen. So machen<br />
wir beispielsweise als Diakonisches Werk ein Projekt mit mehreren Einrichtungen,<br />
um hier<strong>für</strong> Modelle und neue Formen zu schaffen, um eben wirklich dieses Mitdenken<br />
und Mitbestimmen zu ermöglichen.<br />
Wir wehren es nicht ab, sondern wir fördern es. Wir wollen es, weil wir wissen, dass wir<br />
darauf angewiesen sind und weil es vor allem auch das Interesse unserer Einrichtung<br />
ist, dem einzelnen Menschen gerecht zu werden. Diese Unterstellungen, die hier<br />
manchmal mitschwingen, wenn über Einrichtungen gesprochen wird, die sind schon<br />
schmerzhaft. Also, insbesondere im Blick auf Träger, die sich als kirchlich gebundene<br />
Träger der Wohlfahrtspflege verstehen, die natürlich ihre Wurzeln haben, die eigentlich<br />
davon ausgehen, dass man versucht, wirklich das ein Stück nachzuleben, was Jesus<br />
mal vorgelebt hat. Der ist nicht hingegangen und hat den Leuten irgendeine Hilfe aufgedrückt,<br />
sondern der ist hingegangen und hat gefragt: Was willst Du von mir? Was willst<br />
Du, was ich Dir tue, was genau? Das ist der Ansatz, den wir im Grund verfolgen. Unser<br />
103
Sozialstaat hat ja eine lange Tradition und Geschichte und ist in dieser Form, wie er<br />
heute da ist, dadurch entstanden, dass immer wieder einzelne Menschen Initiativen ergriffen<br />
haben und Dinge angepackt haben. Das fing in der Diakonie vor über 125 Jahren<br />
an. Ich muss immer mal wieder zu Jubiläen unserer Einrichtungen, 100 Jahre, manchmal<br />
sogar 150 Jahre. Und wenn Sie gucken, wo die Ursprünge waren, die Ursprünge<br />
waren immer so etwas, was Frau Reitsma hier geschildert hat, dass nämlich einzelne<br />
Menschen die Not gesehen und da<strong>für</strong> Hilfeformen entwickelt haben. Und dieses ist immer<br />
weiter entwickelt worden. Und in unserem deutschen Sozialstaat ist es so, dass wir<br />
immer wieder versucht haben, die Dinge zu ordnen und in Spuren zu lenken. So hat einerseits<br />
der Staat an verschiedenen Stellen eingegriffen und andererseits ist so die<br />
Wohlfahrtspflege entstanden. Aber wer sich heute hinstellt und sagt, die Wohlfahrtspflege<br />
muss abgeschafft werden, der ist, glaube ich, ein Stück neben der Realität. Ich will<br />
an dieser Stelle nur erwähnen, dass wir da auch eine wirtschaftliche und eine gesamtgesellschaftliche<br />
Verantwortung haben. Ich stehe hier <strong>für</strong> einen Verband, bei dem es<br />
immerhin um 28.000 Arbeitsplätze geht. Jetzt kann man natürlich sagen, wo<strong>für</strong> brauchen<br />
wir euch denn. Aber glauben Sie das denn wirklich, dass das realistisch ist? Ich<br />
bin Ihnen, Herr Lehmann, sehr dankbar <strong>für</strong> Ihren Einwand, den Sie gleich gemacht haben.<br />
Ich möchte noch einen Gedanken aufgreifen. Herr Blanke hat gestern etwas ganz Wichtiges<br />
gesagt. Erstens, was die Notwendigkeit der Kooperation angeht. Wir verändern die<br />
Dinge nur in Kooperation und in demokratischen Aushandlungsprozessen. Und deshalb<br />
ist es notwendig, was er gesagt hat, dass wir im Grunde eine Demokratiereform brauchen.<br />
Da will ich die Wohlfahrtsverbände ausdrücklich einbeziehen. Wir brauchen tatsächlich<br />
wieder einen Demokratisierungsprozess in unserer Gesellschaft. Denn das eigentliche<br />
Problem ist, dass immer mehr Menschen denken, sie brauchen da gar nicht<br />
mehr mitreden und gar nicht mehr mitwirken und auch ihre eigenen Rechte gar nicht<br />
mehr umsetzen. Man denkt, man hat ja die Pflegeversicherung und man hat jene Versicherung<br />
und da zahlt die Sozialhilfe. Und es geht unter, dass wir im Grunde dieses bürgerschaftliche<br />
Mitdenken und Mitwirken brauchen, um Innovationsprozesse in dem Sinne,<br />
wie sie hier andiskutiert worden sind, einleiten zu können. Das wünsche ich mir tatsächlich<br />
auch <strong>für</strong> unsere Wohlfahrtsverbände. Und da ist es richtig, was vorhin angesprochen<br />
worden ist, dass wir tatsächlich eine Rollendiffusion haben, an der wir dringend<br />
arbeiten müssen. Gerade heute Morgen beim Frühstück habe ich mit Herrn Briel<br />
vom deutschen Caritasverband genau über dieses Thema gesprochen, weil wir beide<br />
dort ein riesiges Problem empfinden. Wir lassen uns da gerne auf die Diskussion mit<br />
anderen Partnern ein, um etwas zu verändern und weiter zu entwickeln. Aber bitte nicht<br />
unter der Überschrift, „Wohlfahrtspflege ade“. Denn das halte ich <strong>für</strong> fatalistisch.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Als Leiter einer Podiumsdiskussion freut man sich immer, wenn es heftig zugeht. Aber<br />
dem möchte ich mich anschließen, auch um am Schluss nicht den Dissens stehen lassen.<br />
Wir werden um die richtigen Lösungen ringen müssen. Ich habe Ihre Meldung, Herr<br />
<strong>Dr</strong>. Schneider, auch in diese Richtung verstanden.<br />
104
<strong>Dr</strong>. Gerd Schneider<br />
Ich hätte einen Verfahrensvorschlag. Es kommen ja die alten Grabenkämpfe wieder<br />
hoch. Ich erinnere an die erste Tagung, von der gibt es eine Tagungsdokumentation. Es<br />
gab damals einen Vortrag: Krieg zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern. Da<br />
ist das alles eigentlich beschrieben. Ich stelle fest, wir sitzen alle immer noch in den<br />
Schützengräben wie damals. Das Thema der Podiumsdiskussion lautet „Chancen und<br />
Grenzen der Selbststeuerung“. Ich bitte, darauf zurückzukommen.<br />
Wilfried Nodes<br />
Ich wollte eigentlich nur einige kleine Aspekte einbringen. Ich glaube, dass diese ganze<br />
Frage der Partizipation nicht so einfach ist. Ich will sagen, die kann man nicht einfach<br />
herbeireden. Wir haben in Deutschland eine andere Kultur. Nur drei Prozent der Ehrenamtlichen<br />
sind im sozialen Bereich tätig. Wir müssen einfach sehen, dass nicht alle in<br />
der Lage sind, sachgerecht zu partizipieren, weil die Strukturen eben andere sind. Sie<br />
haben eben gerade das Beispiel des Altenheimes genannt. Wir haben auf der anderen<br />
Seite natürlich systemische Bedingtheiten der Wohlfahrtsverbände und eine Verdoppelung<br />
ihres Auftrages. Ich denke, wir brauchen eine ganz andere Kultur und wir müssen<br />
einen langen Prozess gehen und in diesem Prozess auch überlegen, welche anderen<br />
Formen von Empowerment sind außerhalb vorhandener Hilfestrukturen und Hilfeorganisationen<br />
möglich. In diesem Rahmen braucht dieser Staat auch eine Auskunft zu der<br />
Frage, wie viel Sozialstaat können wir uns eigentlich leisten? Also, ein „demokratisches<br />
satt und sauber“ bleibt ein „satt und sauber“ im Altenheimbereich. Es bedarf ganz anderer<br />
Ressourcen und das ist nicht über Aushandlung zu regeln. Das ist nur über politische<br />
Lösungen zu regeln und über die grundsätzliche Wertefrage in dieser Gesellschaft.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Ich möchte die Aussage von Herrn <strong>Dr</strong>. Schneider aufgreifen, die Grenzen der Selbststeuerung.<br />
Herr <strong>Dr</strong>. Schulte, in unserem Vorgespräch haben Sie mir einen Schrecken<br />
eingejagt. Sie erzählten, dass auf einer Ebene, die bislang noch gar nicht diskutiert wurde,<br />
nämlich auf der europäischen Ebene, Indikatoren entwickelt werden, an denen die<br />
Qualität der Sozialsysteme europaweit nicht nur landesvergleichend betrachtet werden,<br />
sondern auch, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Maßstab staatlichen Handelns<br />
werden soll. Spielt dort Selbststeuerung als Qualitätsmerkmal von Sozialsystemen<br />
eine Rolle oder wird dort staatlicher Dirigismus über Benchmarking vorbereitet?<br />
<strong>Dr</strong>. Bernd Schulte<br />
Eine kleine Vorbemerkung: Sie haben zu Recht angemerkt, dass wir über Selbststeuerung<br />
reden und über Steuerung. Ich würde nur gerne in Erinnerung zurückrufen, dass<br />
die Selbststeuerung oder auch die Steuerung durch <strong>Dr</strong>itte sozusagen ein Element sind,<br />
das ich als soziale Intervention beschreiben würde. Und soziale Interventionen, das<br />
muss man immer im Hinterkopf behalten, können verschiedene Dimensionen haben. Sie<br />
können ökonomische Dimensionen haben, indem Sie durch Leistungen Anreize geben,<br />
dass beispielsweise Behinderte eingestellt werden. Sie können eine ökologische Dimension<br />
haben, indem Sie beispielsweise sagen, die Behinderten bekommen keine finanzielle<br />
Mobilitätsbeihilfe, sondern Sie geben denen ein Fortbewegungsmittel, z.B. ein<br />
105
Auto, wenn sie zur Arbeit gehen. Oder sie sorgen da<strong>für</strong>, dass die Bürgersteige alle abgeflacht<br />
werden, dann können Sie selber mit ihrem Rolli fahren. Oder sie sorgen da<strong>für</strong>,<br />
wie ich es gerade in London mit großer Begeisterung gesehen habe, dass in jedem Bus,<br />
der tagsüber fährt, ein Mensch sitzt, der nicht nur die Fahrkarten kontrolliert, sondern<br />
Behinderten und alten Leuten in den Bus reinhilft. Das ist eine weitere Möglichkeit der<br />
ökologischen Intervention. Dann haben wir die pädagogische Intervention, dass wir die<br />
Leute z.B. <strong>für</strong> Berufe wie Gerontopsychologen, Gerontomediziner, Altenpfleger usw.<br />
ausbilden und schulen.<br />
Und dann erst kommen wir zu der vierten Ebene, der politischen und rechtlichen Intervention.<br />
Da haben wir auch ganz unterschiedliche Dimensionen. Da haben wir Ge- und<br />
Verbote, das heißt, man muss z.B. in einzelnen Ländern einen Behinderten einstellen.<br />
Wir haben dann auch eine Antidiskriminierungsgesetzgebung. Ich komme damit zur EG.<br />
Die EG will diese Antidiskriminierungsgesetzgebung, die wir bei Männern und <strong>Frauen</strong><br />
sehr erfolgreich durchgeführt haben, auf die Opfer ethnischer Verfolgung und rassistischer<br />
Übergriffe übertragen. Dies auf EG-Ebene mit Durchgriff auf die Mitgliedsstaaten,<br />
weil EG-Recht Vorrang vor dem Recht der Mitgliedsstaaten hat. Die zweite Kategorie<br />
sind die Behinderten und die dritte Kategorie werden die älteren Menschen sein. Wir<br />
werden also irgendwann auch mal qua EG ein Altendiskriminierungsgesetz bekommen,<br />
wie es das in den USA bereits gibt, wie es das in Großbritannien bereits gibt, wie es in<br />
Schweden demnächst eingeführt wird, wie es in den Niederlanden diskutiert wird, und<br />
wie es bei uns noch kaum diskutiert wird aber diskutiert werden wird. Dann gibt es bei<br />
uns natürlich entsprechend unserem traditionellen sozialstaatlichen Weg, das Leistungsgesetz.<br />
Darüber haben wir uns heute sehr viel unterhalten. Ich will damit nur deutlich<br />
machen, dass das, was hier an zwei Tagen Thema unserer Unterhaltung war, an<br />
sich nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist - ein Ausschnitt aus dem, was rechtliches Instrumentarium<br />
ist, und ein noch viel kleinerer Ausschnitt aus dem, was soziale Intervention<br />
überhaupt ist. Und in diesem rechtlichen Bereich müssen wir uns vor Augen halten,<br />
dass wir als Mitglied der Europäischen Union jede Politik, die wir heute betreiben, zukünftig<br />
entweder national überhaupt nicht mehr betreiben können - siehe Wirtschafts-<br />
und Währungspolitik - oder sie immer nur auf zwei Ebenen betreiben können, nämlich<br />
nur mehr zum einen auf der Europäischen Ebene und zum anderen auf der nationalen<br />
Ebene.<br />
Ein Beispiel ist auch die freie Wohlfahrtspflege, die dies inzwischen auch schmerzhaft<br />
gelernt hat, denn Vergaberecht ist heutzutage europäisches Vergaberecht, Beihilferecht<br />
ist europäisches Beihilferecht, so dass sie ab einer bestimmten Schwelle auch soziale<br />
Investitionen EG-weit ausschreiben müssen. Dass wir EG-Angehörige als Pfleger und<br />
als Ärzte einstellen ist sowieso schon klar. Jetzt kommt das, was Herr <strong>Schröder</strong> gerade<br />
nachgefragt hat: Wir haben im Bereich der Wirtschaftspolitik schon seit Jahren den Prozess<br />
der sogenannten offenen Koordinierung. Das heißt, die Wirtschaftspolitiken der<br />
Mitgliedstaaten müssen abgestimmt werden nach Europäischen Vorgaben. Seit 1996<br />
gilt dasselbe <strong>für</strong> die Beschäftigungspolitik. Sie ist im EG-Vertrag festgeschrieben, das<br />
heißt die Mitgliedstaaten müssen jedes Jahr einen Beschäftigungsbericht schreiben, ihn<br />
nach Brüssel schicken, dann wird ein Europäischer Beschäftigungsbericht erstellt. Dann<br />
kriegen die Mitgliedsstaaten Noten. Ich glaube, dass die beste Note, die wir mal bekommen<br />
haben, war 3 minus - auf einer Sechserskala, keiner 20er Skala.<br />
106
Wenn Sie diese Politik auf den Bereich des Sozialschutzes übertragen: Es sind seit dem<br />
1. Juni dieses Jahres sogenannte „NA Pinds“ erstellt worden, National Action Plans for<br />
Social Inclusion. Das heißt, eine Dame im <strong>Bundesministerium</strong> <strong>für</strong> Arbeit und Sozialordnung,<br />
die fachlich an sich nicht ganz alleine zuständig ist, weil das Ministerium, dessen<br />
Vertreter hier vorne in der ersten Reihe sitzen und das die Veranstaltung trägt, eigentlich<br />
auch da<strong>für</strong> zuständig wäre, hat den undankbaren Auftrag erhalten (und m.E. gut<br />
erledigt), auf 40 Seiten zu beschreiben, was die Bundesrepublik Deutschland gegen sozialen<br />
Ausschluss und Verarmung und <strong>für</strong> soziale Integration tut. Der Bericht wird nach<br />
Brüssel geschickt. Er kommt mit einer Bewertung durch einen EG-Experten zurück,<br />
dann kann die Bundesregierung ihre Stellungnahme machen, der Bericht kommt dann<br />
wieder nach Brüssel und dann wird insgesamt ein Bericht darüber geschrieben, wie die<br />
einzelnen Mitgliedstaaten in der sozialen Integrationspolitik dastehen. Da gibt es dann<br />
beispielsweise <strong>für</strong> die Bundesrepublik relativ schlechte Noten, was die Asylbewerber<br />
angeht, und was Obdachlose angeht, weil wir trotz unserer Armutsbekämpfungsbemühungen<br />
dort in gewisser Weise noch einen schwarzen Fleck haben.<br />
Zur Zeit wird dasselbe im Bereich der Alterssicherung gemacht. Die Alterssicherungspolitik<br />
der Mitgliedstaaten wird beschrieben. Die Berichte werden nach Brüssel geschickt<br />
und sollen dann anhand von Indikatoren, nach bestimmten Kriterien bewertet werden.<br />
Dabei kommt es darauf an, welche Kriterien Sie nehmen: Ob Sie nur die Höhe der Rente<br />
nehmen, ob Sie auf persönliche Volldeckung abheben, das heißt 100 Prozent der Bevölkerung<br />
erhält eine Altersrente usw. Da können Sie viel Phantasie entwickeln über<br />
mögliche Kriterien. Aber diese Kriterien werden in einer Gruppe in Brüssel erarbeitet.<br />
Deutschland hat da eine Stimme und dann kommen zum Teil noch Kriterien raus, die<br />
vielleicht uns nicht so gefallen bzw. unser System nicht so richtig widerspiegeln.<br />
Dasselbe wird Anfang nächsten Jahres <strong>für</strong> das Gesundheitswesen stattfinden und dort<br />
wird, keiner weiß genau warum, d.h. auf wessen Initiative, nach den Beschlüssen des<br />
Europäischen Rates auch die Altenpflege behandelt, d.h. <strong>für</strong> soziale Dienste. Und damit<br />
ist auch dieses Ministerium betroffen und wird einen Bericht schreiben müssen, wie es<br />
mit den altersspezifischen sozialen Diensten in Deutschland aussieht. Für Deutschland<br />
ist das sehr kompliziert, weil die Verantwortung bei den Ländern und bei den Kommunen<br />
liegt. Und dann wird man darüber auch an Hand bestimmter Kriterien dieses Thema<br />
vergleichen. Und man wird später auch ein Benchmarking. Da wird immer gesagt: die<br />
drei besten Länder werden genommen, das ist sozusagen der gute Durchschnitt, und<br />
dann wird an einer Grafik dargestellt - das sieht ganz kompliziert mathematisch aus - wo<br />
dann der einzelne Staat liegt, ob man über den Ländern liegt oder unter diesen Ländern<br />
liegt oder seitwärts usw. Das ist eine höchst spannende Sache und läuft darauf hinaus,<br />
dass wir hier keine Rechtsetzung haben über Sozialstandards oder Leistungsniveaus<br />
o.ä., sondern wir haben hier ein politisches Verfahren, das sehr effektiv ist und das sehr<br />
tief in die nationalen Souveränitäten eingreift. Insofern müssen wir sagen, dass diese<br />
ganze Diskussion, die wir hier führen, eine Europäische Dimension erhält. Bei diesem<br />
Prozess ist interessant, dass andere Mitgliedstaaten, nämlich das Vereinigte Königreich,<br />
die Niederlande und nordischen Länder bei der Festlegung der Indikatoren sagen, es<br />
komme auch darauf an, nicht nur Input- und Output-Kriterien zu benennen - das ist die<br />
deutsche Betrachtung -, sondern auch Outcome-Kriterien, nämlich etwa die Frage nach<br />
der subjektiven Zufriedenheit.<br />
107
Und dann spielt z.B. eine Rolle, Sie haben das vorhin ironisch angemerkt, ob es eine<br />
Auswahl beim Essen gibt. Für die alten Leute, die ich regelmäßig besuche, spielt die<br />
Möglichkeit, im Altenheim eine Auswahl zwischen zwei oder sogar drei Mahlzeiten bekommen<br />
zu können, eine ganz entscheidende Rolle. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.<br />
Und weitere Frage der subjektiven Zufriedenheit: Gibt es <strong>für</strong> jeden, der es möchte, ein<br />
Einzelzimmer im Pflegeheim? Das ist z.B. aus meiner Sicht ein sehr zentrales Kriterium.<br />
Da müssen sich manche Bundesländer noch anstrengen. Ich habe eine 99jährige Verwandte,<br />
die in einer kleinen Stadt am Niederrhein in einer Pflegeeinrichtung der Diakonie<br />
lebt, in der es kein einziges Einzelzimmer gibt. Die alte Dame hat Geld genug und<br />
beglückt ihre <strong>Familie</strong> noch mit Teilen ihrer hohen Pension. Aber ein Einzelzimmer hat<br />
sie seit zehn Jahren nicht, weil es keines gibt. Das vielleicht als Beispiel <strong>für</strong> Kriterien<br />
subjektiver Zufriedenheit.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Herzlichen Dank. Kommen wir zur Schlussrunde mit noch einigen gezielten Fragen.<br />
Frau Reitsma, angesichts dieses europäischen Prozesses, retten uns da die Niederländer,<br />
indem sie ihren Fortschritt im Sinne Selbststeuerung hier einspeisen? Können Sie<br />
uns dazu etwas sagen?<br />
Liesbeth Reitsma<br />
Ich versuche etwas zu erreichen. Aber welchen Weg ich gehen muss, kann ich im Voraus<br />
nicht sehen. Aber es geschieht oft im Leben, dass man auf Wege kommt, die man<br />
selbst nicht wählt, die aber geschehen. Mit dem Patientenverband sind wir schon „nach<br />
Europa“ gelangt. Ob es auch gelingen wird, die verschiedenen Länder in Europa soweit<br />
zu bringen, weiß ich nicht. Ich mache im Moment einen Versuch mit verschiedenen<br />
Ländern und die können sich <strong>für</strong> Projekte einschreiben. Im Moment habe ich z.B. ein<br />
Projekt mit Portugal, Italien, Finnland und Holland. Ich habe schon oft Vertreter aus<br />
Deutschland gefragt, aber die sagen, wir haben nicht die Möglichkeiten oder kein Personal<br />
oder kein Geld, weil auch ein kleiner Teil vom Land selbst bezahlt werden muss.<br />
Und das ist dann immer schade. Ich hoffe und ich versuche, auch den Patientenverein<br />
in Zukunft mitzunehmen. Aber ich kann es nicht versprechen. Was ich versprechen kann<br />
ist, dass ich die Gelegenheit biete, Leute und Gruppen nach Holland einzuladen, dass<br />
sie sehen können, wie wir es machen. Das ist das Einzige was ich machen kann. Aber<br />
ich glaube, das ist schon viel, dass Sie sehen können, wie es funktioniert.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Vielen herzlichen Dank. Also doch nicht Mallorca, sondern Utrecht. Herr Gitschmann,<br />
wie sind Ihre Erfahrungen mit der Beteiligung in Hamburg, die Sie schon bei der Vorbereitung<br />
Ihres Projektes gemacht haben? Wie haben sich die Interessensverbände, die<br />
Selbsthilfeorganisationen eingebracht? Ermutigt Sie das, diesen Weg weiter zu gehen?<br />
<strong>Dr</strong>. Peter Gitschmann<br />
Ja unbedingt. Ich denke es ist wirklich gelungen, zu einem Konsens über die Rahmenbedingungen,<br />
auch die finanziellen, zu kommen. Es geht nicht um mehr Geld, sondern<br />
es geht darum, mit dem Vorhandenen umgehen und sich fachlich zu verständigen auf<br />
108
Ziele und auf Fragen, die man jetzt in einer modellhaften Erprobung gemeinsam klären<br />
will. Und das halte ich <strong>für</strong> nahezu jeglichen innovativen Ansatz grundsätzlich <strong>für</strong> den<br />
richtigen Weg. Ich bin da sehr optimistisch, dass das auch zu guten Ergebnissen führt.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Herzlichen Dank. Frau Baehrens, von meiner Seite noch eine Frage. Frau Reitsma hat<br />
gesagt, sie hätte viel gemacht mit dem Personal. In Deutschland würde das normalerweise<br />
umgekehrt laufen. Das Personal hat viel mit Ihnen gemacht? Frau Baehrens, was<br />
meinen Sie was mit dem Personal noch geschehen muss? Müssen wir dort etwas tun,<br />
damit sie mit solchen rebellischen Patienten umgehen können?<br />
Heike Baehrens<br />
Nein, ich glaube, dass es viele Fachkräfte gibt, die sich im Grunde freuen, wenn sie<br />
wirklich Klienten / Patienten gegenüber haben, die mitdenken und die vor allem selber<br />
auch Initiative ergreifen. Ich glaube, dass da eine große Aufgeschlossenheit vorhanden<br />
ist. Und ich glaube vor allem, dass sich die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
am ehesten auf das persönliche Budget oder auf die neuen Angebotsformen einlassen<br />
werden. Die, die dem skeptisch gegenüberstehen, bleiben in den anderen Angebotsformen.<br />
Das ist ja kein Problem. Und insofern wäre mein Wunsch, dass wir mehr die<br />
Chancen des persönlichen Budgets in den Blick nehmen und nicht von vornherein nur<br />
die Grenzen beschreiben und die möglichen Gefahren sehen. Sondern wirklich erst<br />
einmal auf die Chancen gucken, verschiedene Modelle ausprobieren und damit Erfahrungen<br />
machen und dann wirklich prüfen, was ist davon tragfähig und was wollen wir<br />
wirklich auf Dauer installieren und nicht von vornherein mit der großen Skepsis rangehen.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Herr <strong>Dr</strong>. Schulte, noch ein Letztes. Wenn Sie einen Wunsch hätten und das gesamte<br />
deutsche Sozialrecht vor sich sehen, und Sie hätten den Auftrag, Selbststeuerung soll<br />
intensiviert werden und noch größere Chancen bekommen, es sind ja schon einige da,<br />
was müsste da der nächste Schritt sein?<br />
<strong>Dr</strong>. Bernd Schulte<br />
Ich habe vorhin einmal von den verschiedenen Rollen gesprochen, die der Bürger bei<br />
uns hat. Und er hat z.B. auch die Rolle des Altenheimbewohners, irgendwann mal. Und<br />
dann sollte er auch in dieser Rolle eine Teilkarte erhalten, Mitwirkungsmöglichkeit bekommen<br />
an den Dingen, die im Altenheim passieren. Und wenn er selber nicht mehr in<br />
der Lage ist, das zu tun – ich habe so einen Altenheimbeirat von drei Leuten vor Augen,<br />
das Durchschnittsalter ist 85, zwei sitzen im Rollstuhl, einer hat einen Stock, und die<br />
stehen allein der Heimleitung gegenüber - dann müssen da auch Externe rein. Das hätten<br />
die freien Wohlfahrtsverbände als Heimträger schon freiwillig machen können, schon<br />
vor Jahren und Jahrzehnten. Also, wenn sie das nicht freiwillig tun, müssen sie dazu<br />
gezwungen werden. Wobei Externe Angehörige sein können, aber es nicht sein müssen.<br />
Dasselbe gilt, jetzt wieder als Beispiel aus den Niederlanden, <strong>für</strong> Klientenräte. Bei<br />
teilstationären und ambulanten Einrichtungen sagt man bei uns stereotyp, dass man da<br />
109
keine Mitbestimmung einführen könne, weil die Leute immer wechseln. Das ist ein vorgeschobenes<br />
Argument. In den Niederlanden hat man auch Modelle entwickelt, dass<br />
man auch ehemalige Patienten usw. da reinnehmen kann. Ich will deshalb da<strong>für</strong> plädieren,<br />
in den verschiedenen Funktionsbereichen, die wir haben, den Betroffenen mehr<br />
gesellschaftliche Verantwortung zu geben. Das ist der erste Punkt. Eine letzte Bemerkung<br />
zu Herrn Lehmann: Herr Lehmann hat zu Recht die Rolle des Staates angemerkt.<br />
Der Staat hat nach wie vor die Rahmenverantwortung, die soziale Sicherheit zu organisieren,<br />
und eine Basisverantwortung <strong>für</strong> das, was lebensnotwendig ist. Es gibt diesen<br />
berühmten Witz von dem Neger, der in New York in der Synagoge sitzt und dem klopft<br />
jemand auf die Schulter und sagt: „Schwarz sein allein reicht Ihnen wohl nicht?“ Dahinter<br />
steht also die Idee, dass es Außenseiter gibt. Die Stärke eines Sozialstaates zeigt<br />
sich darin, dass der Ärmste der Armen und der größte Außenseiter auch noch integriert<br />
wird. Das ist eine Schwäche der US-amerikanischen Kommunitarismus-Idee: der jüdische<br />
Neger in Wisconsin oder Madison oder in Montana, hat eben keine Garantie, dass<br />
er die gleiche Leistung bekommt wie der andere und dass er gleich behandelt wird. Eine<br />
solche Garantie kann letztlich nur der Staat geben. Insofern wird der Staat gebraucht,<br />
aber er muss sich ändern, genau wie die Wohlfahrtsverbände sich ändern müssen. Und<br />
denen muss man ein bisschen dabei helfen. Das haben wir bei der Pflegeversicherung<br />
bereits getan, indem wir den Vorrang der freien Wohlfahrtspflege aus dem BSHG nicht<br />
in das Pflegeversicherungsgesetz übernommen haben. Wir haben den Wettbewerb zugelassen<br />
zugunsten gewerblicher Leistungsanbieter. Und ich behaupte, dass die Qualität<br />
im Bereich der Pflege, bei allen Mängeln, dadurch steigt. Danke schön.<br />
<strong>Dr</strong>. <strong>Jan</strong> <strong>Schröder</strong><br />
Herzlichen Dank auch <strong>für</strong> diesen Appell zur freundlichen Fürsorge in Richtung der Wohlfahrtspflege.<br />
Wir gehen jetzt nicht in die nächste Diskussionsrunde. Ich möchte mich bei<br />
Ihnen Vieren und auch bei Ihnen im Publikum <strong>für</strong> diese muntere Runde herzlich bedanken.<br />
Ich hoffe, es wurde Ihnen noch das eine oder andere zum Denken mitgegeben.<br />
MDir Eduard Tack, <strong>Bundesministerium</strong> <strong>für</strong> <strong>Familie</strong>, <strong>Senioren</strong>, <strong>Frauen</strong> und Jugend<br />
Herr MDir Tack bedankt sich <strong>für</strong> die erfolgreich verlaufene Tagung und wünscht allen<br />
Anwesenden eine gelingende Fortsetzung der „Magdeburger Gespräche“.<br />
110