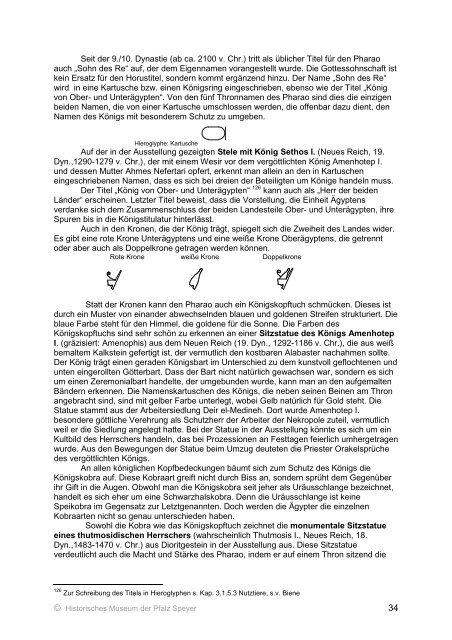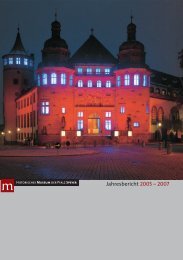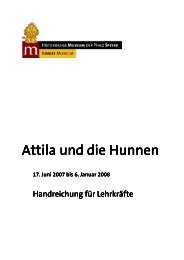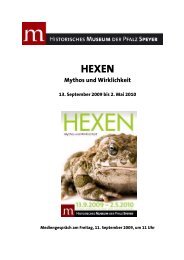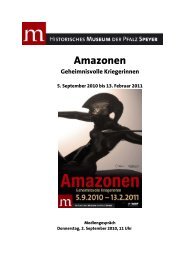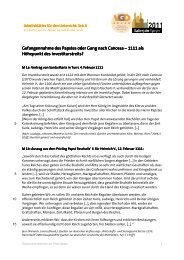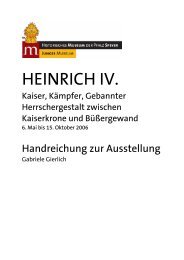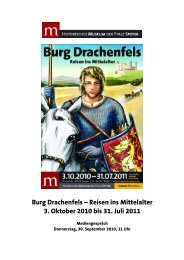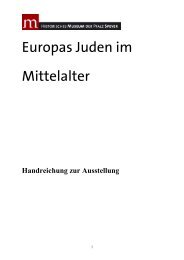Ägyptens Schätze entdecken - Historisches Museum der Pfalz Speyer
Ägyptens Schätze entdecken - Historisches Museum der Pfalz Speyer
Ägyptens Schätze entdecken - Historisches Museum der Pfalz Speyer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seit <strong>der</strong> 9./10. Dynastie (ab ca. 2100 v. Chr.) tritt als üblicher Titel für den Pharao<br />
auch „Sohn des Re“ auf, <strong>der</strong> dem Eigennamen vorangestellt wurde. Die Gottessohnschaft ist<br />
kein Ersatz für den Horustitel, son<strong>der</strong>n kommt ergänzend hinzu. Der Name „Sohn des Re“<br />
wird in eine Kartusche bzw. einen Königsring eingeschrieben, ebenso wie <strong>der</strong> Titel „König<br />
von Ober- und Unterägypten“. Von den fünf Thronnamen des Pharao sind dies die einzigen<br />
beiden Namen, die von einer Kartusche umschlossen werden, die offenbar dazu dient, den<br />
Namen des Königs mit beson<strong>der</strong>em Schutz zu umgeben.<br />
Hieroglyphe: Kartusche<br />
Auf <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Ausstellung gezeigten Stele mit König Sethos I. (Neues Reich, 19.<br />
Dyn.,1290-1279 v. Chr.), <strong>der</strong> mit einem Wesir vor dem vergöttlichten König Amenhotep I.<br />
und dessen Mutter Ahmes Nefertari opfert, erkennt man allein an den in Kartuschen<br />
eingeschriebenen Namen, dass es sich bei dreien <strong>der</strong> Beteiligten um Könige handeln muss.<br />
Der Titel „König von Ober- und Unterägypten“ 126 kann auch als „Herr <strong>der</strong> beiden<br />
Län<strong>der</strong>“ erscheinen. Letzter Titel beweist, dass die Vorstellung, die Einheit <strong>Ägyptens</strong><br />
verdanke sich dem Zusammenschluss <strong>der</strong> beiden Landesteile Ober- und Unterägypten, ihre<br />
Spuren bis in die Königstitulatur hinterlässt.<br />
Auch in den Kronen, die <strong>der</strong> König trägt, spiegelt sich die Zweiheit des Landes wi<strong>der</strong>.<br />
Es gibt eine rote Krone Unterägyptens und eine weiße Krone Oberägyptens, die getrennt<br />
o<strong>der</strong> aber auch als Doppelkrone getragen werden können.<br />
Rote Krone weiße Krone Doppelkrone<br />
Statt <strong>der</strong> Kronen kann den Pharao auch ein Königskopftuch schmücken. Dieses ist<br />
durch ein Muster von einan<strong>der</strong> abwechselnden blauen und goldenen Streifen strukturiert. Die<br />
blaue Farbe steht für den Himmel, die goldene für die Sonne. Die Farben des<br />
Königskopftuchs sind sehr schön zu erkennen an einer Sitzstatue des Königs Amenhotep<br />
I. (gräzisiert: Amenophis) aus dem Neuen Reich (19. Dyn., 1292-1186 v. Chr.), die aus weiß<br />
bemaltem Kalkstein gefertigt ist, <strong>der</strong> vermutlich den kostbaren Alabaster nachahmen sollte.<br />
Der König trägt einen geraden Königsbart im Unterschied zu dem kunstvoll geflochtenen und<br />
unten eingerollten Götterbart. Dass <strong>der</strong> Bart nicht natürlich gewachsen war, son<strong>der</strong>n es sich<br />
um einen Zeremonialbart handelte, <strong>der</strong> umgebunden wurde, kann man an den aufgemalten<br />
Bän<strong>der</strong>n erkennen. Die Namenskartuschen des Königs, die neben seinen Beinen am Thron<br />
angebracht sind, sind mit gelber Farbe unterlegt, wobei Gelb natürlich für Gold steht. Die<br />
Statue stammt aus <strong>der</strong> Arbeitersiedlung Deir el-Medineh. Dort wurde Amenhotep I.<br />
beson<strong>der</strong>e göttliche Verehrung als Schutzherr <strong>der</strong> Arbeiter <strong>der</strong> Nekropole zuteil, vermutlich<br />
weil er die Siedlung angelegt hatte. Bei <strong>der</strong> Statue in <strong>der</strong> Ausstellung könnte es sich um ein<br />
Kultbild des Herrschers handeln, das bei Prozessionen an Festtagen feierlich umhergetragen<br />
wurde. Aus den Bewegungen <strong>der</strong> Statue beim Umzug deuteten die Priester Orakelsprüche<br />
des vergöttlichten Königs.<br />
An allen königlichen Kopfbedeckungen bäumt sich zum Schutz des Königs die<br />
Königskobra auf. Diese Kobraart greift nicht durch Biss an, son<strong>der</strong>n sprüht dem Gegenüber<br />
ihr Gift in die Augen. Obwohl man die Königskobra seit jeher als Uräusschlange bezeichnet,<br />
handelt es sich eher um eine Schwarzhalskobra. Denn die Uräusschlange ist keine<br />
Speikobra im Gegensatz zur Letztgenannten. Doch werden die Ägypter die einzelnen<br />
Kobraarten nicht so genau unterschieden haben.<br />
Sowohl die Kobra wie das Königskopftuch zeichnet die monumentale Sitzstatue<br />
eines thutmosidischen Herrschers (wahrscheinlich Thutmosis I., Neues Reich, 18.<br />
Dyn.,1483-1470 v. Chr.) aus Dioritgestein in <strong>der</strong> Ausstellung aus. Diese Sitzstatue<br />
verdeutlicht auch die Macht und Stärke des Pharao, indem er auf einem Thron sitzend die<br />
126 Zur Schreibung des Titels in Hieroglyphen s. Kap. 3.1.5.3 Nutztiere, s.v. Biene<br />
© <strong>Historisches</strong> <strong>Museum</strong> <strong>der</strong> <strong>Pfalz</strong> <strong>Speyer</strong><br />
34