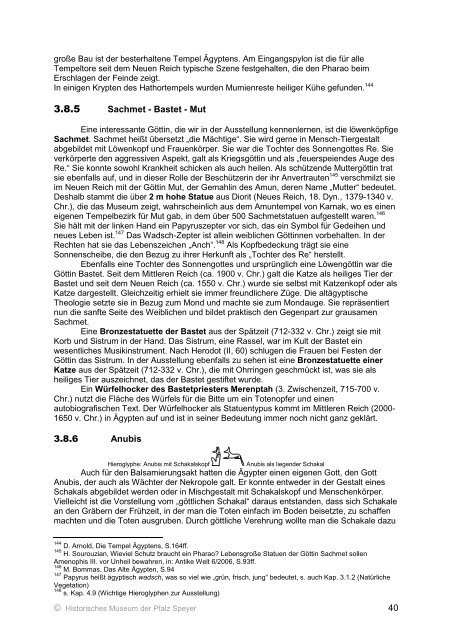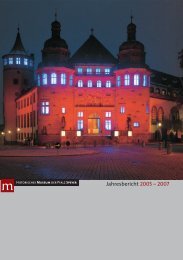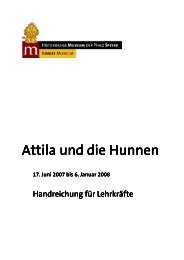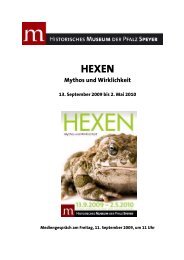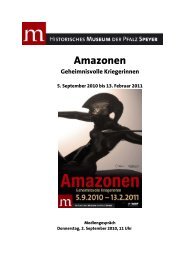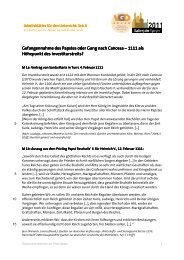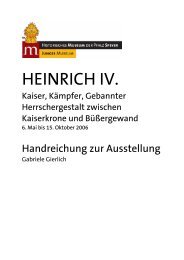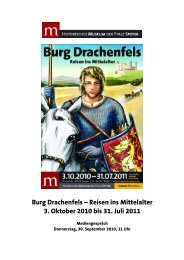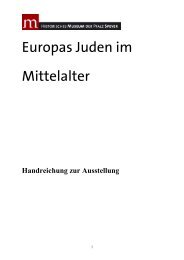Ägyptens Schätze entdecken - Historisches Museum der Pfalz Speyer
Ägyptens Schätze entdecken - Historisches Museum der Pfalz Speyer
Ägyptens Schätze entdecken - Historisches Museum der Pfalz Speyer
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
große Bau ist <strong>der</strong> besterhaltene Tempel <strong>Ägyptens</strong>. Am Eingangspylon ist die für alle<br />
Tempeltore seit dem Neuen Reich typische Szene festgehalten, die den Pharao beim<br />
Erschlagen <strong>der</strong> Feinde zeigt.<br />
In einigen Krypten des Hathortempels wurden Mumienreste heiliger Kühe gefunden. 144<br />
3.8.5 Sachmet - Bastet - Mut<br />
Eine interessante Göttin, die wir in <strong>der</strong> Ausstellung kennenlernen, ist die löwenköpfige<br />
Sachmet. Sachmet heißt übersetzt „die Mächtige“. Sie wird gerne in Mensch-Tiergestalt<br />
abgebildet mit Löwenkopf und Frauenkörper. Sie war die Tochter des Sonnengottes Re. Sie<br />
verkörperte den aggressiven Aspekt, galt als Kriegsgöttin und als „feuerspeiendes Auge des<br />
Re.“ Sie konnte sowohl Krankheit schicken als auch heilen. Als schützende Muttergöttin trat<br />
sie ebenfalls auf, und in dieser Rolle <strong>der</strong> Beschützerin <strong>der</strong> ihr Anvertrauten 145 verschmilzt sie<br />
im Neuen Reich mit <strong>der</strong> Göttin Mut, <strong>der</strong> Gemahlin des Amun, <strong>der</strong>en Name „Mutter“ bedeutet.<br />
Deshalb stammt die über 2 m hohe Statue aus Diorit (Neues Reich, 18. Dyn., 1379-1340 v.<br />
Chr.), die das <strong>Museum</strong> zeigt, wahrscheinlich aus dem Amuntempel von Karnak, wo es einen<br />
eigenen Tempelbezirk für Mut gab, in dem über 500 Sachmetstatuen aufgestellt waren. 146<br />
Sie hält mit <strong>der</strong> linken Hand ein Papyruszepter vor sich, das ein Symbol für Gedeihen und<br />
neues Leben ist. 147 Das Wadsch-Zepter ist allein weiblichen Göttinnen vorbehalten. In <strong>der</strong><br />
Rechten hat sie das Lebenszeichen „Anch“. 148 Als Kopfbedeckung trägt sie eine<br />
Sonnenscheibe, die den Bezug zu ihrer Herkunft als „Tochter des Re“ herstellt.<br />
Ebenfalls eine Tochter des Sonnengottes und ursprünglich eine Löwengöttin war die<br />
Göttin Bastet. Seit dem Mittleren Reich (ca. 1900 v. Chr.) galt die Katze als heiliges Tier <strong>der</strong><br />
Bastet und seit dem Neuen Reich (ca. 1550 v. Chr.) wurde sie selbst mit Katzenkopf o<strong>der</strong> als<br />
Katze dargestellt. Gleichzeitig erhielt sie immer freundlichere Züge. Die altägyptische<br />
Theologie setzte sie in Bezug zum Mond und machte sie zum Mondauge. Sie repräsentiert<br />
nun die sanfte Seite des Weiblichen und bildet praktisch den Gegenpart zur grausamen<br />
Sachmet.<br />
Eine Bronzestatuette <strong>der</strong> Bastet aus <strong>der</strong> Spätzeit (712-332 v. Chr.) zeigt sie mit<br />
Korb und Sistrum in <strong>der</strong> Hand. Das Sistrum, eine Rassel, war im Kult <strong>der</strong> Bastet ein<br />
wesentliches Musikinstrument. Nach Herodot (II, 60) schlugen die Frauen bei Festen <strong>der</strong><br />
Göttin das Sistrum. In <strong>der</strong> Ausstellung ebenfalls zu sehen ist eine Bronzestatuette einer<br />
Katze aus <strong>der</strong> Spätzeit (712-332 v. Chr.), die mit Ohrringen geschmückt ist, was sie als<br />
heiliges Tier auszeichnet, das <strong>der</strong> Bastet gestiftet wurde.<br />
Ein Würfelhocker des Bastetpriesters Merenptah (3. Zwischenzeit, 715-700 v.<br />
Chr.) nutzt die Fläche des Würfels für die Bitte um ein Totenopfer und einen<br />
autobiografischen Text. Der Würfelhocker als Statuentypus kommt im Mittleren Reich (2000-<br />
1650 v. Chr.) in Ägypten auf und ist in seiner Bedeutung immer noch nicht ganz geklärt.<br />
3.8.6 Anubis<br />
Hieroglyphe: Anubis mit Schakalskopf Anubis als liegen<strong>der</strong> Schakal<br />
Auch für den Balsamierungsakt hatten die Ägypter einen eigenen Gott, den Gott<br />
Anubis, <strong>der</strong> auch als Wächter <strong>der</strong> Nekropole galt. Er konnte entwe<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Gestalt eines<br />
Schakals abgebildet werden o<strong>der</strong> in Mischgestalt mit Schakalskopf und Menschenkörper.<br />
Vielleicht ist die Vorstellung vom „göttlichen Schakal“ daraus entstanden, dass sich Schakale<br />
an den Gräbern <strong>der</strong> Frühzeit, in <strong>der</strong> man die Toten einfach im Boden beisetzte, zu schaffen<br />
machten und die Toten ausgruben. Durch göttliche Verehrung wollte man die Schakale dazu<br />
144<br />
D. Arnold, Die Tempel <strong>Ägyptens</strong>, S.164ff.<br />
145<br />
H. Sourouzian, Wieviel Schutz braucht ein Pharao? Lebensgroße Statuen <strong>der</strong> Göttin Sachmet sollen<br />
Amenophis III. vor Unheil bewahren, in: Antike Welt 6/2006, S.93ff.<br />
146<br />
M. Bommas, Das Alte Ägypten, S.94<br />
147<br />
Papyrus heißt ägyptisch wadsch, was so viel wie „grün, frisch, jung“ bedeutet, s. auch Kap. 3.1.2 (Natürliche<br />
Vegetation)<br />
148<br />
s. Kap. 4.9 (Wichtige Hieroglyphen zur Ausstellung)<br />
© <strong>Historisches</strong> <strong>Museum</strong> <strong>der</strong> <strong>Pfalz</strong> <strong>Speyer</strong><br />
40