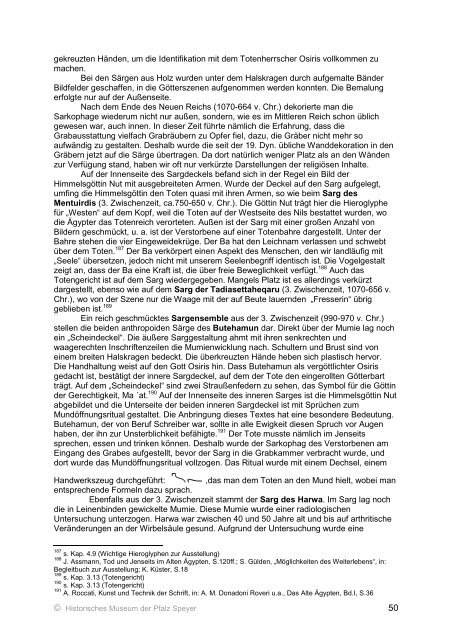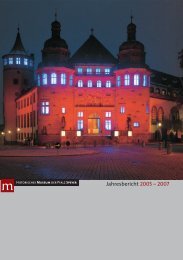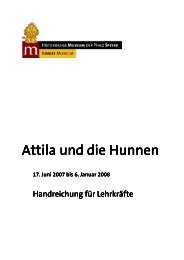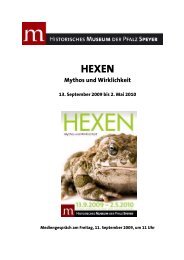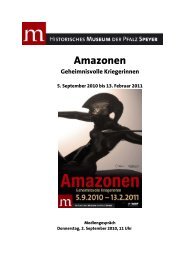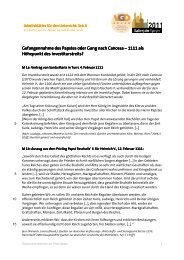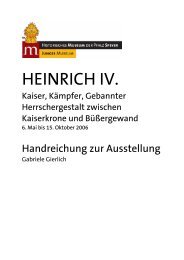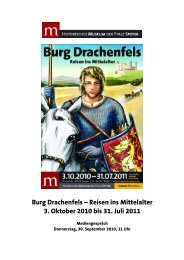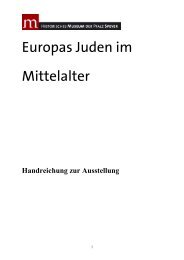Ägyptens Schätze entdecken - Historisches Museum der Pfalz Speyer
Ägyptens Schätze entdecken - Historisches Museum der Pfalz Speyer
Ägyptens Schätze entdecken - Historisches Museum der Pfalz Speyer
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gekreuzten Händen, um die Identifikation mit dem Totenherrscher Osiris vollkommen zu<br />
machen.<br />
Bei den Särgen aus Holz wurden unter dem Halskragen durch aufgemalte Bän<strong>der</strong><br />
Bildfel<strong>der</strong> geschaffen, in die Götterszenen aufgenommen werden konnten. Die Bemalung<br />
erfolgte nur auf <strong>der</strong> Außenseite.<br />
Nach dem Ende des Neuen Reichs (1070-664 v. Chr.) dekorierte man die<br />
Sarkophage wie<strong>der</strong>um nicht nur außen, son<strong>der</strong>n, wie es im Mittleren Reich schon üblich<br />
gewesen war, auch innen. In dieser Zeit führte nämlich die Erfahrung, dass die<br />
Grabausstattung vielfach Grabräubern zu Opfer fiel, dazu, die Gräber nicht mehr so<br />
aufwändig zu gestalten. Deshalb wurde die seit <strong>der</strong> 19. Dyn. übliche Wanddekoration in den<br />
Gräbern jetzt auf die Särge übertragen. Da dort natürlich weniger Platz als an den Wänden<br />
zur Verfügung stand, haben wir oft nur verkürzte Darstellungen <strong>der</strong> religiösen Inhalte.<br />
Auf <strong>der</strong> Innenseite des Sargdeckels befand sich in <strong>der</strong> Regel ein Bild <strong>der</strong><br />
Himmelsgöttin Nut mit ausgebreiteten Armen. Wurde <strong>der</strong> Deckel auf den Sarg aufgelegt,<br />
umfing die Himmelsgöttin den Toten quasi mit ihren Armen, so wie beim Sarg des<br />
Mentuirdis (3. Zwischenzeit, ca.750-650 v. Chr.). Die Göttin Nut trägt hier die Hieroglyphe<br />
für „Westen“ auf dem Kopf, weil die Toten auf <strong>der</strong> Westseite des Nils bestattet wurden, wo<br />
die Ägypter das Totenreich verorteten. Außen ist <strong>der</strong> Sarg mit einer großen Anzahl von<br />
Bil<strong>der</strong>n geschmückt, u. a. ist <strong>der</strong> Verstorbene auf einer Totenbahre dargestellt. Unter <strong>der</strong><br />
Bahre stehen die vier Eingeweidekrüge. Der Ba hat den Leichnam verlassen und schwebt<br />
über dem Toten. 187 Der Ba verkörpert einen Aspekt des Menschen, den wir landläufig mit<br />
„Seele“ übersetzen, jedoch nicht mit unserem Seelenbegriff identisch ist. Die Vogelgestalt<br />
zeigt an, dass <strong>der</strong> Ba eine Kraft ist, die über freie Beweglichkeit verfügt. 188 Auch das<br />
Totengericht ist auf dem Sarg wie<strong>der</strong>gegeben. Mangels Platz ist es allerdings verkürzt<br />
dargestellt, ebenso wie auf dem Sarg <strong>der</strong> Tadiasettaheqaru (3. Zwischenzeit, 1070-656 v.<br />
Chr.), wo von <strong>der</strong> Szene nur die Waage mit <strong>der</strong> auf Beute lauernden „Fresserin“ übrig<br />
geblieben ist. 189<br />
Ein reich geschmücktes Sargensemble aus <strong>der</strong> 3. Zwischenzeit (990-970 v. Chr.)<br />
stellen die beiden anthropoiden Särge des Butehamun dar. Direkt über <strong>der</strong> Mumie lag noch<br />
ein „Scheindeckel“. Die äußere Sarggestaltung ahmt mit ihren senkrechten und<br />
waagerechten Inschriftenzeilen die Mumienwicklung nach. Schultern und Brust sind von<br />
einem breiten Halskragen bedeckt. Die überkreuzten Hände heben sich plastisch hervor.<br />
Die Handhaltung weist auf den Gott Osiris hin. Dass Butehamun als vergöttlichter Osiris<br />
gedacht ist, bestätigt <strong>der</strong> innere Sargdeckel, auf dem <strong>der</strong> Tote den eingerollten Götterbart<br />
trägt. Auf dem „Scheindeckel“ sind zwei Straußenfe<strong>der</strong>n zu sehen, das Symbol für die Göttin<br />
<strong>der</strong> Gerechtigkeit, Ma ´at. 190 Auf <strong>der</strong> Innenseite des inneren Sarges ist die Himmelsgöttin Nut<br />
abgebildet und die Unterseite <strong>der</strong> beiden inneren Sargdeckel ist mit Sprüchen zum<br />
Mundöffnungsritual gestaltet. Die Anbringung dieses Textes hat eine beson<strong>der</strong>e Bedeutung.<br />
Butehamun, <strong>der</strong> von Beruf Schreiber war, sollte in alle Ewigkeit diesen Spruch vor Augen<br />
haben, <strong>der</strong> ihn zur Unsterblichkeit befähigte. 191 Der Tote musste nämlich im Jenseits<br />
sprechen, essen und trinken können. Deshalb wurde <strong>der</strong> Sarkophag des Verstorbenen am<br />
Eingang des Grabes aufgestellt, bevor <strong>der</strong> Sarg in die Grabkammer verbracht wurde, und<br />
dort wurde das Mundöffnungsritual vollzogen. Das Ritual wurde mit einem Dechsel, einem<br />
Handwerkszeug durchgeführt: ,das man dem Toten an den Mund hielt, wobei man<br />
entsprechende Formeln dazu sprach.<br />
D Ebenfalls aus <strong>der</strong> 3. Zwischenzeit stammt <strong>der</strong> Sarg des Harwa. Im Sarg lag noch<br />
die in Leinenbinden gewickelte Mumie. Diese Mumie wurde einer radiologischen<br />
Untersuchung unterzogen. Harwa war zwischen 40 und 50 Jahre alt und bis auf arthritische<br />
Verän<strong>der</strong>ungen an <strong>der</strong> Wirbelsäule gesund. Aufgrund <strong>der</strong> Untersuchung wurde eine<br />
187<br />
s. Kap. 4.9 (Wichtige Hieroglyphen zur Ausstellung)<br />
188<br />
J. Assmann, Tod und Jenseits im Alten Ägypten, S.120ff.; S. Gülden, „Möglichkeiten des Weiterlebens“, in:<br />
Begleitbuch zur Ausstellung; K. Küster, S.18<br />
189<br />
s. Kap. 3.13 (Totengericht)<br />
190<br />
s. Kap. 3.13 (Totengericht)<br />
191<br />
A. Roccati, Kunst und Technik <strong>der</strong> Schrift, in: A. M. Donadoni Roveri u.a., Das Alte Ägypten, Bd.I, S.36<br />
© <strong>Historisches</strong> <strong>Museum</strong> <strong>der</strong> <strong>Pfalz</strong> <strong>Speyer</strong><br />
50