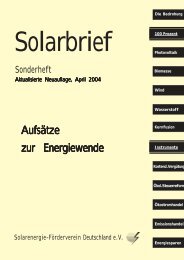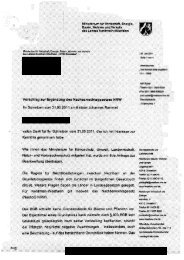SOLARBRIEF - SFV
SOLARBRIEF - SFV
SOLARBRIEF - SFV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ausbau der "Sammelnetze" in<br />
netzfernen Gebieten<br />
Windanlagen und Solaranlagen auf Feldscheunen werden<br />
zunehmend in weiterer Entfernung von bereits verlegten<br />
Stromnetzen aufgebaut. Damit steigt die Notwendigkeit zum<br />
Ausbau der "Sammelleitungen" [1]. Dieser Netzausbau wird<br />
durch den <strong>SFV</strong> ausdrücklich gefordert. In diesem Zusammenhang<br />
entsteht für die Betreiber eine erhöhte Kostenbelastung.<br />
Für Offshore-Windparks gibt es eine betreiberfreundliche<br />
Regelung. § 17 Abs. 2a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)<br />
verpfl ichtet den nächstgelegenen Netzbetreiber zur Netzanbindung<br />
der Offshore-Windparks, d.h. vom Umspannwerk auf<br />
See bis zum technisch und wirtschaftlich günstigsten Netzanschlusspunkt.<br />
Diese Regelung betrifft alle Windparks, mit deren<br />
Bau bis Ende 2015 begonnen wurde (§118 Abs. 3 EnWG).<br />
Die Kosten für die Netzanbindung trägt der Netzbetreiber. Er<br />
kann sie auf alle Übertragungsnetzbetreiber verteilen.[2] Für<br />
die Betreiber von Windparks im Binnenland fehlt leider eine<br />
entsprechende Regelung.<br />
Ausbau der "Sammelnetze" im Ortsnetzbereich<br />
Beim Ausbau der Solarenergie im Ortsnetzbereich liegen<br />
die Verhältnisse etwas anders, da dort in der Regel bereits<br />
elektrische Anschlüsse für die dort zu versorgenden Stromverbraucher<br />
verlegt sind.<br />
Allerdings verweigern die zuständigen Netzbetreiber immer<br />
häufi ger den Anschluss von Solaranlagen an das bestehende<br />
Netz, weil es dadurch tatsächlich oder auch nur angeblich<br />
überlastet würde.<br />
Welche Abhilfe in einem solchen Fall aus technischen<br />
Gründen gerechtfertigt wäre, ergibt sich aus folgender Überlegung.<br />
Die Höchstleistung von Solaranlagen erreicht etwa den<br />
zehnfachen Wert der Durchschnittsleistung. Diese zehnfache<br />
Leistung kann zwar durch eine erhebliche Verstärkung des<br />
Nieder- und Mittelspannungsnetzes in andere Gegenden<br />
weitergegeben werden, doch fehlt die fortgeleitete Energie<br />
dann schon wenige Stunden später in dem betroffenen<br />
Ortsteil selbst. Ein Netzbetreiber, der auf Vollversorgung mit<br />
Erneuerbaren Energien setzt, sollte deshalb zunächst den<br />
Ausbau der dezentralen Stromspeicher in dem überlasteten<br />
Netzzweig vorantreiben. Das tut er aber zur Zeit noch nicht,<br />
weil es keinen kostendeckenden Anreiz zum Bau dezentraler<br />
Stromspeicher gibt; weder für den Netzbetreiber noch für die<br />
Solaranlagenbetreiber, noch für die Verbraucher.<br />
Um Missverständnisse auszuschließen: Die Speicherung<br />
und Glättung des Solarstroms ist nicht Aufgabe der Solaranlagenbetreiber<br />
alleine. Vielmehr sollten Speicherbau-Förderanreize<br />
sich an alle Anschlussnehmer wenden (Stromspeicher<br />
auch für Anschlussnehmer ohne PV-Anlage!, siehe Bild 7 auf<br />
Seite 20).<br />
Solarbrief 4/10<br />
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.<br />
Stromspeichern - Brücke zum Solarzeitalter<br />
Wird diese neue Forderung nicht erfüllt, dann unterbleibt<br />
entweder der weitere Ausbau der Photovoltaik in diesem Teil<br />
des Netzes oder es werden möglicherweise unnötige Netzverstärkungen<br />
vorgenommen, die im Endausbaustand nicht<br />
gebraucht werden.<br />
Bevor das Netz zur Fortleitung des Solar- oder Windstroms<br />
weiter ausgebaut wird, wäre also zu klären, ob das eigene<br />
Gebiet bereits vollständig versorgt ist, genauer gesagt, ob die<br />
vorhandenen Stromspeicher bereits ausreichen, den Stromverbrauch<br />
des eigenen Gebietes vollständig aus Sonne und<br />
Wind zu decken.<br />
Nur wenn in absehbarer Zeit mehr Solar- und Windstrom<br />
erzeugt werden wird, als in diesem Gebiet benötigt wird, erst<br />
dann ist der Ausbau der Netze zur Fortleitung des Stroms in<br />
andere Gebiete durchzuführen, und zwar in solche Gebiete,<br />
die ihren eigenen Strombedarf mangels eigenen Solar- und<br />
Windpotentials auch zukünftig nicht vollständig mit Strom aus<br />
Erneuerbaren Energien werden decken können.<br />
Hier gibt es leider einen Widerspruch zwischen der sachgemäßen<br />
Entscheidung, die lokalen Speicher auszubauen<br />
und der gesetzlichen Regelung, die nur die Maßnahme des<br />
Netzausbaus kennt. Solange bis unsere Forderung nach Speicherausbau<br />
keinen Eingang in die Fördergesetze gefunden<br />
hat, so lange können Anlagenbetreiber bei Netzüberlastung<br />
konkret nur den weiteren Ausbau des Netzes fordern.<br />
Internationale Fernübertragungsleitungen?<br />
Potentialüberlegungen im nationalen Rahmen zeigen, dass<br />
jedes Land in Europa (mit Ausnahme der Niederlande) bei<br />
entsprechendem Ausbau der Erneuerbaren Energien damit<br />
seinen Jahresbedarf decken und sogar noch Überschüsse<br />
erzielen kann, mit denen die unvermeidbaren Speicherverluste<br />
gedeckt werden können. Für Deutschland kann dies mit Hilfe<br />
des Energiewenderechners (www.energiewenderechner.de)<br />
gezeigt werden. Für die anderen Länder Europas gilt die<br />
Überlegung, dass dort das Verhältnis von Energiebedarf zu<br />
Landesfl äche kleiner ist als in Deutschland. Weil das Potential<br />
der Erneuerbaren Energien in erster Näherung proportional<br />
zur Bodenfl äche ist, lässt sich plausibel vermuten, dass eine<br />
Vollversorgung in diesen Ländern noch einfacher zu verwirklichen<br />
sein wird als in Deutschland.<br />
Würden in jedem dieser Länder in Verbrauchernähe dezentrale<br />
Stromspeicher errichtet, deren Kapazität ausreicht,<br />
den erwarteten Verbrauch in den Wind- und Sonnenlücken<br />
zu decken, so wäre dort eine durchgängige Energieversorgung<br />
mit Erneuerbaren Energien möglich. Man könnte dort<br />
auf den weiteren Ausbau der grenzüberschreitenden Fernübertragungsleitungen<br />
verzichten, die wie vorhergehend<br />
erläutert, weder für den Hell-Dunkel-Ausgleich noch für den<br />
Ausgleich fehlenden Windes bei europaweiter Windstille<br />
benötigt werden.<br />
[1] Es handelt sich um Leitungen, die das "Einsammeln" der Erneuerbaren Energien ermöglichen sollen.<br />
[2] § 17 Abs. 2a EnWG bestimmt: „(2a) Betreiber von Übertragungsnetzen, in deren Regelzone die Netzanbindung von Offshore-Anlagen im Sinne des § 10 Abs. 3 Satz 1<br />
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes erfolgen soll, haben die Leitungen von dem Umspannwerk der Offshore-Anlagen bis zu dem technisch und wirtschaftlich günstigsten<br />
Verknüpfungspunkt des nächsten Übertragungs- oder Verteilernetzes zu errichten und zu betreiben; die Netzanbindungen müssen zu dem Zeitpunkt der Herstellung der<br />
technischen Betriebsbereitschaft der Offshore-Anlagen errichtet sein. Eine Leitung nach Satz 1 gilt ab dem Zeitpunkt der Errichtung als Teil des Energieversorgungsnetzes.<br />
Betreiber von Übertragungsnetzen sind zum Ersatz der Aufwendungen verpfl ichtet, die die Betreiber von Offshore-Anlagen für die Planung und Genehmigung der Netzanschlussleitungen<br />
bis zum 17. Dezember 2006 getätigt haben, soweit diese Aufwendungen den Umständen nach für erforderlich anzusehen waren und den Anforderungen<br />
eines effi zienten Netzbetriebs nach § 21 entsprechen. Die Betreiber von Übertragungsnetzen sind verpfl ichtet, den unterschiedlichen Umfang ihrer Kosten nach den Sätzen<br />
1 und 3 über eine fi nanzielle Verrechnung untereinander auszugleichen; § 9 Abs. 3 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes fi ndet entsprechende Anwendung."<br />
§ 118 EnWG Abs. (7) bestimmt: "§ 17 Abs. 2a gilt nur für Offshore-Anlagen, mit deren Errichtung bis zum 31. Dezember 2011 begonnen worden ist."<br />
21