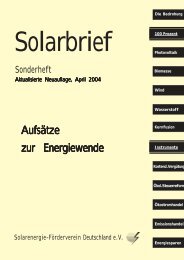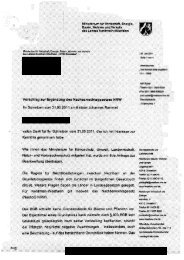SOLARBRIEF - SFV
SOLARBRIEF - SFV
SOLARBRIEF - SFV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
(1) Abwägung zwischen Netzausbau<br />
und Speicherausbau<br />
Die Fragestellung - Anreiz zum Speicherbau unzureichend -<br />
Steigende Verluste trotz vollkommenen Netzausbaus<br />
Einleitung<br />
Zunehmend kommt es an verschiedenen Stellen<br />
Deutschlands dazu, dass Strom aus Erneuerbaren<br />
Energien von den Stromnetzbetreibern nicht abgenommen<br />
werden kann. Bekannt ist das Beispiel Westholstein,<br />
wo schon seit einigen Jahren bei gutem Wind<br />
einige Windparks „abgeregelt“ werden müssen, d.h.<br />
Windanlagen werden angehalten oder in ihrer Leistung<br />
reduziert. Die Stromleitungen, die den Windstrom ins<br />
Ruhrgebiet leiten könnten, sind zu schwach dimensioniert<br />
und können deswegen die Windstromleistung<br />
nicht übertragen. Kostbare Energie wird vernichtet, die<br />
im Ruhrgebiet gut gebraucht werden könnte. Wenige<br />
Tage später, wenn das Sturmtief weitergezogen ist,<br />
werden die Bewohner von Westholstein mit Braunkohlestrom<br />
aus dem Ruhrgebiet versorgt. Jetzt reicht die<br />
Übertragungskapazität der Stromleitungen zwischen<br />
Ruhrgebiet und Westholstein plötzlich aus. Merkwürdig<br />
eigentlich! Was mag dahinter stecken?<br />
Und warum wird der in Westholstein an windigen<br />
Tagen abgeregelte Windstrom nicht einfach gespeichert?<br />
Mit diesen Fragen sind wir mitten im Thema. Es geht<br />
um die Frage, ob man überschüssigen Strom aus Erneuerbaren<br />
Energien besser woandershin leiten oder<br />
ihn besser speichern soll. Vielleicht muss man sogar<br />
beides? Wir werden sehen!<br />
Anreiz zum dezentralen Speicherbau<br />
unzureichend<br />
Bisher ist bei den Überlegungen zum weiteren Ausbau<br />
der Erneuerbaren Energien von Stromspeicherung<br />
kaum die Rede. Lediglich in § 16 Absatz 3 EEG 2009<br />
wird bestimmt, dass der Netzbetreiber zwischengespeicherten<br />
Strom aus Erneuerbaren Energien<br />
genauso vergüten muss wie den direkt eingespeisten<br />
EE-Strom. Einen besonderen fi nanziellen Anreiz zur<br />
Speicherung von Strom gibt es zwar auch, aber er<br />
lohnt eher für den Bau von Großspeichern [1].<br />
Diese Möglichkeit wird deshalb praktisch nie genutzt,<br />
denn Stromspeicher sind teuer und die Betreiber<br />
von Wind- oder Solaranlagen müssten sie zusätzlich<br />
Solarbrief 4/10<br />
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.<br />
Stromspeichern - Brücke zum Solarzeitalter<br />
bezahlen. Dagegen muss der weitere Ausbau der<br />
Stromnetze durch die Stromnetzbetreiber bezahlt<br />
werden, die ihre Mehrkosten auf die Netzgebühren<br />
umlegen können (soweit es ihnen genehmigt wird).<br />
Der Verzicht auf kostendeckende Anreize für den<br />
Bau kleiner dezentraler Stromspeicher hat seit Jahren<br />
dazu geführt, dass einseitig das Augenmerk nur auf<br />
den Netzausbau gerichtet war und bei den Planern<br />
offensichtlich immer noch ist. Zwar gibt es schon seit<br />
Jahren engagierte wissenschaftliche Diskussionen<br />
des Speicherthemas, nur haben sie bisher zu keinen<br />
energiepolitischen Konsequenzen geführt.<br />
In einer Antwort vom 03.12.2010 auf eine Anfrage<br />
der Grünen betont die Bundesregierung ausdrücklich,<br />
dass die Frage der Speicherung von Strom aus Wind<br />
und Sonnenenergie allein nach betriebswirtschaftlichen<br />
Erwägungen gelöst werden müsse.<br />
Die Dringlichkeit der Situation ist nur Wenigen<br />
bewusst. Zwar haben wir scheinbar noch viel Zeit, in<br />
der bisherigen Weise weiter zu machen. Es gibt ja<br />
noch genügend Verbraucher, die nur unvollständig mit<br />
Strom aus Erneuerbaren Energien versorgt werden,<br />
denn Deutschland wird bekanntlich bisher erst zu<br />
17 Prozent mit Strom aus Erneuerbaren Energien<br />
versorgt. Aber fragen wir doch mal, wie weit wir damit<br />
kämen, wenn wir uns weiter ausschließlich auf den<br />
Ausbau der Stromnetze beschränken würden.<br />
Dazu stellen wir uns einmal vor, die Stromnetze<br />
wären schon jetzt so weit ausgebaut, dass es<br />
überhaupt keine Einschränkungen mehr gäbe, EE-<br />
Strom aus Überschussgebieten in Mangelgebiete zu<br />
verschieben - z.B. aus Westholstein ins Ruhrgebiet.<br />
Bild 1 zeigt als Überlegungsskizze schematisch über<br />
einen Zeitraum von knapp 20 Tagen die Verhältnisse,<br />
die wir bei vollendet ausgebautem Stromnetz derzeit<br />
in Deutschland hätten. Die obere gezackte Kurve<br />
zeigt den üblichen Stromverbrauch Deutschlands<br />
an. Die Spitzen nach oben zeigen den täglichen<br />
Höchstverbrauch um die Mittagszeit. Man erkennt<br />
den geringeren Verbrauch am Samstag und Sonntag.<br />
Die Spitzen nach unten zeigen den Minderverbrauch<br />
nach Mitternacht.<br />
[1] EnWG § 118 Absatz 7 bestimmt: „Nach dem 31. Dezember 2008 neuerrichtete Pumpspeicherkraftwerke und andere Anlagen zur Speicherung<br />
elektrischer Energie, die bis zum 31. Dezember 2019 in Betrieb gehen, sind für einen Zeitraum von zehn Jahren ab Inbetriebnahme hinsichtlich des<br />
Bezugs der zu speichernden elektrischen Energie von den Entgelten für den Netzzugang freigestellt.“<br />
7