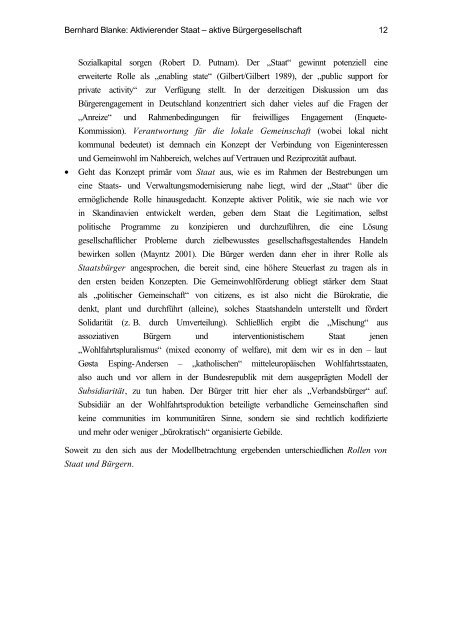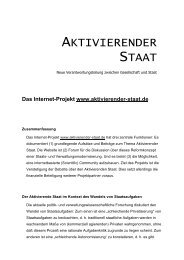Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bernhard</strong> <strong>Blanke</strong>: <strong>Aktivierender</strong> <strong>Staat</strong> – <strong>aktive</strong> <strong>Bürgergesellschaft</strong><br />
Sozialkapital sorgen (Robert D. Putnam). Der „<strong>Staat</strong>“ gewinnt potenziell eine<br />
erweiterte Rolle als „enabling state“ (Gilbert/Gilbert 1989), der „public support for<br />
private activity“ zur Verfügung stellt. In der derzeitigen Diskussion um das<br />
Bürgerengagement in Deutschland konzentriert sich daher vieles auf die Fragen der<br />
„Anreize“ und Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement (Enquete-<br />
Kommission). Verantwortung für die lokale Gemeinschaft (wobei lokal nicht<br />
kommunal bedeutet) ist demnach ein Konzept der Verbindung von Eigeninteressen<br />
und Gemeinwohl im Nahbereich, welches auf Vertrauen und Reziprozität aufbaut.<br />
• Geht das Konzept primär vom <strong>Staat</strong> aus, wie es im Rahmen der Bestrebungen um<br />
eine <strong>Staat</strong>s- und Verwaltungsmodernisierung nahe liegt, wird der „<strong>Staat</strong>“ über die<br />
ermöglichende Rolle hinausgedacht. Konzepte <strong>aktive</strong>r Politik, wie sie nach wie vor<br />
in Skandinavien entwickelt werden, geben dem <strong>Staat</strong> die Legitimation, selbst<br />
politische Programme zu konzipieren und durchzuführen, die eine Lösung<br />
gesellschaftlicher Probleme durch zielbewusstes gesellschaftsgestaltendes Handeln<br />
bewirken sollen (Mayntz 2001). Die Bürger werden dann eher in ihrer Rolle als<br />
<strong>Staat</strong>sbürger angesprochen, die bereit sind, eine höhere Steuerlast zu tragen als in<br />
den ersten beiden Konzepten. Die Gemeinwohlförderung obliegt stärker dem <strong>Staat</strong><br />
als „politischer Gemeinschaft“ von citizens, es ist also nicht die Bürokratie, die<br />
denkt, plant und durchführt (alleine), solches <strong>Staat</strong>shandeln unterstellt und fördert<br />
Solidarität (z. B. durch Umverteilung). Schließlich ergibt die „Mischung“ aus<br />
assoziativen Bürgern und interventionistischem <strong>Staat</strong> jenen<br />
„Wohlfahrtspluralismus“ (mixed economy of welfare), mit dem wir es in den – laut<br />
Gøsta Esping-Andersen – „katholischen“ mitteleuropäischen Wohlfahrtsstaaten,<br />
also auch und vor allem in der Bundesrepublik mit dem ausgeprägten Modell der<br />
Subsidiarität, zu tun haben. Der Bürger tritt hier eher als „Verbandsbürger“ auf.<br />
Subsidiär an der Wohlfahrtsproduktion beteiligte verbandliche Gemeinschaften sind<br />
keine communities im kommunitären Sinne, sondern sie sind rechtlich kodifizierte<br />
und mehr oder weniger „bürokratisch“ organisierte Gebilde.<br />
Soweit zu den sich aus der Modellbetrachtung ergebenden unterschiedlichen Rollen von<br />
<strong>Staat</strong> und Bürgern.<br />
12