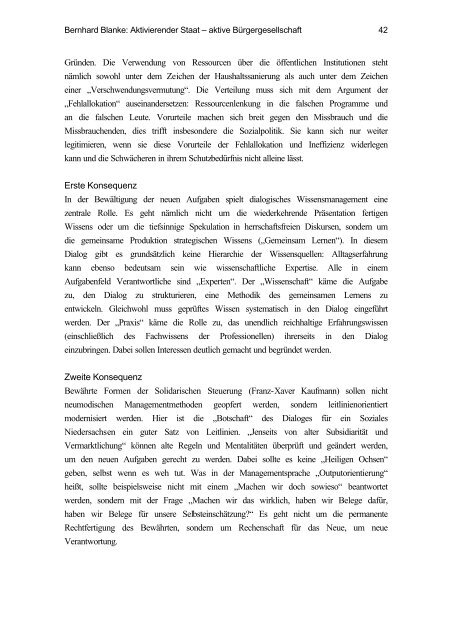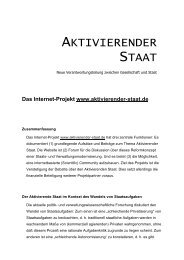Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Bernhard</strong> <strong>Blanke</strong>: <strong>Aktivierender</strong> <strong>Staat</strong> – <strong>aktive</strong> <strong>Bürgergesellschaft</strong><br />
Gründen. Die Verwendung von Ressourcen über die öffentlichen Institutionen steht<br />
nämlich sowohl unter dem Zeichen der Haushaltssanierung als auch unter dem Zeichen<br />
einer „Verschwendungsvermutung“. Die Verteilung muss sich mit dem Argument der<br />
„Fehlallokation“ auseinandersetzen: Ressourcenlenkung in die falschen Programme und<br />
an die falschen Leute. Vorurteile machen sich breit gegen den Missbrauch und die<br />
Missbrauchenden, dies trifft insbesondere die Sozialpolitik. Sie kann sich nur weiter<br />
legitimieren, wenn sie diese Vorurteile der Fehlallokation und Ineffizienz widerlegen<br />
kann und die Schwächeren in ihrem Schutzbedürfnis nicht alleine lässt.<br />
Erste Konsequenz<br />
In der Bewältigung der neuen Aufgaben spielt dialogisches Wissensmanagement eine<br />
zentrale Rolle. Es geht nämlich nicht um die wiederkehrende Präsentation fertigen<br />
Wissens oder um die tiefsinnige Spekulation in herrschaftsfreien Diskursen, sondern um<br />
die gemeinsame Produktion strategischen Wissens („Gemeinsam Lernen“). In diesem<br />
Dialog gibt es grundsätzlich keine Hierarchie der Wissensquellen: Alltagserfahrung<br />
kann ebenso bedeutsam sein wie wissenschaftliche Expertise. Alle in einem<br />
Aufgabenfeld Verantwortliche sind „Experten“. Der „Wissenschaft“ käme die Aufgabe<br />
zu, den Dialog zu strukturieren, eine Methodik des gemeinsamen Lernens zu<br />
entwickeln. Gleichwohl muss geprüftes Wissen systematisch in den Dialog eingeführt<br />
werden. Der „Praxis“ käme die Rolle zu, das unendlich reichhaltige Erfahrungswissen<br />
(einschließlich des Fachwissens der Professionellen) ihrerseits in den Dialog<br />
einzubringen. Dabei sollen Interessen deutlich gemacht und begründet werden.<br />
Zweite Konsequenz<br />
Bewährte Formen der Solidarischen Steuerung (Franz-Xaver Kaufmann) sollen nicht<br />
neumodischen Managementmethoden geopfert werden, sondern leitlinienorientiert<br />
modernisiert werden. Hier ist die „Botschaft“ des Dialoges für ein Soziales<br />
Niedersachsen ein guter Satz von Leitlinien. „Jenseits von alter Subsidiarität und<br />
Vermarktlichung“ können alte Regeln und Mentalitäten überprüft und geändert werden,<br />
um den neuen Aufgaben gerecht zu werden. Dabei sollte es keine „Heiligen Ochsen“<br />
geben, selbst wenn es weh tut. Was in der Managementsprache „Outputorientierung“<br />
heißt, sollte beispielsweise nicht mit einem „Machen wir doch sowieso“ beantwortet<br />
werden, sondern mit der Frage „Machen wir das wirklich, haben wir Belege dafür,<br />
haben wir Belege für unsere Selbsteinschätzung?“ Es geht nicht um die permanente<br />
Rechtfertigung des Bewährten, sondern um Rechenschaft für das Neue, um neue<br />
Verantwortung.<br />
42