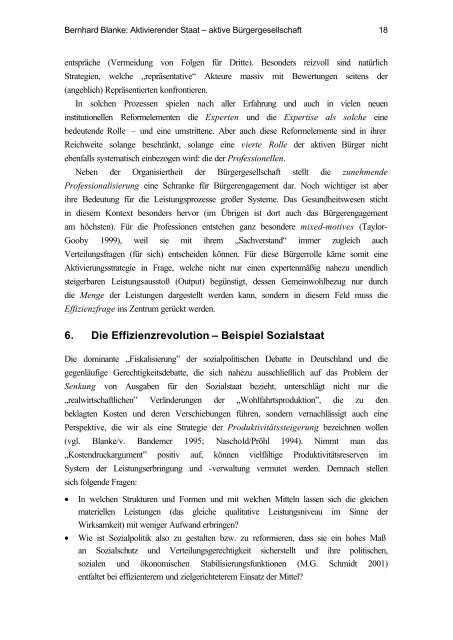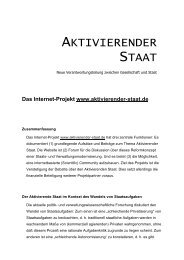Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bernhard</strong> <strong>Blanke</strong>: <strong>Aktivierender</strong> <strong>Staat</strong> – <strong>aktive</strong> <strong>Bürgergesellschaft</strong><br />
entspräche (Vermeidung von Folgen für Dritte). Besonders reizvoll sind natürlich<br />
Strategien, welche „repräsentative“ Akteure massiv mit Bewertungen seitens der<br />
(angeblich) Repräsentierten konfrontieren.<br />
In solchen Prozessen spielen nach aller Erfahrung und auch in vielen neuen<br />
institutionellen Reformelementen die Experten und die Expertise als solche eine<br />
bedeutende Rolle – und eine umstrittene. Aber auch diese Reformelemente sind in ihrer<br />
Reichweite solange beschränkt, solange eine vierte Rolle der <strong>aktive</strong>n Bürger nicht<br />
ebenfalls systematisch einbezogen wird: die der Professionellen.<br />
Neben der Organisiertheit der <strong>Bürgergesellschaft</strong> stellt die zunehmende<br />
Professionalisierung eine Schranke für Bürgerengagement dar. Noch wichtiger ist aber<br />
ihre Bedeutung für die Leistungsprozesse großer Systeme. Das Gesundheitswesen sticht<br />
in diesem Kontext besonders hervor (im Übrigen ist dort auch das Bürgerengagement<br />
am höchsten). Für die Professionen entstehen ganz besondere mixed-motives (Taylor-<br />
Gooby 1999), weil sie mit ihrem „Sachverstand“ immer zugleich auch<br />
Verteilungsfragen (für sich) entscheiden können. Für diese Bürgerrolle käme somit eine<br />
Aktivierungsstrategie in Frage, welche nicht nur einen expertenmäßig nahezu unendlich<br />
steigerbaren Leistungsausstoß (Output) begünstigt, dessen Gemeinwohlbezug nur durch<br />
die Menge der Leistungen dargestellt werden kann, sondern in diesem Feld muss die<br />
Effizienzfrage ins Zentrum gerückt werden.<br />
6. Die Effizienzrevolution – Beispiel Sozialstaat<br />
Die dominante „Fiskalisierung” der sozialpolitischen Debatte in Deutschland und die<br />
gegenläufige Gerechtigkeitsdebatte, die sich nahezu ausschließlich auf das Problem der<br />
Senkung von Ausgaben für den Sozialstaat bezieht, unterschlägt nicht nur die<br />
„realwirtschaftlichen” Veränderungen der „Wohlfahrtsproduktion”, die zu den<br />
beklagten Kosten und deren Verschiebungen führen, sondern vernachlässigt auch eine<br />
Perspektive, die wir als eine Strategie der Produktivitätssteigerung bezeichnen wollen<br />
(vgl. <strong>Blanke</strong>/v. Bandemer 1995; Naschold/Pröhl 1994). Nimmt man das<br />
„Kostendruckargument” positiv auf, können vielfältige Produktivitätsreserven im<br />
System der Leistungserbringung und -verwaltung vermutet werden. Demnach stellen<br />
sich folgende Fragen:<br />
• In welchen Strukturen und Formen und mit welchen Mitteln lassen sich die gleichen<br />
materiellen Leistungen (das gleiche qualitative Leistungsniveau im Sinne der<br />
Wirksamkeit) mit weniger Aufwand erbringen?<br />
• Wie ist Sozialpolitik also zu gestalten bzw. zu reformieren, dass sie ein hohes Maß<br />
an Sozialschutz und Verteilungsgerechtigkeit sicherstellt und ihre politischen,<br />
sozialen und ökonomischen Stabilisierungsfunktionen (M.G. Schmidt 2001)<br />
entfaltet bei effizienterem und zielgerichteterem Einsatz der Mittel?<br />
18