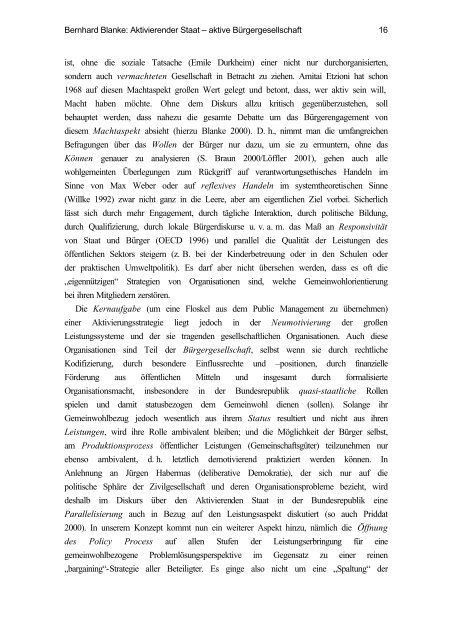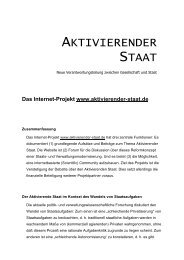Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Bernhard Blanke: Aktivierender Staat - aktive Bürgergesellschaft ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bernhard</strong> <strong>Blanke</strong>: <strong>Aktivierender</strong> <strong>Staat</strong> – <strong>aktive</strong> <strong>Bürgergesellschaft</strong><br />
ist, ohne die soziale Tatsache (Emile Durkheim) einer nicht nur durchorganisierten,<br />
sondern auch vermachteten Gesellschaft in Betracht zu ziehen. Amitai Etzioni hat schon<br />
1968 auf diesen Machtaspekt großen Wert gelegt und betont, dass, wer aktiv sein will,<br />
Macht haben möchte. Ohne dem Diskurs allzu kritisch gegenüberzustehen, soll<br />
behauptet werden, dass nahezu die gesamte Debatte um das Bürgerengagement von<br />
diesem Machtaspekt absieht (hierzu <strong>Blanke</strong> 2000). D. h., nimmt man die umfangreichen<br />
Befragungen über das Wollen der Bürger nur dazu, um sie zu ermuntern, ohne das<br />
Können genauer zu analysieren (S. Braun 2000/Löffler 2001), gehen auch alle<br />
wohlgemeinten Überlegungen zum Rückgriff auf verantwortungsethisches Handeln im<br />
Sinne von Max Weber oder auf reflexives Handeln im systemtheoretischen Sinne<br />
(Willke 1992) zwar nicht ganz in die Leere, aber am eigentlichen Ziel vorbei. Sicherlich<br />
lässt sich durch mehr Engagement, durch tägliche Interaktion, durch politische Bildung,<br />
durch Qualifizierung, durch lokale Bürgerdiskurse u. v. a. m. das Maß an Responsivität<br />
von <strong>Staat</strong> und Bürger (OECD 1996) und parallel die Qualität der Leistungen des<br />
öffentlichen Sektors steigern (z. B. bei der Kinderbetreuung oder in den Schulen oder<br />
der praktischen Umweltpolitik). Es darf aber nicht übersehen werden, dass es oft die<br />
„eigennützigen“ Strategien von Organisationen sind, welche Gemeinwohlorientierung<br />
bei ihren Mitgliedern zerstören.<br />
Die Kernaufgabe (um eine Floskel aus dem Public Management zu übernehmen)<br />
einer Aktivierungsstrategie liegt jedoch in der Neumotivierung der großen<br />
Leistungssysteme und der sie tragenden gesellschaftlichen Organisationen. Auch diese<br />
Organisationen sind Teil der <strong>Bürgergesellschaft</strong>, selbst wenn sie durch rechtliche<br />
Kodifizierung, durch besondere Einflussrechte und –positionen, durch finanzielle<br />
Förderung aus öffentlichen Mitteln und insgesamt durch formalisierte<br />
Organisationsmacht, insbesondere in der Bundesrepublik quasi-staatliche Rollen<br />
spielen und damit statusbezogen dem Gemeinwohl dienen (sollen). Solange ihr<br />
Gemeinwohlbezug jedoch wesentlich aus ihrem Status resultiert und nicht aus ihren<br />
Leistungen, wird ihre Rolle ambivalent bleiben; und die Möglichkeit der Bürger selbst,<br />
am Produktionsprozess öffentlicher Leistungen (Gemeinschaftsgüter) teilzunehmen nur<br />
ebenso ambivalent, d. h. letztlich demotivierend praktiziert werden können. In<br />
Anlehnung an Jürgen Habermas (deliberative Demokratie), der sich nur auf die<br />
politische Sphäre der Zivilgesellschaft und deren Organisationsprobleme bezieht, wird<br />
deshalb im Diskurs über den Aktivierenden <strong>Staat</strong> in der Bundesrepublik eine<br />
Parallelisierung auch in Bezug auf den Leistungsaspekt diskutiert (so auch Priddat<br />
2000). In unserem Konzept kommt nun ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich die Öffnung<br />
des Policy Process auf allen Stufen der Leistungserbringung für eine<br />
gemeinwohlbezogene Problemlösungsperspektive im Gegensatz zu einer reinen<br />
„bargaining“-Strategie aller Beteiligter. Es ginge also nicht um eine „Spaltung“ der<br />
16